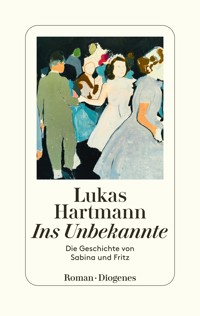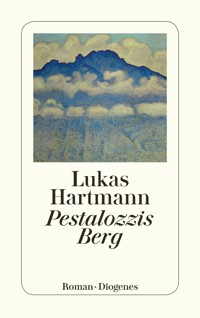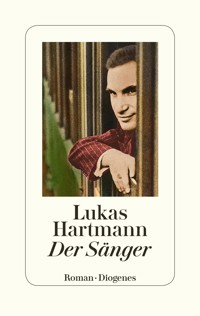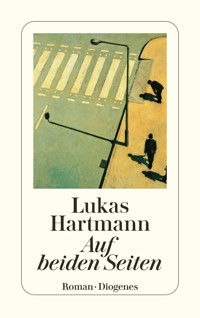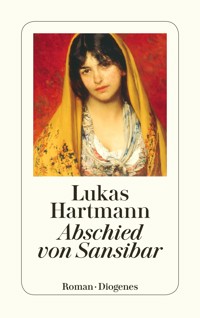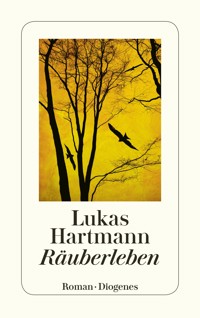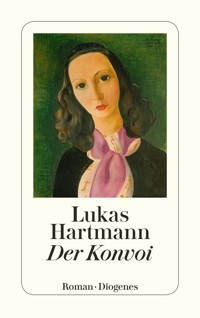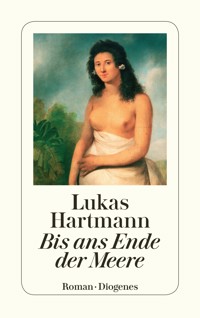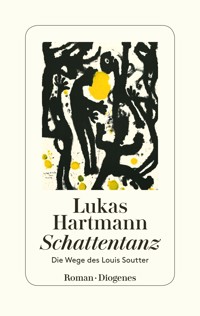
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1923 wird der Musiker und Maler Louis Soutter von seiner Familie aufgrund seines exzentrischen Lebensstils in ein Heim im Schweizer Jura eingewiesen. Nur noch sein berühmter Cousin Le Corbusier interessiert sich für ihn. Soutters Bilder verstören, die Kunstwelt seiner Zeit beachtet ihn nicht. So befremdet wie fasziniert lässt sich Le Corbusier auf diese archaische Kunst ein und auf die verschlungenen Lebenswege, die Soutter an diesen Ort geführt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lukas Hartmann
Schattentanz
Die Wege des Louis Soutter
Roman
Diogenes
L’amour est un fil de soie
ou qu’on noue
ou qu’on coupe
Louis Soutter
1Charles-Edouard
Ich glaube, es war 1927, als ich das erste Mal zu ihm nach Ballaigues fuhr, zu meinem Cousin Louis Soutter. Er war in Morges am Genfer See aufgewachsen, der Sohn der Schwester meines Vaters, die einen Apotheker geheiratet hatte. Unsere beiden Familien hatten kaum Kontakt. Nur selten vernahm ich etwas über ihn. Ich wusste lediglich, dass ihm die Karriere als Violinist nicht geglückt war und er nun mit kleinen Unterhaltungsorchestern in Schweizer Kurorten spielte. Als ich wieder einmal zu Besuch bei den Eltern in La Chaux-de-Fonds war, sagte mir die Mutter, Louis schlage nun endgültig aus der Art, er habe sich verschuldet, sei, obwohl erst fünfzig, zwangsweise in einem abgelegenen Altersheim im Jura untergebracht, dort zeichne er fremdartige und erschreckende Figuren. Er sei förmlich besessen davon, das habe sie über Bekannte erfahren, er sei Dorfgespräch wegen seiner Kleidung, die man für extravagant halte, und auch wegen der Nackten, die er zeichne. Louis hatte ich vor Jahren, da war ich noch ein Kind, bei einem unserer seltenen Familienfeste getroffen. Ich erinnerte mich schwach an ihn, nein, eigentlich überhaupt nicht, ich bin ja sechzehn Jahre jünger als er. Vermutlich hielt er sich abseits von der Jeanneret-Sippe, die da zusammenkam, und so nahm ich ihn kaum wahr, es gab auch andere extravagante Figuren, die meine Aufmerksamkeit fesselten. Was mir die Mutter über Louis erzählte, machte mich nun aber doch so neugierig, dass ich beschloss, bei meinem nächsten Aufenthalt in La Chaux-de-Fonds in den Weiler Ballaigues zu fahren und den verlorenen Cousin aufzusuchen.
Ich erinnere mich genau an diese erste Begegnung. Es war im März, ich fror, als ich das Auto verließ. Offenbar galt ich als wichtiger Besuch. Man holte die Leiterin herbei, eine unangenehme, vierschrötige Person, sie führte mich persönlich in den ersten Stock, wo Louis sein Zimmer hatte. Die Leiterin klopfte kurz an, trat dann gleich ein. Der Geruch, der mir entgegenschlug, war abschreckend, aber immerhin vermischt mit dem von Farben und Tusche. Und man gewöhnte sich schnell daran. Der Mann, der in höflicher Verwirrung von seinem mit Papier übersäten Arbeitstisch aufstand, war groß und hager, schlottrig gekleidet, er hatte reflexartig das Blatt, an dem er arbeitete, umgedreht. Er wirkte auf mich mit dem knochigen Gesicht irgendwie alterslos, seine auffallend großen und dunklen Augen musterten mich fragend, in ihnen lag ein Schrecken, den ich zu vertreiben versuchte, indem ich mich als sein Cousin Charles-Edouard Jeanneret zu erkennen gab. Da hellte sein Gesicht sich auf. Er stelzte auf seinen langen Beinen um den Tisch herum und reichte mir beide Hände, ließ sie gar nicht mehr los. »Ein Jeanneret? Du bist doch Architekt, oder?« Er lachte sogar kurz auf, während die Leiterin sich zurückzog und die Tür hinter sich schloss. Ich sah auf dem Tisch, neben den Blättern, Tintenfässer, Federhalter.
»Ich habe von dir gehört«, sagte ich und erwiderte sein Lachen, das ihn völlig verwandelte. »Ich wollte mir ansehen, was du zeichnest. Wenn du es erlaubst.« Ich deutete auf die Papierstapel, die blauen Schulhefte, die am Boden lagen.
Als er meine forschenden Blicke sah, wurde er verlegen. »Ach, das ist nicht viel wert.« Seine Stimme klang wieder unsicher, verlor sich beinahe in einem Flüstern. »Es ist so lange her, dass ich Kunst studierte, ich habe fast alles vergessen.«
»Manchmal tut es gut, von vorne anzufangen«, entgegnete ich (oder etwas in dieser Art).
Da nickte er mehrmals, mit großer Überzeugung. »Ja, ja, so ist es. Das Neue muss von innen kommen.«
Ich bemühte mich um ein ermunterndes Lächeln. »Zeigst du mir etwas von dem, was du geschaffen hast?«
Er zuckte zusammen und zog sich hinter seinen Maltisch zurück, setzte sich umständlich, in zunehmender Scheu, wie mir schien. Ich hatte einen Moment Zeit, das Zimmer zu mustern: Neben dem Bett stand ein Schemel, darauf ein Waschkrug, darunter ein Nachttopf mit Deckel, in der Ecke ein kleiner Ofen mit schiefem Rohr, spürbar erkaltet. Die Einrichtung war spartanisch; Louis schien die Einfachheit nicht zu stören, ebenso wenig die beinahe blinden Fensterscheiben, die die Außenwelt vernebelten.
Ich setzte mich fröstelnd auf den zweiten Stuhl, den ich zum Tisch hinschob. »Fang doch einfach mit irgendeinem Blatt an.«
»Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll«, sagte er verlegen. »Es sind Hunderte. Und manchmal entwendet jemand vom Personal das eine oder andere zum Anfeuern.« Er machte eine resignierte Gebärde. »Ich darf nicht erwarten, dass sie in dem, was ich tue, einen Sinn sehen.«
Mir fiel auf, wie gewählt er redete, fast altväterisch, ohne Dialektfärbung; das kam bei den übrigen Insassen bestimmt nicht gut an. Ich rückte den Stuhl auf seine Seite, und er fing an, mir die Blätter vom ersten Stapel, der hinten auf dem Tisch lag, zu zeigen, es mochten fünfzig oder sechzig sein. Er hob beinahe mit Zärtlichkeit jedes Blatt mit zwei Fingern hoch und legte es direkt vor mich hin. Dann schob er es weg und schuf am Tischrand einen neuen Stapel.
Mir diese Werke so unvermittelt anzuschauen, war eine schockierende, eine völlig unerwartete Erfahrung. Man wird in diesen Liniengeflechten konfrontiert mit eigenen Phantasien, die, nie voraussehbar, Alpträumen gleichen oder paradiesischen Vorstellungen vom Nebeneinander nackter oder halbnackter Körper, man sieht das leere Kreuz und weiß nicht, vollführen die Gestalten ringsum einen Freudentanz oder trauern sie in allen Posen, mit flehend ausgestreckten, übergroßen Händen. Mit jedem Blatt, das er vor mich hinschob, wurde mir klarer, dass dieser Mann, mein Cousin, ein bedeutender Künstler war. Wenn auch ein völlig unbekannter. Mir verschlug es die Sprache. Ich nickte bloß, bedeutete ihm ab und zu mit einer Gebärde, das Blatt noch nicht gleich zu wenden, damit ich mich länger in den Anblick vertiefen konnte. Plötzlich fuhr er mit der freien Hand über den Ärmel meines Vestons. »Das ist ein feiner Stoff«, sagte er, der eine abgetragene Weste trug, darunter ein mehrfach geflicktes Hemd, dem man den guten Schnitt immer noch ansah. »Schurwolle, nicht wahr?«
Ich stimmte mit einem unbestimmten Laut zu.
Er stutzte, schwieg, fragte dann unsicher: »Was hältst du von meinem Gekritzel? Du bist doch ein Kunstverständiger. Wie nennst du dich, Le Corbusier, nicht wahr? Du malst selber, hat man mir gesagt.«
Auch später stellte sich immer wieder heraus, dass er über weit mehr Kenntnisse verfügte, als man ihm zutraute; er las Zeitungen, die ins Heim kamen, er war informiert über aktuelle politische Ereignisse, hatte seine eigene Meinung dazu, die ich oft nicht teilte. Aber diese Bilder, dieser Reichtum an Details und Sujets, diese kompositorische Sicherheit!
Eine Antwort fiel mir schwer: »Darauf war ich nicht gefasst, Louis … Das ist bemerkenswert. Man muss dich dringend bekannt machen, du verdienst größte Beachtung …« Ja, etwa so redete ich, ein wenig schwülstig, aber da war etwas in dieser Kunst, das mich tief berührte, ja erschütterte, dabei bin ich der Mann der reinen Linie, der klaren Proportionen. Heute glaube ich zu verstehen, dass es das Gegensätzliche war, was mich so unmittelbar traf, der Gegensatz zu dem, was ich zu leisten imstande war, genau das, wovon ich wusste, dass es mir fehlte, die Kraft des ganz und gar Intuitiven, denn aus diesen Bildern las ich, dass sie ohne Plan gewachsen waren, aus der Bewegung des Stifts heraus, dem die Finger folgten, denen der Verstand hinterherhinkte, der dann für das, was entstanden war, geheimnisvolle Titel fand, die Louis in steiler Schulschrift irgendwohin setzte, wo noch Platz war: Tanagra, Jungfrauen von Gruyère, Unter Nackten, Wir leiden unter der Liebe. Dieses letzte Bild – er habe es in der Vorwoche gezeichnet, erzählte Louis – zeigt Akte, Männer und Frauen, mit übergroßen Händen, voneinander abgewandt, sie möchten sich berühren, tun es aber nicht.
Er sagte, wieder fast unhörbar: »Wir haben Angst vor dem Begehren. Man verliert sich darin, nicht wahr?«
Die Nackte in der Bildmitte, verlockend üppig in ihren Formen, erinnerte mich an Yvonne mit ihrem mediterranen Charme und dem braunen Teint, aber Louis kannte meine Verlobte ja gar nicht. Ich deutete auf sie. »Eine, die ihr gleicht, wird schon bald meine Frau.«
Er musterte mich aus seinen viel zu großen Augen, sie wirkten so, als zwinge er sich, sie immer noch weiter zu öffnen und alles, was sie sahen, in sich hineinzutrinken. Aber was ist, dachte ich schon damals, wenn man den Andrang der Eindrücke nicht mehr aushält?
Vielleicht hatte ich laut gesprochen, denn er sagte: »Dann wendet man sich ab und ist allein wie stets.« Er überlegte eine Weile, wir schauten einander an.
»Ich war sieben Jahre mit Madge verheiratet«, fuhr er fort. »Es ist lange her. Wir haben uns geschlagen und zerkratzt, ich habe geschwiegen, sie hat mich angeschrien. So war das.«
»Warum denn?«, fragte ich, erneut aus der Fassung gebracht.
»Sie war zu schön für mich, zu begabt, zu reich. Das hat alles nicht zusammengepasst. Ich musste mich wehren, sie hat mich vertrieben. Verstehst du? Ein Kind hätte uns für eine Weile gerettet, ich wollte keines.«
Auch in den Jahren, die folgten, entdeckte ich auf Hunderten seiner Blätter keine Kinder. Es schien sie nicht zu geben in seiner Welt oder höchstens auf seinen eigenwilligen Kopien der italienischen Renaissance-Meister. Es gab ja keine Kinder im Heim von Ballaigues, ich hatte selbst auch keine. Und Yvonne auch nicht. Sie hatte eine Vergangenheit mit vielen Männern. Wäre ich auf sie eifersüchtig gewesen, wäre ich an der Eifersucht verendet. Dass sie mich wie ein Marktweib beschimpfte, wenn sie mich bei einer Affäre ertappte, das erzählte ich Louis später auf einer unserer Wanderungen, die ich mit ihm nach diesem ersten Besuch unternahm, weil er darauf bestand. Er lachte ein wenig, machte längere Schritte, die mich außer Atem brachten. »Mann und Frau«, sagte er, »das verträgt sich selten. Aber dass sie zusammenkommen, will ja die Natur, darum lasse ich die Natur über Liebespaare wuchern. Und um sie herum. Das dämpft das Seufzen und die Schreie.« Es war ein trauriges Lachen. Seine Aussagen waren oft so paradox oder vieldeutig, dass sie mich tagelang verfolgten und ich ihnen nicht auf den Grund kam.
Am Ende meines ersten Besuchs, der bis zur Abenddämmerung dauerte, schenkte er mir das Blatt mit dem Liebesleid. Eine Bezahlung lehnte er ab. Ich solle wiederkommen, sagte er, später könne ich kaufen, was ich wolle, und schenkte mir noch ein zweites Blatt, Die Ankündigung des Bösen an zwei Engel. Sie waren flügellos, sie streckten die Hände himmelwärts. Hinter ihnen stand ein Teufel mit geschwärztem, maskenhaftem Gesicht.
2Louis
Als er 1904 endgültig aus Colorado Springs zurückkam, konnten seine alten Bekannten kaum glauben, wie sehr er sich verändert hatte. Er war ja erst Anfang dreißig, er hatte sieben Jahre zuvor, nach dem Wechsel von der Geige zur Malerei, überstürzt eine reiche Amerikanerin, Madge Fursman, geheiratet und war ihr in ihre Heimat gefolgt. Als Direktor der örtlichen Kunsthochschule soll er völlig versagt haben. Vor allem deshalb sei die Ehe gescheitert, so hieß es.
Seine Augen lagen tief in den Höhlen, noch verschlossener war er geworden, sein Ausdruck, seine Magerkeit machten ihn zu einem Fremdling. Hatte er auf seiner Rückreise wirklich einen Typhusausbruch überlebt, wie man herumerzählte? Hatte man ihn deshalb wochenlang in einer französischen Quarantänestation festgehalten? Niemand wusste Genaues. Er selbst schwieg, lächelte manchmal oder scheuchte lästige Frager von sich weg. Er wolle nun wieder Geige spielen, sagte er, und damit sein Geld verdienen. Die Bilder, die er gemalt habe, seien in Colorado Springs geblieben, sie hätten keinen Wert. Was zwischen ihm und Madge vorgefallen war, behielt er für sich.
Jeanne, die Schwester, setzte sich für ihn ein, und so boten ihm die Eltern vorübergehend sein altes Zimmer in ihrem Haus, der Apotheke von Morges, an. Er verschloss sich ganz in sich selbst, hielt es aber im alten Umfeld nicht aus. Er zog in eine Mansarde am See, die seine Eltern gemietet hatten. Dort versteckte er sich tagelang. Die Einzige, die sich ohne Angst vor Zurückweisung um ihn kümmerte, war die Schwester. Sie trat in der Region inzwischen als Sängerin auf, lehrte Gesang am Konservatorium Fribourg. Ab und zu kehrte sie übers Wochenende, trotz ihrer schwierigen Beziehung zur Mutter, nach Morges zurück. Dann klopfte sie an Louis’ Mansardentür; wenn er nicht öffnete, wusste sie, dass er unterwegs war. Man sah ihn am See entlanggehen, eine Strecke hin und zurück, er schien auf niemanden zu achten, er verscheuchte auch Hunde nicht, die ihn verfolgten.
An einem Sonntag, drei Wochen nach seiner Ankunft, ließ er die Schwester herein, bot ihr den einzigen Stuhl an, er selbst setzte sich aufs Bett.
Sein Zustand war ihr ein Rätsel, sie wiederholte, was sie ihm schon gesagt hatte: »Du kannst dich doch nicht von allem zurückziehen. Du vereinsamst ja total.«
»Ich kann nicht anders«, sagte er so leise, dass es beinahe ein Flüstern war.
»Warum denn? Was quält dich?«
Er schaute sie verloren an, schüttelte den Kopf. »Wenn ich das wüsste.«
»Wir waren als Kinder oft so übermütig.«
»Das ist lange her.«
Sie beugte sich vor. »Erklär mir doch endlich, warum du von Madge weggegangen bist.«
Er begann, als wehe ihn etwas Unangenehmes an, seinen Oberkörper leicht hin und her zu wiegen. »Du weißt es doch. Wir haben es nicht mehr miteinander ausgehalten. Eine andere Antwort gibt es nicht.«
»Da bin ich nicht sicher«, sagte sie. »Weißt du noch, wie du sie damals an Weihnachten in unser Haus gebracht hast? Und wie du deine Blicke nicht von ihr abwenden konntest? Bis über beide Ohren verliebt warst du. Und dann der Streit mit Maman.«
Er schwieg. Sie versuchte, mit weiteren Erinnerungen zu ihm vorzudringen, er wehrte sie ab, mit kleinen verbalen Paraden wie ein ungeübter Fechter. Aus dem Wasserkrug, der auf dem Tischchen stand, füllte er beiden das Glas, so viel Höflichkeit hatte er sich bewahrt. Sie trank, sie schaute ihn an. War das wirklich ihr Bruder, dieser ausgemergelte Eremit, der sich nicht mehr unter die Menschen traute?
»Was fürchtest du?«, fragte sie. »Was kann man dir antun?«
Er zuckte mit den Achseln, lächelte sogar auf seine Weise.
»Madge hat dich in die Enge getrieben, oder nicht? Sie ist eine stolze Frau, ich habe dich gewarnt.« Sie suchte seinen Blick, kämpferisch wie damals, als er sie im Obstgarten am Erklettern eines Apfelbaums gehindert hatte, fünf Jahre jünger als er war sie und sträubte sich mit aller Kraft gegen seinen Versuch, sie festzuhalten.
Er schwieg, schaute durch sie hindurch, wie so oft; alles schien in ihn hineinzusinken, sich zu verlieren im Labyrinth seiner Gedanken. »Die Überfahrt«, sagte er völlig unerwartet, »sie war schrecklich, sie hat mich ausgezehrt, gebrandmarkt, zu viele Gescheiterte im Zwischendeck …«
Er verstummte, seine Wortwahl hatte sie bestürzt. Sie rückte näher, legte ihre Hand auf seine, die kalt war, aber nicht unempfindlich, denn er zuckte zurück wie vor einer Feindseligkeit, und da musste sie beinahe lachen, denn das war ein altes Spiel zwischen ihnen: Berührungen suchen, Berührungen vermeiden. Bruder und Schwester durften sich nicht zu nahe kommen, das Gebot hing über ihnen wie in Stein gemeißelt.
Sie zwang sich zu Geduld. »Was willst du jetzt? Was hast du für Pläne?«
Er lächelte wieder. »Eigentlich keine, im Moment. Und du?«
Sie straffte sich. »Ich will singen, Konzerte geben, und ich will unterrichten. Und einen Frauenchor habe ich gegründet, in La Neuveville. Das ist neu bei uns. Ich dirigiere ihn. All dies nebeneinander, gegen den Rat unserer Mutter.« Das hatte sie ihm schon erzählt, bei ihrem ersten Gespräch nach der Rückkehr, es war in ihm versickert und tauchte plötzlich wieder auf.
»Dann viel Erfolg«, sagte er. »Du bist begabt, das wird man hoffentlich bald bemerken … Ein Frauenchor? Da denke ich an die Erinnyen in griechischen Tragödien.« Er lachte in sich hinein.
Sie schüttelte den Kopf. »Was ist bloß aus dir geworden? Was für ein eigentümlicher Mann?«
»Von der Geige lasse ich nicht ab«, sagte er und begann, seine Hände zu kneten. »Ich werde üben, hier in dieser Mansarde. Dann suche ich eine Stelle in einem Orchester und verdiene damit mein eigenes Geld.«
Ihr schwarzes Haar war immer noch linksseitig gescheitelt, es ließ sie streng aussehen, und das wollte sie nicht ändern, die Lockenpracht der Mutter war ihr zuwider. Wie hatten sie beide unter den Hauskonzerten gelitten, Jeanne, als Siebenjährige, mit ihrer hohen Stimme, die sie vor der eingeladenen Elite von Morges vorführen musste, der Bruder, bleich und schmächtig, als halbwüchsiger Geigenvirtuose, beide von der Mutter auf dem Klavier begleitet. Danach hatten sich die Geschwister, selbst im Winter, draußen auf der Terrasse getroffen und sich über eingeschlafene Zuhörer lustig gemacht, eine würdige Dame mit Pelzstola war einmal sogar halb vom Stuhl gerutscht.
»Ich werde bald«, sagte Louis, »beim Orchestre de Genève vorspielen.« Er machte mit der rechten Hand eine Bewegung, als dirigiere er, und sie nickte ihm aufmunternd zu.
Gegen die Knauserigkeit von Albert, dem älteren Bruder, mussten sie sich verbünden. Louis hatte er vorgeworfen, das Familienvermögen zu verprassen, von Jeanne forderte er, dass sie standesgemäß heirate und ihr Ehemann dann für sie sorge.
»Unser Bruder verläuft sich in den Zahlen«, sagte Louis. »Und unsere Schwägerin ist darin noch penibler.«
Sie lachte nun auch, sein Humor hatte, seit er aus den Staaten zurückgekommen war, etwas Forciertes; seine fließenden, ihr einst so vertrauten Handbewegungen waren eckiger geworden, auch in seinem Zwinkern erkannte sie ihn kaum wieder.
»Willst du heiraten, Jeanne?«, fragte er plötzlich. »Tu’s nicht, Heiraten ist gefährlich, vor Madge musste ich fliehen.«
Sie schaute ihn forschend an. »Du warst bestimmt auch kein Unschuldslamm.«
Er sprang auf die Füße, ließ sich wieder fallen, die Bettfedern quietschten. »Hör auf damit! Das ist meine Sache.« Seine Augen füllten sich mit Tränen.
»Tröste dich, Bruderherz, ich habe sie nie richtig gemocht.«
Er nickte. In Brüssel, als er bei Eugène Ysaÿe studierte, hatte sie Madge, die ebenfalls dessen Schülerin war, kennengelernt. Jeanne hatte sich von oben herab behandelt gefühlt, ihr hatten weder Madges Geigenspiel noch ihr heller Sopran gefallen. Und Madges Besuch an Weihnachten in Morges, ein Jahr später, war eine Katastrophe gewesen. Sie und ihre künftige Schwiegermutter hatten sich beim Versuch, zusammen zu spielen, so heftig gestritten, dass den Gästen die Luft wegblieb. Louis’ Einladungen, ihn in Colorado Springs, in dieser amerikanischen Wüstenei, zu besuchen, hatte Jeanne stets ausgeschlagen. Sie wollte nicht monatelang unterwegs sein, um sich dann über ihre Schwägerin zu ärgern. Louis war, auf Drängen Madges, Direktor der Kunsthochschule geworden, Jeanne hatte sein Scheitern vorausgesehen. Sie wäre vielleicht hingereist, wenn das Paar in den sechs Jahren, die es zusammen war, ein Kind gezeugt hätte, aber sie bekamen keines.
Er schaute Jeanne abwägend an. »Ich habe diese Frau am Anfang maßlos geliebt.« Er suchte nach weiteren Worten. »Geliebt mit aller Unvernunft. Es war wie ein Brand, der mich erfasste, eine Welle, die mich hochtrug und dann irgendwohin warf, wo Madge über mir stand wie eine Zirkusdompteurin, sie brauchte nicht mit der Peitsche zu knallen, sie hatte Worte, immer härtere, immer verletzendere …«
Jeanne setzte sich zu ihm aufs Bett, strich ihm übers Haar.
»Ich musste weg von ihr«, sagte er, »das weißt du ja. Aber eigentlich hat sie mich verjagt, sie wollte mich kraftlos, ihr ergeben, und das schien ich ja zu sein, auch in den Augen ihrer Familie, aber ich war es nicht. Ein Kind mit ihr zu haben, war mir ein Schrecknis … Ach Gott …« Er schlug die Hände vors Gesicht. »Ich stellte mir eine widerwärtige Missgeburt vor, einen Kretin, der mich angrinste … Ich wollte das nicht, ich wollte kein Kind …« Er lehnte sich an sie, schien zu weinen, denn seine Schultern bebten, aber es kam kein Laut von ihm. »Meine armselige Existenz verdoppeln, das geht doch nicht … das will ich nicht.«
Sie streichelte seinen Nacken. Mit Louis und ein paar Nachbarskindern hatten sie Verstecken gespielt, und immer war er es gewesen, der sie aufgespürt hatte. Dass er sie fand und kein anderer, dem konnte man nachhelfen, und darin war sie geschickt: im flüchtigen Zeigen einer Hand, dem Bewegen der Haare hinter Zweigen, wenn er sich näherte. Das durchschaute er nie. Er war oft so ernst, in sich versunken, sie hätte alles getan, um ihn aufzuheitern.
Sie kam nun in der nächsten Zeit regelmäßig vorbei. Oft gingen sie in der Dämmerung am Strand entlang, es waren nicht mehr als zwanzig Schritte bis dorthin, er glaubte, mit der Schwester zusammen in den Fußstapfen von gestern und vorgestern zu gehen, durch Sand und über Kieselsteine, er wollte seinen Marsch zu zweit exakt wiederholen. Jeanne lachte ihn aus; das seien längst Spuren von anderen, die Wellen, so klein sie seien, hätten die von ihr und ihm ausgewischt. Beinahe stritten sie deswegen, aber Louis gab bald nach, verstummte. Das Wetter war trüb, sie sahen nicht zum gegenüberliegenden Ufer, nur ein beleuchtetes Passagierschiff zog in der Ferne vorbei. Sie gingen schnell, sie waren annähernd gleich groß, wer sie als Silhouetten vor dem helleren See nebeneinander sah, hätte sie, ungeachtet des Altersunterschieds, für Zwillinge halten können. Eine Stunde oder länger gingen sie, redeten beinahe nichts, bis Louis brüsk stehen blieb. Sie stolperte, aus dem Tritt gebracht, schaute ihn an. Die Gesichter waren kaum noch wahrnehmbar.
»Ich möchte dich porträtieren«, sagte er, seine Aufregung bezwingend, »ich möchte das Bild bei der Exposition nationale suisse des Beaux-Arts einreichen.« Er sprach den Ausstellungstitel mit Absicht so geziert, dass er sie erneut zum Lachen brachte. »Willst du das? Willst du mein Modell sein?« Bereits jetzt, in der beginnenden Dunkelheit, schien er sie zu studieren.
»Also hast du das Malen doch nicht aufgegeben.«
»Ich möchte es mit dir versuchen«, sagte er, fast unhörbar.
Sie schob ihn leicht von sich weg. »Kennst du mich denn nicht auswendig?« Sie spürte an seiner Bewegung, dass er den Kopf schüttelte.
»Jetzt nicht mehr. Du hast dich verändert.«
Sie ging weiter, mit weniger ausgreifenden Schritten als vorher. Schon waren sie fast auf der Höhe von St. Sulpice; überall begannen nun die Lichter zu brennen. Er wartete auf ihre Antwort.
»Also gut«, sagte sie. »Aber es muss ein ehrbares Bild sein. Kein Akt, weder ein ganzer noch ein halber.«
»Ein Porträt, habe ich gesagt«, antwortete Louis.
»Du weißt ja, was man mir nachredet. Mehr als eine Liebschaft, das gilt bei uns für eine Unverheiratete als Todsünde … Aber vielleicht finde ich ja doch noch den Richtigen vor der Verdammung … Er müsste verständnisvoll sein wie du, aber weniger labil.«
Die Lichter der Häuser in der Nähe gaben einen schwachen Schein, wie von Spiegelungen, in ihm sah sie, dass der Bruder plötzlich vor ihr auf die Knie gesunken war und die Hände zu ihr emporstreckte. »Bitte, tu es für mich, ich muss dich malen, ich muss.«
»Steh auf!«, fuhr sie ihn an, und gleichzeitig ging ihr durch den Kopf, ob er auch so vor Madge gekniet hatte, um etwas bittend, das ihm unerreichbar schien. »Ich tue es ja«, sprach sie besänftigend weiter. »Ich komme vorbei, immer, wenn ich Zeit habe. Aber ich muss an meine Lektionen in Fribourg denken, die darf ich nicht versäumen. Ich will für mich selber genug verdienen. Auch wenn die jungen Damen, die zu mir kommen, völlig unbegabt sind.« Sie gab ein paar hohe Misstöne von sich.
Er lachte kurz, sprang auf die Füße wie ein geübter Turner und stand wieder vor der Schwester, so groß wie sie, deren Bluse weiß schimmerte, heller als ihr Gesicht. »Danke, Schwesterherz, ich werde mich bemühen.«
Sie gingen weiter. »Willst du etwas essen?«, fragte sie. »Dann bestellen wir im Hotel de la Plage eine Kleinigkeit. Einverstanden?«
Er antwortete nicht, folgte ihr einfach.
»Der Vater ist krank«, sagte er plötzlich, dicht hinter ihr, beinahe in ihren Nacken hinein. »Maman hat gesagt, er werde sterben, ich solle ihn malen, nicht dich.« Er atmete tief ein und aus. »Aber die Zeiten, in denen Maman alle herumkommandierte, sind vorbei. Sie findet es herzlos, dass ich Papa nicht zu Hause besuche … Er liegt im Hinterzimmer, unten. Das ist wie eine Verbannung.« Wieder seine Atemgeräusche, dann wurde seine Stimme überraschend laut, überschlug sich beinahe: »Ich mag ihn nicht sehen!« Er packte sie an den Schultern, als sie weitergehen wollte. »Ich kann nicht zu ihm, es geht nicht, nein, es geht nicht.«
»Mir fällt es auch schwer«, sagte Jeanne. »Aber ich gehe hin, setze mich eine Weile zu ihm. Er ist mein Vater, auch wenn er nur noch Löcher in die Wand starrt.«
3Das Bild der Schwester
Den Vater hatte er dann doch ein letztes Mal besucht, er wollte mit niemandem darüber sprechen. Aber zur Beerdigung ging er, die Verpflichtung war stärker als seine Widerstände. Er hielt sich deutlich abseits von der Trauergemeinde; nur während der Predigt und beim Gebet am Grab nahm er den Hut ab. Die meisten, die dem Apotheker von Morges die letzte Ehre erwiesen, wichen Louis aus, der Bruder Albert, der jetzt die Verantwortung fürs Geschäft trug, begnügte sich mit einem kurzen Händedruck und einem unverständlichen Satz. Bloß Jeanne stellte sich einen Moment an seine Seite und flüsterte ihm zu: »Gut, dass du doch gekommen bist.« Er nickte, blieb stehen, drehte den Hut in den Händen. Die Mutter stand mitten unter den Trauernden, kerzengerade hielt sie sich. Ob unter ihrem Schleier, den der Wind leicht bewegte, die harten Gesichtszüge aufgeweicht waren, war nicht zu sehen, ebenso wenig, ob sie die Anwesenheit des jüngeren Sohns bemerkte. Dem älteren, Albert, überließ sie widerwillig den Arm, als sie zur Kirche gingen; dessen Frau Elisabeth drang darauf, die Schwiegermutter von der anderen Seite unterzufassen.
Der Trauergottesdienst war kurz, die Witwe hatte es so gewünscht, sie selbst fühlte sich außerstande, dabei mitzuwirken. Aber Jeanne sang, von der Orgel begleitet, das Salve Regina von Pergolesi, ihre Stimme brach nicht vor Gram, wie viele erwartet hatten; der eindringliche Klang trug die Worte bis zu Louis, der drinnen bei der Eingangstür stand wie einer, der sich selbst verstoßen hatte. Später fragte ihn Jeanne, ob es nicht angemessen gewesen wäre, sich mit seiner Geige zu den beiden Musikerinnen zu gesellen.
Er schüttelte den Kopf: »Nein, ich bin aus der Übung.«
»Dabei hast du Vater gar nicht gehasst.«
Er machte mit der Hand eine seiner kreisenden Bewegungen, die so vieles bedeuten konnten. »Gehasst habe ich ihn nicht, aber verloren schon lange.«
Sie schüttelte nachsichtig den Kopf und versuchte, sein gescheiteltes Haar mit zwei Fingern zu zerzausen, damit hatte sie ihn vor Jahren oft geneckt. Er wich ihr aus, packte sogar ihr Handgelenk und stieß sie zurück, nicht hart, aber spürbar.
»Man muss mich lassen, wie ich bin«, sagte er.
Als sie ihn bei einem ihrer spontanen Besuche in der Mansarde wieder einmal antraf, fragte er, wann er mit dem Porträt beginnen könne.