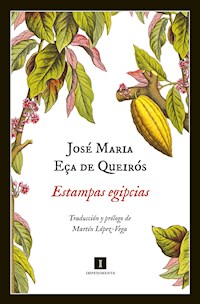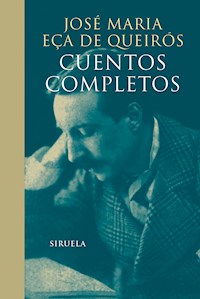Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die portugiesischen „Buddenbrooks“ als spektakuläre literarische Wiederentdeckung. Scharf beobachtet, voller Komik, Menschenkenntnis und Gesellschaftskritik Lissabon um 1870. Carlos de Maia stammt aus einer der vornehmsten Familien des Landes und hat alles: Er sieht blendend aus, ist reich, intelligent und hat hochfliegende Pläne. Er und sein bester Freund João brillieren in der feinen Gesellschaft, über deren Rückständigkeit sie sich zugleich lustig machen. Carlos studiert im Ausland, wird Arzt und richtet sich eine luxuriöse Praxis ein, doch schon bald stürzt er sich in eine Affäre mit der rätselhaften Maria Eduarda, die das Zeug dazu hat, nicht nur ihn, sondern seine ganze Familie zu ruinieren. Der größte Klassiker der portugiesischen Literatur, ein Familien- und Gesellschaftsroman voll unvergleichlichem Witz und tiefer Menschenkenntnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1291
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die portugiesischen »Buddenbrooks« als spektakuläre literarische Wiederentdeckung. Scharf beobachtet, voller Komik, Menschenkenntnis und GesellschaftskritikLissabon um 1870. Carlos de Maia stammt aus einer der vornehmsten Familien des Landes und hat alles: Er sieht blendend aus, ist reich, intelligent und hat hochfliegende Pläne. Er und sein bester Freund João brillieren in der feinen Gesellschaft, über deren Rückständigkeit sie sich zugleich lustig machen. Carlos studiert im Ausland, wird Arzt und richtet sich eine luxuriöse Praxis ein, doch schon bald stürzt er sich in eine Affäre mit der rätselhaften Maria Eduarda, die das Zeug dazu hat, nicht nur ihn, sondern seine ganze Familie zu ruinieren. Der größte Klassiker der portugiesischen Literatur, ein Familien- und Gesellschaftsroman voll unvergleichlichem Witz und tiefer Menschenkenntnis.
José Maria Eça de Queirós
Die Maias
Episoden aus dem romantischen Leben
Herausgegeben und übersetzt von Marianne Gareis
Hanser
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Fußnoten
Über José Maria Eça de Queirós
Impressum
Inhalt
Die Maias
Anhang
»Die Maias« im literarischen Wirken Eça de Queirós’ — von Carlos Reis
Editorische Notiz
Anmerkungen
Die Maias
I
Das Haus in Lissabon, das die Maias im Herbst 1875 bezogen, war in der Gegend um die Rua de São Francisco de Paula und sogar im ganzen Viertel Janelas Verdes unter dem Namen Casa do Ramalhete, »das Haus mit dem Blumenstrauß«, bekannt oder einfach nur als Ramalhete. Trotz dieses frischen, nach Landhaus klingenden Namens machte das Ramalhete, ein großer, düsterer Klotz mit strengem Gemäuer, einer Reihe schmaler schmiedeeiserner Balkone im ersten Stock und schüchtern wirkenden Fensterchen unter dem schützenden Dach, den traurigen Eindruck einer kirchlichen Residenz, passend für ein Gebäude aus der Zeit der Königin Dona Maria I. Mit einem Glöckchen und einem Kreuz auf dem Dach hätte man es für ein Jesuiten-Kolleg halten können. Der Name ging offensichtlich zurück auf ein quadratisches Fliesenpaneel an der Stelle, wo eigentlich das Wappenschild hätte prangen sollen, das aber nie angebracht worden war — ein großer Strauß Sonnenblumen, zusammengehalten von einem Band, auf dem die Ziffern und Buchstaben eines Datums zu erkennen waren.
Viele Jahre lang war das Ramalhete unbewohnt gewesen, die Gitter der kleinen Fenster im Erdgeschoss mit Spinnweben überzogen, seine Farbe zunehmend die des Verfalls. 1858 hatte Monsignore Buccarini, Nuntius Seiner Heiligkeit, den die klerikale Strenge des Gebäudes und der schläfrige Frieden des Viertels betört hatten, es mit dem Gedanken besichtigt, dort die Apostolische Nuntiatur einzurichten. Die Innenräume sagten ihm gleichermaßen zu: die palastartige Ausstattung des Hauses mit getäfelten Decken und Wandfresken, auf denen die Rosen der Girlanden und die Wangen der Amoretten bereits verblassten. Doch der Monsignore mit seinen Gepflogenheiten des reichen römischen Prälaten wollte in seiner Residenz nicht auf die Bäume und das Wasser eines Lustgartens verzichten, und im Ramalhete gab es zu Füßen der roten Backsteinterrasse lediglich ein kleines, ungepflegtes, dem Unkraut überlassenes Gärtchen mit einer Zypresse und einer Zeder, einer ausgetrockneten Kaskade, einem Teich voller Unrat und einer vom feuchten Blattwerk geschwärzten Statue ganz hinten in der Ecke (in der Monsignore sogleich die Venus von Kythera erkannte). Hinzu kam, dass die Miete, die der alte Vilaça, Verwalter der Maias, verlangte, dem Monsignore so überhöht vorkam, dass er ihn lächelnd fragte, ob er denn glaube, dass die Kirche immer noch in der Zeit Leo X. lebe. Vilaça erwiderte, auch der Adel lebe nicht mehr in der Zeit Dom João V, und so blieb das Ramalhete weiterhin unbewohnt.
Diese unnütze Bruchbude (wie Vilaça Júnior das Haus nannte, der nach dem Tod seines Vaters Verwalter der Maias wurde) fand erst Ende 1870 eine Verwendung, als sie nämlich das Mobiliar und Tafelgeschirr aus dem Familienschlösschen von Benfica aufnahm, eines beinahe historischen Domizils, das, nachdem man es jahrelang feilgeboten hatte, schließlich von einem brasilianischen Komtur erworben worden war. Bei dieser Gelegenheit war auch eine weitere Besitzung der Maias verkauft worden, die Tojeira; und einige wenige Menschen in Lissabon, die sich noch an die Maias erinnerten und wussten, dass sie seit der Zeit der Regeneração zurückgezogen an den Ufern des Douro auf ihrem Landgut Santa Olávia lebten, hatten Vilaça gefragt, ob diese Leute etwa in Geldschwierigkeiten steckten.
»Einen Kanten Brot haben sie schon noch«, erwiderte Vilaça grinsend, »und auch die Butter zum Draufschmieren.«
Die Maias waren eine alteingesessene Adelsfamilie aus der Beira, die nie wirklich zahlreich gewesen war; ohne Seitenlinien, ohne große Verwandtschaft und inzwischen nur noch ganze zwei Männer zählend, nämlich den bereits betagten Hausherrn Afonso da Maia, fast schon ein Ahnherr, älter als das Jahrhundert, und seinen Enkel Carlos, der in Coimbra Medizin studierte. Als Afonso sich damals endgültig nach Santa Olávia zurückzog, brachte das Gut bereits mehr als fünfzigtausend Cruzados ein; und seitdem hatten sich Ersparnisse aus zwanzig Jahren Dorfleben angesammelt, zu denen noch die Erbschaft eines letzten Verwandten, Sebastião da Maia, hinzugekommen war, der seit 1830 allein in Neapel gelebt und sich dort nur mit der Numismatik beschäftigt hatte: Der Verwalter konnte also getrost selbstbewusst grinsen, wenn er von den Maias und ihrem Kanten Brot sprach.
Zu dem Verkauf der Tojeira hatte in der Tat Vilaça geraten, doch niemals hatte er befürwortet, dass Afonso sich von Benfica trennte, nur weil diese Mauern so viel häusliches Leid miterlebt hatten. Das sei doch das Schicksal aller Mauern, sagte Vilaça. Die Folge war, dass die Maias nun, da man im Ramalhete nicht wohnen konnte, in Lissabon über keine Bleibe mehr verfügten; und Afonso mochte in seinem Alter ja die Ruhe von Santa Olávia lieben, sein Enkel hingegen, ein junger Mann mit Sinn für Geschmack und Luxus, der seine Ferien in Paris und in London verbrachte, würde sich nach seinem Studium bestimmt nicht zwischen den Felsen des Douro vergraben. Und tatsächlich überraschte Afonso seinen Verwalter etliche Monate, bevor der Enkel Coimbra verlassen sollte, mit der Ankündigung, er wolle fortan im Ramalhete wohnen! Vilaça verfasste sogleich einen Bericht, in dem er die Nachteile des Hauses aufzählte. Dies waren in erster Linie die erforderlichen Bauarbeiten und deren hohe Kosten; ferner der fehlende Garten, was sicher schmerzlich wäre für jemanden, der aus der waldreichen Gegend von Santa Olávia kam; und schließlich führte er sogar noch eine Legende an, der zufolge die Wände des Ramalhete den Maias stets Unheil gebracht hätten, »wenngleich es mir peinlich ist«, fügte er mit wohlgesetzten Worten hinzu, »in diesem Jahrhundert eines Voltaire, eines Guizot oder anderer liberaler Philosophen solche Albernheiten anzubringen …«
Afonso lachte herzlich über diesen Satz und antwortete, das seien zwar einleuchtende Gründe, doch er wolle unter einem Dach leben, das traditionell das seine sei; und wenn Bauarbeiten nötig seien, so solle man sie durchführen, auch im großen Stil; und was die Legenden und schlechten Omen angehe, so genüge es, die Fenster aufzureißen und die Sonne hereinzulassen.
Seine Exzellenz hatte das Sagen, und da der Winter trocken war, wurde sofort mit den Arbeiten begonnen, unter der Leitung eines gewissen Esteves — Architekt, Politiker und Freund Vilaças. Diese Künstlernatur hatte den Verwalter mit seinen Plänen für eine prächtige, von zwei Statuen flankierte Treppe begeistert, die die Eroberungen Guineas und Indiens symbolisieren sollte. Und er entwarf auch bereits einen Keramikbrunnen für den Speisesaal, als — gänzlich unerwartet — Carlos mit einem Innenarchitekten aus London in Lissabon aufkreuzte, dem er, nachdem er auf die Schnelle einige Dekors und Farbmuster für die Polster mit ihm ausgesucht hatte, die vier Wände des Ramalhete überließ, damit er dort nach seinem Gusto ein komfortables Interieur von klugem und dezentem Luxus entwarf.
Vilaça war zutiefst gekränkt über diese Missachtung des heimischen Künstlers; Esteves brüllte in seinem Parteilokal herum, dass diesem Land nicht zu helfen sei. Auch Afonso bedauerte Esteves’ Entlassung und verlangte sogar, ihn mit dem Bau des Kutschenhauses zu beauftragen. Der Künstler wollte gerade zusagen — da wurde er zum Zivilgouverneur ernannt.
Nach einem Jahr, in dem Carlos häufig nach Lissabon gekommen war, um bei den Arbeiten mitzuwirken und »dem Ganzen ästhetisch den letzten Schliff zu geben«, war von dem früheren Ramalhete nur noch die triste Fassade übrig, die Afonso nicht verändert haben wollte, da sie dem Haus sein Gesicht verlieh. Und Vilaça scheute sich nicht zu erklären, Jones Bule (wie er den Engländer nannte) habe ohne übermäßige Kosten zu verursachen und sogar unter Einbeziehung der alten Möbel aus Benfica »ein Museum« aus dem Ramalhete gemacht.
Zuallererst stach der Patio ins Auge, vormals so nackt und düster mit dem groben Steinboden — nunmehr strahlendhell, mit quadratischen weiß-roten Marmorfliesen, dekorativen Zierpflanzen, Quimper-Vasen und zwei großen noblen, von Carlos aus Spanien mitgebrachten Bänken, die mit ihren Schnitzereien die Würde eines Chorgestühls ausstrahlten. Darüber erhob sich das Vorzimmer, mit Stoffen ausgekleidet wie ein orientalisches Zelt, in dem jeder Schritt sofort verhallte: Seine Ausstattung bestand aus mit Perserteppichen belegten Diwanen, großen, funkelnden maurischen Kupfertellern, alles in dunklen Tönen gehalten, gegen die sich eine unbefleckt weiße Skulptur abzeichnete, ein fröstelndes Mädchen, das lachend und erschaudernd sein Füßchen ins Wasser streckte. Vom Vorzimmer ging ein breiter Flur ab, den die wertvollen Stücke aus Benfica zierten: gotische Truhen, indische Krüge und alte christliche Gemälde. Die besten Räume des Ramalhete gingen von ihm ab. In dem selten genutzten, gänzlich mit herbstmoosfarbenem Samtbrokat ausgekleideten edlen Salon hing ein schönes Constable-Gemälde, ein Porträt von Afonsos Schwiegermutter, der Gräfin Runa, mit federgeschmücktem Dreispitz und scharlachroter englischer Jagdkleidung vor einer verschneiten Landschaft. Der kleine Saal daneben, in dem musiziert wurde, wirkte mit seinen goldblattverzierten Möbeln und den glänzenden Seidenstoffen mit Blättermuster wie aus dem 18. Jahrhundert. An den Wänden zwei verblasste, in Grautönen gehaltene Gobelins mit Schäfer- und Waldmotiven.
Ihm gegenüber lag das Billardzimmer, ausgekleidet mit einer von Jones Bule mitgebrachten modernen Ledertapete, auf der aus einem Gewirr von flaschengrünen Ästen silberne Schwäne aufflogen. Daneben befand sich der fumoir, das gemütlichste Zimmer des Ramalhete: Die Ottomanen hatten das anheimelnde Ausmaß von Betten, und die warme, wenngleich etwas düstere Gemütlichkeit der scharlachroten und schwarzen Polster wurde durch die heiteren Farben der alten holländischen Fayencen wieder aufgehellt.
Am Ende des Flurs befand sich Afonsos Arbeitszimmer, mit rotem Damast ausgeschlagen wie ein altes Prälatengemach. Der massive Palisanderholztisch, die niedrigen, geschnitzten Eichenholzregale, der erhabene Luxus der Schmuckeinbände — alles verströmte die Strenge eines arbeitsamen Friedens, der noch verstärkt wurde durch ein Rubens zugeschriebenes Gemälde, eine alte Familienreliquie, Christus am Kreuz, dessen athletische Nacktheit sich gegen das wilde Rot eines Sonnenuntergangs abzeichnete. Neben dem Kamin hatte Carlos für seinen Großvater ein gemütliches Eckchen geschaffen, mit einem goldbestickten japanischen Paravent, einem weißen Bärenfell und einem ehrwürdigen Armsessel, dessen verblasster Seidenstoff noch das Wappen der Maias aufwies.
Vom Flur des zweiten Stocks, den die Familienporträts zierten, gingen Afonsos Gemächer ab. Carlos hatte die seinen in einem Seitenflügel des Gebäudes mit separatem Eingang und Blick auf den Garten untergebracht: drei aufeinanderfolgende Räume ohne Türen, verbunden über einen durchgehenden Teppich. Die dicken Kissen und die Seidentapeten an den Wänden veranlassten Vilaça zu dem Ausspruch, dies seien nicht die Gemächer eines Arztes, sondern die einer Tänzerin!
Als das Haus fertig eingerichtet war, stand es zunächst leer, da Carlos nach dem Studium eine lange Reise durch Europa machte; und erst kurz vor seiner Rückkehr in jenem goldenen Oktober 1875 entschloss sich Afonso schließlich, von Santa Olávia wegzugehen und sich im Ramalhete niederzulassen. Seit fünfundzwanzig Jahren war er nicht mehr in Lissabon gewesen, und nach wenigen Tagen gestand er Vilaça bereits, dass er sich nach seinem schattigen Santa Olávia sehnte. Aber was sollte er machen! Er wollte nicht gänzlich getrennt von seinem Enkel leben; und Carlos musste nun, da er ernsthafte Karriereabsichten verfolgte, unbedingt in Lissabon wohnen … Im Übrigen war es keineswegs so, dass das Ramalhete ihm nicht gefiel, wenngleich Carlos es wegen seiner Schwäche für den Luxus kälterer Zonen etwas übertrieben hatte mit den Wandteppichen und den schweren Samtportieren. Das Viertel sagte ihm ebenfalls sehr zu, diese sanfte Ruhe einer in der Sonne dösenden Vorstadt. Und er liebte auch seinen kleinen Garten. Natürlich war er nicht vergleichbar mit dem von Santa Olávia, doch er hatte etwas sehr Ansprechendes mit den am Fuße der Terrassenstufen aufgereihten Sonnenblumen, der Zypresse und der Zeder, die wie zwei traurige Freunde gemeinsam alterten, und der Venus, die in dem nunmehr hellen Ton einer Parkstatue direkt aus Versailles, aus den Tiefen des Grand Siècle zu kommen schien … Und seitdem das Wasser wieder strömte, war auch die Kaskade in ihrer muschelverzierten Nische zwischen den großen, zu drei Felsstufen gefügten Steinen eine wahre Freude, die diesen Winkel des sonnigen Gartens mit dem melancholischen Weinen einer Hausnymphe erfüllte, das sich Tropfen für Tropfen in das Marmorbassin ergoss.
Anfangs war Afonso enttäuscht gewesen wegen der Aussicht von der Terrasse, die einst bestimmt bis zum Meer gereicht hatte. Doch die in den letzten Jahren neu errichteten Häuser hatten diesen glänzenden Horizont verdeckt. Nun war ein schmaler Streifen Wasser zwischen zwei fünfstöckigen Gebäuden alles, was man an Landschaft vom Ramalhete aus noch erblicken konnte. Dennoch hatte dies für Afonso einen ganz eigenen Reiz. Es war wie eine zwischen zwei weiße Quadersteine gespannte Meeresleinwand, die vor der Terrasse vom blauen Himmel herabhing und mit einer unendlichen Vielfalt an Farben und Licht die flüchtigen Augenblicke eines beschaulichen Flusslebens aufzeichnete: Mal war es das Segel einer aus Trafaria kommenden, anmutig kreuzenden Barke; mal ein Dreimaster unter Vollsegel, der, eine günstige Brise nutzend, gemächlich im Abendrot einfuhr; oder auch die Melancholie eines flussabwärts gleitenden, sich stumm gegen die Wellen wappnenden Passagierschiffs, nur einen Augenblick lang zu sehen, bis es wieder verschwand, als hätte das unberechenbare Meer es bereits verschluckt; oder, für ein paar Tage, der schwarze Umriss eines englischen Panzerkreuzers im Goldstaub der stillen Siesta … Und dahinter stets das Stück schwarzgrüner Hügel mit der Windmühle darauf und, unten am Wasser, zwei malerischen weißen Häusern — mal funkelnd und leuchtend aus glutroten Fenstern, mal eher nachdenklich, zum Abend hin, im zarten Rosa des Sonnenuntergangs, fast wie ein menschliches Erröten; und an Regentagen so schauerlich traurig, so einsam, so weiß, wie nackt in dem unwirtlichen Wetter.
Von der Terrasse aus führten drei Glastüren ins Arbeitszimmer — und in diesem schönen Prälatengemach verbrachte Afonso nun seine Tage, in der gemütlichen Ecke neben dem Kamin, die sein Enkel so liebevoll für ihn hergerichtet hatte. Seit seinem langen Englandaufenthalt liebte er das stille Verweilen am Feuer. In Santa Olávia wurden die offenen Kamine bis in den April hinein beheizt und danach mit ausladenden Blumensträußen geschmückt wie Hausaltäre; und dort in diesem Duft, in dieser Frische hatte er seine Pfeife stets ganz besonders genossen, und auch seinen Tacitus oder seinen geliebten Rabelais.
Doch Afonso war noch weit davon entfernt, ein alter Ofenhocker zu werden, wie er es nannte. Trotz seines Alters war er sommers wie winters bei Sonnenaufgang aufgestanden und nach seinem ordentlichen Morgengebet, bestehend aus einem tiefen Eintauchen ins kalte Wasser, sofort zu den Wirtschaftsgebäuden gegangen. Er liebte das Wasser fast abgöttisch und pflegte zu sagen, es gebe nichts Besseres für den Menschen als den Geschmack des Wassers, das Geräusch des Wassers und den Anblick des Wassers. Was ihn an Santa Olávia am meisten faszinierte, war sein großer Reichtum an frischem Wasser — Quellen, Springbrunnen, der ruhige Spiegel stehender Gewässer, das frische Sprudeln des Wassers zur Bewässerung … Und dieser gesunden Kräftigung durch das Wasser schrieb er zu, dass er schon seit Beginn des Jahrhunderts ohne Schmerzen oder Krankheiten durchs Leben ging und — die Tradition der guten Gesundheit seiner Familie wahrend — standhaft den Widrigkeiten und Jahren trotzte, die an ihm ebenso spurlos vorübergingen wie die Jahre und Stürme an seinen Eichen.
Afonso war nicht sehr groß, untersetzt, die Schultern quadratisch und kräftig; mit seinem breiten Gesicht und der Adlernase, dem dunklen, fast roten Teint, dem weißen, kurzgeschorenen Haar und dem langen, schneeweißen Spitzbart erinnerte er, wie Carlos meinte, an einen tapferen Recken aus heroischen Zeiten, an einen Dom Duarte de Meneses oder Afonso de Albuquerque. Das brachte den Alten zum Schmunzeln, und er erinnerte den Enkel scherzhaft daran, dass der Schein doch sehr trüge!
Nein, er war kein Meneses und auch kein Albuquerque, sondern lediglich ein gutmütiger Ahnherr, der seine Bücher, die Bequemlichkeit seines Sessels und seine Partie whist in der Kaminecke liebte. Er selbst pflegte zu sagen, dass er einfach nur ein Egoist sei: Doch niemals war sein Herz großzügiger und verständnisvoller gewesen als jetzt im Alter. Ein Teil seines Einkommens zerrann ihm wegen seiner rührenden Mildtätigkeit zwischen den Fingern. Er liebte zunehmend alles, was arm und schwach war. In Santa Olávia liefen die Kinder vor den Haustüren auf ihn zu, weil sie spürten, dass er fürsorglich und geduldig war. Alles, was lebte, verdiente seine Liebe, und er war einer jener Menschen, die keine Ameise zertreten können und Mitleid haben mit dürstenden Pflanzen.
Vilaça sagte immer, Afonso erinnere ihn an den typischen Patriarchen, wenn er ihn in seiner abgetragenen langen Wollsamtjacke in der Kaminecke antraf, heiter und strahlend, ein Buch in der Hand, zu seinen Füßen der alte Kater. Dieser riesige, schwere Angorakater mit gelbgeflecktem weißem Fell war nun (seit dem Tod des stolzen Bernhardiners Tobias) Afonsos treuer Begleiter. Er war in Santa Olávia geboren und auf den Namen Bonifácio getauft worden; später, als er ins Liebes- und Jagdalter eintrat, wurde ihm der galantere Spitzname »Dom Bonifácio de Calatrava« zuteil; nun, da er dösig und fettleibig und endgültig der Ruhe klerikaler Würdenträger verfallen war, nannte man ihn Hochwürden Bonifácio …
Nicht immer war dieses Leben mit der heiteren Ruhe eines breiten, sommerlichen Flusses dahingeströmt. Der Ahnherr, dessen Augen sich nun beim Anblick seiner Rosen mit zärtlichem Glanz füllten und der am prasselnden Kaminfeuer genussvoll seinen Guizot las, war nach Meinung seines Vaters einst der wildeste Jakobiner Portugals gewesen! Dabei hatte die revolutionäre Wut des armen Jungen lediglich darin bestanden, Rousseau, Volney, Helvétius und die Enciclopédie zu lesen, Feuerwerkskörper auf die Verfassung zu entzünden und, ausgestattet mit der phrygischen Mütze der Liberalen und der hohen blauen Halsbinde, in den Freimaurerlogen abscheuliche Oden auf den allmächtigen Baumeister aller Welten vorzutragen. Das hatte jedoch genügt, um den Zorn des Vaters zu erregen. Caetano da Maia war ein traditioneller Portugiese der alten Schule, der sich bekreuzigte, wenn der Name Robespierre fiel, und der in seinem drögen Dasein des frömmelnden, kränklichen Edelmanns nur ein einziges leidenschaftliches Gefühl kannte — den Horror, den Hass gegenüber den Jakobinern, denen er sämtliche Übel zuschrieb: die des Vaterlandes und auch die eigenen, vom Verlust der Kolonien bis hin zu seinen Gichtanfällen. Um die Jakobiner im Land auszurotten, hatte er sich dem Infanten Dom Miguel verschrieben, dem großen Messias und Erneuerer, den die Vorhersehung geschickt hatte … Und dass er nun ausgerechnet einen Jakobiner zum Sohn hatte, erschien ihm wie eine Prüfung, die allerhöchstens mit denen von Hiob vergleichbar war!
Anfangs, als er noch hoffte, der Junge würde sich bessern, begnügte er sich damit, ihn voll Sarkasmus und mit strengem Gesicht einen Bürger zu heißen! Doch als ihm zu Ohren kam, dass sein Sohn, sein Erbe, sich unter die Meute gemischt hatte, die eines Nachts, als die Stadt festlich beleuchtet war, bei einer patriotischen Feier Steine auf die bereits dunklen Fenster des von der Heiligen Allianz geschickten Herrn Gesandten aus Österreich warf, sah er in seinem Sohn einen Marat, und seine ganze Wut brach sich Bahn. Der unbarmherzigen Gicht, die ihn in den Sessel zwang, war es zu verdanken, dass er den Freimaurer nicht nach guter portugiesischer Vätersitte mit dem indischen Rohrstock verprügelte. Doch er beschloss, ihn hinauszuwerfen aus seinem Haus, ohne monatliche Zahlungen und väterlichen Segen, verleugnet wie einen Bastard! Denn dieser Freimaurer konnte unmöglich von seinem Blute sein!
Die Tränen der Mutter erweichten ihn, und insbesondere auch die Argumente, die eine Schwägerin seiner Frau anbrachte, eine in Benfica mit ihnen zusammenlebende, hochgebildete irische Dame, respektiert als Minerva und Lehrmeisterin; sie hatte dem Jungen Englisch beigebracht und verwöhnte ihn wie ein Baby. Caetano da Maia begnügte sich also damit, den Sohn auf das Landgut Santa Olávia zu verbannen, doch er beweinte weiterhin an der Brust der Patres, die regelmäßig nach Benfica kamen, das Unglück seiner Familie. Diese hochheiligen Menschen trösteten ihn und versicherten ihm, Gott, der alte Gott von Ourique, würde doch niemals zulassen, dass ein Maia mit dem Beelzebub und der Revolution paktiere! Und stellvertretend für Gottvater gebe es da ja noch Unsere Liebe Frau der Einsamkeit, die Schirmherrin des Hauses und Beschützerin des Knaben; sie würde ein Wunder geschehen lassen.
Und das Wunder geschah. Nach einigen Monaten kehrte der Jakobiner, der Marat aus Santa Olávia zurück, ein wenig reuig und vor allem dieser Einsamkeit überdrüssig, in der die Tees bei Brigadegeneral Sena sogar noch trostloser waren als der Rosenkranz bei den Cousinen Cunha. Er bat seinen Vater um seinen Segen und um einige Tausend Cruzados, denn er wollte nach England reisen, ins Land der saftigen Wiesen und güldenen Haare, von dem ihm seine Tante Fanny so viel erzählt hatte. Der Vater küsste ihn mit tränennassen Augen und willigte sofort in alles ein, sah er darin doch die glorreiche Intervention Unserer Lieben Frau der Einsamkeit! Und selbst sein Beichtvater, Pater Jerónimo da Conceição, erklärte dies zu einem Wunder, das dem von Carnaxide um nichts nachstand.
Afonso reiste also ab. Es war Frühjahr — und das so grüne England mit seinen luxuriösen Parks, den zahlreichen Annehmlichkeiten, der tiefen Harmonie seiner feinen Sitten und diesem so ernsten, starken Menschenschlag entzückten ihn. Schnell vergaß er seinen Hass auf die finsteren Patres der Kongregation, vergaß die euphorischen Stunden der Mirabeau-Rezitationen im Café der Rua dos Romolares und vergaß die Republik, die er hatte gründen wollen, klassisch und voltairianisch, mit einem Triumvirat von Scipionen und Festlichkeiten zu Ehren des Höchsten Wesens. Zur Zeit der Abrilada war er in Epsom beim Pferderennen, saß mit Pappnase gerüstet hoch oben auf einer Postkutsche und brüllte furchterregende Hurras — keinen Gedanken an seine Freimaurerbrüder verschwendend, die der Infante auf seinem kräftigen Altér Real in den Gassen des Bairro Alto gerade mit Lanzen durchbohrte.
Da verstarb unerwartet sein Vater, und er musste nach Lissabon zurückkehren. Dort lernte er Dona Maria Eduarda Runa kennen, Tochter des Grafen Runa, eine wunderschöne Brünette, zart und ein wenig kränklich. Als die Trauerzeit vorüber war, heiratete er sie. Sie brachte einen Sohn zur Welt, und er wünschte sich weitere; also ließ er mit der blühenden Fantasie des jungen Patriarchen das Schlösschen von Benfica renovieren, Haine anlegen und schattenspendende Überdachungen bauen für die geliebte Nachkommenschaft, die ihm das Alter versüßen sollte.
Doch er konnte England nicht vergessen. Und angesichts dieses miguelistischen Lissabons, das ähnlich desorganisiert war wie das berberische Tunis, angesichts dieser rüden apostolischen Verschwörung von Ordensbrüdern und von Kutschern, die in Tavernen und in Kapellen herumpolterten, angesichts dieses scheinheiligen, schmutzigen und wilden Pöbels, der sich vom jeweiligen Ort des Lausperene zum curro wälzte und dort lärmend auf den Prinzen wartete, der ihre Laster und Leidenschaften so perfekt verkörperte, erschien ihm jenes Land nur noch begehrlicher …
Dieses ganze Schauspiel empörte Afonso da Maia; und in den heiteren Abendstunden mit Freunden brachte er, den Kleinen auf den Knien, nicht selten diese aufrichtige Empörung zum Ausdruck. Natürlich verlangte er nicht mehr wie in seiner Jugend nach einem Lissabon der Katos und Mucius Scaevolas. Er billigte sogar bereits das Streben des Adels nach Wahrung seiner historischen Privilegien; doch er wollte einen intelligenten, würdevollen Adel ähnlich der Tory-Aristokratie (die er in seiner Liebe für England idealisierte), der in allem die moralische Richtung vorgab, der die Sitten prägte und die Literatur inspirierte, der prachtvoll lebte und genüsslich parlierte, Vorbild an hohen Ideen, Spiegel der vornehmen Lebensart … Was er nicht ertrug, war diese viehische, verkommene Welt von Queluz.
Derlei Worte kamen, kaum dass sie ausgesprochen waren, Queluz zu Ohren. Und als der Hof zu den Cortes Gerais zusammenkam, stürmte die Polizei das Haus in Benfica, »weil sie Dokumente und versteckte Waffen suchten«.
Reglos und ohne ein Wort sah Afonso da Maia, seinen Sohn auf dem Arm, die zitternde Frau neben sich, zu, wie Gewehrkolben Schubladen aufbrachen, wie die schmutzigen Hände des Polizeispitzels die Matratzen seines Betts durchwühlten. Der Herr Landrichter fand nichts, er ließ sich sogar in der Kammer ein Glas Wein kredenzen und bekannte dem Verwalter gegenüber, »dass die Zeiten gerade hart seien …«. Von diesem Vormittag an blieben die Fenster des Schlösschens geschlossen, und auch das edle Portal wurde nicht mehr geöffnet, um die Kutsche der Senhora passieren zu lassen. Einige Wochen später brach Afonso da Maia mit Frau und Sohn nach England ins Exil auf.
Dort ließ er sich mit allem Komfort zu einem langen Aufenthalt nieder, im Londoner Umland nahe Richmond, ganz hinten in einem Park, umgeben von der sanften, ruhigen Landschaft Surreys.
Sein Vermögen war dank des Ansehens des Grafen Runa, einst Günstling Königin Dona Carlota Joaquinas und nunmehr grimmiger Berater Dom Miguels, nicht konfisziert worden, und Afonso da Maia konnte im Überfluss leben.
Anfangs machten ihm noch die emigrierten Liberalen zu schaffen, Palmela und die Leute von der Belfast. Seine redliche Seele rebellierte angesichts der Kastentrennung und Hierarchien, die dort in der Fremde zwischen den besiegten Anhängern derselben Ideen aufrechterhalten wurden — zwischen Edelmännern oder Landrichtern, die in London in Saus und Braus lebten, und dem gemeinen Volk, dem Heer, das nach der leidvollen Erfahrung von Galicien nun in den Baracken von Plymouth dem Hunger, den Würmern oder dem Fieber zum Opfer fiel. Er geriet sofort in Konflikt mit den Anführern der Liberalen, wurde als Vintista und Demagoge bezichtigt und verlor schließlich den Glauben an den Liberalismus. Er zog sich zurück — ohne jedoch seinen Geldbeutel zu verschnüren, dem weiterhin die Münzen entsprangen, zu fünfzig oder zu hundert Stück … Doch als die erste Expedition aufbrach und die Lager der Emigrierten sich allmählich leerten, atmete er auf und genoss erstmals, wie er sagte, die englische Luft!
Monate später verstarb seine in Benfica verbliebene Mutter an einem Schlaganfall. Tante Fanny kam nach Richmond und machte Afonsos Glück mit ihrem wachen Verstand, ihren weißen Locken und ihrer diskreten Art der Minerva perfekt. Nun war sein Traum wahr geworden, er lebte in einer würdigen englischen Residenz zwischen jahrhundertealten Bäumen, erblickte auf den weiten Wiesen um sich herum weidende oder schlafende Luxusrinder und empfand alles als gesund, stark, frei und solide — so, wie sein Herz es begehrte.
Er pflegte Freundschaften, studierte die edle und reiche englische Literatur, interessierte sich, wie es sich für einen englischen Edelmann geziemte, für den Ackerbau und die Pferdezucht, praktizierte die Nächstenliebe und dachte mit Freude daran, für immer in diesem Frieden und in dieser Ordnung zu verbleiben.
Doch Afonso spürte auch, dass seine Frau nicht glücklich war. Nachdenklich und traurig wandelte sie hüstelnd durch die Salons. Abends setzte sie sich an den Kamin, seufzte und schwieg …
Die arme Frau! Die Sehnsucht nach ihrem Land, nach ihrer Familie und den Gotteshäusern höhlte sie innerlich aus. Als echte Lissabonnerin, von kleiner Statur und dunklem Teint, lebte sie seit ihrer Ankunft klaglos und mit mattem Lächeln in einem dumpfen Hass auf dieses Land der Irrgläubigen mit seiner barbarischen Sprache: Stets fröstelnd und in Pelze gehüllt blickte sie mit Schrecken auf den grauen Himmel oder die verschneiten Bäume und war mit ihrem Herzen niemals dort, sondern stets im fernen Lissabon, auf den Plätzen vor den Kirchen und in den sonnendurchfluteten Stadtvierteln. Ihre immer schon bestehende tiefe Frömmigkeit (die Frömmigkeit der Runas!) hatte sich angesichts der feindlichen Atmosphäre gegenüber den »Papisten«, die sie spürte, noch einmal verfestigt und verhärtet. Und Zufriedenheit verspürte sie nur abends, wenn sie sich mit den portugiesischen Bediensteten ins oberste Stockwerk flüchtete, um dort, auf einer Binsenmatte kauernd, den Rosenkranz zu beten. Und in diesem Gemurmel von Ave Marias in einem protestantischen Land empfand sie den Zauber einer katholischen Verschwörung!
Da sie alles hasste, was englisch war, hatte sie auch nicht zugestimmt, dass ihr Sohn Pedrinho in die Schule von Richmond ging. Vergebens hatte Afonso ihr klarzumachen versucht, dass es sich um ein katholisches Kolleg handelte. Sie wollte es nicht: Dieser Katholizismus ohne Wallfahrten, ohne Johannisfeuer, ohne Bilder des kreuztragenden Jesus, ohne Ordensbrüder auf den Straßen war für sie keine Religion. Sie würde doch die Seele ihres kleinen Pedros nicht der Ketzerei überlassen, also ließ sie für seine Erziehung Pater Vasques, den Kaplan des Grafen Runa, aus Lissabon kommen.
Vasques brachte Pedro die lateinischen Deklinationen bei, und insbesondere den Katechismus. Über Afonso da Maias Gesicht legte sich Traurigkeit, wenn er von der Jagd oder den Londoner Straßen wiederkam, wo das freie Leben pulsierte, und er im Studierzimmer die schläfrige Stimme des Reverendus hörte, der wie aus einer tiefen Finsternis heraus fragte:
»Wie viele Feinde hat die Seele?«
Und der Kleine, noch verschlafener, murmelte:
»Drei. Die Welt, den Teufel und das Fleisch …«
Armer Pedrinho! Feind seiner Seele war nur der fettleibige, schmierige Reverendus Vasques, der mit Schnupftuch auf den Knien aus seinem tiefen Sessel heraus rülpste …
Manchmal betrat Afonso empört das Zimmer, unterbrach die Doktrin, packte Pedrinho an der Hand und nahm ihn mit, um mit ihm an der Themse unter den Bäumen herumzurennen und die Schwere der Doktrin im weiten Licht des Flusses aufzulösen. Aber dann kam sofort die entsetzte Mutter herbeigeeilt und wickelte ihn in eine dicke Decke. Und draußen fürchtete sich der Junge, der nur den Schoß der Bediensteten und die gepolsterten Ecken kannte, vor dem Wind und den Bäumen. So wurden ihre Schritte immer trauriger, und sie stapften schweigend durch die trockenen Blätter — der Sohn gänzlich eingeschüchtert von den Schatten des lebendigen Waldes, der Vater nachdenklich und mit gebeugten Schultern, traurig über die Schwächlichkeit seines Sohnes …
Doch der kleinste Versuch, den Jungen aus den verweichlichenden Mutterarmen und der tödlichen Doktrin Pater Vasques’ zu reißen, löste bei der zartbesaiteten Hausherrin Fieberanfälle aus. Und Afonso traute sich nicht, der armen, so tugendhaften Kranken zu widersprechen, die ihn doch so sehr liebte! Also klagte er Tante Fanny sein Leid. Die kluge Irin legte ihre Brille zwischen den Seiten ihres Buchs ab, ein Addison-Traktat oder ein Pope-Gedicht, und zog nur melancholisch die Schultern hoch. Was konnte sie schon ausrichten! …
Schließlich verschlimmerte sich Maria Eduardas Husten, und auch ihre Worte wurden immer trauriger. Sie sprach bereits von »ihrem letzten Wunsch«, nämlich noch einmal die Sonne zu sehen! Warum kehrten sie nicht nach Benfica, in ihr Heim, zurück, nun, da der Infant ebenfalls verbannt war und ein großer Frieden herrschte? Doch diesen Wunsch erfüllte Afonso ihr nicht: Er wollte nicht noch einmal zusehen müssen, wie seine Schubladen mit Gewehrkolben aufgebrochen wurden, und vor den Soldaten des Königs Dom Pedro war er keinesfalls sicherer als vor den Polizeispitzeln Dom Miguels.
Zu dieser Zeit erlebte das Haus ein großes Leid: In den kalten Märztagen verstarb Tante Fanny an einer Lungenentzündung, und dies verschlimmerte Maria Eduardas Melancholie noch, denn sie hatte die Tante ebenfalls sehr gemocht — weil sie Irin und katholisch war.
Um seiner Frau Ablenkung zu verschaffen, fuhr Afonso mit ihr nach Italien, in eine entzückende Villa in der Nähe von Rom. Dort mangelte es ihr nicht an Sonne: Pünktlich und großzügig war sie jeden Morgen da, badete die Terrassen in Licht und vergoldete die Lorbeersträucher und Myrten. Und dann gab es dort unten, inmitten von Marmorgestein, auch noch diese kostbare und heilige Sache — den Papst!
Doch die traurige Frau klagte weiter. Wonach sie sich wirklich sehnte, war Lissabon, waren ihre Novenen, die frommen Gläubigen ihres Viertels, die Prozessionen, die zu trägem Büßergemurmel durch sonnige und staubige Nachmittage zogen …
Man musste ihr zu ihrem Seelenfrieden verhelfen, musste nach Benfica zurückkehren.
Dort begann ein trostloses Leben. Maria Eduarda welkte dahin, wurde von Tag zu Tag blasser, saß wochenlang reglos auf dem Sofa, die durchsichtigen Hände über den dicken englischen Pelzen gefaltet. Pater Vasques, der sich dieser verschreckten Seele annahm, für die Gott ein herrischer Gebieter war, wurde zum wichtigsten Mann im Haus. Zudem traf Afonso in den Fluren ständig weitere kirchliche Kanoniker in langen Mänteln und Scheitelkäppchen an, in denen er alte Franziskaner erkannte oder auch einen mageren Kapuzinermönch, der sich hier im Viertel durchfüttern ließ. Das Haus verströmte einen Geruch nach Sakristei, und aus den Gemächern der Hausherrin erklang stetig, klagend und dumpf, eine gemurmelte Litanei.
All diese frommen Herren speisten in der Kammer neben der Küche und tranken seinen Portwein. Die Rechnungen des Verwalters wiesen hohe Summen an monatlichen Spenden der frommen Hausherrin auf: Ein gewisser Bruder Patrício hatte ihr zweihundert Totenmessen für die Seele König Dom José I zu je einem Cruzado abgeluchst …
Diese ganze Frömmelei um ihn herum löste in Afonso einen erbitterten Atheismus aus: Am liebsten hätte er alle Kirchen und Klöster geschlossen gesehen, die Heiligenbilder mit Äxten zerschlagen, die Geistlichen getötet … Sobald er im Haus irgendwo eine betende Stimme vernahm, flüchtete er, zog sich in den hintersten Winkel des Guts, unter die Kletterpflanzen am Aussichtspunkt, zurück und las seinen Voltaire: Oder er verließ das Haus, um seinem Ärger bei seinem alten Freund, dem Oberst Sequeira, Luft zu machen, der in einem Gutshaus in Queluz lebte.
Pedrinho hingegen war fast schon ein Mann. Er war klein geblieben und nervös wie Maria Eduarda, hatte wenig vom Schlag und von der Kraft der Maias. Das hübsche ovale Gesicht mit dem dunklen, warmen Teint, die unwiderstehlichen, schnell feucht werdenden Augen ließen ihn einem schönen Araber ähneln. Er hatte sich langsam entwickelt, hatte wenig Neugier und kein Interesse an Spielzeugen, Tieren, Blumen und Büchern gezeigt. Kein starkes Begehren schien je diese leicht verschlafene, passive Seele zu erschüttern. Er erwähnte nur manchmal, dass er sehr gerne nach Italien zurückkehren würde. Inzwischen hasste er Pater Vasques, wagte aber nicht, ihm den Gehorsam zu verweigern. Er war in jeder Hinsicht ein Schwächling; und diese fortwährende Niedergeschlagenheit in seinem ganzen Wesen entlud sich bisweilen in Anfällen von schwarzer Melancholie, während derer er tagelang stumm war, welk und gelb, mit tiefen Augenringen und vorzeitig gealtertem Gesicht. Sein einziges echtes, intensives Gefühl war bislang die Liebe zu seiner Mutter gewesen.
Afonso hatte ihn nach Coimbra schicken wollen. Doch bei der Vorstellung, sich von ihrem Pedro trennen zu müssen, war die arme Senhora zitternd und stammelnd vor Afonso auf die Knie gefallen. Und angesichts dieser flehenden Hände, dieser Tränen, die ihr in Doppelreihen über das elende, wächserne Gesicht liefen, hatte er natürlich nachgegeben. Der Junge blieb in Benfica, unternahm seine gemächlichen Ausritte, gefolgt von einem Diener in Livree, und fing bereits an, in den Lissabonner Schänken seinen Gin zu trinken … Dann brach sich in diesem Wesen eine große amouröse Tendenz Bahn: Mit neunzehn hatte Pedro bereits einen kleinen Bastard gezeugt.
Afonso da Maia tröstete sich mit dem Gedanken, dass es dem Jungen trotz dieser leidigen Zimperlichkeiten nicht an guten Eigenschaften mangelte: Er war sehr klug, gesund und, wie alle Maias, mutig: Kürzlich erst hatte er, auf der Landstraße allein, mit seiner Peitsche drei mit Hirtenstöcken bewaffnete Bauernburschen vertrieben, die ihn einen Schlappschwanz genannt hatten.
Als seine Mutter in einem schrecklichen Todeskampf starb, bei dem die Frömmlerin tagelang die Hölle fürchtete, hatte Pedro in seinem Schmerz Anfälle von Wahnsinn. In seiner Hysterie hatte er das Gelübde abgelegt, ein Jahr lang auf dem Steinfußboden im Hof zu schlafen, wenn sie überlebte. Und als der Sarg hinausgetragen und die Patres weg waren, verfiel er in einen dumpfen, tränenlosen Angstzustand, aus dem er nicht wieder auftauchen wollte. Wie ein besessener Büßer lag er bäuchlings auf dem Bett. Monatelang fand er nicht heraus aus dieser Traurigkeit. Afonso da Maia verzweifelte bereits, wenn er den Jungen, seinen Sohn und Erben, tagtäglich in düsterer Trauer und mönchischer Haltung zum Grab der Mama pilgern sah …
Doch irgendwann war dieser übertriebene, krankhafte Schmerz vorbei und ging fast nahtlos in eine leichtfertige, wilde Phase über, in ein oberflächliches Luxusleben, in dem Pedro die Sehnsucht nach der Mutter in schäbigen Bordellen und Schänken zu ertränken suchte. Doch diese Übermäßigkeit, die so plötzlich, so tumultartig in seinem unsteten Wesen aufgebrochen war, erschöpfte sich ebenfalls schnell wieder.
Nach einem turbulenten Jahr im Marrare, mit Heldenstückchen beim Stiertreiben, müde gerittenen Pferden und Fußgetrappel im São Carlos kam es erneut zu den alten Melancholieanfällen; endlos wie die Wüste kehrten die Tage des Schweigens wieder, an denen er gähnend im Haus herumstrich oder bäuchlings unter einem Baum des Guthofs lag, als wäre er in eine tiefe Bitternis verfallen. In diesen Phasen wurde er wieder fromm: Er las das Leben der Väter und besuchte das Lausperene. Diese plötzliche Mutlosigkeit der Seele hatte früher die Schwachen ins Kloster geführt.
Das bekümmerte Afonso da Maia. Lieber hätte er erfahren, dass er erst in den Morgenstunden aus Lissabon zurückgekommen sei, erschöpft und betrunken, statt ihn mit dem Brevier unterm Arm und gealtertem Gesichtsausdruck in die Kirche von Benfica marschieren zu sehen.
Es gab da auch noch etwas anderes, das Afonso zu seinem Leidwesen manchmal quälte: Ihm war die große Ähnlichkeit zwischen Pedro und einem Großvater seiner Frau aufgefallen, einem Runa, von dem es in Benfica ein Porträt gab. Dieser außergewöhnliche Mann, mit dem man im Hause den Kindern Angst machte, war dem Wahnsinn verfallen und hatte sich, weil er sich für Judas hielt, an einem Feigenbaum erhängt …
Doch irgendwann fanden die Exzesse und Krisen ein Ende. Pedro da Maia lernte die Liebe kennen! Es war eine Liebe wie die von Romeo, ausgelöst durch einen schicksalhaften, betörenden Blick, eine dieser Leidenschaften, die in das Leben eines Menschen einfallen, es wie ein Orkan verheeren, dem Betroffenen jeden Willen, jede Vernunft und menschliche Rücksichtnahme rauben und ihn augenblicklich an den Abgrund bringen.
Eines Nachmittags, Pedro war gerade im Marrare, hatte er beobachtet, wie gegenüber, am Haus von Madame Levaillant, eine blaue Kalesche anhielt, in der ein alter Herr mit weißem Hut und eine blonde, in einen Kaschmirschal gehüllte Dame saßen.
Der kleine, untersetzte Mann mit dem schlohweißen, unter dem Kinn gestutzten Bart, dem sonnenverbrannten Gesicht eines ehemaligen Seefahrers und einem eher unbeholfenen Gebaren stützte sich beim Aussteigen schwer auf seinen Lakaien, als plagte ihn heftiges Rheuma. Dann trat er, ein Bein nachziehend, in den Hauseingang der Modistin, während die Dame langsam den Kopf umwandte und einen Augenblick zum Marrare hinübersah.
Unter den Röschen, die ihren schwarzen Hut zierten, wellten sich über der kurzen, klassischen Stirn sanft die blonden Haare, es war ein goldenes Blond, und die wunderschönen Augen ließen ihre ganze Erscheinung erstrahlen. Durch die Kälte wirkte ihre Marmorhaut noch blasser, und ihr ernstes Statuenprofil, die edel geformten Schultern und die vom Schal umhüllten Arme kamen Pedro in diesem Augenblick vor wie etwas Unsterbliches und Überirdisches.
Er kannte sie nicht. Doch am anderen Türpfosten lehnte rauchend und in gelangweilter Pose ein großer, schlanker junger Mann mit schwarzem Schnauzbart und schwarzer Kleidung, und der nahm, als er Pedros brennendes Interesse und den flammenden, verstörten Blick sah, mit dem er der den Chiado hinauftrottenden Kalesche nachblickte, seinen Arm und murmelte, dicht an seinem Ohr, mit tiefer, schleppender Stimme:
»Willst du wissen, wie sie heißt, mein lieber Pedro? Name, Herkunft, die wichtigsten Daten und Fakten? Und dafür spendierst du deinem Freund Alencar, deinem durstigen Alencar, eine Flasche Champagner?«
Der Champagner wurde serviert. Alencar strich sich mit den mageren Fingern über die gelockte Mähne und die Schnauzbartspitzen, lehnte sich zurück, zupfte seine Manschetten zurecht und begann:
»Eines goldenen Oktobernachmittags …«
»André«, rief Pedro, auf den Marmortisch hämmernd, dem Kellner zu, »nimm den Champagner wieder mit!«
Alencar brüllte, den Schauspieler Epifânio imitierend:
»Wie bitte? Ohne die Gier meiner Lippen zu befriedigen? …«
Nun denn, der Champagner sollte bleiben, doch Freund Alencar sollte vergessen, dass er der Dichter der Stimmen der Morgenröte war, und sich in einer verständlichen Christensprache zu diesen Leuten aus der blauen Kalesche äußern! …
»Das kommt doch noch, mein lieber Pedro, das kommt doch noch!«
Zwei Jahre zuvor, als Pedro gerade seine Mama verloren hatte, sei dieser alte Herr, Papa Monforte, eines Morgens in ebendieser Kalesche und mit ebendieser schönen Tochter neben sich in den Straßen und in der Gesellschaft Lissabons aufgetaucht. Niemand kannte sie. Sie hatten in Arroios den ersten Stock des Stadtschlösschens der Vargas gemietet, und die junge Dame tauchte fortan im São Carlos auf, wo sie großen Eindruck machte — einen Eindruck zum Aneurysmen auslösen, sagte Alencar! Wenn sie den großen Saal durchquerte, neigten sich sämtliche Schultern, so sehr blendete die Ausstrahlung dieser wundersamen Kreatur, die mit dem Schritt einer Göttin ihre Schleppe hinter sich herzog, stets ein Dekolleté wie in Galanächten trug und, obwohl unverheiratet, mit funkelnden Edelsteinen behangen war. Der Papa bot ihr nie den Arm: Er lief stets hinter ihr, in eine große weiße Hofmeisterhalsbinde gezwängt, und in dem blonden Schein, der von seiner Tochter ausging, wirkte er noch dunkler und seemännischer, schüchtern und fast verschreckt, in den Händen das Monokel, das Libretto, ein Tütchen Pralinen und seinen Regenschirm. Doch erst, wenn in der Loge das Licht auf ihre elfenbeinfarbene Brust und ihre goldenen Zöpfe fiel, wurde sie zur wahren Verkörperung des Renaissance-Ideals, zum Tizian-Modell … Er, Alencar, habe an dem Abend, als er sie zum ersten Mal sah, augenblicklich auf sie und die anderen Frauen, die ewigen Dunkelhaarigen, gezeigt und ausgerufen:
»Jungens, das ist wie ein neuer Golddukaten unter alten Patacos aus der Zeit Dom Joãos VI!«
Magalhães, dieser plumpe Pirat, habe diesen Ausspruch dann in einem Feuilleton des Português veröffentlicht. Doch er stamme von ihm, von Alencar!
Die jungen Männer begannen natürlich sofort, um das Schlösschen von Arroios herumzuschwänzeln. Doch niemals öffnete sich in diesem Haus ein Fenster. Über die befragten Bediensteten erfuhr man lediglich, dass das Fräulein Maria heiße und der Herr Manuel. Schließlich aber verriet eine Bedienstete, die man mit sechs Pintos weichgeklopft hatte, mehr: Der Herr sei schweigsam, zittere vor seiner Tochter und schlafe in einer Hängematte; die Senhora schlafe in einem Nest aus Seide, alles in Stahlblau gehalten, und lese den ganzen Tag nur Romane. Damit gab sich das neugierige Lissabon jedoch nicht zufrieden. Eine Untersuchung wurde angestellt, bei der man methodisch, geschickt und geduldig vorging … Er, Alencar, habe dabei mitgewirkt.
Und man brachte Horrordinge in Erfahrung. Papa Monforte stammte von den Azoren; in seiner Jugend hatte er sich wegen eines Streits, einer Messerstecherei mit tödlichem Ausgang, gezwungen gesehen, an Bord eines amerikanischen Zweimasters zu fliehen. Einige Zeit später traf ein gewisser Silva, Verwalter der Casa da Taveira, Monforte (dessen wirklicher Name Forte war) wieder; er hatte ihn auf den Azoren kennengelernt und studierte in Havanna den Tabakanbau, den die Taveiras auf den Azoren einführen wollten. Monforte drehte gerade in seinen Bastschuhen eine Runde am Kai, weil er sich nach New Orleans einschiffen wollte. Danach gab es eine dunkle Stelle in Monfortes Lebenslauf. Offensichtlich hatte er eine Zeitlang als Aufseher auf einer Plantage in Virginia gearbeitet … Und als er schließlich wieder auf der Bildfläche erschien, war er Kapitän des Zweimasters Nova Linda und hatte schwarze Sklaven geladen, die er nach Brasilien, Havanna und New Orleans brachte.
Er war den englischen Kreuzern entkommen und hatte mit der Haut der Afrikaner ein Vermögen gemacht; nun, da er reich und wohlhabend war, ging er ins São Carlos und lauschte der Musik von Corelli. Doch diese schreckliche, düstere und schlecht belegte Geschichte war immer noch hier und da unvollständig …
»Und die Tochter?«, fragte Pedro, der ihm ernst und blass zugehört hatte. Doch dazu konnte Freund Alencar nichts sagen. Wie kam er zu dieser so blonden Schönheit? Wer war ihre Mutter? Wo war sie? Wer hatte ihr beigebracht, sich mit dieser königlichen Eleganz in ihren Kaschmirschal zu hüllen? …
»Das, mein lieber Pedro, sind
Geheimnisse, die das schlaue Lissabon
Nie konnt’ ergründen
Und die nur Gott wird finden!«
Jedenfalls nahm die Begeisterung für die Monforte ab, nachdem Lissabon von dieser Geschichte mit dem Blut und den Sklaven erfahren hatte. Teufel nochmal! Eine Juno mit Mörderblut, Tizians beltà die Tochter eines Sklavenhändlers! Die Damen, für die es ein Genuss war, eine so blonde, so schöne, so juwelenschwere Frau zu verunglimpfen, nannten sie sofort die Sklavenhändlerin! Tauchte sie nun im Theater auf, verbarg Dona Maria da Gama ihr Gesicht hinter ihrem Fächer, weil sie glaubte, in der jungen Dame (vor allem, wenn sie ihre prächtigen Rubine trug) das Blut der Messerstiche ihres lieben Papas zu sehen! Sie wurde schrecklich verleumdet. Also verschwanden die Monfortes nach ihrem ersten Winter in Lissabon wieder. Danach wurde sogleich frohlockt, dass sie bankrott seien, dass der Alte von der Polizei verfolgt werde, tausenderlei perverse Gerüchte … Dabei genoss der gute Monforte, der an Gelenkrheuma litt, gerade in aller Seelenruhe die Heilwasser der Pyrenäen … Dort habe Melo die beiden kennengelernt …
»Ah! Der Melo kennt die beiden?«, rief Pedro aus.
»Ja, mein lieber Pedro, der Melo kennt sie.«
Kurz darauf verließ Pedro das Marrare; und an diesem Abend strich er, bevor er nach Hause aufbrach, trotz des kalten Nieselregens eine Stunde lang mit flammendem Herzen um das Vargas-Schlösschen, das dunkel und stumm dalag. Zwei Wochen später erlebte Alencar, als er nach dem ersten Akt des Barbier von Sevilla ins São Carlos kam, eine Überraschung: Pedro da Maia saß ganz vorn neben Maria in Monfortes Proszeniumsloge, an seinem Revers eine scharlachrote Kamelie, so rot wie die des Blumenstraußes auf der samtenen Brüstung.
Nie hatte Maria Monforte schöner ausgesehen. Sie trug eine dieser übertriebenen Theatergarderoben, die Lissabon beleidigten und die Damenwelt zu der Äußerung veranlassten, sie kleide sich wie eine Figur aus einem Lustspiel: Ein weizenfarbenes Seidenkleid, im geflochtenen Haar zwei gelbe Rosen und eine Ähre, auf der Brust und an den Armen Opale; und dieser Ton des reifen, von der Sonne verwöhnten Kornfelds, der mit dem Gold ihrer Haare verschmolz, ihre elfenbeinfarbene Haut erstrahlen ließ und sanft ihre Formen der Statue umspielte, verlieh ihr den Glanz einer Ceres. Im Hintergrund der Loge konnte man Melos großen blonden Schnurrbart erahnen. Melo plauderte im Stehen mit Papa Monforte, der sich wie immer in die dunkle Ecke der Loge zurückgezogen hatte.
Alencar beobachtete »den Fall« von der Loge der Gamas aus. Pedro war auf seinen Platz zurückgekehrt und blickte nun mit vor der Brust gekreuzten Armen zu Maria hinüber. Sie bewahrte sich noch eine Weile die Haltung der ungerührten Göttin, doch dann, beim Duett zwischen Rosina und Lindoro hefteten sich ihre blauen, tiefgründigen Augen zweimal ernst und anhaltend auf ihn. Alencar rannte mit rudernden Armen ins Marrare und verkündete lautstark die Neuigkeit.
Es dauerte im Übrigen nicht lang, bis man in ganz Lissabon von Pedro da Maias leidenschaftlicher Liebe für die Sklavenhändlerin sprach. Er machte ihr auch in aller Öffentlichkeit den Hof, ganz traditionell, indem er sich an einer Ecke vor dem Vargas-Schlösschen postierte und reglos und blass vor Ekstase auf ihr Fenster starrte.
Er schrieb ihr täglich zwei sechsseitige Briefe — wirre Gedichte, die er im Marrare verfasste. Und jeder dort wusste, für wen diese Seiten mit den sich überkreuzenden Zeilen bestimmt waren, die sich vor ihm auf dem Tablett mit dem Gin türmten. Wenn ein Freund am Café vorbeikam und nach Pedro da Maia fragte, antworteten die Kellner ganz selbstverständlich:
»Senhor Dom Pedro? Der schreibt gerade an das Fräulein.«
Und Pedro selbst reichte dem Freund, wenn dieser an seinen Tisch trat, die Hand und rief mit seinem schönen, offenen und strahlenden Lächeln aus:
»Warte kurz, mein Lieber, ich schreibe gerade an Maria!«
Afonso da Maias alte Freunde, die regelmäßig zu ihrer whist-Runde in Benfica zusammenkamen, und vor allem Vilaça, der Verwalter der Maias, dem der gute Leumund des Hauses sehr am Herzen lag, überbrachten Afonso alsbald die Kunde von diesem Liebesverhältnis seines Pedrinho. Afonso ahnte bereits etwas, hatte er doch beobachtet, wie jeden Tag ein Diener des Guts mit einem großen Strauß bester Kamelien aus dem Garten wiederkam. Und frühmorgens traf er im Flur regelmäßig den Kammerdiener an, der zum Zimmer des jungen Herrn unterwegs war und genussvoll das feine Parfum einatmete, das einem mit Goldlack versiegelten Brief entströmte. Und Afonso da Maia missfiel es keineswegs, dass sein Sohn durch ein starkes menschliches Gefühl aus diesem unsteten Leben der Leichtfertigkeit, des Spiels und der grundlosen Melancholie gerissen wurde, in dem wieder das schwarze Gebetbuch auftauchen würde …
Doch er kannte keinen Namen, wusste nicht einmal von der Existenz der Monfortes; und die Details, die seine Freunde ihm schließlich enthüllten, die Messerstecherei auf den Azoren, die Peitsche des Aufsehers von Virginia, der Zweimaster Nova Linda, diese ganze düstere Geschichte des alten Monforte missfielen Afonso da Maia zutiefst.
Eines Abends, als Oberst Sequeira beim whist erzählte, er habe Maria Monforte und Pedro beim Ausritt gesehen, beide strahlend und sehr distingués, sagte Afonso nach einem Augenblick des Schweigens mit verärgerter Miene:
»Nun ja, alle jungen Männer haben ihre Geliebten … Das ist doch üblich, und so ist das Leben, und es wäre absurd, das unterbinden zu wollen. Aber diese Frau mit einem solchen Vater erscheint mir selbst für eine Geliebte recht unpassend.«
Vilaça unterbrach das Kartenmischen, rückte seine Brille zurecht und rief überrascht aus:
»Geliebte! Aber die junge Dame ist doch ledig, gnädiger Herr, ist ein anständiges Fräulein! …«
Afonso da Maia stopfte seine Pfeife, seine Hände begannen zu zittern; und als er sich an den Verwalter wandte, zitterte seine Stimme ebenfalls ein wenig:
»Vilaça, Sie wollen doch nicht etwa andeuten, dass mein Sohn diese Kreatur womöglich heiraten will …«
Der andere verstummte. Stattdessen murmelte Sequeira:
»Nein, das nicht, das sicher nicht.«
Und das Spiel wurde eine Zeitlang schweigend fortgesetzt.
Doch fortan verspürte Afonso da Maia ein Unbehagen. Wochenlang erschien Pedro in Benfica nicht zum Abendessen. Wenn er ihn vormittags sah, kam er, einen Handschuh bereits übergestreift, strahlend und in Eile, die Treppe herunter, um zum Mittagessen auszugehen; er fragte den Diener, ob sein Pferd schon gesattelt sei, trank im Stehen einen Schluck Tee, fragte im Vorbeieilen, »ob der Papa etwas brauche«, strich sich vor dem großen venezianischen Spiegel über dem Kamin den Schnurrbart glatt und schwebte hinaus. Dann wieder kam er den ganzen Tag nicht aus seinem Zimmer: Der Abend brach an, die Lichter wurden angezündet, und der Vater ging schließlich beunruhigt nach oben und fand den Sohn lang ausgestreckt auf dem Bett vor, den Kopf zwischen den Armen vergraben.
»Was hast du?«, fragte er.
»Migräne«, antwortete Pedro mit dumpfer, heiserer Stimme.
Missmutig stieg Afonso die Treppe wieder hinab, da er hinter dieser hasenherzigen Mutlosigkeit einen nicht eingetroffenen Brief vermutete oder auch eine offerierte Rose, die sie sich nicht ins Haar gesteckt hatte …
Dann gab es zuweilen, zwischen zwei robbers oder beim Tee, Bemerkungen seiner Freunde, die ihn beunruhigten, zumal sie von Männern kamen, die in Lissabon wohnten und die Gerüchte kannten, während er sommers wie winters dort zwischen seinen Büchern und Rosen lebte. So erkundigte sich der geschätzte Sequeira zum Beispiel, warum Pedro nicht eine längere Bildungsreise unternehme, nach Deutschland oder in den Orient etwa. Oder es beklagte sich der alte Luís Runa, Afonsos Vetter, bei unverfänglichen Anlässen, dass die Zeiten, in denen der Polizeiintendant unliebsame Menschen nach eigenem Gutdünken aus Lissabon vertreiben konnte, leider vorbei seien … Es war klar, dass sie auf die Monforte anspielten, offensichtlich hielt man sie für gefährlich.
Im Sommer reiste Pedro nach Sintra; Afonso erfuhr, dass die Monfortes dort ein Haus gemietet hatten. Zwei Tage später tauchte ein äußerst beunruhigter Vilaça in Benfica auf: Am Vortag habe Pedro ihn in der Kanzlei aufgesucht und um Angaben zu seinen Besitztümern gebeten, hatte gefragt, wie er Geld abheben könne. Vilaça hatte ihm gesagt, im September, wenn er volljährig wäre, könne er über seinen Pflichtteil am Erbe der Mama verfügen …
»Aber das hat mir gar nicht gefallen, gnädiger Herr, das hat mir gar nicht gefallen …«
»Und warum nicht, Vilaça? Der Junge wird Geld brauchen, damit er dieser Kreatur Geschenke machen kann … Die Liebe ist ein teurer Luxus, Vilaça.«
»Ich hoffe bei Gott, dass es das ist, gnädiger Herr, möge Gott Sie erhören!«
Und dieses edelmütige Vertrauen Afonso da Maias in den Patrizierstolz und das Standesbewusstsein seines Sohnes beruhigte Vilaça schließlich wieder.
Einige Tage später bekam Afonso da Maia endlich Maria Monforte selbst zu Gesicht. Er hatte auf Sequeiras Landgut bei Queluz zu Abend gespeist, und sie tranken gerade auf der Aussichtsterrasse ihren Kaffee, als die blaue Kalesche mit den von Netzen geschmückten Pferden in den schmalen Weg an der Mauer einbog. Maria, die unter einem scharlachroten Schirm saß, trug ein rosafarbenes, rüschenbesetztes Kleid, dessen Reifrock fast gänzlich die Knie des neben ihr sitzenden Pedros bedeckte. Die vor der Brust zu einer großen Schleife gebundenen Hutbänder waren ebenfalls rosafarben. Und ihr Gesicht, so ernst und rein wie das einer griechischen Marmorstatue, sah wirklich bezaubernd aus mit diesen leuchtenden Augen inmitten all der Rosatöne. Auf dem Sitz gegenüber, der übersät war mit Schnittmustern der Modistin, saß in schlichten Baumwollhosen und mit einem großen Panamahut auf dem Kopf Monforte, in geduckter Haltung, den Umhang der Tochter überm Arm, den Sonnenschirm zwischen den Knien. Sie sprachen nicht und sahen auch nicht zu der Aussichtsterrasse herüber; sanft schaukelnd fuhr die Kalesche den schattigen Weg unter den Ästen entlang, und Marias Schirmchen streifte die Zweige. Sequeira verharrte reglos mit aufgerissenen Augen, die Kaffeetasse an den Lippen, und murmelte schließlich:
»Caramba! Die ist aber hübsch!«
Afonso antwortete nicht. Bekümmert blickte er dem scharlachroten Sonnenschirm nach, der sich nun über Pedro senkte, ihn fast versteckte und gänzlich einzuhüllen schien — wie ein großer Blutfleck, der sich unter dem tristen Grün der Zweige über die Kalesche legte.
Der Herbst verging, der Winter kam, eisig kalt. Eines Vormittags tauchte Pedro in der Bibliothek auf, in der sein Vater gerade am Kamin las. Er nahm seinen Segen entgegen, ließ kurz den Blick über eine aufgeschlagene Zeitung schweifen und wandte sich dann unvermittelt an seinen Vater:
»Vater«, sagte er, um klare und entschlossene Worte bemüht, »ich komme, weil ich Sie um die Erlaubnis bitten möchte, eine Dame namens Maria Monforte zu heiraten.«
Afonso legte das geöffnete Buch auf seinen Knien ab und sagte mit ernster, gemessener Stimme:
»Davon hast du mir nie etwas erzählt … Ich glaube, das ist die Tochter eines Mörders und Sklavenhändlers, und sie selbst wird auch Sklavenhändlerin genannt …«
»Vater! …«
Streng und unerbittlich richtete Afonso sich vor seinem Sohn auf, als verkörperte er selbst die Ehre des Hauses.
»Hast du mir noch mehr zu sagen? Du lässt mich ja vor Scham erröten.«
Pedro, der weißer war als das Taschentuch, das er in der Hand hielt, rief, am ganzen Körper zitternd, fast schluchzend aus:
»Ich werde sie heiraten, Vater, darauf können Sie sich verlassen!«
Er ging hinaus und knallte wütend die Tür zu. Im Flur rief er nach dem Diener, sehr laut, damit der Vater es hörte, und wies ihn an, seine Koffer ins Hotel Europa zu bringen.
Zwei Tage später kam Vilaça mit Tränen in den Augen nach Benfica und erzählte, der Junge habe an diesem Morgen geheiratet — und laut Sérgio, Monfortes Verwalter, wolle das Brautpaar nun nach Italien reisen.
Afonso da Maia hatte sich gerade an den neben dem Kamin gedeckten Mittagstisch gesetzt. Durch die Hitze des Feuers verlor ein Zweig in einer japanischen Vase auf dem Tisch gerade seine Blätter. Neben Pedros Besteck lag eine Ausgabe der Grinalda, des Lyrikjournals, das er immer bekam … Afonso hörte dem Verwalter ernst und stumm zu, während er langsam seine Serviette entfaltete.
»Haben Sie schon zu Mittag gegessen, Vilaça?«
Erstaunt über diese Gelassenheit stammelte der Verwalter:
»Ja, das habe ich, gnädiger Herr …«
Daraufhin deutete Afonso auf Pedros Gedeck und sagte zu dem Diener:
»Das Gedeck können Sie wegnehmen, Teixeira. Fortan gibt es nur noch ein Gedeck am Tisch … Setzen Sie sich doch, Vilaça, setzen Sie sich.«
Teixeira, der in dem Haus noch neu war, entfernte ungerührt das Gedeck des Jungen. Vilaça hatte sich gesetzt. Alles ringsum zeugte von Ordnung und Ruhe, wie an früheren Vormittagen, wenn er in Benfica zu Mittag gegessen hatte. Die Schritte des Dieners machten auf dem weichen Teppich kein Geräusch, das Feuer knisterte fröhlich vor sich hin und warf einen goldenen Schein auf das polierte Silber. Draußen glitzerten im winterlichen Blau die vereisten Äste in der sanften Sonne, und am Fenster stieß der Papagei, der gerne herumkrakelte und von Pedro abgerichtet worden war, Verwünschungen gegen die Cabralisten aus.
Schließlich stand Afonso auf. Er blickte eine Weile lang zerstreut auf den Gutshof und die Pfauen auf der Terrasse. Beim Verlassen des Zimmers nahm er Vilaças Arm und stützte sich fest darauf, als überkäme ihn gerade der erste Altersschwindel, als spürte er in seiner Verlassenheit in Vilaça einen sicheren Freund. Schweigend gingen sie den Flur entlang. In der Bibliothek ließ Afonso sich in seinem Sessel am Fenster nieder und stopfte bedächtig seine Pfeife. Vilaça wandelte gesenkten Kopfes an den hohen Regalen entlang, auf Zehenspitzen, wie in einem Krankenzimmer. Ein Spatzenschwarm lärmte einen Augenblick lang in den Zweigen eines hohen Baums neben der Terrasse. Dann war es still, bis Afonso da Maia sagte:
»Nun, Vilaça, Saldanha ist also vom König entlassen worden …«
Der andere antwortete vage und mechanisch:
»So ist es, gnädiger Herr, so ist es …«
Und über Pedro da Maia wurde nicht mehr gesprochen.
II
Indessen reisten Pedro und Maria in märchenhafter Glückseligkeit südwärts durch Italien, in kleinen Tagesetappen und von Stadt zu Stadt, auf jenem geheiligten Wege, der von den Blumen- und Kornfeldern der lombardischen Ebene bis nach Neapel führt, dem sanften Ort der Romanzen, weiß unter blauem Himmel. Dort beabsichtigten sie den Winter zu verbringen, in dieser stets lauen Luft, an dem stets ruhigen Meer, wo der Müßiggang der Flitterwochen auf sanfte Weise fortgeführt werden konnte … Doch eines Tages, sie waren gerade in Rom, verspürte Maria Lust auf Paris. Sie war es leid, in der schaukelnden Kutsche zu reisen, nur um am Ende Makkaroni verschlingende lazzaroni vor sich zu sehen. Wie viel besser wäre es doch, in einem weich gepolsterten Nest in den Champs Élysées zu wohnen und dort einen schönen Liebeswinter zu verbringen! Paris war doch inzwischen sicher, unter dem Prinzen Louis-Napoléon … Außerdem langweilte sie dieses alte klassische Italien bereits: Der ewige Marmor und die ewigen madonas machten ihren armen Kopf schon ganz schwindlig (wie sie schmachtend, an Pedros Hals hängend, sagte)! Sie sehnte sich nach einem guten Modesalon, nach den Gaslaternen, einem lauten boulevard … Und schließlich machte ihr dieses Italien, wo alle Welt nur konspirierte, Angst.
Sie fuhren nach Frankreich.
Doch am Ende missfiel Maria auch dieses weiterhin aufgewühlte Paris, wo in den Straßen noch ein vager Pulvergeruch zu hängen schien, wo jedem Gesicht noch die Hitze der Schlacht anhaftete. Nachts wurde sie von der Marseillaise geweckt, die Polizisten hatten für sie ein wildes Äußeres, alles wirkte immer noch trist; und aus Angst vor den Arbeitern, diesem unersättlichen Lumpenpack, wagten sich die Herzoginnen, diese armen Engel, noch nicht in den Bois! Letztendlich blieben sie bis zum Frühjahr dort — in dem Nest, das sie sich erträumt hatte, gänzlich aus blauem Samt, mit Blick auf die Champs-Élysées.
Dann wurde erneut von Revolution gesprochen, von einem Staatsstreich. Marias unverständliche Bewunderung für die neuen Uniformen der Garde Mobile machte Pedro nervös. Und als sie schwanger wurde, erwachte in Pedro das Bedürfnis, sie aus diesem kämpferischen, faszinierenden Paris fortzuschaffen in die Geborgenheit des friedlich in der Sonne schlummernden Lissabons.
Bevor sie losfuhren, schrieb er jedoch seinem Vater.
Maria hatte ihm dazu geraten, fast war es eine Forderung gewesen. Afonso da Maias Ablehnung hatte sie anfangs verzweifeln lassen. Es war nicht der Bruch mit der Familie, der sie bekümmerte, eher war es die Tatsache, dass dieses schimpfliche Nein jenes tugendhaften Edelmanns ganz öffentlich, ganz brutal ihre zweifelhafte Herkunft festgeschrieben hatte! Sie hasste den Alten. Und sie hatte die Hochzeit, die triumphale Abreise nach Italien beschleunigt, um ihm deutlich zu machen, dass Genealogien, gotische Vorfahren und Familienehre nichts zählten gegen ihre nackten Arme … Nun jedoch, da sie nach Lissabon zurückkehren, dort soirées veranstalten, sich einen Hofstaat aufbauen wollte, wurde die Versöhnung unabdingbar; dieser zurückgezogen in Benfica lebende Vater mit dem gestrengen, aus anderen Zeiten stammenden Stolz würde sie sonst, selbst in ihren eigenen luxuriösen vier Wänden, permanent an den mit Sklaven beladenen Zweimaster Nova Linda erinnern … Und sie wollte sich in Lissabon am Arm dieses noblen Schwiegervaters zeigen, der so schmuckvoll war wie sein an den Vizekönig erinnernder Bart.
»Schreib ihm, dass ich ihn bereits verehre«, murmelte sie, während sie sich über Pedros Schreibtisch beugte und ihm zärtlich durchs Haar fuhr. »Schreib ihm, dass ich unser Kind, wenn es ein Junge wird, nach ihm benennen werde … Schreib ihm einen schönen Brief, ja?«