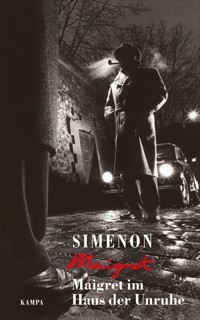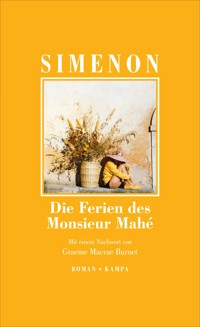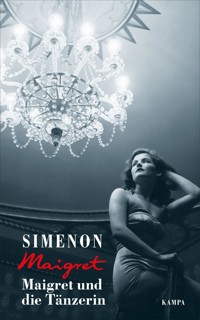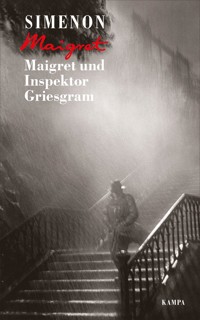10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die großen Romane
- Sprache: Deutsch
Ein Fischerdorf in der Normandie: Nach dem Tod ihres Vaters beschließt die 17-jährige Marie, anders als ihre Geschwister in Port-en-Bessin zu bleiben und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Als Serviererin im Café de la Marine verzaubert die spröde Schönheit nicht nur ihren Geliebten Marcel, sondern zieht auch bald den Liebhaber ihrer Schwester in den Bann, doppelt so alt wie Marie. Eifersüchtig beäugt Marcel die beiden. Zunächst zeigt Marie dem Café- und Kinobetreiber die kalte Schulter, doch sie bleibt nicht lange unempfänglich für das Werben des unwahrscheinlichen Verehrers ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Georges Simenon
Die Marie vom Hafen
Die großen Romane – Band 31
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
Mit einem Nachwort von Christian Seiler
Hoffmann und Campe
1
Es war Dienstag, und die fünf oder sechs Kutter, die während der ganzen Woche vor der englischen Küste fischten, waren am Morgen zurückgekommen. Wie gewohnt hatten sie in der Nähe des Fischmarkts im Vorhafen festgemacht, und erst jetzt, bei Flut, öffnete man ihnen die Drehbrücke.
Der Oktober ließ die Tage schneller schwinden, und seine Nipptiden bespülten kaum den Fuß der Klippen. Der Kanal war auf Höhe der Brücke verengt durch die niedrigen Häuser von Port-en-Bessin mit ihren grauen Fassaden und den harten Schieferdächern.
Wie immer um diese Zeit waren die Alten zur Stelle und umrahmten die Brücke mit ihren blauen, mit dunkleren Flicken besetzten Silhouetten.
Es regnete nicht. Ein leichter Wind wehte von Nordosten, der Himmel war gleichmäßig grau.
Eins nach dem anderen fuhren die großen Holzschiffe dicht am Kai, ja scheinbar dicht an den Häusern entlang, um sich ganz hinten im Hafenbecken zusammenzudrängen. Die Männer standen reglos und geduldig an Deck. Sie schauten zu den Alten an Land. Die Alten schauten zu ihnen hinüber. Sie waren Väter, Söhne oder Cousins, aber vor lauter Verwandtschaft hatten sie sich nichts zu sagen und nickten einander nicht einmal zu.
Auch Frauen waren da, schwarz in ihren Umschlagtüchern, lackierte Holzschuhe an den Füßen, und liefen wie Ameisen hintereinander her in die kleinen Läden, wo gerade die Lampen angingen.
Man hörte die Kugeln auf dem Billardtisch des Café de la Marine klappern, und das gelbe Licht der Markise war voller Verheißung von Kaffee mit einem Schuss Calvados.
Es blieb noch eine knappe Stunde Tageslicht und Dämmerung; die Brücke war wieder geschlossen, die Schiffe vertäut, die Alten standen wieder reglos an ihrem Platz, ans Geländer gelehnt, es wurde noch etwas gearbeitet, Ordnung geschaffen, Leinen wurden aufgeschossen, Luken und Klappen geschlossen.
Neben den wuchtigen Kuttern bildeten die Schaluppen eine dichtere, beweglichere Masse, in der hier und da ein Mann ein Netz flickte, an seinem Motor bastelte oder manchmal einfach nur seine Pfeife rauchte, zufrieden, an Bord seines Schiffs zu sein.
Der dicke Charles mit seinem Holzbein kletterte über die Reling. Der Großvater folgte ihm ruhig, fast feierlich. Charles hielt jedem Fischer ein nicht sehr sauberes Blatt Papier und einen Kopierstiftstummel hin. Er wusste, wer lesen konnte und wer nicht. Zu denen, die es nicht konnten, sagte er nur: »Für die Marie vom armen Jules …«
Man zündet die Lampen immer zu früh an. Sie brannten, obwohl der Himmel noch weiß war, sodass sie nur ein trauriges Licht geben konnten.
»Wie viel gibt man denn?«, wurde meistens gefragt.
»Nach deinem Gutdünken … Louis hat zwanzig Franc gegeben … Manche zwei und manche fünf …«
»Trag mich mit fünf Franc ein …«
Der Großvater folgte unbewegt, wie ein Ministrant. Man hatte ihm gesagt, sie müssten zu zweit sein, damit niemand Schwindeleien unterstellen konnte.
»Wenn noch jemand zum Tragen gebraucht wird …«, wurde auch gesagt.
Es handelte sich um Jules, der am nächsten Morgen beerdigt wurde. Er war noch da, in seinem Haus am Fuß der Klippe, wo Licht brannte und alte Frauen ein und aus gingen.
Der dicke Charles zog sein Holzbein nach. Großvater folgte. Sie kamen zur Brücke zurück und streckten ihr Blatt Papier jetzt den Alten hin, die Invalidenrente bezogen.
»Für die Marie vom armen Jules …«
Und während die Männer, da sie nichts Besseres zu tun hatten, einer nach dem anderen in die Cafés traten, sich an die lackierten Tische setzten und die Beine ausstreckten, senkte sich endlich sanft die Nacht.
Es war, als gäbe es weder Morgen noch Mittag noch Abend, denn alles lag im selben Quadersteingrau da, alles außer den weißen Schaumschäfchen auf dem Meer und den schwarzen, harten Schieferdächern, die wie mit Tinte auf Glanzpapier gezeichnet wirkten.
Schwarz waren auch die Leute, allesamt, die Männer, die Frauen und die Kinder. Schwarz und steif, ungelenk in ihren guten Kleidern, wie sonntags.
Der Trauerzug hatte die Drehbrücke überquert; es waren vier Kapitäne, die den Sarg trugen, vier Kapitäne mit weißen Baumwollhänden an den langen Armen. Alle hatten bemerkt, dass gleich dahinter, neben der Marie mit einem ihrer Brüder an der Hand, die älteste Tochter Odile ging, die am Morgen aus Cherbourg gekommen war, wo sie ein loses Leben führte.
Man hatte auch bemerkt, dass sie nicht mit dem Bus gekommen war, sondern in einem Auto, mit einem Mann, der sicher ihr Liebhaber war. Als der Trauerzug an dem Auto vorbeikam, drehte man den Kopf zur Seite, um es in Augenschein zu nehmen, dann drehte man ihn noch etwas weiter, um den Fremden zu betrachten, der mit dem Hut in der Hand vor dem Eingang des Café de la Marine stand.
Der Zug schritt langsam voran. Er hielt zweimal an, um die weiß behandschuhten Träger abzulösen. Die Glocken klangen über den leeren Straßen, und nur der Fremde blieb im Café, während alle anderen in der Kirche und auf dem Friedhof waren, sogar der Gastwirt.
Der Mann kam nicht aus der Gegend, das sah man, sondern aus der Stadt. Er nannte die Serviererin Kleines, obwohl sie Mutter von fünf Kindern war, und er ging ungeniert in die Küche, wo die Wirtin persönlich arbeitete.
»Sagen Sie, Mutti, was könnten Sie mir denn zum Mittagessen machen?«
Worauf diese, die Vertraulichkeiten nicht schätzte, antwortete: »Sie bleiben also zum Mittagessen?«
Er schaute in die Kochtöpfe, er schnitt sich sogar eine Scheibe Kuttelwurst ab und wischte sich an der Schürze der Wirtin die Finger ab.
»Versuchen Sie mir doch eine schöne dicke Seezunge aufzutreiben, mit viel Muscheln und Krabben …«
»Die Seezungen standen heute früh bei dreißig Franc das Kilo …«
»Na und?«
Er mochte vielleicht nicht unsympathisch sein, aber er gab sich allzu vertraulich, mit einem gewissen Ausdruck, als mache er sich über alles und jeden lustig. Er bildete sich wohl ein, dass ihm die Welt gehörte, dass die Leute von Port-en-Bessin allesamt seine Dienstboten waren!
Die Hände in den Taschen, spazierte er über den Kai, dann die Hafenmole entlang. Er konnte den Trauerzug sehen, der sich wie eine schwarze Raupe von der Kirche zum Friedhof ausdehnte, und die Luft füllte sich erneut mit unsichtbaren Glocken.
Er ging wieder hinein, wie er hinausgegangen war, trat hinter den Tresen und roch an den Flaschen, ohne die wütenden Blicke der Serviererin zu beachten.
»Decken Sie mir den Tisch am Fenster …«
Die Serviererin, die wie alle anderen geweint hatte, als der Trauerzug vorbeigekommen war, hatte noch eine rote Nase. Es war niemandem entgangen, dass keine einzige Schaluppe ausgelaufen war, was bewies, wie sehr man die Familie Le Flem schätzte. Und oben auf dem Hügel lagen jetzt dreimal mehr Blumen, als nötig waren, um das lehmige Grab zu bedecken.
Erst um elf Uhr füllten sich die Cafés mit Männern im Sonntagsanzug, die noch mehrere Minuten lang ihr ernstes Beerdigungsgesicht beibehielten.
Dann begann man nach und nach, von diesem und jenem zu reden, von Odile, die in vollem Trauerstaat aus Cherbourg gekommen, unter dem Schleier jedoch geschminkt war wie eine Schauspielerin, von der Marie, die aussah wie fünfzehn in ihrem kleinen schwarzen Kostüm, das sie sich zwei Jahre zuvor beim Tod ihrer Mutter hatte nähen lassen; man redete von den beiden Familien, die mit dem Pferdewagen gekommen waren, den Boussus und den Pincemins, Landwirte aus der Nähe von Mayeux, die über die Frauen mit dem armen Jules verwandt waren.
Die Wagen mit den hohen Rädern und dem braunen Verdeck standen neben der Drehbrücke, denn die Straße, in der die Le Flems wohnten, war zu schmal und zu steil.
Sie lag gleich hinter der Brücke. Ihre zehn Häuser standen eher übereinander als nebeneinander. Das Pflaster war holprig, ein Rinnsal von Waschlauge lief ewig den Hang hinab, jahrein, jahraus hingen Hosen und Fischerhemden zum Trocknen auf Drahtleinen.
Oberhalb der Straße trat man aus der Stadt heraus, auf die endlosen Wiesen, steil darunter das Meer.
Marie bediente und putzte sich dabei hin und wieder die Nase, doch wie Tante Mathilde – die Tante Pincemin aus Pré-aux-Bœufs – bemerkte, hatte man sie den ganzen Morgen nicht weinen sehen.
Odile dagegen, mit der niemand sprach und an der alle geflissentlich vorbeischauten, war zweimal in Tränen ausgebrochen, einmal in der Kirche, als der Priester Weihwasser auf den Sarg gesprengt hatte, ein zweites Mal auf dem Friedhof, beim Geräusch der ersten Schaufel Erde, die ins Grab fiel. Sie hatte so laut geweint, mit so herzzerreißenden Schluchzern, dass es, wäre sie kein gefallenes Mädchen gewesen, zwei Frauen gebraucht hätte, um sie zu stützen.
Marie putzte sich lediglich die Nase, mit ihrer Art, niemanden anzusehen, immer ins Leere zu schauen und die Lider zu senken, sobald man sie beobachtete.
Dabei hatte sie getan, was zu tun war: Es gab einen guten Fleischeintopf, den eine Nachbarin während der Beerdigung beaufsichtigt hatte, und der Bäcker war gerade mit dem Braten gekommen, den man ihm zum Garen gegeben hatte.
Die beiden Schwager legten jenen Ernst an den Tag, der sich geziemt, wenn man Verantwortung trägt. Pincemin zog hin und wieder an seinem langen blonden Schnurrbart, der nicht dicht genug wuchs, um ihm das Aussehen eines Galliers zu verleihen, und seine Wangen waren so merkwürdig rosa gefärbt, dass viele dachten, er sei schwindsüchtig.
»Ich will mich gerne des Älteren annehmen«, erklärte er und blickte mit seinen blauen Augen auf Joseph.
Denn abgesehen von Odile, von der hier nicht die Rede war, und der Marie, die groß genug war, um allein zurechtzukommen, waren noch drei Kinder übrig.
Joseph war dreizehn, er hatte eckige Knie und einen argwöhnischen Blick, vor allem wenn sein Onkel Pincemin ihn nachdenklich anstarrte.
»Ich will nicht auf einen Hof!«, protestierte er.
Und er schob seinen Teller voll gräulichem Eintopf weg.
»Du gehst dahin, wo man dich haben will!«, erwiderte unmissverständlich die Tante, die wusste, was sich gehörte.
Es gab keine Tischdecke. Man aß auf dem braunen Wachstuch, das die Marie schon immer auf dem Tisch hatte liegen sehen, und da das Zimmer nicht groß war, hatte man die Tür zur Straße hin offen stehen lassen.
»Sieh mal, Félix, ich will dir etwas sagen«, meinte Boussus, nachdem er sich den Mund abgewischt hatte, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. »Du nimmst also Joseph, sagst du! Wohlan! Du hast mehr Land als ich, und wir sind es gewohnt, auf dich zu hören. Aber wenn du Joseph nimmst, der schon groß und stark ist, und ich Hubert mit seinen acht Jahren, dann ist es nur recht, wenn du die Schnecke dazunimmst! Das wollte ich gesagt haben …«
Und zufrieden, so gut gesprochen zu haben, drehte er sich zu seiner Frau um.
Der betreffende Hubert war ein Junge mit einem großen Kopf auf einem mageren Hals, der sie einen nach dem anderen musterte, ohne zu begreifen, was vor sich ging. Und die Schnecke war die Letztgeborene, ein vierjähriges Mädchen, dick und gleichmütig, das Gesicht immer mit Rotz und Essen verschmiert.
»Man muss die Dinge gerecht regeln«, verhandelten die beiden Schwager. »Bis Hubert eine Hilfe ist …«
Es war auch die Rede von Schulabschlüssen. Marie aß im Stehen, so wie sie es ihre Mutter immer hatte tun sehen, so wie die Frauen essen müssen, die alle anderen zu bedienen haben. Sie hatte ihre Schürze über das schwarze Kleid gezogen, und niemand hätte sagen können, was sie dachte.
»Und du, Geheimniskrämerin, du tätest am besten daran, dir in der Stadt eine Stellung zu suchen, bei anständigen Leuten.«
Man nannte sie schon lange die Geheimniskrämerin, aber das war ihr gleichgültig. Sie hatte keine Angst vor ihren Onkeln und auch vor ihrer Tante Mathilde nicht, wenngleich sie die Schwester ihrer Mutter war.
»Hörst du, was man dir sagt?«
Natürlich hörte sie! Aber wozu antworten, wenn sie sich doch so oder so aufregen würden?
»Kannst du nicht den Mund aufmachen, wo wir uns alle um dich sorgen?«
»Ich bleib in Port!«
»Was willst du denn in einem Loch wie Port-en-Bessin? Hier wirst du nicht mal eine Stellung finden …«
»Ich hab schon eine.«
»Wo denn?«
»Im Café de la Marine.«
»In einem Café willst du arbeiten? Um wie deine Schwester zu enden?«
Das sagte man vor Odile, der es nicht mal in den Sinn kam, gekränkt zu sein. Odile aß und hörte ihnen zu, leidend, aber mehr, weil sie sich auf dem Friedhof erkältet hatte, als aus anderen Gründen.
Niemand hatte sie gebeten, zum Mittagessen zu bleiben. Sie legte auch keinen Wert darauf, aber sie war doch geblieben, denn sie meinte, so müsse es sein. Hubert war am Anfang von ihren rotlackierten Fingernägeln gebannt gewesen, jetzt aber war er schon daran gewöhnt, und vor allem hatte er so viel gegessen, dass er reglos, mit hochrotem Kopf dasaß und vor sich hin träumte.
Er wusste, dass von ihm, der Schnecke und Joseph die Rede gewesen war, aber er hatte nicht mitbekommen, was man genau beschlossen hatte, und wartete auf den Apfelkuchen, der, weil es keinen anderen Platz gab, auf dem Bett stand.
Im Café de la Marine hatte Chatelard am Fenster seine Seezunge verspeist und danach, um sich die Zeit zu vertreiben, allein Billard gespielt, denn die anderen waren jetzt beim Mittagessen. Schließlich war er in die Küche gegangen, wo der Wirt mit der Wirtin aß, und hatte sich ungeniert rittlings auf einen Stuhl mit Strohgeflecht gesetzt.
»Lassen Sie sich nicht stören! Sagen Sie, meinen Sie, das Essen da oben wird lange dauern?«
»Sicher bis um drei«, behauptete der Wirt, der es nicht leiden konnte, wenn die Gäste ihm beim Essen zuschauten.
»Was wird denn jetzt aus der Kleinen werden?«
»Aus der Marie? Die fängt heute Abend hier an. Sie hat selbst darum gebeten …«
»Wie viel geben Sie ihr?«
»Hundert Franc im Monat, Kost und Logis und die Trinkgelder.«
»Muss sie saubermachen?«
»Saubermachen und alles Übrige … Die andere Serviererin geht, weil sie schon wieder schwanger ist.«
»Ich würde sie gern zu mir nehmen«, meinte Chatelard.
»Wen?«
»Die Marie natürlich! Nicht die andere … Kennen Sie nicht das Café Chatelard, in Cherbourg, am Kai?«
»Das sind Sie?«
»Ja, das bin ich … Sagen Sie mal, läuft der Laden hier einigermaßen?«
Er benahm sich jetzt ganz wie zu Hause, fachsimpelte und bediente sich direkt aus der Kaffeekanne, die auf dem Herd stand.
»Ich kenne sie nicht … Ich habe sie nur vorhin im Trauerzug vorbeigehen sehen … Sie sieht ihrer Schwester nicht ähnlich, wie?«
Er kam auf die Marie zurück, die tatsächlich ganz anders war als ihre Schwester. Odile war rundlich, hatte zarte, rosige Haut, große Kinderaugen und wirkte unterwürfig und fügsam. Sie errötete oder weinte wegen jeder Kleinigkeit und tat alles, um es jedem recht zu machen.
Ihre Schwester, die noch kaum entwickelt war, der Busen fast flach, die Hüften schmal und der Bauch gewölbt, das Haar immer ungekämmt und strähnig, scherte sich nicht um die Leute und noch weniger darum, ihnen Freude zu bereiten. Sie sah sie von der Seite an. Sicher dachte sie sich ihren Teil, behielt ihn jedoch für sich.
»Der arme Jules war ein anständiger Mann … Er hat alles aufgebraucht, was er hatte, um seine Frau zu pflegen, die fünf Jahre lang dahingesiecht ist, wie man so sagt, das Haus dauernd voller Ärzte, und die sündhaft teuren Operationen …«
Chatelard war nicht da, um sich in Mitleid zu ergehen. Hin und wieder stellte er sich ans Fenster und schaute zur Drehbrücke hinüber, zu den beiden Pferdewagen und der Gasse, in der das Essen sich in die Länge zog.
An der Wand, neben den Billardqueues, verkündete ein rosafarbenes Plakat: Öffentliche Versteigerung eines motorisierten Fischkutters …
Und da er immer überall seine Nase hineinstecken musste, fragte er den Wirt: »Was ist denn das für ein Schiff?«
»Das da um zwei Uhr versteigert wird? Nun, es wäre kein schlechtes Schiff, wenn ihm nicht ein Unglück nach dem anderen passieren würde …«
»Was für Unglücke?«
»Unglücke eben! Alle, die einem Schiff nur zustoßen können … Letzten Monat, nur zwei Tage nachdem sich seine Netze auf dem Meeresgrund verhakt hatten, sollte es an einem Abend ausfahren, an dem es dunkler war als sonst … Der Steuermann, der vielleicht ein bisschen getrunken hatte, hat geglaubt, die Drehbrücke sei offen, und ist in sie hineingefahren … Der Mast ist gebrochen und hätte beinahe einen Mann erschlagen … Vor einem halben Jahr hat beim Hochziehen des Schleppnetzes ein Stahlseil einem Schiffsjungen das Bein abgerissen …«
Oben im Haus lief das Gespräch zum Ende des Essens langsamer, schwerfälliger dahin, die beiden Schwager erörterten eine komplizierte Viehgeschichte, während den Kindern die Augen zufielen. Die Marie hatte den Calvados-Krug auf den Tisch gestellt, ohne sich zu setzen, als ihre Schwester ihr durch Zeichen zu verstehen gab, sie solle ihr in ihr früheres Zimmer folgen.
»Hör zu, Marie … Du weißt doch, dass ich nie jemandem etwas zuleide getan habe … Sie haben alle etwas gegen mich, weil ich einen Freund habe, aber sie bilden sich sonst was ein. An deiner Stelle würde ich nach Cherbourg kommen. Ich rede mit Chatelard, ich bin mir sicher, dass …«
Es war für Port-en-Bessin wirklich ein außergewöhnlicher Tag, einer, der aus dem Kalender fiel. Er war sogar außergewöhnlicher als ein Sonntag, als Pfingsten oder Allerheiligen. Zuerst war da die Beerdigung des armen Jules gewesen, das gab es nicht oft, vor allem mit lauter Fischereikapitänen, die den Sarg den ganzen Weg trugen.
Und jetzt standen alle auf dem Kai, neben der Jeanne, deren Mast nicht repariert worden war. Man trug noch die guten Kleider vom Morgen und die Schuhe mit Gummiband. Wenn man schon nicht arbeitete, konnte man weiter eine Runde Calvados nach der anderen trinken, sodass man ein bisschen lauter redete als sonst und das Gefühl hatte, wesentliche Fragen zu verhandeln.
Zwei Autos hatten die Herren aus Bayeux hergebracht, den Notar und seinen ersten Gehilfen sowie die Gläubiger von Marcel Viau, der als Einziger nicht im Sonntagsstaat erschienen war.
Die Leute aus Bayeux waren sich zu fein, in eines der Cafés am Kai zu gehen, und bildeten neben dem Kutter eine gesonderte Gruppe. Sie warteten, bis es Zeit war. Sie unterhielten sich über ihre Angelegenheiten, während Viau, ein großer blonder Mann, dessen verwaschene Augen alles Unglück der Welt widerzuspiegeln schienen, traurig und argwöhnisch von Gruppe zu Gruppe ging.
Was konnte man ihm sagen? Man schüttelte ihm die Hand. Man sagte ohne rechte Überzeugung: »Es wird schon keiner kaufen wollen …«
Aber es war schwieriger, für Viau ein paar anteilnehmende Worte zu finden, als den Verwandten des armen Jules, der tot war, sein Beileid auszusprechen.
Denn Viau war nicht tot! Er war da! Und das war viel trauriger, viel peinlicher!
Für die Marie hatte man immerhin eine Spendensammlung organisieren können, und sofern man entsprechend seinen Verhältnissen seinen Teil beigesteuert hatte, fühlte man sich mit seinem Gewissen im Reinen.
Aber man konnte doch keine Sammlung für einen Schiffseigner organisieren, nur weil er kein Glück gehabt hatte!
Denn das war es. Viau hatte einfach nie Glück gehabt. Nachdem er sein Schiff gekauft hatte, mit Hilfe eines Kredits, hatte er gemeint, sich aufspielen zu können. Er tat geradeso, als wären alle, die mit der Grundfischerei kein Geld verdienten, entweder Stümper oder Faulpelze.
Doch erst einmal hatte er Probleme mit den Raten bekommen, dann mit den Versicherungen, weil er einmal einen Alten mitgenommen hatte, der nicht in der Musterrolle eingetragen war, und ein anderes Mal hatte er sein Steuer verloren und sich nach England abschleppen lassen müssen, wo man Unsummen von ihm verlangt hatte …
»Du hättest dich nie selbstständig machen sollen!«, sagte man ihm. »Du bist nicht dafür geschaffen. Du hast nicht einmal etwas gelernt …«
Er hatte sich fünf Jahre lang stur gestellt, doch jetzt gab es ein Gerichtsurteil, und die Jeanne wurde verkauft.
»Meine Herren, es ist zwei Uhr!«, verkündete der Notar.
Man lachte. Es war Ebbe. Um an Bord zu gelangen, musste man eine rutschige Leiter hinabsteigen und fast einen Meter über den Schlick springen. Der Notar war durch seine Lederaktentasche und seinen Überzieher behindert, außerdem drohte seine Melone davonzufliegen.
Man half ihm. Schließlich schaffte er es, und die einen gingen an Deck, die anderen blieben am Rand des Kais stehen, so ernst wie am Morgen während des Totenamts.
Zuerst wurde ein Text verlesen, den niemand verstand. Dann eine Zahl.
»Ausrufpreis zweihunderttausend Franc. Ich wiederhole, zweihunderttausend Franc …«
Blicke gingen hin und her, von Gruppe zu Gruppe. Man wusste, dass niemand aus der Gegend bieten würde, erstens weil es sich um Viau handelte, der ein guter Kerl war, dann weil man mit den Schiffen sowieso schon genug Sorgen hatte.
Man versuchte zu erkennen, ob nicht vielleicht jemand aus Caen gekommen war, oder aus Honfleur oder sogar aus Fécamp, wie manche angekündigt hatten.
»Ich sagte, zweihunderttausend Franc …«
Auch der Notar schaute nacheinander in die strengen Gesichter um ihn herum, vielleicht erahnte er in den Blicken eine gewisse Ironie?
Viau weinte. Es war das erste Mal, dass man ihn weinen sah. Er stand hinter allen anderen und weinte, ohne zu versuchen, sein Gesicht zu verbergen.
»Zweihunderttausend … Niemand bietet zweihunderttausend? Meine Herren, machen Sie ein Angebot …«
Ein Witzbold rief: »Zehntausend!«
Gelächter brandete auf.
»Zweihunderttausend … Hundertneunzigtausend … Hundertachtzigtausend …«
Die Frauen in Schwarz standen etwas abseits, denn sie waren hier nicht an ihrem Platz, aber sie verstanden sehr wohl, was vor sich ging. Kinder drängten sich zwischen den Beinen durch und wurden beiseitegeschoben.
»Ich sagte, hundertachtzigtausend …«
Allein der Motor hatte fünf Jahre zuvor dreihunderttausend Franc gekostet.
»Zum Ersten …! Zum Zweiten …«
Es war fast noch trostloser als auf dem Friedhof, zumal man den abgebrochenen Mast der Jeanne quer über das Schiff gelegt hatte. Man drehte sich nach Viau um. Man freute sich zu sehen, dass der Hauptgläubiger erblasst war und dem Notar etwas ins Ohr flüsterte.
Inzwischen hatte die Flut eingesetzt. Das Wasser stieg und strömte ins Hafenbecken hinein, und die Möwen jagten kreischend den Abfällen nach, die an der Oberfläche trieben.
Der Gläubiger wurde als Erster auf einen Mann in der Menge aufmerksam und beugte sich zum Notar hinüber. Dieser schaute suchend umher, deutete auf jemanden.
»Hundertachtzigtausend, da drüben …«
Alle Köpfe wandten sich um. Schließlich entdeckte man Chatelard, der seine Nebenmänner beiseiteschob, um in die erste Reihe zu gelangen.
»Hundertachtzigtausend … Bietet niemand mehr …? Zum Ersten …«
Der Notar sah den Gläubiger fragend an, dieser nickte.
»… Zum Zweiten …! Zum Dritten …! Zuschlag!«
Es war wie eine Erlösung. Man konnte sich wieder rühren, herumlaufen, laut reden. Alle kreisten um Chatelard, der an Bord kletterte wie einer, der Eisenleitern gewohnt ist, und auf den Notar zutrat. Er zog eine Brieftasche aus der Jacke, holte Papiere hervor, während drei Männer versuchten, Viau in die Kneipe mitzuschleifen.
»Lass doch …! Das ist niemand aus der Gegend …! Und er ist kein Kapitän … Vielleicht heuert er dich ja an?«
Das kleine Grüppchen unterhielt sich an Deck. Die anderen Gruppen standen lockerer zusammen, und so konnte Odile sich vorschlängeln, immer noch in vollem Trauerstaat, den Kreppschleier zurückgeschlagen.
»Pssstt …!«, zischte sie, über den Schlick des Beckens gebeugt.
Chatelard sah sie nicht. Der Notar machte ihn auf sie aufmerksam.
»Ich bin da …!«, sagte sie, als sei das unbemerkt geblieben.
»Nun, dann bleib, wo du bist!«, meinte Chatelard, kehrte ihr den Rücken zu und setzte seine Unterhaltung fort.
Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie stand eine Weile da, inmitten der Leute, die sie ansahen, aber nicht mit ihr redeten. Schließlich ging sie zurück zum Auto, wagte jedoch nicht, allein einzusteigen.
»Wer führt das Gespräch?«
Nicht mit ihr wollte man sprechen, sondern mit dem neuen Eigentümer. Man hatte Viau versprochen, mit ihm zu reden, ihm zu sagen, dass er keinen besseren Kapitän finden könne als Viau, der zudem seinen Lebensunterhalt verdienen müsse, denn er habe einen Sohn, der studierte, und eine Tochter, die nicht war wie die anderen.
An Deck der Jeanne unterhielten sich die Leute aus der Stadt weiter und schienen bester Laune zu sein. Auf der anderen Seite des Beckens warteten die Boussus und die Pincemins, die Gesichter etwas gerötet vom vielen Essen und Trinken, bis die Marie ihre Geschwister fertig gemacht hatte.
Der Ältere, Joseph, war wütend und schaute die Pincemins, die ihn auf den Pferdewagen hievten, grimmig an.
Hubert dagegen folgte willig, ließ sich einen dicken Wollschal umbinden und nahm den Kuss seiner Schwester entgegen, ohne zu mucksen. Er hatte natürlich keine Ahnung, was ihm widerfuhr, und wusste nicht mal, wo er hinkam!
Und die Schnecke, die Jüngste, die dicke, ewig schmutzige Puppe, die ihren Geschwistern als Spielzeug gedient hatte, tröstete man mit einem Apfel, den man ihr in die Hand drückte, sodass ihr die Abreise wie die Fortsetzung eines wunderbaren Mahls erschien.
Die beiden Wagen fuhren über die Brücke. Am Kai mussten die verschiedenen Gruppen beiseitetreten, um sie vorbeizulassen, aber man beachtete sie kaum, denn es waren Fremde, Leute vom Land. Nur ein paar Frauen ließen sich vom Los der Schnecke rühren, die von allen so genannt wurde, weil sie mit vier Jahren immer noch auf dem Boden herumkroch, als wäre sie zu dick, um sich mühelos aufrecht zu halten.
Marie war nach Hause gegangen. Mit ein paar alltäglichen Handgriffen setzte sie Wasser auf, um das Geschirr zu spülen, dann kehrte sie den Boden, der recht schmutzig geworden war.