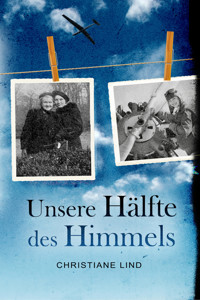8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Heilerinnen Saga
- Sprache: Deutsch
Denn Liebe ist stärker als Hass ...
Bremen, 1381: Für Aleke ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie hat sich in Salerno zur Medica ausbilden lassen und wagt nun gemeinsam mit ihrem Ehemann Righert in der Hansestadt Bremen einen Neuanfang. Doch plötzlich taucht eine Bedrohung aus der Vergangenheit auf und bringt ihr mühsam erkämpftes Glück in Gefahr. Alekes heilerische Kenntnisse werden auf eine harte Probe gestellt. Wird es ihr gelingen, das Leben ihrer Liebsten zu retten?
Die mitreißende Geschichte einer selbstbewussten Frau zur Blütezeit der Hanse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Informationen zum Buch
Im Reich der Friesen
4. Jhd. in Bremen: Eine junge Medica kämpft für ihre Liebe.
Bremen, 1380: Den Neuanfang in der Hansestadt haben sich die Medica Aleke und ihr Ehemann Righert einfacher vorgestellt. Die Bremer stehen ihr misstrauisch gegenüber, und auch Righert tut sich schwer, als Kaufmann Fuß zu fassen. Als sein Schiff von einem friesischen Häuptling gekapert wird, bricht für Aleke eine Welt zusammen. Aber sie gibt nicht auf und macht sich auf die Suche nach ihrem Mann. Bei ihrem gefahrvollen Weg durchs Worpsweder Land werden ihre heilerischen Kenntnisse auf eine harte Probe gestellt. Und dann taucht ein alter Todfeind auf, der nach Rache sinnt …
Christiane Lind
Die Medica und das Teufelsmoor
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Dramatis Personae
Prolog: Glück und Hass
Prolog
Teil 1: Unglück in Bremen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil 2: Die Suche nach Righert
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil 3: Im Teufelsmoor
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Epilog
Glossar
Historische Hintergründe
Literatur- und Recherchehinweise
Danksagung
Über Christiane Lind
Impressum
DER KNABE IM MOOR
O schaurig ist’s übers Moor zu gehn,
Wenn es wimmelt vom Heiderauche,
Sich wie Phantome die Dünste drehn
Und die Ranke häkelt am Strauche,
Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
Wenn aus der Spalte es zischt und singt,
O schaurig ist’s übers Moor zu gehn,
Wenn das Röhricht knistert im Hauche!
ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF
DRAMATIS PERSONAE
(* reale historische Personen)
HAUSHALT DER VAN ANHALDS
Aleke van Anhald
Heilerin und Medica
Righert van Anhald
Alekes Gemahl und Fernhändler
Lucke
Righerts stumme Schwester
Smalejohan
Righerts Knecht
Wynneke
Righerts Magd
Kinen
Junges Dienstmädchen
Maustod
Großer roter Kater, alt, aber nicht müde
BREMER BÜRGERINNEN UND BÜRGER
Ysake von Bremhen
Jüdischer Medicus, der in Salerno studierte
Rina von Bremhen
Ehefrau des Medicus, die ebenfalls Medizin studierte
Esther, Jacob und Tikva
Rinas und Ysakes Kinder
Johanatan
Ysakes Vater
Deborah
Ysakes Mutter
Borchard van Hemeling
Bremer Fernhändler und Wortführer
Gotfried van Gropelinghen
Bremer Fernhändler
Frederik Wynman
Bremer Fernhändler
BRAUNSCHWEIGER BÜRGERINNEN UND BÜRGER
Acchem van dem Broke
Fernhändler, Stadtrat und Alekes Onkel
Fredereke van dem Broke
Ehefrau des Acchem van dem Broke
Kersten van dem Broke
Einziger Sohn von Acchem und Fredereke van dem Broke
Gerwen Krameres
Ratsherr und ehrgeiziger Händler
Benedicte Muntaries
Vorsteherin der Beginen, Schwester des Acchem van dem Broke
Ghese Ysernehagen
Begine, Kräuterfrau und Heilerin
Mechtylde von Helmenstede
Begine, die Aleke das Leben schwer macht
FRIESEN UND PIRATEN
Uko Ukena*
Hovetling
Almke von Lengen*
Ehefrau des Uko Ukena und Mutter von Focko
Focko Ukena*
Sohn von Uko Ukena und Almke
Cort Valeberghes
Pirat und Pelzhändler
Henning Mandüvel*
Freibeuter und Kaperer im Auftrag des mecklenburgischen Herzogs
Arnd Stuke*
Seeräuber, aus mecklenburgischem Adel
Meynerd Pryndeney
Herr der Gnarrenburg
Willehin
Dienstmann des Cort Valeberghes
PROLOG Glück und Hass
PROLOG
Salerno 1378
Vier Säfte sind es, die die Gesundheit ausmachen.«
Klar und deutlich klang die tiefe Stimme des Magisters zu Aleke hoch, die unruhig auf ihrem Platz hin und her rutschte. So sehr das Thema der Vorlesung sie interessierte, so sehr sie das Wissen liebte, das ihr hier in Salerno vermittelt wurde, so wenig konnte sie sich heute auf die Worte des Lehrers konzentrieren. Am liebsten wäre sie aufgesprungen, um nach Hause zu eilen, damit sie Righert die wunderbare Neuigkeit überbringen konnte. Doch noch musste sie zwei Stunden ausharren. Bald kamen die Prüfungen, und Aleke konnte es sich nicht erlauben, ihre Gedanken wandern zu lassen, wollte sie erfolgreich sein. Und das musste sie – schließlich gehörte sie zu den wenigen Frauen, die an der Schule zugelassen worden waren. Ihr Scheitern würde nur all denen recht geben, die predigten, dass Frauen keine Medici werden könnten. Daher gestattete Aleke sich nur ein kleines Lächeln, bevor sie ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Säftelehre richtete.
»Die Säfte Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle lassen sich den Elementen zuordnen: der Luft, dem Wasser, dem Feuer und der Erde. Im Jahr wiederum lässt sich deutlich zeigen, dass eines der Elemente die Vorherrschaft innehat«, führte der zierliche Mann weiter aus. Der Blick aus seinen dunklen Augen wanderte über die kleine Gruppe, die ihm mehr oder minder aufmerksam lauschte. Der Scholar schüttelte den Kopf, als er den Studenten entdeckte, der den Kopf auf die Arme gelegt hatte und leise vor sich hin schnarchte. »Im Frühling und in der Jugend überwiegt die Luft und damit das Blut. Jedenfalls bei den meisten. Dass es auch anders geht, verdeutlicht uns der schlafende junge Mann hier.«
Das Gelächter der Lernenden weckte den Angesprochenen, der rot anlief und sich aufrecht hinsetzte. Wie jung die anderen Lernenden waren.
So sehr sie die Schule von Salerno schätzte, so begeistert sie das Wissen in sich aufsaugte, so wenig fühlte Aleke sich hier vollkommen zu Hause. Unter den anderen Scholaren fiel sie auf, nicht nur weil sie hochgewachsen war und auffallend graue Augen und tiefbraune Haare hatte. Nein, weil sie eine Frau war und weil sie älter war als die meisten von ihnen. Älter, obwohl Aleke dank der Schreiben der Medici Rina und Ysake von Bremhen ein Jahr des Logikstudiums erlassen worden war. Doch nicht nur ihre Lebensjahre trennten Aleke von ihren Lernenden. Ihre Erfahrung als Heilerin stieß oft auf Unverständnis bei den jungen Männern, die ihr Wissen aus Pergamenten und Folianten bezogen. Auch ihre Sprache und ihr Leben ließen Aleke fremd wirken. Während die anderen Scholaren zumeist gerade erst ihre Eltern verlassen und ihr Leben noch vor sich hatten, war Aleke verheiratet und trug die Narben einer schweren Vergangenheit mit sich. Daher fühlte sie sich stets ein wenig verloren, gerade so sehr, dass es ihr auffiel.
Doch all das nahm sie gerne in Kauf, weil sie ihr Wissen und ihre Heilkunst verbessern wollte, weil sie – in ihren kühnsten Träumen gestand sie sich das ein – eine mulier sapiens, eine weise Frau, werden wollte. Eine kluge Frau, so wie es der Ehrentitel von Trotula war, der großen Medica, die in Salerno gelebt und unterrichtet hatte. Nichts erschien Aleke erstrebenswerter, als eine Magistra in Salerno zu werden, an der Schule zu unterrichten und Menschen zu heilen. Nein, das stimmte nicht, beinahe nichts erschien ihr so wünschenswert. Es gab nur eine Sache, die ihr noch mehr am Herzen lag. Ihren sehnlichsten Wunsch, der ihr bisher jedoch versagt geblieben war. Bis heute. Am heutigen Tag hatte sie endlich Gewissheit erlangt. Bevor die Scholaren sich versammelten, war Aleke zu Francesca de Romana gegangen, die Frauenheilkunde lehrte, um mit ihr zu sprechen.
»Entschuldigt.« Aleke nahm ihren Mut zusammen, galt die Magistra doch als ungeduldig gegenüber den Schülern, während sie den Kranken gegenüber stets ein freundliches Wort und immerwährende Ruhe aufbrachte. »Ich benötige Euren Rat.«
»Ihr wollt wissen, ob Ihr wirklich ein Kind bekommt?« Francesca de Romana, eine stämmige kleine Frau mit klugen Augen, lächelte Aleke an. »Die Frage beschäftigt Euch schon seit Wochen, nicht wahr?«
»Woher …?« Aleke konnte nur den Kopf schütteln über das Wissen ihrer Lehrerin, war sie doch sicher gewesen, dass niemand ihr ihre Unruhe anmerken könnte. »Ja, das möchte ich wissen. Ich sorge mich, da …«
Die Angst griff nach ihr und raubte ihr die Kraft weiterzusprechen. Bereits zweimal war Aleke schwanger gewesen und hatte das ungeborene Kind nach wenigen Wochen verloren, obwohl sie sich geschont und alle Regeln befolgt hatte, die sie in Salerno gelernt hatte. Ihr Gemahl Righert hatte Aleke in diesen schweren Stunden zur Seite gestanden, auch wenn er selbst sich genauso sehr ein Kind wünschte wie sie. Daher hielt Aleke ein banges Gefühl gefangen, als sie erneut meinte, schwanger zu sein. Eine Mischung aus inniger Freude und der schrecklichen Angst, wieder eine Fehlgeburt zu erleiden. Die Sorge hatte gesiegt, so dass Aleke jeden Morgen erwartet hatte, mit Krämpfen zu erwachen, dem bitteren Zeichen, dass ihr Wunsch wieder einmal unerfüllt bliebe. Doch die Schmerzen und das Blut waren ausgeblieben, so dass Aleke wagte, Hoffnung zu schöpfen. Ein wenig nur, ein schmaler Lichtstreif, der jedoch mit jedem vergehenden Morgen heller leuchtete.
»Trinkt jeden Tag einen Aufguss aus Johanniskraut und Baldrian. Fügt Melisse hinzu, wenn die Übelkeit einsetzt.« Nun betrachtete ihre Magistra Aleke mit dem prüfenden Blick einer Medica. Sie griff nach Alekes Hand und schaute ihr in die Augen. »Ich werde mit den anderen Magistri reden, damit Ihr weniger Kranke pflegen müsst.«
»Habt Dank.« Aleke lächelte. Erleichterung überkam sie, gemeinsam mit Dankbarkeit, sie wollte jubilieren und der ganzen Welt ihr Glück mitteilen. Doch sie hielt sich zurück. Erst musste ihr Gemahl erfahren, dass er Vater werden würde. Righert würde gewiss außer sich sein vor Freude. Alekes Lächeln vertiefte sich, als sie sich vorstellte, wie sehr sich auch Lucke, ihre Schwägerin, für sie freuen würde. Ganz zu schweigen von ihrer Magd Wynneke. Dieser, der mit ihrem Gemahl Smalejohan eigene Kinder verwehrt waren, sah in Alekes Gatten etwas wie einen Sohn und konnte es kaum erwarten, dass er und Aleke endlich ein Kind bekamen.
»Auch wenn es ein Anlass zu großer Freude ist, gibt er Euch nicht das Recht, Eure Studien zu vernachlässigen«, sagte die Magistra jetzt mit ernster Stimme, aber in ihren Augen entdeckte Aleke ein Lächeln. »Nun geht, der verehrte Magister Calenda beginnt gleich mit seiner Vorlesung.«
»Habt Dank«, sagte Aleke erneut und umarmte die Medica, was diese mit einem kurzen Nicken bedachte.
Schnell war Aleke zu der Vorlesung geeilt, die sie keinesfalls verpassen wollte. Schon von weitem konnte sie die klare Stimme des Professors hören. An schönen Frühlingstagen wie heute zog es den Lehrer hinaus. An einem Brunnen hatte er die kleine Schülerschar versammelt, die zu seinen Füßen saß und eifrig lauschte. Aleke suchte sich einen Platz und ließ sich nieder. Einen Moment schloss sie die Augen, um das Gefühl der Frühlingssonne auf ihrem Gesicht zu genießen. Dann konzentrierte sie sich auf die Worte von Salvatore Calenda, den Aleke besonders mochte, da er ihr als Frau gegenüber keinerlei Vorbehalte zu hegen schien. Auch wenn es in Salerno Frauen erlaubt war, zu studieren, so stieß sie viel zu häufig auf Vorurteile bis hin zur offenen Feindseligkeit. Nichtsdestotrotz war für sie ein Traum in Erfüllung gegangen, als sie an der Schule akzeptiert worden war. Und so sehr sie sich über die Überraschung freute, die sich nun endlich zur Gewissheit verdichtete, so schwierig blieb die Frage, ob sie als Mutter eine Medica werden könnte.
Endlich endete die Vorlesung, und Aleke sprang auf, um nach Hause zu eilen. Mühsam zügelte sie den Wunsch, ihr Gewand zu heben und einfach loszulaufen. Als wollte man ihre Geduld prüfen, war Salerno heute voller Menschen, die sich Aleke in den Weg stellten, ihr Vieh vor sich hertrieben, so dass sie nicht daran vorbeigehen konnte, oder aber plötzlich auf den Gassen stehen blieben, weil sie einen Bekannten gesehen hatten, mit dem sie ausgerechnet jetzt ein Schwätzchen halten mussten. Gerade mit einem Herzen, das vor Glück über die wundervolle Neuigkeit überfloss, genoss sie diesen sonnigen Frühlingstag in einer der schönsten Städte, die sie sich vorstellen konnte. Auch wenn es Scholaren gab, die immer wieder betonten, wie klein und unbedeutend Salerno gegenüber Paris oder Bologna war, für Aleke blieben die Stadt am Meer und deren Medizinschule der wunderbare Ort, an dem sie leben wollte.
Sie liebte die Sonne, die an so vielen Tagen auf die Stadt schien, liebte die Farben des Meeres, die von einem tiefen Grün bis zu einem schimmernden Blau reichten. Immer wieder erfreute sie sich an der bunten Vielfalt der Menschen, die hier lehrten und lernten oder Handel trieben. Ihre Ohren vermochten sich nicht satt zu hören an dem Sprachengewirr, das in den Gassen und vor allem im Hafen zu erlauschen war. Ihre Augen vermochten sich nicht satt zu sehen an den Farben, die Salerno mit sich brachte. Das tiefe Grün der Wälder um die Stadt herum, das helle Gelb der Häuser, das glitzernde Blau des Meeres, die unglaubliche Vielfalt der Waren, die auf den Schiffen aus dem Orient herbeigebracht wurden.
Selbst die intensiven Gerüche gehörten mit zu Alekes liebsten Eindrücken wie die exotischen Gewürze, die ein Händler von einem der großen Schiffe entlud. Der Gestank nach Fisch und Meeresfrüchten, der die kleinen Boote der Fischer begleitete, mischte sich mit dem süßen Aroma von Weihrauch, den ein junger Mann in einer Mönchskutte mit sich trug.
Nur jetzt schlug ihr der Weihrauchduft auf den Magen, so sehr, dass sie ihre Ellenbogen einsetzen musste, um sich ihren Weg durch die Menschen zu bahnen. Sie hielt die Hand vor den Mund und schluckte gegen die aufsteigende Übelkeit an. Endlich, endlich gelang es ihr, einen Olivenbaum zu erspähen, der ihr Schatten spenden würde. Mit geöffnetem Mund und geschlossenen Augen atmete sie gegen die Übelkeit an, bis es ihr etwas besser ging. Erneut griff die Angst, ihr Kind zu verlieren, nach ihr. Nein, sprach sie sich Mut zu. Mein Kind wird leben. Wir haben die Schatten der Vergangenheit hinter uns gelassen und werden glücklich werden.
***
Ostsee 1378
»Er stirbt. Nur noch wenige Tage«, hörte der Mann, der sich Cort Valeberghes nannte, den Bader sagen, der seit einigen Wochen mit ihnen reiste. Ihr Anführer hatte dem Heiler die Wahl gelassen, den anderen Menschen auf dem gekaperten Schiff in den Tod zu folgen oder mit ihnen zu reisen. »Diese Krankheit kann man nicht besiegen.«
»Was weißt du schon?«, flüsterte Valeberghes. Kaum hatte er die Worte ausgestoßen, da schüttelte ihn wieder der Brechreiz. Endlich ließ das Würgen nach, so dass er sich ein wenig aufrichten konnte. »Was weißt du schon?«
In dem Augenblick traf eine hohe Welle das Piratenschiff, so dass die Kogge sich schwer nach Backbord neigte. Von der Gewalt der Woge überrascht, rollte Cort Valeberghes über die harten Planken, stieß sich schmerzhaft an einem Fass, das angebunden an der Wand stand. Sein Schmerzensschrei ging im Husten unter. Er schaffte es gerade noch, auf allen vieren zurück zu den schmutzigen Lumpen zu krabbeln, die er sich als Lager zurechtgelegt hatte. Schwer atmend ließ er sich auf sie fallen, ignorierte Gestank und Flöhe. Für einen kurzen Moment schloss er die Augen und fühlte sich versucht, sich der Krankheit und dem Tod zu ergeben. Aber nein, er wollte überleben, bis sein Rachdurst gestillt wäre. Gleichgültig, was der Bader auch sagte, er würde die Krankheit überstehen.
Seit drei Tagen fuhren sie durch schwere See, als hätte sich der Himmel gegen die Piraten im Allgemeinen und gegen Cort Valeberghes im Besonderen verschworen. Schlimm genug, dass ihn der Husten plagte. Nun musste er auch noch spucken, weil er sich in all der Zeit an Bord niemals richtig an das Rollen des Schiffs gewöhnt hatte. Glatte See und Sonnenschein konnte Cort Valeberghes ertragen, aber Sturm und hohe See ließen ihn würgen, als wäre er eine Landratte, die gestern erst an Bord gekommen war.
Viel Spott hatte er von den anderen Seeräubern dafür erhalten, dass er in all den Jahren niemals seefest geworden war, aber darum hatte Valeberghes sich nicht geschert. Sollten die Männer reden, was sie wollten, er verfolgte sein Ziel. Mehr interessierte ihn nicht. Alles, was er in den vergangenen Jahren getan hatte, diente nur einem Zweck – seiner Rache.
An dem Mann und der Frau, die ihn aus seiner Heimatstadt vertrieben hatten, die Schuld daran trugen, dass er sich mit diesen elenden Piraten hatte einlassen müssen. Die ihm seinen Namen und seinen Besitz genommen hatten, ungestraft.
Ihm war nichts geblieben als die Kleidung, die er bei seiner Flucht getragen hatte, und das Pferd, auf dem er geflohen war. Das Pferd hatte er verkauft, weil er Silber brauchte, um einen Neuanfang zu wagen. Doch bald schon waren die Häscher erschienen, von seinen Feinden geschickt, um ihn zu fangen. Weiter und weiter nach Norden war er geflohen, bis er schließlich Henning Mandüvel getroffen hatte, den Freibeuter, der im Auftrag Mecklenburgs kaperte.
»Ich kann einen guten Mann immer gebrauchen«, hatte Mandüvel gesagt, als Cort Valeberghes – inzwischen verzweifelt und dem Wahnsinn nahe – ihm seine Dienste angeboten hatte. »Stell keine Fragen und tu, was ich dir sage.«
Und Cort Valeberghes hatte eingewilligt und begonnen, sich seinen Platz unter den Seeräubern zu erkämpfen. Zwei Jahre war er mit Mandüvel gesegelt. Dann hatte er sein Glück wieder an Land versucht. Den Handel mit Bier und Pelzen hatte er aufbauen wollen, doch mit dem ersten Erfolg kamen die Neider und mit ihnen die Häscher aus Braunschweig. Da hatte Cort Valeberghes erkannt, dass er niemals seinen Frieden finden würde, solange das Paar noch lebte.
Cort Valeberghes war nichts anderes übrig geblieben, als sich erneut einem Piratenkapitän anzudienen. Schon bald nachdem er an Bord gekommen war, hatte Valeberghes alles getan, sich beim Kapitän unentbehrlich zu machen. Inzwischen hatte er genügend Beute gemacht, um einen weiteren Versuch als Händler zu wagen. So dumm wie beim letzten Mal würde er nicht handeln. Dieses Mal würde er – so wie er es gut konnte – die Fäden im Hintergrund ziehen. Cort Valeberghes hatte bereits einen Kumpan gefunden, der nach außen auftreten würde, so dass er selbst im Hintergrund und damit allen Häschern verborgen bleiben könnte.
Wäre ihm die vermaledeite Krankheit nicht dazwischengekommen, so würde er jetzt schon an Land gegangen sein, um dort sein drittes Leben zu beginnen. Ein gutes Leben, bezahlt mit Blut und Tränen der Menschen, die Opfer der Seeräuber geworden waren.
Er musste leben, denn erst vor kurzem hatte er endlich die heißersehnten Neuigkeiten von seinen Feinden erfahren. Erst jetzt hatte er ihre Spur entdecken können. Gut lebten sie, unter südlicher Sonne. Die Frau wagte es gar, eine Schule zu besuchen, um Medica zu werden. Brauchte es noch mehr Zeichen ihrer Gottlosigkeit? Ein Weib, das seinen angestammten Platz verlassen wollte, um es den Männern gleichzutun. Cort Valeberghes spuckte erneut aus. Er hätte sie damals töten sollen, als er die Gelegenheit dazu gehabt hatte. Andererseits blieb ihm nun mehr Zeit, sich einen Plan auszudenken, wie er dem Paar seine Schmach vergelten könnte. Leiden sollten sie beide, so sehr leiden, wie er gelitten hatte. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht glitt er in einen tiefen Schlaf.
TEIL 1 Unglück in Bremen
KAPITEL 1
Bremen 1381
Eine Medica will sie sein«, hörte Aleke es hinter sich zischen, als sie in die Lange Strate einbog. »Eine Zauberin ist sie. Oder ein Scharlatan.«
Aleke drehte sich um, um herauszufinden, wer diese Worte geflüstert hatte. Als mache es einen Unterschied, wenn sie es wüsste. Schließlich musste sie sich tagaus, tagein mit derartigen Vorwürfen auseinandersetzen, sei es, dass diese ihr geradewegs ins Gesicht gesagt oder hinterrücks getuschelt wurden. Auch wenn sie genau wusste, dass es wenig ändern würde, blieb Aleke stehen und wandte sich der Sprecherin zu, einer Bremer Bürgersfrau, deren runder Leib Zeugnis davon ablegte, wie gut es ihr ging.
Auch die Kleidung ihrer Angreiferin sah teuer, wenn auch wenig geschmackvoll aus, wie Aleke mit kundigem Auge erkannte. Man konnte nicht die Ehefrau eines Tuchhändlers sein, ohne etwas über Stoffe und Schneiderkunst zu lernen. Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht, als sie an Righert dachte. Doch erst galt es, die Patrizierfrau zurechtzuweisen.
»Sprecht Ihr mit mir?« Aleke trat auf die Frau zu und schaute sie herausfordernd an. »Kann ich Euch helfen?«
»Wie könnt Ihr es wagen, Euch Medica zu nennen?« Die Bremerin gehörte nicht zur feigen Sorte, das musste Aleke, wenn auch widerstrebend, anerkennen. Die Frau neben der Händlergemahlin, ebenso rund und ebenso reich geschmückt wie diese, hingegen sah zu Boden, als wäre ihr die Szene entsetzlich unangenehm. »Es ist Gottes Wille, dass ein Weib sich um das Haus und die Kinder kümmert. Das, was Ihr Medizin nennt, ist reiner Heilzauber.«
Als ob Ihr nicht die Mittelchen und Rezepturen der Magie nutzen würdet wie so viele hier, dachte Aleke voller Zorn. Als ob Ihr nicht lieber einem dummen, eitlen Mann vertraut als einer gebildeten Frau. Erst gestern hatte Aleke sich wieder einen Disput mit Arnold Doneldy geliefert, der als führender Medicus der reichen Bremer Familien galt. Doneldy prahlte mit seinen Kenntnissen der Magianaturalis, die er in einem Arzneybuch zu sammeln gedachte. Aleke hingegen hielt den Mann, der Beschwörungsformeln murmelte und sich mit einem Ruch des Geheimnisvollen umgab, für einen üblen Schwindler, der mehr Menschen auf dem Gewissen hatte als manch Angstmann.
»Ihr wollt doch nicht leugnen, dass gemahlene Fledermaus bei Augenkrankheiten höchste Wirksamkeit erreicht«, hatte Doneldy beharrt, nachdem er sich dazu herabgelassen hatte, mit Aleke zu reden. »Das müsst Ihr selbst in der Schola Medica Salernitana gelernt haben.«
Diese Herablassung gegenüber der Schule von Salerno hatte Aleke so wütend gemacht, dass sie kein Wort mehr hatte herausbringen können. Doneldy hatte sich umgedreht und war davonstolziert wie ein Hahn, der sich den größten Misthaufen suchte. Die ganze Nacht hatte Aleke wegen dieser Schmach wach gelegen. Wieder und wieder hatte sie sich Antworten überlegt, mit denen sie Doneldy zum Schweigen bringen würde. Nur leider hatte sie den Mann bisher nicht angetroffen, so dass Alekes Zorn sich ein anderes Ziel suchen musste. Pech für die Bremerin, dass sie gerade heute Aleke über den Weg gelaufen war.
»Woher wollt Ihr das wissen?« Aleke zog eine Augenbraue hoch, wohl wissend, wie arrogant sie diese Geste aussehen ließ. In dem halben Jahr, das sie und ihre Familie nun in Bremen lebten, hatte sie mehr als genug Gelegenheit gehabt, diesen Blick zu üben. Als Schutz gegen die Anfeindungen, denen sie viel zu häufig begegnete. »Habt Ihr je meine Hilfe beansprucht?«
»Das brauche ich nicht.« Die Patrizierin schaute Aleke an, als sei diese eine Schmeißfliege. »Es reicht mir zu hören, was man in den Gassen über Euch sagt. Den Sohn des Steinhauers, den habt Ihr auf dem Gewissen.«
Vor ohnmächtiger Wut ballte Aleke die Hände zu Fäusten, bevor sie sich umdrehte und die Frau stehen ließ. Dieser Streit würde zu nichts führen, sondern nur alte Wunden aufreißen. Zu sehr schmerzte die Erinnerung an das Kind, das selbst ihre Heilkunst nicht hatte retten können. Viel zu spät hatten seine Eltern Aleke rufen lassen. Nachdem bereits ein Bader den armen Jungen mehrfach zur Ader gelassen hatte, was dessen ohnehin schwindende Kräfte nur noch mehr beanspruchte. Elendig hatte das wohl siebenjährige Kind gehustet und Blut gespuckt.
Selbst ihr Studium bot Aleke keinerlei Handhabe, diesen Jungen dem Tod zu entreißen. Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als dem Kind beim Sterben Gesellschaft zu leisten und seinen Eltern ein wenig Trost zu spenden. Dass der Steinhauer und seine Frau es ihr derart danken würden, hatte sie nicht ahnen können. Bereits am nächsten Tag hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass die Frau, die sich vermessen Medica nannte, den Jungen auf dem Gewissen hatte.
»Nimm es dir nicht so zu Herzen«, hatte Alekes Freundin Rina von Bremhen ihr zugeredet. Die Jüdin, die wie Aleke Medizin an der Schule in Salerno studiert hatte, war Aleke der Ansporn gewesen, in die Ferne zu ziehen, um eine medizinische Ausbildung zu erhalten. Nachdem Aleke ihr Studium abgeschlossen hatte, war sie Rina nach Bremen gefolgt, um von ihrer Freundin zu lernen. »Aus den Worten der Eltern spricht nur große Trauer. Es ist leichter, wenn sie einen Schuldigen finden.«
Warum hatten sie nicht dem Bader die Schuld gegeben, der nicht einmal die letzten Augenblicke des Kindes abgewartet hatte, sondern mit den Münzen, die er für schlechte Dienste erhalten hatte, verschwunden war? Die Antwort auf diese Frage kannte Aleke zur Genüge. Weil der Bader ein Mann war, sie nur eine Frau. Eine studierte Frau noch dazu – das musste ja Misstrauen hervorrufen. Aleke hatte nicht erwartet, dass es leicht werden würde, in Bremen als Heilerin zu arbeiten, aber mit derart starken Vorbehalten und üblen Nachreden hatte sie nicht rechnen können.
Auch ihr Gemahl Righert musste darum kämpfen, dass die Bremer Patrizier ihn als einen der Ihren akzeptierten. Righert, der seine Ausbildung als Fernhändler erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde dennoch von den Bremer Kaufleuten geschnitten und bekam nur selten Aufträge von ihnen. Obwohl die Bremer gut vom Handel mit Fremden lebten, blieben sie bei den Geschäften lieber unter sich.
Ein Gutes hatte es immerhin, dachte Aleke. Da die Bremer sie ohnehin niemals mit offenen Armen aufnehmen würden, erschwerte es ihre Lage nicht, dass sie mit einer Jüdin befreundet war.
Wieder einmal bewunderte sie ihre Freundin, die sich trotz der Anfeindungen der braven christlichen Bremer Bürger ihre Freundlichkeit nicht nehmen ließ. Aleke hingegen fiel es schwer, Unhöflichkeit und Missgunst zu ertragen. Böse Worte wie die der Bremer Patrizierfrau schmerzten.
Und das, obwohl Aleke es eigentlich gewohnt war, Anfeindungen ertragen zu müssen. Jedoch nicht, weil sie eine Medica, sondern weil sie von unehelicher Geburt war. Diesen Makel hatten die Menschen ihrer Heimatstadt Braunschweig sie stets spüren lassen. Daher hatten Righert und sie entschieden, dass sie gemeinsam einen Neuanfang in einer anderen Stadt versuchen wollten. Bremen sollte es sein, weil Rina hier wohnte und weil Righert sich erhofft hatte, in der Stadt an der Weser erfolgreich Handel treiben zu können.
Durch die Regengüsse der vergangenen Tage führte der Fluss wieder hohes Wasser, so dass der Fluss trübe und gelblich aussah. Wie viel schöner als deren braungelbes Wasser war das türkisfarbene Meer vor Salerno, dachte Aleke mit Wehmut. Wie ein Edelstein hatte das Meer geglitzert, wenn die Sonne hoch am Himmel stand. Warm und freundlich war es in Salerno gewesen. Sowohl das Wetter als auch die Menschen hatten häufiger gelächelt als in Bremen. Aleke wagte nicht mehr, Righert gegenüber diese Gedanken zu äußern, weil er ihr vorgeworfen hatte, kein gutes Haar an Bremen zu lassen.
Dabei hatte es das Leben so gut mit ihr gemeint und ihr Righert gesandt, einen Gemahl, der Alekes Ziele vorbehaltlos unterstützt hatte, so dass sie ihre Studien mit Erfolg abgeschlossen hatte. Da Righert in Salerno als Händler nicht Fuß fassen konnte, hatte das Paar sich entschieden, sein Glück in Bremen zu versuchen. Es war also nur recht und billig, der Stadt eine Chance zu geben. Voller Vorfreude waren Righert, Aleke und ihr kleiner Haushalt, zu dem Righerts Schwester Lucke, der Knecht Smalejohan und dessen Frau Wynneke sowie die junge Magd Kinen gehörten, in die Hansestadt eingereist. Nun, ein gutes halbes Jahr später, schienen sich ihre Hoffnungen zerschlagen zu haben. Nur weniges von dem, was sie sich versprochen hatten, hatte sich erfüllt. Vielleicht war sie ja nur zu ungeduldig, überlegte Aleke, und es brauchte seine Zeit, bis sie die Stadt an der Weser ihr Zuhause nennen könnte.
Alekes Weg führte sie an der Martinikirche vorbei, die direkt am Ufer der Weser lag. Das Hämmern der Maurer und Zimmerleute erklang schon von weitem. Die Winterfluten und einige Brände hatten der Kirche so viel Schaden zugefügt, dass sie nun schon seit fünf Jahren bearbeitet wurde, ohne dass ein Ende der Bautätigkeiten abzusehen war. Ob sie es wohl noch erleben würde, dass die Kirche in altem Glanz erstrahlte, fragte sich Aleke.
Der Reichtum der Stadt zeigte sich überall – in der Höhe der steinernen Häuser, ihren Dächern und den vorgebauten Erkern als Zeichen der Baukunst. Die Straßen jedoch ließen zu wünschen übrig.
»Verdammter Steinweg!«, hörte Aleke einen Mann fluchen, dessen Karren zwischen zwei Steinen steckengeblieben war. »Kann die Stadt es sich nicht leisten, eine vernünftige Gasse zu bauen?«
Mit Straßen lässt sich nun einmal kein Staat machen, hätte Aleke dem Mann am liebsten geantwortet. Stattdessen mahnte Aleke sich zur Vernunft. Schließlich hatte sie es Righert versprochen, und solange Righert und sie einander hatten, würden sie jeder Unbill trotzen können. Selbst wenn es so ausgesehen hatte, als würden die Bremer sie niemals als Heilerin akzeptieren. Vielleicht ward ja heute ein Anfang gemacht, als die Gemahlin von Detward Wierdes, einem Ratsherrn, sie zu ihrer Überraschung hatte zu sich rufen lassen. Aleke musste sich sputen, wollte sie rechtzeitig ankommen.
»Eure Herrin hat nach mir geschickt«, sagte Aleke einer feisten Magd, die ihr die Tür geöffnet hatte. Die Frau glotzte Aleke an, als wäre diese eine Bettlerin, die Schmutz in das feine Bremer Haus tragen wollte. »Führ mich zu ihr.«
»Folgt mir«, lautete die mürrische Antwort. Die Magd wandte sich um und führte Aleke durch die Dornse in einen fürstlich eingerichteten Raum, den eine Feuerstelle behaglich wärmte. »Wartet hier.«
Aleke nutzte die Gelegenheit, sich in der Kammer umzuschauen. Edle Teppiche in leuchtenden Farben schmückten die Wände, feine Schnitzereien zierten die große Truhe aus dunklem Holz, die an einer Wand stand. Auch der Tisch und die Bänke davor waren aus edlem Holz, wie Aleke erkannte. Man konnte deutlich sehen, dass Detward Wierdes seinen Handel erfolgreich betrieb.
Bevor Aleke die Bilder der Teppiche eingehend studieren konnte, öffnete sich die Tür, und eine schlanke Frau, die sich sehr gerade hielt, trat ein. Eine Haube verbarg ihre Haare, aber die feinen, hellblonden Brauen und Wimpern ließen Aleke vermuten, dass auch das Haar von gleicher Farbe war. Eisigblaue Augen musterten Aleke neugierig, als wäre sie ein Kalb mit zwei Köpfen.
»Ihr seid also die Medica aus Salerno.« Detward Wierdes’ Gattin hielt sich nicht mit einer Begrüßung auf, was Aleke ärgerte. Dennoch lächelte sie in der Hoffnung, ihre Heilkunst anwenden zu können. »Man hört viel über Euch.«
»Ich grüße Euch.« Aleke neigte den Kopf. »Glaubt nicht alles, was Ihr hört.«
Die Bremerin antwortete mit einer wegwerfenden Geste ihrer schmalen Hand, die mit schweren Ringen geschmückt war.
»Was kann ich für Euch tun?«, fragte Aleke. Sie klopfte auf ihre Tasche. »Ich habe Kräutertinkturen und Salben für unterschiedlichste Beschwerden dabei.«
»Meine Krankheit heißt Alter.« Detward Wierdes’ Gemahlin verzog ihren Mund. »Ich hörte, dass Eure Trotula über Zauber verfügte, die dem Alter Einhalt gebieten.«
Aleke konnte ihr Seufzen nur mühsam unterdrücken. Trotula war eine der angesehensten Medicae, die je in Salerno gelehrt hatten. Ihre Lehrbücher zur Frauenheilkunde galten als richtungsweisend, aber die Bremerinnen wünschten davon nichts zu hören, sondern fragten nur nach Schönheitsmittelchen. Da dies Aleke schon mehrfach geschehen war, hatte sie vorgesorgt. Sie griff in ihre Tasche und holte einen Tiegel heraus.
»Ich kann Euch diese Paste aus Lilienwurz und Rosenwässern empfehlen. Sie wird Eure Haut blütenweiß halten.«
»Zeigt her.« Mit schlecht verhohlener Gier griff die Ratsherrngattin nach dem Töpfchen. »Habt Ihr noch mehr?«
Nach schier endlosem Feilschen mit Detward Wierdes’ Gemahlin hatte Aleke ihr drei Tiegel mit Salben verkaufen können und konnte nun gehen, um ihre Freundin aufzusuchen. Auf der Gasse versank Aleke wieder in ihren düsteren Gedanken. Sie war enttäuscht. Gab es in ganz Bremen niemanden, der sich für ihr Wissen interessierte? Niemanden, der ihre Heilkunst und ihre Zeit des Studiums wertzuschätzen wusste?
Als hätten Alekes Gedanken sie herbeigerufen, sah sich Aleke einer Begine gegenüber, der sie freundlich zunickte. Die Katharinenjungfern oder schwarzen Nonnen, wie die Bremer Bürger die Frauengemeinschaft ihrer Tracht nach nannten, erinnerten sie stets an das Leben, das sie in Braunschweig geführt hatte. Als Righert und sie nach Bremen gekommen waren, hatte Aleke bei den Beginen vorgesprochen, um den Schwestern ihre Fertigkeiten als Medica anzubieten, aber die Schwestern hatten dies abgelehnt. Ihre Magistra hatte Aleke erklärt, dass die schwarzen Nonnen in Bremen einen schweren Stand hatten, weil man ihnen nachsagte, ketzerische Gedanken zu verbreiten.
»Ich glaube fest, dass Ihr uns eine große Hilfe wäret«, hatte die Vorsteherin mit einem Seufzen gesagt. »Aber ich fürchte, dass eine Medica in unseren Reihen den bösen Gerüchten nur Vorschub leistet.«
»Ich verstehe«, hatte Aleke geantwortet und es ehrlich gemeint. »Falls Ihr dennoch meine Hilfe benötigt, gebt mir Bescheid.«
»Ich danke Euch.« Die Magistra hatte Aleke zugelächelt. »Doch zumeist werden wir erst geholt, wenn die Menschen bereits im Sterben liegen.«
So wie Aleke bisher nur zu Kranken gerufen worden war, wenn Bader und Heilzauber versagt hatten. Die wenigen Male, wo sie den Kranken hatte helfen können, hatten ihr zwar Dank seitens deren Familien eingebracht, aber nichts daran geändert, dass man ihr weiterhin misstraute. Gar häufig hatte Bremen sie enttäuscht. So vieles, was Aleke sich erhofft hatte, hatte sich als trügerisch erwiesen. Nur eines gab es, das Aleke wieder Hoffnung schöpfen ließ und was der Grund war, warum sie so schnell durch die Stadt eilte.
KAPITEL 2
Braunschweig 1381
Ruhig, viel zu ruhig war es im Hause der van dem Brokes. Kein Händler wartete in der Dornse mit Waren oder Silber; seit Tagen hatte kein Wagen, vollbeladen mit edlem Tuch oder Braunschweiger Bier, den Hof verlassen. Selbst die Mägde schlichen auf Zehenspitzen durch das Haus, als könnten sie so das Unausweichliche verhindern. Nur der alte Knecht hatte den Mut gehabt auszusprechen, was ihnen sicher allen durch den Kopf ging: »Wen der Tod sich holen will, dem helfen weder Geld noch gute Worte.«
»Schhh, wie kannst du so was sagen?«, hatte die Köchin ihn zum Schweigen gebracht und mit dem Kopf auf Kersten gedeutet, der am Tisch saß und warmen Würzwein trank. Aber Kersten hatte ihr angesehen, dass auch sie nicht mehr an die Genesung seines Vaters glaubte. Wie sollte auch das Gesinde darauf vertrauen, dass der Herr des Hauses gesund werden würde, wenn er selbst nicht daran glauben konnte? Zu lange lag Acchem van dem Broke nun schon darnieder, ohne dass ein Medicus oder Bader ihm hatte helfen können. Alles hatte seine Mutter versucht, viel Silber für Heiler ausgegeben, die große Versprechungen gemacht hatten, ohne dass Acchem van dem Brokes Zustand sich besserte. Eher das Gegenteil war eingetreten. Der Hausherr war derart oft geschröpft und zur Ader gelassen worden, dass er inzwischen bleich und ausgezehrt aussah, so als hielte der Tod ihn bereits fest in den Krallen.
»Hör auf, ihn mit Quacksalbern zu quälen«, hatte Kerstens Tante Benedicte Muntaries ihrer Schwägerin befohlen, nachdem sie einen Blick auf ihren Bruder geworfen hatte. »Acchem braucht Ruhe, Hühnerbrühe und frische Luft.«
Seine Tante hatte einen vielsagenden Blick mit Kersten gewechselt, der nur hilflos die Hände heben konnte. Auf ihn wollte seine Mutter nicht hören, wenn er sagte, dass nun genug wäre mit den Medici und Apothekern, die in ihrem Haus ein und aus gingen wie früher die Fernhändler aus aller Herren Länder. Daher hatte Kersten sich keinen Rat gewusst, als Benedicte Muntaries holen zu lassen. Als Magistra der Beginen verfügte seine Tante über genügend Durchsetzungskraft, um seine Mutter aufzuhalten. Benedicte Muntaries hatte Ghese Ysernehagen, die Heilerin der Beginen, gerufen, die seinen Vater ausgiebig untersucht hatte. Einen Stärkungstrank und viel Ruhe hatte die Heilerin empfohlen, aber auch eingestehen müssen, dass nur wenig Hoffnung blieb.
Auf Wunsch seiner Mutter hatte Kersten den Handel nahezu erliegen lassen, damit sein Vater sich erholen könnte. Lange können wir nicht mehr warten, dachte Kersten und schlug das Rechnungsbuch zu. Obwohl seine Familie immer noch zu den wohlhabenden der Stadt gehörte, so hatten auch sie unter der Verhansung gelitten. Unter dem Bann, den die Hansestädte über Braunschweig ausgesprochen hatten, so dass der Handel nur noch mit Städten außerhalb des Bundes möglich gewesen war. All das, weil die Gildemeister vor sieben Jahren den Aufstand gegen die alten Ratsfamilien gewagt hatten. Kersten schauderte, als er an die Unruhen und die schreckliche Zeit danach dachte, die einige Ratsherren das Leben gekostet hatten. Seine Familie hatte entkommen können, obwohl sein Vater als Ratsherr um sein Leben hatte fürchten müssen.
Nein, heute wollte er seine Gedanken nicht wieder mit der Vergangenheit belasten. Obwohl seit damals viel Wasser die Oker heruntergeflossen war, konnte Kersten nicht an jene Zeit denken, ohne in Zorn zu geraten. Zorn auf seinen Vater, der ihn verraten hatte, aber mehr noch Zorn auf sich selbst, dass er nicht den Mut aufgebracht hatte, seine Familie und Braunschweig hinter sich zu lassen. Aus Pflichtgefühl war er geblieben, weil jemand den Handel aufrechterhalten musste, nachdem sein Vater nicht mehr dazu in der Lage war. Nach und nach hatte Kersten immer mehr Verantwortung übernommen, bis er es war, den die Knechte ansprachen, wenn sie eine Entscheidung wollten. Da hatte er dann gar nicht mehr gehen können – zu viele Menschen verließen sich auf ihn.
»Herr, Euer Vater wünscht Euch zu sehen.« Lautlos wie eine Katze hatte die Magd sich in die Dornse geschlichen. Die junge, hübsche, die Kersten stets verheißungsvoll anlächelte, obwohl er ihre Avancen niemals erwiderte. Auch heute versuchte sie, ihm schöne Augen zu machen, worüber er geflissentlich hinwegsah. Eines Tages würde sie schon einen Mann finden, dem sie gefiel, blond und drall, wie sie war. »In seiner Kammer. Eure Mutter wartet bereits.«
»Sag ihnen, ich komme gleich«, antwortete er brüsk, damit sich das Mädchen keine falschen Hoffnungen machte. Seit dem Mord an seiner Gemahlin hatte Kersten nie wieder eine andere Frau auch nur angesehen. Diese Treue schuldete er Ceffeken. »Ich muss noch die Bücher einschließen.«
»Ja, Herr.« Die Stimme des Mädchens klang enttäuscht, aber darauf konnte und wollte Kersten keine Rücksicht nehmen. Er hatte einen Handel zu führen und konnte keine Zeit mit Tändeleien vergeuden.
Kersten wartete, bis die Magd verschwunden war, bevor er langsam zu der großen Truhe ging, in der er seine Bücher aufbewahrte. Mit der linken Hand hob er den schweren Deckel an, legte das Rechnungsbuch hinein und verschloss die Truhe mit dem Schlüssel, der an einer Kette um seinen Hals hing. Dann setzte er sich auf die Truhe. Er fühlte sich schuldig, weil er der Begegnung lieber ausweichen wollte. Seit den Ereignissen vor sieben Jahren sprach Kersten mit seinem Vater nur das Nötigste, und selbst das kostete ihn Überwindung. Außerdem ahnte Kersten bereits, warum er ihn hatte rufen lassen. Vor einer Woche hatte Acchem van dem Broke den Wunsch das erste Mal geäußert und war seitdem dreimal wieder darauf zurückgekommen, obwohl Kersten stets eine neue Ausrede gefunden hatte.
»Nun gut. Es muss sein«, sprach er sich leise Mut zu. »Für Mutter.«
Dennoch ging er nur langsam die Stiege hinauf, die zur Kammer seines Vaters führte. Der durchdringende Geruch nach verbranntem Kampfer stieg ihm in die Nase, als er sich dem Raum näherte. Das Kraut zu verbrennen, dazu hatte Ghese Ysernehagen geraten. »Das hilft deinem Vater zu atmen.«
Endlich stand Kersten vor der Tür, hinter der Acchem van dem Broke vor sich hin siechte. Seine Mutter war aus dem gemeinsamen Schlafgemach ausgezogen, nachdem die Krankheit seines Vaters sich verschlimmert hatte. Sicher war es aber auch für sie ein guter Vorwand gewesen, sich von ihm zu distanzieren. Sie musste ihrem Gemahl schließlich noch viel mehr zürnen, als Kersten es tat, so hatte er schon oft gedacht. Gefragt danach hatte er sie jedoch nie. Schon vor langer Zeit hatten Kersten und seine Mutter eine stillschweigende Übereinkunft getroffen, dass keiner von ihnen an jene Ereignisse vor sieben Jahren rühren würde.
Mit mehr Kraft, als er fühlte, stieß Kersten die Tür auf. Sein Vater lag im Bett, eine dicke Wolldecke bis zum Hals gezogen, obwohl der Tag ausnehmend warm und sonnig war. Kersten musste an sich halten, um nicht bei dem Anblick zusammenzuzucken, der sich ihm bot. Sein vormals so kräftiger Vater war derart abgemagert, dass man die Knochen sehen konnte. Alt ist er geworden, dachte Kersten. War Acchem van dem Broke früher hochgewachsen und schlank, so konnte man ihn jetzt nur hager nennen. Nur wenige dunkelbraune Strähnen waren im schmutzigen Grau seines Haupthaares verblieben. In seinem bleichen und schmalen Gesicht stach Acchem van dem Brokes lange, schmale Nase hervor wie ein Adlerschnabel. Die Nase, die auch Kersten geerbt hatte. Viel zu ähnlich sehe ich meinem Vater, hatte Kersten oft gedacht, doch inzwischen musste man schon genau hinsehen, um zu erkennen, dass sie Vater und Sohn waren. Acchem van dem Brokes dunkle Augen lagen tief in ihren Höhlen und wirkten riesig wie die einer Eule. Bleich war er, mit glühenden roten Flecken auf den Wangen. Schlagartig überfiel Kersten das schlechte Gewissen, weil er seinem sterbenden Vater so lange ausgewichen war.
Fredereke van dem Broke saß neben dem Bett auf einem Hocker. Sie hielt sich sehr gerade, als wollte sie dem Schicksal und der Krankheit so die Stirn bieten. Als Kersten in die Kammer trat, wandte seine Mutter sich ihm zu. Für einen Augenblick konnte er hinter die Maske schauen, die sie nun schon so viele Jahre trug. Erschöpft wirkte sie und müde, als hätte das Leben an Acchem van dem Brokes Seite alles von ihr gefordert. Kersten fühlte sich versucht, zu ihr zu treten, um sie zu trösten, aber da war der Augenblick der Schwäche auch schon vorüber. Wieder wirkte seine Mutter beherrscht und auch unnahbar.
»Mutter.« Er grüßte sie mit einem Nicken. »Vater. Wie geht es dir?«
»Dein Vater hat eine Bitte an dich«, sagte seine Mutter mit tonloser Stimme. Erneut blitzten ihre wahren Gefühle kurz hervor. Kersten meinte Zorn zu erkennen. »Hol dir einen Schemel und setz dich zu uns. Bitte.«
Ob sein Vater wieder davon anfangen würde?, fragte sich Kersten, während er sich einen Schemel heranzog. Acchem van dem Broke richtete sich etwas auf und starrte Kersten aus riesigen Augen durchdringend an. Sein Vater zog eine Hand, die so mager war, dass sie an eine Kralle erinnerte, unter der Wolldecke hervor und griff nach Kerstens Arm.
»Mein Sohn. Du musst es mir versprechen.« Kaum hatte Acchem van dem Broke diese Worte hervorgestoßen, schüttelte ein Hustenkrampf seinen ohnehin geschwächten Körper. Kersten griff nach dem Tonbecher mit dem verdünnten Starkbier und reichte ihn seinem Vater. Gierig griff der nach dem Getränk. Seine Stimme klang rau, als er fortfuhr: »Bitte, mein Sohn. Ich kann nicht in Ruhe sterben …«
»Vater. Ich kann Braunschweig nicht verlassen. Wer soll sich um den Handel kümmern?«
Beistand suchend schaute Kersten seine Mutter an, die seinem Blick jedoch auswich. Stattdessen wischte Fredereke ihrem Gemahl mit einem weichen Tuch über das Gesicht, säuberte ihn von Biertropfen und Hustenschleim.
»Sprich nicht vom Tod«, sagte sie zu ihrem Gemahl. Sorge zeichnete sich auf ihren feinen Zügen ab, in denen die Schlaflosigkeit tiefe Spuren hinterlassen hatte. Als er seine Mutter ansah, entdeckte Kersten zum ersten Mal, dass sie den Jahren Tribut hatte zollen müssen. Dem Alter und der Angst, ihren Gemahl an den Tod zu verlieren. »Du wirst wieder gesund.«
Als Kersten zu seiner Mutter schaute, senkte diese erneut den Blick zu Boden. Zu deutlich stünde ihr die Lüge ins Gesicht geschrieben. Keiner von ihnen glaubte, dass Acchem van dem Broke die Krankheit überleben würde, die ihn schon so lange in ihren fiebrigen Krallen hielt. Seit den furchtbaren Geschehnissen im Umfeld des Bürgeraufstands vor sieben Jahren, der etliche Braunschweiger Ratsherren den Kopf gekostet hatte, war Kerstens Vater von Jahr zu Jahr schwächer geworden, als hätte er den Lebensmut verloren. Nun hielt ihn wohl nur noch sein eiserner Wille aufrecht. Der Wille und der Wunsch, die Schuld zu tilgen, die der ehemalige Ratsherr so lange mit sich herumgetragen hatte.
Sieben Jahre hatte Acchem van dem Broke Zeit gehabt, zu Aleke zu reisen und sich bei ihr zu entschuldigen oder ihr zu erklären, was ihn zu seinen Lügen bewogen hatte. Stattdessen hatte der Braunschweiger Ratsherr es vorgezogen, weiterhin den Mantel des Schweigens über sein Versagen zu decken.
Kersten erschrak über die Bitterkeit seiner Gedanken. Selbst damals, als er gebrochen aus dem Kerker entkommen war, hatte er seinem Vater nicht derartig heftige Vorwürfe gemacht, sondern sich nur über seine wiedergewonnene Freiheit gefreut. Doch je mehr Zeit vergangen war, desto stärker waren Kerstens Vorbehalte geworden, die er allerdings nur einmal ausgesprochen hatte. Erst hatte das Glück, dem Rade entkommen zu sein, überwogen. Dann hatte er sich gescheut, Zorn gegenüber seinem Vater zu empfinden, der ihm so viel Gutes getan hatte.
Als hätte Acchem van dem Broke die Gedanken seines Sohnes gelesen, flehte er erneut: »Bitte, du musst sie herholen. Ich kann nur Frieden finden, wenn Aleke mir vergibt.«
»Ach, Vater«, versuchte Kersten freundlich zu antworten, obwohl ihm eine scharfe Entgegnung auf der Zunge lag. Wie stellte er sich das vor? Als könnte Kersten von einem Tag auf den anderen alles stehen und liegen lassen, um eine Frau zu suchen, die seinem Vater eh nicht vergeben würde. Bei dem Gedanken an Aleke begann Kerstens rechte Hand erneut zu schmerzen, als wären die entsetzlichen Wunden ihm erst vor kurzem zugefügt worden. Gedankenverloren kratzte er den Handschuh aus feinstem Ziegenleder, hinter dem er seine zerstörten Finger verbarg. »Wer soll das Geschäft führen?«
»Nichts ist so wichtig wie mein Seelenheil.« Acchem van dem Broke griff nach der linken Hand seines Sohnes und umklammerte sie mit mehr Kraft, als man von seinem geschwächten Körper erwartet hätte. »Deine Mutter und die Knechte können sich um den Handel sorgen. Bitte, Kersten, bitte. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit.«
Bevor Kersten etwas erwidern konnte, schaute seine Mutter ihn an. So flehentlich, dass ihm keine Wahl blieb. Warum nur sprang Fredereke van dem Broke ihrem Gemahl zur Seite, obwohl dessen Wunsch so aussichtslos war? Warum nutzte seine Mutter ihren Einfluss nicht, um Acchem van dem Broke davon abzubringen, sein Lebenswerk für einen sinnlosen Traum zu opfern?
Nur gut, dass Kersten seine Eltern und deren Wünsche bereits durchschaut hatte. Daher hatte er bereits alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um die Reise zu unternehmen. Allerdings blieb ein mulmiges Gefühl. Allein der Weg würde ihn vier oder fünf Tage kosten, wenn sein Pferd gesund bliebe. Vier Tage hin, vier Tage zurück, ein oder zwei Tage, um mit Aleke zu reden. Zehn verschwendete Tage, aber nun denn, wenn es der letzte Wunsch seines sterbenden Vaters war.
»Gut.« Kersten seufzte. »Morgen früh werde ich nach Bremen aufbrechen.«
»Danke, mein Sohn.« Als wäre seine Kraft damit erschöpft, ließ Acchem van dem Broke sich wieder auf sein Lager sinken und schloss die Augen. »Möge unser Herr deine Wege segnen.«
Auf einen Wink seiner Mutter folgte Kersten ihr vor die Tür der Schlafkammer.
»Danke«, sagte Fredereke so leise, als könnte ihr Gemahl sie hören. »Du tust das Richtige.«
»Vielleicht.« Kersten hob zweifelnd die Hände. Er konnte das Unbehagen nicht benennen, das ihn überfallen hatte, seitdem sein Vater die Reise von ihm gefordert hatte, aber es wuchs und legte sich schwer auf seine Gedanken. »Aber, Mutter, glaubst du wahrlich, dass Aleke Vater vergeben kann?«
Wenn nicht einmal ich es kann, dachte er, behielt die Worte aber für sich, weil er seiner Mutter nicht noch mehr Schmerz zufügen wollte. Fredereke van dem Broke war durch schwere Stunden gegangen, bis sie ihrem Mann verzeihen konnte, dass er ihrer aller Leben und Glück aufs Spiel gesetzt hatte. Aber ihr war nicht viel Zeit geblieben, Groll zu hegen.
Vor sieben Jahren war Kersten durch eine Intrige seines Onkels Hinrek beinahe als Mörder verurteilt worden. Hinrek van dem Broke und sein Kumpan Gerwen Krameres hatten Ceffeken, Kerstens Braut, in der Hochzeitsnacht ermordet. Hinrek, weil er Spielschulden hatte und verzweifelt war, Krameres wohl nur aus reiner Boshaftigkeit. Allein dank Aleke und Righert van Anhald hatte Kersten dem Kerker entkommen können. Der peinlichen Befragung jedoch hatte er sich unterziehen müssen – die Narben trug er noch heute an Körper und Seele mit sich.
Bald nachdem Kersten glücklich dem Kerker entkommen war, hatte Braunschweig gebrannt. Die Zunftmeister und Bürger hatten sich gegen den Stadtrat gewandt, die Ratsherren getötet und Feuer an die Stadt gelegt. Nur mit viel Glück hatten die van dem Brokes entkommen können. Ein halbes Jahr hatten sie bei Geschäftsfreunden in Helmenstede verbracht, bis sich die Lage in der Stadt so weit beruhigt hatte, dass sie zu Haus und Hof zurückkehren konnten. Fredereke hatte ihre Sachen für immer packen wollen, um in einer anderen Stadt zu leben, aber Acchem van dem Broke brachte es nicht über sich, Braunschweig zu verlassen.
Etwas, das Kersten beim besten Willen nicht verstehen konnte. Schließlich verband die Familie viele düstere Erinnerungen mit Braunschweig. Er selbst konnte es kaum über sich bringen, am Rathaus vorbeizugehen, in dessen Kerker er die schlimmen Folterqualen der peinlichen Befragung durchlitten hatte. Aber sein Vater wollte unbedingt bleiben. Als gute Gemahlin stand ihm Fredereke treu zur Seite, so dass Kersten ebenfalls keine Wahl blieb und er sein Leben in der Stadt verbringen musste, die ihm das Liebste genommen hatte.
Vielleicht ist die Reise ja eine Chance für mich, überlegte sich Kersten. Vielleicht könnte er nach dem Tode seines Vaters in Bremen leben. Sofort überkam ihn das schlechte Gewissen.
»Kersten.« Die Stimme seiner Mutter klang müde. Seit dem Voranschreiten der Krankheit seines Vaters wirkte sie grau und gramgebeugt, ihr schönes Gesicht übermüdet. »Ich weiß, wie schwer es dir fällt, hier zu leben. Möglicherweise solltest du –«
»Ich will nicht heiraten«, unterbrach er sie rüde und bereute sofort, dass er so barsch gewesen war, weil Fredereke erbleichte. »Mutter. Bitte. Ich möchte weder über eine Gemahlin reden noch darüber nachgrübeln. Nicht, nachdem …«
Er brauchte die schrecklichen Worte nicht aussprechen, wusste seine Mutter doch genau, worauf Kersten anspielte. Dass diesem bitteren Unglück qualvolle Tage im Kerker gefolgt waren, daran trug Acchem van dem Broke einen wesentlichen Anteil, etwas, das Kersten ihm selbst auf dem Totenbett nicht verzeihen konnte. Denn sein Vater hatte Hinrek geschützt, um den Preis, dass Kersten als Mörder verurteilt zu werden drohte.
»Wenn du Aleke gefunden hast, sende ihr einen Gruß.« Fredereke rang sichtlich um Fassung. »Bitte sie auch in meinem Namen um Vergebung und um ihre Rückkehr nach Braunschweig.«
»Ich werde mein Glück versuchen.« Kersten umarmte seine Mutter, die zu müde schien, um diese Geste zu erwidern. »Aber ich fürchte, wir haben ihr nichts anzubieten. Warum sollte sie Vater noch einmal sehen wollen?«
»Ich weiß.« Es gelang Fredereke van dem Broke nicht mehr, die Fassung zu bewahren. Tränen strömten aus ihren Augen. Ihre Worte waren hinter dem Schluchzen kaum zu verstehen. »Aber ich hoffe, dass Aleke sich an das Gute erinnert, was dein Vater für sie getan hat. Nun, wo sie selbst Familie hat, kann sie vielleicht besser verstehen, warum Acchem handeln musste, wie er handelte.«
Es ist nur die Traurigkeit, die aus ihr spricht, redete Kersten sich ein, obwohl er den Vorwurf nur zu gut kannte, den ihm seine Mutter machte. Aleke hatte geheiratet, möglicherweise sogar Kinder, während er es vorzog, alleine zu leben. Wie konnte seine Mutter nur von ihm verlangen, dass er alles verleugnete, was geschehen war? Dass er Ceffeken verriet, die er so sehr geliebt hatte.
»Ich muss mit den Knechten reden«, sagte er schmallippig, bevor er sich umdrehte und seine Mutter stehenließ. »Es ist noch einiges zu besprechen, bevor ich abreisen kann.«
KAPITEL 3
Bremen 1381
Nun gut. Dann warten wir eben auf die Kogge, die mir das Tuch aus Brügge bringt.« Righert donnerte mit der Faust auf den schweren Tisch, was die drei Männer, denen er gegenübersaß, nicht beeindruckte. Sie musterten ihn mit undurchdringlichen Mienen, so wie sie ihn die gesamte Verhandlung über angesehen hatten. Kühl und gelassen, so waren die Bremer Kaufleute. So beherrscht, dass Righert sich vorkam wie ein Narr, weil sein Temperament mit ihm durchgegangen war.
Zu groß war der Druck, unter dem er stand. Falls es ihm nicht gelänge, die Waren, die er in den nächsten Tagen erwartete, mit Gewinn zu verkaufen, dann war sein Geschäft gefährdet. Das Tuch, das er jeden Tag erwartete, hatte er mit dem letzten Silber bezahlt, das ihm geblieben war. Sollte es ihm nicht gelingen, seine Waren gut zu veräußern, stand sein Handel auf dem Spiel. Im schlimmsten Fall bliebe ihm nichts anderes übrig, als mit Aleke und seiner Familie nach Magdeburg zu gehen und seinen Onkel um Hilfe zu bitten. Nicht, dass der ihn nicht unterstützen würde, aber Righerts Stolz ließ nicht zu, dass er scheiterte.
Alles hatte Righert versucht, um die Bremer auf seine Seite zu ziehen. Den besten Wein hatte er ihnen aufgetischt, begleitet von Würzküchlein, wie sie nur Wynneke backen konnte. Die Kaufleute hatten seinen Clarêt getrunken, als wäre er billiges Bier, hatten nicht einen Krümel von den Leckereien stehen lassen, aber einen Sinneswandel hatte Righert bei ihnen nicht erreichen können. Sie würden ihm nicht helfen. Einander würden sie beistehen, aber nicht ihm, einem Fremden, der vor einem halben Jahr in die Weserstadt gezogen war und es wagte, als Fernhändler tätig zu werden. Die Bremer konnten es Righert zwar nicht verbieten, seine Waren in ihrer Stadt zu verkaufen, aber sie hatten ihm von Anfang an Steine in den Weg gelegt.
Obwohl Righert eine Ausbildung zum Fernhändler aufwies und sieben Jahre im Ausland verbracht hatte, spürte er seitens der Bremer Kaufleute stets Vorbehalte. Auch wenn er es nur ungern zugab, so musste Righert sich eingestehen, dass er niemals Teil der Bremer Handelsfamilien sein würde. Stets würde man ihn als Zugezogenen betrachten, dem man nicht so vertrauen konnte wie einem alteingesessenen Bremer. Und ihm blieb die Möglichkeit verwehrt, durch eine passende Heirat in den Kreis der Kaufmannsfamilien zu gelangen. Nur seine Kenntnisse des Welschen machten ihn für die Kaufleute der Weserstadt interessant. Aber wohl nicht interessant genug, dass sie sich dazu herabließen, ihm etwas entgegenzukommen.
»Habt Dank für den Wein.« Borchard van Hemeling, der Erste unter Gleichen, der Kaufmann, der die Verhandlungen geführt hatte, während seine Kumpane nur genickt hatten, erhob sich. Sofort sprangen Gotfried van Gropelinghen und Frederik Wynman auf, als hätten sie nur auf dieses Signal gewartet. Sie nickten Righert knapp zu, bevor sie den Raum verließen. Borchard van Hemeling blieb noch einen Augenblick. »Falls Eure Ware nicht rechtzeitig kommt, könnt Ihr mich aufsuchen. Ich werde eine Lösung finden.«
»Ich« hatte der Bremer gesagt, nicht »wir«. Vor ohnmächtigem Zorn knirschte Righert mit den Zähnen, aber er musste sich zurückhalten, weil er nicht sicher war, dass er die Gunst von Borchard van Hemeling ablehnen könnte. Er musterte sein Gegenüber. Nur zwei oder drei Jahre älter als Righert war der Kaufmann, aber er gebärdete sich, als wäre er Righert um Jahrzehnte voraus. Was nur müssen die Ratsherren so protzen, dachte Righert, während er Borchard van Hemeling schweigend betrachtete. Trotz des für Bremen warmen Wetters war der Kaufmann in Zobel gehüllt, als wollte er seinen Reichtum zur Schau stellen. Ein Wunder, dass Borchard van Hemeling nicht bei jedem Schritt klingelte wie die Glocken des Bremer Doms, so wie der Händler mit Goldschmuck behangen war.
»Ich danke Euch für das Angebot«, brachte Righert endlich zwischen den Zähnen hervor. »Ich werde es sorgfältig prüfen, sollte das Tuch nicht so sein wie erwartet.«
»Ihr meldet Euch, sobald Eure Waren angekommen sind.« Borchard van Hemeling nickte Righert zum Abschied zu. »Gutes Tuch findet immer einen Abnehmer.«
Er betonte das »gut« so sehr, dass Righert erneut Zorn in sich aufwallen fühlte, aber er beherrschte sich.
»Dann sind wir uns einig.« Mühsam zwang Righert ein Lächeln auf sein Gesicht. »Gehabt Euch wohl.«
Righert wartete, bis Borchard van Hemeling die Tür hinter sich geschlossen hatten. Dann nahm er den tönernen Becher, aus dem der Ratsherr getrunken hatte, und warf ihn mit aller Kraft gegen die Wand. Sofort erschreckte er sich. Hoffentlich hatte das Getöse Aleke nicht geweckt, die sich vor dem Besuch der Bremer Kaufleute in ihre Kammer zurückgezogen hatte. Obwohl seine Gemahlin sich bemühte, tapfer zu sein, spürte Righert das Leid, das der Tod des armen Jungen, den sie nicht hatte heilen können, in ihr hervorgerufen hatte.
Sein Herz fühlte sich gleichzeitig freudig und schwer an, als er an seine Gemahlin dachte. Noch immer erschien es ihm als eine Gunst des Schicksals, dass er diese wunderbare Frau gefunden hatte, die ihm in seiner dunkelsten Stunde zur Seite gestanden hatte. Niemals hatte Righert zu hoffen gewagt, dass es einen Menschen gäbe, der ihm so vorbehaltlos vertraute und dem er vertrauen konnte. Umso mehr drückte ihn Alekes Unglück darüber, dass der Steinhauer-Knabe gestorben war, nieder. Wusste er doch nur zu gut, wie sehr Aleke Kinder liebte. Was war es für eine böse Laune der Natur, dass seine Gemahlin, die eine so wunderbare Heilerin für andere Menschen war, sich nicht selbst helfen konnte. Dass ihr der sehnlichste Wunsch verwehrt blieb. Ihnen beiden verwehrt blieb.
Righert sprang auf. Er hasste es, zur Untätigkeit gezwungen zu sein. Um sich abzulenken, würde er zum Markt gehen, um eine Leckerei für sie zu erwerben. Vielleicht würde eine Süßigkeit sie von ihrem Kummer etwas ablenken. Ach, was redete er sich da nur ein? In ohnmächtiger Wut schlug Righert gegen die Wand. Was war er nur für ein Mann? Weder in der Lage, erfolgreich zu handeln, noch seiner Frau ein Kind zu schenken.
Vielleicht hätte er auf Aleke hören und mit ihr in Salerno bleiben sollen, wie es ihr Wunsch war. Aber Righert hatte sich im Süden nie heimisch gefühlt. Die Sonne, die Aleke so schätzte, hatte ihm die Haut verbrannt. Die Menschen, deren laute Fröhlichkeit Aleke liebte, hatten ihn, der er eher ruhig und wortkarg war, nie verstehen können. Nur ihretwegen hatte er es die langen Jahre dort ausgehalten. Als sie aus Braunschweig geflohen waren, hatte Righert Aleke versprochen, dass sie an der Schola Medica Salernitana studieren könnte. Dieses Versprechen hatte er gehalten, weil er sie liebte und für sie alles auf sich nehmen würde, was nötig war, wenn es Aleke denn glücklich machte. Er hatte die Zeit ihres Studiums genutzt, seine Ausbildung als Fernhändler voranzutreiben und Sprachen zu lernen, aber glücklich war er in Salerno nicht geworden.
In Bremen allerdings auch nicht. Die Hansestadt hatte sich ihm gegenüber nicht so weltoffen präsentiert, wie er es erwartet hatte. Schlimmer noch, Aleke litt unter den Anfeindungen, die ihr die Bremer Bürger entgegenbrachten. Wäre Rina von Bremhen nicht, dann wäre Aleke vollends unglücklich.
Die Tür zu seiner Schreibstube öffnete sich einen Spalt. Righert schaute auf, in der Hoffnung, dass seine Gemahlin aufgestanden war, um ihn zu suchen. Doch es