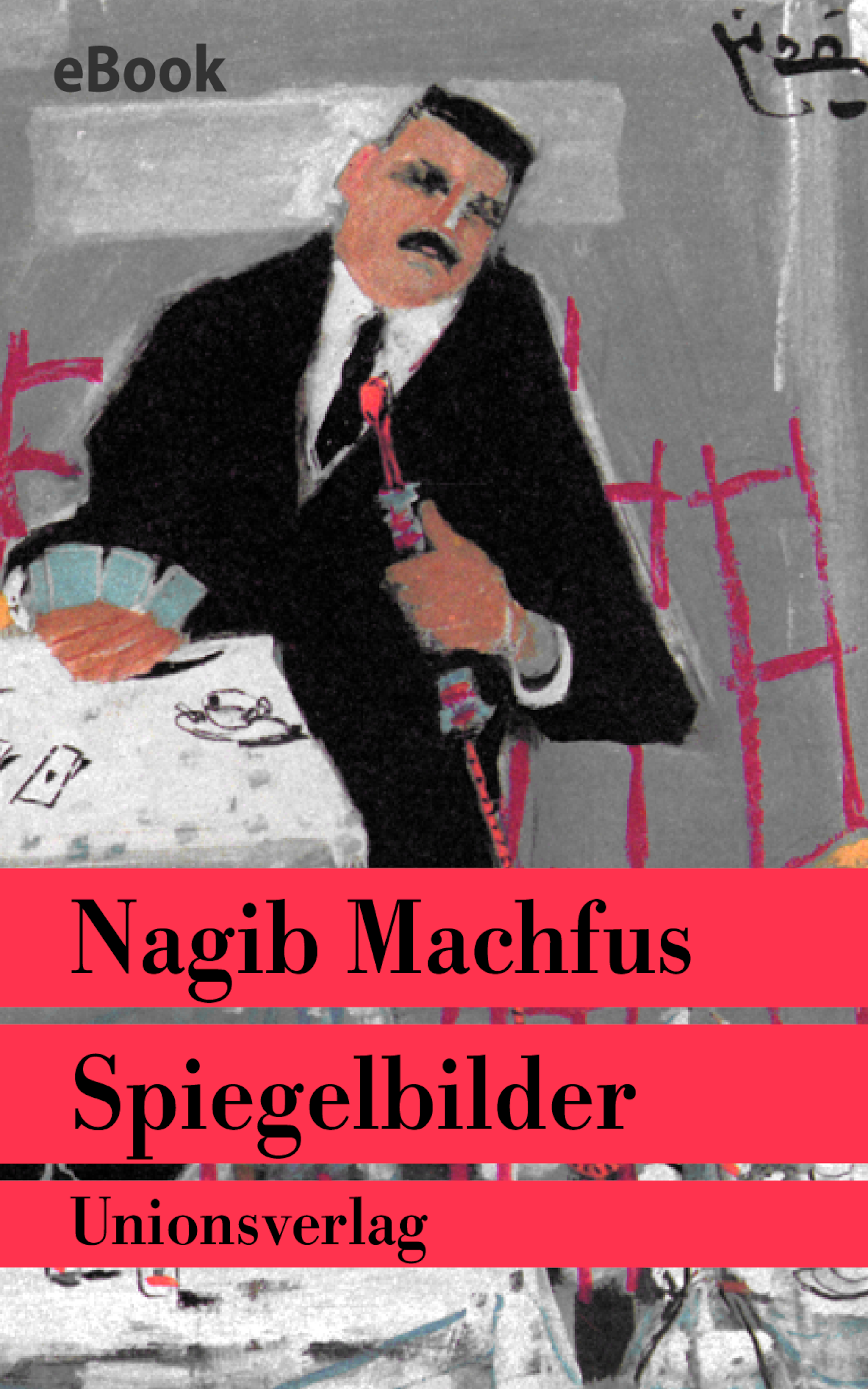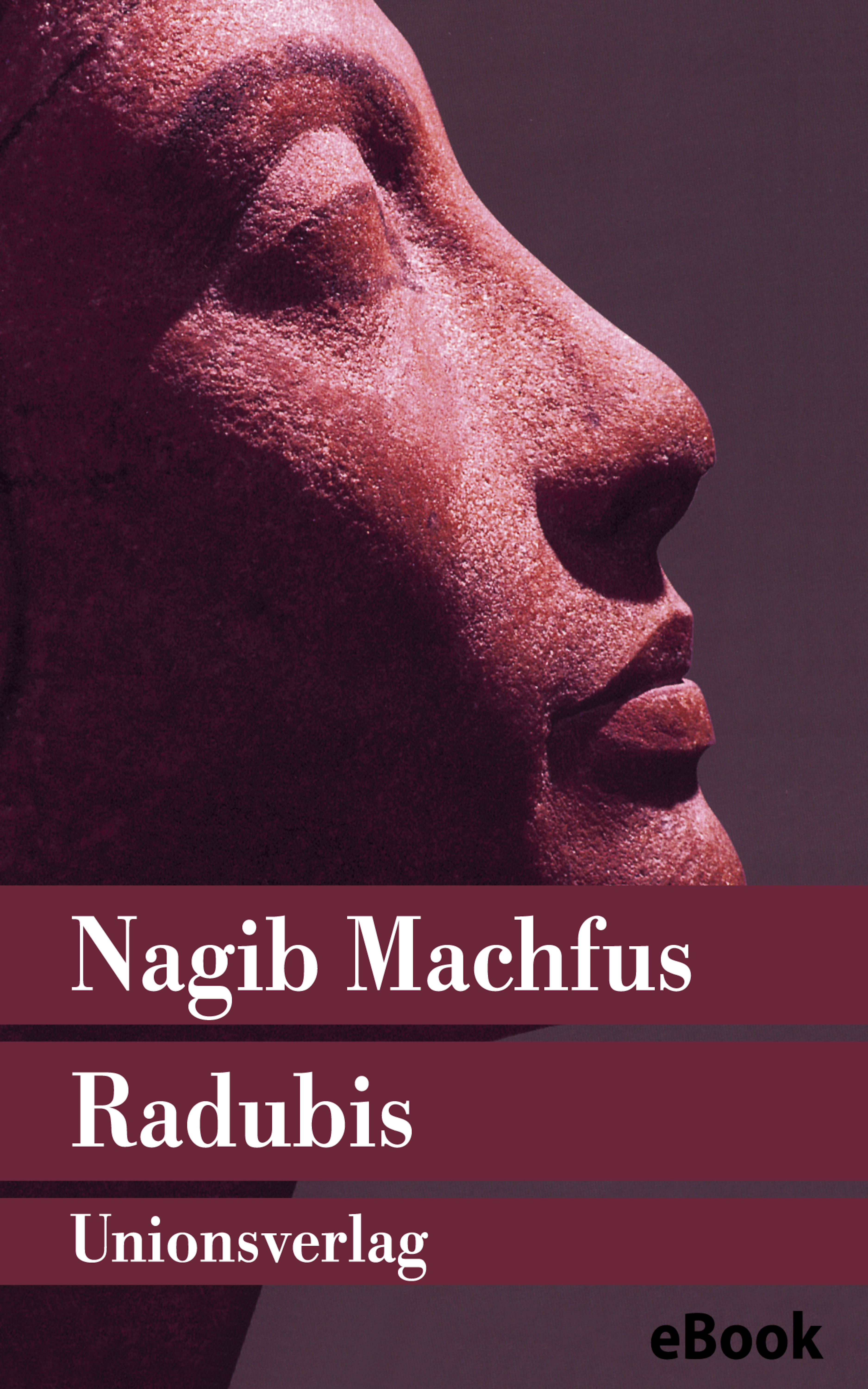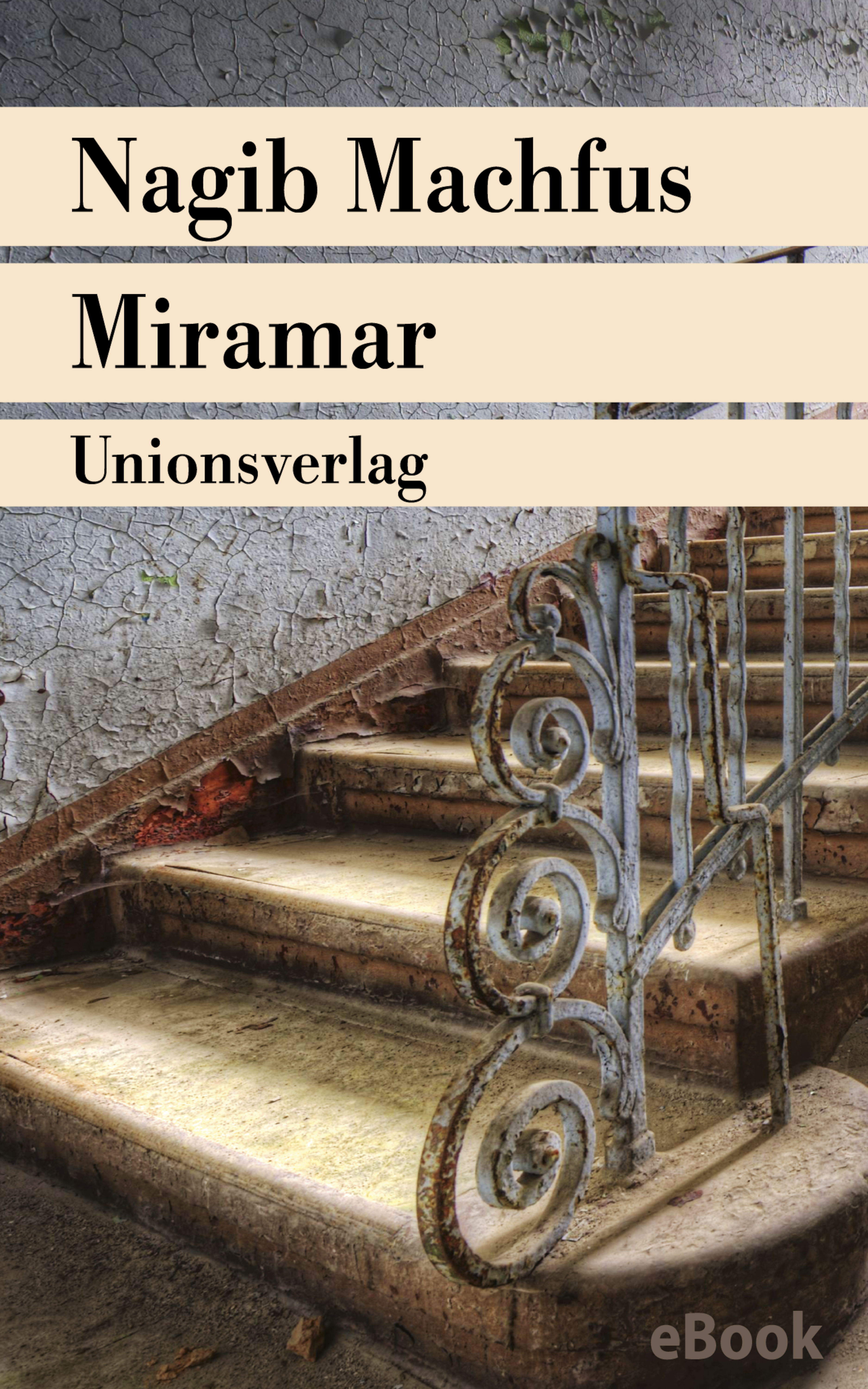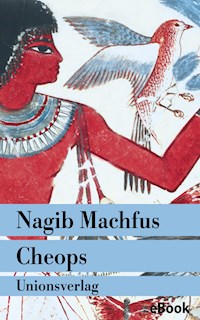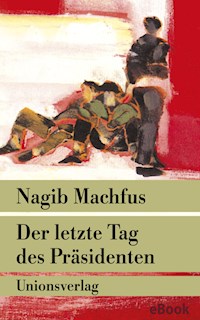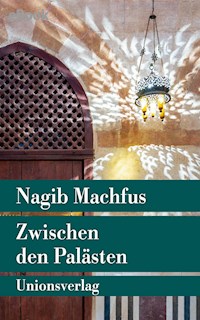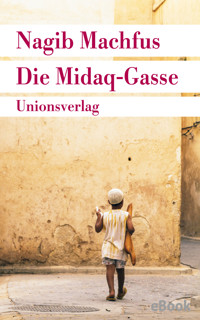
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einst glänzte die Midaq-Gasse wie ein Stern in der Geschichte des mächtigen Kairo. Inzwischen sind die Arabesken am berühmten Kirscha-Kaffeehaus bröcklig und morsch geworden. Onkel Kamil, der Bonbonverkäufer, der alte Dichter, den keiner mehr hören will, seit es das Radio gibt, der stolze Chef der Handelsfirma, ja sogar der düstere Zita, der aus Menschen Krüppel macht, damit sie besser betteln können - sie alle spüren die neue Zeit, deren Rhythmus die Stadt erobert. Jeder sucht seinen eigenen Weg in die Zukunft. Umm Hamida, Chronistin aller Nachrichten und wandelndes Lexikon aller Missetaten, hat täglich mehr zu erzählen über die Geheimnisse dieser Gasse, denn eine Welt ist in Unordnung geraten. In diesem Roman wird eine Altstadtgasse von Kairo zum Mikrokosmos einer Welt im Umbruch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Einst glänzte die Midaq-Gasse wie ein Stern in der Geschichte des mächtigen Kairo. Inzwischen sind die Arabesken am berühmten Kirscha-Kaffeehaus bröcklig und morsch geworden, aber immer noch ist die Gasse erfüllt vom Lärm ihres eigenen Lebens. Hier laufen die Fäden zusammen, hier strömen die Menschen ein und aus – Mikrokosmos einer Welt im Umbruch.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Nagib Machfus (1911–2006) gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart und gilt als der eigentliche »Vater des ägyptischen Romans«. Sein Lebenswerk umfasst mehr als vierzig Romane, Kurzgeschichten und Novellen. 1988 erhielt er als bisher einziger arabischer Autor den Nobelpreis für Literatur.
Zur Webseite von Nagib Machfus.
Doris Kilias (1942–2008) arbeitete als Redakteurin beim arabischen Programm des Rundfunks Berlin (DDR). Nach der Promotion war sie als freie Übersetzerin tätig.
Zur Webseite von Doris Kilias.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Nagib Machfus
Die Midaq-Gasse
Roman
Aus dem Arabischen von Doris Kilias
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 6 Dokumente
Die arabische Originalausgabe erschien 1974 in Kairo unter dem Titel Zuaqaq al-Midaqq
Originaltitel: Zuqaq al-Midaqq (1947)
© by Nagib Machfus 1947
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Verlags Volk und Welt, Berlin© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Barbara Bischof
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30576-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 09:36h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE MIDAQ-GASSE
1 – Viele Zeugnisse sprechen dafür, dass die Midaq-Gasse zu …2 – Sie musterte sich im Spiegel, ohne etwas zu …3 – Kurz nachdem Frau Sanija gegangen war, kam Hamida …4 – Früh am Morgen ist die Gasse feucht und …5 – Nachmittag … Ganz allmählich tauchte die Gasse wieder …6 – Meister Kirscha, der Kaffeehausbesitzer, war mit etwas Wichtigem …7 – Die Bäckerei gleich neben dem Kaffeehaus war nicht …8 – Von der Firma ging ein solcher Lärm aus …9 – Auf Umm Husain, der Frau von Meister Kirscha …10 – Abbas al-Hilu sah sich immer wieder prüfend im …11 – O Allah, vergib mir und sei gnädig« …12 – Geduldig wartete Umm Husain den ersten Tag ab …13 – Die letzte Begegnung mit Hamida in der Azhar-Straße …14 – Nachdem Abbas abgereist und nichts mehr von ihm …15 – Frau Sanija Afifi hatte es klopfen gehört …16 – Was sehe ich da! Du bist ja ein …17 – Herr Salim Alwan saß wie immer am Schreibtisch …18 – Umm Hamida eilte nach Hause. Auf dem kurzen …19 – An einem der nächsten Tage war die Gasse …20 – Von nun an kam er regelmäßig in die …21 – Doktor Buschi wollte gerade seine Wohnung verlassen …22 – Glockengeläut weckte Onkel Kamil aus seinem gewohnten Schlummer …23 – Ins Kaffeehaus gehe ich nicht mehr, damit in …24 – Ihre Mutter fragte gleich, warum sie so spät …25 – Husain Kirscha war auf dem Weg zur Midaq-Gasse …26 – Hamida öffnete schlaftrunken die Augen und sah über …27 – Dunkelheit lag über der Gasse, tiefe Stille herrschte …28 – Onkel Kamil schlief wie immer auf dem Stuhl …29 – Kaum hatte Salim Alwan den Vertrag unterschrieben …30 – Abbas al-Hilu hatte sich in Onkel Kamils Wohnung …31 – Der nachmittägliche Spaziergang war das Einzige, was sie …32 – Abbas!«, schrie Hamida. Abbas al-Hilu war völlig außer …33 – In der Midaq-Gasse herrschte Abschiedsstimmung, aber niemand war …34 – Einen besseren Rat als den von Radwan al-Husaini …35 – Morgenlicht überflutete die Gasse, die ersten Sonnenstrahlen spiegelten …WorterklärungenNagib MachfusMehr über dieses Buch
Über Nagib Machfus
Nagib Machfus: Das Leben als höchstes Gut
Nagib Machfus: Rede zur Verleihung des Nobelpreises 1988
Tahar Ben Jelloun: Der Nobelpreis hat Nagib Machfus nicht verändert
Erdmute Heller: Nagib Machfus: Vater des ägyptischen Romans
Gamal al-Ghitani: Hommage für Nagib Machfus
Hartmut Fähndrich: Die Beunruhigung des Nobelpreisträgers
Über Doris Kilias
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Nagib Machfus
Zum Thema Ägypten
Zum Thema Arabien
Zum Thema Großstadt
1
Viele Zeugnisse sprechen dafür, dass die Midaq-Gasse zu den Kostbarkeiten vergangener Jahrhunderte gehört und einstmals in der Geschichte des mächtigen Kairo wie ein strahlender Stern geglänzt hat. Welches Kairo meine ich? Das Kairo der Fatimiden, der Mamluken oder das der Sultane? Allein Gott und die Archäologen wissen das. Auf jeden Fall ist diese Gasse ein geschichtliches Denkmal, und zwar ein wertvolles. Wie auch nicht, wo doch die mit Steinplatten belegte Straße direkt zur Sanadiqija-Straße hinunterführt, diesem historischen Winkel mit dem berühmten Kirscha-Kaffeehaus, mit seinen Wänden voller Arabesken aus längst vergangener Zeit, bröckelig und morsch nun, und mit dem starken Duft uralter Heilkräuter, die mittlerweile zu wohlduftenden Parfümen geworden sind.
Obwohl die Gasse fast gänzlich ausgeschlossen vom Getriebe der Welt lebte, war sie doch vom Lärm ihres eigenen Lebens erfüllt, einem Leben, das in tiefstem Innern unlösbar im Ganzen, vollen Sein verwurzelt war und erst noch die Geheimnisse der alten, vergangenen Welt in sich barg und bewahrte.
Die Sonne kündigte den nahenden Abend an, und die Midaq-Gasse hüllte sich in den bräunlichen Schleier der Dämmerung. Wie in einer Falle gefangen, war das Abendlicht von drei Wänden umschlossen, was die Brauntöne noch stärker hervortreten ließ. Die Gasse führte von der Sanadiqija-Straße herauf und stieg unregelmäßig an. Auf der einen Seite gab es einen Laden, ein Kaffeehaus und eine Bäckerei, auf der anderen einen zweiten Laden und eine Handelsfirma. Wie ihr vergangener Ruhm endete die Gasse jäh an zwei nebeneinanderliegenden dreistöckigen Häusern.
Das lärmende Leben des Tages verstummte, die sanften Töne des Abends breiteten sich aus. Ein Wispern hier, ein Murmeln dort:
O Allah, Helfer in der Not … Du Ernährer, du Wohltäter … O Allah, möge alles gut enden … Allein bei Ihm liegt alles … Guten Abend, Leute. Kommt nur, kommt, nun ist die Zeit, sich zu unterhalten … Steh auf, Onkel Kamil, und schließe den Laden … Wechsle das Wasser in den Pfeifen, Sanqar! … Lösch das Feuer im Ofen, Djada! … Dieses Haschisch presst mir das Herz zusammen … Wenn wir schon fünf Jahre lang nächtliche Finsternis und Luftangriffe erdulden müssen, dann liegt das nur an unserer eigenen Schlechtigkeit …
Nur die Läden von Onkel Kamil, dem Bonbonverkäufer rechts am Anfang der Gasse, und der Frisiersalon von al-Hilu auf der linken Seite blieben noch ein wenig nach Sonnenuntergang geöffnet. Onkel Kamil hatte die Gewohnheit – genauer gesagt, er hielt es für sein Recht –, einen Stuhl auf die Schwelle seines Ladens hinauszustellen und mit dem Fliegenwedel im Schoß zu schlummern. Nur das laute Rufen eines Kunden oder ein Scherz von Abbas al-Hilu, dem Friseur, konnten ihn wecken. Er war eine einzige gewaltige Fleischmasse, der Djilbab spannte sich auf seinen Schenkeln, sodass sie aussahen wie Wasserschläuche. Hinten bauschte sich das Gewand wie eine Kuppel, deren Mittelpunkt auf dem Stuhl lag, während der Rest frei in der Luft hing. Er hatte einen Bauch wie eine Tonne und weiche, ausladende Brüste. Von einem Hals war kaum etwas zu sehen, denn dicht zwischen den Schultern saß ein rundes, aufgeblähtes Gesicht, in dem sich das Blut staute. In all dem Fett waren Gesichtszüge kaum noch zu erkennen, es zeichnete sich keine feste Linie ab, und fast sah es so aus, als habe er weder Nase noch Augen. Gekrönt war das alles von einem kleinen, kahlen Schädel, der ebenso rosig war wie die übrige Haut. Ständig keuchte und prustete er, als nähme er unentwegt an einem Wettlauf teil. Kaum hatte er ein paar Bonbons verkauft, da überfiel ihn schon wieder der Schlaf. Wie oft hatten ihn die anderen gewarnt, die Herzverfettung könne eines Tages zu seinem plötzlichen Ende führen. Er stimmte ihnen immer zu. Aber wie sollte ihm der Tod schaden, wenn doch sein ganzes Leben ein ununterbrochener Schlaf war?
Der Salon von al-Hilu war zwar ein kleiner Laden, galt aber in der Gasse als sehr elegant, gab es doch außer den vielen Geräten auch einen Spiegel und einen Sessel. Der Besitzer all dessen war von mittlerem Wuchs, neigte zur Fülle und hatte eine blasse Hautfarbe. Die Augen standen ein wenig hervor, und die ordentlich gekämmten Haare hatten trotz der Bräune der Haut einen Stich ins Gelbliche. Er trug einen Anzug, darüber eine Schürze – stand ihm das vielleicht nicht ebenso zu wie den Großen seines Fachs?
Onkel Kamil und Abbas al-Hilu waren in ihren Läden noch anzutreffen, wenn die dem Salon benachbarte Handelsfirma schon ihre Pforten schloss und die Angestellten nach Hause gingen. Der Letzte, der ging, war der Chef, Herr Salim Alwan. Stolzen Schritts ging er in seinem Kaftan auf die Kutsche zu, die ihn am Anfang der Gasse erwartete. Würdevoll stieg er ein und füllte mit seinem stattlichen Körper den Sitzplatz voll aus. Ein Tscherkessen-Schnurrbart wippte ihm forsch voraus. Der Kutscher trat mit dem Fuß auf die Glocke, sodass sie kräftig läutete. Der einspännige Wagen fuhr die Rurija-Straße hinunter und weiter in Richtung der Hilmija-Straße.
Die Fensterläden der beiden Häuser am Ende der Straße wurden zum Schutz gegen die Nachtkälte geschlossen, Lampenschein drang durch ihre Ritzen. Die Midaq-Gasse wäre in völligem Dunkel versunken, wenn da nicht Kirschas Kaffeehaus gewesen wäre. Die Schnüre der elektrischen Lampen waren voll von Fliegen. Der Raum war quadratisch und ein wenig verkommen. Aber noch waren ja die Arabesken an den Wänden. Nur noch ihr Alter und mehrere Sofas längs der Wände erinnerten an die großen Zeiten. Am Eingang war gerade ein Arbeiter dabei, einen alten Lautsprecher an der Wand anzubringen. Einige wenige Leute saßen herum, rauchten Wasserpfeifen und tranken Tee.
Nahe der Eingangstür saß ein etwa fünfzigjähriger Mann, die Beine auf dem Polster gekreuzt. So wie die Effendis trug er einen Djilbab mit Kragen und Krawatte. Auf seiner Nase saß eine goldgerahmte, teuer aussehende Brille. Die Holzpantoffeln hatte er abgestreift, sie lagen zu seinen Füßen. Reglos wie ein Denkmal und schweigend wie ein Toter hockte er da und schaute weder nach links noch nach rechts, als sei er ganz allein auf der Welt.
Draußen näherte sich dem Kaffeehaus ein greiser Mann, dem die Zeit keine einzige heile Stelle am Körper gelassen hatte. An seiner linken Seite ging ein Junge und führte ihn. Unter dem rechten Arm trug er eine Rebab und ein Buch. Beim Eintreten grüßte der Alte die Anwesenden und ging auf die Polsterbank in der Mitte des Raums zu. Mithilfe des Jungen stieg er hinauf. Der setzte sich neben ihn und legte die Rebab und das Buch zwischen sich und den Alten. Der Mann musterte die Gesichter der Besucher, als wolle er den Eindruck prüfen, den sein Erscheinen bei ihnen hervorgerufen hatte. Dann richtete er die trüben, entzündeten Augen unruhig auf den Bedienungsgehilfen Sanqar. Als ihm klar wurde, dass der Junge ihn absichtlich übersah, brach er sein Schweigen und sagte grob: »Kaffee, Sanqar!«
Der Bursche guckte kurz hinüber, drehte ihm dann nach kurzem Zögern wortlos den Rücken zu und überhörte die Bestellung. Dem Alten war klar, dass der Junge ihn auch weiterhin übersehen würde, er hatte auch nichts anderes erwartet. Aber der Himmel schien ihm zu Hilfe zu kommen, denn genau in diesem Moment war ein Mann hereingekommen, der den Alten gehört und die abweisende Haltung des Burschen beobachtet hatte. Gebieterisch befahl er: »Bring den Kaffee für den Dichter, Junge!«
Dankbar blickte der Alte ihn an und sagte mit trauriger Stimme: »Gott möge es Ihnen danken, Doktor Buschi.«
Der Doktor grüßte zu ihm hinüber und setzte sich nicht weit von ihm hin. Auch er hatte einen Djilbab an, trug auf dem Kopf ein Käppchen und an den Füßen Holzpantoffeln. Er war Zahnarzt, hatte aber seine Kunst dem Leben abgenommen, ohne je eine medizinische oder sonstige Schule besucht zu haben. Angefangen hatte er als Gehilfe bei einem Zahnarzt im Djamalija-Viertel. Gescheit wie er war, hatte er sich so manchen Kunstgriff abgeguckt und es zu etwas gebracht. Er war vor allem wegen seiner nützlichen Verordnungen berühmt geworden, auch wenn er das Ziehen eines Zahns noch immer als die beste Behandlung ansah. Sicherlich war es recht schmerzhaft, wenn er in seiner ambulanten Praxis einen Backenzahn zog. Aber dafür war es auch billig: einen Qirsch für die Armen und zwei für die Reichen – die der Midaq-Gasse natürlich. Und wenn tatsächlich einmal Blut floss, was gar nicht so selten war, dann sah er es als gottgegeben an und meinte, Allah werde es auch wieder stillen. Dem Meister Kirscha hatte er sogar ein goldenes Gebiss eingesetzt, für ganze zwei Pfund. In der Gasse und den benachbarten Vierteln wurde er »Doktor« genannt, und vielleicht war er der erste Arzt, der seinen Titel von den Patienten empfangen hatte.
Sanqar brachte dem Dichter Kaffee, so wie der Doktor es befohlen hatte. Der alte Mann nahm das Glas und pustete, um den Kaffee abzukühlen. Dann begann er, in kleinen Schlucken zu trinken. Als er fertig war und das Glas beiseitestellte, fiel ihm ein, wie schlecht der Bursche ihn behandelt hatte. Böse blickte er zu ihm hinüber und murmelte wütend: »Schlecht erzogen …« Dann nahm er die Rebab, probierte auf den Saiten herum und vermied ganz bewusst, die scheelen Blicke zur Kenntnis zu nehmen, mit denen Sanqar ihn bedachte. Ganz so, wie man es im Kaffeehaus Kirscha seit zwanzig Jahren oder mehr gewohnt war, begann er mit einem Vorspiel. Sein ausgemergelter Körper begann sich dem Rhythmus der Musik anzupassen, der Alte räusperte sich, spuckte aus und murmelte: »Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen …« Dann rief er mit rauer Stimme: »Bevor wir heute anfangen, wollen wir für den Propheten beten. Ein arabischer Prophet, auserwählter Sohn des Adnan. Abu Sada az-Zanat erzählt, dass …« Die raue Stimme eines Mannes, der gerade eingetreten war, unterbrach ihn: »Sei still! Kein einziges Wort mehr!«
Der Alte sah mit mattem Auge von seinem Instrument auf und erblickte Meister Kirscha. Er war ein Mann von schmaler, hoher Statur, mit dunkelhäutigem Gesicht und träge-verdrießlich blickenden Augen. Sprachlos starrte der Alte ihn an, so als könnte er nicht glauben, was seine Ohren eben gehört hatten. Er setzte sich über diese unerwartete Grobheit hinweg und begann wieder zu rezitieren: »Abu Sada az-Zanat erzählt, dass …«
Wütend fauchte ihn der Meister an: »Mit Gewalt willst du uns zwingen, dir zuzuhören? Hör auf, hör sofort auf! Hab ich dich nicht schon vor einer Woche gewarnt?«
Dem Dichter war anzusehen, dass er sich sehr ärgerte. Aber er sagte nur vorwurfsvoll: »Mir scheint, du nimmst zu viel Haschisch. Findest du wohl kein anderes Opfer als mich?« Der Dichter schlug nun einen etwas sanfteren Ton an, wohl in der Hoffnung, noch ein wenig Mitgefühl zu finden. »Aber das ist doch auch mein Kaffeehaus … Hab ich denn hier in den letzten zwanzig Jahren nicht immer rezitiert?«
Während Meister Kirscha wie immer seinen Platz hinter der Kasse einnahm, sagte er: »Wir alle haben deine Geschichten satt und können sie fast auswendig. Es gibt also keinen Grund, sie uns nochmals anzuhören. Die Leute wollen keinen Dichter mehr, wie oft haben sie mich gedrängt, ein Radio anzuschaffen. Und da ist es nun, da steht es. Also lass uns in Ruhe, möge Gott für dich sorgen.«
Das Gesicht des Dichters verdüsterte sich, und niedergeschlagen dachte er daran, dass das Kaffeehaus von Kirscha die letzte Zuflucht geworden war. Es war die einzig verbliebene Möglichkeit, den Unterhalt zu verdienen, und das nach Jahren großen Ruhms. Erst kürzlich hatte man ihm im Kaffeehaus »Zitadelle« bedeutet, dass man auf ihn verzichten konnte. So alt war er geworden, und nun stand er ohne allen Verdienst da. Was sollte er mit dem Leben anfangen? Wozu sollte er dann noch seinem unglücklichen Sohn diese Kunst beibringen, die keiner mehr wollte und die brotlos geworden war? Was würde ihm die Zukunft bringen, was seinem Jungen? Verzweiflung stieg in ihm auf; sie wurde noch bitterer, als er in Meister Kirschas Gesicht las, dass er zwar das Ganze ein wenig bedauerte, aber umso entschlossener war.
»Langsam, Meister Kirscha, langsam«, sagte er. »Al-Hilali hat immer wieder Neues, das kann das Radio gar nicht bringen.«
»Das sagst du«, antwortete der Meister schroff. »Aber dein Gerede bringt mir keine Kunden ein. Also ruiniere nicht länger mein Geschäft. Es hat sich eben alles verändert.«
Verbittert sagte der Alte: »Aber haben nicht Generationen seit der Zeit des Propheten – Segen und Friede sei mit ihm – diesen Geschichten zugehört, ohne sie langweilig zu finden?«
Da schlug Meister Kirscha mit der Faust auf die Kasse und schrie: »Ich hab doch gerade gesagt, dass sich alles verändert hat!«
In diesem Moment bewegte sich zum ersten Mal der starr und reglos sitzende Mann mit dem Kragen, der Krawatte und der goldenen Brille. Er hob den Kopf, blickte zur Decke auf und seufzte so tief, dass die anderen denken mussten, ihm sei die Seele aus dem Leib gerissen worden. Leise und geheimnisvoll sprach er: »Ach ja, alles hat sich verändert. Weil, meine Dame, sich eben alles geändert hat. Alles, alles – nur nicht mein Herz, das noch immer die Leute des Hauses Amer liebt.« Ganz langsam senkte er den Kopf, wiegte ihn von rechts nach links und von links nach rechts, wurde dann immer verhaltener in der Bewegung, bis er schließlich genauso reglos wie zuvor dasaß und in Abwesenheit versank.
Keiner der Anwesenden nahm Notiz von ihm. Nur der Dichter wandte sich ihm zu wie ein Dürstender, der auf Regen hofft: »Verehrter Scheich Darwisch, sind Sie denn damit zufrieden?« Aber nichts konnte diesen aus der Versunkenheit wecken, nichts war imstande, ihm ein Wort zu entlocken.
Genau in diesem Moment trat ein neuer Gast ein, auf den sich alle Blicke voller Ehrerbietung und Zuneigung richteten. Sein Gruß wurde auf das freundlichste erwidert. Radwan al-Husaini war eine respektgebietende Erscheinung, so groß und stark, wie er war. Die schwarze, stoffreiche Abaja umhüllte einen stattlichen Körper. Das Gesicht war großzügig geschnitten, sein Teint weiß mit einem Stich ins Rötliche, den auch der Bart auf Backen und Kinn aufwies. Auf seiner edlen Stirn lag ein Lichtglanz, der Heiterkeit, Güte und tiefen Glauben ausstrahlte. Er schritt gemächlich daher, mit gesenktem Haupt, und auf seinen Lippen lag ein leichtes Lächeln, das seine Liebe zu den Menschen und der ganzen Welt verriet.
Nachdem er sich neben den Dichter gesetzt hatte, begrüßte ihn der und klagte ihm sein Leid. Radwan al-Husaini hörte ihm bereitwillig zu, obwohl er das alles schon kannte. Schon oft hatte er versucht, Meister Kirscha davon abzubringen, auf den Dichter zu verzichten. Aber alles war vergebens gewesen. Als der alte Mann sich nun ausgeklagt hatte, beruhigte er ihn und versprach ihm, für seinen Jungen eine Arbeit zu besorgen, von der er leben könne. Heimlich steckte er ihm etwas Geld zu und flüsterte: »Wir alle sind die Kinder Adams, und wenn dich etwas quält, dann gehe zu deinem Bruder. Denn das tägliche Brot gibt der Herr, von ihm kommt jede Wohltat.«
Sein schönes Gesicht erstrahlte nach diesen Worten noch mehr, denn wie bei allen großzügigen Menschen, die Gutes tun, machte auch ihn die Wohltat glücklicher und schöner. Er war ständig darauf bedacht, dass kein Tag verging, an dem er nicht etwas Gutes tat; andernfalls wäre er bekümmert und schuldbewusst heimgekehrt. Hatte es bei all seiner Großmut auch den Anschein, dass er zu den mit Geld und Besitz reichlich versehenen Menschen gehörte, so gehörten ihm in Wirklichkeit doch nur das Haus rechts in der Gasse und ein paar Hektar Land in Mardj. Die Bewohner seines Hauses, Meister Kirscha im dritten und Onkel Kamil und Abbas al-Hilu im ersten Stock, hatten in ihm einen gutherzigen und freundlichen Vermieter gefunden. Er hatte sogar auf die Mieterhöhung verzichtet, zu der ihn ein Sondergesetz der Militärverwaltung über Mieten im ersten Stock berechtigt hatte, weil ihm seine beiden armen Mitbewohner leidgetan hatten. Wo immer er weilte und wandelte, war er voller Mitleid und Großmut.
Dabei war sein Leben reich an Enttäuschungen und Leid gewesen, vor allem in den frühen Jahren. Das Studium an der Azhar-Universität hatte mit einem Misserfolg geendet. Viele Jahre seines Lebens hatte er dort unter den Bogengängen verbracht und nie ein Gelehrtendiplom erworben. Der Verlust der Söhne war ein weiterer Schicksalsschlag gewesen, kein einziger Nachkomme war ihm von der reichen Kinderschar geblieben. Er hatte so viel schmerzliche Enttäuschungen durchlebt, dass sein Herz von Verzweiflung erfüllt war und in den Augen nur noch tiefste Trauer geschrieben stand. Er hatte ganz in sich zurückgezogen gelebt.
Aus der Finsternis all seines Schmerzes hatte ihn der Glaube herausgetragen und ihn das Licht der Liebe sehen lassen. Von da an kannte sein Herz keine Not und keine Trübsal mehr, sondern war nur noch von umfassender Liebe, überfließender Güte und unendlicher Geduld erfüllt. Die irdischen Kümmernisse zertrat er unter den Füßen, und seine Seele wandte sich dem Himmel zu, wenn er seine Liebe über die Menschen verströmte. Je schlimmer die Drangsal war, desto geduldiger und gütiger wurde er.
Damals, als er einen seiner Söhne zur letzten Ruhestätte begleitete, sahen die Menschen, wie er mit leuchtendem Gesicht den Koran rezitierte. Als sie ihn in ihre Mitte nehmen und ihm Trost spenden wollten, hatte er nur lächelnd zum Himmel gewiesen und gesagt: »Er hat gegeben, Er hat genommen. Alles geschieht, wie Er will, und alles gehört Ihm. Trauer ist Unglaube.« So war er also noch zum Tröster geworden. Doktor Buschi hatte deshalb einmal gesagt: »Bist du krank, dann halte dich an Herrn Husaini, und du wirst geheilt werden. Bist du verzweifelt, so bringt sein Glanz dir Hoffnung. Und bist du traurig, so lausche seinen Worten, und du wirst glücklich werden.« Sein Gesicht war ein wahres Abbild seines Wesens, war es doch von der Schönheit, die nur Barmherzigkeit spenden kann.
Der Dichter, nun halbwegs beruhigt und getröstet, stieg vom Sofa hinunter. Der Junge nahm die Rebab und das Buch und folgte ihm. Der Alte schüttelte Radwan al-Husaini die Hand, grüßte die anderen und übersah dabei geflissentlich Meister Kirscha. Mit einem verächtlichen Blick bedachte er den Lautsprecher, den der Arbeiter fast fertig installiert hatte, reichte dem Jungen die Hand und ging mit ihm hinaus.
Scheich Darwisch schien wieder einmal ins Leben zurückgekehrt zu sein. Er wendete den Kopf in die Richtung, in der die beiden verschwunden waren, und murmelte: »Der Dichter ist gegangen, das Radio ist gekommen. So ist es Brauch in der Schöpfung. So ist es mit der Geschichte – das ist das, was man auf Englisch kurz history nennt. Ich buchstabiere: h-i-s-t-o-r-y.«
Bevor er mit dem Buchstabieren fertig war, kamen Onkel Kamil und Abbas al-Hilu herein, die nun ihre Läden geschlossen hatten. Zuerst erschien al-Hilu, das Gesicht gewaschen, das blonde Haar frisch gekämmt. Onkel Kamil folgte ihm, gravitätisch schaukelnd wie eine Kamelsänfte und in mühevoller Bedachtsamkeit die Füße vom Boden hebend. Sie grüßten die Anwesenden, setzten sich nebeneinander und bestellten Tee. Kaum dass sie eingetreten waren, ging das Geschwätz auch schon los. Abbas begann: »Hört mal, Leute. Mein Freund, Onkel Kamil, hat sich bei mir beklagt, dass er jeden Moment sterben könne, aber kein Geld habe, um ordentlich begraben zu werden.«
»Mohammeds Gemeinschaft geht es gut, und sie trägt Sorge«, meinten einige sogleich beflissen. Andere sagten lachend, das, was er aus dem Verkauf der Bonbons herausschlage, reiche mehr als aus, um ein ganzes Volk zu beerdigen.
Auch Doktor Buschi lachte und sagte zu Onkel Kamil: »Hör auf, an den Tod zu denken. Bei Gott, mit deinen eigenen Händen wirst du uns alle noch ins Grab betten.«
Mit hoher, unschuldig klingender Kinderstimme antwortete Onkel Kamil: »Passen Sie auf, was Sie sagen, und fürchten Sie Allah, mein Herr. Ich bin wirklich ein armer Mann.«
Abbas al-Hilu unterbrach ihn: »Als ich Onkel Kamil so klagen hörte, tat er mir leid. Immerhin sind seine Bonbons ja für uns alle etwas Schönes. Also hab ich ihm ein Leichentuch gekauft und es für die Stunde verwahrt, der man nicht entkommen kann.« Er wandte sich an Onkel Kamil und fuhr fort: »Das war ein Geheimnis, von dem ich dir nichts sagen wollte. Aber jetzt wissen es alle und können es bezeugen.«
Voller Freude nickten die anderen beifällig, hatten aber Mühe, ernst zu bleiben, um den leichtgläubigen Onkel Kamil an den Worten von Abbas nicht zweifeln zu lassen. Man lobte dessen Großmut. Ja, hieß es, das sei eine würdige Tat gegenüber dem Mann, den er so gern mochte, mit dem er gemeinsam wohnte und das Leben teilte, als sei er von seinem Fleisch und Blut. Selbst Scheich Radwan lächelte zufrieden. Onkel Kamil starrte einfältig seinen Freund an und fragte vorsichtig: »Ist das wahr, was du gesagt hast, Abbas?«
Doktor Buschi antwortete für diesen: »Hab keinen Zweifel, Onkel Kamil. Ich hab das schon vorher gewusst und das Leichentuch mit meinen eigenen Augen gesehen. Es ist ein kostbares Stück, ich wünschte, ich hätte so etwas für mich.«
Der Scheich kam zum dritten Mal in Bewegung. »Viel Glück damit! Das Leichentuch ist der Rock fürs Jenseits. Kamil, genieße das Leichentuch, bevor es dich genießt. Du wirst den Würmern eine willkommene Mahlzeit sein. Sie werden sich an deinem knusprigen Fleisch wie an Bonbons gütlich tun und groß und fett werden wie Frösche. Frosch heißt auf Englisch frog. Ich buchstabiere: f-r-o-g.«
Onkel Kamil glaubte nun alles und fragte nur noch nach der Art, Farbe und Güte des Stoffs. Dann wünschte er Abbas immer und immer wieder Segen, freute sich und pries Gott.
Die Stimme eines jungen Mannes, der beim Hereintreten allen ein »Guten Abend« zurief, unterbrach ihn. Es war Husain Kirscha, Sohn des Kaffeehausbesitzers, der auf dem Weg zum Haus von Radwan al-Husaini nur schnell einmal hereinsah. Er war etwa zwanzig Jahre alt, dunkelhäutig wie sein Vater und schlank. Die fein geschnittenen Züge zeugten von Klugheit und Tatkraft. Bekleidet mit einem blauen Wollhemd, einer khakifarbenen Hose, einem Käppi und schweren Stiefeln, sah man ihm den Stolz auf den Wohlstand der Leute an, die bei der britischen Armee arbeiteten. Zu dieser Stunde kehrte er immer aus dem Lager zurück. Viele der Gäste schauten ihm voller Bewunderung nach, gemischt mit Neid. Abbas, der mit ihm befreundet war, wollte ihn noch hereinbitten. Aber Husain dankte und ging weiter.
Nun herrschte völlige Dunkelheit in der Gasse, und nur die Lampen des Kaffeehauses zeichneten auf dem Pflaster quadratische Lichtinseln, die sich an der Mauer des Firmengebäudes brachen. Der schwache Schein, der durch die Fensterläden der beiden Wohnhäuser drang, verlöschte nach und nach.
Die nächtliche Männerrunde im Kaffeehaus war ganz ins Domino- und Kartenspiel vertieft. Nur Scheich Darwisch war in Selbstvergessenheit versunken, und Onkel Kamil war eingeschlafen; der Kopf war ihm auf die Brust gefallen. Sanqar lief wie immer geschäftig hin und her, brachte die bestellten Getränke und legte das Geld in die Kasse. Meister Kirscha beobachtete ihn mit trägem Blick, fühlte wohlig, wie das Haschisch von ihm Besitz ergriff, und überließ sich ganz dieser köstlichen Macht. Es war schon spät, sodass Herr Radwan al-Husaini beschloss, nach Hause zu gehen. Der Nächste, der sich erhob, war Doktor Buschi, und dann folgten al-Hilu und Onkel Kamil. Allmählich leerten sich die Sitze, bis schließlich um Mitternacht nur noch drei Männer da waren: der Meister, der Gehilfe und Scheich Darwisch.
Aber noch einmal wurde die Tür geöffnet, und herein traten ein paar von Meister Kirschas Kumpanen, mit denen er zu einem Dachzimmer in Radwans Haus hinaufstieg. Man setzte sich um ein Kohlebecken und begann eine neue Runde, die erst enden sollte, als man zur Dämmerzeit wieder einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden konnte.
Sanqar bemühte sich indessen, mit freundlichen Worten Scheich Darwisch zum Gehen zu bewegen. »Es ist doch schon Mitternacht, Scheich Darwisch«, sagte er. Endlich hatte der Scheich die Stimme vernommen. Er nahm die Brille ab, putzte sie mit einem Zipfel seines Gewands, setzte sie auf die Nase, rückte die Krawatte zurecht, stand auf, glitt in die Holzpantoffeln und verließ das Kaffeehaus ohne ein Wort. Das Klappern seiner Pantoffeln durchbrach die Stille. Kein Laut sonst war zu hören, tiefste Finsternis hatte sich ausgebreitet, einsam und leer lagen die Straßen und Gassen. Scheich Darwisch überließ sich dem Lauf seiner Füße, denn er hatte weder ein Zuhause, noch kannte er ein Ziel. Die Schwärze der Nacht umhüllte ihn und nahm ihn auf.
Scheich Darwisch war in jungen Jahren Lehrer an einer der Schulen des Ministeriums für religiöse Stiftungen gewesen. Er hatte dort sogar Englisch unterrichtet und war für seinen Eifer und Fleiß bekannt gewesen. Zudem zeigte sich ihm das Schicksal günstig, stand er doch einer glücklichen Familie vor. Nachdem aber die Schulen des Ministeriums für religiöse Stiftungen dem Unterrichtsministerium angeschlossen worden waren, hatten sich für ihn so wie auch für andere seiner Kollegen die Lebensumstände verändert. Wie viele andere besaß auch er nicht die erforderliche hohe Qualifikation und war deshalb im Ministerium für religiöse Stiftungen als Schreibkraft eingestellt worden. Nur gehörte er nicht mehr der sechsten, sondern nur noch der achten Rangstufe an und bezog dementsprechend weniger Gehalt. Da war es nur natürlich, dass er gekränkt war und sich über das, was ihm zugestoßen war, furchtbar erregte. Manchmal zeigte er das ganz offen, dann wiederum fühlte er sich geschlagen und unterdrückte seinen Ärger. Er unternahm alles Mögliche, stellte Bittgesuche, flehte die Vorgesetzten an, beklagte seine Situation und die Armut seiner kinderreichen Familie – alles vergebens. Schließlich überließ er sich hoffnungsloser Verzweiflung, seine Nerven waren zerrüttet. Mittlerweile war sein Fall im Ministerium bekannt geworden, hatte er sich doch den Ruf eingehandelt, ein unzufriedener, hartnäckig klagender, lästiger Angestellter zu sein. Zudem fiel er auch dadurch unangenehm auf, dass er sich schnell erregte; kaum ein Tag verging, an dem er nicht einen Streit oder Zusammenstoß mit einem Kollegen hatte. Gerüstet mit einem nicht gerade geringen Maß an Selbstbewusstsein und dementsprechend aggressiv im Umgang mit anderen, verhielt er sich bei Streitereien auch noch hochnäsig und beschimpfte seinen Gegner auf Englisch. Wenn der Kollege protestierte und meinte, es gebe keinen Grund, in einer fremden Sprache zu reden, warf er ihm verachtungsvoll entgegen: »Legen Sie sich erst mal ein wenig Bildung zu, dann dürfen Sie das Wort an mich richten!«
Nach und nach erfuhren auch seine Vorgesetzten von seiner Zanksucht und Halsstarrigkeit. Da man aber einerseits Mitleid mit ihm hatte und sich großzügig erweisen wollte und andererseits keine Lust hatte, sich mit ihm anzulegen, blieb er von härteren Strafen verschont. Ein paar Mal wurde er verwarnt, und für ein oder zwei Tage erhielt er einen Gehaltsabzug. Mit der Zeit wurde er immer überheblicher, und so kam er denn eines Tages auf die Idee, die dienstlichen Schreiben in Englisch zu verfassen, war er doch im Unterschied zu den anderen Angestellten gebildet. Schließlich vernachlässigte er seine Pflichten so sehr, dass sein Direktor sich entschloss, ihn nun härter und gestrenger zu behandeln. Aber das Schicksal schlug schneller zu als der Direktor. Darwisch Effendi nämlich – so wurde er zu jener Zeit genannt – kam auf die Idee, den Unterstaatssekretär sprechen zu wollen. Würdevoll und gesetzt betrat er dessen Raum, begrüßte ihn wie einen vertrauten Bekannten und sprach im Brustton tiefster Überzeugung: »Allah hat seinen Mann auserwählt.«
Kaum hatte der Unterstaatssekretär ihn gebeten, sich deutlicher zu erklären, fuhr er erhaben fort: »Allah hat mich zu Ihnen mit einer neuen Botschaft gesandt.«
Damit fand seine Laufbahn im Ministerium ein Ende, wie denn auch jegliche Verbindung zu den Menschen, die ihn kannten und mit denen er lebte, zerstört worden war. Er verließ seine Familie, seine Brüder, seine Freunde und machte sich, wie man so sagt, in die Welt des Herrn auf. Außer der goldenen Brille war ihm nichts von all den Dingen der Vergangenheit geblieben. Von nun an wandelte er in einer neuen Welt, ohne einen Freund, ohne Geld und ohne ein Zuhause. So wie er lebte, bewies er aber auch, dass manche Menschen in dieser von bitteren Kämpfen erfüllten Welt ohne Wohnung, Geld und Freunde leben können und sich trotzdem nicht mit Sorgen, Not und Betrübnis herumschlagen müssen. An keinem Tag hungerte er, nie irrte er nackt herum. Er hatte einen Zustand von Ruhe, Zufriedenheit und Glückseligkeit erreicht, den er nie zuvor gekannt. Hatte er auch sein Zuhause verloren, so war für ihn nun die ganze Welt zum Heim geworden. Hatte er auch kein Gehalt mehr, so war eben das Bedürfnis nach Geld von ihm abgefallen. Hatte er keine Familie und Freunde mehr, so waren nun eben alle Menschen zu seiner Familie geworden. War der Djilbab zerrissen, so kam von irgendwoher ein neuer. War die Krawatte zerschlissen, so fand sich eine andere.
Nie hätte er sich dort niedergelassen, wo man ihn nicht willkommen hieß. Er konnte sich darauf verlassen, dass selbst Meister Kirscha trotz all seines Schwebens in anderen Sphären ihn vermisst hätte. Dabei war es nicht einmal so, dass er besonderer Sachen fähig war; zum Beispiel konnte er weder Wunder vollbringen noch Übersinnliches fühlen, noch in der Zukunft Verborgenes voraussagen. Entweder war er geistesabwesend und schweigsam, oder er plapperte beliebig drauflos, ohne zu wissen, ob es überhaupt zum Gespräch passte. Geliebt und gesegnet, wie er war, verspürte jeder seine Anwesenheit als glückliches Zeichen und meinte, dass er einer von Gottes frommen Freunden wäre, dem die Eingebungen in zwei Sprachen kämen: in Arabisch und Englisch.
2
Sie musterte sich im Spiegel, ohne etwas zu finden, woran sie etwas auszusetzen hatte – anders gesagt, sie sah sich durchaus wohlgefällig und zufrieden an. Was sie da sah, war ein schmales, langes Gesicht, bei dem Schminke und Tusche an Wangen, Brauen, Lidern und Lippen geradezu Wunder bewirkt hatten. Während sie die Haare flocht, drehte sie sich nach links und nach rechts. »Hübsch, wirklich hübsch«, murmelte sie fast unhörbar. Nun war sie aber schon an die fünfzig, und natürlich lässt das Leben ein Gesicht während eines halben Jahrhunderts nicht unversehrt. Ihr Körper war schlank oder auch mager, wie die Frauen der Gasse sagten, und die Brust ein wenig flach, was aber vom Kleid einigermaßen verhüllt wurde.
Es war Frau Sanija Afifi, die Besitzerin des zweiten Hauses in der Gasse, in dem im ersten Stock Doktor Buschi wohnte. An diesem Tag hatte sie sich darauf vorbereitet, der Wohnung im zweiten Stock einen Besuch abzustatten, in der Umm Hamida lebte. Sie machte nicht gerade oft Besuche, und diese Wohnung betrat sie eigentlich immer nur am Ersten des Monats, um die Miete zu kassieren. Diesmal jedoch ließ eine innere Regung sie nicht zur Ruhe kommen, und das machte den Besuch unumgänglich. So verließ sie also die Wohnung, stieg die Treppen hinunter und flüsterte dabei hoffnungsvoll: »O Allah, lass meine Hoffnung in Erfüllung gehen.«
Mit schweißiger Hand klopfte sie an die Tür. Hamida öffnete, begrüßte sie mit höflichem Lächeln und führte sie in das gute Zimmer. Dann ging sie hinaus, um ihre Mutter zu rufen. Es war ein kleiner Raum, in dem zwei altmodische Sofas einander gegenüberstanden. In der Mitte stand ein abgenutzter Tisch, darauf ein Aschenbecher. Der Boden war mit einer Matte ausgelegt. Frau Sanija musste nicht lange warten, Umm Hamida hatte nur eilig den alten Hausdjilbab ausgezogen. Beide begrüßten sich freudig, tauschten Küsse und setzten sich.
»Willkommen, herzlich willkommen«, sagte Umm Hamida. »Das ist ja, als wäre der Prophet selbst zu Besuch gekommen, liebe Frau Afifi.« Umm Hamida war in den Sechzigern, von mittlerer, korpulenter Statur und einer gesunden Lebendigkeit. Mit ihren Pockennarben und den leicht hervorquellenden Augen war sie nicht gerade schön. Außerdem war ihre Stimme laut und rau, ihr Sprechen hörte sich wie Schreien an. Diese Stimme war ihre beste Waffe, wenn zwischen ihr und den Nachbarinnen ein Streit ausbrach. Der Besuch war ihr keineswegs angenehm, denn die Hausbesitzerin als Gast zu haben, das konnte schlimme Folgen haben und verhieß nichts Gutes. So hatte sie sich also entschlossen, sich auf alles einzustellen und abzuwarten. Kam Gutes, dann war es gut, kam Schlechtes, war es eben schlecht. Sie würde beidem gewachsen sein.
Umm Hamida betätigte sich als Brautwerberin und als Badewärterin und hatte mit der Zeit einen ziemlichen Scharfblick für Menschen entwickelt. Sie war aber auch geschwätzig, ja mehr als das, sie konnte ihre Zunge nicht zügeln. Kein Tratsch über einen Bewohner des Viertels, kein Klatsch über eine Familie entging ihrer Aufmerksamkeit. Sie war der plappernde Chronist aller – zumeist üblen – Nachrichten und das wandelnde Lexikon aller Missetaten.
Wie gewöhnlich fing sie also zu reden an, begrüßte nochmals den Gast und überschüttete ihn mit Lob. Dann ging sie dazu über, ein paar Neuigkeiten aus der Gasse und den benachbarten Vierteln zu erzählen. Ob sie schon von dem neuen Skandal um Meister Kirscha gehört habe? Es wäre wieder so etwas Schlimmes wie schon vorher. Als seine Frau davon erfuhr, gab es einen üblen Streit, und sie zerriss ihm die Djubba. Tags zuvor hatte Husnija, die Bäckersfrau, ihren Mann Djada so verprügelt, dass ihm das Blut von der Stirn geflossen war. Und der fromme und gütige Herr Radwan al-Husaini hatte seine Frau schlimm beschimpft. Würde dieser nette Mann wohl so etwas tun, wenn sie nicht ein schlechtes und verdorbenes Weibsbild wäre? Doktor Buschi hatte sich beim letzten Angriff im Luftschutzkeller an ein kleines Mädchen herangemacht, weswegen ihn ein ehrbewusster Mann geschlagen hatte. Die Frau von al-Mawaardi, dem Holzhändler, war mit ihrem Diener durchgebrannt, ihr Vater sei vor Scham zu Boden gesunken. Die Bäckerei Kafrawi habe heimlich Brot aus reinem Mehl verkauft, und so weiter, und so weiter …
Frau Sanija Afifi hörte nur mit halbem Ohr zu, war sie doch viel zu sehr mit der Angelegenheit beschäftigt, wegen der sie gekommen war. Sie war fest entschlossen, koste es, was es wolle, auf das Problem zu sprechen zu kommen, das ihr schon so lange im Kopf herumging. Also musste sie ihr irgendwie den Gesprächsfaden entreißen, damit sie überhaupt eine Gelegenheit zum Sprechen bekam. Das trat ein, als sich Umm Hamida nach ihrem Befinden erkundigte. Frau Afifi runzelte ein wenig die Stirn und sagte: »Die Wahrheit ist, Umm Hamida, dass ich ziemlich müde bin.«
Umm Hamida tat besorgt und hob bekümmert die Brauen. »Möge Allah Sie vor Bösem schützen!«
Frau Sanija wartete ab, bis Hamida, die gerade mit den Kaffeetassen kam, wieder hinausgegangen war. Erst dann sprach sie unwillig weiter. »Ja, müde, Umm Hamida. Ist es denn nicht auch anstrengend, die Mieten für die Läden zu bekommen? Stellen Sie sich doch nur vor, da steht eine Frau wie ich einem fremden Mann gegenüber und verlangt von ihm die Miete!«
Umm Hamidas Herz klopfte unruhig, als sie das Wort Miete hörte. Aber sie sagte nur mitleidig: »Das glaube ich, dass das schwer ist, liebe Frau Sanija. Möge Gott Ihnen beistehen!« Insgeheim fragte sie sich, warum die Frau immer wieder klagte. Das war schon öfter der Fall gewesen, sie hatte sie ja auch schon zwei- oder dreimal besucht, und zwar nicht am Monatsersten. Ihr kam ein Gedanke, der sie verblüffte. Vielleicht hatte das mit ihrer Tätigkeit zu tun, darin kannte sie sich aus und konnte einen unvergleichlichen Scharfsinn entwickeln. Sie beschloss, ihre Besucherin ein wenig auszuhorchen, und sagte bösartig heuchelnd: »Ja, liebe Frau Sanija, das gehört nun einmal zu den Unannehmlichkeiten des Alleinseins. Sie sind einsam. Zu Hause sind Sie allein, auf der Straße sind Sie allein, und im Bett sind Sie auch allein. Wenn Sie das nicht ändern …«
Frau Sanija freute sich, dass das Gespräch genau auf das Thema kam, auf das sie abzielte. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, sagte sie: »Was kann ich tun? Alle meine Verwandten haben Familie. Und dann fühle ich mich auch nur bei mir zu Hause wohl. Ich muss dem Schicksal danken, dass es mich wenigstens ein bisschen wohlhabender gemacht hat als andere.«
Umm Hamida beobachtete sie listig. Nun konnte sie auf das Wesentliche kommen. »Allah sei tausendmal gedankt. Aber sagen Sie mir aufrichtig – warum sind Sie diese ganze lange Zeit allein geblieben?«
Wieder freute sich Frau Sanija, denn das Gespräch berührte nun den entscheidenden Punkt. Sie seufzte und sagte mit vorgetäuschtem Missbehagen: »Mir hat gereicht, was ich an Bitterkeit in einer Ehe durchgemacht habe.« In ihrer Jugend war sie mit dem Besitzer eines Parfümladens verheiratet gewesen. Aber die Ehe hatte ihr wenig Glück gebracht. Der Mann hatte sie schlecht behandelt, ihr das Leben schwer gemacht und ihr Geld ausgegeben. Vor zehn Jahren war er gestorben. Sie blieb allein, weil sie – wie sie sagte – das Eheleben hasste. Das war wirklich ehrlich gemeint und entsprang nicht etwa nur dem Ärger darüber, dass sie vom anderen Geschlecht vernachlässigt wurde. Nein, sie hatte die Ehe wirklich gehasst und sich gefreut, als sie ihre Freiheit und ihren Frieden wiedererlangt hatte. Das war lange so geblieben, bis sich dieser starke Widerwille nach und nach doch verlor und sich allmählich das Gefühl einstellte, dass sie ihr Glück vielleicht noch einmal versuchen sollte, wenn es jemanden gäbe, der sich um ihre Hand bewarb. Ab und zu hatte sich ein Hoffnungsschimmer gezeigt, der aber, als sich nichts tat, wieder verlöscht war. Da wollte sie sich nicht länger falschen Hoffnungen hingeben und das Leben so genießen, wie es nun einmal war.
Aber der Mensch braucht nun einmal etwas, von dem er träumen kann, das seinem Leben einen Wert gibt, und wäre es auch nur ein fadenscheiniges Trugbild.
So fand auch sie schließlich etwas Passendes. Glücklicherweise gehörte sie ja nicht zu den armen Witwen, die plötzlich ohne alle Mittel dastehen. So konnte sie es sich also leisten, Kaffee zu trinken, Zigaretten zu rauchen und neue Geldscheine zu horten. Von jeher hatte sie einen gewissen Hang zum Geiz gehabt und war eine der ersten Kunden der Sparkasse. Ihre neue Liebhaberei, Banknoten zu sammeln, entsprach also vollauf dieser Neigung, die nun noch stärker wurde. Aber da das für sie eine Lebenshilfe war, verlieh es ihr auch Kraft. Die schönen neuen Scheine pflegte sie in einem Elfenbeinkästchen aufzubewahren, das sie zuunterst im Kleiderschrank versteckt hielt. Die Scheine unterteilte sie in Bündel von Fünfern und Zehnern und freute sich, sie anzuschauen, immer wieder zu zählen, immer wieder ordentlich zu stapeln. Angst um das Geld hatte sie nicht, denn im Unterschied zu Münzen machten diese Scheine ja keinen Lärm. Tatsächlich ahnte keiner der pfiffigen Gauner in der Gasse, was sich da anhäufte, obwohl sie für so etwas durchaus ein feines Gespür hatten.
Frau Sanija fand also im Horten von Geld Trost, darüber hinaus aber auch eine Entschuldigung dafür, dass sie unverheiratet war. Jeder Ehemann, sagte sie sich, würde so wie ihr Verstorbener das Geld wieder an sich reißen und im Nu den sorglich gehüteten Schatz verschwenden. Aber dann hatte sich trotz alledem einmal der Gedanke eingestellt, vielleicht doch wieder zu heiraten. In dem Maße, wie diese Idee sich festigte, schwanden auch all ihre Ängste und Entschuldigungen. Ob gewollt oder nicht – eigentlich trug Umm Hamida an diesem Gesinnungswandel Schuld, hatte sie ihr doch oft genug erzählt, dass sie wieder einmal eine ältere Witwe verheiratet hatte. Das brachte sie darauf, dass das vielleicht auch für sie möglich wäre, und schon bald nahm dieser Gedanke sie ganz gefangen und drängte sich ihr immer mehr auf. Alles, was sie vorher übers Heiraten gedacht hatte, ihre ganze Abneigung, schien in Vergessenheit geraten zu sein angesichts der nun heiß ersehnten Hoffnung, der gegenüber sich aller Trost durch Kaffee, Zigaretten und Geld als nichtig erwies. Hatte sie nicht ihr ganzes Leben vergeudet? Was hatte sie in den letzten zehn Jahren eigentlich dafür getan, um jetzt mit fünfzig nicht allein und einsam zu sein? Welch ein Wahnsinn. Schuld daran war nur ihr verstorbener Mann, den sie vergessen sollte, lieber heute als morgen.
Die Brautwerberin Umm Hamida hörte sich die Klagerei aufmerksam und auch ein wenig belustigt an. ›Was, liebe Frau, sollen diese Tricks?‹, dachte sie verächtlich. Nicht ganz ohne Boshaftigkeit sagte sie: »Aber Frau Sanija, übertreiben Sie doch nicht. Auch wenn Ihr erster Versuch enttäuschend war, so muss man doch sehen, dass es auch viele glückliche Ehen gibt.«
Frau Sanija stellte die Kaffeetasse auf den Tisch und nickte dankend. »Aber ein kluger Mensch sollte sich nicht dem Schicksal in den Weg stellen, wenn es ihm nicht wohlgesinnt ist.«
»Was reden Sie denn da, Sie sind doch eine vernünftige Frau«, protestierte Umm Hamida. »Schluss mit dem Alleinsein, Sie waren es lange genug!«
Die Frau schlug sich auf die flache Brust und sagte betont empört: »Das wäre was! Wollen Sie, dass die Leute mich für verrückt halten?«
»Wer sollte denn so etwas denken? Es gibt viel ältere, die noch heiraten.«
Das »viel ältere« ärgerte Frau Sanija. »So alt, wie Sie denken, bin ich gar nicht. Gott vertreibe die Sorgen, die schuld sind.«
»Aber das meinte ich doch nicht, Frau Sanija. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass Sie noch jung sind. Aber die Sorgen haben Sie sich selbst aufgeladen.«
Frau Sanija schien erleichtert, wollte aber unbedingt weiter den Eindruck erwecken, als versuche man sie ohne eigenes Zutun zur Ehe zu treiben. So zögerte sie noch ein wenig, ehe sie fragte: »Würde das nicht ein schlechtes Licht auf mich werfen, wenn ich nach so langem Alleinsein jetzt noch einmal heirate?«
›Und warum bist du dann hergekommen, liebe Frau?‹, dachte Umm Hamida. Laut aber sagte sie: »Wie sollte etwas, was Recht und Gesetz ist, Schande bringen? Sie sind eine kluge und ehrenwerte Frau, wie jedermann weiß. Heißt es nicht, dass die Ehe eine Hälfte der Religion ist? Allah hat sie als Gesetz erachtet, und der Prophet – Heil und Segen über Ihn – hat es uns so auch auferlegt.«
»Gott segne Ihn und gebe Ihm Frieden«, wiederholte Frau Sanija fromm.
»Warum also nicht? Bei Gott, unser arabischer Prophet liebt seine gottesfürchtigen Diener.«
Frau Sanijas Gesicht rötete sich unter dem Rouge noch mehr. Ihr Herz klopfte vor Freude. Sie holte zwei Zigaretten aus der Tasche. »Und wer würde mich wollen?«
Umm Hamida tippte sich mit dem Finger an die Stirn und sagte entrüstet: »Na, tausendundein Mann!«
Da lachte die Frau laut auf. »Einer reicht völlig!«
Im Brustton der Überzeugung sagte Umm Hamida: »Alle Männer wollen heiraten. Beklagen tun sich nur die, die schon verheiratet sind. Aber wie viele sind noch allein und sehnen sich nach der Ehe! Wenn ich zu einem nur sage, dass ich vielleicht eine Braut für ihn hätte, kommt Leben in seine Augen, und er fängt an zu strahlen. Gleich will er alles wissen, ob es auch stimme und wer sie sei. Der Mann will eben die Frau, selbst wenn er ein Krüppel ist. Da zeigt sich die Weisheit Allahs.«
Frau Sanija neigte glücklich den Kopf. »Seine Weisheit ist groß und erhaben.«
»So ist es, Frau Sanija, deshalb konnte er auch die Welt erschaffen. Nun hätte er sie ja auch nur mit Männern oder nur mit Frauen füllen können. Aber nein, er hat das männliche und das weibliche Geschlecht erschaffen und uns mit Verstand versehen, damit wir seine Absicht erkennen. Um die Ehe kommt man also nicht herum.«
Sanft lächelnd sagte Frau Afifi: »Ihre Worte sind so süß wie Zucker, liebe Umm Hamida.«
»Allah möge Ihnen das Leben versüßen und Ihr Herz mit einer angenehmen Ehe erfreuen!«
Die Frau wurde mutiger. »So Gott will, und dank Ihrer Güte wird es so sein.«
»Ich habe, dem Herrn seis gedankt, eine glückliche Hand. Die Ehen, die ich vermittelt habe, laufen alle gut. Wie viele von ihnen haben sich ein schönes Heim eingerichtet, haben Kinder in die Welt gesetzt und sind des Glückes voll. Vertrauen Sie auf Allah und auf mich.«
»Ja, Ihre Arbeit ist nicht mit Geld aufzuwiegen.«
›So nun auch wieder nicht, liebe Frau‹, dachte Umm Hamida bei sich. ›Das kostet schon etwas, und zwar eine ganze Menge! Also auf zur Sparkasse und Schluss mit der Knauserei!‹ Sie fand es an der Zeit, einen sachlicheren Ton anzuschlagen. Wie die Männer, die genau wussten, wann bei Geschäften genug der Vorreden gewechselt waren, kam auch sie nun zum eigentlichen Thema. »Ich denke, dass Sie vielleicht einen Mann im vorgerückten Alter bevorzugen würden?«
Die andere wusste nicht, was sie antworten sollte. Einen jungen Mann wollte sie natürlich nicht, das wäre sicher nicht das Richtige für sie. Aber von der Bezeichnung »vorgerücktes Alter« war sie auch nicht begeistert. Der bisherige Verlauf des Gesprächs hatte sie ein wenig aufgelockert, sodass sie jetzt mit einem Lachen ihre Verwirrung überspielen konnte. »Wenn ich aber nun faste und nur noch eine Zwiebel zum Frühstück esse?« Umm Hamidas dröhnendes Lachen hinterließ einen Missklang. Sie war nun noch mehr davon überzeugt, dass das ein lohnendes Geschäft sein würde. Boshaft meinte sie: »Glauben Sie, liebe Frau, ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass die Ehen die glücklichsten sind, bei denen die Frau älter ist als der Mann. Deshalb wäre vielleicht wirklich ein Mann in den Dreißigern oder etwas darüber am besten für Sie geeignet.«
Besorgt fragte Frau Sanija: »Aber wäre so ein Mann auch einverstanden?«
»Aber sicher. Sie sehen doch gut aus und sind reich.«
»Vielen Dank, mögen Sie vor jedem Unheil bewahrt bleiben!«
Umm Hamidas pockennarbiges Gesicht wurde ernst und bedeutungsvoll. »Ich werde ihm sagen: eine Dame mittleren Alters ohne Kind und ohne Schwiegermutter, wohlerzogen und reif, Besitzerin von zwei Läden in Hamzawi und einem zweistöckigen Haus in der Midaq-Gasse.«
Frau Sanija lächelte und berichtigte: »Einem dreistöckigen Haus sogar.«
Aber Umm Hamida wehrte ab: »Nein, es hat nur zwei, denn für das dritte Stockwerk, das ich bewohne, werden Sie, solange ich lebe, keine Miete mehr nehmen.«
»Darauf haben Sie mein Wort«, kam es freudig als Antwort.
»Das höre ich gern. Möge unser Herr alles zum Besten wenden«, meinte Umm Hamida trocken.
Umm Hamida stieß zwar ein Lachen aus, das auch ihre Verwunderung bezeugen sollte, dachte aber insgeheim, dass Frau Sanija sich schämen sollte, zu meinen, sie sei auf ihre Tricks hereingefallen. »Aber, meine Liebe, ist das nicht der Wille unseres Herrn? Geschieht nicht alles so, wie er es will?«
Da nun alles besprochen war, verabschiedete sich Frau Sanija und kehrte froh in ihre Wohnung zurück, fragte sich aber zugleich: Wie kann man nur so habgierig sein, sich ein Leben lang die Wohnungsmiete schenken zu lassen!
3
Kurz nachdem Frau Sanija gegangen war, kam Hamida ins Zimmer, die gerade dabei war, ihr schwarzes Haar zu kämmen, das nach Petroleum roch. Umm Hamida schaute auf die glänzenden, weich fallenden Locken, die bis zu den Kniekehlen des Mädchens reichten. »Was für ein Jammer«, klagte sie. »Wie kannst du bloß zulassen, dass sich die Läuse in diesem schönen Haar einnisten!«
Die dunklen, mit schwarzer Schminke umrandeten und dicht bewimperten Augen blitzten auf und blickten scharf und abweisend.
»Läuse?«, fragte das Mädchen. »Beim Propheten, im Kamm waren höchstens zwei.«
»Und dass ich neulich, vor zwei Wochen, zwanzig Läuse zerquetscht habe, hast du wohl vergessen?«
Das Mädchen blieb ungerührt. »Da hatte ich mir auch zwei Monate lang nicht die Haare gewaschen.« Sie setzte sich neben die Mutter und kämmte kräftig weiter. Sie war um die zwanzig, schlank, nicht zu groß und nicht zu klein und hatte eine bronzefarbene Haut. Ihr Gesicht war schmal, ihr Teint rein. Das Auffallendste daran waren die großen schwarzen Augen, von denen ein bezaubernder Glanz ausging. Sie hatte zarte, fein geschwungene Lippen, aber wenn sie sie zusammenpresste und zornig mit den Augen blitzte, strahlte sie eine Härte und Strenge aus, die unweiblich wirkte. So war denn auch ihr Zorn bei allen Menschen ihrer Umgebung gefürchtet. Selbst die Mutter, die für ihre Härte und ihren Mut bekannt war, ging ihr dann geflissentlich aus dem Weg. Eines Tages, als sie sich stritten, hatte sie zu ihr gesagt: »Dir wird der Herr nie zu einem Mann verhelfen. Wer hat schon Lust, sich glühende Kohlen auf die Brust zu legen?« Ein andermal wiederum meinte sie, es müsse sich zweifellos um Wahnsinn handeln, was da ihre Tochter überfiel, wenn sie in Rage geriet. Sie nannte sie deshalb auch Chamsin, wie der heiße Wüstenwind genannt wird.
Trotz allem liebte sie sie sehr, auch wenn sie nur die Adoptivmutter war. Die richtige Mutter hatte früher mit ihr zusammen in einer Imbissstube gearbeitet. Wenn es ihr besonders schlecht gegangen war, hatte Umm Hamida sie auch in ihre Wohnung aufgenommen. Dort war sie auch gestorben und hatte ihr das Baby hinterlassen. Umm Hamida hatte es adoptiert und der Frau von Meister Kirscha anvertraut, die es zusammen mit ihrem eigenen Sohn Husain gestillt hatte. Hamida war also dessen Milchschwester.
Hamida kämmte sich noch immer und wartete darauf, dass ihre Mutter wie immer etwas über den Besuch und die Besucherin zum Besten gab. Als ihr das Schweigen zu lange dauerte, fragte sie: »Das war ein ganz schön langer Besuch. Worüber habt ihr denn gesprochen?«
Ihre Mutter lachte spöttisch. »Kannst ja mal raten!«
Das Mädchen wurde neugieriger. »Hat sie mehr Miete verlangt?«
»Wenn sie das getan hätte, dann hätten sie die Männer von der Ersten Hilfe heraustragen müssen. Nein, im Gegenteil, sie will weniger.«
»Bist du verrückt?«
»Bin ich. Aber nun rate doch mal!«
Die Mutter hob die Brauen, zwinkerte und sagte: »Deine Freundin will heiraten.«
Hamida war verblüfft. »Heiraten?«
»Gewiss. Und zwar einen möglichst jungen Mann. Ein Jammer, dass so ein junges Mädchen wie du das Glück mit Füßen tritt und keinen findet, der um sie anhält.«
Hamida, nun mit dem Flechten beschäftigt, bedachte die Mutter mit einem schiefen Blick und sagte: »Ich finde sogar eine ganze Menge – du bist bloß eine miese Brautwerberin und willst das nicht zugeben. Was sollte jemand an mir schon auszusetzen haben? Also kann es nur an dir liegen. Wie gesagt, du hast eben keinen Erfolg. Für dich trifft genau das Sprichwort zu: Türen von Tischlern sind immer morsch.«
Umm Hamida lächelte. »Wenn selbst eine Sanija Afifi noch verheiratet werden kann, braucht keine Frau die Hoffnung aufzugeben.«
Das Mädchen sah sie wütend an. »Ich renne dem Heiraten nicht hinterher, eher ist es umgekehrt. Ich werde noch oft ablehnen.«
»Natürlich! Bist ja auch eine Prinzessin!«
Das Mädchen überhörte den Spott und entgegnete scharf: »Gibt es auch nur einen einzigen in der Gasse, der ernsthaft in Betracht kommt?«
Die Mutter hatte durchaus nicht die Sorge, dass sie das Mädchen nicht an den Mann bringen konnte, so schön, wie es war, doch ihr missfiel, wie eitel und eingebildet ihre Tochter war. Verärgert sagte sie: »Schimpfe nicht auf die Gasse, die Leute hier sind die besten der Welt.«
»Für dich vielleicht. Das sind doch alles nur Nullen. Abgesehen von einem Einzigen, in dem noch Leben steckt. Aber den habt ihr ja zu meinem Bruder gemacht.«
Die Mutter war empört. »Wie kannst du bloß so reden? Wir haben ihn überhaupt nicht zu deinem Bruder gemacht. Keiner von uns kann Brüder oder Schwestern ›machen‹. Er ist lediglich dein Milchbruder, so wie der Herr es wollte.«
Hamida war wie vom bösen Geist besessen und begann zu spotten: »Dann hing er wohl an einer und ich an der anderen Brust?«
Umm Hamida versetzte ihr einen Schlag in den Rücken und schrie: »Gemeines Weibsbild!«
Die Antwort war nur ein verächtliches: »Blöde Gasse.«
»Du willst wohl einen hohen Beamten haben!«
»Wieso, ist ein Beamter ein Gott?«, fragte sie scharf zurück.
»Wenn du bloß nicht so eingebildet wärst!«
Sie äffte sie nach: »Wenn du bloß einmal im Leben ein wenig gerecht sein könntest!«
»Essen, trinken und undankbar sein, das kannst du. Weißt du noch, was du wegen eines einfachen Djilbabs für einen Zank angefangen hast?«
»Ist denn ein Djilbab so eine Kleinigkeit?«, fragte Hamida zurück. »Was hat die Welt außer neuen Sachen schon zu bieten? Siehst du denn nicht ein, dass ein Mädchen ohne hübsche Kleider lebendig begraben ist?« Sie holte tief Luft und fuhr fort: »Du solltest die Mädchen von der Fabrik sehen! Oder die Jüdinnen, die arbeiten gehen. Sie alle haben etwas Schönes zum Anziehen. Was hat das Leben denn für einen Sinn, wenn man nicht einmal das anziehen kann, was man gerne möchte!«
»Dein andauerndes Interesse für das, was die Fabrikmädchen und die Jüdinnen tun, scheint dir den Verstand genommen zu haben. Hör doch endlich mal damit auf!«
Hamida, die mit dem Flechten fertig geworden war, schien nicht mehr zuzuhören. Sie holte einen kleinen Spiegel aus einer Tasche und stellte ihn auf die Sofalehne. Sie hockte davor nieder, musterte sich und sprach bewundernd zu sich selbst: »Ach, Hamida, was für ein Jammer. Warum lebst du bloß in dieser Gasse? Und warum ist diese Frau deine Mutter, wo sie doch nicht einmal zwischen Staub und Gold unterscheiden kann?« Langsam trat sie zum Fenster, das zur Gasse lag, und zog die Flügel bis auf einen kleinen Spalt zu. Dann stützte sie sich auf das Fensterbrett und blickte hinunter.
Mal dahin und mal dorthin schauend, führte sie spöttisch ein scheinbares Selbstgespräch. »Sei gegrüßt, Straße des reinsten Glücks und höchster Wonne! Lange mögen deine prächtigen Bewohner leben! Was gibt es denn so zu sehen? Ha, da haben wir Husmija, die Bäckersfrau. Hockt auf der Schwelle des Backofens wie ein Sack und lässt das eine Auge nicht von den Broten und das andere nicht von ihrem Mann Djada. Und der arbeitet nur, weil er wieder Angst hat, sie könnte ihn mit Fußtritten und Hieben traktieren. Und da ist ja auch Meister Kirscha vom Kaffeehaus. Der Kopf hängt ihm herunter, als ob er schliefe, was aber durchaus nicht der Fall ist. Onkel Kamil schläft wirklich, und da keiner aufpasst, hocken die Fliegen auf der Bonbonschüssel. Ach, wen haben wir denn da? Abbas al-Hilu, der heimlich und voller Hingabe heraufschaut. Wahrscheinlich denkt er jetzt, dass sein sehnsüchtiger Blick mich zur Sklavin seiner Liebe macht, sodass ich mich ihm zu Füßen werfe. Na, dann sieh mal zu, dass du mich bekommst. Hallo, Herr Salim Alwan, Chef der Handelsfirma! Erst schaut er hinauf, dann guckt er schnell weg, und dann schaut er wieder hinauf. Beim ersten Mal war es vielleicht reiner Zufall, aber beim zweiten Mal? O Gott, nun schon zum dritten Mal. Was willst du eigentlich, du alter Kerl, halb tot, wie du bist? Immer der gleiche Zufall, jeden Tag zur selben Stunde? Wenn du wenigstens nicht schon verheiratet und Vater wärst, dann würde ich deine Blicke ja noch erwidern und dich herzlich willkommen heißen. Aber so? Das war es also, das ist die Gasse. Warum sollte Hamida da nicht ihre Haare verdrecken lassen und Läuse kriegen? Halt, da kommt noch Scheich Darwisch und macht einen höllischen Lärm mit den Holzpantoffeln auf dem Pflaster …«
An dieser Stelle fiel ihr die Mutter ins Wort. »Wäre Scheich Darwisch vielleicht nicht ein passender Gatte für dich?«, fragte sie spöttisch.