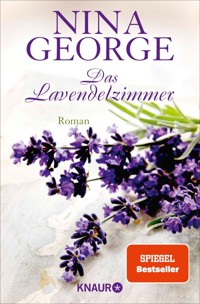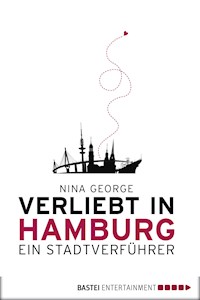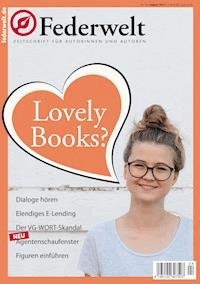9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der ebenso poetische wie lebenskluge internationale Erfolgs-Roman "Die Mondspielerin" von Spiegel- und New-York-Times-Bestseller-Autorin Nina George jetzt einer liebevoll gestalteten Sonderausstattung im Geschenkformat mit hochwertiger Veredelung: "Für Bretagne-Fans, Frauen- und Menschenmöger sowie Lebensgenießer ein Muss." Welt am Sonntag Schluss mit mir! Das ist Mariannes sehnlichster Wunsch, als sie sich in Paris in die Seine stürzt. Doch das Schicksal will es anders – sie wird gerettet. Die 60-jährige Deutsche, die kein Wort Französisch spricht, flüchtet vor ihrem lieblosen Mann bis in die Bretagne. Dort begegnet sie dem Maler Yann, und es gelingt ihr, mit neu erwachendem Mut und überraschender Zähigkeit ein neues Leben zu wagen. Ihr eigenes. »Ein liebevolles, warmherziges und lebenskluges Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen mag.« Hamburger Abendblatt ›Die Mondspielerin‹ – »Eine Geschichte voller Hoffnung, Weisheit und bretonischem Zauber; eine Geschichte über das eigene Leben, für das es nie zu spät ist.« Pforzheimer Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Nina George
Die Mondspielerin
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Schluss mit mir! Das ist Mariannes sehnlichster Wunsch, als sie sich in Paris in die Seine stürzt. Doch das Schicksal will es anders – sie wird gerettet. Die 60-jährige Deutsche, die kein Wort Französisch spricht, flüchtet vor ihrem lieblosen Mann bis in die Bretagne. Dort begegnet sie dem Maler Yann, und es gelingt ihr, mit neu erwachendem Mut und überraschender Zähigkeit ein neues Leben zu wagen. Ihr eigenes.
»Ein liebevolles, warmherziges und lebenskluges Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen mag.«
Hamburger Abendblatt
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Epilog
Interview mit Nina George
Die Bretagne von A bis nicht ganz Z
Danksagung
Für Jens,
Geliebter, Ehemann und Freund.
Und für Wolfgang George
* 20. März 1938 † 4. April 2011
bester Vater der Welt.
1
Es war die erste Entscheidung, die sie alleine traf. Das erste Mal eben, dass sie bestimmte, was zu tun war.
Marianne beschloss zu sterben. Jetzt. Hier. Da unten in den Wassern der Seine, am Ende dieses grauen Tages.
Kein Stern war zu sehen. Der Eiffelturm verblasste hinter dunstigem Smog. Paris sonderte ein Rauschen ab, ein ständiges Rauschen, Motorroller, Autos, das Raunen der Metro tief im Bauch der Stadt.
Das Wasser war kühl, schwarz und sanft. Die Seine würde sie mitnehmen, in einem Bett aus Freiheit und Stille bis ins Meer.
Tränen liefen ihr die Wangen herab, Perlenfäden aus Salz. Marianne lächelte, während sie weinte. Niemals zuvor hatte sie sich so leicht gefühlt. So frei. So glücklich.
»Meine Sache«, flüsterte sie. »Meine Sache.«
Sie zog die mehrfach nachbesohlten Schuhe aus, die sie vor fünfzehn Jahren gekauft hatte. Heimlich, kein Sonderangebot, Lothar hatte mit ihr geschimpft, als er es erfuhr. Dann hatte er ihr das Kleid dazu geschenkt. Zweite Ware, Webfehler, Preisnachlass, ein graues Kleid mit grauen Blumen. Auch das trug sie heute.
Das letzte Heute. Als sie noch all die Jahre und Jahrzehnte vor sich gehabt hatte, war ihr die Zeit unendlich erschienen. Wie ein Buch, das darauf wartet, geschrieben zu werden, so war ihr das Leben, das noch vor ihr lag, als junges Mädchen vorgekommen. Nun war sie sechzig, und die Seiten waren leer.
Die Unendlichkeit war wie ein einziger, grauer Tag vergangen.
Sie plazierte die Schuhe akkurat nebeneinander auf die Bank neben sich. Dann überlegte sie kurz und stellte sie auf den Boden. Sie wollte nicht, dass die Bank dreckig wurde, eine schöne Frau einen Fleck auf ihrem Rock bekam und darüber in Verlegenheit geriet.
Sie versuchte, ihren Ehering abzuziehen. Es gelang ihr nicht. Sie nahm den Finger in den Mund, schließlich rutschte der Ring ab. Darunter war die Haut hell.
Auf der anderen Straßenseite des Pont Neuf schlief ein Mann auf einer Bank. Er trug ein schmal gestreiftes Hemd wie ein Fischer, und Marianne war dankbar, dass er ihr den Rücken zukehrte.
Sie legte den Ring zu den Schuhen. Irgendeiner würde ihn schon finden und einige Tage davon leben können, wenn er ihn versetzte. Ein Baguette, Pastis, ein Stück Speck. Etwas Frisches. Nichts aus dem Müll. Vielleicht noch eine Zeitung, die ihn wärmte.
»Schluss mit abgelaufenen Lebensmitteln«, sagte sie.
Lothar hatte ihr die Sonderangebote in den Wochenblattbeilagen angekreuzt. Wie andere das Fernsehprogramm der Woche markieren. Samstag: Wetten, dass …? Sonntag: Tatort. Montag: Paradiescreme mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Es wurde gegessen, was angekreuzt war.
Marianne schloss die Augen.
Lothar. Für seine Freunde Lotto. Oberstabsfeldwebel der Artillerie, Mutter der Kompanie.
Lothar Messmann, wohnhaft in Celle, im letzten Haus einer Sackgasse, eine Siedlung wie ein Märklinland, der Jägerzaun direkt am Wendehammer. Ein Mann, dem das Altern gut stand.
Lothar. Er liebte seinen Beruf. Er liebte sein Auto. Und er liebte den Fernseher. Er saß immer auf dem Sofa, ein Tablett mit Essen vor sich auf dem gekachelten Tisch, die Fernbedienung in der linken Hand, die Gabel in der rechten, den Ton ganz laut, wie es Artilleristen brauchen.
»Schluss mit Lothar«, flüsterte Marianne.
Sie schlug sich auf den Mund. Hatte sie jemand gehört?
Sie knöpfte den Mantel auf. Vielleicht wärmte er noch jemanden, auch wenn sie das Futter so oft genäht hatte, dass es ein unruhiges, vielfarbiges Muster aufwies. Lothar hatte ihr von seinen Reisen nach Bonn und Berlin zur Zentralverwaltung stets die Shampoofläschchen und das Nähgarn aus den Hotels mitgebracht. Kleine Manschetten aus Pappe. Graues Garn, schwarzes, weißes, rotes.
Wer braucht schon rotes?, dachte Marianne und begann, den hellbraunen Mantel zu falten, Kante auf Kante. So wie sie Lothars Taschentücher gefaltet hatte, die gebügelten Handtücher, Kante auf Kante.
Nicht einmal im Leben hatte sie Rot getragen. »Die Farbe der Huren«, hatte ihre Mutter gezischt und ihr eine Ohrfeige gegeben, als Marianne als Elfjährige mit einem roten Halstuch nach Hause gekommen war; sie hatte es gefunden, es hatte nach einem blumigen Parfüm gerochen.
Auf dem Montmartre hatte eine Frau am Rinnstein gehockt. Ihr Rock war hochgerutscht, und sie hatte rote Schuhe getragen. Ihre verweinten Augen waren mit Lidschatten verschmiert. »Nur eine betrunkene Hure«, hatte jemand aus der Reisegruppe gesagt. Als Marianne zu ihr gehen wollte, hatte Lothar sie festgehalten. »Mach dich nicht lächerlich, Annilein, die ist doch selber schuld.«
Er hatte sie daran gehindert, der Fremden zu helfen, und Marianne weiter in das Restaurant gezogen, in dem die Busreisegesellschaft einen Tisch bestellt hatte. Marianne hatte über die Schulter geschaut, bis die französische Reiseleiterin ihr kopfschüttelnd erklärt hatte: »Je connais la chanson – es ist immer dieselbe Leier, dabei ist es ihre eigene Schuld.«
Lothar hatte genickt, und Marianne hatte sich selbst dort im Rinnstein gesehen. Das war der Anfang, und nun stand sie hier.
Sie war noch vor der Vorspeise gegangen, weil sie es nicht mehr ertragen konnte, zu sitzen und zu schweigen. Lothar hatte es nicht bemerkt, er war in ein Gespräch verwickelt, das er seit zwölf Stunden führte. Mit einer Frau aus Burgdorf, einer fröhlichen Witwe. Die Frau quiekte ständig »incroyable! – unglaublich!«. Ganz gleich, was Lothar sagte. Sie trug einen roten BH unter der weißen Bluse.
Marianne war nicht einmal eifersüchtig gewesen. Nur müde. Sie hatte das Lokal verlassen und sich immer weiter treiben lassen, bis sie mitten auf dem Pont Neuf stehen geblieben war.
Lothar. Es wäre einfach gewesen, ihm die Schuld zu geben.
Aber so einfach war es nicht.
»Selber schuld, Annilein«, wisperte Marianne.
Sie dachte an ihre Hochzeit im Mai vor einundvierzig Jahren. Ihr Vater hatte ihr auf seinen Stock gestützt zugesehen, wie sie Stunde um Stunde vergeblich gewartet hatte, von ihrem Mann endlich zum Tanz gebeten zu werden. »Mein Stehaufmädchen«, hatte Mariannes Vater gesagt, seine Stimme vom Krebs geschwächt. Sie hatte gefroren in dem dünnen weißen Kleid und nicht gewagt, sich zu bewegen. Nicht dass alles nur ein Traum gewesen war und aufhörte, sobald sie einen falschen Schritt tat.
»Versprichst du mir, dass du glücklich wirst?«, hatte ihr Vater sie gefragt, und Marianne hatte mit »ja« geantwortet. Sie war neunzehn.
Am Ende war das nichts weiter als eine große Lüge gewesen.
Ihr Vater war zwei Tage nach der Hochzeit gestorben.
Marianne schüttelte den gefalteten Mantel wieder auf, schleuderte ihn auf den Boden und trampelte mutwillig auf ihm herum.
»Schluss! Schluss jetzt! Schluss mit mir!« Sie trat ein letztes Mal auf den Mantel und kam sich verwegen vor.
Das Gefühl verging so rasch, wie es aufgebrandet war. Sie hob den Mantel auf und legte ihn auf die Lehne der Bank.
Selber schuld.
Es gab nun nichts mehr, das sie ablegen konnte. Sie besaß keinen Schmuck. Keinen Hut. Sie besaß nichts. Ihre abgeschabte Handtasche, in der sich ein Paris-Reiseführer, ein paar Salz- und Zuckertütchen, eine Haarklammer, ihr Ausweis und ihre Geldbörse befanden, stellte sie zu den Schuhen und dem Ring.
Marianne begann, auf die Brüstung zu steigen. Sie rollte sich erst auf den Bauch, zog das andere Bein nach und drohte dann zurück über die Kante abzurutschen. Ihr Herz klopfte hart, ihr Puls raste, der rauhe Sandstein schürfte ihre Knie auf.
Ihre Zehen fanden einen Mauerspalt, sie drückte sich nach oben. Dann hatte sie es geschafft. Sie setzte sich auf und schwang ihre Füße über den Rand der Brüstung.
Nur abstoßen und fallen lassen, dabei gab es nichts falsch zu machen.
Marianne dachte an die Mündung der Seine bei Honfleur, die ihr Körper nach all den Schleusen und Ufern passieren würde, bevor er das Meer erreichte. Sie stellte sich vor, wie sie sich auf den Wellen um sich selber drehen würde; als ob sie tanzte, zu einem Lied, das nur sie und das Meer würden hören können. Honfleur. Da war Erik Satie geboren; sie liebte seine Musik, liebte ohnehin jede Art von Musik. Musik war wie ein Film, den sie hinter geschlossenen Lidern sah, und bei Satie sah sie das Meer, obgleich sie nie am Meer gewesen war.
»Ich liebe dich, Erik. Ich liebe dich«, flüsterte Marianne; nie hatte sie das zu einem anderen Mann als Lothar gesagt.
Wann hatte er zuletzt gesagt, dass er sie liebte?
Hatte er es jemals gesagt?
Marianne wartete auf die Angst, doch sie kam nicht.
Der Tod ist nicht umsonst. Er kostet das Leben.
Was ist meines wert?
Nichts.
Kein fairer Tausch für den Teufel.
Selber schuld.
Als sie ihre Hände fest in die Steinbrüstung stemmte und nach vorn rutschte, zögerte Marianne und dachte an die Orchidee, die sie im Müll gefunden hatte. Dass sie nach einem halben Jahr Pflege und Vorsingen nun nicht erleben würde, wie sich die Knospe öffnete.
Dann stieß sich Marianne mit beiden Händen ab.
Der Sprung wandelte sich zum Fall, der Fall riss ihr die Arme hoch. Während sie in den Wind hineinfiel, dachte Marianne an die Lebensversicherung, die bei Selbstmord nicht ausgezahlt werden würde. 124 563 Euro perdu. Lothar würde außer sich sein.
Doch ein fairer Tausch.
Mit diesem Gedanken schlug Marianne in der eiskalten Seine auf. Ein Gefühl der wilden Freude, das sich in tiefe Scham verwandelte, als ihr graues Blumenkleid ihren Kopf umschloss, während sie versank. Sie versuchte verzweifelt, den Rocksaum nach unten zu drücken, damit niemand ihre nackten Beine sah.
Irgendwann gab sie auf und breitete die Arme aus, sie öffnete den Mund und atmete das Wasser ein, so tief sie konnte.
2
Sterben war wie Schweben.
Marianne lehnte sich zurück. Es war so schön.
Dieses Glück hörte nicht auf, und man konnte es schlucken. Sie trank alles aus.
Siehst du, Papa, versprochen ist versprochen.
Sie sah eine Orchidee, eine violette Blüte, und alles war Musik. Als sich ein Schatten über sie beugte, erkannte sie den Tod; er trug ihr eigenes Gesicht, das Gesicht eines alt gewordenen Mädchens mit hellen Augen und abgeschnittenen braunen Zöpfen.
Sein Mund war warm. Sein Bart kratzte, und immer wieder legten sich seine Lippen auf die ihren, Marianne schmeckte Zwiebelsuppe und Rotwein, Zigaretten und Zimt.
Der Tod saugte an ihr, er lutschte, er war hungrig.
Marianne strampelte.
Zwei kräftige Hände legten sich auf ihren Busen. Sie versuchte matt, diese kalten Finger aufzubiegen, die ihre Brust aufbrachen, Stoß um Stoß. Ein Kuss. Kälte stieß in ihren Rachen.
Marianne riss die Augen auf, ihr Mund öffnete sich weit, und sie spie dunkles dreckiges Wasser, sie bäumte sich stöhnend auf, und als sie nach Luft schnappte, setzte der Schmerz ein wie eine scharfe Klinge, die ihre Lunge in Fetzen schnitt.
Und so laut! Alles war so laut!
Wo war die Musik? Wo war das Mädchen? Wo war das Glück? Hatte sie es ausgespuckt?
Marianne sackte zurück auf den harten Boden.
Der Tod schlug ihr ins Gesicht.
Sie blickte nach oben und sah in zwei himmelfarbene Augen, hustete und rang nach Luft. Matt hob sie ihren Arm und gab dem Tod eine schlaffe Ohrfeige zurück.
Der Tod redete auf sie ein, in schnellem, melodiösem Französisch, während er sie zwang, sich aufzusetzen.
Marianne gab ihm noch eine Ohrfeige.
Sofort schlug er zurück. Diesmal nicht so fest. Nein. Eigentlich hatte er ihre Wange gestreichelt.
Sie griff sich ins Gesicht. Wieso spürte sie das?
»Wieso?« Ihre Stimme nur ein dumpfes Kratzen.
Es war so kalt. Und dieses Rauschen! Marianne sah nach links. Nach rechts. Auf ihre Hände, die grün von dem Gras waren, in das sie sich krallte. Der Pont Neuf befand sich wenige Meter entfernt. Sie lag neben einem Zelt auf der rive droite, und Paris dröhnte. Und sie war nicht tot.
Nicht. Tot.
Ihr Magen tat ihr weh, ihre Lunge, alles tat weh, sogar ihre Haare, die nass, grau und schwer auf ihre Schultern fielen. Das Herz, der Kopf, die Seele, der Bauch, die Wangen, alles.
»Nicht tot?«, keuchte sie verzweifelt.
Der Mann mit dem Fischerhemd lächelte, dann versank sein Lächeln hinter einem Schatten aus Ärger. Er deutete auf den Fluss, tippte sich an die Stirn und deutete auf seine nackten Füße.
»Warum?« Sie wollte ihn anschreien, aber ihre Stimme zerbrach in heiserem Flüstern. »Warum haben Sie das gemacht?«
Er streckte die Arme hoch, ahmte einen Kopfsprung nach. Zeigte auf Marianne, die Seine und sich. Hob die Achseln, als ob er sagen wollte: »Was hätte ich anderes tun sollen?«
»Ich hatte … einen Grund. Hatte viele Gründe! Sie hatten nicht das Recht, mir den Tod zu nehmen. Sind Sie Gott? Nein, sind Sie nicht, sonst wäre ich ja tot!«
Der Mann mit den blauen Augen unter den schwarzen, dichten Augenbrauen sah Marianne an, als ob er verstand. Er zog sein nasses Hemd über den Kopf und wrang es aus.
Sein Blick fiel auf das Mal auf Mariannes linker Brust, das durch die aufgegangene Knopfleiste zu sehen war. Seine Augenbrauen schnellten überrascht nach oben. Sie zog den grauen Kleiderstoff panisch mit einer Hand zusammen. Das hässliche Mal – eine seltene Pigmentstörung in Form von Feuerflammen –, sie hatte es ihr ganzes Leben unter zugeknöpften Blusen und hochgeschlossenen Kleidern versteckt. Niemals war sie schwimmen gegangen, nur nachts, wenn niemand sie sehen konnte. Das Mal, das ihre Mutter Hexenfut genannt hatte und Lothar Teufelsding; er hatte es nie berührt und immer die Augen geschlossen, wenn er zu ihr kam und sich fünf Minuten in ihr ausruhte.
Dann registrierte Marianne ihre nackten Beine. Verzweifelt versuchte sie, den triefend nassen Saum des Kleides herabzuziehen und gleichzeitig die Knöpfe am Busen zu schließen.
Sie schlug die ausgestreckte Hand des Mannes zurück, der ihr aufhelfen wollte, und stand auf. Sie strich sich das Kleid glatt, das nass und schwer an ihr herunterhing. Ihre Haare rochen nach brackigem Wasser. Sie ging mit unsicheren Schritten auf die Quaimauer zu.
Zu wenig. Zu wenig, um sich herabzustürzen, sie würde sich verletzen, aber nicht sterben.
»Madame!«, bat der Mann, eine volle Stimme, und griff nach ihrem Arm. Sie schlug die Hand erneut weg. Schlug mit beiden Händen nach ihm, seinem Gesicht, seinen Armen, mit geschlossenen Augen, doch traf nur Luft. Dann trat sie nach ihm. Er wich aus, ohne zurückzuweichen. Für andere musste es so aussehen, als tanzten sie eine tragische Komödie der Liebe.
»Mir!«, stieß sie hervor, Tritt um Tritt, »mir gehörte mein Tod, mir und sonst niemandem, Sie durften ihn mir nicht wegnehmen!«
»Madame«, bat er erneut und umschlang Marianne mit beiden Armen. Er hielt sie fest, bis sie aufhörte, nach ihm zu treten, und sich schließlich erschöpft an seine nackte Schulter lehnte. Er strich ihr das Haar aus dem Gesicht, seine Fingerkuppen spröde wie Stroh. Er roch nach Übernächtigung und der Seine, und er roch nach Äpfeln auf einem sonnenwarmen Holzregal.
Er begann, sie in seinen Armen zu wiegen, so sanft, wie sie noch nie gewiegt wurde.
Marianne begann zu weinen. Sie versteckte sich in den Armen des Fremden, und er hörte nicht auf, sie zu halten und zu wiegen, während sie weinte, um ihr Leben, um ihren Tod.
»Mais non. Non.« Der Mann schob sie ein Stück von sich fort, hob ihr Kinn an und sagte: »Venez avec moi. Venez. On y va. Allez.«
Er zog sie mit sich. Marianne fühlte sich unendlich kraftlos, die groben Steine stießen ihr in die nackten Fersen. Der Mann ließ sie nicht los, während er sie hinauf zum Pont Neuf führte.
Als sie die Brücke betraten, verscheuchte der Fremde mit einem Pfiff zwei Clochards, die sich über zwei Paar Schuhe – Damen- und ungleiche Herrenschuhe – beugten; der eine hatte Mariannes Mantel an seine Brust gedrückt, der andere mit der verfilzten Wollmütze biss gerade auf den Ehering und verzog das Gesicht.
Als sie auf derselben Höhe waren, zischte der Mann die beiden Clochards an. Der größere zog ein Mobiltelefon hervor. Der kleinere hielt Marianne abwartend den Ehering hin.
Jetzt fing Marianne an zu beben, der Schüttelfrost stieg aus den Tiefen ihres Körpers empor und wusch durch ihre Adern.
Sie schlug dem Clochard den Ring aus der Hand und wollte auf die Brüstung klettern, doch alle drei Männer sprangen gleichzeitig nach vorn und hielten sie fest. In ihren Augen sah Marianne nur Mitleid und Angst, für etwas belangt zu werden, das sie nichts anging.
»Fasst mich nicht an!«, schrie sie. Keiner ließ sie los.
Sie ließ sich widerwillig auf die Bank setzen, der Große legte seinen schweren Mantel um Mariannes Schultern, der andere kratzte sich an der Mütze und kniete sich auf eine ruppige Anweisung hin nieder, um Mariannes Füße mit dem Ärmel seiner Jacke zu trocknen.
Ihr Retter telefonierte. Die Clochards setzten sich neben Marianne auf die Bank. Sanft hielten sie ihre Hände fest, als sie versuchte, sich in die Pulsadern zu beißen. Einer von ihnen bückte sich und legte Marianne ihren Ehering in das hohle Nest ihrer Hände.
Sie starrte auf den matten, gelbgoldenen Reif. Einundvierzig Jahre hatte sie ihn getragen. Nur einmal hätte sie ihn abgelegt. Beinahe. An ihrem vierzigsten Hochzeitstag. Sie hatte das graue Blumenkleid aufgebügelt, die Bananenknoten-Frisur aus einer Zeitschrift abgeschaut. Aus einer drei Monate alten Zeitschrift, die sie aus einem Altpapiercontainer gezogen hatte. Sie hatte ein wenig Chanel-Parfüm benutzt, eine Probe, die der weggeworfenen Zeitschrift beigelegen hatte; es roch blumig, und sie hätte gern ein rotes Halstuch gehabt.
Dann öffnete sie die Sektflasche und wartete auf ihren Mann.
»Wie siehst du denn aus?«, war Lothars erste Frage gewesen.
Sie hatte sich vor ihm gedreht und ihm den Sekt gereicht.
»Auf uns«, hatte sie gesagt, »Auf vierzig Jahre Ehe.«
Er hatte genippt und dann an ihr vorbei zum Kacheltisch gesehen, auf dem die geöffnete Flasche stand.
»Den teuren Sekt? Muss das sein, weißt du, wie viel der kostet?!«
»Es ist unser Hochzeitstag.«
»Das ist kein Grund, herumzuprassen. Du kannst mit meinem Geld nicht einfach machen, was du willst.«
Sie hatte damals nicht geweint. Sie hatte nie im Beisein von Lothar geweint. Nur unter der Dusche, wo er es nicht sehen konnte.
Sein Geld. Sie hätte gern für ihr eigenes Geld gearbeitet.
Sie hatte gearbeitet, weiß Gott, erst auf dem Hof ihrer Mutter im Wendland, dann als Hebamme zusammen mit ihrer Großmutter und schließlich als Hauswirtschafterin, bis Lothar sie heiratete und er es sich verbat, dass sie Fremden den Haushalt führte; sie hatte seinen zu führen. Sie war seine Putzfrau gewesen, seine Köchin, seine Gärtnerin, seine Gattin, sein Frauchen, »sein Stützpunkt«, wie er es nannte. Für ihre Mutter war sie Sterbepflegerin gewesen, zwanzig Jahre, erst an Mariannes zweiundvierzigstem Geburtstag war es vorbei gewesen. Marianne hatte das Haus bis dahin fast nur zum Einkaufen verlassen, zu Fuß, Lothar hatte ihr verboten, das Auto zu nehmen, und ihre Mutter hatte jeden Tag ins Bett gemacht. Sie konnte nicht selbst aufs Klo gehen, aber Marianne beschimpfen, das konnte sie, jeden Tag, und Lothar schlief immer öfter in der Kaserne oder ging alleine aus, er schrieb seinem Frauchen aus seinen Urlauben Postkarten und ließ die Mamuschka herzlich grüßen.
Marianne ließ den Ehering fallen.
In diesem Augenblick hörte Marianne die Sirene und schloss die Augen, bis der gellende Ton, der sich aus dem Straßengedärm der Stadt näherte, vor ihr innehielt.
Die Clochards wichen vor dem blauen zuckenden Licht zurück, und als zwei Sanitäter und eine kleine Frau mit einem Koffer auf sie zueilten, trat der Mann mit dem Fischerhemd vor, wies auf Marianne, zeigte auf die Seine und tippte wieder an seinen Kopf.
Er hält mich für eine Verrückte, dachte Marianne.
Sie versuchte, in ihr Gesicht das Lächeln zu pressen, das sie Lothar seit Jahrzehnten zeigte. »Du bist viel hübscher, wenn du lächelst«, hatte er nach ihrer ersten Verabredung gesagt.
Er war der erste Mann, der sie hübsch genannt hatte, trotz des Mals und trotz allem anderen. Sie war nicht verrückt. Nein.
Und sie war nicht tot.
Sie sah zu dem Mann, der sie aus der Seine gezogen hatte, ohne dass sie darum gebeten hatte. Er war der Verrückte. Verrückt genug, um anzunehmen, dass man nur zu überleben bräuchte, um zu leben.
Sie ließ sich von den Sanitätern auf die Liege schnallen. Als sie sie hochhoben und auf die geöffneten Türen des Krankenwagens zurollten, griff der Fremde mit den Himmelsaugen nach Mariannes Hand. Sie fühlte sich warm an, warm und vertraut.
Marianne sah ihr Spiegelbild in seinen großen, schwarzen Pupillen; sie sah ihre hellen Augen, die ihr immer zu groß erschienen waren, die Nase, die so klein war, ein herzförmiges Gesicht und dunkelgraues Haar, graubraun wie totes Holz.
Als sie ihre Hand öffnete, lag ihr Ehering darin.
»Entschuldigen Sie die Umstände«, sagte sie, doch er schüttelte den Kopf.
»Excusez-moi«, ergänzte sie.
»Il n’y a pas de quoi«, sagte er ernsthaft und klopfte sich mit der flachen Hand auf seine Brust. »Vous avez compris?«, fragte er.
Marianne lächelte. Was immer er meinte, er hatte bestimmt recht.
»Je m’appelle Eric.«
Er reichte der Ärztin Mariannes Handtasche.
»Marianne«, wollte Marianne sagen, ließ es jedoch sein; es reichte, wenn er seinen Freunden erzählte, er hätte die Verrückte aus dem Wasser gezogen. Wozu ein Name, Namen sagten nichts.
Marianne griff noch einmal nach Erics Hand.
»Bitte«, sagte sie. »Bitte behalten Sie ihn.«
Er starrte auf den Ring, den sie ihm zurückgegeben hatte.
Dann schlossen sich die Türen.
»Ich hasse dich, Eric«, wisperte Marianne, und ihr war, als ob sie immer noch seine spröden, aber so sanften Finger über ihre Wange streicheln spürte.
Auf der Fahrt schnitten ihr die Haltegurte ins Fleisch. Die Ärztin zog eine Spritze auf und stieß sie Marianne in die Armbeuge. Dann nahm sie eine zweite Spritzenspitze mit Schmetterlingsflügeln und schob sie Marianne in den Handrücken, um einen Venentropf anzuschließen.
»Tut mir leid, dass Sie wegen mir noch mal rausmussten«, flüsterte Marianne und sah der Ärztin in die braunen Augen, die ihr rasch auswichen.
»Je suis allemande«, murmelte Marianne. »Allemande.«
Es hörte sich an wie »eine Mandel«.
Die Ärztin breitete eine Decke über sie aus und begann zu diktieren. Der junge Assistent mit dem kargen Bärtchen am Kinn notierte. Das starke Beruhigungsmittel begann zu wirken.
»Ich bin eine Mandel«, nuschelte Marianne noch und schlief ein.
3
In ihrem Traum saß sie auf dem Pont Neuf. Sie nahm die Armbanduhr ab, die sie gar nicht besaß, zertrümmerte das Glas auf dem Stein, riss die Zeiger des Zifferblattes herunter und warf sie in den Fluss.
Niemandem konnte die Zeit jetzt noch dazwischenkommen. Die Zeit würde stehenbleiben, sobald sie sprang, und keiner würde Marianne daran hindern, ins Meer hineinzutanzen.
Doch als sie sprang, fiel sie langsam, wie durch flüssiges Harz gebremst. Aus dem Wasser stiegen Körper auf; sie schwebten an ihr vorbei, nach oben, während Marianne fiel. Sie erkannte die Gesichter. Jedes einzelne. Es waren ihre Toten. Die aus dem Sterbehospiz, in dem Marianne gearbeitet hatte, nachdem ihre Mutter gestorben war. Zu denen niemand sonst ging, aus Angst, sich mit dem Sterben anzustecken. Marianne hatte ihre Hände gehalten, wenn es so weit war; und an Mariannes Händen geführt, gingen sie hinüber in das Nichts.
Manche wehrten sich, verzweifelt, wimmernd. Andere schämten sich ihres Sterbens. Aber alle hatten sie Mariannes Blick gesucht und sich an ihm festgehalten, bis ihre Augen erloschen.
Auch im Traum suchten sie Mariannes Blick und griffen nach ihren Händen. Stimmen, die jeden unerfüllten Traum betrauerten, jeden nicht gegangenen Schritt, jedes nicht gesprochene Wort, vor allem die zornigen. Das Ungetane war es, das sich keiner der Todgeweihten je verzeihen konnte. Alle hatten es Marianne auf dem Sterbebett gestanden, was sie im Leben nicht getan hatten, was sie versäumt hatten zu wagen.
Das Licht war hell und gleißend, und als sie die Augen öffnete, stand Lothar am Ende des Betts. In seinem dunkelblauen Anzug mit den Goldknöpfen sah er aus wie von einer Jacht heruntergesprungen. Und neben ihm stand eine Frau in Weiß gekleidet. Ein Engel?
Auch hier war es furchtbar laut, Maschinen piepten, Menschen redeten, ein Fernseher lief. Marianne legte ihre Hände an die Ohren.
»Hallo«, sagte sie nach einer Weile.
Lothar drehte sich zu Marianne um. In seinen Augen konnte sie sich selbst nicht sehen. Er kam näher und beugte sich über sie. Betrachtete Marianne wieder, als ob er sich nicht sicher wäre, was er da sah.
»Was sollte das?«, fragte ihr Mann schließlich.
»Was sollte was?«
Er schüttelte den Kopf. Als ob er es nicht fassen konnte.
»Dieses Theater.«
»Ich wollte mich umbringen.«
Lothar stützte die Hand neben ihrem Kopf ab. »Wozu?«
Bei welcher Lüge konnte sie nur anfangen? »Ist schon in Ordnung«, wo nichts in Ordnung gewesen war? Oder: »Mach dir keine Gedanken«, wo er sich welche hätte machen müssen?
»Ich … Ich …«
»Ich, ich«, knurrte Lothar. »Das ist mal ein guter Grund. Ich.«
Wieso sagte sie ihm nicht: Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Lieber sterbe ich, als weiter mit dir zu leben.
Marianne versuchte es noch einmal. »Ich … ich will …« Sie stockte wieder. Ihr Mund war wie mit Sandstein gefüllt.
»Ich wollte tun, was ich will.«
Ihr Mann setzte sich auf.
»Tun, was du willst! Aha. Und das kommt dabei heraus, ja? Sieh dich doch nur an.«
Er lachte auf. Sah zu der Schwester, die immer noch da stand und sie beobachtete, und lachte, und dann lachte die Schwester mit, als säßen sie im Zirkus, und der Clown fiele gerade über seine Füße.
Marianne spürte Hitze in ihren Wangen aufsteigen.
Lothar setzte sich wieder auf die Bettkante und drehte ihr den Rücken zu. Sein Lachen hatte abrupt aufgehört.
»Als der Anruf kam, war ich nur noch auf Autopilot. Dein Menü musste ich natürlich zahlen. Ob du dich umbringst, ist dem Koch reichlich egal.«
Marianne zog die Bettdecke höher. Doch ihr Mann saß darauf, und sie zerrte vergeblich. Sie fühlte sich nackt.
»Die Metro fährt nur bis eins. Und das nennt sich Weltstadt! Ich musste ein Taxi nehmen. Das kostet so viel wie der Bus von uns zu Hause bis nach Paris und zurück. Ist dir das klar?«
Lothar atmete hörbar aus, als ob er kurz davor wäre, zu schreien.
»Weißt du überhaupt, was du mir da angetan hast? Willst du, dass wir uns fremd werden? Dass ich jede Nacht das Licht anlassen muss, um nach dir zu sehen?«
»Es tut mir leid«, presste Marianne hervor.
»Ach. Leid. Und an wem bleibt das hängen? Weißt du, wie einen die Leute angucken, wenn sich die Frau umbringt? Das kann einem alles ruinieren, alles. Daran hast du nicht gedacht, als du machen wolltest, was du willst. Als ob du überhaupt wüsstest, was du wolltest.«
Lothar sah auf die Uhr. Eine Rolex. Dann stand er auf.
»Der Bus geht um Punkt sechs Uhr. Dieser Zwangsspaß hier reicht mir.«
»Und … wie komme ich nach Hause?« Marianne hörte ihre eigene bittende Stimme und schämte sich. Sie besaß wirklich nichts, nicht mal Stolz.
»Den Rücktransport zahlt die Kasse. Morgen kommt ein Psychologe, der dich begleitet. Mein Ticket verfällt, wenn ich nicht mitfahre. Du springst allein von der Brücke, ich fahre allein nach Hause, so macht jeder, was er will. Hast du dagegen irgendwas einzuwenden?«
»Könntest du mich in den Arm nehmen?«, flehte Marianne.
Ihr Mann ging, ohne sie noch einmal anzusehen.
Als sie den Kopf abwandte, begegnete sie dem Blick der Frau im Nebenbett. Sie betrachtete Marianne voller Mitleid.
»Er ist schwerhörig«, erklärte Marianne ihr rasch, »er hat es … nur nicht gehört. Nicht gehört, verstehen Sie?« Dann zog sie sich die Decke über den Kopf.
4
Der Engel mit den hungrigen Augen, Schwester Nicolette, hatte ihr nach einer Stunde energisch die Decke vom Kopf gezogen und ihr ein Tablett auf den Beitisch geknallt.
Marianne hatte nichts von dem Essen angerührt. Es sah aus wie ein Stück eines totgetretenen Tiers, der glibberige Rand hatte nach muffigem Holz gerochen. Die Butter war steinhart gewesen, die Suppe dünn, mit drei Möhrenwürfeln und einem einzelnen Frühlingszwiebelring. Sie hatte die Suppe der Frau im Nachbarbett gegeben. Als diese Marianne über den Arm streichen wollte, war sie erschrocken zurückgewichen.
Nun schob sie sich an ihrem Tropf auf Rollen vorwärts und hielt sich das kurze Klinikhemdchen zu, das über dem Hintern offen war. Ihre nackten Fußsohlen schmatzten, wenn sie sie vom Boden nahm. Sie ging den Flur hinunter, bis sie auf einen weiteren stieß, der quer zu ihrem Trakt verlief. An der Ecke befand sich das verglaste Schwesternzimmer.
Ein kleiner Fernseher lief. Ein aufgeregter Nicolas Sarkozy erklärte der Nation seinen Unmut, eine Zigarette dampfte im Aschenbecher vor sich hin. Nicolette hörte Radio, blätterte in einer Zeitschrift und wickelte ein Törtchen aus.
Marianne ging näher heran. Die Musik … Violinen. Akkordeon. Klarinetten. Ein Dudelsack. Marianne schloss die Augen, um ihren Film zu sehen.
Sie sah Männer mit schönen Frauen tanzen. Marianne sah eine Tafel, Kinder und Apfelbäume, die Sonne, die ein Meer am Horizont beleuchtete, sie sah blaue Fensterläden an alten Sandsteinhäusern mit Reetdach und eine kleine Kapelle; die Männer hatten die Hüte nach hinten in den Nacken geschoben. Sie kannte das Lied nicht, doch sie hätte es gern gespielt. Die Klänge des Akkordeons schnitten ihr tief ins Herz.
Sie hatte Akkordeon gespielt, erst mit einem kleinen und dann, als ihre Arme lang genug waren, mit einem großen. Ihr Vater hatte es ihr zum fünfzehnten Geburtstag geschenkt. Ihre Mutter hasste es. »Lern nähen, das macht weniger Lärm.« Irgendwann hatte Lothar das Akkordeon auf den Sperrmüll getragen.
Auf der Anzeigentafel glomm rhythmisch ein rotes Licht mit einer Zimmernummer auf.
Nicolette sah genervt auf, erblickte Marianne und wandte sich dann gleichgültig von ihr ab.
Marianne wartete, bis Nicolette verschwunden war. Dann betrat sie das Schwesternzimmer.
Hungrig griff Marianne nach der Tüte Madeleines auf dem Tisch, einzeln verpackt; dabei stieß sie fast die bunte Fliese herunter, die als Untersetzer diente. Sie hörte, wie eine Tür geschlossen wurde, huschte auf den Flur und durch eine weitere Tür mit dem Symbol für »Treppenhaus«.
Leise drückte sie die Tür hinter sich zu; beinahe blieb der Schlauch des Tropfs im Türspalt stecken.
Marianne setzte sich auf die unterste Treppenstufe und atmete aus. Erst da merkte sie, dass sie immer noch die Törtchen und die Fliese unter dem Arm hielt. Sie lauschte, doch nichts war zu hören. Sie lehnte die Fliese gegen die vergitterte Fensterscheibe, hielt ihre nackten Zehen in das Mondlicht und wickelte das Gebäck aus der Tüte.
So ist das also, dachte Marianne. So ist das also, in Paris zu sein.
Sie biss in den süßen weichen Kuchen und betrachtete die kleine handbemalte Kachel.
Schiffe, ein Hafen. Ein unendlich blauer Himmel, so reich und verschwenderisch strahlend, wie frisch gewaschen. Der Maler hatte auf kleinstem Raum einen großartigen Himmel erschaffen. Marianne versuchte, die Namen auf den Schiffen zu lesen.
Marlin. Genever. Koakar. Und …
Mariann.
Die Mariann war ein zierliches rotes Schiff, das ein wenig vergessen am Rande dümpelte; seine Segel waren schlaff.
Mariann.
Wie schön es dort war. Die Musik aus dem Radio schien dorthin zu passen, so fröhlich, so zärtlich. Sonnig und frei.
Als Marianne das zweite Mal abbeißen wollte, schluchzte sie so heftig auf, dass sie husten musste. Die Krümel explodierten, mit Spucke und Tränen vermischt, aus ihrem Mund.
Das Ungetane. Das war es, was die Toten ihr hatten mitteilen wollen. Das Ungelebte. Es gab im Leben Mariannes nur Ungelebtes.
Marianne betrachtete den Schlauch in ihrer Hand, dann zog sie ihn ruckartig heraus. Es blutete.
Daran werde ich auch nicht sterben, außerdem habe ich die Unterhose seit gestern früh an, wie sieht das denn aus, wenn sie mich in die Kühlschublade stecken?
Sie wischte sich die Tränen mit dem Handrücken fort und blinzelte. Sie hatte in den letzten Stunden mehr geweint als in den Jahrzehnten davor; das musste aufhören, es nützte doch nichts.
Sie sah wieder auf die Fliese und konnte den Anblick der schlaffen Segel der Mariann nicht ertragen. Sie drehte die Kachel um.
Auf der Rückseite war eine Inschrift: Port de Kerdruc, Fin.
Marianne aß das letzte Stück der Madeleines und hatte immer noch Hunger.
Kerdruc. Sie drehte die Fliese wieder um und roch an ihr. Roch sie nicht … nach Meer?
Niemals an einem so schönen Ort gewesen.
Marianne versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, wenn Lothar und sie an so einem Ort gewesen wären. Doch alles, was sie vor ihrem inneren Auge sah, war Lothar vor dem gefliesten Wohnzimmertisch. Sie sah die alten Zeitschriften der Nachbarn, die er parallel zu den Fugen auf dem Wohnzimmertisch anordnete. Ganz gerade. Sie hätte ihm dankbar sein müssen, für die Ordnung, die er in ihr Leben gebracht hatte. Das war ihr Zuhause. Das letzte Haus am Ende einer Sackgasse.
Marianne streichelte wieder die Fliese.
Ob Lothar die Orchidee wohl gießen wird?
Marianne lachte kurz auf. Bestimmt nicht.
Kerdruc. Wenn es am Meer war, dann …
Marianne schrak zusammen, als sich hinter ihr die Tür öffnete. Nicolette. Zornig redete sie auf Marianne ein und bedeutete ihr mit einer herrischen Handbewegung, nach oben zu kommen. Marianne konnte ihr nicht in die Augen sehen, als sie sich neben der Schwester zurück in den hellen Flur drückte und sich widerstandslos in ihr Zimmer zurückdirigieren ließ.
Routiniert legte Nicolette ihr einen neuen Tropf an und presste Marianne zwei rosa Tabletten zwischen die Lippen.
Gehorsam tat sie so, als schlucke sie die Pillen mit dem abgestandenen Wasser auf dem Nachttisch. Ihre Bettnachbarin weinte im Schlaf wie ein wimmerndes Lamm.
Als Nicolette das Licht löschte und die Tür hinter sich zuzog, spuckte Marianne die Pillen aus.
Dann zog sie die Fliese hervor, die sie unter dem Hemd an ihr Herz gedrückt hatte.
Kerdruc. Marianne streichelte über das Bild. Es war absurd, aber es war, als ob sie die milde Luft unter ihren Fingern spürte, und sie erschauerte.
Marianne erhob sich und schritt langsam zum Fenster. Der Wind höhnte. Ein Grollen näherte sich; der Himmel riss auf, und ein Blitz erleuchtete für Sekunden das Zimmer. Regen setzte ein und prasselte gegen die Fensterscheiben wie Perlen einer gerissenen Kette. Das Mondlicht vergrößerte die Tropfen und ließ sie auf der Erde tanzen. Sie kniete sich nieder und fuhr mit dem Finger die Kanten des Fensterschattens nach, den Lunas Laterne aus der Nacht herausgeschnitten und ihr zu Füßen gelegt hatte. Der Donner grollte, als würde das Gewitter direkt über dem Krankenhaus schweben.
Mein kleines Frauchen, das Angst vor einem Gewitter hat.
Lothar.
Sie hatte keine Angst vor Gewittern. Sie hatte ihm zuliebe so getan, damit er Marianne damit aufziehen und sich großartig fühlen konnte. Zu solchen Dummheiten hatte sie sich dauernd hinreißen lassen.
Sie sah hinaus in den entzweigerissenen Himmel und umfasste zögernd ihre vollen Brüste mit beiden Händen. Lothar war der erste Mann gewesen, und der einzige; sie war aus der Jungfräulichkeit ungeküsst in die Ehe geglitten. Er war ihr Zuhause gewesen, seit sie ihr Elternhaus verlassen hatte.
Mein Mann hat weder meine Seele berührt noch meinen Körper bezaubert. Warum habe ich das zugelassen? Warum?
Sie ging zu den Schränken, in denen sie ihre Kleider fand. Sie rochen brackig. Marianne wusch das Kleid aus, fand ein Deodorant und sprühte es damit ein; nun roch es nach Rosen und Brackwasser.
Sie ging auf das Waschbecken zu, das mitten im Raum angebracht war. Wussten die Architekten nicht, wie lächerlich es aussah, wenn eine Frau sich mitten im Zimmer stehend mit dem Waschlappen abreiben musste?
Marianne tat es trotzdem. Als sie sich sauberer fühlte, stellte sie sich auf die Zehenspitzen, um in den Spiegel zu sehen.
Nein. Da war nichts Stolzes in diesem Gesicht. Nichts Würdiges.
Ich bin jetzt älter, als meine Großmutter es überhaupt wurde. Ich habe immer gehofft, in mir wartet eine weise alte Frau. Sie wartet geduldig, sich von innen nach außen zu schälen. Erst erscheint der Körper, dann das Gesicht, zuletzt der Dutt, und in den Händen hält sie eine ofenwarme Form mit Käsekuchen.
Marianne senkte den Blick. Keine weise Frau blickte sie da an, nur eine alte, mit dem faltigen Gesicht eines Mädchens, ein kleines Frauchen, nicht viel größer, als sie es mit vierzehn gewesen war. Und immer noch so pummelig.
Sie lachte bitter auf.
Ihre Großmutter Nane, die sie sehr verehrte, war in einer hellen Januarnacht 1961 gestorben. Sie war auf dem Rückweg vom Landgut der Von Haags, wo sie eine Hausgeburt begleitet hatte, ausgerutscht und in einen Wassergraben gefallen. Aus eigener Kraft hatte sie es nicht geschafft, wieder herauszukommen. Marianne hatte ihre tote Großmutter gefunden. In Nanes Gesicht war der Ausdruck von Ärger und Verwunderung über diese Dummheit festgefroren gewesen.
Marianne spürte immer noch eine diffuse Schuld in sich: An dem Abend hatte sie ihrer Großmutter nicht wie sonst bei der Geburt assistiert, sie hatte sich gedrückt.
Marianne betrachtete ihr Gesicht. Je länger sie sich ansah, desto schwerer fiel ihr das Atmen, Grauen erfüllte sie. Ihr ganzes Sein nahm das Grauen auf wie ein Garten den alles vernichtenden Regen.
Was soll ich nur tun?
Die Frau im Spiegel hatte keine Antwort; sie war bleich wie der Tod.
5
Der Morgen kam schnell. Um kurz nach sechs wurden die Patienten geweckt, und nachdem Marianne sich angekleidet hatte, führte man sie in ein Büro im ersten Stock des Krankenhauses. Es sah so aus, als gehörte es einer Ärztin mit zwei Kindern – überall selbstgemalte Bilder, Fotos der Familie, eine Landkarte Frankreichs mit kleinen Fähnchenpins darin.
Marianne stand auf und suchte Kerdruc, indem sie die Wasserkante des Landes mit den Fingern abfuhr; doch sie fand keinen Ort dieses Namens. Dafür entzifferte sie in der Legende die Abkürzungen der Departements – Fin. Es stand für Finistère, ein Stück Land im Westen Frankreichs, das in den Atlantik hineinragte – die Bretagne.
Marianne drückte vorsichtig die Klinke der Bürotür hinunter, aber sie war verschlossen. Sie setzte sich hinter den Schreibtisch und starrte auf ihre Schuhspitzen.
Nach einer Stunde erschien der Psychologe; ein schlanker, hochgewachsener Franzose mit welligem schwarzem Haar und einem zu intensiven Aftershave. Marianne fand, er sah furchtbar nervös aus, er kaute ständig auf seiner Unterlippe und warf ihr Blicke zu, die so schnell waren, dass sie sie kaum festhalten konnte.
Er blätterte in den wenigen Seiten auf seinem Klemmbrett. Dann nahm er seine Brille ab, setzte sich halb auf die Schreibtischkante und sah Marianne erstmals aufmerksam an.
»Der Suizid ist keine Krankheit«, begann er in stark französisch gefärbtem Deutsch.
»Nicht«, erwiderte Marianne.
»Nein. Er steht nur am Ende einer krankhaften Entwicklung. Er ist Ausdruck der Not. Sehr tiefer Not.« Seine Stimme war sanft, und er sah sie aus grauen Augen an, als würde er nur dafür leben, sie zu verstehen.
Marianne spürte ein Kribbeln im Hals. Es war schon komisch. Da saß sie hier mit einem Mann, der den extravaganten Traum hütete, zu verstehen und helfen zu können, einfach so, nur indem er sie anschaute und wie ein Gesalbter sprach.
»Und der Suizid ist auch zu akzeptieren. Er stellt einen Wert dar für den, der ihn sucht. Es ist nicht falsch, wenn Sie sich umbringen wollen.«
»Und das ist wissenschaftlich erwiesen?«, entschlüpfte es ihr.
Der Psychologe sah sie nur an.
»Entschuldigung.«
»Wieso entschuldigen Sie sich?«, fragte er dann.
»Ich … weiß nicht.«
»Wussten Sie, dass Menschen mit schweren Depressionen leicht zu kränken sind, sich jedoch ständig entschuldigen und ihre Aggressionen gegen sich statt den Auslöser richten?«
Marianne sah den Mann an. Er musste Mitte vierzig sein, er trug einen Ehering am Finger. Wie gern hätte sie daran geglaubt, sich einfach gehenlassen zu können. Alles aus sich herauszuschleudern, sich trösten zu lassen und ihr Leben auf seinem Gesicht zu lesen. Er würde ihr Mut geben und Medikamente, und sie wäre geheilt von jedem törichten Wunsch.
Suizid ist keine Krankheit. Schön.
»Wussten Sie, dass die meisten Kirchenglocken zu große Klöppel besitzen?«, erwiderte sie. »Die meisten Glöckner stellen eine viel zu kräftige Schwungdynamik ein, und nach ein paar Jahren hören sich die Glocken an wie leere Salatschüsseln, die aneinanderschlagen. Sie sind verbraucht.«
»Fühlen Sie sich wie so eine Glocke?«
»Eine … Glocke? Wieso?!«
Ich fühle mich, als ob ich nie da war.
»Sie wollten nicht mehr weiterleben, wie Sie lebten. Warum haben Sie ausgerechnet in Paris versucht, sich zu töten?«
Wie er das sagt. So vorwurfsvoll. Niemand kommt zum Sterben nach Paris, alle wollen hier leben und lieben, nur ich bin so dumm und denke, dass man hier sterben darf.
»Es erschien mir angemessen«, antwortete Marianne schließlich.
Sie hatte es geschafft. Sie hatte den dringenden Wunsch, endlich die Wahrheit zu sagen, überwunden.
»Gut.« Er stand auf. »Ich möchte gern mit Ihnen einige Tests durchführen, bevor Sie nach Hause fahren. Kommen Sie.« Er stand auf und hielt ihr die Tür auf.
Marianne sah auf ihre grauen Schuhe und wie ihre Füße einen Schritt vor den anderen taten. Aus dem Zimmer, über den Flur, durch eine Schwingtür, in den nächsten, und immer weiter.
Ihr Vater war Glockenstimmer gewesen, bevor er aus dem Dachstuhl eines Kirchturms stürzte und sich nahezu alle Knochen brach. Mariannes Mutter hatte ihm dieses Missgeschick für den Rest seines Lebens außerordentlich übelgenommen. Es gehörte sich für einen Mann in diesen Zeiten nicht, seiner Frau solche Umstände zu bereiten.
Über das Wesen der Kirchenglocke hatte ihr Vater ihr erklärt: »Der Klöppel muss die Glocke küssen, nur ganz leicht, und sie zum Schwingen verführen. Niemals zwingen.«
Sein Charakter glich dem einer Glocke. Wenn man ihren Vater zwingen wollte, zu reagieren, so harrte er stumm aus, bis man ihn in Ruhe ließ.
Nach dem Tod ihrer Großmutter hatte er sich dann getraut, aus dem ehelichen Schlafzimmer auszuziehen, und sich im Werkstattschuppen sein Lager bereitet. Bevor Marianne Lothar geheiratet hatte, war sie das Bindeglied zwischen ihren Eltern gewesen, wenn sie ihm Essen in die Werkstatt brachte, wo er sich die Zeit damit vertrieb, kleine Glockenspiele zu bauen. Wenn er Marianne neben sich sah, hatte sie oft die Zuneigung gespürt, die er für sie empfand; er war gerührt, dass er eine Tochter hatte, die ihn liebte und die ihm flüsternd gestand, wie sie sich ihr Leben erträumte; mal wollte sie Archäologin werden, dann Musiklehrerin, und sie wollte Fahrräder für Kinder bauen und in einem Haus am Meer leben. Sie waren beide Träumer gewesen.
»Du hast zu viel von deinem Vater«, hatte Mariannes Mutter gesagt.
Marianne hatte jahrzehntelang nicht an ihren Vater denken können. Er fehlte ihr, vielleicht war das das einzige offene Geheimnis. Und ihr Versprechen, glücklich zu werden. Sich selbst zu verzaubern.
»Entschuldigen Sie mich einen Moment«, sagte der Psychologe und winkte der Ärztin, die Marianne in der vergangenen Nacht ins Krankenhaus gebracht hatte. Sie sprachen Französisch und sahen immer wieder zu Marianne herüber.
Marianne trat ans Fenster und drehte sich so von den beiden weg, dass sie die kleine Fliese aus der Handtasche ziehen und betrachten konnte.
Kerdruc. Als sie das Bild berührte, spürte sie ein so heftiges Ziehen in der Brust, dass sie kaum mehr atmen konnte.
Suizid hat seinen Wert.
Marianne sah wieder auf den Boden.
Ich mag meine Schuhe wirklich nicht.
Dann ging sie einfach los, stieß die nächste Schwingtür auf, fand eine Treppe, lief sie rasch hinunter und bog dann nach rechts ab. Sie kreuzte einen Flur, in dem Kranke matt auf Bänken saßen, und sah am Ende des Gangs eine weitgeöffnete Tür, die ins Freie führte. Luft! Endlich, das Gewitter hatte den Tag gewaschen, und die Luft war mild und sanft, und Marianne ignorierte die Arthroseschmerzen in ihrem Knie und begann zu laufen.
Ihr Herz schlug hart im Gaumen, und sie lief über die gepflasterte Straße und in eine Gasse hinein; sie tauchte unter einem Torbogen hindurch, lief durch einen Innenhof und auf der anderen Seite wieder hinaus. Sie lief ohne nachzudenken immer abwechselnd von der einen Straßenseite zur anderen.
Sie wusste nicht, wie lange sie durchgehalten hatte, aber als das Seitenstechen nicht mehr auszuhalten war, ließ sie sich am Rand eines kleinen Brunnens nieder. Sie ließ sich das Wasser über die Handgelenke rinnen und blickte in ihr Spiegelbild auf der Wasseroberfläche.
Hieß es nicht, Schönheit sei ein Zustand der Seele? Und wenn eine Seele geliebt würde, dann verwandelte sich jede Frau in ein bewunderungswürdiges Wesen, mochte sie sonst noch so durchschnittlich sein. Die Liebe veränderte die Seelen der Frauen, und sie wurden schön, für Minuten nur oder für immer.
Ich wäre so gern schön gewesen, dachte Marianne. Nur fünf Minuten. Ich wünschte, es hätte mich jemand geliebt, den ich liebe.
Sie tauchte den Finger in das Wasser und rührte langsam darin herum. Ich hätte so gern mal mit einem anderen Mann als Lothar geschlafen. Ich hätte so gern etwas Rotes getragen.
Ich wünschte, ich hätte gekämpft.