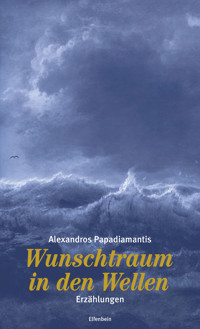Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kleine Griechische Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Papadiamantis' bekannteste Erzählung erschien erstmals 1903 als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift »Panathínäa«. Auf der ägäischen Insel Skiathos wird eine vom Alter gezeichnete Hebamme zur Mörderin an mehreren Mädchen, um diesen ein zukünftiges Leben in Abhängigkeit und Sklaverei zu ersparen. Papadiamantis' sozialkritischer Blick auf die Stellung der Frau in der Gesellschaft seiner Zeit sowie die herausragend sprachlich-stilistische Form des Textes machen »Die Mörderin« (« 'H Φόνισσα ») zu einem der wichtigsten Werke der neugriechischen Erzählliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kleine Griechische Bibliothek, Band 8Alexandros PapadiamantisDie Mörderin
Roman
Aus dem Griechischen von Andrea Schellinger
Mit einem Nachwort von Danae CoulmasElfenbein
Die vorliegende Übersetzung erschien erstmals 1989 in der Bibliothek Suhrkamp.
Zweite Auflage, 2021
© 2015 Elfenbein Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-96160-097-7 (E-Book)
1
Halb sitzend, halb liegend ruhte Tante Hadoúla, im Allgemeinen Jannoú, die Frau von Frangos geheißen, mit geschlossenen Augen beim Kamin, lehnte ihren Kopf an dessen Sockel, den man auch »Feuerbock« nennt, schlief aber nicht, sondern opferte den Schlaf neben der Wiege ihrer kleinen, kranken Enkelin. Die Wöchnerin indes, die Mutter des leidenden Säuglings, war vor kurzem auf ihrer niedrigen, armseligen Liegestatt eingeschlafen.
In Höhe der Kaminhöhle flackerte und zuckte die kleine Hängelampe. Sie warf Schatten statt Licht auf die spärlichen, armseligen Möbel, welche bei Nacht reinlicher und feiner aussahen. Im Herd gaben drei halb abgebrannte Scheite und der klobige, aufgerichtete Holzklotz reichlich Asche, ein wenig Glut und bisweilen eine knisternde Flamme, die der Alten, wie sie so döste, ihre jüngste Tochter Krinió ins Gedächtnis rief; wäre diese jetzt hier, würde sie im Singsang wispern: »Wenn er ein Freund ist, soll er sich seines Lebens freuen; wenn er ein Feind ist, soll er in die Grube fahren …«
Hadoúla, die Frau von Frangos, auch Frangojannoú genannt, war eine wohlgewachsene Frau von fast sechzig Jahren, von männlichem Wesen, mit derben Zügen und zwei kleinen Schnurrbartspitzen oberhalb der Lippen. Wenn sie im Rückblick über ihr Leben nachdachte, begriff sie, dass sie die ganze Zeit nichts weiter getan hatte, als anderen Leuten zu dienen. Im jüngsten Mädchenalter tat sie Dienste für ihre Eltern. Als sie sich verehelichte, wurde sie zur Sklavin ihres Mannes; zugleich stand dieser ihrer Wesensart und seiner schwachen Natur wegen unter ihrer Kuratel; als sie Kinder gebar, wurde sie zur Magd ihrer Kinder; als ihre Kinder selbst Kinder gebaren, wurde sie aufs neue Dienerin für ihre Enkel.
Seit zwei Wochen war das Neugeborene nun auf der Welt. Die Mutter, die auf der Liegestatt schlief – es war Delcharó, die erstgeborene Tochter Frangojannoús und Ehefrau von Trachílis –, hatte ein schweres Wochenbett hinter sich. In großer Eile wurde das Kindchen bereits am zehnten Lebenstag getauft, denn es litt fürchterlich an einem bösen Husten, Keuchhusten war’s wohl, von Krampfanfällen begleitet. Nachdem sie es hatten taufen lassen, schien sich sein Zustand am ersten Abend ein wenig zu bessern; vorübergehend ließ das Husten nach. Seit vielen Nächten hatte Frangojannoú ihren Augen keinen Schlummer und ihren Lidern keine Schläfrigkeit gegönnt. Immerfort wachte sie neben dem kleinen Geschöpf, das sich nicht ausmalen konnte, welche Mühen es anderen bereitete, und auch nichts von der Sorgenlast wusste, die es zu tragen hätte, falls es am Leben bliebe. Es vermochte nicht einmal aufzumerken bei der ratlosen Frage, die sich einzig die Großmutter insgeheim stellte: »Lieber Gott, warum hat auch das noch auf die Welt kommen müssen?«
Die Alte sang es in den Schlaf, und über der Wiege des kleinen Wesens hätte sie die Leiden ihres ganzen Daseins in Liedern vorzubringen vermocht. Als sie sich aber im Verlauf der vergangenen Nächte ohne Rücksicht auf Reime all dieser Kümmernisse und Sorgen entsonnen hatte, war sie wahrhaftig ins Spintisieren geraten. Erneut war ihr in Bildern, Szenen und Visionen das ganze Leben durch den Sinn gegangen, diese unersprießliche, vergebliche Mühe.
Ihr Vater war ein sparsamer, fleißiger und besonnener Mensch gewesen, ihr Mutter dagegen bösartig und missgünstig, ein Lästermaul und einer der Zankteufel ihrer Zeit. Sie betrieb Zauberei. Ein paar Mal hatten Kleften ihr nachgestellt, Gefolgsleute von Karatássos und Gatsos oder von anderen makedonischen Bandenführern, die ihr heimzahlen wollten, dass sie sie verhext hatte und daher die Geschäfte gar nicht gutgingen. Drei Monate lang hatten sie Maulaffen feilhalten müssen, weil einfach keine Beute zu machen war, weder bei Türken noch bei Christenmenschen. Auch war ihnen von der Regierung in Korinth keinerlei Unterstützung zugesandt worden.
Sie hatten sie den Abhang hinuntergejagt, vom Gipfel des Heiligen Athanassios bis aufs Plateau des Propheten Elias mit den riesigen Platanen und der üppig sprudelnden Quelle, von dort nach Merovíli am Bergrücken zwischen einem Wäldchen und Gestrüpp, wo sie versuchte, sich in einem undurchdringlichen Dickicht zu verstecken; die Männer aber ließen sich nicht überlisten. Sie wurde verraten vom Rascheln der Blätter und Zweige, also von ihrer eigenen Furchtsamkeit, die sich als zitternde Bewegung auf Äste und Buschwerk übertrug. Da vernahm sie eine rohe, zornige Stimme:
»Ha! Haben wir dich endlich erwischt, du Weibsstück!«
Sie schoss aus den Büschen hervor und machte sich wie ein aufgescheuchtes Täubchen mit dem Flügelschlag ihrer weiten weißen Ärmel davon. Nun gab’s keine Hoffnung mehr, dass sie mit heiler Haut davonkam. Ehemals, als sie ihr zum ersten Mal nachgestellt hatten, war’s ihr gelungen, sich drunten in Pyrgí zu verbergen, weil es dort viele Pfade gab, nicht wie hier in Merovíli, wo man lediglich auf Baumgruppen und dichtes Strauchwerk stieß und nicht auf schmale, unübersichtlich miteinander verbundene Wege. Die damals junge Delcharó, Frangojannoús Mutter, sprang mit bloßen Füßen wie ein Reh von Busch zu Busch, denn sie hatte ihr Schuhwerk schon längst abgestreift und liegengelassen. Einer der Verfolger hatte bereits einen als Beute an sich genommen. Dornen blieben ihr in den Fersen stecken, sie schnitten ihr die Knöchel und Fußwurzeln blutig. Da hatte sie inmitten der hoffnungslosen Lage einen Gedankenblitz.
Jenseits des Wäldchens gab es am Bergrücken einen einzigen bestellten Olivenwald. Man nannte ihn »Moraítis-Pinie«, nach dem alten Moraítis, dem Großvater des Eigentümers, der Ende des vergangenen Jahrhunderts aus Mystrás hergekommen war und sich an diesem Ort niedergelassen hatte, zur Zeit der Zarin Katharina und Orloffs. Wie ein Riese unter Zwergen stand in der Mitte des Olivenwalds die weithin bekannte Pinie. Ganz unten am gewaltigen Stamm, den fünf Mann nicht umfassen konnten, war in den tausendjährigen Baum eine Mulde gehauen worden. Die hatten Hirten und Fischer in ihn gehackt, ihm das Herzstück herausgenommen, ihn bis ins Innerste ausgehöhlt, und dort versorgten sie sich reichlich mit Feuerholz. Trotz dieser schrecklichen Wunden in ihren Fibern und Eingeweiden überstand die Pinie ein weiteres Dreivierteljahrhundert, bis 1871. Im Juli jenes Jahres nahmen die Leute, die meilenweit entfernt drunten an der Küste wohnten, ein starkes örtliches Erdbeben wahr. In dieser Nacht brach der Riese zusammen.
Zu eben jener Höhlung, in der mühelos zwei Menschen Platz fanden, hastete die damals frisch vermählte Delcharó, die Mutter unserer Frangojannoú, um sich darin zu verstecken. Das Mittel bot keinerlei Aussicht auf Erfolg, ja es war beinahe kindisch, denn wie ein Kind beim Versteckspiel fand sie nur in ihrer Fantasie dort eine Zuflucht. Bestimmt würden die Verfolger sie bemerken und ihren Schlupfwinkel ausfindig machen. Nur wenn jene ihr den Rücken kehrten, blieb sie verborgen, nicht jedoch, wenn sie sich ihr zuwandten. Sobald die drei Kleften an der Pinie vorbeiliefen, wäre sie ihren Blicken schutzlos ausgeliefert.
Die drei Männer eilten heran, ließen die Pinie hinter sich und liefen weiter. Zwei von ihnen drehten sich nicht einmal auf einen einzigen Blick um. Sie glaubten wohl, das »Weibsstück« liefe voraus. Nur der dritte wandte sich im allerletzten Moment etwas verunsichert zurück und musterte weit und breit alles, nur den Pinienstamm nicht. Er nahm ihn wohl als eines unter zahlreichen Dingen wahr, ohne auf den Gedanken zu kommen, ihr Stamm habe einen Schoß, und in diesem Schoß verberge sich gar ein Mensch. Ganz einerlei, ob ihm nun bekannt war oder nicht, dass der riesige Stamm innen hohl war, in diesem Augenblick kam’s ihm jedenfalls nicht in den Sinn. Er schaute umher, um den Schlund zu entdecken, der die Frau verschluckt haben musste – denn man sah keine Erdspalte, wo jemand sich hätte verkriechen können. Vielleicht hatte sie mit ihren Zaubersprüchen die Dryaden, die Waldnymphen, herbeigerufen, die schützend die Hand über sie hielten und ihre Verfolger blendeten, indem sie grünlichen Dunst und moosige Finsternis in deren Augen streuten – so dass sie sie nicht bemerken konnten.
Die junge Frau rettete sich aus ihren Klauen. Auch weiterhin betrieb sie dann die Zauberei und richtete sie gegen die Kleften, denen sie eine Sauregurkenzeit nach der anderen bescherte. Und es kam soweit, dass nirgendwo mehr Diebesbeute zu machen war – bis dass Gott der Herr es gab und die Dinge in ein ruhigeres Fahrwasser gerieten und Sultan Mehmed, wie man erzählt, die »Teufelsinseln« Griechenland als Geschenk überließ. Seither waren sie nicht länger von Abgaben befreit. Statt zu plündern, trieb man jetzt Steuern ein, und von da an rührt und regt das auserwählte Volk seine Hände für den mächtigen Zentralmagen, der »Ohren hat und nicht hören kann«.
Hadoúla, die Frau von Frangos, war damals noch sehr klein, jedoch bereits auf der Welt, und entsann sich all dessen, wovon ihre Mutter später erzählte. Sodann, als sie heranwuchs und schließlich siebzehn Jahre zählte – damals, zur Regierungszeit des Statthalters, als es einigermaßen friedlich herging –, verheirateten ihre Eltern sie mit Jannis Frangos, einem Mann, dem sein Eheweib später die Beinamen »Mütze« und »Rechnung« gab.
Diese beiden Spottnamen hatte seine Frau nicht aus der Luft gegriffen. »Mütze« nannte sie ihn schon vor der Hochzeit, als sie ihn oft mit ihrer jungfräulichen Bosheit zum Besten hielt – ohne zu ahnen, dass dieser Mann einmal ihr Schicksal und ihr Gemahl sein würde –, denn er trug statt eines Fes eine Art Zipfelmütze von ziegelroter Farbe mit einer kurzen Quaste. »Rechnung« nannte sie ihn später, nachdem sie Hochzeit gehalten hatten, denn er machte häufig Gebrauch von der Wendung »So also sieht die Rechnung aus«, dabei konnte er nicht einmal auch nur den Betrag weniger Pará oder zweier Tagelöhne zusammenzählen. Ohne sie hätte man ihn tagtäglich hintergangen und ihm nie und nimmer seine mühselige Arbeit auf den Schiffen, am Dock und in der Werft gebührend entlohnt, wo er als Zimmermann und Kalfaterer beschäftigt war.
Lange Zeit war er Lehrling und Geselle bei ihrem Vater gewesen, welcher dasselbe Handwerk ausgeübt hatte. Als der Alte sah, wie einfältig, genügsam und bescheiden er war, gewann er eine hohe Meinung von ihm und beschloss, ihn zum Schwiegersohn zu machen. Als Mitgift trat er ihm ein abgelegenes, baufälliges Haus in der Nähe des alten Dorfes Kástro ab, das einstmals, vor dem Jahre 1821, bewohnt war. Er gab ihm auch ein Stück Land bei Bostáni, das genau außerhalb des nunmehr verödeten Dorfes an einer Steilküste lag und drei Stunden von der heutigen Ortschaft entfernt war. Desgleichen überließ er ihm einen winzigen Acker, ein braches Feld, auf das der Nachbar einen Anspruch geltend machte. Die anderen Nachbarn meinten, dass alle beiden Äcker, derentwegen sich die zwei in den Haaren lagen, widerrechtlich in Besitz genommen, eigentlich Eigentum der Mönche wären und zum Vermögen eines aufgehobenen Klosters gehörten. So eine Mitgift also gab der alte Statharós seiner Tochter, die auch noch seine einzige war. Für sich selbst, die Frau und seinen Sohn hatte er zwei unlängst errichtete Häuser in der neuen Stadt behalten, zwei nahe gelegene Weinberge, zwei Ölbaumwälder und einige Äcker – dazu seine gesamte Barschaft.
Soweit waren Frangojannoús Erinnerungen in jener Nacht gekommen. Es war die elfte nach der Niederkunft ihrer Tochter. Das kleine Mädchen litt fürchterlich an einem Rückfall. Krank war es auf die Welt gekommen, denn schon im Mutterbauch hatten die Lebensgeister es im Stich gelassen. In jenem Augenblick hörte man einen Hustenkrampf, der die Wachträume und Erinnerungen unterbrach. Da rührte sie sich vom armseligen Lager, beugte sich über das Kind und versuchte, so gut es ging, ihm Linderung zu verschaffen. Sie hob eine kleine Flasche nah ans Lampenlicht und bemühte sich, dem Säugling einen Löffel daraus einzuflößen. Das Kleine schmeckte das Elixier und spuckte es im nächsten Augenblick wieder aus.
Die Wöchnerin rührte sich auf der niedrigen und schmalen Liegestatt. Offenbar schlief sie nicht richtig, sondern hielt lediglich wie benommen ihre Lider geschlossen. Sie öffnete die Augen, hob den Kopf eine Handbreit vom Kissen und fragte:
»Wie geht’s ihr, Mutter?«
»Wie soll’s ihr schon gehen? …«, sagte streng die Alte. »Komm endlich zur Ruhe! … Wie mag’s schon stehen? … Meinst du etwa, dass es plötzlich nicht mehr hustet?«
»Was meinst du denn, Mutter?«
»Was soll ich schon meinen? … Ein kleines Wurm ist’s … Jetzt ist’s halt auf der Welt«, setzte die Alte barsch und befremdlich hinzu.
Nach kurzer Zeit sank die Wöchnerin beruhigt in Schlaf. Nur mit Mühe schloss die Alte ein wenig die Augen, zur Stunde der Frühmesse, nach dem dritten Krähen des Hahns. Sie erwachte von der Stimme ihrer Tochter Amérsa, die früh am Morgen vom kleinen, in der Nachbarschaft liegenden Haus herkam und voll banger Ungeduld erfahren wollte, wie es der Wöchnerin und dem Säugling erging und wie ihre Mutter die Nacht verbracht hatte.
Amérsa, die zweitgeborene Tochter, war unverheiratet und bereits eine alte Jungfer, jedoch tüchtig und arbeitsam, bekannt und auch geschätzt als Weberin. Ihr Gesicht hatte eine dunkle Haut, sie war groß und in ihrer Art wie ein Mann. Seit vielen Jahren befanden sich ihre Aussteuer und der gestickte Zierrat, den sie selbst angefertigt hatte, in der großen, plumpen Truhe, wo Motte und Holzwurm sich daran gütlich taten.
»Guten Morgen. Wie geht’s euch? Wie war die Nacht?«
»Du bist’s, Amérsa? Was soll ich dir schon sagen, diese Nacht ist auch vorbeigegangen.«
Gerade war die Alte aufgewacht und rieb sich schlaftrunken die Augen. Aus der kleinen Nebenkammer kam ein Geräusch. Es stammte von Dadís Trachílis, dem Mann der Wöchnerin. Seite an Seite mit einem weiteren Töchterchen und einem kleinen Knaben schlief er jenseits der dünnen Holzwand. Soeben war er aufgewacht, packte nun seine Geräte zusammen – Äxte, Sägen und Hobel – und machte sich bereit, in die Werft zu gehen und das Tagwerk zu beginnen.
»Hörst du, was für einen Heidenlärm er macht?«, sagte die Alte. »Kann er sein Zeug nicht leise zusammenpacken? Jeder, der ihn hört, meint wunder was da los ist.«
»Viel Geblök …«, sagte Amérsa mit spöttischem Lachen.
Das Geräusch der Geräte, die Dadís, ohne dass man ihn sah, hinter der Holzwand eins nach dem anderen in seinen Strohkorb warf – Äxte, Sägen und Hobel –, weckte auch die Wöchnerin, sein Eheweib, auf.
»Was gibt’s, Mutter?«
»Was soll’s schon geben? Konstandís schmeißt sein Zeug in den Korb!«, sagte die Alte seufzend.
»… und wenig Wolle«, ergänzte Amérsa das Sprichwort. Dann hörte man die Stimme von Konstandís hinter der kleinen Zwischenwand.
»Seid ihr wach, Schwiegermutter?«, sagte er. »Wie geht’s euch?«
»Wie soll’s uns schon gehen? Gebratene Tauben sind uns ins Maul geflogen. Komm und trink deinen Rakí.«
In der Tür der Winterkammer erschien Dadís. Er hatte eine breite Brust, war ungeschlacht, eine »vierschrötige« Gestalt, wie die Alte, seine Schwiegermutter, sagte, und besaß einen nur schütteren Bartwuchs. Die Alte zeigte Amérsa die kleine Flasche mit dem Rakí auf dem schmalen Bord oberhalb des Kamins und gab ihr einen Wink, ein kleines Glas damit zu füllen, damit Konstandís davon trinke.
»Gibt’s vielleicht eine Feige?«, fragte dieser, als er das Glas Rakí aus der Hand seiner Schwägerin entgegennahm.
»Wo soll so was schon herkommen?«, erwiderte die alte Hadoúla. »Das könnten wir wahrhaftig hier gebrauchen: ›Vierzig Weizenbrötchen‹«, setzte sie hinzu und spielte damit auf die verschwenderische Prasserei sogar in den ärmsten Hütten an, wenn ein »freudiges Ereignis« eingetreten war, wie etwa die Geburt einer Tochter.
»Du willst wohl den Himmel auf Erden?«, erinnerte sich seine Schwägerin Amérsa eines weiteren Sprichworts.
»Und du, willst du etwa in der Hölle braten?«, sagte Dadís gleichmütig. »Wohl bekomm’s! Auf dass meine Frau gesund aus dem Wochenbett steigt!«
Und er leerte das Gläschen in einem Zug.
»Dann bis heute Abend!«
Er lud sich den Strohkorb auf und ging zur Werft.
2
Das Feuer verglomm im Kamin, vor dessen Öffnung die Öllampe flackerte, die Wöchnerin döste auf der Liegestatt, in der Wiege hustete der Säugling, und wie in den vergangenen Nächten lag die alte Frangojannoú wach auf ihrem Lager.
Es war etwa zur Stunde, in der der Hahn zum ersten Mal kräht und die Erinnerungen sich in Gestalt gespenstischer Bilder einstellen. Nachdem man sie verheiratet, sie »unter die Haube gebracht« und ihr als Mitgift das baufällige Haus im alten, unbewohnten Kástro überlassen hatte, das unbestellte Land bei Bostáni im rauen, entlegenen Norden der Insel sowie das brachliegende Feld, um welches sich der Nachbar und das Kloster stritten, zog die Jungvermählte mit ihrem Mann bei der verwitweten Schwägerin ein und gründete dort mit dem Nötigsten einen Hausstand. Im Ehekontrakt war die Aussteuer dagegen in allen Einzelheiten festgehalten: Man habe ihr soundso viele Kleider mitgegeben, soundso viele Blusen und Kopfkissen, ebenfalls zwei Kupfertöpfe, eine Pfanne, einen Rost für den Kamin und vieles mehr. Sogar das Besteck führte der Kontrakt auf.
Gleich montags, am Tag nach der Hochzeit, schaute die Schwägerin alles prüfend durch und entdeckte, dass von den Sachen, die in der Liste verzeichnet waren, zwei Bettlaken, zwei Kissen, ein Kupfertopf und eine vollständige Tracht fehlten. Am gleichen Tag ließ sie der Schwiegermutter ausrichten, sie möge doch die fehlenden Sachen noch herschaffen. Die eigensüchtige Alte ließ antworten, dass sie »bereits das gegeben hat, was sich gehört, und das ist mehr als genug«. Daraufhin hetzte die Schwägerin bei ihrem Bruder; der beklagte sich bei seiner jungen Frau; diese wiederum gab ihm zur Antwort: Wenn er schon auf seinen Vorteil bedacht sei, dann hätte er das ihm als Mitgift angebotene Haus in Kástro sich erst gar nicht andrehen lassen dürfen, denn dort hausten sowieso nur Geister und Gespenster. Was würden ihm denn Laken und Blusen nützen, wenn er doch nicht einmal imstande sei, zu einem Haus, einem Weinberg oder einem Olivenwald zu kommen?
Tatsächlich hatte Hadoúla während der Verlobungszeit Versuche unternommen, ihrem Bräutigam dergleichen verstohlen anzudeuten. Wenn auch sehr jung an Jahren, war sie von Natur aus und dank der Lehren, die ihr die Mutter wohlbedacht oder absichtslos erteilt hatte, für ihr Alter recht schlau. Ihre Mutter aber witterte etwas und befürchtete, dass die kleine Hexe, wie sie ihre Tochter gewöhnlich nannte, dem Bräutigam womöglich einen Floh ins Ohr setzte, dieser sich dann nichts mehr vormachen lassen und schließlich Anstalten treffen würde, eine stattlichere Mitgift zu verlangen. Unnachsichtig überwachte sie Tochter und Bräutigam und duldete nicht einmal das geringste Zwiegespräch, unter dem Vorwand, das gehöre sich nicht.
»Das wär ja allerhand, wenn der mir einen Bankert zurechtschustert … mit dieser kleinen Hexe!«, hatte sie gesagt.
Den metaphorischen Ausdruck »zurechtschustern« entnahm sie dem Wortschatz des Handwerks. Im Grunde wollte sie sich nur ersparen, eine größere Mitgift aufbringen zu müssen.
Eines Abends, es war der letzte vor der Verlobung, waren der Bräutigam und seine Schwester zur Unterredung über die Mitgift ins Haus gekommen. Der alte Schiffszimmermann diktierte Anagnóstis Syvías, der in der Kirche Vorsänger war, den Wortlaut des Ehekontrakts. Syvías hatte sein Tintenfass aus Messing bereits aus dem Gürtel gezogen, desgleichen den Gänsekiel aus dem Köcher des Fasses, das damit wie eine Pistole aussah. Das Epistolarium lag bereits auf seinen Knien, auf dem Buch ein Stapel groben Papiers, und er hatte nach dem Diktat des Alten schon aufgeschrieben: »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes … gebe ich meine Tochter Hadoúla dem Jannis Frangos zur Frau und statte sie zuallererst mit meinen Segenswünschen aus!«
Hadoúla stand gegenüber dem Kamin, neben der »Templa« – einem säulenartigen Stapel aus Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen, abgedeckt von einem seidenen Laken und von zwei riesigen Kissen umkränzt –, und erschien nach außen hin so starr und erhaben wie jener Stapel. Doch sie gab dem Bräutigam verstohlen Zeichen; ungeduldig, aber überaus vorsichtig winkte sie erst ihm und dann auch seiner Schwester zu, weder das »Haus in Kástro« noch den »Acker in Stivotó« als Mitgift hinzunehmen, vielmehr ein Haus im neuen Ort zu verlangen sowie einen Weinberg und ein Ölbaumfeld im Umkreis der neuen Ortschaft.
Vergebens. Weder der Bräutigam noch seine Schwester nahmen ihre verzweifelten Zeichen wahr. Nur die Alte, ihre Mutter – obwohl sie der Tochter notgedrungen den Rücken kehrte, um dem Bräutigam und seiner Schwester liebenswürdig entgegenzutreten, hatte sie es dennoch fertiggebracht, so Platz zu nehmen, dass sie dem Mädchen den Rücken nur halb zuwandte –, drehte sich jählings um, als habe ein unsichtbarer Geist ihr etwas mitgeteilt, und bemerkte der Tochter verbotene »Sperenzchen«.
Auf der Stelle warf sie ihr einen Blick zu, in dem eine fürchterliche Drohung lag.
»He! Du kleine Hexe!«, flüsterte sie bei sich. »Überlass das nur mir! Mit dir werd ich schon noch fertig.«
Sogleich aber überlegte sie, dass sie nichts davon hätte, ihrer Tochter gegenüber irgendetwas zu erwähnen. Sie befürchtete nämlich, dass sie ihr damit einen Anlass liefern könnte, dem Vater etwas vorzujammern. Und dann käme alles bestimmt noch viel schlimmer. Vermutlich würde sich der Alte von den flehentlichen Bitten seiner einzigen Tochter erweichen lassen und mehr Mitgift herausrücken. Daher schwieg sie still.
Später, als sie unter sich waren, mutete es Hadoúla seltsam an, dass ihre Mutter, obgleich sie ihr tollkühnes Winken anscheinend bemerkt hatte, zum ersten Mal im Leben weder mit Fingernägeln auf sie losging noch schmerzhaft zwickte und biss, wie schon so oft. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es durchaus sinnvoll war, ein Haus im alten, unbewohnten Dorf als Mitgift abzutreten. Denn immer noch standen viele Häuser in Kástro, wo einige Familien auch den Sommer zubrachten. Auch waren die Leute für das »Alte Dorf« eingenommen, an dem das Herz ihrer Ältesten sehnlich hing, denn sie hatten sich weder an die neuen Verhältnisse gewöhnt noch an das friedliche Leben ohne Überfälle von Kleften, Piraten und türkischem Geschwader. Abgesehen davon waren sie der Ansicht, man habe sich in der neuen Ortschaft nicht unwiderruflich niedergelassen. Sie gaben sich vielmehr der Hoffnung hin, dass die Leute schon bald wieder aufs Hergebrachte und Altbewährte zurückgreifen würden. Und während sie sich Kástro ständig ins Gedächtnis riefen, sich über Kástro grämten, während ihre Gedanken träumerisch nach Kástro schweiften und sie tagaus, tagein Kástro im Munde führten, hielten sie trotzdem nicht inne, Gebäude in der neuen Siedlung zu errichten – und bewiesen damit zum zigtausendsten Mal, dass Menschen in der Regel das eine denken und das andere tun und einander überdies gedankenlos nachmachen.
Also wurde nach zwei Wochen Verlobungszeit geheiratet. So wollte es die Mutter der Braut. Es passte ihr nicht, wie sie sagte, dass der Bräutigam schon vor der Hochzeit im Haus ein und aus ging. Diese Freiheit hatte er sich bereits herausgenommen, da er ja Handwerksbursche und Lehrling bei ihrem Mann war. Die Schwester des Bräutigams, eine alte Witwe – sie hatte einen erwachsenen Sohn, der ebenfalls in der Werft arbeitete, sowie einen Kaben und ein Töchterchen, beide minderjährig – nahm das junge Paar in ihrem Haushalt auf. Nach einem Jahr kam Státhis zur Welt, das erste Kind, als zweites Delcharó, es folgte Jalís, darauf Michális, dann Amérsa, nach ihr Mitrákis und zu letzt Krinió. Während der ersten Jahre schien Eintracht im Haus zu herrschen. Als dann die beiden ältesten Kinder der jungen Frau größer wurden und die zwei jüngsten der Schwägerin herangewachsen waren, machten sich Zank und Zwist im Hause breit. Zu jener Zeit war es der mit den Jahren und der Erfahrung klug gewordenen Frangojannoú vergönnt – wie sie selbst bescheiden sagte –, dank ihres Geschicks und ihrer Sparsamkeit zu einem eigenen Heim zu kommen. Im ersten Jahr konnte sie lediglich vier kleine, niedrige Lehmwände errichten und ihnen ein Dach aufsetzen lassen. Im zweiten Jahr gelang es ihr, fast vollständig Dielen zu legen, das heißt, mit einer Vielzahl von ungleichen alten und neuen Bohlen einen kleinen Fußboden zu fertigen. Ohne Zeit zu verlieren, zog sie aus, denn sie konnte es nicht abwarten, sich von der Herrschsucht der Schwägerin zu befreien, die mit zunehmendem Alter auch immer verschrobener wurde, und ließ sich zusammen mit Mann und Kindern in ihrem »Eckchen«, ihrem »Nest«, in ihrem »Winkel« häuslich nieder. Es war an jenem Tag, dass sie, ihren eigenen Worten zufolge, die größte Freude in ihrem ganzen Leben empfand.
All dessen entsann sich Frangojannoú, und fast durchlebte sie’s erneut, in jenen langen, schlaflosen Januarnächten, als sie neben der Wiege ihrer kleinen Enkeltochter wach dalag und den Nordwind hörte, wie er draußen auf und ab pfiff, wie er die Ziegel klappern und die Fensterscheiben beben ließ. Es war bereits die dritte Stunde nach Mitternacht. Wieder krähte der Hahn. Das kleine Mädchen, das erst vor kurzem ruhig geworden war, begann aufs Neue gepeinigt zu husten. Kränklich war’s schon auf die Welt gekommen; dann hatte sich’s anscheinend auch noch am dritten Lebenstag, als man es zum ersten Mal in der Wanne badete, erkältet und dabei den schlimmen Husten geholt. Unablässig harrte Frangojannoú seit Tagen auf Anzeichen von Hustenkrämpfen bei dem kleinen, kranken Geschöpf, denn dann hätte sie mit Sicherheit gewusst, dass ihm nicht mehr zu helfen wäre. Zum Glück bemerkte sie nichts dergleichen. »Es ist da, damit’s gequält wird und uns quält«, hatte sie leise bei sich geflüstert, ohne dass man sie hören konnte.
In diesem Augenblick öffnete Frangojannoú ihre übernächtigten Augen und brachte die Wiege ins Schaukeln. Zugleich versuchte sie, dem kranken Säugling das übliche Elixier einzuflößen.
»Wer hustet da?«, war eine Stimme hinter der Zwischenwand zu vernehmen.
Die Alte gab keine Antwort. Es war Samstagabend. Der Schwiegersohn hatte vor dem Nachtmahl einen Rakí über den Durst getrunken und danach ein großes Glas klaren Wein, um sich von der Wochenarbeit zu erholen. Dadís hatte sich also einiges zu Gemüte geführt und sprach nun im Schlaf oder redete vielmehr ungereimtes Zeug daher.
Der Säugling behielt den Tropfen Elixier nicht in seinen Mund, sondern stieß ihn mit seiner kleinen Zunge von sich. Gleichzeitig brach ein Hustenanfall aus ihm hervor, stärker denn je und nun sehr schmerzhaft.
»Halt’s Maul«, sagte Konstandís, der Vater des Neugeborenen, aus seinem Schlaf heraus.
»Und mach es nie mehr auf«, setzte Frangojannoú ironisch hinzu.
Die Wöchnerin schreckte aus dem Schlaf; vielleicht hatte sie gehört, wie das Kleine hustete, und dabei den befremdlichen Wortwechsel vernommen, den der schlaftrunkene Vater und die Wachende durch die Holzwand miteinander führten.
»Was ist los, Mutter?«, fragte Delcharó und richtete sich auf. »Geht’s dem Kind nicht gut?«
Im flackernden Schein der kleinen Öllampe verzog die Alte unwirsch den Mund.
»Wenn ich das schon wieder höre, Tochter! …«
Bei diesem »Wenn ich das schon wieder höre« hatte ihre Stimme einen sehr befremdlichen Klang. Auch war es nicht das erste Mal, dass die junge Mutter dergleichen von ihrer eigenen Mutter zu hören bekam. Sie erinnerte sich, wie schon früher die Alte zuweilen, wenn zwischen den Frauen und Greisinnen der Nachbarschaft die Rede darauf kam, sich über die große Anzahl junger Mädchen ausließ und über den Mangel an Freiern, welche sich außerdem in fremden Ländern aufhielten oder übertriebene Ansprüche an die Mitgift stellten, und dann weiter über das Kreuz, das eine Christenfrau zu tragen hatte, um das »schwache Geschlecht«, die Mädchen also, unter Dach und Fach zu bringen; solche Äußerungen, mit denen Hadoúla schon früher ähnliche Gefühle bekundet hatte, waren ihr gut in Erinnerung. Kam ihrer Mutter dann auch noch zu Ohren, dass kleine Mädchen eine Krankheit hatten, hörte man sie kopfschüttelnd sagen:
»Wenn ich das schon wieder höre, Nachbarin! … Wo ist der Sensenmann, wo ist nur ein steiler Felsen?« Denn sie besaß die Gewohnheit, das, was sie sagen wollte, in einprägsame Wendungen zu kleiden. Ein andermal wieder hörte man sie unduldsam darauf pochen, dass es sich nicht lohne, vielen Töchtern das Leben zu schenken,