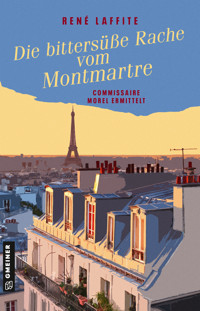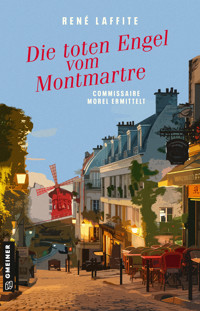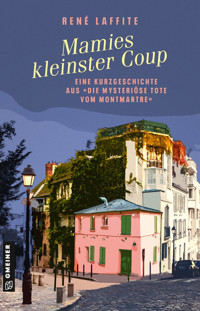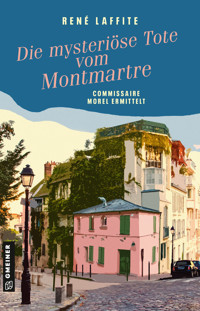
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissaire Morel
- Sprache: Deutsch
Während des beliebten Weinfests am Montmartre wird die Leiche einer jungen Frau gefunden - versenkt in einem Weinbottich. Die Identität der Toten ist zunächst ein großes Geheimnis. Die Ermittlungen führen Commissaire Geneviève Morel schließlich bis in die idyllische Champagne. In Paris wird derweil auch ihre Großmutter Mamie von einem neuen Verehrer umgarnt. Dass dieser ausgerechnet der Kurator einer aktuellen Picasso-Ausstellung ist, lässt bei Geneviève weitere Alarmglocken schrillen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Laffite
Die mysteriöse Tote vom Montmartre
Commissaire Morel ermittelt
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung einer Illustration Lutz Eberle nach einem Foto von KavalenkavaVolha / iStock.com
ISBN 978-3-7349-3280-9
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
DIE KÖNIGIN DER TASCHENDIEBE
Commissaire Geneviève Morel fühlte sich ein wenig wie im falschen Film. Es war die zweite Oktoberwoche – traditionell die Zeit des großen Weinfestes, der Fête des Vendanges, nur ein paar wenige Wölkchen hingen über Paris, der Duft frischer Crêpes und langsam vor sich hin grillender Hähnchen hing über dem Platz vor der Basilika Sacré-Coeur und sie war von ausschließlich gut gelaunten Menschen umgeben. Es war Letzteres, was ihr zu denken gab. Denn diese ausschließlich gut gelaunten Menschen waren ihre Familie. Und das war verdächtig. So gut aufgelegt waren ihre Verwandten normalerweise nur nach einem erfolgreichen Coup. Die Morels gehörten seit Generationen zu den erfolgreichsten und gerissensten Kunstdieben Europas. Geneviève war als Polizistin das schwarze Schaf. Oder das weiße Schaf – das kam ganz auf die Sichtweise an.
Am verdächtigsten verhielt sich jedoch Mamie, Genevièves Großmutter. Sie war nämlich nicht alleine, sondern ging eingehakt am Arm eines Manns, der wie sie um die 70 Jahre alt sein musste. Olivia Morel hatte ihnen den Mann vorgestellt, als sie sich am Fuß der aus Stufen bestehenden Rue Maurice Utrillo unterhalb der Basilika Sacré-Coeur mit dem Rest der Familie getroffen hatten. Geneviève hatte bereits ungeduldig im Freien gewartet, als Mamie mit dem Mann am Arm das Haus verlassen hatte. Hatte sie gar die Nacht mit ihm …? Geneviève hatte den Kopf geschüttelt, um die unweigerlich in ihrem Kopf auftauchenden Bilder zu verdrängen. Sie wusste, dass ihre Großmutter noch sexuell aktiv war, bislang hatte sie aber noch keinen ihrer Lover zu Gesicht bekommen. Dieser äußerlich durchaus distinguierte Mann war der erste. Die Sache war ihr mehr als suspekt. Mamie hatte immer wieder einen Amoureux gehabt, aber dass sie einen davon auch der Familie vorstellte? Das war neu.
Und verdächtig.
Der Mann, der ihnen als Roland Marron präsentiert worden war, war Kurator einer aktuellen Picasso-Ausstellung im Musée de Montmartre. Und spätestens da hatten bei Geneviève tatsächlich alle Alarmglocken zu schrillen begonnen. Da konnte doch nur ein geplanter Coup Mamies dahinterstecken. Olivia Morel hatte sich noch nie um die Abmachung zwischen Geneviève und dem Rest der Familie geschert, dass die Familie einen großen Bogen um die französische Hauptstadt machte, was Kunstdiebstähle anging. Ein brüchiger Frieden, der bislang jedoch gehalten hatte. Zwischen Großmutter und Enkelin hatte es hingegen lediglich ein stillschweigendes Übereinkommen gegeben, dass Mamie wenigstens nicht am Montmartre wildern und Geneviève damit in die unerträgliche Situation bringen würde, nach der eigenen Großmutter fahnden zu müssen.
»Tut-tut«, hatte sie sie ebenso geflissentlich beruhigt. »Ich umgebe mich gerne mit gebildeten Menschen. Mit Roland kann ich mich ganz hervorragend über Kunst unterhalten.«
»Und deshalb nimmst du ihn über Nacht mit zu dir nach Hause?«, hatte Geneviève gezischt, als sie ihre Großmutter zur Seite gezogen hatte, um ihr die Leviten zu lesen. Ein sinnloses Unterfangen, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.
»Das, chérie, überlass bitte mir«, hatte Mamie mit einem Naserümpfen geantwortet. »Ich rede dir in deine Beziehung mit diesem ganz wunderbaren Docteur ja auch nicht rein.«
Genau, als ob Mamie nicht bei jeder Gelegenheit anmerken würde, dass Henry Martel einen ganz hervorragenden Ehemann für sie abgäbe. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, ihr Henry schon so früh vorzustellen.
Der Kurator hatte danach nicht mehr von Olivia Morel abgelassen. Und die hatte sich das gefallen lassen. Wie ein brunftiger Teenager hing er an jedem Wort Mamies, vom Rest der Welt schien er nicht mehr viel wahrzunehmen.
Die einzigen beiden Familienmitglieder, die nicht mit auf dem Weinfest waren, waren Merlot, Genevièves roter Maine-Coon-Kater, und Aramis, Mamies Cocker Spaniel. Den beiden Tieren war der nochmals gesteigerte Trubel am Montmartre nicht zuzumuten. Merlot hatte aktuell sogar die täglichen Kontrollrunden durch sein Revier, das sich von Sacré-Coeur bis hinunter zum Moulin Rouge – also quasi über einen Großteil des südlichen Butte – erstreckte, eingestellt. Die Besuchermassen waren selbst dem Kater zu viel.
»Also wirklich!« Geneviève wurde von der amüsiert klingenden Stimme Mamies aus ihren Gedanken gerissen. Sie drehte sich um. Neben ihrer Großmutter stand ein junger Bursche, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt. Mamie hatte sein Handgelenk gepackt. Der Gesichtsausdruck des Jungen war schwer zu deuten. Verschreckt? Überrascht? Eingeschüchtert? Nein, es gab ein Wort, das all diese Emotionen zusammenfasste: ertappt!
»Ein Taschendieb? Hier am Montmartre? Wie ungewöhnlich«, säuselte Marron, ohne die andere Hand seiner Geliebten loszulassen. Geneviève hasste den Mann schon jetzt. Der herablassende Tonfall, der ebenso herablassende Blick auf den Jungen, der nicht wusste, wie ihm gerade geschah.
Mamie schüttelte die Hand Marrons ab und wandte sich dem Jungen zu, ohne dessen Handgelenk loszulassen. Erst jetzt fiel Geneviève auf, dass der Junge ein Handy fest umklammerte. Mamies Handy.
Olivia Morel, die wie Geneviève rund ein Meter 75 groß, schlank und von sportlicher Statur war, beugte sich ein Stück zu dem Taschendieb hinunter. »Wie heißt du?«, fragte sie ruhig, während sie ihm ihr Handy aus der Hand löste.
»P-P-Pascal …«, stotterte der Junge.
»Alors, Pascal«, flüsterte sie ihm zu. Geneviève konnte es nur hören, weil sie sich ebenfalls zu dem Jungen gebeugt hatte und sehen wollte, wie Mamie die Situation zu lösen gedachte. Es war gute 20 Jahre her, dass ihre Großmutter mit ihr über den Montmartre gestreift war und ihr die Kunst des Taschendiebstahls beigebracht hatte. Pascal hatte Pech gehabt, bei seinem Diebstahl ausgerechnet an die Königin des Taschendiebstahls – und jeglicher anderer Diebstähle – geraten zu sein. Wie hätte er das auch wissen können? Olivia Morel machte nach außen den Eindruck einer verwöhnten Dame der gehobenen Pariser Gesellschaft. Immer in einem sündteuren Designer-Kostüm, die silbergrauen Haare zu einem strengen Dutt hochgesteckt (der von einem teuren und personalisierten Bleistift in Position gehalten wurde) – kurz, ein perfektes Opfer.
»Oui, Madame?« Eine andere Antwort fiel dem Jungen nicht ein.
Olivia Morel sah sich um. Marron war zwei Meter entfernt, Letitia hatte sich geistesgegenwärtig des Liebhabers angenommen und ihn in ein Gespräch verwickelt, um ihn abzulenken. »Dein Versuch war nicht schlecht«, flüsterte Mamie dem Jungen zu, »aber an deiner Technik musst du noch arbeiten. Die Sache mit dem Anrempeln funktioniert ganz gut in Menschenmengen. Aber hier?« Sie breitete die Arme aus. Es war zwar einiges los, aber von sich durch die schmalen Gassen des Montmartre drängelnden Menschenmassen war man noch weit entfernt.
Der Blick des Jungen änderte sich. Von eingeschüchtert zu rebellisch. Aufmüpfig.
»Madame, geben Sie mir mein portable zurück, oder ich rufe die Polizei.«
Mamie seufzte theatralisch. Dann sagte sie: »Gené?«
Geneviève nickte und zog ihre Dienstmarke. Die Augen des Jungen wurden groß.
»Also, Pascal. Wie wollen wir die Sache regeln?«
Der Junge zuckte mit den Schultern. Immerhin probierte er es jetzt nicht mehr auf die freche Tour. Mamie zog eine Augenbraue in die Höhe.
»Ich – ich – ich entschuldige mich, Madame. Es wird nicht mehr vorkommen.«
»Und?«
Pascal sah Olivia Morel verständnislos an. »Und?«, wiederholte er ihre Worte.
Mamie seufzte wieder. Wieso machten es einige Menschen einem so schwer? Sie hatte doch nur sein Bestes im Sinn. »Und ich verspreche, dass ich mir in Zukunft mehr Mühe geben werde«, sprach sie ihm leise vor. Dem Jungen fielen die Augen beinahe aus dem Kopf.
Geneviève schüttelte entnervt den Kopf. Als Polizistin konnte sie da nicht mehr mit. Also ließ sie ihre Großmutter mit dem Jungen allein. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der Junge eifrig nickte und die Worte nachflüsterte. Zum Abschluss drückte Mamie ihm noch einen Hunderteuroschein in die Hand und schickte ihn seines Weges.
»Hättest ihm auch gleich deine Visitenkarte geben können«, pflaumte sie ihre Großmutter an.
»Führe mich nicht in Versuchung, immerhin ist er kein flic«, antwortete Mamie lapidar und hakte sich wieder bei Marron ein. Geneviève warf entnervt die Arme in die Höhe, ehe sie wieder von ihrer Schwägerin Letitia in Beschlag genommen wurde. Der Rest der Familie hatte von dem Vorfall nichts mitbekommen und war weiter Richtung Place du Tertre spaziert.
»Bewundernswert«, hörte Geneviève Marron flöten. »Wie du mit diesem verkommenen Jungen umgegangen bist. Ich könnte das nicht. Das Leben in dieser Stadt ist auch nicht mehr das, was es einmal war.«
»Ach, Roland«, antwortete sie mit einer Stimme voller Süßholzgeraspel, die Geneviève bei ihrer Großmutter noch nie gehört hatte. »Es haben eben nicht alle so gut wie wir.«
»Aber war es gleich nötig, ihm so viel Geld zuzustecken?«
Mamie lehnte ihren Kopf an Marrons Schulter. »Warum nicht? Damit muss der arme Junge die nächsten Tage nicht andere unaufmerksame Leute bestehlen. Wer weiß?« Dabei warf sie Geneviève über die Schulter einen stechenden Blick zu. »Vielleicht hat er beim nächsten Mal nicht so viel Glück und wird von einem Polizisten erwischt. Wäre doch schade um so ein junges, unschuldiges Leben.«
»Unschuldig?«, fragte Marron indigniert.
»Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein«, konterte Mamie energisch und sah Marron dabei tief in die Augen. Wie in Zeitlupe hob sich dabei ihre linke Augenbraue. Ein Merkmal, das Geneviève nur zu gut kannte. Sie setzte es selbst immer wieder ein. Bei Verhören. In Kombination mit ihren eisblauen Augen hatte es nicht nur einen Verdächtigen ins Schwitzen gebracht. Auch Marron wandte seinen Blick ab.
Wieder sah Mamie zu ihrer Enkelin hinüber. Diesmal mit einem fröhlichen Augenzwinkern. Oh ja, Olivia Morel war wirklich gut. Wahrscheinlich die Beste. Und Marrons eingebildete und arrogante Art hatte jedes Mitleid Genevièves mit ihm verschwinden lassen. Wenn Mamie ihn wirklich ausnehmen wollte, dann hatte er das verdient. Immerhin kam er dabei in den Genuss eines körperlichen Vergnügens, das ihm sonst wohl nur von bezahlten Professionellen zugestanden wurde. Wer sonst würde sich mit so einem eingebildeten Arsch abgeben? Normalerweise war Geneviève nicht so oberflächlich, aber Marron widerte sie einfach an. Dabei wusste sie ganz genau, dass diese abgehobene Art in der Kunstszene gang und gäbe war.
Entweder so oder völlig oberflächlich wie ihre Eltern. Wobei es im Fall ihrer Familie eine notwendige Fassade war, um das eigentliche Familiengeschäft zu schützen. Ein Zwiespalt, mit dem Geneviève zu leben gelernt hatte und mit dem sie tagtäglich durch ihre Großmutter konfrontiert wurde, die ja im selben Haus wie sie lebte und zu der sie eine – trotz aller Gegensätzlichkeiten – enge Beziehung pflegte. Enger als zu ihren Eltern. Die Sommer ihrer Kindheit und Jugend hatte sie immer in Paris bei ihr verbracht und war von ihr in die Kunst – und nicht anders wurde ihre Profession von Mamie genannt – des Diebstahls eingeführt worden. Am Montmartre, am Marché aux Puces de Saint-Ouen, dem weltgrößten Flohmarkt, gerade mal jenseits der Phériphérique, selbst in der Basilika Sacré-Coeur hatte sie unaufmerksamen Touristen mit zwölf, 13 Jahren die Geldbörsen aus den Taschen gezogen. All das hätte sie darauf vorbereiten sollen, einmal in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, der das Familiengeschäft wiederum von Mamie übernommen hatte. »Ars est nostra ars« – Kunst ist unsere Kunst. So lautete das Familienmotto, das auch im Familienwappen so verewigt war. Ganz offen vor und für aller Augen. Und doch hatte noch niemand den tieferen Sinn erkannt. Aus Sicht der Morels gehörte Kunst ihnen. Also war auch nichts Verwerfliches daran, sich diese Kunst anzueignen. Nach unzähligen Generationen war Geneviève die Erste gewesen, die das nicht so sah.
Normalerweise lebte Geneviève mit ihrer Großmutter allein in einem Haus am Fuß der über Paris thronenden, strahlend weißen Basilika. Alle paar Wochen fuhr sie auf Besuch zu ihrer Familie – Mutter, Vater, jüngerer Bruder, dessen Frau und deren Kinder – nach Cannes, wo die Familie Morel dem klischeebehafteten Jet-Set-Leben der Côte d’Azur frönte, während Geneviève als Commissaire des 18. Arrondissement über »ihren« Montmartre wachte. Was gar nicht so einfach war, wenn man bedachte, dass sie sich in ihrer Familie als Einzige redlich ihr Geld verdiente. Ja, die Familie Morel galt zwar als eine der einflussreichsten Kunstsammlerfamilien der Grande Nation, in Wirklichkeit wurde das große Geld jedoch mit dem Diebstahl von Kunst gemacht. Die Kunstsammlung war lediglich die schöne und legale Fassade. Als Geneviève fünf Jahre zuvor von Cannes nach Paris übersiedelt war, um hier die Leitung des Kommissariats des Montmartre zu übernehmen, war dies unter einer Bedingung geschehen: Sie schnüffelte nicht in den illegalen Tätigkeiten der Familie herum, dafür machte ihre Familie in Sachen Kunst-Coups einen großen Bogen um die französische Hauptstadt. Das war bislang gut gegangen.
Das gesammelte Auftreten ihrer Familie gab ihr jedoch zu denken. Heckten sie etwas aus? Gemeinsam mit Mamie, die sich mit dem sogenannten Ruhestand ohnehin nicht so richtig anfreunden konnte.
»Mach dir keine Sorgen, ma puce«, hatte ihr Vater sie beruhigt, als die Familie überraschend und ohne Vorankündigung am Vorabend bei ihr aufgeschlagen war. »Wir wollen uns nur das Weinfest anschauen. Außerdem war ich schon ewig nicht mehr in Paris.« Das stimmte sogar. Das letzte Mal war vor fünf Jahren gewesen. Als Geneviève die Dachgeschosswohnung im familieneigenen Haus bezogen hatte und es sich Papa nicht hatte nehmen lassen, ein wenig beim Um- und Einzug zu helfen. Er mochte Milliardär sein, aber die größte Freude hatte er noch immer, wenn er mit seinen eigenen beiden Händen etwas machen konnte.
Mamie war eingeweiht gewesen, aber sie hatte dichtgehalten. »Ich wollte dich überraschen«, hatte sie ihr später entschuldigend – aber ganz ohne schlechtes Gewissen – gestanden.
Also stand Geneviève jetzt mitsamt ihrer Familie inmitten von Touristen und genoss – mehr oder weniger – den Trubel des Weinfestes am Montmartre. Die Fête des Vendanges war eines der drei größten Festivals von Paris. Was schon einiges über die alljährlichen Besucherströme sagte. Dabei war der Freitag noch der angenehmste Tag, um das Fest zu besuchen. Da waren die Pariser selbst noch in der Arbeit, und das Fest gehörte mehr oder weniger ganz den Touristen. Ausnahmen wie die Familie Morel bestätigten die Regel nur.
Tatsächlich startete das Fest bereits immer am zweiten Mittwoch im Oktober, für die Öffentlichkeit zugänglich und mit all den Aussteller- und Kulinarikständen ging es aber erst am Freitag los. Bis zum Sonntag standen dann allerlei Aktivitäten und Events auf dem Programm: Von Führungen über eine Laufveranstaltung, Konzerten bis hin zum abschließenden Ball am Sonntag wurde dem Publikum jeden Tag beinahe rund um die Uhr einiges geboten. Fast schon zu viel, um es in einem Jahr zu erleben. Aber genau das war es, was Genevièves Vater vorhatte. »So oft komme ich nicht mehr hierher«, hatte er ihr erklärt, »da will ich mir nichts entgehen lassen.«
Einquartiert hatte man sich im Ritz, an der Place Vendome, nur unweit der Operá Garnier. Man musste dem lieben Gott schon für die kleinen Glücksmomente im Leben dankbar sein, hatte sich Geneviève gedacht. Sie liebte ihre Familie, egal wie viele Fehler sie auch hatte, aber sie für mehrere Tage ganz bei sich in der Nähe zu haben? Nein, danke. In erster Linie ging es dabei um ihren fünf Jahre jüngeren Bruder Frédéric, mit dem sie einfach nicht zurechtkam. Was auf Gegenseitigkeit beruhte und zugleich überhaupt nicht auf seine Frau, Letitia, zutraf. Ihre Schwägerin war für Geneviève über die Jahre wie zu der Schwester geworden, die sie nie gehabt hatte. Und Letitias Kinder, Jules und Danielle, zu den Kindern, die sie noch nicht hatte – und, wenn es nach ihr ging, auch nie haben würde. Was gleich zum nächsten Problem führte. Henry Martel, Médecin généraliste und seit einigen Monaten ihr on/off-Freund, sah das ganz anders. Nicht, dass er sie zu Kindern gedrängt hätte – so dumm war er nun auch nicht –, aber sein Wunsch nach Nachwuchs war in längeren Diskussionen kaum zu überhören. In diesen Momenten stellte Geneviève auf taub und wechselte das Thema. Oder legte die Beziehung für ein paar Tage auf Eis.
Aktuell stand ihre Beziehung jedoch auf »on« und so war auch Henry in den Genuss gekommen, die gesamte Familie erstmals zu treffen. Bislang hatte er nur das Vergnügen gehabt, Mamie und Letitia kennenzulernen. Den Rest der Familie kannte er allerdings bereits aus den Gesellschaftsspalten der Klatschmagazine, die im Wartezimmer seiner Ordination auslagen und die er nach Ordinationsschluss gierig verschlang, wenn sonst keine Termine anstanden. Guilty pleasure und so. Umso vertiefter war er jetzt in das Gespräch mit Genevièves Vater. So oft kam es nicht vor, dass man echte Prominente treffen konnte. Oder sich sogar die Hoffnung machen durfte, in deren Familie einzuheiraten. Noch so ein Thema, das bei Geneviève Eiseskälte auslöste. Aufgrund ihres atemberaubenden Äußeren hatte es an Heiratskandidaten noch nie gemangelt. Zugleich war das aber auch das Problem gewesen: Sie wusste nie, ob Männer sie nur wegen ihres Äußeren oder gar wegen ihres Familienvermögens anbaggerten. Bei Henry konnte sie Letzteres ausschließen. Ihre Schutzmauern einzureißen hatte aber auch der Doktor bislang nicht vermocht.
Letitia hatte sich bei ihrer Schwägerin eingehakt und Frédéric die Beaufsichtigung des Nachwuchses überlassen. Keine einfache Aufgabe, einen Zehnjährigen und eine Achtjährige in dem Gewusel des Fests im Auge zu behalten. »Recht geschieht ihm«, flüsterte Letitia Geneviève schmunzelnd ins Ohr. »Daheim überlässt er die ganze Arbeit ohnehin mir.« Geneviève hörte nur halb hin. Ihre Aufmerksamkeit war nach wie vor auf Mamie gerichtet. Was führte sie nur im Schilde? Sie sollte dem kleinen Museum in der Rue Cortot, nur unweit der Place du Tertre, mal wieder einen Besuch abstatten, um zu sehen, worauf es Mamie abgesehen haben könnte. Im Großen und Ganzen war sie mit dem Museum und dessen Geschichte bestens vertraut. Eine umfassende kunstgeschichtliche Ausbildung hatte ihr die Großmutter während ihrer zahlreichen »Ausbildungslehrgänge« ganz nebenbei angedeihen lassen. Im 19. Jahrhundert war das Gebäude von Künstlern bewohnt und als Atelier benutzt worden. 1876 schuf Auguste Renoir hier sein Gemälde Bal du Moulin de la Galette. Geneviève lief noch immer die Gänsehaut über den Rücken, wenn sie an die Mühle dachte, deren festliches Innenleben von Renoir in seinem berühmten Gemälde verewigt worden war. Gerade mal zwei Monate zuvor war eine Tänzerin des Moulin Rouge halb nackt auf einem der Mühlenflügel gekreuzigt worden. Der Fall und seine Auswirkungen hatten Geneviève auch Wochen nach seiner Lösung nicht in Ruhe gelassen. Erst langsam hatte sie die Erinnerungen an die verstümmelte Leiche aus ihrem Kopf bekommen.
»Was ist los?«, fragte Letitia besorgt, als sie merkte, dass sich Geneviève unwillkürlich abgebeutelt hatte.
»Nichts, nichts«, wiegelte Geneviève ab und schenkte ihrer Schwägerin ein strahlendes, aber aufgesetztes Lächeln.
»Entzugserscheinungen, weil du dich gerade um keinen Mordfall kümmern musst?«, scherzte Letitia.
»Wahrscheinlich«, lächelte Geneviève müde zurück. Sie wollte sich jetzt auf keine Diskussionen einlassen. Der Tag war viel zu schön, um sich mit trüben Gedanken herumzuschlagen. Selbst wenn der nervige kleine Bruder nur ein paar Meter vor ihr durch ihr Arrondissement trabte und genervt versuchte, seinen Nachwuchs unter Kontrolle zu halten, wo doch alle paar Meter eine andere lukullische Verführung wartete: Zuckerwatte, Crêpes, Schokofrüchte … Oder kurz gesagt: alles, was der liebe Gott für Kinder erschaffen und strenge Eltern ebenjenen wieder verboten hatten.
Zum Glück gab es da ja noch Tanten.
Geneviève löste sich von Letitia, schnappte Jules und Danielle an der Hand und ließ sich von den beiden – unter lautstarkem Protest ihres Bruders – zum gewünschten Stand führen. Dort entschied sich der Junge für eine Nutella-Crêpe mit Kokosflocken. Das Mädchen wählte einen Holzspieß mit Schoko-Erdbeeren. Eine Wahl, der auch Geneviève selbst folgte. Es war verdammt lange her, dass sie sich diese kleine Sünde gegönnt hatte. Andererseits trieb sie sich auch selten auf Volksfesten oder Jahrmärkten herum, und woanders gab es diese Leckereien selten bis nie. Vielleicht, so überlegte sie nach der ersten schokolierten Erdbeere, sollte sie das öfter tun.
Ihrem verdutzten Bruder drückte sie eine Portion barbe à papa in die Hand. Zuckerwatte war die schnellste Möglichkeit, ihn zum Schweigen zu bringen, bevor er sich darüber auslassen konnte, dass sie die Früchte seiner Lenden über Gebühr mit ungesunden Süßigkeiten verwöhnte.
»Und jetzt husch«, feuerte sie die beiden Kinder an. »Ich sehe den Rest der Familie gar nicht mehr.« Die Aktion hatte einige Minuten in Anspruch genommen, weil Jules’ Crêpe selbstverständlich frisch gemacht worden war. Geneviève hatte gebannt zugesehen, wie die Verkäuferin den flüssigen Teig hauchdünn auf die heiße Crêpe-Platte gegossen und mit einem Holzspachtel kreisförmig verteilt hatte. Der Duft, der ihr dabei in die Nase stieg, war beinahe unwiderstehlich. Beinahe, weil sie da schon ihre schokolierten Erdbeeren in der Hand beziehungsweise eine bereits im Mund hatte.
Das fertige Produkt war schließlich so heiß gewesen, dass Jules drei Servietten benötigt hatte, um die gefaltete Crêpe ohne schwere Verbrennungen in der Hand halten zu können. Das konnte den Jungen nicht davon abhalten, sofort in die Crêpe zu beißen und sich gleich einmal gewaltig den Mund zu verbrennen. Geneviève musste sich ein Grinsen verkneifen, als sie sah, wie Jules die Tränen in die Augen stiegen, er den Schmerz aber heldenhaft hinunterschluckte.
(K)EINE SCHÖNE LEICHE
Ein paar Minuten später hatten sie den Rest der Familie eingeholt. Papa bestand darauf, dass die Familie bei La Mère Catherine auf der Place du Tertre zu Mittag aß – er hatte dort bereits vorab einen Tisch reserviert. Es war das älteste Restaurant am Platz und damit zugleich auch das geschichtsträchtigste. Keine Kleinigkeit auf einem Hügel, auf dem praktisch jedes Haus seine eigene faszinierende Geschichte zu erzählen hatte.
La Mère Catherine erlangte Berühmtheit, weil – wie eine kleine Tafel am Eingang verriet – hier angeblich das Wort »Bistro« erfunden worden war. Am 30. März 1814 soll eine Gruppe russischer Soldaten die Bedienung mit den Worten »bystro, bystro« zu mehr Geschwindigkeit aufgefordert haben. Daraus hatte sich laut der Überlieferung das Wort »Bistro« und die Bezeichnung für ein Lokal gebildet, das raschen Gaumengenuss für zwischendurch bietet.
Heute wurde Catherine in erster Linie von Touristen frequentiert, die, ohne mit der Wimper zu zucken, die überteuerten Preise bezahlten, die hier verlangt wurden. Die Speisekarte las sich wie aus dem Klischee-Handbuch für Parisbesucher: Weinbergschnecken, Austern, Entenconfit, Zwiebelsuppe und so weiter. Als Zugeständnis für weniger entdeckungsfreudige und, was den Gaumengenuss anging, risikoaffine Touristen stand inzwischen jedoch unter anderem auch ein Burger auf der Karte. Wieso es ihren Vater gerade hierher zog, wollte sich Geneviève nicht erschließen. Die Familie besaß unter anderem auch einen luxuriösen Privat-Strandclub in Cannes, in dem tatsächlich allerfeinstes Essen gekocht und aufgetischt wurde. Ihr Vater kannte sich also mit Kulinarik durchaus aus. Trotzdem saß er jetzt freudestrahlend wie ein kleines Kind an einem der Tische mit rot-weiß karierten Tischdecken, seine Familie um sich geschart und die Karte einmal rauf und runter bestellend. Ein klein wenig wie ein Mafiapate, der sich ebenfalls im Kreis seiner Familie am wohlsten fühlte. Und ganz so weit hergeholt war der Vergleich auch nicht. Nur dass die Familie Morel mit Gewalt nichts am Hut hatte. Man sah sich als Gentlemen-Ganoven. Brutale Gewalt überließ man dem kriminellen Pöbel. Wie Geneviève wusste, gab es auch in der Unterwelt soziale Unterscheidungen.
»Was steht als Nächstes an?«, wandte sich Papa während der entrées an Letitia. Die Schwiegertochter war mit der Organisation des Besuchs betraut worden und war am besten mit dem Programm vertraut.
Letitia tupfte sich die Lippen mit einer Stoffserviette ab und konsultierte ihr Handy. »Um 13.30 Uhr steht eine Führung durch den Weingarten an. Höhepunkt laut Programm ist das Traubenstampfen.«
»Fein, fein!« Michel Morel rieb sich die Hände. »Richtig schön traditionell.« Papa wollte also das volle Touristenprogramm. Geneviève hatte zwar keine Ahnung, warum, aber wenn er es so wollte, konnte er es haben. Was Tourismus und Klischees anging, war Montmartre geradezu prädestiniert, um Gästen den Charme von Paris näherzubringen.
Kurz nach 13 Uhr hatte die Morel-Sippe ihr Mittagessen beendet. Geneviève hatte sich zurückgehalten, sie wollte am Abend noch bei La course nocturne, dem Nachtlauf im Rahmen des Weinfests, mitmachen. Ein voller Magen war da nur hinderlich. Was Geneviève beim Essen eingespart hatte, hatten die Kinder ihres Bruders wieder wettgemacht. Der zehnjährige Jules war mitten in einem Wachstumsschub und baggerte in sich hinein, was ihm vorgesetzt wurde. Auch die um zwei Jahre jüngere Danielle hatte keine Scheu vor den lokalen Spezialitäten und ekelte sich nicht einmal vor den Weinbergschnecken, die als Vorspeise serviert worden waren. Geneviève hatte darauf verzichtet.
Der Vigne du Clos Montmartre war nur wenige Gehminuten von der Place du Tertre entfernt. Trotzdem passierte man auf dem Weg dorthin, von der Place kommend, einige der bekannten Sehenswürdigkeiten des Butte. Für Kunstliebhaber war in dieser Hinsicht La Maison Rose von besonderem Interesse. Das komplett rosa gestrichene kleine Haus an der Ecke der Rue des Saules und der Rue de l’Abreuvoir »war 1905 von Laure Germaine und ihrem Mann, Ramon Pichot i Gironès, gekauft worden«, wie Mamie ausführte. In erster Linie für die beiden jüngsten Familienmitglieder, der Rest der Morels hatte diesen geschichtlichen Exkurs schon vor Jahren oder Jahrzehnten vorgetragen bekommen.
Jules und Danielle sahen ihre Urgroßmutter mit großen verständnislosen Augen an. Sie befanden sich erst am Beginn ihrer Ausbildung und hatten ganz andere Sachen im Sinn, als sich mit Kunstgeschichte auseinanderzusetzen. Selbstverständlich lebten die beiden auch noch in gesegneter Ignoranz, was die kriminellen Aktivitäten der Familie anging.
Geduldig erklärte Mamie weiter: »Laure war eine der Musen von Picasso. Ihr wisst schon, wer Picasso ist?«
»Natürlich!«, erklärte Jules stolz. »Maman hat uns alle wichtigen Maler erklärt. Der Mann hat lustige Bilder gemacht.«
»Aber was ist eine Muse?«, mischte sich Danielle mit unschuldigem Blick ein. Mamie lief rot an, Geneviève kicherte hinter vorgehaltener Hand.
»Eine Muse … Laure war … Picasso wurde durch ihre Schönheit inspiriert«, wand sich Mamie schließlich aus der Sache und wechselte kurzerhand das Thema. »Ihr Mann Ramon hingegen war ein Mentor des jungen Salvador Dalí. Sie waren beide Spanier, und Ramon erkannte Dalís Talent, als der gerade mal zehn Jahre alt war. Also so alt wie du jetzt gerade bist, Jules.«
»Ließ sich Ramon auch von seiner Schönheit inspirieren?«, hakte Danielle unschuldig nach.
»Ja, genau – wie war das eigentlich?«, ließ Geneviève lachend eine Spitze folgen. Es passierte selten genug, dass Olivia Morel einmal keine Antwort wusste. Das musste man ausnutzen. Ihre Großmutter antwortete allerdings nur mit einer streng hochgezogenen Augenbraue.
»Vite, vite«, unterbrach Letitia die peinliche Diskussion. »Die Führung durch den Weingarten beginnt in Kürze.« Sie trieb die Sippschaft die wenigen Meter weiter. Rasch wurde die Rue des Saules überquert, und nach 20 Metern stand man schon vor dem kleinen Weingarten mitten im Herzen von Paris. Gut ein Dutzend andere Besucher warteten bereits vor dem schmiedeeisernen Tor, über dem ein Schild mit der Aufschrift »Vigne du Clos Montmartre« prangte. Aufgrund des großen Andrangs benötigte man für die Führung durch den Weingarten eine Voranmeldung. Im Halbstundentakt wurden die neugierigen Besucher dann durch den Weingarten getrieben. Geneviève versuchte, die Gegend mit den Augen einer Touristin zu betrachten. Da dies ihrArrondissement war, war das gar nicht so einfach. Sie kannte jede Gasse, jeden Platz seit ihrer Kindheit und nahm vieles für gegeben an. So auch den Clos Montmartre. Ein Frevel, denn wenn man sich in aller Ruhe umsah, offenbarte sich erst die gesamte Schönheit und Einzigartigkeit dieses Stückchens Natur mitten in der Stadt. Eingebettet zwischen alte Häuserzeilen und umrahmt von Kopfsteinpflasterstraßen wirkte der kleine Weinberg wie eine Oase der Ruhe mitten in der hektischen Großstadt. Sie stellte sich den Ausblick aus den angrenzenden Wohnhäusern vor – Henrys Wohnung war nur unweit entfernt, hatte aber keinen Blick auf den Weingarten – und schloss die Augen. In ihrem Kopf flog sie vom obersten Stock eines der benachbarten Häuser mit dem Blick über die herbstlich bunt leuchtenden Weinreben den abfallenden Hang hinunter. Gleich an der nächsten Straßenecke war das Lapin Agile, ein altes Kabarett und eine weitere viel besuchte Touristenattraktion. Dahinter fiel der Butte immer weiter ab, und im mittäglichen Dunst erstreckte sich unten im Becken die Millionenmetropole Paris. Von hier oben scheinbar unendlich weit entfernt. All der Stress, die Hektik – nichts von alldem war hier auf ihrem geliebten Montmartre zu spüren.
Letitia stieß ihr einen Ellbogen in die Seite. »Es geht los!«, zischte sie.
Das schmiedeeiserne Tor wurde mit einem leisen Quietschen von innen geöffnet. Eine leger gekleidete Frau undefinierbaren Alters – sie mochte so alt wie Maman sein, konnte aber auch so alt wie Mamie sein – empfing die Besuchergruppe. Beim Eintreten fiel Geneviève auf, dass der Torknauf die Form einer Weinflasche hatte. Ein Detail, das ihr bislang entgangen war. Ja, sie sollte wirklich mit offeneren Augen durch ihren eigenen Bezirk gehen. Wie viele andere Kleinigkeiten gab es hier noch zu entdecken?
»Bienvenue, Mesdames et Messieurs«, begrüßte die Frau die Gruppe mit einem freundlichen Lächeln in ihrem runden Gesicht. »Entrez, s’il vous plait.«
Die Besucher strömten durch das Tor. Sofort stand man zwischen den ersten Weinreben. »Mein Name ist Alice Foucher, und ich darf Sie heute durch unseren kleinen, aber feinen Weingarten führen.« Foucher sah sich um und dabei in einige fragende Blicke. »Jemand hier, der kein Französisch versteht?«, fragte sie auf Englisch. Sofort schoss ein halbes Dutzend Hände in die Höhe.
»Darf ich fragen, woher Sie kommen?«, erkundigte sich Foucher weiter.
»Aus Österreich«, antwortete eine Frau ebenfalls auf Englisch. Geneviève schätzte sie etwa auf ihr eigenes Alter, also Anfang, Mitte 30. Die Frau hatte gelocktes kastanienrotes Haar, grüne Augen und war deutlich kleiner als sie. Eng an sie geschmiegt stand eine etwas größere, bildhübsche Blondine. Sie hatte ihren Arm besitzergreifend um die Rothaarige gelegt.
»Sie müssen meine Schwester entschuldigen«, mischte sich nun eine jüngere Frau ein. Sie war blond wie die Freundin der Rothaarigen, und noch keine 20. »Ich beherrsche sehr wohl Ihre Sprache«, erklärte die Kleine vorlaut in fließendem Französisch.
»Kein Problem«, erklärte Foucher. »Ich werde die wichtigsten Sachen auf Französisch und Englisch erklären. Deutsch kann ich leider nicht«, fügte sie entschuldigend hinzu. »Sind Sie hier auf Urlaub?«
Wieder war die Kleine schneller als ihre Schwester. Vielleicht wollte die Rothaarige aber auch gar nichts sagen. Jedenfalls warf sie ihr einen bitterbösen, stechenden Blick zu. Geneviève verfolgte das Ganze höchst amüsiert. Sie kannte die kleinen Sticheleien innerhalb einer Familie nur zu gut. Es war schön, das mal als Außenstehende genießen zu können.
»Zum Teil«, antwortete die jüngere Blondine. »Wir sind selbst Winzer und sind mit unseren Weinen bei Ihrem großartigen Fest vertreten. Wie wunderschön Sie es hier haben. Einzigartig, muss ich sagen. Es ist uns eine große Ehre, das wir hier dabei sein dürfen.« Ein bisschen viel Geschleime, fand Geneviève, sagte aber nichts. So wie sich die Grüppchen rund um Foucher geschart hatten, schätzte Geneviève, dass zu der Gruppe der drei Österreicherinnen noch zwei Männer gehörten. Ein großer, muskulöser Mann, ebenfalls um die 30, dem sie auf den ersten Blick ansah, dass er ebenfalls Polizist sein musste. Es gab kein eindeutiges Merkmal, an dem sie ihre Vermutung festmachen konnte, aber alles an ihm schrie »Polizist«. Und kein gewöhnlicher. Nein, er musste eine leitende Funktion innehaben. Wie selbstverständlich strich sein Blick ständig umher, um die Lage abzuklären. Als die Kleine ihrer großen Schwester gegenüber vorlaut wurde, hatte er sich sofort zwischen die beiden geschoben. Wohl um einen größeren Konflikt zu verhindern. In welchem Verhältnis stand er zu den Frauen? Der Freund konnte er nicht sein. Für die Kleine war er zu alt, und die beiden älteren Frauen waren ganz offensichtlich ein Liebespaar. War er der Bruder? Ein Cousin? Eine gewisse Ähnlichkeit mit der Rothaarigen war nicht zu leugnen. Das fünfte und letzte Mitglied der Gruppe war ein Junge, der in etwa so alt wie die junge Blondine sein musste. Er war schlank, hochgewachsen, hatte schwarze Haare und einen wachen, aber zugleich wehmütigen Blick. Geneviève hatte das Gefühl, dass der Junge schon mehr erlebt hatte, als sein junges Alter vermuten ließ.
»Das ist ja ganz wunderbar«, freute sich Foucher über die Auskunft der jungen Blondine. »Ich bin schon gespannt, wie Ihnen die Führung gefällt. Sie müssen mir danach unbedingt erzählen, wie sich unsere Methoden von den Ihren unterscheiden.« Die Frau war ein Vollprofi. Mit einem einzigen – freundlichen – Satz hatte sie die kleine Vorlaute bis zum Ende der Führung ruhiggestellt, ihr zugleich aber das Gefühl gegeben, dass sie eine Insiderin war. Eine, mit der man sich später austauschen und fachsimpeln konnte.
Wenn man das denn wollte …
So schnell wollte sich die kleine Blondine aber nicht ruhigstellen lassen. Sie öffnete den Mund, wurde aber von ihrem großen Begleiter zur Seite gezogen und nach hinten geschoben. Die leisen Proteste vernahm Geneviève nur mehr am Rande. Sie konzentrierte sich lieber auf das, was ihre Führerin zu sagen hatte.
»Hier am Butte wird bereits seit der gallo-römischen Zeit Wein angebaut. Wir befinden uns also auf durchaus traditionellem Weinbaugebiet, auch wenn das heute nicht mehr so aussieht«, begann Foucher ihre Ausführungen. »Neben dem Montmartre gab es auch noch einige andere Weinberge. Die Hochblüte erlebte der Weinanbau in dieser Gegend im 18. Jahrhundert. 1860 wurde das Dorf eingemeindet, und damit begann auch der langsame Abgesang auf den Weinbau im gesamten Stadtgebiet.«
»Wieso gibt es den Weinberg dann heute noch?«, meldete sich die vorlaute Österreicherin aus der letzten Reihe.
»Das ist der Initiative einiger besorgter Bürger zu verdanken«, erklärte Foucher. »Vor 1933 war dieser wunderschöne Hang als Müllhalde verwendet worden. Diese sollte verschwinden und verbaut werden. Die Bürgerinitiative – so etwas hat es auch damals schon gegeben – wollte das verhindern. Dazu nutzte man ein altes, obskures Gesetz. Nämlich, dass es verboten ist, auf einem Weinberg ein Haus zu bauen. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung wurde daraufhin hier ein kleiner Weinberg angelegt, und so dürfen wir uns heute über dieses Kleinod mitten im hektischen Paris freuen.«
Foucher führte die Gruppe weiter den Hang hinauf, vorbei an abgeernteten Weinstöcken, deren Laub in bunten herbstlichen Farben leuchtete. »Der Name dieser Bürgerinitiative lautet Republique de Montmartre. Sie war ursprünglich ein Zusammenschluss besorgter Künstler und Bürger des Montmartre, die das kulturelle und historische Erbe des Hügels erhalten wollten. Gegründet wurde diese Gruppe bereits 1921 und ist bis heute karitativ tätig. Sie veranstaltet unter anderem eine Buch- und eine Kunstbiennale, besonders am Herzen liegen den Mitgliedern aber arme Kinder, denen finanziell unter die Arme gegriffen wird und für die es spezielle Veranstaltungen gibt. Der Erlös des Weins dieses Weinbergs geht ebenfalls direkt an karitative Zwecke.«
»Wie viele Flaschen werden alljährlich abgefüllt?« Wieder die kleine Österreicherin. Aber es war eine gute Frage, deren Antwort Geneviève ebenfalls interessierte.
»Nun, wir haben hier circa 2.000 Weinstöcke, das Gelände umfasst nicht einmal ein Viertel Hektar. In den letzten Jahren betrug die Ernte jeweils um die zwei Tonnen, aus denen am Ende rund 2.000 Flaschen Wein gekeltert und für den guten Zweck versteigert werden. Ein paar Flaschen werden aufgehoben und für Verkostungen oder andere spezielle Anlässe aufgehoben.«
»Wie heute zum Beispiel?« Diesmal war es Letitia, die die Frage stellte.
»Wie heute zum Beispiel«, bestätigte Foucher lächelnd. »Wenn Sie mir folgen wollen.« Während sie die Gruppe ins Herz des kleinen Weinbergs führte, erklärte Foucher, dass hier nicht nur Wein wuchs, sondern auch Erdbeeren, Oliven und sogar Kiwis.
Kurz darauf standen sie vor einer dicht bewachsenen Laube, unter deren schützenden Ästen ein Holztisch mit gut zwei Dutzend – noch leeren – Weingläsern auf die Gäste wartete. In der Mitte des runden Tisches standen zwei geöffnete Flaschen Rosé.
»Wir bauen hier in erster Linie die Sorten Gamay und Pinot Noir an, dazu kommen jedoch noch etliche andere Sorten. Insgesamt sind es 27 verschiedene Rebsorten. Produziert werden Rot- und Roséweine. Letzteren darf ich Ihnen heute zur Verkostung anbieten.« Foucher nahm eine der beiden Flaschen und begann, die bereitgestellten Gläser zu füllen.
»Was passiert dort?«, meldete sich wieder die kleine Österreicherin zu Wort. Ohne zu fragen, schnappte sie sich eines der bereits gefüllten Gläser und marschierte schnurstracks auf einen großen Holzbottich zu, der einen Durchmesser von gut drei Metern hatte und mit einer Plastikplane abgedeckt war. Geneviève bezweifelte, dass die Kleine bereits das legale Alter zum Trinken von Alkohol erreicht hatte. Aber sie war heute in keiner offiziellen Funktion auf dem Weinfest, und einer Jugendlichen das Weinglas aus der Hand zu nehmen, gehörte ohnehin nicht zu den Aufgaben der leitenden Kommissarin des 18. Arrondissements.
»In diesem Bottich werden heute zu Anschauungszwecken Trauben gestampft.«
»Mit den Füßen?«
»Ja, es geht um eine Show – Sie verstehen?« Foucher zwinkerte der jungen Österreicherin verschwörerisch zu. Natürlich stampfte heutzutage kaum jemand mehr Trauben mit den Füßen. »Eigentlich war das als Höhepunkt der Führung geplant, aber jetzt haben Sie die Überraschung rui… vorweggenommen«, verbesserte sich Foucher im letzten Moment. Geneviève stellte eine gewisse passiv-aggressive Stimmung bei der Weinbergführerin fest. Sie konnte es gut nachvollziehen. Die kleine Österreicherin nervte gewaltig. Mit dieser Feststellung war sie nicht allein, wie ihr ein Blick auf die ältere Schwester zeigte, die die Augen verdreht hatte.
»Ist das nicht höchst unhygienisch?«, mischte sich nun Marron ein. Er hatte die ganze Zeit über die Hand Mamies nicht losgelassen.
»Au contraire, Monsieur!« Foucher fuhr sich mit der Hand entsetzt an die Brust. »Diese Technik wird bereits seit Jahrtausenden angewandt, und bislang ist noch niemand an durch Fußpilz vergiftetem Wein gestorben.« Das rief eine Runde Gelächter hervor. Marron lief hochrot an. »Es gibt Studien, die besagen, dass der menschliche Fuß wie geschaffen für das Stampfen der Trauben ist«, erklärte Foucher weiter.
»Inwiefern?«, fragte ein anderer Gast, der bislang nicht in Erscheinung getreten war.
»Nun, der Druck und die Beschaffenheit des menschlichen Fußballens sind prädestiniert dafür, das Maximum an Geschmack aus den Trauben herauszuholen. Dabei bleiben die Kerne unverletzt und können keine Bitterstoffe freisetzen.«
»Das mit der Hygiene würde mich jetzt dennoch interessieren«, blieb Marron hartnäckig.
»Richtig, diese Antwort bin ich Ihnen noch schuldig«, entschuldigte sich Foucher. »Durch den Fermentationsprozess in Kombination mit dem natürlichen Zuckergehalt und der Säure der Trauben werden mögliche Krankheitserreger ganz von selbst vernichtet. Nicht vergessen – der Saft der süßen Früchte wird in Alkohol umgewandelt. Praktisch ein biologisches Desinfektionsmittel. Außerdem würde ich mir an Ihrer Stelle wegen nackter Füße noch die wenigsten Sorgen machen. Was denken Sie, was sonst so auf Trauben klebt? Vogelkot, Schneckenschleim und so weiter – nicht alles wird bei der Ernte entfernt.«
Marron nickte zufrieden. Die Antwort war einleuchtend.
»Aber um Sie endgültig zu beruhigen, nehme ich gerne den ersten Schluck«, meinte Foucher milde lächelnd. Sie hob ihr Glas, führte es zu den Lippen und machte einen kleinen Schluck. Diesen ließ sie mit geschlossenen Augen im Mund kreisen, bevor sie den Wein schluckte. »Sehen Sie? Noch immer am Leben.« Wieder Gelächter vom Rest der Gäste.
»Im Gegensatz zu dieser Frau«, rief die kleine Österreicherin gelassen vom Bottich herüber. Sie hatte die Plane angehoben und druntergelugt. »Oder ist das hier ein Krimi-Lunch und wir müssen jetzt den Täter finden?«
»Wie … was …?«, stotterte Foucher, die durch die Kleine völlig aus der Fassung gebracht worden war. Da war Geneviève schon bei dem Bottich und scheuchte die junge Frau weg. Sie schlug die Plane ganz zurück. Tatsächlich schwamm ein Frauenkörper mit dem Rücken nach oben in der dunkelroten Maische. Hinter ihr drängten sich nun auch die anderen Gäste rund um den Bottich.
Sofort schaltete Geneviève in den Kommissarinnen-Modus. »Zurück. Bitte alle zurücktreten. Das hier ist ein Tatort, und Sie könnten wichtige Spuren vernichten.« Erschrocken wichen einige der Gäste zurück. Nur die Österreicher nicht.
»Deinen Weg pflastern wirklich Leichen, Charlotte«, meinte die Kleine kopfschüttelnd in Richtung ihrer großen Schwester. »Nicht einmal ein paar ruhige Tage in Paris kann man mit dir verbringen.« Geneviève hatte keine Ahnung, was sie damit meinte, notierte die Aussage aber sicherheitshalber mal im Kopf. Während Letitia geistesgegenwärtig half, die anderen Gäste zurückzudrängen, verständigte Geneviève ihre Assistentin Lunette. Sie erklärte ihr kurz den Sachverhalt, den Rest konnte Lunette in die Wege leiten.
In der Zwischenzeit hatte Letitia mithilfe des großen Österreichers die anderen Schaulustigen zurück in die Weinlaube gelotst. Einige der Gäste versuchten, ihren Schock mit Alkohol zu beruhigen. Die beiden offenen Verkostungsflaschen waren im Handumdrehen geleert. Lediglich die Familie Morel und die Österreicher blieben ruhig. Über den Stoizismus ihrer eigenen Familie war Geneviève nicht sonderlich überrascht, ein Pokerface bewahren zu können, gehörte zum Familiengeschäft, und Jules und Danielle hatten von der ganzen Sache zum Glück nichts mitbekommen. Den beiden war die Weinverkostung zu langweilig gewesen, stattdessen waren sie durch die Weinreben gejagt und hatten Fangen gespielt.
Im Fall der österreichischen Touristen stellten sich bei Geneviève hingegen einige Fragen. Die Antworten darauf würde sie sich holen, sobald Verstärkung eingetroffen und der Tatort abgesperrt war. Bis es so weit war, warf sie noch mal einen Blick auf die Frauenleiche, die halb versunken in der Maische lag. Auf Isabelle Thibault, die Gerichtsmedizinerin und Freundin Genevièves, wartete jede Menge Arbeit. Auch wenn Geneviève schon jetzt sagen konnte, dass die Tote wohl nicht in der Maische ertrunken war. Außer es hatte ihr jemand nachträglich den Schädel eingeschlagen.
CORPS AU VIN
»Und?« Geneviève stand hinter der Gerichtsmedizinerin, die über die Leiche gebeugt war. Keine 15 Minuten, nachdem Geneviève das Kommissariat alarmiert hatte, war ihr Team auch schon am Tatort eingetroffen. Lunette und Commandant Albouy sogar ein paar Minuten früher als das Team der Spurensicherung.
Isabelle Thibault, die Gerichtsmedizinerin, hatte länger gebraucht. Sie hatte auch den längsten Weg. Das Institut médico-légal war zwar nur knapp sieben Kilometer Luftlinie entfernt, im Pariser Verkehr bedeutete das jedoch quasi eine andere Welt. Eine halbe Stunde nach Genevièves Alarm hatte aber auch sie es hinauf zum Weinberg geschafft.
»Kann ich dir jetzt noch nicht sagen«, antwortete Isabelle kurz. »Der Schlag auf den Hinterkopf war auf jeden Fall tödlich. Ob er auch die Todesursache ist …« Sie hob entschuldigend die Schultern. »Ich kann dir mehr sagen, wenn ich die Arme bei mir auf dem Tisch habe. Wissen wir schon, um wen es sich handelt?«
»Nein, leider noch nicht. Die Leiche hatte weder Ausweise noch Handy bei sich. Und die Touristenführerin kennt sie auch nicht.«
»Ich schätze ihren Todeszeitpunkt auf irgendwann zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens. Genau lässt es sich noch nicht sagen, weil sie ja in einer Flüssigkeit gelegen hat.«
»Wie eine Wasserleiche.«
»Ähnlich, aber nicht ganz. Die Maische hat viel mehr Feststoffe, außerdem war die Leiche nicht unter der Oberfläche.«
Mit Wasserleichen hatte es Geneviève im 18. Arrondissement glücklicherweise so gut wie nie zu tun. Sie gehörten mit zu den unappetitlichsten Anblicken, die man in einem an grausigen Anblicken ohnehin nicht armen Beruf serviert bekam. Aufgeblähte Körper, aufgesprungene Haut, von Fischen angefressene Körperteile … Es gab schier unendliche Möglichkeiten, eine grausiger als die andere.
Dagegen war die Frau, die die Polizisten aus dem Holzbottich gefischt hatten, harmlos anzusehen. Wenn man mal von der leicht lila Verfärbung ihrer Haut absah. Isabelle hatte sie nach der ersten Untersuchung auf ein Alter von 25 bis 30 geschätzt. Sie war mittelgroß, mit schlanker Figur und dunklen Haaren. Am Hinterkopf klaffte ein großes Loch, umgeben von getrocknetem Blut.
»Haben wir den Gegenstand schon, mit dem sie erschlagen wurde?«
»Ja, wir haben einen Stein gefunden, an dem Blutspuren sind. Der Täter muss ihn weggeworfen haben. Er lag nur ein paar Meter entfernt vom Bottich zwischen den Weinreben.«
Die Spurensicherung hatte ein kleines weißes Zelt gleich neben der Laube aufgestellt, in dem einerseits die Aussagen von jenen Besuchern aufgenommen wurden, die mit Geneviève die Führung mitgemacht hatten, andererseits wurden hier auf einem Klapptisch auch alle gefundenen Gegenstände sortiert, nummeriert und katalogisiert. Dorthin begab sich Geneviève, um die vermeintliche Tatwaffe zu holen. Gerade eben wurden dort die Aussagen der österreichischen Touristen aufgenommen. Zuständig dafür war Major Jean-Marie Faivre, einer ihrer verlässlichsten Mitarbeiter. Einer von jenen, die nicht in den Vordergrund drängten, aber dafür ihren Dienst vorbildlich verrichteten. Außerdem war er der Freund von Lunette, aber das hatte bislang noch keine negativen beruflichen Auswirkungen gehabt. Eher im Gegenteil. Beide wussten, dass sie unter besonderer Beobachtung standen, und gaben daher extra acht, ja alles ordnungsgemäß zu erledigen.
Sie beneidete Faivre nicht. Das Französisch der kleinen Österreicherin war bemerkenswert gut, und sie plapperte ohne Unterbrechung auf den Major ein. Tatsächlich war es so, dass sie ihn ausfragte, statt umgekehrt. Ihre große Schwester hatte die Ablenkung genutzt und stand über den Tisch mit den Beweisstücken gebeugt.
»Was machen Sie da?«, herrschte Geneviève die rothaarige Touristin auf Englisch an.
»Schauen«, antwortete die Angesprochene kurz angebunden. Sie richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, was wenig imposant war, denn Geneviève überragte sie um mehr als einen halben Kopf.
»Wieso interessiert Sie das?«
»Ich war selbst mal Polizistin.«
»Waren.«
»Und?«
Spitze, das hatte Geneviève gerade noch gefehlt. Eine Ehemalige, noch dazu aus dem Ausland. Und die wollte sich jetzt offenbar wichtigmachen.
Aber damit war noch lange nicht Schluss. Jetzt gesellte sich auch noch der große Begleiter der Gruppe dazu. Immerhin gab er sich Mühe: »Ich bin aktiver Polizist«, erklärte er in gebrochenem Französisch. »Ich leite ebenfalls ein Kommissariat. Vielleicht können wir Ihnen ja behilflich sein. Wir haben durchaus Erfahrung im Aufklären von Morden.«
Geneviève prustete vor Lachen. »Entschuldigen Sie«, meinte sie schließlich. »Aber ich denke, das überlassen Sie hier bitte doch uns.«
»Wir können das wirklich!«, mischte sich nun wieder die Rothaarige ein.
»Madame, sehr freundlich«, gab sich Geneviève alle Mühe, höflich zu bleiben. Man wollte ja die Touristen nicht vergrämen. »Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, stehen Sie mir momentan eher im Weg.« Sie wandte sich an den Major. »Haben Sie die Aussagen der Herrschaften aufgenommen?«
Faivre nickte eifrig. Auch er konnte es nicht erwarten, die Touristenbande loszuwerden.
»Gut, Madame … Wie heißen Sie eigentlich? Sie haben mir Ihren Namen noch gar nicht gesagt.«
»Sie haben bislang auch nicht danach gefragt«, antwortete die Rothaarige eingeschnappt.
Geneviève verlor langsam die Geduld. »Verraten Sie ihn mir jetzt?«
»Nöhrer. Charlotte Nöhrer.«
»Star-Winzerin!«, warf die Kleine stolz ein.
»Jetzt reicht’s dann auch wieder«, sagte der große Begleiter und angeblich echte Polizist sichtbar peinlich berührt. Er schnappte das Schwesternpaar an der Hand, nickte Geneviève entschuldigend zu und schleppte beide aus dem Zelt. Die blonde Freundin der Rothaarigen folgte ihnen auf dem Fuß.
Endlich Ruhe.
Geneviève nahm die Plastiktüte mit dem Stein und ging zurück zu Isabelle.
»Das hat ganz schön gedauert. Herrscht da drin so ein Saustall?«, wurde sie von der Gerichtsmedizinerin ungeduldig empfangen.
»Wenn es nur das wäre. Nein, ein paar neugierige Möchtegern-Detektive.«
»Will ich Genaueres wissen?«
Geneviève schüttelte den Kopf. »Konzentrieren wir uns auf unsere Leiche. Hier ist der Stein.«
Isabelle beließ den Stein in der Tüte, drehte und wendete sie und legte sie auf die Wunde. »Scheint zu passen. Ohne der Obduktion vorgreifen zu wollen, würde ich mal sagen, dass die Frau mit diesem Stein erschlagen wurde. Habt ihr sonst noch etwas gefunden?«
»Wahrscheinlich nichts von Bedeutung. Wir müssten den kompletten Bottich genau untersuchen – das sind einige Hektoliter. Und durch den bereits gestarteten Gärvorgang …«
»Und rund um den Bottich?«
»Ein paar Textilfasern, aber die könnten von jedem hier stammen. Die Touristenführungen finden bereits seit gestern statt. Da sind schon ein paar 100 Leute durchgekommen. Es gibt ein paar Kratzer an der Außenseite des Bottichs. Dort wurde die Leiche mutmaßlich drübergehievt.«
»Was auch dafür spricht, dass sie vorher erschlagen und dann in der Maische versenkt wurde.«
Geneviève nickte.
»Habt ihr schon den Ort gefunden, wo die Frau erschlagen wurde?«
»Direkt hier am Bottich war es wohl nicht, dafür fehlen Blutspuren am Boden, und bei so einer großen Wunde muss ja etwas herumgespritzt sein.«
»Auf jeden Fall«, bestätigte die Gerichtsmedizinerin.
»Wir suchen gerade die Reben in der Umgebung ab.«
»Du glaubst nicht, dass sie weiter weg erschlagen wurde?«
Geneviève schüttelte den Kopf. »Nein. Die Leiche ist zwar kein Schwergewicht, aber es macht trotzdem keinen Spaß, eine Leiche durch den halben Weingarten zu schleppen. Außerdem sind uns auch keine Spuren aufgefallen, die darauf hätten schließen lassen. Die Wege zwischen den Reben sind schmal, da hätten wir jede Menge abgerissener Blätter oder Schleifspuren finden müssen. Je nachdem, ob der Täter die Leiche getragen oder gezogen hat. Und weil der Bottich recht hoch ist, war es auch nicht einfach, den Körper in der Maische zu entsorgen. Dafür sprechen auch die Kratzer und Spuren an Bauch und Brust des Opfers. Die Kleidung dort ist zerrissen. Von einem Kampf kam das meiner Meinung nach nicht. Aber dafür habe ich ja dich. Du bist die Spezialistin.«
»Klingt schlüssig.« Isabelle drehte die Leiche auf den Rücken. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte die Frau Jeans, eine Bluse und eine Jeansjacke getragen. In der Bluse waren am Bauch deutliche Risse zu sehen. Die mussten von dem Moment stammen, als der Mörder sie über den Rand des Bottichs geschoben hatte. Isabelle sah sich die Haut unter der zerrissenen Bluse genauer an. Sie war von der Maische ein wenig verfärbt. Da waren tatsächlich ein paar Kratzer zu erkennen. Isabelle strich mit den Fingern langsam über die oberflächlichen Verletzungen und fand schließlich einen gut fünf Zentimeter langen Holzspan, der sich in der Haut des Opfers verfangen und von der roten Traubenmaische lila verfärbt hatte. Er steckte tief in der Bauchdecke, nur die letzte Spitze hatte noch herausgeschaut und war von Isabelle ertastet worden. Vorsichtig zog sie den Holzspan aus dem Körper und präsentierte ihn Geneviève. »Bingo!«, rief sie freudig.
Geneviève steckte zwei Finger in den Mund und pfiff laut.
»Ich bin doch kein Hund!«, meldete sich Thierry Zazou, der Leiter des Spurensicherungsteams.