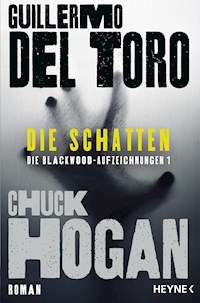9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Strain
- Sprache: Deutsch
Der Kampf gegen die Untoten geht in die letzte Runde
Sie waren immer hier. Unter uns. Sie haben gewartet. In der Dunkelheit. Jetzt ist ihre Zeit gekommen ... Durch ein Virus haben sich die Vampire rund um die Welt ausgebreitet und die menschliche Zivilisation in weiten Teilen vernichtet. Dem Anführer der Vampire ist es sogar gelungen, die anderen Vampir-Clans soweit zu schwächen, dass er die alleinige Herrschaft über den Planeten antreten kann. Doch er hat nicht mit Ephraim Goodweather, einst Chef der New Yorker Seuchenpräventionsteams, gerechnet. Goodweather stemmt sich mit aller Kraft dem Ansturm der Vampire entgegen. Wird es ihm gelingen, die Menschheit zu retten? Und welche Rolle spielt dabei ein sagenumwobenes Buch, das auf geheimnisvolle Weise in Goodweathers Besitz gelangt ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
GUILLERMO DEL TORO
CHUCK HOGAN
DIE
NACHT
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von
Alexander Lang
Für meine Eltern.
Jetzt weiß ich, dass es ganz
schön viel Arbeit für euch war …
GDT
Für Charlotte – auf ewig
CH
ASCHEREGEN
Aus dem Tagebuch von Ephraim Goodweather
Am zweiten Tag der Dunkelheit hatte man sie alle erwischt. Die Besten, die Klügsten. Die Mächtigen, die Reichen, die Bedeutenden. Abgeordnete und Minister, Wirtschaftsbosse und Intellektuelle, Oppositionsführer und andere Berühmtheiten. Aber sie wurden nicht verwandelt. Sie wurden getötet. Ihre Exekution ging schnell und vor aller Augen vonstatten. Und sie war von ausgesuchter Brutalität.
Nur einige wenige aus jeder Gruppe wurden verschont – alle anderen wurden ausgelöscht. Wurden aus ihren River Houses gezerrt, ihren Dakotas, ihren Beresfords und wie Vieh zusammengetrieben: auf der National Mall in Washington, auf der Nanjing Road in Shanghai, auf dem Roten Platz in Moskau, im Fußballstadion von Kapstadt, im Central Park von New York City. Und dort, in einer Orgie aus Blut und Gewalt, entledigte man sich ihrer.
Es hieß, dass über tausend strigoi die Lexington Avenue hinunter kamen und alle Gebäude rund um den Gramercy Park stürmten. Weiche, manikürte Hände baten und bettelten. Aber ihr ganzes Geld war nutzlos. Ihre zuckenden Körper baumelten von den Straßenlaternen auf der Madison Avenue. Und auf dem Times Square verbrannte wohlgenährtes Fleisch auf über sechs Meter hohen Scheiterhaufen. Die Elite Manhattans erleuchtete – im wahrsten Sinne des Wortes – die leergefegten Straßen, die verschlossenen Läden (»ALLES MUSS RAUS!«) und die dunklen LED-Schirme.
Der Meister hatte sich genau überlegt, wie viele Vampire er benötigte, um die Herrschaft über den Planeten an sich zu reißen, ohne zugleich die Versorgung mit Blut zu gefährden; er ging methodisch, ja geradezu mathematisch vor. Es war nicht nur ein Umsturz – es war eine Säuberungsaktion. Etwa ein Drittel der menschlichen Bevölkerung wurde in den ersten zweiundsiebzig Stunden ausgelöscht – zweiundsiebzig Stunden, die sich im kollektiven Gedächtnis als »Night Zero« einbrannten.
Die Vampirhorden übernahmen die Kontrolle auf den Straßen. Die Polizei, die SWAT-Teams, die U.S. Army – sie alle wurden überrannt. Diejenigen von ihnen, die sich unterwarfen, die sich den Geschöpfen der Nacht auslieferten, wurden auch unter den neuen Herren als Aufseher eingesetzt. Nach einem brutalen darwinistischen Ausleseverfahren machte sich der Meister die gehorsamsten Überlebenden untertan.
Und sein Plan war ein durchschlagender Erfolg. Es gab nun niemanden mehr, der sich ihm in den Weg stellen konnte: Die Alten waren vernichtet, die Macht des Meisters über die Vampire – und dadurch über die Welt – war absolut. Nun wüteten die strigoi nicht länger durch die Städte wie wild gewordene, gierige Zombies, sondern ihre Aktionen waren koordiniert. Wie in einem Bienenstock oder einem Ameisenbau hatte nun jeder von ihnen eine klar definierte Rolle und Aufgabe. Sie waren die Augen des Meisters auf den Straßen. Und sie waren überall. Wie Spinnen hatten sie sich in jeder Ecke eingenistet und sorgten dafür, dass sich die Menschen, die sie am Leben gelassen hatten, in die neue Ordnung fügten.
Am Anfang herrschte Dunkelheit. Nur für einige Sekunden, wenn sie im Zenit stand, konnte man die Sonne erahnen – sonst war ihr Licht völlig verschwunden. Nun, zwei Jahre später, drang die Sonne vielleicht für zwei, drei Stunden am Tag durch die vergiftete Atmosphäre, aber ihr fahles Licht hatte nichts mehr mit jenem hellem Leuchten zu tun, das einst den Planeten gewärmt hatte.
Und doch: Das Erschreckendste war, wie wenig sich geändert hatte. Der Meister hatte sich das Chaos, das in den ersten Monaten herrschte, geschickt zunutze gemacht. Es mangelte so sehr an Nahrungsmitteln, an sauberem Wasser, an öffentlicher Sicherheit, dass sich die Menschen – kaum dass eine Art von Infrastruktur wieder hergestellt war, die Versorgung mit dem Nötigsten einigermaßen funktionierte und das reparierte Stromnetz für Licht in dieser ewigen Nacht sorgte – dankbar unter seine Obhut begaben. Eine Viehherde braucht das Gefühl von Ordnung und Routine – die Grundlagen jeder Machtausübung –, um sich zu unterwerfen.
Und so waren schon nach zwei Wochen die meisten Versorgungssysteme wieder in Betrieb. Wasser, Strom … sogar die Fernsehstationen sendeten wieder. Natürlich waren die Filme und Nachrichten und Sportberichte nur Wiederholungen aus der Zeit davor – aber die Menschen freuten sich trotzdem darüber.
Transportmittel hatten eine zentrale Bedeutung in dieser neuen Welt, denn kaum jemand besaß noch ein eigenes Auto. Jeder Wagen konnte eine potenzielle Bombe sein, und so wurden die meisten von ihnen beschlagnahmt und zerstört. Die verbliebenen Fahrzeuge gehörten zur Polizei, zur Feuerwehr oder zu anderen Versorgungsdiensten, die von jenen Menschen betrieben wurden, die sich den Vampiren gebeugt hatten.
Auch dem Flugverkehr war es nicht besser ergangen. Die einzigen Flugzeuge, die noch in Betrieb waren – kaum mehr als sieben Prozent der Maschinen, die einst um die Erde geflogen waren –, gehörten der Stoneheart Group, jenem multinationalen Konzern, dessen Kontrolle über Nahrungsmittel, Energie und Militärgüter sich der Meister zunutze gemacht hatte.
Silber wurde verboten und damit zu einer äußerst begehrten Schattenwährung, die man gegen Essensgutscheine tauschen konnte. Ja, mit der richtigen Menge an Silber konnte man sich – oder seine Liebsten – sogar von den Farmen freikaufen.
Die Farmen … Sie waren das Einzige, was sich wirklich radikal geändert hatte. (Die Farmen und die Tatsache, dass es kein Erziehungssystem mehr gab – keine Schulen, keine Bücher, keine freien Gedanken mehr.) Sie waren rund um die Uhr in Betrieb, sieben Tage die Woche. Von Experten für Viehzucht mit dem nötigen Grundwissen ausgestattet, errichteten die strigoi ein biologisches Kastensystem. Sie bevorzugten B positiv. Natürlich diente ihnen jede Blutgruppe als Nahrung, aber B positiv hatte offenbar einen erhöhten Nährwert – so wie unterschiedliche Milchsorten – oder verdarb nicht so schnell außerhalb des menschlichen Körpers und konnte so besser aufbewahrt werden. Die Menschen mit anderen Blutgruppen bildeten die niederen Kasten, sozusagen die Arbeiterklasse; diejenigen mit B positiv waren die Filetstücke. Sie wurden gehätschelt und mit ausgewählten Nährstoffen versorgt, ja, sie bekamen sogar die doppelte Menge an UV-Licht, damit ihr Blut genug Vitamin D aufbauen konnte. Ihr Tagesablauf, ihr Hormonspiegel und schließlich auch ihre Fortpflanzung wurden streng kontrolliert und dem Bedarf angepasst.
Das also ist die Welt, in der wir jetzt leben. Die Menschen gehen zur Arbeit, sehen fern, essen ihre Mahlzeiten und legen sich nachts ins Bett. Aber dort, in der Dunkelheit und Stille, weinen und zittern sie, weil sie wissen, dass die, die ihnen nahestehen – ja, sogar die, mit denen sie das Bett teilen – von einem Moment auf den anderen verschwinden können, verschluckt vom dunklen Beton der Farmen. Und sie beißen sich auf die Lippen und wischen sich die Tränen aus den Augen, weil sie keine Wahl haben: Sie müssen sich unterwerfen. Müssen für jene, die von ihnen abhängig sind – ihre betagten Eltern oder ihre kleinen Kinder – da sein. Und so haben sie immer eine Rechtfertigung für ihre Angst. Und für ihre Feigheit.
Wer hätte gedacht, dass wir einmal mit nostalgischer Wehmut auf die Zeit der Jahrhundertwende zurückblicken würden? Jene Zeit politischer Verwirrung und ökonomischer Turbulenzen, die dem Zusammenbruch vorausging – eine goldene Zeit im Vergleich zur Gegenwart. Alles, was wir waren, alles, was unsere Väter und deren Väter erschaffen hatten – verloren, vernichtet. Jetzt sind wir nicht mehr als eine Herde Vieh.
Und diejenigen von uns, die noch am Leben sind und sich nicht unterworfen haben … sind die Anomalität. Das Ungeziefer. Die Gejagten.
Und wir haben keine Mittel, uns gegen unsere Jäger zur Wehr zu setzen.
Kelton Street, Woodside, Queens
Ein Schrei erklang in der Ferne und riss Ephraim Goodweather aus dem Schlaf. Er fuhr blitzschnell auf, rollte sich von dem Sofa, auf dem er lag, griff nach dem Silberschwert, das aus der Tasche auf dem Boden ragte, und ließ – alles in einer einzigen fließenden Bewegung – die Klinge durch die Luft zischen.
Sein heiserer, sich überschlagender Kampfschrei, Nachhall seiner Alpträume, brach jäh ab. Das Schwert zitterte in seiner Hand.
Er war allein.
Kellys Wohnzimmer … Kellys Sofa … All die vertrauten Dinge … Er war im Haus seiner Exfrau. Und der Schrei, den er im Traum gehört hatte, war der Ton einer Sirene, die einige Straßen weiter losgegangen war.
Wieder dieser Traum! Von Feuer und Gestalten aus glänzendem Licht, die vage an Menschen erinnerten. Ein Kampf. Im Traum kämpfte er mit diesen Gestalten – bis das Licht so gleißend wurde, dass es alles verschluckte. Und immer wachte er völlig erschöpft auf, als ob er tatsächlich mit jemandem gekämpft hätte. Der Traum kam wie aus dem Nichts; er träumte auf die normalste Weise vor sich hin – er war bei einem Picknick oder steckte in einem Verkehrsstau oder saß im Büro –, und plötzlich wurde alles ganz hell, und die silbrig glänzenden Gestalten erschienen.
Er tastete nach den anderen Waffen in der umgerüsteten Baseballtasche, die er in einer geplünderten Modell’s-Filiale auf der Flatbush Avenue gefunden hatte. Er war in Queens. Okay? Okay! Allmählich kam die Erinnerung zurück. Und mit ihr die Kopfschmerzen – er hatte gestern Abend, wie so oft in letzter Zeit, zuviel getrunken und einen Blackout gehabt. Er steckte das Schwert in die Tasche zurück, setzte sich auf das Sofa und legte den Kopf in die Hände, als wäre er eine zerbrechliche Kristallkugel. Sein Haar fühlte sich wirr und borstig an, seine Schläfen pochten.
Die Hölle auf Erden. Ja, das ist es!
Die Wirklichkeit war der eigentliche Alptraum. Eph war noch am Leben und er war noch ein Mensch – das war nicht viel, aber immerhin.
Ein weiterer Tag in der Hölle …
Das Letzte, an das er sich von seinem Traum erinnerte, jener Teil, der an seinem Bewusstsein haftete wie eine klebrige Nachgeburt, war ein Bild von Zack. Sein Sohn Zack – umgeben von gleißendem, silbernem Licht. Und aus diesem Licht waren die Gestalten gekommen. »Dad!«, hatte Zack gerufen oder geflüstert, und sein Blick hatte sich an den seines Vaters geklammert, und dann hatte das Licht sie alle verschluckt.
Der Gedanke daran ließ Eph zittern. Warum fand er keine Ruhe, keinen Trost in seinen Träumen? Waren Träume nicht dafür da? Sollten sie nicht diesem Gefängnis, das sich Realität nannte, Bilder vom Entkommen entgegensetzen? Was hätte er nicht für einen jener rührseligen Träume von früher gegeben, für einen Löffel Zucker für sein geplagtes Unterbewusstsein:
Eph und Kelly kurz nach dem Collegeabschluss, wie sie händchenhaltend über einen Flohmarkt schlendern und nach billigen Möbeln und anderem Krimskrams Ausschau halten, mit dem sie ihre erste gemeinsame Wohnung einrichten wollen …
Zack als Dreikäsehoch, der mit seinen dicken Füßen durch das Haus stapft, ein kleiner Tyrann in Windeln …
Eph und Kelly und Zack beim Abendessen, die Hände vor den Tellern gefaltet, während Z mit ernster Miene das Gebet aufsagt, das er auswendig gelernt hat …
Nein, jetzt waren Ephs Träume ganz anders, glichen eher verwackelten Snuff-Filmen. Menschen aus seiner Vergangenheit – Freunde oder Bekannte oder Feinde – wurden gejagt und verschleppt, und er musste dabei zusehen, unfähig, ihnen zu helfen, unfähig, sich abzuwenden …
Er stand wieder auf, versuchte das Gleichgewicht zu halten. Ging zu dem großen Fenster, von dem aus man den Hinterhof sah. Der LaGuardia Airport war nicht weit entfernt, aber der Anblick eines Flugzeugs, das Geräusch eines Düsenjets – das alles war inzwischen äußerst selten geworden. Die Lichter waren vom Himmel verschwunden. Eph musste an den 11. September 2001 denken – jenen Tag, an dem der leere Himmel ihnen allen so unwirklich erschienen war – und daran, was es für eine Erleichterung gewesen war, als eine Woche später die Flugzeuge zurückgekehrt waren. Jetzt gab es keine Erleichterung. Keine Rückkehr zur Normalität.
Wie spät war es wohl? Irgendwann am Vormittag – das sagte ihm jedenfalls seine innere Uhr, die noch nach dem Tag-Nacht-Rhythmus funktionierte. Und es war Sommer, zumindest dem Kalender nach, also hätte die Sonne hoch und heiß am Himmel stehen sollen.
Stattdessen war es dunkel. Eine ewige Dunkelheit, so schien es. Die natürliche Abfolge von Tag und Nacht war aufgehoben; die Sonne wurde von einem düsteren Schleier aus Asche verdeckt, der sich am Himmel ausgebreitet hatte – die Folge der weltweiten Nuklearexplosionen und Vulkanausbrüche – und kein Licht und keine Wärme mehr durchließ. Der Planet hatte sich in ein blasses, ausgemergeltes Niemandsland verwandelt, eine Welt aus Kälte und Finsternis.
Der perfekte Lebensraum für Vampire.
Und wenn man den allerletzten Live-Nachrichten Glauben schenken wollte – die wie Pornos im Internet hin und her geschickt worden waren –, dann war es überall auf der Erde dasselbe: ein sich verdunkelnder Himmel, schwarzer Regen, finstere Wolken, die sich zusammenballten und wie riesige Felsen in der Luft hingen … Zog man die Rotation und die Windverhältnisse auf dem Planeten in Betracht, so waren der Nord- und Südpol die einzigen Orte, an denen noch wie früher die Sonne schien. Theoretisch. Denn niemand wusste das genau.
Der radioaktive Fallout nach den Explosionen und Kernschmelzen an den zahllosen »Ground Zeros« war äußerst intensiv gewesen; Eph und die anderen hatten beinahe zwei Monate tief unter der Erde verbringen müssen, im North River Tunnel unter dem Hudson. Erst als Stürme und Windböen den kontaminierten Staub in der Atmosphäre verteilt und schwere Regenfälle die Radioaktivität aus der Luft gewaschen hatten, war es wieder möglich, zumindest jene Gebiete zu betreten, die den Explosionen nicht direkt ausgesetzt gewesen waren.
Die langfristigen Folgen dieses brutalen Eingriffs in das Ökosystem des Planeten würden verheerend sein: die Auswirkungen auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit, die Schäden im Genom, die Krebserkrankungen … Aber niemand machte sich über die Zukunft Gedanken – zwei Jahre nach den Explosionen, zwei Jahre nach der Machtübernahme der Vampire lebte die Menschheit in einer ewigen Gegenwart. In einem ewigen Alptraum.
Die Sirene verstummte. Diese Alarmsysteme, die früher dazu gedacht gewesen waren, vor menschlichen Eindringlingen zu warnen, schlugen immer noch gelegentlich an; aber längst nicht mehr so oft wie in den ersten Tagen nach den Explosionen, als sie ständig geheult hatten – wie der Todesschrei einer sterbenden Spezies, einer vergehenden Zivilisation.
Nun, da es wieder still war, lauschte Eph seinerseits auf Eindringlinge. Durch Fenster, durch modrige Keller, durch staubige Dachböden – die Vampire konnten von überall her kommen. Selbst in den wenigen Stunden am Tag, in denen die Sonne durch die Asche brach – ein fahles bernsteinfarbenes Licht, das irgendwie unnatürlich wirkte –, war man nicht sicher vor ihnen. Dies waren die einzigen Stunden, in denen sich Eph und die anderen in der Stadt bewegen konnten, ohne eine direkte Konfrontation mit den strigoi zu riskieren, aber es waren auch die gefährlichsten Stunden, denn die Straßen wurden von Überläufern bewacht – Menschen, die glaubten, ihrem Schicksal entgehen zu können, indem sie den Vampiren zu Diensten waren.
Er drückte die Stirn gegen das Fenster. Das Glas war kalt und fühlte sich gut an; es linderte das Dröhnen in seinem Kopf.
Das Schlimmste war zu wissen. Zu wissen, dass man verrückt war, machte einen nicht weniger verrückt; zu wissen, dass man ertrank, ließ einen nicht weniger ertrinken, ganz im Gegenteil: Es trug dazu bei, dass man noch panischer wurde. Zu wissen, dass es einmal eine bessere, hellere Welt gegeben hatte, war ebenso ein Grund für Ephs Qual wie die Vampirseuche selbst.
Er brauchte Essen. Proteine. Aber in diesem Haus war nichts mehr; schon vor Monaten hatte er sämtliche Nahrungsmittel verbraucht, die Kelly gelagert hatte – inklusive des Alkohols. Ja, er hatte sogar einen geheimen Butterfinger-Vorrat entdeckt, den Kellys damaliger Freund Matt in seinem Zimmer gehortet hatte.
Eph wandte sich vom Fenster ab und blickte sich im Wohnzimmer um, als würde er es zum ersten Mal sehen. Wie war er nur hierher gekommen? Warum war er hierher gekommen? Er sah die Kratzer an der Wand, dort, wo er Matt – Matt, den Vampir – getötet hatte. Geköpft hatte. Das war in jenen Anfangstagen gewesen, als einen Vampir zu töten genauso beängstigend gewesen war wie der Gedanke, von einem Vampir verwandelt zu werden. Selbst wenn in diesem Fall der Vampir der Freund seiner Exfrau gewesen war, der Eph als Vaterfigur in Zacks Leben zu ersetzen gedroht hatte.
Aber dieser Reflex einer nur allzu menschlichen Moral gehörte längst der Vergangenheit an. Die Welt hatte sich verändert, und Dr. Ephraim Goodweather, einst ein bedeutender Epidemiologe in Diensten der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC, hatte sich mit ihr verändert. Das Vampirvirus hatte die gesamte Menschheit befallen. Hatte die menschliche Zivilisation ausgelöscht. Wer sich gegen die Seuche zur Wehr gesetzt hatte – und war er noch so stark gewesen –, war getötet oder verwandelt worden, und übrig waren jene geblieben, die sich dem Willen des Meisters gebeugt hatten und nun seinen Befehlen folgten.
Eph ging wieder zur Waffentasche, öffnete ein Seitenfach, das eigentlich für Baseballhandschuhe oder Schweißbänder gedacht war, und zog ein leicht zerfleddertes Moleskine-Notizbuch heraus. Was er nicht aufschrieb, vergaß er. Und so schrieb er alles auf, das Banale ebenso wie das Tiefsinnige. Alles musste dokumentiert, archiviert werden – es war wie ein innerer Zwang. Sein Tagebuch war ein nie endender Brief an seinen Sohn. Es enthielt die Geschichte seiner Suche nach Zack. Und es enthielt – schließlich war er Wissenschaftler – die Theorien, die er in Bezug auf das Vampirvirus anstellte, die Beobachtungen, die er gemacht, die Erkenntnisse, die er gewonnen hatte.
Außerdem war es eine gute Methode, um bei Verstand zu bleiben – oder zumindest den Anschein zu erwecken.
Seine Handschrift war in den letzten zwei Jahren so unleserlich geworden, dass er die Einträge kaum entziffern konnte. Er notierte jeden Tag das Datum – die einzige Möglichkeit, ohne Kalender das Vergehen der Zeit zu dokumentieren. Nicht dass das irgendetwas bedeutet hätte …
Aber heute bedeutete es etwas. Als Eph das Datum aufschrieb, war es, als würde sein Herz für eine Sekunde aussetzen. Natürlich! Wie hatte er das nur vergessen können? Das war der Grund, warum er heute hier war, hier in Kellys Haus.
Heute war Zacks dreizehnter Geburtstag.
EINTRITT NUR UNTER LEBENSGEFAHR!, stand auf dem Schild, das an der Tür im ersten Stock hing. Die Worte waren mit dickem Filzstift geschrieben und mit Grabsteinen, Skeletten und Kreuzen verziert. Zack hatte das Schild gemalt, als er sieben oder acht war; Eph wusste es nicht mehr ganz genau.
Das Zimmer seines Sohnes war in mehr oder weniger demselben Zustand, in dem Zack es zuletzt verlassen hatte. Es glich darin wohl allen Zimmern verschwundener Kinder – Orte, an denen die Zeit ebenso still stand wie in den Herzen der Eltern. Immer wieder kehrte Eph in dieses Zimmer zurück, wie ein Taucher zu einem versunkenen Schiff. Zacks Zimmer war sein geheimes Museum, sein Fenster in die Vergangenheit.
Er setzte sich auf das Bett, spürte das vertraute Nachgeben der Matratze, hörte das leise Knarren des Holzgestells. Alles in diesem Raum war ihm vertraut – all die Dinge, die Zack in seinem früheren Leben berührt hatte. Eph war der Kurator dieses Museums; er kannte jedes Spielzeug, jedes Stofftier, jedes T-Shirt, jedes Buch. Und doch war er nicht der Ansicht, dass er sich hier in der Vergangenheit verlor. Man ging nicht in die Kirche oder Synagoge oder Moschee, um sich in etwas zu verlieren; man ging dorthin, um seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Zacks Zimmer war wie ein Schrein, dort – und nur dort – spürte Eph eine Art inneren Frieden und fühlte sich in seiner Überzeugung bestätigt.
Seiner Überzeugung, dass Zack noch am Leben war.
Das war kein Wunschdenken, keine blinde Hoffnung. Nein, Eph wusste, dass sein Sohn noch am Leben war. Und dass er noch nicht verwandelt war.
Früher – in der Zeit davor – hatten sich die Eltern eines verschwundenen Kindes an jemanden wenden können: an die Polizei, an Hunderte, wenn nicht Tausende anderer Menschen, die Mitleid mit ihnen hatten und sich an der Suche beteiligten. Zack jedoch war in einer Welt ohne Polizei, ohne menschliche Gesetze entführt worden. Und es gab nicht den geringsten Zweifel, wer der Täter war: Zack war von jener Kreatur verschleppt worden, die einst seine Mutter gewesen war. Aber hinter ihr verbarg sich ein noch viel mächtigeres, dunkleres Wesen.
Der Herr der Vampire. Der Meister.
Was Eph nicht wusste, war, warum Zack entführt worden war. Vermutlich um ihn, seinen Vater, zu verletzen. Und um die Gier seiner Mutter zu stillen, die es nach jenen verlangte, die sie früher einmal geliebt hatte. Um sich auszubreiten, machte sich das Vampirvirus auf perverse Weise die menschliche Liebe zunutze: Wenn man einen Menschen in einen strigoi verwandelte, war man auf ewig mit ihm verbunden, in einer Form der Existenz, in der die Probleme und Sorgen des menschlichen Daseins keinerlei Rolle mehr spielten, einer Existenz, in der es nur noch um Nahrung, um Fortpflanzung, ums Überleben ging.
Deshalb war Kelly – die Vampir-Kelly – so fixiert auf ihren Sohn, und deshalb war es ihr trotz Ephs heftiger Gegenwehr gelungen, mit dem Jungen zu entkommen.
Doch genau deshalb – aufgrund derselben Obsession, jene zu verwandeln, die einem früher am nächsten gestanden hatten – wusste Eph auch, dass Zack nicht verwandelt worden war. Denn hätten der Meister oder Kelly den Jungen mit dem Virus infiziert, wäre Zack längst zu ihm zurückgekehrt: als Vampir. Diese Vorstellung – seinem untoten Sohn von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen – war in den letzten zwei Jahren Ephs ständiger Begleiter gewesen.
Blieb nur die Frage: Warum? Warum hatte der Meister Zack nicht verwandelt? Was hielt ihn davon ab? War der lebende, nicht-verwandelte Zack eine nützliche Waffe gegen Eph und gegen den gesamten Widerstand? Oder gab es noch einen anderen Grund?
All das lastete schwer auf Ephs Schultern. Wenn es um seinen Sohn ging, war er verwundbar. Aber es war eine Schwäche, aus der er zugleich seine Kraft schöpfte: Es war unmöglich für ihn, seinen Sohn loszulassen.
Wo war Zack in diesem Moment? War er eingesperrt? Wurde er gefoltert? Gedanken wie scharfe Klauen, die sich in Ephs Bewusstsein geschlagen hatten … Und so war es das Schlimmste für ihn, nicht zu wissen. Während die anderen – Vasiliy, Nora, Gus – sich mit aller Kraft dem Widerstand gegen die Vampire widmen konnten, musste er immer daran denken, dass sein Sohn eine Geisel in diesem Krieg war.
Wenn er in Zacks Zimmer war, fühlte er sich etwas weniger allein. Heute jedoch hatte dieser Ort den geradezu gegenteiligen Effekt – Eph hatte sich noch nie so allein gefühlt wie in diesem Augenblick.
Wieder musste er an Kellys Exfreund Matt denken – den er in diesem Haus getötet hatte –, daran, wie er sich über Matts Einfluss auf seinen Sohn aufgeregt hatte. Wie lächerlich! Jetzt stand Zack unter dem Einfluss einer ganz anderen Kreatur, eines wirklichen Monsters …
Eph spürte, wie ihn die Traurigkeit übermannte. Er schlug das Notizbuch auf und notierte diese eine Frage, die Frage, die er in all der Zeit immer wieder notiert hatte:
»Wo ist Zack?«
Dann ging er, wie er es oft tat, die Einträge der letzten paar Tage durch. Und blieb an einigen Worten hängen, die offenbar mit Nora in Verbindung standen.
»Gerichtsmedizin« … »Treffen« … »Bei Sonnenlicht«
Eph kniff die Augen zusammen, versuchte sich zu erinnern.
Verdammt!
Ja, das war es: Er hatte sich mit Nora und ihrer Mutter am früheren Hauptsitz der New Yorker Gerichtsmedizin verabredet. In Manhattan. Heute!
Die Silberklingen klirrten, als er nach der Baseballtasche griff und sie sich über die Schulter warf; die Schwertgriffe ragten hinter ihm auf wie lederbezogene Antennen. Dann sah er sich noch einmal im Zimmer um – und aus irgendeinem Grund fiel ihm neben dem CD-Spieler auf der Kommode eine alte Transformers-Figur auf. Ihr Name war Sideswipe, wenn Eph sich recht erinnerte; er hatte sie Zack vor einigen Jahren zum Geburtstag geschenkt. Einer von Sideswipes Armen wies bereits deutliche Abnutzungserscheinungen auf. Eph nahm die Figur in die Hand und drückte daran herum – und dachte daran, wie Zack früher mit scheinbar nie endender Begeisterung Sideswipe von einem Auto zu einem Roboter und wieder zu einem Auto verwandelt hatte, ganz so, als wäre es ein Rubik’s Cube.
»Alles Gute zum Geburtstag, Z«, flüsterte er, steckte die Spielzeugfigur zu den Schwertern in die Tasche und verließ das Zimmer seines Sohnes.
Woodside
Die frühere Kelly Goodweather erreichte ihr früheres Haus in der Kelton Street nur wenige Minuten, nachdem Eph es verlassen hatte. Sie war ihm – diesem Menschen, den sie einmal geliebt hatte – auf der Spur, seit sie vor etwa fünfzehn Stunden das Pulsieren seines Blutes vernommen hatte. Doch dann war mittags der Himmel aufgerissen, und für jene zwei, drei Stunden fahlen, aber für Vampire tödlichen Sonnenlichts hatte sie sich in einem Keller verstecken müssen. Dort hatte sie entscheidende Minuten verloren.
Zwei schwarzäugige Späher begleiteten Kelly – zwei jener Kinder, die damals während der Sonnenfinsternis, die den Beginn der Vampirseuche in New York begleitet hatte, erblindet und darauf vom Meister persönlich verwandelt worden waren. Trotz des fehlenden Augenlichts nahmen sie alles um sich herum wahr, schärfer und deutlicher als andere Vampire. Wie hungrige Spinnen liefen sie auf allen Vieren neben Kelly her.
Normalerweise hätte Kellys vampirischer Instinkt, der sie zu einst geliebten Menschen trieb, ausgereicht, um Ephs Aufenthaltsort zu bestimmen. Doch der Alkohol und all die anderen Aufputsch- und Beruhigungsmittel, die er regelmäßig konsumierte, beeinflussten sein Nervensystem und die Gehirntätigkeit so sehr, dass sein »Signal« stark abgeschwächt wurde – so wie eine Radioübertragung durch atmosphärische Störungen.
Der Meister aber hatte ein spezielles Interesse an Ephraim Goodweather; vor allem wollte er wissen, wie und wohin sich Eph innerhalb der Stadt bewegte. Deshalb hatte er Kelly die beiden Späher mitgegeben – früher Bruder und Schwester, waren sie jetzt nicht mehr auseinander zu halten, nachdem ihr Haar ausgefallen war und sie ihre Genitalien und anderen menschlichen Geschlechtsmerkmale verloren hatten. Die beiden liefen ihr voraus auf das Haus zu und warteten aufgeregt am Gartenzaun, bis sie sie endlich einholte.
Kelly öffnete das Gartentor und schlich vorsichtig einmal um das Haus herum. Ihre Vampirsinne registrierten keine Anzeichen für eine Falle. Schließlich ging sie zu einem der kleinen Fenster im Erdgeschoss, schlug mit dem Handballen ein Loch in das Glas, griff hindurch und zog den Fenstergriff nach unten.
Blitzschnell sprangen die Späher an ihr vorbei in das Haus. Kelly schob zunächst ein nacktes, dreckiges Bein durch das Fenster und verkrümmte sich dann mühelos so weit, dass ihr Körper durch die schmale Öffnung passte. Im Wohnzimmer stiegen die Späher wie Polizeihunde über das Sofa und suchten nach einer Spur, während Kelly für einen Moment still verharrte und in die Wohnung hinein horchte.
Sie waren allein.
Sie waren zu spät gekommen.
Aber Eph war hier gewesen. Und das war noch nicht allzu lange her.
Jetzt liefen die Späher zu einem der Fenster, die nach Norden gingen, und berührten das Glas, als könnten sie dadurch vergangene Ereignisse wieder aufleben lassen. Dann wandten sie sich unvermittelt ab und rannten die Treppe hoch. Kelly folgte ihnen und fand sie schließlich in Zacks Zimmer, wo sie hektisch hin und her sprangen, all ihre Sinne auf die Spuren gerichtet, die Eph hier hinterlassen hatte – wie Tiere, die von einem überwältigenden, ihnen jedoch unverständlichen Impuls geleitet wurden.
Kelly sah sich um. Die Hitze, die ihr vampirischer Stoffwechsel erzeugte, ließ die Temperatur im Raum um einige Grad ansteigen. Im Gegensatz zu Eph überkamen sie hier – in ihrem früheren Haus, im ehemaligen Zimmer ihres Sohnes – keinerlei nostalgische Empfindungen. Keine Wehmut. Kein Gefühl des Bedauerns. Ja, sie hatte überhaupt keine emotionale Verbindung mehr zu diesem Ort, so wie sie auch keine emotionale Verbindung mehr zu ihrer menschlichen Vergangenheit hatte. Der Schmetterling blickt nicht auf sein Leben als Raupe zurück – er fliegt einfach davon.
Ihre Gefühle waren nun anderer Art, und das stärkste dieser neuen Gefühle empfand sie jetzt – als plötzlich ein Summen in ihrem Körper erklang. Etwas war in ihrem Kopf, war überall in ihr. Eine Präsenz. Der Meister.
Der Meister sah mit ihren Augen. Fühlte mit ihren Sinnen. Erkannte, dass Ephraim Goodweather vor Kurzem hier gewesen war …
Und dann, so plötzlich, wie es gekommen war, verstummte das Summen wieder. Kelly spürte keine Vorwürfe von Seiten des Meisters dafür, dass sie Eph so knapp verpasst hatte. Nein, sie spürte, dass sie dem Herrn der Vampire nach wie vor von großem Nutzen war – wegen ihrer Verbindung zu Eph.
Und wegen ihrer Verbindung zu Zack.
Noch immer sehnte sich Kelly Goodweather danach, ihren Sohn in einen Vampir zu verwandeln. Dieses Verlangen erzeugte eine Leere in ihr. Sie brauchte ihren Sohn, um Vollkommenheit zu erlangen; alles andere widersprach ihrer vampirischen Natur. Aber sie ertrug den nagenden Schmerz in ihrem Inneren – weil der Meister es so wollte. Es war sein Wille, dass Zack ein Mensch blieb. Dass ihr Sohn unvollendet blieb. Der Meister hatte ihr keinen Grund dafür genannt – es stand ihr offenbar noch nicht zu, diesen Grund zu kennen.
Alles, was ihr zustand, war, Zack an der Seite des Meisters zu sehen.
Während Kelly die Treppe wieder hinunterging, strichen die Späher um ihre Beine. Sie durchquerte das Wohnzimmer und sprang durch die Fensteröffnung nach draußen. Es hatte inzwischen zu regnen begonnen; dicke, schwarze Tropfen prasselten auf Kellys erhitzte Haut und verdampften zu winzigen Wölkchen. Sie stand in der Mitte der Straße. Lauschte. Spürte Ephs pulsierendes Blut … Nun, da sich der Alkohol langsam daraus verflüchtigte, war es wieder deutlicher.
Einen Schweif aus Dampf hinter sich lassend, lief Kelly die Straße hinunter, die beiden Späher ihr immer einen Schritt voraus. Doch dann, während sie sich einer U-Bahn-Station näherten, wurde das Signal wieder schwächer. Die Distanz zwischen ihnen und Eph nahm schlagartig zu. Er war in einem Zug.
Er war auf dem Weg zurück nach Manhattan.
Die Farrell
Das Pferd galoppierte los und ließ eine Wolke aus schwarzem Rauch und orangenen Flammen hinter sich.
Das Pferd brannte.
In Feuer gehüllt stürmte das Tier vorwärts, aber es rannte nicht aus Schmerz, sondern aus purem Verlangen. Ohne Reiter, ohne Sattel schoss es wie ein brennender Pfeil durch die Nacht, lief über das flache, karge Land, galoppierte auf das Dorf zu. Auf Vasiliy Fet zu.
Er war von diesem Anblick wie gelähmt. Er wusste, dass das Pferd auf ihn zukam. Ja, er erwartete es geradezu.
Und dann, kurz bevor es ihn erreichte, senkte das Pferd plötzlich den Kopf und sprach – so natürlich, wie Pferde in einem Traum eben zu sprechen vermochten. »Ich lebe«, sagte es.
Und Vasiliy schrie.
Und schlug die Augen auf.
Er lag in der Schlafkoje eines hin- und herschwankenden Schiffes. Alle Gegenstände in der Koje waren mit Netzen gesichert. Die anderen Betten waren hochgeklappt; Vasiliy war der einzige, der sich aufs Ohr gelegt hatte.
Dieser Traum – es war immer derselbe Traum – suchte ihn seit seiner Jugend regelmäßig heim. Das brennende Pferd, das in der Dunkelheit auf ihn zulief … Das ihn aufweckte, kurz bevor es ihn erreichte … Die tiefe, blanke Angst, die er nach dem Aufwachen empfand … Die Angst eines kleinen Kindes …
Er griff nach der Stofftasche unter dem Bett. Sie war feucht – alles auf dem Schiff war feucht –, aber der Knoten, mit dem er sie festgezurrt hatte, hielt. Die Sachen in der Tasche waren sicher verwahrt.
Sie kamen von Island zurück und hielten auf die amerikanische Ostküste zu.
Der Name des Schiffes war Farrell, ein stattliches Fischerboot, das man schon früher dazu benutzt hatte, Marihuana zu schmuggeln. Und das war – da den Vampiren der Zugang zum Meer verwehrt war – immer noch ein recht einträgliches Geschäft. Vasiliy hatte das Boot im Tausch gegen ein Dutzend kleinerer Waffen und so viel Munition gechartert, dass die Besatzung auf Jahre hinaus ihre Schmuggelgeschäfte fortsetzen konnte. Unter der Herrschaft der Vampire waren Drogen streng verboten, und so beschränkte sich der Handel damit auf selbstgepflanztes Marihuana und selbstgekochtes Meth. Außerdem transportierte das Schiff hin und wieder selbstgebrannten Schnaps oder, wie jetzt gerade, kistenweise besten isländischen und russischen Wodka.
Vasiliy Fet, in seinem früheren Leben Kammerjäger beim Amt für Schädlingsbekämpfung der Stadt New York, hatte die Reise nach Island aus zwei Gründen unternommen. Zum einen wollte er die Universität in Reykjavik besuchen. In den Monaten nach den Nuklearexplosionen, während sie im Tunnel unter dem Hudson darauf gewartet hatten, dass die Luft an der Oberfläche wieder atembar sein würde, hatte Vasiliy immer wieder das Buch durchgeblättert – jenes Buch, für das Professor Abraham Setrakian sein Leben gegeben hatte. Das Buch, das der alte Mann vor seinem Tod ihm, Vasiliy Fet, anvertraut hatte. Das Occido Lumen. »Das gefallene Licht«, wie Setrakian es genannt hatte.
489 Seiten handbeschriebenes Pergament, dazu zwanzig Illustrationen, in Leder gebunden und zum Schutz gegen Vampire mit hauchdünnen Silberplatten versehen. Das Occido Lumen basierte auf einer Sammlung von Tontafeln aus mesopotamischen Zeiten, die von den Anfängen der Vampirseuche berichteten und im Jahre 1508 in einer Höhle im Zagrosgebirge entdeckt worden waren. Die äußerst zerbrechlichen Tafeln mit der sumerischen Schrift fielen ein Jahrhundert später in die Hände eines französischen Rabbis, der sie – lange bevor Übersetzungen aus dem Sumerischen üblich wurden – in mühevoller Kleinarbeit entzifferte. Als er mit der Übertragung fertig war, machte der Rabbi sein illustriertes Manuskript König Louis XIV. zum Geschenk – und wurde dafür in den Kerker geworfen.
Auf Befehl des Königs wurden die Tontafeln vernichtet, und das Buch des Rabbis, das Occido Lumen, verschwand. Aber nicht für immer: 1671 entdeckte es die Mätresse des Königs, die dem Okkulten zugeneigt war, im Gewölbe des Palastes, und von nun an galt es als »verflucht«. Wann immer es auftauchte, etwa in den Jahren 1823 und 1911, war sein Erscheinen mit dem Ausbruch einer rätselhaften Epidemie verbunden. Und dann – nach der Ankunft des Meisters in New York und dem Beginn der Vampirseuche – stand es bei Sotheby’s in Manhattan zur Auktion. Und Abraham Setrakian konnte es mit Unterstützung der Alten – jener anderen Ur-Vampire, gegen die sich der Meister erhoben hatte – ersteigern.
Vor langer Zeit hatte der Professor seine geliebte Frau an die Vampire verloren und sich daraufhin geschworen, die strigoi zu jagen und zu vernichten – und im Occido Lumen sah er den Schlüssel für das Verständnis jener furchtbaren Seuche, die die Menschheit befallen hatte. Nach außen betrieb er eine Pfandleihe in Spanish Harlem; aber in seinem Keller hatte er neben einer Menge Waffen, die im Kampf gegen die Vampire von Nutzen waren, unzählige Bücher angehäuft, in denen die strigoi erwähnt wurden. Sein Wunsch, den Geheimnissen des Occido Lumen auf die Spur zu kommen, war so stark gewesen, dass er schließlich sein Leben dafür geopfert hatte, dass Vasiliy das Buch nun in Händen hielt.
So viele Geheimnisse … Irgendjemand musste das Occido Lumen zur Auktion gestellt haben, musste es in seinem Besitz gehabt haben. Aber wer? Vielleicht wusste dieser Jemand ja mehr über den Inhalt, über die magische Kraft des Buches. Als sie schließlich den Tunnel unter dem Hudson hatten verlassen können, war Vasiliy den Text mit einem Lateinwörterbuch durchgegangen und hatte versucht, die Worte so gut es ging zu verstehen. Außerdem hatte er dem Sotheby’s-Gebäude an der Upper East Side einen weiteren Besuch abgestattet – und herausgefunden, dass die Erlöse aus der Versteigerung des Occido Lumen an die Universität Reykjavik gegangen waren. Nora und er hatten Nutzen und Risiken einer Reise nach Island sorgfältig abgewogen, aber beiden war klar, dass es die einzige Möglichkeit war, herauszufinden, wer das mysteriöse Buch versteigern hatte lassen.
In Island angekommen, musste Vasiliy allerdings feststellen, dass die Vampire die Universität verwüstet hatten. Er hatte gehofft, die Isländer hätten so schnell und konsequent auf die Vampirseuche reagiert wie die Briten, die den Kanaltunnel gesprengt und großflächig Jagd auf die Kreaturen gemacht hatten; mit dem Ergebnis, dass Großbritannien – auch wenn es vom Rest der Welt völlig isoliert war – heute nahezu vampirfrei war.
Vasiliy wartete, bis das spärliche Sonnenlicht endlich durch die Wolken brach, dann wagte er sich in das Universitätsgebäude. In den Büros herrschte ein heilloses Durcheinander, aber er fand schließlich heraus, dass es die Universitätsverwaltung gewesen war, die das Occido Lumen zur Auktion freigegeben hatte, kein bestimmter Professor oder Förderer der Universität, wie er es sich erhofft hatte. War die lange Reise in dieser Hinsicht also völlig umsonst gewesen? Nicht ganz: In der ägyptologischen Fakultät stieß er auf ein ledergebundenes Buch, 1920 in Frankreich erschienen, auf dessen Einband Sadum et Amurah geschrieben stand. Sadum, Amurah – es waren genau diese beiden Worte, die Abraham Setrakian Vasiliy aufgetragen hatte, nie zu vergessen … Obwohl er kein Französisch konnte, nahm er das Buch mit.
Aber es gab noch einen zweiten Grund für seine Reise nach Island – und hier hatte er weitaus mehr Erfolg. Schon bald nachdem er die Geschäftsbeziehung mit den Drogenschmugglern eingegangen war – als ihm klargeworden war, wie weit die Kontakte dieser Leute reichten –, hatte Vasiliy von ihnen verlangt, ihm einen Nuklearsprengkopf zu verschaffen. Das klang verwegener, als es tatsächlich war: So waren etwa in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, wo die strigoi inzwischen die totale Kontrolle ausübten, etliche sogenannte »Kofferbomben« von Ex-KGB-Offizieren aus den Beständen entwendet worden und nun in mehr oder weniger gutem Zustand auf den Schwarzmärkten Osteuropas erhältlich. Der Meister wollte den Planeten mit aller Macht von diesen Waffen säubern, damit sie nicht dazu verwendet werden konnten, seine Herkunftsstätte zu vernichten – so wie er es mit den Herkunftsstätten der sechs anderen Alten gemacht hatte –, und das bewies Vasiliy und seinen Gefährten, dass der König der Vampire verwundbar war. Und irgendwo auf den Seiten des Occido Lumen, davon war Professor Setrakian überzeugt gewesen, war der Ort dieser Herkunftsstätte, der Ort, an dem der Meister einst zum ersten Mal als Vampir auf Erden erschienen war, verzeichnet …
Vasiliy bot eine stattliche Menge an Silber für eine solche Bombe, und die Schmuggler hörten sich bei ihren Seemannskameraden um. Geraume Zeit später kontaktierten sie ihn und sagten, sie hätten eine Überraschung für ihn. Vasiliy war skeptisch, aber wenn man verzweifelt ist, hält man sich an jedem Strohhalm fest, und sei er noch so dünn. Und so trafen sie sich nach seinem Besuch in der Universität auf einer kleinen Vulkaninsel südlich von Island mit einer Handvoll Ukrainer, die mit einer abgetakelten Jacht gekommen waren, an deren Heck sechs Außenbordmotoren hingen. Ihr Kapitän war höchstens Mitte zwanzig und konnte nur noch eine seiner Hände benutzen; sein linker Arm war klauenartig verkrümmt.
Die Bombe sah allerdings überhaupt nicht wie ein Koffer aus. Eher wie ein kleines Fass oder eine Mülltonne. Sie war mit einer schwarzen Plane umwickelt, die mit grünen Bändern festgezurrt war, und etwa einen Meter hoch und einen halben Meter breit. Vasiliy versuchte sie zu heben – sie wog bestimmt an die fünfzig Kilo.
»Und die funktioniert wirklich?«, fragte er.
Der Kapitän fuhr sich mit seiner intakten Hand durch den kupferfarbenen Bart und erwiderte mit starkem russischen Akzent: »Hat man mir gesagt. Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden … Ein Teil fehlt aber.«
»Es fehlt etwas? Lass mich raten. Das Plutonium?«
»Nein, Brennstoff genug. Sprengkraft eine Kilotonne. Zündvorrichtung fehlt.« Der Kapitän deutete auf ein Bündel Drähte, das aus der Plane herausragte, und zuckte mit den Schultern. »Sonst alles gut.«
Vasiliy legte die Hand auf die Bombe. Eine nukleare Sprengkraft von einer Kilotonne entsprach tausend Tonnen TNT. Entsprach einer Schockwelle von einem Kilometer, die selbst die stärkste Stahlkonstruktion zerreißen konnte. »Ich wüsste wirklich gerne, wo ihr die herhabt.«
»Und ich, was Sie damit vorhaben.« Der Kapitän verzog den Mund zu einem verschmitzten Grinsen. »Besser, wenn jeder Geheimnis für sich behält.«
Vasiliy musste ebenfalls grinsen. »Gute Idee.«
Gemeinsam mit einem der ukrainischen Seeleute verstaute Vasiliy die Bombe auf der Farrell. Dann öffnete er das kleine Depot im stählernen Schiffsboden, wo er das Silber aufbewahrte. Die strigoi waren so verzweifelt hinter Silber her wie hinter Nuklearsprengköpfen, und so war der Wert des vampirtötenden Metalls in den letzten Jahren geradezu exponentiell angestiegen.
Als das Geschäft schließlich abgeschlossen war – inklusive des Tauschs einiger Flaschen Wodka gegen Tabak –, stießen die beiden Schiffscrews darauf an.
»Sie Ukrainer?«, fragte der Kapitän Vasiliy, nachdem er einen ordentlichen Schluck Schnaps genommen hatte.
Vasiliy nickte. »Sieht man das?«
»Ja. Sie sehen aus wie Leute aus meinem Dorf. Bevor es verschwand.«
»Verschwand?«
Der junge Kapitän hob seinen verkümmerten Arm. »Tschernobyl.«
Vasiliy runzelte die Stirn und blickte auf die Bombe, die sie an einer Seitenwand festgezurrt hatten. Kein Blinken, kein Tick-tick-tick. Ein schlafendes Biest, das darauf wartete, dass man es weckte. Oder vielleicht doch nur ein Haufen Schrott? Nein, Vasiliy vertraute darauf, dass die Ukrainer zuverlässige Lieferanten hatten; außerdem wollten die Schmuggler weiterhin Geschäfte mit ihm machen. Er war ziemlich aufgekratzt, ja, seit langer Zeit spürte er zum ersten Mal wieder so etwas wie Zuversicht. Er besaß nun eine geladene Waffe – und benötigte nur noch den Abzug dafür. Den Zünder.
Während seines Aufenthalts auf Island hatte er eine interessante Beobachtung gemacht: Eine Gruppe Vampire war in einem geologisch äußerst aktiven Gebiet in der Nähe von Reykjavik – »Black Pool« genannt – mit Ausgrabungen beschäftigt gewesen. Vasiliy zog daraus den Schluss, dass der Meister den genauen Ort seiner Herkunftsstätte selbst nicht kannte und seine Schergen aussandte, um danach zu suchen.
Dieser Ort aber war auf den Seiten des Occido Lumen zu finden – Vasiliy musste es nur noch entschlüsseln. Doch das war leichter gesagt als getan. Wäre das Occido Lumen eine simple Anweisung für die Vernichtung von Vampiren gewesen, hätte der ehemalige Kammerjäger Vasiliy Fet damit keinerlei Probleme gehabt; stattdessen aber wimmelte es in dem Buch von unverständlichen Allegorien, verwirrenden Erklärungen und rätselhaften Abbildungen. Es beschrieb, soviel hatte er verstanden, eine Geschichte der Menschheit, die nicht von Evolution und Zufall bestimmt war, sondern von der lenkenden Hand der Alten. Aber die Worte waren mehr als nur doppeldeutig; Vasiliy und die anderen hatten einfach nicht das nötige Hintergrundwissen, um sie wirklich verstehen zu können. Ohne Professor Setrakians Kenntnisse, die sich dieser über viele Jahrzehnte angeeignet hatte, war das Occido Lumen in etwa so nützlich wie ein nuklearer Sprengsatz ohne Zündvorrichtung.
Trotzdem: Sie machten Fortschritte. Vasiliy hatte seinen Optimismus nicht verloren … Jetzt hielt er sich an der Reling fest und sah auf das aufgewühlte Meer. Heute Nacht würde Nebel aufziehen, aber es würde nicht regnen. Zumindest hoffte er das. Die dramatischen Veränderungen in der Atmosphäre hatten die Seefahrt zu einer gefährlichen Angelegenheit gemacht; es war praktisch unmöglich, eine verlässliche Wettervorhersage zu erstellen. Und es gab noch andere Gefahren: In diesem Moment fuhr die Farrell durch einen riesigen Schwarm Quallen, eine Spezies, die sich explosionsartig im Meer ausgebreitet hatte und wie eine Puddinghaut weite Abschnitte des Ozeans bedeckte. Was ging in den lichtlosen Tiefen darunter vor sich? Welche Kreaturen wuchsen dort heran?
Etwa zehn Meilen von der Küste entfernt passierten sie New Bedford, Massachusetts – und Vasiliy musste an Setrakians Aufzeichnungen denken, die ihm der alte Professor zusammen mit dem Occido Lumen hinterlassen hatte. Setrakian hatte sich Berichte über die Winthrop-Flotte notiert, die 1630, zehn Jahre nach der Mayflower, über den Atlantik in die Neue Welt gefahren war. Eines der Schiffe dieser Flotte, die Hopewell, hatte drei Kisten aus kunstvoll verziertem Holz transportiert, über deren Inhalt niemand etwas wusste. Dann, nachdem sie bei Salem, Massachusetts, an Land gegangen und sich, wegen des leichten Zugangs zu Frischwasser, in Boston niedergelassen hatten, brach unter den Pilgern das Grauen aus. Zweihundert von ihnen verloren im Laufe eines Jahres ihr Leben. Offiziell wurde ihr Tod einer geheimnisvollen Seuche zugeschrieben, aber Vasiliy wusste natürlich, woran sie wirklich gestorben waren: Sie waren den Alten zum Opfer gefallen, die die Pilger, ohne es zu ahnen, in die Neue Welt gebracht hatten.
Setrakians Tod hatte in Vasiliy eine große Leere hinterlassen. Er vermisste die Ratschläge des Professors; er vermisste die Gespräche, die sie miteinander geführt hatten; vor allem aber vermisste er dessen scharfen Verstand. Setrakians Tod war nicht nur ein schwerer Schlag für Vasiliy Fet, sondern für die gesamte Menschheit. Der alte Mann hatte sich geopfert, um das Occido Lumen für die Menschen zu bewahren – aber er hatte ihnen keine Anleitung hinterlassen, wie sie es entziffern konnten. Und so verbrachte Vasiliy Tage um Tage damit, den geheimnisvollen Text ebenso zu studieren, wie er Setrakians Notizbücher studierte, ein wirres Konvolut aus wissenschaftlichen Theorien, alltäglichen Beobachtungen, Einkaufslisten und Finanzangelegenheiten.
Und nun hatte er einen weiteren Text, von dem er kein Wort verstand – das französische Buch, das er in Reykjavik entdeckt hatte. Er zog es aus der Jackentasche und schlug es auf. Auch dieses Buch enthielt einige ganzseitige Illustrationen. Auf einer davon sah man einen alten Mann, der mit seiner Frau aus einer brennenden Stadt flieht und gewahr wird, dass die Frau zu einer Salzsäule erstarrt ist. Das zumindest sagte Vasiliy etwas: das Alte Testament, Lot und seine Ehefrau, die sich verbotenerweise umdreht … Eine andere Abbildung zeigte den alten Mann, wie er sich schützend vor zwei übernatürlich schöne Flügelwesen stellt, zwei von Gott gesandte Erzengel … Vasiliy klappte das Buch zu und sah sich einmal mehr den Einband an. Sadum et Amurah.
»Sodom und Gomorra«, flüsterte er. »Sadum und Amurah sind Sodom und Gomorra …« Und plötzlich erinnerte er sich an eine praktisch identische Abbildung im Occido Lumen – nicht in der Art und Weise, wie sie gemalt war, aber was ihren Inhalt anging: Lot, der die Erzengel vor jenen zu beschützen versucht, die sie vernichten wollen.
Es war wie bei einem Puzzle: Die einzelnen Teile lagen alle vor ihm, aber Vasiliy wusste nicht, wie er sie zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügen sollte. Ja, selbst seine Hände – rau und groß wie Baseballhandschuhe, die Hände eines Kammerjägers – schienen völlig ungeeignet für den Umgang mit dem Occido Lumen. Warum hatte der alte Professor das Buch gerade ihm anvertraut und nicht Eph? Ohne Zweifel war Ephraim Goodweather der Klügere und Belesenere von ihnen beiden. Und vermutlich konnte er auch Französisch … Aber Setrakian hatte ihn, Vasiliy, so gut gekannt, dass er wusste, Vasiliy würde eher sterben, als das Buch dem Meister zu überlassen. Und er hatte Vasiliy geliebt, so wie ein Vater seinen Sohn liebt. Er hatte ihn nie spüren lassen, er sei zu langsam oder zu ungebildet, ganz im Gegenteil – er hatte jedes Detail mit großer Sorgfalt und Geduld erläutert und so Vasiliy das Gefühl gegeben, dazu zu gehören, Teil von etwas zu sein. Das war sein größtes Geschenk gewesen.
Die Wunde in Vasiliys Innerem, die der Tod des Professors geschlagen hatte, wurde jedoch auf völlig unerwartete Weise gelindert. Seit Ephs Verhalten immer erratischer und zwanghafter geworden war – das hatte schon in den Monaten im Tunnel begonnen und war nach ihrer Rückkehr an die Oberfläche nur noch stärker geworden –, hatte sich Nora Martinez an Vasiliy gewandt, wenn sie einen Rat brauchte oder einfach nur die Nähe zu einem anderen Menschen suchte. Und im Laufe der Zeit hatte Vasiliy gelernt, auf ihre Annäherungen zu reagieren. Er bewunderte Noras Kraft angesichts der verzweifelten Lage, in der sie sich befanden. Viele andere waren unter dieser Last zusammengebrochen, waren wahnsinnig geworden oder hatten, wie Eph, einen Persönlichkeitswandel durchgemacht – aber nicht Nora. Und offenbar sah sie ihrerseits auch etwas in Vasiliy – vielleicht das, was auch der Professor in ihm gesehen hatte: eine innere Würde und Größe, derjenigen eines Lasttiers nicht unähnlich. Vasiliy hatte nie darüber nachgedacht, aber wenn diese Qualitäten – Standhaftigkeit, Willensstärke, womöglich auch eine gewisse Skrupellosigkeit – ihn in Noras Augen attraktiver machten, dann sollte ihm das nur recht sein.
Um Eph nicht zu verletzen, hatte er sich zunächst dagegen gesträubt, mit Nora irgendeine Art von Verhältnis einzugehen, und seine Gefühle unterdrückt. Aber es war inzwischen unübersehbar, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlte. Am Vorabend seiner Abreise nach Island saß er beim Essen neben ihr, und sein Bein berührte ihr Bein. Nichts Ungewöhnliches unter Freunden – aber ungewöhnlich für Vasiliy, einem großen, korpulenten Mann, der sich des Raumes, den er einnahm, nur allzu bewusst war und deshalb instinktiv Distanz zu seinen Mitmenschen hielt. Aber jetzt lehnte sein Knie an Noras Knie, und sein Herz schlug schneller, als ihm bewusst wurde, dass sie sich nicht gegen die Berührung sperrte, sondern dass sie im Gegenteil ihr Knie an seines drückte …
Später bat sie ihn, auf der Reise auf sich Acht zu geben, und als sie das sagte, sah er ein feuchtes Schimmern in ihren Augen.
Nie zuvor hatte jemand wegen Vasiliy Fet Tränen in den Augen gehabt.
Manhattan
Eph nahm die Linie 7 stadteinwärts. Die Hände an den Fensterrahmen geklammert, die Füße auf der schmalen Stahltreppe, hing er am hinteren Ende des letzten Waggons und schaukelte im Rhythmus des fahrenden Zuges hin und her. Er hatte sich die Kapuze weit über den Kopf gezogen; Wind und Regen peitschten seine schwarzgraue Jacke.
Es war noch nicht allzu lange her, da hatten sich die Vampire an die Außenseite der U-Bahn-Waggons klammern müssen, um sich unentdeckt durch Manhattan bewegen zu können. Jetzt beobachtete Eph durch das Fenster, an dem er hing, die ausdruckslosen Gesichter der menschlichen Passagiere, ihre ins Nichts starrenden Blicke. Es schien wie eine ganz normale Alltagsszene, aber er wagte es nicht, länger hinzusehen – wenn strigoi im Zug waren, könnten sie ihm mit ihrer Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen, auf die Schliche kommen und ihm an der nächsten Station einen ungemütlichen Empfang bereiten. Eph war offiziell immer noch auf der Flucht; sein Foto hing in allen Polizeistationen und Postämtern der Stadt, und im Fernsehen wurde der Bericht über sein gelungenes Attentat auf den Milliardär Palmer Eldritch – eine ziemlich gut gemachte Fälschung –, Woche für Woche wiederholt, so dass sein Name und Gesicht dem aufmerksamen Bürger im Bewusstsein blieb.
Um sich effizient mit den Zügen durch die Stadt zu bewegen, bedurfte es einiger besonderer Fähigkeiten, die sich Eph im Laufe der Zeit angeeignet hatte. Die Tunnel waren feucht und stanken nach verbranntem Ozon und altem Öl, so dass seine zerrissene, verdreckte Kleidung in dieser Umgebung eine perfekte Tarnung war. Sich an einer anfahrenden U-Bahn festzuhalten, setzte außerdem präzises Timing voraus; doch dafür musste er sich nur ein paar Tricks aus seiner Kindheit in Erinnerung rufen. Damals in San Francisco hatte er sich an die berühmten Streetcars gehängt, um schneller zur Schule zu kommen. Und da hatte man auch genau den richtigen Moment erwischen müssen. Zu früh – und man wurde vom Schaffner entdeckt. Zu spät – und man kam ins Stolpern und knallte auf das Straßenpflaster.
Tatsächlich war Eph bei seinen U-Bahn-Fahrten schon einige Male ins Stolpern geraten und übel gestürzt – meistens wenn er zu viel getrunken hatte. Einmal, als der Zug in eine scharfe Kurve unter der Tremont Avenue fuhr, verloren seine Füße den Halt und er wurde einige Sekunden über das Gleisbett geschleift. Als er endlich losließ und gegen eine der Schienen prallte, brach er sich dabei zwei Rippen und kugelte sich die Schulter aus. Er konnte sich gerade noch vor der nächsten U-Bahn in eine schmale Wartungsnische zwängen. Dort, umgeben von verdreckten Zeitungen und durchdringendem Uringestank, drückte er die Schulter wieder in das Gelenk – aber es gab immer noch Nächte, in denen er vor Schmerzen aufwachte, wenn er sich im Schlaf unabsichtlich darauf gelegt hatte.
Inzwischen allerdings, nach einiger Übung, wusste er, wie er auf der kleinen Treppe stehen und sich am Fensterrahmen festhalten musste, um nicht hinunterzufallen. Und er kannte jeden Zugtyp, jedes Waggonmodell. Außerdem besaß er zwei kurze Haken, die er in Sekundenschnelle in das Blech der Außenhülle schlagen konnte; er hatte sie aus dem Silberbesteck gefertigt, das er vor langer Zeit einmal mit Kelly gekauft hatte – was den Nebeneffekt hatte, dass er damit im Notfall einen Nahkampf mit den strigoi ausfechten konnte.
Die Haken waren mit hölzernen Griffen versehen – Teile der Beine des Mahagonitisches, den ihnen Kellys Mutter damals zur Hochzeit geschenkt hatte. Wenn seine Schwiegermutter nur wüsste, was aus dem Tisch geworden war … Aber sie hatte ihn ja ohnehin nie gemocht – »Er ist einfach nicht gut genug für meine Kelly!« – und inzwischen würde sie ihn wohl noch weniger ausstehen können.
Eph wandte sich um und blickte durch den schwarzen Regen auf die Häuserblocks links und rechts des Betonviadukts, das über dem Queens Boulevard verlief. Etliche davon sahen immer noch aus wie Ruinen – sie waren während des Aufstands ausgebrannt oder geplündert worden. Tatsächlich schien es, als wäre eine feindliche Armee durch die Stadt marschiert – und in gewisser Weise war es ja auch so.
Es gab aber auch Häuser, deren Fenster beleuchtet waren und die auch sonst ganz normal wirkten – die Häuser in jenen Zonen, die auf Geheiß des Meisters von der Stoneheart Foundation wiederaufgebaut worden waren. Künstliches Licht war ein entscheidender Faktor in einer Welt, die zweiundzwanzig Stunden am Tag in Dunkelheit gehüllt war. Die von den Nuklearexplosionen ausgelösten elektromagnetischen Schockwellen hatten die meisten Stromkraftwerke zum Kollabieren gebracht und so die Welt in Dunkelheit gestürzt. Und schlagartig war den Menschen bewusst geworden, dass eine überlegene Spezies die Macht auf dem Planeten übernommen und Homo sapiens an der Spitze der Nahrungskette abgelöst hatte – eine Spezies, die sich von menschlichem Blut ernährte. Panik und Verzweiflung hatten sich auf allen Kontinenten ausgebreitet. Auch die hochgerüsteten Armeen der Menschen hatten den Invasoren nichts entgegenzusetzen; das Virus hatte auch vor den Soldaten nicht haltgemacht. Und in der Zeit der Konsolidierung nach »Night Zero«, während sich die Atmosphäre vom gröbsten Gift reinigte, errichteten die Vampire ihre neue Weltordnung …
Ein Quietschen riss Eph aus seinen Gedanken. Der Zug näherte sich Queensboro Plaza und bremste ab. Eph nahm die Füße von der Treppe und hängte sich mit den Haken so an die Außenwand, dass man ihn vom Bahnsteig aus nicht sehen konnte. Der unaufhörliche Regen war letztlich doch zu einer Sache gut: Er trübte die Sicht der rotäugigen Vampire.
Eph hörte, wie sich die Türen öffneten und Fahrgäste ein- und ausstiegen. Die automatische Ansage dröhnte aus den Lautsprechern. Dann schlossen sich die Türen, und der Zug setzte sich erneut in Bewegung. Mit schmerzenden Fingern hängte sich Eph wieder an das Fenster und sah, wie der Bahnsteig in der Ferne verschwand – so wie die Welt der Vergangenheit vor seinen Augen verschwand, schrumpfte, verblasste, vom vergifteten Regen und der Nacht verschluckt wurde.
Kurz darauf verließ die Linie 7 die Oberfläche, entkam dem prasselnden Regen und fuhr nach zwei weiteren Stationen in den Steinway Tunnel, der unter dem East River hindurchführte. Es waren solche Errungenschaften moderner Technik wie ein Tunnel unter einem reißenden Fluss, die entscheidend zur Niederlage der Menschheit beigetragen hatten; indem sie sich Eisenbahntunnels, Linienmaschinen und andere Möglichkeiten der Fortbewegung zunutze machten, umgingen die Vampire den Nachteil, dass sie von Natur aus nicht in der Lage waren, durch eigene Kraft fließendes Wasser zu überqueren.
Der Zug wurde langsamer, als er sich der Grand Central Station näherte. Endlich! Eph, der sich beharrlich an den selbstgebastelten Haken festhielt und gegen die Erschöpfung ankämpfte, justierte seinen Griff neu. Er wusste, dass er seinen Körper nicht gut behandelte: Er war so dünn wie in seinem ersten Jahr an der Highschool und hatte sich an das ständig nagende Gefühl in seinem Bauch gewöhnt; obwohl ihm nur allzu bewusst war, dass ein andauernder Mangel an Proteinen und Vitaminen nicht nur Knochen und Muskeln schädigte, sondern auch das Gehirn.
Kurz bevor der Zug zum Stillstand kam, löste Eph seinen Griff, sprang auf das Schotterbett zwischen den Gleisen und rollte sich – fast schon wie ein professioneller Stuntman – ab. Dann stand er auf, streckte seine arthritisartig verkrampften Finger und verstaute die beiden Haken in der Baseballtasche. Er sah, wie die Lichter des Zuges langsam im Tunnel verschwanden, und hörte, wie der Stahl der Räder gegen den Stahl der Gleise gedrückt wurde – ein metallisches Kreischen, an das er sich wohl nie gewöhnen würde.
Er wandte sich um und ging leicht hinkend in die entgegengesetzte Richtung – in den Tunnel hinein. Er kannte sich in diesem Abschnitt des New Yorker U-Bahn-Systems so gut aus, dass er hier kein Nachtsichtgerät benötigte, um zur nächsten Nebenstation zu finden. Auch die stromführende Schiene war, was das anging, kein Problem – sie war mit einer Holzverkleidung gesichert und bot sogar eine willkommene Hilfe, um auf den verlassenen Bahnsteig zu gelangen.
Ganz offensichtlich waren die Renovierungsarbeiten an der Station unterbrochen worden, kaum dass sie begonnen hatten: Da stand noch ein Gerüst; da lagen übereinandergelegte Rohre, in Plastikfolie verpackte Schläuche und überall Werkzeug auf dem Boden. Eph schlug die Kapuze zurück, holte das Nachtsichtgerät aus der Tasche, setzte es auf und klappte die Linse vor das rechte Auge. Das erbsengrüne Bild zeigte ihm, dass sich seit seinem letzten Besuch nichts Außergewöhnliches ereignet hatte. Beruhigt ging er auf eine unbeschriftete Tür zu.
Früher – vor dem Ausbruch der Vampirseuche – waren bis zu einer halben Million Menschen täglich über den marmornen Boden des Grand Central Terminals über ihm gelaufen. Jetzt war es viel zu gefährlich, die kathedralenartige Halle zu betreten – sie bot kaum Möglichkeiten, sich zu verstecken –, aber einmal war Eph auf die Galerie direkt unter dem Dach gestiegen und hatte von dort aus die steinernen Überreste einer versunkenen Zeit betrachtet: das MetLife Building und das Chrysler Building, dunkel und still vor dem nächtlichen Himmel. Ja, er war sogar auf die überdimensionale Klimaanlage geklettert und hatte einen Blick auf die 42nd Street und die Park Avenue riskiert, zwischen den riesigen Statuen der römischen Götter Minerva, Herkules und Merkur stehend, die über der berühmten Uhr aus Tiffany-Glas thronten. Von der Mitte des Daches aus hatte er schließlich mehr als dreißig Meter hinunter in die Bahnhofshalle geblickt. Näher war er ihr nicht gekommen.
Jetzt öffnete er vorsichtig die Tür und spähte mit dem Nachtsichtgerät in die Dunkelheit dahinter. Keine Vampirspuren zu sehen! Er ging eine Treppe zwei Stockwerke nach oben und betrat durch eine weitere unverschlossene Tür einen langen Korridor. Dicke Heizungsrohre verliefen hier am Boden, immer noch in Betrieb, ächzend vor Hitze. Schweißperlen bildeten sich auf Ephs Stirn, während er den Gang hinunter und durch die nächste Tür ging.
Ab hier war äußerste Vorsicht geboten – der schmale, von Betonwänden eingefasste Notausgang war der denkbar schlechteste Ort, um Vampiren über den Weg zu laufen. Eph zog ein kleines Silbermesser aus der Tasche und ging langsam über den mit schwarzen Wasserpfützen bedeckten Boden. Früher waren in diesem Teil des U-Bahn-Systems regelmäßig Wartungsarbeiter unterwegs gewesen und hatten Obdachlose oder sonstige Störenfriede hinausgeworfen. Dann hatten die strigoi die Kontrolle über dieses unterirdische Reich übernommen – hatten sich dort versteckt, sich genährt, sich vermehrt. Nun, nachdem der Meister die Atmosphäre des Planeten so verändert hatte, dass die Vampire die ultravioletten Strahlen der Sonne nicht mehr zu fürchten brauchten, hatten sie das Kellerlabyrinth verlassen und die Oberfläche für sich reklamiert.
An der letzten Tür ganz am Ende des Ganges war ein weiß-rotes Schild angebracht: NOTAUSGANG – ACHTUNG ALARM! Eph steckte das Messer und das Nachtsichtgerät zurück in die Tasche und drückte dann gegen die Verriegelung; er wusste, dass die Drähte, die zur Alarmanlage führten, schon vor langem durchtrennt worden waren.
Aus dem strömenden Regen schlug ihm ein nach Fäulnis riechender Wind ins Gesicht. Er zog sich die Kapuze über und ging die 45th Street hinunter. Noch immer waren die Straßen voller Autos, die in den Kämpfen zerstört oder aufgegeben worden waren, so dass sich die Versorgungsfahrzeuge der Vampire und der Stoneheart-Angestellten mühsam einen Weg bahnen mussten. Eph hielt den Kopf gesenkt und sah zu, wie seine Füße das Wasser in den Pfützen aufwirbelten. Trotzdem achtete er aufmerksam auf das, was rechts und links von ihm geschah. Er hatte es sich angewöhnt, sich nicht zu offensichtlich umzusehen, wenn er durch die Straßen New Yorks ging – es gab zu viele Fenster, zu viele Vampiraugen. Und wenn man verdächtig aussah, war man auch verdächtig.
Mit schnellen Schritten ging er hinüber zur First Avenue und dann auf das türkisgrüne Gebäude der New Yorker Gerichtsmedizin zu, das zwischen dem Bellevue Hospital und dem University Medical Center lag. Durch die halb offen stehende Krankenwagen-Zufahrt gelangte er ins Innere und betrat, vorbei an etlichen Bahren und Rollschränken, die zu Barrikaden umfunktioniert worden waren, schließlich den Obduktionssaal.