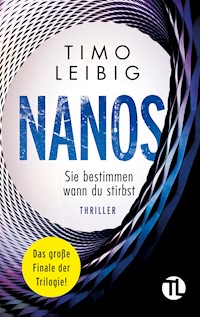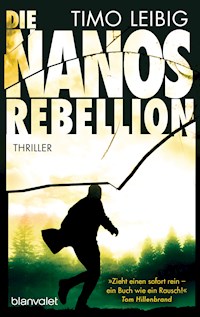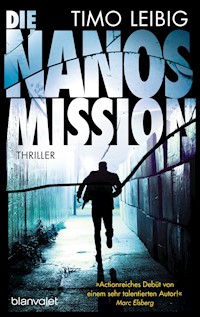
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Malek Wutkowski
- Sprache: Deutsch
Sie sind überall. Sie beherrschen jeden. Nur ein Mann ist frei. Nur ein Mann kann gegen sie kämpfen.
Deutschland 2028: Die Bevölkerung ist einem Kanzler hörig, der mit Nanoteilchen ihr Denken manipuliert. Nur wenige sind resistent gegen die Nanos – und versuchen, die Aufmerksamkeit des Regimes nicht auf sich zu ziehen. Während sich im Untergrund eine Rebellion zu einer gefährlichen Mission formiert, verfolgt der entflohene Sträfling Malek eigene Pläne. Er will seine frühere Komplizin Maria finden und vor dem Regime schützen. Doch dann erkennt er, dass zwischen ihm und seinem Ziel ein Mann steht: Kanzler Kehlis, der es persönlich auf Malek abgesehen hat.
Bei Penhaligon unter dem Titel »Nanos. Sie bestimmen, was du denkst« erschienen.
Alle Bücher der Malek-Wutkowski-Reihe:
Nanos – Sie bestimmen, was du denkst / Die Nanos-Mission
Nanos – Sie kämpfen für die Freiheit / Die Nanos-Rebellion
- Nominiert in der Kategorie »Bestes Buch« für den Seraph 2019; auf der Shortlist des Krefelder Phantastik-Preises 2020.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Deutschland 2028: Die Bevölkerung ist hörig. Dank Nanoteilchen in Lebensmitteln und im Trinkwasser glauben die Menschen alles, was ihnen die Regierungspartei weismacht. Nur wenige sind »free« – und sammeln sich im Untergrund zu einer Rebellion. Unter ihnen befindet sich der entflohene Sträfling Malek, ein Mann, der nur ein Ziel hat: überleben. Und wer wie er nichts zu verlieren hat, den kümmert auch kein Freiheitskampf – wäre da nicht jenes Versprechen, das er seinem besten Freund auf dem Totenbett gab …
Autor
Timo Leibig, geboren 1985, studierte interaktives Design und verbale Kommunikation. Seitdem arbeitet er als Schriftsteller und Webentwickler. Sieben Thriller und einen Fantasyroman hat er bislang veröffentlicht. Im Herbst 2018 erscheint sein Verlagsdebüt Nanos – Sie bestimmen, was du denkst. bei Penhaligon. Die Idee für den actiongeladenen Thriller um gedankenverändernde Nanotechnik hatte Timo bereits 2015 in einem Hamburgurlaub. Er fragte sich: Was wäre, wenn man das Denken der Bevölkerung manipulieren könnte – übers Essen?Weitere Informationen unter: www.timoleibig.deBesuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
TIMOLEIBIG
DIENANOS-MISSION
THRILLER
blanvalet
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Timo Leibig
Erstmals erschienen unter dem Titel »Nanos – Sie bestimmen, was du denkst«
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
© 2018 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Hanka Jobke
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: plainpicture/Mark Owen
BL · Herstellung: eR
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25899-3V001www.blanvalet.de
Für Arne Burkert
Kapitel 1
Bei München, Forschungslabor von SmartBrain, 26. Februar 2021, Testreihe CY
»Erzählen Sie mir, wie das Obduktionsergebnis Ihrer Mutter ausfiel.«
»Natürlicher Tod. Sie erlitt einen plötzlichen Herzstillstand.«
»Was haben Sie bei diesem Bericht empfunden?«
»Ich dachte, sauber und fundiert obduziert.«
»Haben Sie jemals den Verdacht gehegt, dass das Ergebnis gefälscht sein könnte?«
»Nein, niemals. Warum auch?«
»Sie waren weder bei dem Tod Ihrer Mutter noch bei der Obduktion anwesend. Sie haben nur den rechtsmedizinischen Bericht gelesen. Berichte können gefälscht sein.« Oder frei erfunden, doch diese Möglichkeit erwähnte Carl Oskar Fossey nicht.
»So wie Statistiken?« Der Proband mit der Registrierungsnummer CY173 versuchte den Kopf zu schütteln, doch die Vorrichtung, die seinen Kopf für die Elektroden in Position hielt, hinderte ihn daran. »Wussten Sie, dass ich früher als Controller in der Schadensregulierung eines großen Autokonzerns gearbeitet habe? Unser Motto war: Traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.«
»Bitte schweifen Sie nicht ab. Wir waren bei der Obduktion Ihrer Mutter.«
»Und was wollten Sie noch mal wissen?«
Carl mahnte sich zur Ruhe und wiederholte stoisch: »Ob Sie dem Bericht glauben, obwohl Sie nicht anwesend waren und offenbar wissen, wie leicht Berichte und Statistiken zu fälschen sind.«
CY173 zuckte mit den Achseln. »Ich sehe keinen Grund, den Bericht infrage zu stellen, egal ob ich nun dabei war oder nicht. Was hätte ich auch dort sollen?«
»Sich überzeugen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.«
»Sie mögen Andeutungen, oder?« Der Proband wollte den Arm heben, vielleicht um sich zu kratzen, doch der war am Probandenstuhl fixiert. So konnte er nicht aus Versehen die Schläuche und Manschetten abreißen, die seine Vitalfunktionen und Blutwerte maßen.
»Ich möchte nur wissen, ob alles mit rechten Dingen zuging«, erläuterte Carl. »Haben Sie dieses Gefühl?«
»Ja, absolut.«
Carl Oskar Fossey blickte dem Probanden lange in die Augen. Keinerlei Zweifel. Er wandte sich ab und musterte auf dem Monitor dessen Vitalfunktionen und das Elektroenzephalogramm. Letzteres war das Spannende. Ein Netz aus hexagonförmigen Elektroden war auf der Kopfhaut von CY173 befestigt und maß während des Gesprächs dessen Hirnstromwellen, die in Echtzeit als gezackte Linien angezeigt wurden. Die Ergebnisse waren niederschmetternd. Die Deltawellen wiesen eindeutig auf Gehirnschädigungen hin.
CY173 saß seelenruhig da. »Haben Sie noch Fragen?«
»Zwei. Sagen Sie mir bitte, was Sie fühlen, wenn Sie an den Tod Ihrer Mutter denken?«
Der Proband lächelte. »Sie haben es ganz schön mit meiner Mutter, nicht? Was möchten Sie hören? Dass sie eine tolle Frau war? Dass sie mich an ihre warme Brust drückte, wenn ich Angst hatte? Suchen Sie sich etwas aus. Entscheidend ist doch, dass sie jetzt unter der Erde ist.«
Carl hob eine Augenbraue. Ausdrucksweise und Aussage des Probanden passten überhaupt nicht zur Verlaufsdynamik des EEG; die abgebildeten Gehirnfunktionen implizierten starken Ärger und Aggression, keine Trauer, keine Freude, keine Angst. Allerdings kamen Ärger und Aggression offenbar nicht im Verarbeitungszentrum des Probanden an, sodass er sie selbst nicht verspürte. Das war nicht gewollt. An sich ein negatives, aber zugleich ein positives Resultat, denn der heutige Proband war der letzte einer Testserie, und alle Ergebnisse waren deckungsgleich. Sie hatten die Angstbeseitigung geschafft. Carl fühlte sich allerdings eher, als wäre er wie Ikarus mit seinen Flügeln aus Federn und Bienenwachs zu nah an die Sonne geflogen und herabgestürzt.
Er blickte auf das Datenblatt des Probanden und fragte: »Zuletzt noch als Verifizierung: Ihre Registrierungsnummer und Lieblingsfarbe ist …?«
»C Y eins sieben drei und braun.«
Carl nickte, erhob sich wortlos, gab per Handzeichen den beiden Laborassistenten zu verstehen, dass sie den Probanden noch fixiert lassen sollten, und verließ das Labor.
Im Nebenraum roch es nach Desinfektionsmittel. Die Lüftung rauschte, und nur ein Mann war anwesend. Carls Chef Johann Kehlis sah aus wie immer – leger, gepflegt, einnehmend. Er stand, gekleidet in einen schwarzen Rollkragenpullover und schwarze Jeans, neben einer Glasscheibe, die Hände locker in den Hosentaschen, und hatte von dort aus die Testfragen verfolgt. Die EEG-Ergebnisse waren auf einem separaten Monitor abgebildet. Jetzt sahen beide durch die Scheibe den Probanden, der den Blick durch den Raum schweifen ließ. Sein Gesicht war völlig ausdruckslos.
»Ebenfalls Gehirnschädigungen vorhanden«, sagte Carl müde, obwohl sein Chef selbst das EEG interpretieren konnte. »Der Zufall ist als Faktor ausgeschlossen. Alle Probanden aus der Testreihe sind gleichermaßen betroffen.«
»Und alle sind angstfrei«, fügte Johann hinzu. »Du hast es geschafft, Carl! Du hast sie geheilt.«
Carl schnaubte. »Ich habe ihre Gehirne geschädigt.«
»Sie wussten um die gesundheitlichen Risiken der Studienteilnahme. Sie gaben ihre Einwilligung freiwillig und bei vollem Bewusstsein.«
»Trotzdem. Bleibt zu hoffen, dass die Schädigungen nicht irreversibel sind. Vermutlich ist die Funktionsweise der Amygdala überreizt oder sogar zerstört. Der da drin produziert nur noch Aggression gegenüber seiner Mutter, doch weiß er es selbst nicht. Er ist völlig emotionslos. Wir müssen herausfinden, wie groß das Ausmaß der Schädigungen ist.«
»Das sind Nebenwirkungen, die wir in den Griff bekommen«, versicherte Johann. »Viel wichtiger ist, dass wir die Informationen ins Gehirn einspeisen konnten. Proband CY173 weiß nicht mehr, dass seine Mutter einem grausamen Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Er glaubt, sie sei eines natürlichen Todes gestorben. Er bekommt keine Panikattacken mehr, wenn er an ihren Tod denkt. Das ist es, worauf wir hingearbeitet haben!«
»Aber die Eisennanopartikel und deren Interferenzen mit den Amygdalae sind …«
»Carl! Lass doch mal die Schwarzseherei. Das Ergebnis dieser Testreihe ist der Durchbruch für SmartBrain und Hunderttausende Angstpatienten weltweit! All deine Forschungsbemühungen und all die geopferten Jahre werden endlich Früchte tragen! Du wirst sehen. Zusammen werden wir Großes leisten.« Johann fasste Carl an der rechten Schulter und nickte ihm aufmunternd zu. Dann machte er Anstalten, den Raum zu verlassen.
»Wo willst du hin?«
»Ich möchte selbst noch mit dem Probanden reden.«
Carl folgte Johann hinaus in den Flur. »Worüber?«
Johann zwinkerte ihm zu. »Warte ab. Ich erkläre dir meine Theorie danach.«
Gemeinsam betraten sie den Besprechungsraum. CY173 sah zu ihnen auf. »Hallo«, grüßte er.
»Guten Tag.« Johann und Carl nahmen ihm gegenüber am Tisch Platz. Zu den Laborassistenten sagte Johann: »Könnten Sie bitte den Herrn aus der Fixierung befreien, das EEG aber lassen?« Und dem Probanden zugewandt fügte er hinzu: »Wären Sie so freundlich, mir auch noch ein paar Minuten Ihrer Zeit zu schenken?«
»Sehr gern. Was kann ich für Sie tun?«
Das fragte sich Carl auch, doch er schwieg. Sein Chef hatte meist andere Gedankengänge als er, einer der Gründe, warum Johann Kehlis einer der erfolgreichsten Chemiker und Unternehmer der Welt war, während Carl selbst mit SmartBrain herumkrebste wie ein Bettler.
Johann wartete, bis man dem Probanden die Messmanschetten und die Armfixierung abgenommen hatte. Dann zog er aus der Hosentasche einen orangen Gegenstand und legte ihn auf den Tisch. Zwischen Plastik glänzte im kühlen Licht des Besprechungsraums Metall.
Carl riss die Augen auf, doch Johann legte ihm sanft die Hand auf den Unterarm und signalisierte, dass er sich zurückhalten sollte.
Der Proband betrachtete das Teppichmesser ausdruckslos.
»Können Sie damit umgehen?«, fragte Johann.
Der Proband nickte, die Lippen geschürzt. »Möchten Sie, dass ich Ihnen einen Teppich verlege?«
»Nein.« Johann lehnte sich zurück, verschränkte die Hände vor dem flachen Bauch wie zum Gebet und schlug die Beine übereinander. »Ich wollte Sie fragen, ob Sie etwas dagegen hätten, sich den kleinen Finger abzuschneiden.«
Ein Moment der Stille folgte, und zu Carls Entsetzen sagte CY173: »Klar, kann ich schon tun.« Er griff nach dem Teppichmesser. Die Klinge glitt ratschend aus dem Plastikgriff.
»Nein!«, flüsterte Carl, doch Johann gab dem Probanden mit einer auffordernden Geste zu verstehen, dass er fortfahren sollte.
CY173 betrachtete seine Hände. »Ich bin Rechtshänder«, sagte er. »Ist der kleine Finger der linken Hand in Ordnung?«
»Sie entscheiden«, gab Johann zurück.
Der Proband setzte das Messer auf der Handinnenseite an der Hautfalte des Fingeransatzes an und schnitt.
Blut spritzte über den Tisch. Der kleine Finger fiel auf die Holzplatte. Carl schrie vor Entsetzen. Und Johann sagte, den Blick auf die Gehirnstromwellen gerichtet: »Tatsächlich kein Empfinden. Das ist ja höchst interessant.«
TEIL 1
Oktober 2028
Kapitel 2
Nahe Grauach
Seit Stunden trommelte Regen auf das Wellblechdach, ein nicht enden wollendes rostiges Prasseln, wogegen das Rauschen des Waldes keine Chance hatte.
Malek stand unter dem Vorzeltersatz des Wohnwagens im Trockenen und hielt einen emaillierten Metallbecher, ein ramponiertes Teil in Weiß und Blau mit roten Herzen, in den Regen, der wie ein Vorhang dicker Wasserschnüre von der Wellblechdachkante auf die aufgeweichte Erde stürzte. Als das Regenwasser überquoll, führte Malek den Becher an die Lippen und trank in tiefen Schlucken. Er wischte sich Tropfen aus dem Bart und füllte den Becher erneut. Sein Blick streifte durch den Regen, über das Dickicht und die Bäume, die wie finstere Soldaten die Lichtung umringten.
In seinem Rücken hustete Tymon. Die Wohnwagentür war verbogen und schloss nicht mehr richtig, also stand sie immer offen. Und sie sollte auch gar nicht geschlossen sein, diese Tür.
Das Husten wiederholte sich, und es klang, als würde sich Tymon jeden Augenblick erbrechen.
Malek wandte sich vom Wald ab, der so düster wirkte, als wäre die Nacht schon hereingebrochen, obwohl es gerade einmal Mittag sein musste, und trat zu einem Klapptisch, der zusammen mit einem Liegestuhl vor dem Wohnwagen stand. Plastiktüten hingen unter dem Wellblechdach, gefüllt mit Rehinnereien. Das ausgeweidete Tier baumelte daneben, aufgehängt mit zwei Drahtschlaufen, die Augen voller Unschuld, wie sie nur Rehe in den Augen haben. Blut tropfte aus dem geöffneten Körper in einen Eimer. Dampf stieg davon auf, der Blutgeruch mischte sich mit der regenschweren Luft.
Das Husten ging in ein Keuchen über, verstummte, dann stieß Tymon hervor: »Malek! Malek, du Sohn eines räudigen Hundes! Ha! Haaa! Komm her! Komm endlich … komm! Wo bist du?« Eine flache Hand schlug auf Holz. Noch einmal. Ein Husten folgte, dann ein Wimmern, ein hilfloses Weinen wie von einem Kleinkind. »Wo bist du, Malek? Malek! So komm doch!«
Malek stellte den Becher auf den Tisch, schnappte sich einen Lappen, der dort lag, trottete zurück und hielt ihn in den Regen. Das eisig kalte Wasser rann ihm über die Hand, durchtränkte den Lappen in Sekunden. Er wrang ihn aus, atmete tief durch und ging damit zum Wohnwagen. Der umgedrehte Bierkasten, der als Tritt diente, knarzte unter seinen Füßen.
Drinnen war es kalt – es gab weder Strom noch Gas, womit man den Innenraum hätte heizen können –, und es stank nach Schweiß, Eiter und Kot. Das Leben reduziert auf Gerüche.
Tymon stieß ein würgendes Bellen aus und rollte sich wie ein Baby auf einem der beiden zerwühlten Betten zusammen. Tränen liefen über seine Wangen, verschwanden in dem Gestrüpp von Bart. Die Haut war blass und mit Schweiß bedeckt.
Malek trat neben ihn, ließ sich auf die fleckige Matratze nieder und legte ihm den Lappen auf die heiße Stirn.
»Malek«, flüsterte Tymon, öffnete die Augen und grinste schief. »Du bist gekommen und bringst mir etwas zu essen. Oder zu trinken? Ein wenig Mineralwasser, ja? Nur ein bisschen?«
Malek hingegen schüttelte den Kopf. Er griff nach einer Tasse, die neben dem Kranken auf einer Ablage stand und genauso aussah wie seine – nur mit gelben statt roten Herzen –, und hielt sie ihm hin.
Der Kranke verzog das Gesicht zu einer Grimasse und schlug ihm den Becher aus der Hand. Ein Schwall Regenwasser spritzte von innen gegen die trübe Wohnwagenscheibe. Mit einem Scheppern verschwand der Becher irgendwo.
»Arschloch!«, kreischte Tymon. »Die Götterpisse kannst du selbst saufen! Genauso wie dein scheiß Wildblut! Ich will Wasser. Echtes Wasser! Oder ein Schnitzel mit Pommes!« Er brach in Tränen aus, krümmte sich wie ein Embryo auf dem Bett zusammen, barg den Kopf in den zitternden Händen.
Malek blickte auf ihn hinab, regungslos und still, dann bemerkte er einen rötlich braunen Fleck auf dem Pullover des Kranken, oberhalb des Hüftknochens. Seine Finger wurden feucht und rot, als er Tymons Bauch berührte.
Maleks Augenbrauen rückten zusammen, als er den Pullover vorsichtig lupfte. Tymons Wimmern ignorierte er, doch ihm entfuhr ein Stöhnen, als er den Verband darunter sah, den er Tymon um die Nierengegend angelegt hatte. Der Stoff war vollgesogen mit Blut, fast schwarz, durchzogen mit gelben Flecken. Die Wunde hatte sich erneut entzündet.
Malek erhob sich. Er öffnete Einbauschränke, schaute in Schubladen und Ablagen, wühlte sich durch den Plunder und das wenige Hab und Gut, das in diesem gottverlassenen, verranzten Wohnwagen zurückgeblieben war, bis er endlich einen Verbandskasten fand. Das Ablaufdatum mahnte das Jahr 2018, doch Mull und Pflaster waren auch ein Jahrzehnt später bereit, Blut aufzusaugen.
Als die Verschlüsse klickten, erklang ein Schrei. Draußen. Im Wald. Zart und zerbrechlich.
Malek trat zur Tür.
»Der Pizzabote! Der Pizzabote!« Tymon lachte gackernd und richtete sich auf, sank jedoch vor Schmerzen zurück in die Laken und hustete hart. »Er bringt mir meine Drei-S-Pizza! Salami, Sardellen, Speck. Hoffentlich mit ganz viel Knob…«
»Psst!«, zischte Malek.
Abermals ertönte ein Schrei im Wald. Es klang nach einer Frau. Oder einem Mädchen?
Malek setzte den Verbandskasten ab und verließ geräuschlos den Wohnwagen. Am Rand des Wellblechdachs blieb er stehen, beobachtete die Lichtung, lauschte. Nur das Trommeln des Regens, kein Schrei, keine Wortfetzen oder andere menschlichen Geräusche. Nichts. Gar nichts. Aber die Schreie waren da gewesen. Die hatte er sich nicht eingebildet. Tymon hatte sie auch gehört.
»Dance, dance, dance, dance, dance!«, sang Tymon unvermittelt im Wohnwagen. »Hellooo? Wooosa! Wo bleibt mein verfucktes Essen, Malek!«
Malek musterte unbeirrt das Unterholz und die dunklen Schatten zwischen den Bäumen.
»Maaaleeek!«
Malek wandte sich grimmig um, da erschien in seinem Augenwinkel zwischen all dem farblosen Grün und Grau etwas Postgelbes.
Es hüpfte auf und ab, kam näher.
Eine Mütze.
Die junge Frau, die sie auf dem Kopf trug, war kaum zu erkennen, so dreckverschmiert und abgerissen sah sie aus. Sie brach aus dem Wald auf die Lichtung und schien den Wohnwagen zu entdecken, denn sie schlug einen Haken und kam direkt auf Malek zu. Angst und nacktes Entsetzen lagen auf ihrem Gesicht.
Malek spannte die Muskeln, blickte ihr entgegen und erkannte, wovor sie solche Angst hatte: Ein weißer Teufel verfolgte sie.
Das ließ auch Maleks Puls steigen.
Die Argentinische Dogge, mindestens fünfzig Kilo pure Muskelmasse und noch viel mehr Aggression bei entsprechendem Drill, preschte heran. Die Frau musste einen enormen Vorsprung gehabt haben.
Malek würde es nicht schaffen, eine Waffe aus dem Wohnwagen zu holen. Entweder er handelte jetzt und ging ein hohes Risiko ein, oder er überließ die Frau dem Teufel auf vier Beinen. Läge Tymon nicht halb wahnsinnig und mit einer eiternden Bauchwunde im Wohnwagen, dann …
Der Blick der Frau fand den seinen, und Malek stürzte vorwärts. Das hohe Gras peitschte ihm um die Beine, der Regen klatschte ihm hart und kalt ins Gesicht.
Tymon sang Knocking on heaven’s door.
Der Argentino setzte zum Sprung an.
Malek ebenfalls.
Und auch die Frau.
Als sie alle drei in der Luft hingen, nahm Malek alle Details gestochen scharf wahr: die feine flammenartige Struktur ihrer braunen Augen, eingerahmt von nassen Haarsträhnen. Ein Hauch von Sommersprossen, ein Pickel an der Augenbraue. Ein mit schwarzem Faden eingestickter Smiley auf der quietschgelben Mütze … und gleich daneben die aufgerissene Schnauze des Hundes, ein Kranz blitzender Zähne in blassrotem Zahnfleisch, darüber die zu Schlitzen verengten Augen.
Die Fänge des Argentinos klappten zusammen wie Baggerschaufeln, gruben sich in den Oberarm der Frau. Sie stieß einen spitzen Schrei aus, und Maleks Hände schlangen sich um den Hals des Hundes. Das Fell war glatt und nass, doch Maleks Rechte bekam ein Halsband zu fassen, ein feingliedriges Metallband, knapp drei Zentimeter breit.
Er riss den Hund mit sich hinab. Die Frau schrie lauter. Zusammen stürzten sie ins Gras.
Die kantigen Kiefer ließen Fleisch und Stoff los, schnappten sofort nach Malek. Speichel sprühte ihm ins Gesicht, gepaart mit scharfem Mundgeruch. Die Vorderläufe stießen gegen seine Brust, doch er drückte den Hund zu Boden, damit der Argentino ihm nicht die Kehle zerfetzte und er selbst die gesamte Faust unter das Milanaise-Halsband bekam.
Mit einem Ruck drehte er die Faust um neunzig Grad. Das Metallband grub sich tief ins Fleisch des weißen Teufels.
Der Hund schnappte nach ihm, grollte, gebärdete sich wie verrückt. Malek presste sein Knie in die Weichteile des Rüden, setzte sein ganzes Körpergewicht ein. Die Bewegungen des Hundes wurden fahrig. Die Augen zuckten, das Weiß quoll hervor, doch die blutnassen Fänge stießen weiter nach seinem Gesicht.
Tief in Maleks Brustkorb begann ein Schrei, versetzte seine Brust in Schwingungen und brach hervor, erst leise, dann immer lauter, während seine Muskeln vor Anstrengung zitterten. Er brüllte der Dogge seinen Zorn entgegen, hob den Schädel an und wuchtete ihn zurück auf die Erde, die Faust immer noch seitlich unter dem Halsband quergestellt.
Wie ein Irrer schrie er, schrie und schrie und knallte den Schädel des Hundes in den Schlamm, hinterließ eine Kuhle, in der sich Regenwasser sammelte.
Dann war es vorbei.
Malek sank keuchend in sich zusammen, rollte auf den Rücken, den erdrosselten Hund neben sich. Sein Atem kam stoßweise, der Regen prasselte auf ihn ein, doch die Berührung hatte etwas Beruhigendes.
Schließlich richtete Malek sich auf, stemmte sich auf die Knie und besah sich das Milanaise-Halsband. Er öffnete den wuchtigen Verschluss. Wie flüssiges Silber glitt das Band durch seine Finger, bis ein rechteckiger Anhänger in der Größe einer Visitenkarte zwischen ihnen hängen blieb. Eine Ziffern-und-Zahlen-Kombination war zusammen mit einem Strichcode eingraviert. Daneben ein Symbol: ein Parallelogramm mit einem angeschnittenen J. Das Parteilogo der JKP. Kein Zweifel; es war eine Identifikationsmarke.
Als er sich mit dem Halsband erhob, war die Frau bereits unter das Wellblechdach getaumelt. Sie hatte Schlagseite und hielt sich den Oberarm, aus dem Blut quoll. Ihr Gesicht war so weiß wie das Fell des toten Teufels.
Malek stapfte zu ihr, streckte ihr das Halsband entgegen, deutete auf den Anhänger und die Gravur.
»Warum?« Das Wort kam rau wie Splitt auf Eis.
»Keine Ahnung!«, wimmerte sie. »Es waren drei Männer!«
Maleks Finger schlossen sich um das Metallstück, so fest, dass das Band daran zitterte, als stünde es unter Strom. Er ließ es auf den Klapptisch fallen, schob sich wortlos an ihr vorbei in den Wohnwagen und kam mit dem Jagdmesser wieder heraus.
Tymon hustete, lachte und sang: »Bang bang! Und? Von wem ist es? Bang bang!«
Die Frau wich bis zur Wohnwagenwand zurück. Ihr Blick flatterte zwischen dem Messer, Maleks Gesicht und der Wohnwagentür hin und her. »Wer seid ihr?« Ihre Stimme überschlug sich.
Wortlos verließ Malek den Schutz des Wellblechdachs und die Klinge den Schutz der Lederhülle.
Vor dem Kadaver des Hundes ging er in die Knie. Seine Finger glitten über den muskulösen Hals des Teufels, strichen systematisch darüber wie die eines erfahrenen Physiotherapeuten. Er ertastete, was er befürchtet hatte: eine runde Verhärtung in Form einer Patrone.
Malek setzte das Messer an. Ein präziser Schnitt ließ Fell und Fleisch aufklaffen. Er wischte das Messer am Gras sauber, steckte es weg. Dann schob er Zeigefinger und Daumen in den roten Schnitt, pulte herum, bis er die silberne Kapsel fand.
Als er zurückkehrte, hing der Blick der Frau – Malek schätzte sie auf Mitte zwanzig – an seinen blutigen Fingern, die die Kapsel wie eine Patronenhülse hielten.
»Was ist das?«, stieß sie hervor. »Was zum Teufel ist das?«
Sie hatte noch weniger Ahnung als er.
Malek kehrte ihr den Rücken zu, wandte sich dem Wald und den Regenwolken entgegen. Er schätzte den Stand der Sonne anhand des hellen Schimmers in all dem Grau. Das Verhängnis war von Süden gekommen.
Er sagte: »Ein Galileo-Sender.«
Dann trat er zum dritten Mal hinaus in den Regen. Ohne sich umzudrehen, fügte er hinzu: »Mein Kumpel ist harmlos. Verbandszeug steht auf dem Herd.« Dann verfiel er in Laufschritt und eilte auf den Waldrand zu – Richtung Osten.
Götz Nowak blieb stehen und hob die Hand. Seine beiden Begleiter stoppten ebenfalls.
»Zerberus bewegt sich wieder«, sagte er. Durch die Glasses sah er vor den Bäumen in feinen, leuchtenden Linien die stilisierte Draufsicht der Umgebung und das blinkende Dreieck, das sich laut der danebenschwebenden Zahlen mit 12,3 Kilometern pro Stunde bewegte. Seine ausgestreckte Hand deutete nach Osten. »In diese Richtung.«
»Seltsam«, meinte Yannic, der eine weiße, daumendicke Hundeleine lässig in Händen hielt. »Er müsste sie längst erwischt haben. Kein Mensch hält so lange durch.«
»Vielleicht hat er eine Wildsau gewittert«, warf Moritz ein, grinste und schob die Maschinenpistole, die an einer Trageleine über seiner Schulter baumelte, in eine bequemere Position. »Dafür sind die Biester schließlich mal in Argentinien gezüchtet worden.«
Yannic schüttelte den Kopf. »Zerberus würde neben ihrer Leiche warten, bis ich ihm einen anderen Befehl erteile. Und selbst wenn er verdursten müsste, er würde ausharren. Wenn er sich bewegt, hat er sie noch nicht gefasst.«
»Vielleicht spielt er mit ihr?« Moritz setzte sich gen Osten in Bewegung. »Auch wir wollten doch mit ihr ein wenig spielen, oder nicht? Ich habe schon ein paar nette Ideen.« Er kratzte sich im Schritt. »Hoffen wir nur, dass dein Schoßhündchen etwas von ihr übrig lässt.«
Götz rief ihn barsch zurück. »Wir gehen erst nach Norden«, befahl er. »Und gespielt wird hier überhaupt nichts. Wir haben Befehle und werden diese zügig ausführen.«
»Ach, komm schon! Diese Befehle sind so langweilig und unattraktiv wie die ganzen haarigen Ärsche in der Kaserne. Und ob wir ein, zwei oder drei Stunden unterwegs sind, interessiert doch keine Sau. Hat halt gedauert. Also: Macht euch locker. Endlich kommen wir mal raus aus dem Kabuff.«
Das Grinsen auf Moritz’ Gesicht verschwand, als er Götz’ grimmigen Blick hinter den Glasses bemerkte.
»Du willst wirklich sofort zurück? Ohne ein bisschen Spaß …« Moritz hob beschwichtigend die Hände. »Okay, okay! In Kehlis! Dann los, Cheffe.«
Götz sah in den Augen des jungen Mannes kein Verständnis, sondern nur lahmen Gehorsam. Im Geiste vermerkte er das. Das Schlimme an Grünschnäbeln wie Moritz Rösner war, dass sie ihre Aufgaben nicht allzu ernst nahmen, und das Leben noch weniger. Alles war ein großes Spiel. Sie lechzten immer nur nach Vergnügung und Entertainment, und sei es beim Ausheben der Latrinen. Diese Haltung widerte Götz an. Er war knapp dreißig Jahre Soldat mit Leib und Seele gewesen, unter anderem Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr, bevor man ihn outgesourced hatte. Unter der flirrenden Sonne in Kundus hatte er gedient und bei Straßenschlachten in Afghanistan Truppen geführt – er kannte das wahre Leben und den Tod; im Gegensatz zu seinen beiden Begleitern, die nichts anderes gesehen hatten als Übungsplätze und Trainingscamps – bessere Pfadfinderlager. Yannic war von der härteren Sorte, aber für Burschen wie Moritz war ein Einsatz wie der heutige das reinste Vergnügen, ein Highlight im langweiligen Garde-Alltag.
Wortlos ging Götz vorneweg, Moritz und Yannic folgten ihm leicht versetzt.
Nach einem knapp zehnminütigen Marsch in völligem Schweigen standen die Bäume dichter, und das Unterholz bildete dornige Wälle, doch dahinter schimmerte das Licht einer baumfreien Stelle. Dort hatte sich Zerberus laut dem Galileo-Signal für ein paar Minuten aufgehalten.
Vorsichtig schoben sich die drei auf ein Handzeichen von Götz durch Büsche, kahle Ranken und Stockausschläge, die sie ins Stolpern brachten, und blieben im Schutz der Schatten stehen.
Vor ihnen öffnete sich der Wald zu einer mittelgroßen Lichtung, vermutlich früher einmal ein Jagdplatz, in dessen Mitte ein einzelner Wohnwagen stand. Die Gräser direkt davor waren platt gedrückt – und zwar nicht vom Regen.
»Niemand zu sehen«, stellte Yannic leise fest. Er hatte sich die Hundeleine um Brust und Schulter gewickelt, damit er die Hände frei hatte. Mit zusammengekniffenen Augen musterte er die offenbar verlassene Unterkunft. »Irgendwie gefällt mir das nicht.«
Götz teilte sein Unbehagen. Etwas erfüllte die Luft dieser Lichtung mit einer Schärfe, die nicht sein sollte. Doch konnte Götz weder etwas Eigenartiges riechen noch sehen. Er deutete auf den offen stehenden Wohnwageneingang und das ausgeweidete Reh, das dort hing. »Jemand lebt hier.«
»Da schau an! Ein Öko!« Moritz’ Wangen waren gerötet, seine Augen leuchteten vor Begeisterung. Er schien keinerlei Gefahr wahrzunehmen.
»Still!«, zischte Götz. »Wir sehen nach, was es damit auf sich hat.« Er schaltete die Glasses ab, damit ihn die Informationsüberlagerungen nicht störten, und wandte sich an Yannic. »Du von der Seite, ich von der. Und du, Moritz, sicherst uns von hier aus. Liegender Anschlag.«
Moritz öffnete den Mund zu einem Protest, doch dann weiteten sich seine Augen, und sein Arm schoss in die Höhe.
Götz’ Blick folgte dem ausgestreckten Finger, doch er konnte nichts Auffälliges vor dem Wohnwagen erkennen. Yannic stieß allerdings geräuschvoll die Luft aus und sprintete los.
Dann sah auch Götz den blassen Schemen am Boden liegen.
»Scheiße!«, fauchte er und drehte sich zu Moritz. »Du sicherst uns! Keine Widerrede!«
Dann zückte er seine Pistole und rannte geduckt hinter Yannic her.
Dieser hatte Zerberus erreicht, ging in die Knie und beugte sich mit einem erstickten Schrei über den toten Hund. Der Schnitt am Hals ließ keine Spekulationen darüber zu, warum sich Zerberus angeblich nach Osten bewegte. Sein Ziel Sarah Engelhart würde sich wohl kaum mit dem Galileo-Sender entfernen, wenn sie die Möglichkeit hatte, unbemerkt zu entkommen. Blieb also nur jemand, der Engelhart vor dem Hund gerettet hatte und ihre Verfolger an dem Wohnwagen vorbeilotsen wollte. Warum wohl?
Götz sah sich um. Vor dem Wohnwagen gewahrte er einen einzigen Liegestuhl, und auch der Wohnwagen selbst war nicht allzu geräumig. Womöglich lebte hier nur ein Mensch.
Er wandte sich Richtung Wald, signalisierte Moritz, dass er aufmerksam und an Ort und Stelle bleiben solle, dann riss er Yannic an der Schulter in die Höhe.
»Wohnwagen!«, zischte er und zeichnete mit dem Finger ein Rechteck in die Luft, wobei er den unteren Strich wegließ. Eigentlich hätte die Geste, die Zur Tür bedeutete, reichen müssen, aber Yannic schien völlig neben sich zu stehen. Er starrte Götz nur an, während ihm Regen – und sind das verdammt noch mal Tränen? – übers Gesicht rann.
»Okay. Du sicherst von hier! Aber achte auf die Umgebung, es könnten mehrere Leute hier sein. Verstanden?«
Yannic nickte, die Augen aufgerissen, und fummelte sein Gewehr vom Rücken.
Götz signalisierte derweil Moritz, dass er herankommen sollte. Seine erhobene Faust pumpte auf und ab. Das Zeichen für Beeilung!
Dann huschte er selbst die paar Meter zum Wohnwagen hinüber. Das Gras flüsterte feucht unter seinen Sohlen, das Trommeln des Regens auf dem Wellblechdach übertönte die Geräusche.
Zwischen der offen stehenden Eingangstür und einem Fenster bezog Götz Stellung, die Pistole erhoben. Er wagte einen Blick. Das Fenster war so matt und von innen angelaufen, dass er nichts erkannte. Also wartete er, bis Moritz aufgeschlossen und auf der anderen Seite der Eingangstür Posten bezogen hatte.
Yannic lag derweil im Gras, sein Sturmgewehr im Anschlag.
Götz und Moritz blickten sich an. Die Feuerprobe für den Jungspund war gekommen. Götz nickte in Richtung Tür. Daraus ertönte ein Poltern, ein Husten, dann ein Fluch.
»Ja Scheiße!«, stieß ein Mann hervor. »Einfach ohnmächtig geworden.« Er kicherte. »Aber ’nen geilen Arsch hat die Kleine. Vielleicht« – die Männerstimme wurde schrill – »hat sie auch was zu essen!«
Götz deutete abermals auf die Tür, signalisierte, dass er Feuerschutz gab und direkt folgen würde.
Moritz nickte und trat zügig über den provisorischen Tritt in den Wohnwagen.
Kaum war er drin, krachte ein Schuss in die prasselnde Stille.
Moritz taumelte rückwärts wieder heraus, verfehlte die umgedrehte Bierkiste und stürzte wie ein gefällter Baumstamm auf die Erde. Götz konnte seinem Kameraden gerade noch ausweichen und unterdrückte einen Fluch. Moritz’ linkes Auge fehlte, dort war nur noch eine blutige Höhle. Seine Hände zuckten unkontrolliert.
Schnell sprang Götz aus dem möglichen Schussbereich der Tür und richtete die Waffe darauf. Er hatte die Order, Sarah Engelhart zu fassen – lebend oder tot. Und auch wenn er überzeugt davon war, dass ein Menschenleben das höchste Gut auf Erden darstellte und nur im Notfall ausgelöscht werden sollte, feuerte er nun seinerseits die gesamten zwölf Schuss des Magazins schräg auf den Wohnwagen, etwa dorthin, wo der Schütze sich aufhalten musste. Er würde keinen Orden erhalten, wenn er auch noch sein oder Yannics Leben gefährdete. Und der Typ da drinnen hatte kaltblütig in Moritz’ Gesicht geschossen.
Die Patronen durchschlugen mühelos die Außenwand, durchsiebten die Isolierung und die Holzverkleidung dahinter.
Aus dem Inneren war ein Schmerzensschrei zu vernehmen, dann herrschte Stille.
Götz’ Brustkorb hob und senkte sich wie nach einem Dauerlauf. Schweiß trat ihm aus den Poren – die Wirkung des ausgeschütteten Adrenalins. Er hatte das Magazin bereits gewechselt, als er Yannic das Signal gab, weiterhin aus der Distanz zu sichern und auf der Hut zu sein. Irgendwo musste sich noch jemand aufhalten, es sei denn, Sarah Engelhart rannte tatsächlich selbst mit dem Galileo-Sender nach Osten.
Ganz vorsichtig näherte er sich der offen stehenden Tür. Ohne den Blick abzuwenden und mit einem Kilo Druck auf dem Drei-Kilo-Abzug, stieg er über den regungslosen Moritz hinweg.
Dann schnell rein in den Wohnwagen, die Pistole nach rechts schwenken, nach links, die Situation mit einem Blick erfassen. Auf dem Bett lag rücklings ein Mann, die Augen blickten starr zur Decke, eine Pistole in den verkrampften Fingern. Überall um ihn herum Blut. Zu seinen Füßen lag das Ziel ihrer Mission, Sarah Engelhart, eindeutig zu erkennen an der gelben Mütze. Schwer verletzt oder sogar tot. Die größer werdende Blutlache unter ihr sprach für Letzteres.
»Yannic!«, schrie er, die Pistole sicherheitshalber auf den Mann auf dem Bett gerichtet. »Da draußen ist noch einer. Aufrücken! Schnell!«
Keine Antwort.
»Yannic! Was ist dort draußen los?«
Wieder keine Antwort.
Götz beschlich ein ungutes Gefühl. Er löste die Stützhand von der Pistole und schaltete die Glasses per Druck auf den Seitenbügel ein. Sofort flammte die lokale Geografie des Waldes auf. Das Dreieck, das repräsentativ für Zerberus’ Peilsender stand, blinkte immer noch, bewegte sich nun mit 0,72 Kilometern pro Stunde nach Südosten. Es folgte exakt einem gestrichelten Bachverlauf – mit Fließgeschwindigkeit.
»Scheiße!«, wisperte er. »Yannic! Der kann schon da sein!«
Noch bevor er die Tür erreichte, hörte er hinter sich ein unterdrücktes Husten.
Götz riss die Pistole herum.
Der Mann auf dem Bett hatte den Kopf gehoben, das Gesicht zu einer Grimasse verzogen und sang: »Bang bang!”
Die Mündung seiner Pistole verwandelte sich zweimal in eine gelborange Sonne. Dann ein drittes und viertes Mal.
Alle Schüsse trafen Götz in Brust und Gesicht. Dieser sank im Eingangsbereich in sich zusammen, glitt an der Wand entlang zu Boden, hinterließ eine breite blutige Schmiererei.
Wieder ein Husten, die Stimme setzte zitternd an: »Bang bang, I …«, und brach weg.
Eine drückende Stille legte sich über die Lichtung. Nur der Regen fiel und fiel und fiel.
Yannic schniefte. Als würde sein Hund noch leben, spürte er dessen Präsenz hinter sich. Jeden Augenblick müsste er neben ihm erscheinen, schnuppernd, die blassrosa Zunge heraushängend, die ihm warm und rau übers Gesicht leckte.
Doch nur der Regen leckte ihm über das Gesicht, kalt und lieblos.
Warum hatte es ausgerechnet Zerberus erwischt, seinen Zerberus? Er war ein guter Hund gewesen, der beste Freund, den man sich wünschen konnte, mit verspieltem Gemüt und unerschütterlicher Loyalität.
Rotz tropfte Yannic aus der Nase, und gern hätte er ihn weggewischt, doch er durfte die Hände nicht vom Gewehr nehmen. Er musste Götz sichern, der in den Wohnwagen eindrang.
Yannic schnaubte durch die Nase, doch der Rotz blieb an Ort und Stelle, behinderte seine Atmung. Yannic zögerte, dann nahm er doch die Hand vom Abzug. Es dauerte nur einen Augenblick, doch in dem spürte er das diffuse Gefühl von Gefahr.
Die Finger voller Schleim, die Augen von Tränen verquollen, fuhr er herum.
Ein Mann ragte über ihm auf, presste die Hand auf seinen Mund, erstickte den Schrei.
Aus dem Wohnwagen drang: »Yannic! Da draußen ist noch einer. Aufrücken! Schnell!«
Das Messer des Mannes stieß herab.
Yannic versuchte, den Kopf zur Seite zu werfen, doch der Mann hielt ihn erbarmungslos fest. Die Klinge drang mit einem ekelhaften Schmatzen durch sein Auge.
»Yannic! Was ist dort draußen los?«
Yannic entwich ein zitternder Atemzug. Das Letzte, was er mit seinem unverletzten Auge sah, waren verfilzte Haare, ein struppiger Bart, eine silbrige Narbe parallel zur Nase und dunkelbraune Augen, in denen sich sein eigenes bleiches Gesicht spiegelte … und das Messer, riesengroß, als es aus seiner Augenhöhle fuhr.
Malek erhob sich. Er entriss dem Toten das Sturmgewehr.
Der letzte Soldat erschien zur Hälfte in der Tür des Wohnwagens – und sank in sich zusammen, als vier Schüsse peitschten.
Malek blieb wie angewurzelt stehen.
Für einen Moment hoffte er. »Tymon!«
Im Wohnwagen roch es nach Blut. Es war überall; die Wände gesprenkelt, der Boden glitschig, die Laken feucht.
Das Sturmgewehr klapperte, als Malek es achtlos auf die Spüle warf. Er legte der Frau zu seinen Füßen die Finger an den Hals. Da war nichts. Ein Querschläger musste sie erwischt haben.
Dann wandte er sich seinem Gefährten zu. Vier frische Löcher zierten Tymons Oberkörper, und Malek wusste sofort, dass die neuen Verletzungen tödlich waren.
Und doch öffnete Tymon die Augen und lächelte, als Malek an seine Seite trat und sich niederließ. Ein Husten schüttelte seinen Körper. Die Einschusslöcher glänzten wie Rosen im Regen.
Mit brüchiger Stimme sagte er: »Malek! Gut, dass du lebst.« Er schluckte, stöhnte. »Malek! Du versprichst es mir jetzt!« Ihre Hände fanden sich – Maleks warm, Tymons kalt. »Versprich mir, dass du Maria rausholst!« Er hustete Blut, atmete mehrmals heftig und schien sich nicht mehr zu erholen, doch dann wurde er wieder ruhig und fand genügend Luft. Der Fieberwahn der letzten Tage war verschwunden, vielleicht ausgetreten durch die Einschusslöcher.
»Ich hätte es sowieso nicht geschafft«, flüsterte Tymon. »Also: Bring meine Schwester aus diesem verdammten Deutschland raus …« Er musste wieder husten. Seine Hände krampften sich zusammen.
Malek erwiderte den Druck der zitternden Finger. Tränen rannen über seine Wangen. »Wir hatten das doch geklärt. Sie ist seit acht Jahren untergetaucht. Wenn ich sie aufsuche, bringe ich sie in Gefahr.«
»Scheiß drauf, Malek! Das ganze Leben ist eine einzige Gefahr! Lieber will ich sie in guten Händen wissen. In deinen Händen!«
Malek schluckte schwer.
»Versprich es!«, wisperte Tymon.
»Ich …«
»Versprich es, du Arschloch!«
Die Worte wollten nicht über Maleks Lippen kommen, taten es aber trotzdem: »Ich verspreche es.«
Ein zufriedener Gesichtsausdruck breitete sich auf Tymons Zügen aus. »Gut. Das ist gut. Hör zu: Du brauchst die Zeitungen. Von ihrem jährlichen Todestag. Wo sie beerdigt ist! Die Todesanzeigen! Dann wirst du sie finden. Old-school. Verstanden?«
Malek nickte, worauf sich Tymons Körper zu entspannen schien, doch die Muskeln am Hals zuckten, als er sagte: »Schade, dass die Grillen bei diesem Scheißwetter nicht zirpen.« Er hustete abermals, dann sang er: »A cricket sings on the wayside, I try to poise on the white lines. Lying down, the sky is full of shimmer, then light, a shout, and a happy dying sinner.«
Danach verstummte Tymon Król. Auf seinen Lippen schimmerte Blut, doch es dauerte noch eine gute halbe Stunde, bis sein Brustkorb aufhörte, sich zu bewegen.
Ganz still saß Malek neben dem Verstorbenen, die Hände mit Tymons verschränkt.
Schließlich löste er seine Finger.
Es dauerte nicht lange, bis er die zwei Sturmgewehre und vier Pistolen – drei der Soldaten und eine von ihm und Tymon – zusammengesammelt und neben dem toten Soldaten aufgetürmt hatte. Das Jagdmesser steckte wieder an seinem Gürtel. Seine restlichen Habseligkeiten packte er in einen zerschlissenen Rucksack. Wer mit nichts außer seinem Leben unterwegs war, brauchte kein großes Gepäck.
Malek stellte den Rucksack, an den er seine zusammengerollte Bettdecke – eingeschlagen in eine Plastiktüte – gebunden hatte, neben den toten Soldaten an die Tür.
Er betrachtete ein letztes Mal seinen langjährigen Weggefährten, seinen Freund, seinen Mentor; die blasse Haut, den grau melierten Bart, die Narbenflecken von Akne aus längst vergangenen Tagen. Er kannte es so gut wie das Gesicht seines Bruders Dominik. Dominik … alle sind tot.
Er konnte Tymon so nicht zurücklassen, nicht nachdem er Dominik schon nicht beerdigt hatte. Eine anständige letzte Ruhestätte war er seinem Freund schuldig, irgendwo unter freiem Himmel, wo er die Grillen zirpen hören konnte. Noch besser wäre ein Feuer – Flammen, Funken und Asche, so hätte Tymon es gewollt. Aber Feuer hatte er nicht.
Abermals öffnete Malek Schränke und Klappen, doch die ehemaligen Besitzer des Wohnwagens hatten keinen Spaten oder überhaupt irgendetwas zum Graben zurückgelassen. Schließlich nahm er das Bettlaken, breitete es aus und bedeckte damit Tymons Leichnam.
Der Anblick hatte etwas Endgültiges. Da ist kein Leben mehr, flüsterte das Bettlaken.
Als sich Malek mit einem Ruck abwandte, sah er eine Armbanduhr am Handgelenk des toten Soldaten glänzen. Er ließ sich auf ein Knie sinken und streifte sie dem Toten ab. Es war eine klassische Analoguhr mit Zeigern aus silbernem Metall. Sie zeigte 14.13 Uhr. Nach Maleks Schätzung waren knapp zwei Stunden vergangen, seit der weiße Teufel aus dem Wald aufgetaucht war. Zwei Stunden, die sein Leben völlig verändert hatten. Mit einem Knack rastete der Uhrverschluss an seinem Handgelenk ein.
Malek musste los. Drei Soldaten, die nicht von ihrem Einsatz zurückkehrten, würden bemerkt werden. Man würde nach ihnen suchen und sie früher oder später finden. Glasses. Galileo. Eher früher als später.
Ein letztes Mal sah er sich im Wohnwagen um. Zu seiner Überraschung verspürte er eine Welle des Bedauerns. Er hatte in den letzten Tagen hier seit langer Zeit wieder so etwas wie Glück verspürt, trotz Tymons Verletzung, trotz der Aussichtslosigkeit ihrer Situation. Als er das Chaos um sich herum betrachtete, hörte er in Gedanken Tymon sagen: Das Dumme mit dem Glück ist, dass man es erst bemerkt, wenn es vorüber ist. Malek war versucht, Tymon recht zu geben.
»Tymon …«
Mit einem Mal brach all die Wut aus ihm heraus. Er wischte die Gläser und Becher von der Spüle, er riss Schubladen mit Plastikgeschirr und Campingutensilien heraus und warf sie um sich. Er zertrümmerte die Tür zu der winzigen Waschkabine, aus deren Wasserhahn kein Wasser kam. Er wütete wie ein zorniges Kind in einem Puppenhaus.
Als die Federn eines zerplatzten Kopfkissens durch die Luft wirbelten und der Regen durch ein gesprungenes Fenster prasselte, sank Malek schluchzend neben den toten Soldaten. Seine breiten Schultern bebten.
»Und jetzt, Kumpel?«, fragte er den Toten und gab ihm mit dem Ellbogen einen Stoß in die Rippen. »Jetzt bist du tot, und Tymon ist tot, und die beiden da draußen sind tot, und die Frau ist auch tot. Ahh … und den Hund nicht zu vergessen. Tot, tot, tot. Und wofür?«
Er strich sich seine strähnigen Haare aus dem Gesicht. Sie blieben an seinem Kopf kleben.
»Weißt du, Kumpel«, fuhr er fort, »ich scheine verhext zu sein. Egal was ich anpacke, es geht schief. Ich bin wie ein Magnet. Ich ziehe das Unglück und den Tod an wie ihr bald die Fliegen.«
Malek blickte hinaus in den Regen.
Mehrere Gestalten schlichen durch das hohe Gras auf den Wohnwagen zu. Er zählte zwei, drei, vier, fünf geduckte Frauen und Männer. Sie trugen nicht die weiß-grauen Uniformen der Kehlianer wie die drei Toten und auch keine Sondereinsatzkommandorüstungen, wie er sie jeden Tag erwartete, sondern braune Mäntel und schwarze Hüte. Die Frau in der Mitte hatte sich einen Fransenponcho übergeworfen, von dessen Kordeln Regenwasser herabtropfte.
Und sie trugen Gewehre.
Abgesägte Schrotflinten.
Elektroschockpistolen.
Für die Dauer von drei Herzschlägen konnte Malek den Anblick nicht glauben, für zwei weitere überlegte er, einfach sitzen zu bleiben und zu warten, doch dann dachte er an Tymon und das Versprechen, das er ihm gegeben hatte, und fasste hinter sich zum Waffenstapel.
Er bekam ein Sturmgewehr in die Finger.
Kapitel 3
Nahe Grauach
»Keinen Schritt weiter!«
Die Drohung flog Jannah Sterling entgegen wie eine wütende Wespe und wurde vom unverkennbaren Knacken eines Sturmgewehr-Ladehebels begleitet.
Ihr Handzeichen ließ den Trupp stoppen.
Kurz hatte sie den Kerl in der Wohnwagentür gesehen, bevor er im Inneren verschwunden war; finster, grimmig, mit Blut besudelt und irgendwie müde. Er schien die drei Soldaten samt Hund niedergemetzelt zu haben. Ein Argentino zählte wie ein Mann, also vier gegen einen? Unwahrscheinlich. Hatte er Freunde? Und wenn ja, wo waren sie?
Alle hatten den Wohnwagen im Visier. Hendrik und Jan scherten an den Flanken aus, um ihn vorsichtig zu umrunden. Michael blieb bei Jannah, während Sabine sich zurückzog, um zu sichern.
Jannah rief: »Wenn der Köter und die Kehlianer auf deine Kappe gehen, könnten wir Freunde sein!«
Vielleicht, vielleicht, vielleicht, wisperte der Regen.
»Hast du gehört? Wir scheinen denselben Feind zu haben.«
Vielleicht, vielleicht, vielleicht, antwortete das Wellblechdach.
»Was uns nicht automatisch zu Freunden macht«, erklang es aus dem Wohnwagen. »Deine beiden Flanken lassen mich etwas anderes glauben!«
Jan und Hendrik erstarrten. Hendriks Lippen formten ein Wort, und Jannah hörte ihn über das Headset in ihrem Ohr: »Weiter?«
Jannah schüttelte den Kopf. »Wir suchen keinen Streit«, rief sie, »sondern eine Frau.«
Ein Moment des Schweigens, dann: »Mit gelber Mütze?«
»Genau die. Wenn sie bei dir da drin ist: Lass sie frei, und wir sind nur noch eine Erinnerung. Wie gesagt: Wir suchen keinen Streit!«
»Wer seid ihr?«
»Frauen und Männer auf einer Mission.«
»Und ihr wollt die Frau? Warum? Um sie zu töten?«
Ohne Informationen preiszugeben, richtete Jannah möglicherweise ein Blutbad an. Doch wie viel durfte sie verraten? Unbestimmt sagte sie: »Um sie zu schützen. Vor den Kehlianern.«
Diesmal dauerte es länger, bis der Kerl voll Bitterkeit rief: »Dann habt ihr versagt.«
Jannah wischte sich den Regen aus dem Gesicht. »Was ist passiert?«
Die gelbe Mütze flog in einem spitzen Winkel aus der offenen Tür, landete unter dem Wellblechdach im Trockenen; ein postgelber Fleck in all dem Matsch, die eine Seite dunkelrot verfärbt.
»Sie haben sie erwischt«, erklärte der Kerl. »Vermutlich ein Querschläger.«
Jannah blickte die Mütze an. Der aufgestickte Smiley grinste höhnisch. Zu spät, Lady. Dann sah sie die Reihe von Einschusslöchern in der Außenhülle des Wohnwagens. Seine Geschichte könnte stimmen. Dennoch fragte sie: »Warum sollte ich dir glauben?«
»Warum sollte ich lügen?«
Darauf fiel ihr keine Antwort ein. Sie an seiner Stelle hätte gelogen und Sarahs vermeintliches Leben als Druckmittel benutzt, um Zeit zu schinden, außer … er hatte keine Freunde, die irgendwo in der Nähe waren und ihm helfen konnten.
Ihr Blick fand den toten Gardisten zu ihren Füßen. Ein Auge starrte zu ihr auf, das andere war ein Krater voller Blut. Ein toter Kehlianer.
Jannah tat das, wofür ihre Mutter sie immer schimpfte: Sie hörte auf ihr Bauchgefühl und reichte ihr Gewehr an Michael, der neben ihr stand und verständnislos dreinblickte, als er die Waffe an sich nahm.
Jannah rief: »Ich komme jetzt in den Wohnwagen. Allein und unbewaffnet. Ich muss wissen, ob du die Wahrheit sagst. Wenn ja, verschwinden wir wieder. Wenn nicht, haben wir beide ein Problem.« Ohne eine Erwiderung abzuwarten, setzte sie sich mit erhobenen Armen in Bewegung. Der vom Regen schwere Poncho zerrte an ihr, die Fransen wippten hin und her, doch Jannah straffte die Muskeln und hob die Arme noch ein wenig höher.
Der Lautsprecher knackte in ihrem Ohr. Hendriks Stimme war heiser vor Aufregung: »Das ist Wahnsinn! Du weißt nicht, was dich da drin erwartet!«
»Deswegen werde ich es herausfinden.«
»Aber doch nicht so! Deine Mutter lyncht dich, wenn sie davon erfährt! Und uns auch!«
»Hast du hier das Kommando oder ich?«, fragte Jannah scharf und beendete damit die Diskussion. Den Rest des Wegs schwieg der Ohrhörer, und als Jannah unter das Wellblechdach trat, hörte sie das Trommeln ihres Herzens und das Rauschen ihres Blutes so laut wie den Regen.
»Ich stehe jetzt genau vor der Tür«, rief sie. »Ich komme langsam rein, in Ordnung?«
Das Plastik der Bierkiste knarzte und bog sich ein wenig durch, als sie einen Fuß darauf setzte. Ihre Finger fanden am Türrahmen Halt. Die Außenhülle des Wohnwagens war kalt und klamm von der regenschweren Luft.
»Ob das in Ordnung ist?«, wiederholte sie, und ihre Stimme zitterte ein wenig.
»Die Hände zuerst! Ausgestreckt und Handflächen nach oben!«
»Okay.« Ganz langsam schob Jannah ihre Hände durch die Türöffnung, bis er »Weiter!« rief und sie vollständig eintrat.
Der Lauf einer Pistole deutete auf ihre Stirn, hinter ihm lag ein Sturmgewehr der Kehlianer griffbereit. Er hielt nicht zum ersten Mal eine Waffe in Händen, und seine lauernde Haltung erinnerte sie unweigerlich an den Dreckshund, der draußen lag. Und doch waren es seine Augen in der Farbe feuchten Bärenfells, die ihr einen Schauder die Wirbelsäule hinabjagten.
Wortlos standen sie sich gegenüber und musterten sich.
»Hi!«, sagte sie schließlich. »Ich heiße Jannah.«
Er hob eine Augenbraue. »Was soll das werden?«
»Macht man das nicht so? Man begrüßt sich, stellt sich vor, redet über das Wetter. Smalltalk eben.«
Er musterte sie durchdringend, senkte den Blick Richtung Boden und sah sie dann wieder an. »Erledige deine Pflicht und verschwinde.«
Jannah zögerte. Ihr Mund wollte Wörter formulieren, aber die Buchstaben fanden nicht zusammen. Also kam sie ihrer Aufgabe nach und ging neben der Frau auf die Knie.
Er hatte die Wahrheit gesagt: Sarah Engelhart war tot.
Als sich Jannah wieder erhob, tropfte Blut von den Fransen ihres Ponchos, die den Boden berührt hatten.
»Wer bist du?«, fragte sie.
Sein Kehlkopf, halb unter dem Bart zu sehen, hüpfte nach oben. »Malek«, antwortete er. »Ich heiße Malek.«
Sie versuchte es mit einem grüßenden Nicken. »Und was tust du hier alleine im Wald, Malek? Warum hast du die Wichser alle umgebracht?«
»Geh jetzt!« Seine Kopfbewegung wies zur Tür.
»Nein«, sagte sie entschieden. »Vielleicht stehen wir auf derselben Seite. Auf der richtigen Seite.« Möglicherweise beging sie eine riesige Dummheit, doch ohne Risiko kamen sie nicht vorwärts, also fügte sie hinzu: »Auf der Seite gegen Kehlis.«
In seinen Augen lag Unverständnis und Abneigung, und diese Erkenntnis ging ihr durch und durch. Die feinen Härchen an ihren Armen richteten sich auf. Die Worte kamen ganz von selbst: »Du bist free!«
Die Mündung des Pistolenlaufs rückte näher. »Was schwafelst du da?«
Jannah wich nicht zurück. Sie dachte an das ausgeweidete Reh neben der Tür, an den platten Reifen seitlich der Bierkiste, an die Lage des Wohnwagens tief im Wald, ohne Strom und fließend Wasser. Konnte es möglich sein, dass er all die Jahre nichts mitbekommen hatte? Ein kampferprobter Mann, der drei Kehlianer und einen abgerichteten Argentino niedermachte, wäre in ihren spärlichen Idealistenreihen Gold wert. »Wie lange lebst du schon hier?«
»Spielt keine Rolle. Unsere gemeinsame Zeit ist um. Dort ist die Tür.«
Bestimmt schüttelte Jannah den Kopf. »Es spielt eine sehr große Rolle, Malek! Du bist free und weißt es nicht einmal! Du könntest mit uns kommen. Wir könnten dir helfen! Du hast ja keine Ahnung, was für ein Glück du hast!«
»Glück?«
Jannah nickte. »Es muss dein Glückstag sein.«
Noch bevor sie begriff, was das Flackern in seinen Augen bedeutete, glänzte in seiner anderen Hand ein Messer. Im selben Atemzug war er bei ihr, stieß sie herum, und dann streichelte die Klinge ihren Hals.
»Glück?«, knurrte er ihr ins Ohr, und ein Hauch von Wildkräutern strich ihr über die Nase. »Weißt du, was das dahinten ist?« Die Pistole ruckte herum, deutete in den hinteren Wohnwagenteil. Erst jetzt bemerkte Jannah die menschliche Silhouette unter dem blutbespritzten Bettlaken.
»Keine Ahnung«, flüsterte sie.
»Das ist mein bester Kumpel! Von diesen Wichsern erschossen! Er ist noch warm, und du redest von Glück!« Er stieß die Luft aus und drängte sie zur Ausgangstür, das Messer blieb an ihrer Kehle.
In Jannahs Ohr ertönte Hendrik. »Scheiße! Scheiße! Verdammte Scheiße! Jannah! Tu was er sagt! Lock ihn raus! Ich schalte ihn dann aus.«
Malek schien Hendriks Stimme vernommen, aber nicht verstanden zu haben, denn er zischte: »Was hat er gesagt?«
»Dass sie dich draußen … ausschalten.«
»Wirklich? Dich nehme ich aber mit!«
Gemeinsam traten sie aus dem Wohnwagen, wobei das Messer Jannah ein wenig ritzte, als er direkt hinter ihr die Bierkiste herunterstieg. Es musste verdammt scharf sein.
Nur drei ihrer Truppe blickten grimmig herüber: Hendrik, Jan und Michael. Sabine hatte sich irgendwohin zurückgezogen.
»Keiner schaltet ihn aus!«, rief Jannah. »Er will mir nichts tun!«
»Das sieht verdammt nach dem Gegenteil aus«, entgegnete Hendrik und hob sein Gewehr höher. Er war ein guter Schütze, aber einen finalen Rettungsschuss traute sie dem ehemaligen Systemadministrator nicht unbedingt zu.
Und plötzlich wusste Jannah, was in Maleks Augen geflackert hatte. Sie schluckte ihre Furcht hinunter und rief: »Er hat einen Freund gegen die Kehlianer verloren! Er ist blind vor Trauer und Wut! Es war mein Fehler!« Und leiser sagte sie: »Das wollte ich nicht, Malek.«
Sein Atem kam hart und stoßweise. Der Druck der Klinge ließ ein wenig nach, verharrte aber an ihrem Hals. »Wir werden jetzt ganz langsam verschwinden«, rief er Hendrik entgegen. Der grollende Zorn war aus seiner Stimme verschwunden, stattdessen klang er unendlich müde. »Und wenn wir außer Schussweite sind, lasse ich sie frei. Verstanden?«
»Das wird er!«, fügte Jannah hinzu.
Hendrik rang sichtlich mit sich, doch er nickte. »Abgemacht. Aber solltest du ihr etwas antun, finden wir dich!«
»Fairer Deal!« Malek führte Jannah mit kleinen Schritten am Wohnwagen entlang zur Seite.
Jan bekam riesengroße Augen. »H-H-H-Hendrik!«, stammelte er. »Hendrik!«
»Was denn?«
»D-d-das … das ist einer der W-W-Wutkowski-Brüder! Ja! Stell ihn dir ohne Bart vor! Er ist es!«
Wutkowski. Der Name rief in Jannah eine blasse Erinnerung wach. Sie war sich sicher, den Namen schon gehört, vielleicht in der Zeitung gelesen oder in den Nachrichten vernommen zu haben. Irgendwann vor langer Zeit, als die Welt noch in Ordnung gewesen war.
Sie traten unter dem Wellblechdach hervor in den Regen. Einen halben Meter weiter erreichten sie das Ende des Wohnwagens und die Wiese daneben. Hinter ihnen raschelte das Gras, und ein Pistolenabzug knackte.
Panik packte Jannahs Eingeweide. Das hörte sich nach dem Distanz-Taser an. Sabine hatte sich angeschlichen und dabei das Messer an meinem Hals übersehen!
»Nicht!«
Ihr Schrei kam zu spät.
Malek wurde getroffen. 50000 Volt jagten über die Nadelelektroden durch seinen Körper. Seine Muskeln kontrahierten, krampften sich zusammen, besonders in den Regionen nahe der beiden Projektile. Sein rechter Arm zuckte. Die Klinge tauchte knapp über Jannahs Schlüsselbein ins Fleisch ein.
Roter Regen erfüllte die Luft, während sie mit Malek Wutkowski zu Boden ging.
Kapitel 4
Berlin
Maria Müller, geborene Król, kauerte auf dem Fahrersitz und beobachtete durch die Frontscheibe des SUV den Kindergarten ihres Sohns Paul. Das einstöckige Gebäude mit dem Zeltdach aus rostbraunen Frankfurter Pfannen lag hinter einem Gitterzaun und kahlen Sträuchern am Rand des Stadtparks. Im Inneren brannte Licht, weiß und grell, das den gebastelten Fensterschmuck von außen schwarz erscheinen ließ.
Auf dem Parkplatz standen neben Marias Wagen noch zwei weitere: der Kombi von Frau Petri-Holden in der reservierten Parkbucht für die Kindergartenleiterin und daneben der Familienschlitten von Emmas Mutter. Leider war der in die Jahre gekommene Golf von Caro, der Mutter von Pauls bestem Freund Finn, nicht zu sehen. Wäre auch zu schön gewesen. Caro holte Finn wegen ihres frühen Feierabends fast immer als Erste ab, während Maria häufig die Letzte war. Falls sie sich doch einmal hier trafen, quatschten sie so lange, bis sie die Letzten waren.
Maria blickte sich noch mal um, und als sie sicher war, nicht beobachtet zu werden, massierte sie sich den Bauch. Ihr war übel, und ihre linke Seite fühlte sich an, als hätte sie faustgroße Kieselsteine verschluckt. Die Massage brachte kaum Linderung, und Maria brach sie ab, als sie Emma mit ihrer Mutter Nora den Gehweg vom Kindergarten zum Parkplatz entlangkommen sah.
Emma lief brav neben Nora her, die Maria hinterm Steuer bemerkte, ihr flüchtig zunickte und einen Schritt zulegte. Keine Minute später waren sie am Wagen, eingestiegen und davongefahren. Die Rücklichter wurden in der hereinbrechenden Dämmerung kleiner und kleiner.
Marias Blick richtete sich wieder auf die erleuchteten Fenster hinter dem mannshohen Gitterzaun. Sie atmete tief durch, schloss den obersten Knopf ihrer Jeans und stieg aus.
Der Asphalt glänzte nass vom Regen am Mittag, war übersät mit braunen Flecken von welkem Laub. Der Weg führte knapp dreißig Meter um das Gebäude herum zum Eingang. Hier hatten die Kinder den Metallzaun mit bunten Schnüren verziert, an denen Scherenschnitte von Blumen, Sternen und dem ABC baumelten, die heute jedoch regenfeucht und farblos herabhingen.
Das Eingangstor des Grundstücks quietschte und fiel mit lautem Krachen hinter Maria ins Schloss. Liegengelassenes Spielzeug säumte ihren Weg.
Sie öffnete die Tür aus Chrom und Glas und betrat die geräumige Diele. An den Kleiderhaken, die sich auf Hüfthöhe über die gesamte Länge des Flurs erstreckten, hingen vereinzelte Schals. Ein vergessener Handschuh steckte auf einem der Haken, ein erhobener Zeigefinger aus rosa Stoff.
»Paul!«, rief sie. »Ich bin da!« Ihre Stimme hallte laut in die Stille hinein – genauso wie ihr Schnaufen. Maria atmete zu schnell und nur flach in die Brust. Der Druck in ihrer Magengegend hatte sich durch die Bewegung verlagert und schmerzte, ließ sie jeden Herzschlag überdeutlich fühlen, und doch sank sie lachend in die Hocke, als ihr Sohn aus einem der Zimmer stürmte, bereits aufbruchsbereit angezogen. »Na, mein Großer!«
Paul brachte den Geruch von Kakao mit sich, drückte sich an ihre Schulter, vergrub sein Gesicht in ihrem wollenen Mantel.
Frau Petri-Holden, die Kindergartenleiterin, trat aus derselben Tür wie Paul. Mit vor der Brust verschränkten Armen lehnte sie sich gegen den Rahmen. Beobachtete. Die Augen auf Maria gerichtet.
Sie schenkte der Erzieherin ein flüchtiges Lächeln, schob dann Paul sanft von sich. Ihre Hände ruhten auf seinen Schultern. »Und wie war dein Tag? Habt ihr etwas Tolles gebastelt?«
Zu ihrer Verwunderung stiegen Tränen in seine Augen, die nun wie feuchte Inseln in seinem blassen Gesicht schimmerten. »Finn und … und seine Mama sind geholt worden«, stieß er heiser hervor.
Schon hing er wieder an ihrer Schulter. Die Wolle ihres Mantels sog seine Schluchzer auf.
Maria drückte ihn fest an sich, strich ihm über den Rücken. Das Lächeln auf ihrem Gesicht war verschwunden, und ihr Blick fand den von Frau Petri-Holden, die wortlos das Geschehen betrachtete.
Die blonde Frau löste sich vom Türrahmen und kam auf sie zu. »Finn hat heute Morgen gebeichtet«, erklärte sie so nüchtern, als ob sie den Regenschauer vom Morgen erwähnen würde. »Ich musste die Garde informieren.«
Es dauerte einen Moment, bis Maria den plötzlich entstandenen Kloß in ihrem Hals hinuntergeschluckt hatte. »Das war gut«, sagte sie. »Am Ende hätte er Paul noch verdorben.«
Eine Augenbraue von Petri-Holden wanderte nach oben. »Finn hat nicht für sich gebeichtet. Er hat für seine Mutter gebeichtet.«
Diesmal dauerte es länger, bis Maria reagieren konnte. Caro war eine herzensgute Frau, ein fröhlicher Lockenkopf mit schwarzen, dicken Augenbrauen, roten Lippen und der Intelligenz einer Professorin. Leider auch gesegnet mit dem Mundwerk einer Straßenhure. Das war ihr sicher zum Verhängnis geworden, zusammen mit ihrer kritischen Betrachtung des aktuellen Tagesgeschehens. Sie hatte sich viel für Politik interessiert und kein Blatt vor den Mund genommen, wie schlecht sie diese fand. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis jemand sie beichtete. Oder hatte Finn lediglich über die chronischen Magenbeschwerden gesprochen, an denen auch Caro litt? Sie war bereits die Dritte aus dem Bekanntenkreis, die diffuse Magenprobleme hatte und von einem Familienangehörigen gebeichtet worden war.
Wie zur Antwort gurgelte und gluckerte ihr Magen geräuschvoll.
Maria übertönte es mit einem Husten. Sie stemmte sich hoch, wobei sie Paul auf den Arm nahm. Sie wischte ihm eine Träne von den bläulichen Schatten der winzigen Augenringe.
»Das haben Sie sehr gut gemacht, Frau Petri-Holden. Ich bin froh, dass mein Sohn eine so vorbildlich geführte Institution besucht. Nicht auszudenken, was Caroline alles hätte anrichten können, wenn Sie das nicht gemeldet hätten. Herzlichen Dank!«
Die Leiterin lächelte, doch ihre Augen blieben ausdruckslos. »Danken Sie dem Herrn und Kehlis, nicht mir. Ich tue nur meine Pflicht, wie Sie auch.« Die Blonde kam auf Armeslänge heran. »Und ein Ratschlag unter uns: Paul wirkt in letzter Zeit ein wenig angeschlagen. Vielleicht brütet er eine Grippe aus. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, der ihn gründlich untersucht.«
»Ich will nicht zum Arzt!« Paul löste sich von Marias Schulter und sah sie erschrocken an. »Das letzte Mal hat er gesagt, es tut überhaupt nicht weh, und es hat aber wehgetan!«
»Das letzte Mal hast du auch eine Zecken-Impfung bekommen.« Maria strich ihrem Sohn eine widerspenstige Haarsträhne aus der Stirn. »Wenn er dich wegen einer Grippe untersucht, schaut er dir nur in den Hals und hört dich mit einem Stethoskop ab. Du weißt schon: Dieser Schlauch, den der Onkel Doktor immer um seinen Hals hängen hat. Das tut überhaupt nicht weh. Du darfst ihm sogar deine Zunge rausstrecken.«
»So?« Paul zeigte seine vom Kakao belegte Zunge.
Maria lachte. »Genau so, mein Schatz.«
»Dabei können Sie ihn auch gleich auf diesen unaussprechlichen Wahnsinn testen lassen«, schlug die Leiterin vor. »Nicht dass er ebenfalls irgendwann beichten muss.«
Marias Kopf ruckte herum. »Mein Sohn muss nicht beichten!« Die Worte kamen ein wenig zu scharf. »Er ist in dieser Hinsicht kerngesund! Haben wir uns verstanden?«
In den Augen der Blonden spiegelte sich die Deckenlampe als verzerrtes Lichtquadrat wieder. »Entschuldigen Sie, Frau Müller. Ich wollte Sie nicht brüskieren und schon gar nicht verdächtigen, nichts läge mir ferner aber es täte mir im Herzen weh, wenn wir den lieben Paul oder sogar Sie nicht wiedersehen würden. Heutzutage muss man ja jederzeit damit rechnen, dass irgendjemand aus dem Umfeld abgeholt wird. Ich habe gehört, dass immer häufiger Menschen mit Magenbeschwerden betroffen sind, und das in allen Bildungsschichten. Treffen kann es also jeden. Hoffen wir, dass dies nur eine kurze Phase ist.«
Frau Petri-Holden nickte zum Abschied und stupste Paul sanft gegen die Schulter, auf der ein silberner Aufnäher in Form eines Parallelogramms mit einem stilisierten J angebracht war. »In Kehlis, kleiner Mann!« Dann machte Frau Petri-Holden auf dem Absatz kehrt. Das Klappern ihrer halbhohen Absätze hallte durch den Flur.
»Na!«, zischte Maria ihrem Sohn ins Ohr.
»In Kehlis!«, rief er Frau Petri-Holden hinterher.
Diese warf ihnen einen kurzen Blick über die Schulter zu und verschwand dann in einem der angrenzenden Räume. Die Tür fiel leise hinter ihr ins Schloss.
Abermals gurgelte Marias Magen, so schmerzhaft, dass ihre Beine zitterten. Da sie jetzt allein mit ihrem Sohn war, stieß sie ein Seufzen aus.
»Das hast du sehr gut gemacht«, lobte sie ihn leise. »Komm, wir fahren nach Hause.«
»Aber wirklich nach Hause! Ich will nicht zum Doktor.«
»Musst du auch nicht.«
»Nein?«
»Nein. Du bist kerngesund, mein Engel.«
»Und mein Bauch? Der hat heute wieder gegrummelt.«
»Psst!«, flüsterte Maria und legte Paul den Zeigefinger über die Lippen. »Du weißt, dass man das nicht sagt. Der Bauch arbeitet nur. Der räumt dein Essen auf! Das gehört sich so.«
Paul sah sie müde an, dann nickte er.
Auf dem Weg zum Auto lief er so brav neben ihr her wie Emma neben ihrer Mutter. Maria war stolz auf ihn, und gleichzeitig hätte sie in Tränen ausbrechen können. Verstohlen strich sie mit dem Handballen unterhalb des Rippenbogens entlang, um den heftigen Druck im Inneren ein wenig zu lindern. Umsonst. Er würde noch schlimmer werden. Es wurde immer im Laufe des Abends schlimmer.
Kapitel 5
Nahe Grauach