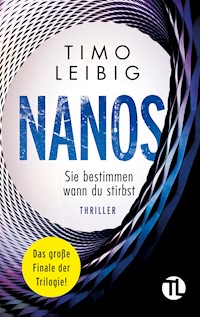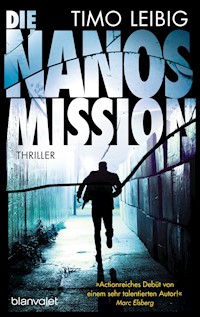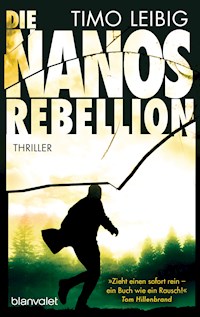
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Malek Wutkowski
- Sprache: Deutsch
Viele träumen davon die Welt zu retten – aber nur einer hat das Zeug dazu …
Deutschland 2029: Während die Bevölkerung mit Hingabe ihrem manipulativen Kanzler dient, formiert sich im Untergrund eine Rebellion. Eine Gruppe Menschen, die gegen die gedankenverändernden Nanos immun ist, hat einen Weg gefunden, um das System zu stürzen. Malek Wutkowski war einer von ihnen, doch er hat sich von den Rebellen abgewandt und verfolgt sein eigenes Ziel: seinen Bruder Dominik, einen ranghohen Mann des Regimes, zu retten. Ein riskanter Plan, denn um Dominik von den Nanos zu erlösen, muss er ihn erst umbringen …
Bei Penhaligon unter dem Titel »Nanos. Sie kämpfen für die Freiheit« erschienen.
Alle Bücher der Malek-Wutkowski-Reihe:
Nanos. Sie bestimmen, was du denkst / Die Nanos-Mission
Nanos. Sie kämpfen für die Freiheit / Die Nanos-Rebellion
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Malek Wutkowski ist auf der Flucht: vor seiner Vergangenheit, den fanatischen Anhängern von Kanzler Kehlis und nun auch vor den Rebellen, denen er sich im Kampf gegen das Regime angeschlossen hatte. Nach dem Angriff auf die Gardedirektion 21 will Malek seinen Bruder Dominik, den Konfessor Nummer Elf, einen der ranghöchsten Männer des Regimes, auf seine Seite ziehen. Doch dazu muss er die gefährliche Lifewatch vom Handgelenk seines Bruders entfernen – ein sicheres Todesurteil für Dominik. Denn in jeder Lifewatch steckt ein Mechanismus, der ihren Träger tötet, sollte man versuchen, die Uhr zu entfernen. Doch Malek glaubt, eine Lösung zu kennen – und eine Möglichkeit, um die Macht der gedankenverändernden Nanos zu brechen und die Bevölkerung zu befreien. Vorausgesetzt, er bleibt am Leben …
TIMOLEIBIG
DIE NANOS-REBELLION
Sie kämpfen für die Freiheit
THRILLER
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Timo Leibig
Erstmals erschienen unter dem Titel »Nanos – Sie kämpfen für die Freiheit«
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
© 2019 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Hanka Leo
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: plainpicture/Mark Owen
BL · Herstellung: dm
Satz: Uhl+Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24091-2V002
www.blanvalet.de
Für meine Nichte Cora.Bleib, wie du bist – starke Frauen kann es nicht genug geben.
Was bisher geschah
Deutschland 2028. Die Bevölkerung ist hörig. Dank Nanoteilchen in Lebensmitteln und im Trinkwasser glauben die Menschen alles, was ihnen die Regierungspartei weismacht.
An deren Spitze steht Johann Kehlis. Mit seiner Lebensmittelfirma JK’s wurde der Lebensmittelchemiker reich, bevor er zusammen mit dem Nanoforscher Carl Oskar Fossey und dessen Firma SmartBrain die Nanos entwickelte, mit denen er die Bevölkerung manipuliert. Seit einigen Jahren ist Kehlis Bundeskanzler, vergöttert und gewählt mit absoluter Mehrheit. Mithilfe der Garde und seinen Konfessoren – einer Spezialeinheit emotionsloser Soldaten – sorgt er für Ordnung und die Einhaltung seiner Gesetze.
Das muss er, denn einige wenige Bürger sind »free«, also resistent gegen die manipulativen Nanos, und bedeuten eine Gefahr für das System. Die meisten werden zwar von aufmerksamen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gebeichtet, also denunziert, und daraufhin von Konfessoren in Gardedirektionen gebracht, aber ein kleiner Teil kann sich der Staatsgewalt entziehen und sammelt sich im Untergrund zu einer Rebellion.
Zu dieser stößt der entflohene Häftling Malek Wutkowski. Zu dreißig Jahren Haft verurteilt, floh er mit seinem Mentor und Freund Tymon Kròl nach acht Jahren Haft aus der JVA Grauach. Tymon starb bei der Flucht.
Vor ihrer Inhaftierung bildeten Malek und Tymon zusammen mit Maleks Bruder Dominik das kriminelle Kròl-Wutkowski-Trio. Unterstützt wurden sie von Tymons Schwester Maria.
Um die soll sich Malek nun kümmern – das Versprechen ringt ihm Tymon kurz vor seinem Tod ab. Ein schwieriges Unterfangen, da Maria nach Maleks und Tymons Inhaftierung untertauchte. Malek sieht die Chance, sie mithilfe der Rebellion aufzuspüren. Dafür stellt er sich in deren Dienst.
Die Rebellenführung – auch DasQuartett genannt –, bestehend aus dem Datenbaron Vitus Wendland, der ehemaligen Bundeswehrmajorin Barbara Sterling, dem Arzt Jörg Imholz und dem Unternehmensberater Sean, plant die Entführung des Nanoforschers Carl Oskar Fossey. Man verspricht sich, mit dessen Hilfe eine Möglichkeit zu finden, Kehlis’ Nanosystem zu unterwandern, gar zu zerstören. Malek Wutkowski scheint aufgrund seiner kriminellen Expertise genau der Richtige für die heikle Fossey-Entführung zu sein.
Und er ist der Richtige. Zusammen mit Jannah Sterling, der Tochter der Majorin, und Hendrik Thämert gelingt es ihm, den Forscher zu entführen. Im Gegenzug erhält er Informationen über Marias Aufenthaltsort, den die Rebellen ausfindig machen konnten: Berlin.
Dort erwartet Malek eine unschöne Überraschung: Der ranghohe Regierungsbeamte Konfessor Nummer Elf hat Marias fünfjährigen Sohn Paul in seine Gewalt gebracht. Er will sie dazu bringen, ihren alten Weggefährten Malek auszuliefern. Malek kann Maria überzeugen, nicht auf den Deal einzugehen, sondern mit ihm eine Befreiungsaktion zu wagen – wie in alten Zeiten. Zu zweit dringen sie gewaltsam in die Gardedirektion 21 ein, um Paul zu befreien.
Der Plan misslingt, denn Konfessor Nummer Elf entpuppt sich als niemand anders als Maleks tot geglaubter Bruder Dominik, der mit einer solchen Aktion gerechnet hat. Er lässt Malek und Maria inhaftieren – bis Jannah Sterling zusammen mit einer Rebellentruppe aufkreuzt und die drei befreit. Bei der Flucht erschießt Dominik Wutkowski Maria, bevor Jannah ihn mit einem Schuss in die Schulter außer Gefecht setzen kann.
Nun will Malek Wutkowski nicht zurück zu den Rebellen. Entsetzt davon, dass sein Bruder lebt und im Dienste des Regimes steht, fasst er einen Plan: Er wird Dominik befreien und ihm die Lifewatch abnehmen. Und so setzt er sich von der Rebellion ab, denn er glaubt, allein mehr zu erreichen.
TEIL 1
__________
Observation
Kapitel 1
Südbayern, Justizvollzugsanstalt Kronthal
Erik »Der Fuchs« Krenkel hatte es sich zur Mission gemacht, die JVA Kronthal in einen Hort erstklassiger Alkoholika zu verwandeln. Fast jeder Insasse wusste zwar, dass man Früchte, Wasser und Hefe miteinander mischen und einige Tage bei Wärme lagern musste, um eine natürliche Gärung in Gang zu setzen und in der Folge Alkohol zu erzeugen, doch gab es im Knast keine Hefe. Einfallsreich war man trotzdem, und Brotreste schafften Abhilfe. Entsprechend mundete der Aufgesetzte wie Wein mit Kotzgeschmack.
Nicht so mit Eriks selbst gemachter Hefe, die liebevoll Fuchsspritz genannt wurde. Er zwackte nichtgeschwefelte Rosinen aus dem Frühstücksmüsli ab, besorgte sich Honig aus dem Knastladen und setzte beides zusammen mit Leitungswasser in ausgekochten Müllbeuteln oder Mineralwasserflaschen an; auf einen Liter Wasser kamen zwei Teelöffel Honig und acht gehäufte Esslöffel Rosinen. Nach zwei Tagen bildeten sich kleine Bläschen an der Oberfläche, die Flüssigkeit trübte sich ein, nach vier bis fünf Tagen schwammen die Rosinen auf und voilà – fertig war die Flüssighefe. Sie roch angenehm weinig und katapultierte den Aufgesetzten der Häftlinge in andere geschmackliche Sphären.
Erik verkaufte oder tauschte seinen Fuchsspritz in Portionen von einhundert Millilitern, abgefüllt in ausgewaschenen Kaltgetränkeflaschen, was für einen Liter ordentlichen Aufgesetzten reichte. Entsprechend mangelte es ihm an wenig; er hatte genug Zigaretten, löslichen Kaffee und Pornoheftchen und blieb außerdem von der meisten Knastscheiße verschont. Auch wollte keiner den einzigen inhaftierten Apotheker verprellen, der im Tausch für andere Waren den ein oder anderen medizinischen Ratschlag parat hatte. Erik »dem Fuchs« Krenkel vertraute man mehr als dem Anstaltsarzt.
Auch der frische Hefeansatz roch einwandfrei und sah gut aus. Die meisten Rosinen schwammen oben, nur ein paar Bläschen waren noch zu sehen. Morgen würde er fertig sein. Der gesamte Liter war bereits restlos vorbestellt.
Erik schraubte die Mineralwasserflasche zu und klemmte sie – eingeschlagen in ein Handtuch – zwischen Matratze und Bettgestell des Stockbetts. Er legte sich hin, verschränkte die Arme hinterm Kopf. An der Decke über ihm hing wie in den letzten achthundertsiebzehn Nächten das allabendliche gerippte Lichttrapez, das von der Fassadenbeleuchtung durchs vergitterte Fenster geworfen wurde.
Der Anblick langweilte ihn. Der ganze Aufenthalt in der JVA langweilte ihn. Die ersten Wochen, in denen er sich akklimatisiert und seine Position in der Gefangenenhierarchie bestimmt hatte, waren schnell verflogen, aber seitdem … Ihm fehlte eine Herausforderung und ein ebenbürtiger Gesprächspartner. Und am allermeisten langweilte ihn sein Dilemma. Die Vernunft gebot ihm, eine weitere Straftat zu begehen, die seine Haftentlassung in knapp zwei Jahren um weitere ein, zwei oder drei nach hinten verschieben würde, doch sein Bauch riet zu einem eleganten Ausbruch. So schwer würde es nicht sein.
Erik bemerkte, wie er mit den Zähnen knirschte, und öffnete den Mund, um seine verkrampfte Kiefermuskulatur zu entspannen. Dabei entwich ihm ein langer Atemzug.
Hätte er damals nur seinen Mund gehalten, dann wäre er vermutlich längst draußen, aber nein, so war er für dreizehn Tage in die Gardedirektion 4 eingerückt, gebracht vom Konfessor mit der Nummer acht auf der Armbanduhr, und danach weiter in die JVA Kronthal. Raus aus der JVA Grauach, raus aus der Wäscherei, weg von seinen Kumpels Malek und Tymon, mit denen er eingesessen hatte, und rein in den Irrsinn.
Nur dreizehn Tage.
Bei der Erinnerung zitterten seine Hände. Zum Glück war es nur ein kurzes Gastspiel gewesen – seiner Lügerei sei Dank. Mephistopheles war sicher stolz auf ihn.
Erik rieb sich über das Gesicht. Er wusste, dass er das Dilemma heute nicht lösen würde. Er wollte nicht mehr dorthin, in keine Gardedirektion und in die Hände von Wahnsinnigen, auf keinen Fall, aber er wollte auch nicht in einer Gefängniszelle an Langeweile sterben. Bald, Anfang März, wurde er 43 Jahre alt, 86 hatte er sich vorgenommen – wie sein Großvater Heinz. Vielleicht sollte er seine Lebenserwartung nach oben korrigieren, einfach um nicht in ein paar Tagen über den Zenit hinwegzugleiten. Aufs Ende zuzumarschieren fühlte sich nicht erbaulich an.
Ein Geräusch erfüllte die neun Quadratmeter messende Zelle, ließ Erik die Stirn runzeln. Auch das war nicht erbaulich. Die Beengtheit war ertragbar, auch die Überbelegung – nicht aber der Schlafplatz in der oberen Etage des Stockbetts. Sein Zellengenosse Noah Johansson hatte einfach keinen Darm mit Charme.
Gleich noch einmal stieg das Geräusch eines Abwinds zu Erik empor. Ihm reichte es. Er holte eine Packung Zigaretten und ein Feuerzeug aus dem Spalt zwischen Matratze und Bettgestell. Mit den oberen Schneidezähnen und der Unterlippe zog er sich eine Kippe heraus. Tabakgeruch erfüllte seine Nase, bevor es von unten her nach faulen Eiern stank.
Das Feuerzeug ratschte, der Tabak knisterte, und Erik sagte: »Du solltest dir mal Probiotika beschaffen.«
Johansson schnaubte. Sein Lattenrost knarrte.
»Mal im Ernst, Noah, deine Fürze stinken, als wedle jemand mit toten Fischen vor meinem Gesicht herum. Sei froh, dass ich nicht etepetete bin. Wenn du mit dem schlauen Jonny oder dem Romanello in einer Zelle hocken würdest, hätten sie dir schon längst den Hintern zugenäht.«
»Erik.«
Die Zigarettenspitze erglühte. Eine Rauchwolke stieg auf. »Ja?«
»Halt einfach die Klappe.«
»Nur, wenn du deinen Arsch hältst.«
Johansson gab nichts darauf, was Erik auch nicht erwartet hatte. Der ein Meter vierundneunzig große, zweiundneunzig Kilogramm schwere Hüne mit dem blonden Militärhaarschnitt und den traurigen blauen Augen besaß eine enorm hohe Toleranzgrenze, was an seiner Ausbildung zum Polizeibeamten und seiner jahrelangen Tätigkeit in einem Spezialeinsatzkommando liegen mochte. Er war nur ein einziges Mal in seinem Leben ausgerastet, als er den Nachbarn dabei erwischte, wie er seiner fünfjährigen Tochter den Schwanz in den Mund steckte. Der Nachbar war an seinem eigenen Penis erstickt.
Jetzt waren nur Johanssons harte Atemzüge zu hören; er litt wieder an Magenschmerzen. So wie seine Abwinde stanken, musste er innerlich halb verrottet sein, aber Erik würde sich hüten, ein ernsthaftes Wort darüber zu verlieren. Irgendein Zusammenhang bestand zwischen Magenbeschwerden und diesen Beichten, und er war insgeheim froh, dass es ihm selbst nicht so schlecht ging. Er hatte nur ein ertragbares Völlegefühl. Blieb die Frage, wie lange noch. Immer häufiger hörte er von diffusen Magenbeschwerden innerhalb der JVA, erlebte wenig später eine Beichte und sah, wie der Betroffene von der Garde oder einem Konfessor weggebracht wurde. Ob bei ihm auch irgendwann die Magenbeschwerden einsetzten? Auch er war kein Anhänger Kehlis’.
Egal. Erik würde sich nicht beschweren wie damals in Grauach. Noch einmal dreizehn Tage in einer Gardedirektion würde er nicht überstehen. Außerdem hatte er noch Wünsche und Pläne – im Gegensatz zu vielen anderen Inhaftierten. Proportional zur Haftdauer schienen bei den meisten die Wünsche abzunehmen. Am Ende blieben simple Verlangen übrig: das eigene Kind auf die Stirn küssen, die Ehefrau in den Arm nehmen, keine Schmerzen mehr haben.
Erik wollte hingegen noch an Australiens Küste mit Haien tauchen, in Japan Kugelfisch essen (und überleben), wieder eine Stammkneipe besitzen, sich ein Haus am See kaufen, sich darin eine Minibar mit einem sechzig Jahre alten Single Malt Whisky der Marke Springbank 1919 einrichten, Kubanische in die Holzbox darüber stecken, ein Hochbeet mit Erdbeeren bepflanzen und eine Klobrille aus transparentem Kunststoff mit integriertem Stacheldraht im Gästeklo montieren.
Es wurde heiß an seinen Fingern. Erik nahm einen letzten Zug von der Zigarette, drückte den Stummel in einer zum Aschenbecher umfunktionierten Wurstdose der Marke JK’s aus und behielt den Rauch lange in den Lungen, um möglichst viel Nikotin aufzunehmen. Als er den blauen Dunst gen Zellendecke blies, zog sich ein grüner Lichtstrahl mitten durch den Raum, um über der Zellentür in einem grellen Punkt zu enden.
Erik glotzte den Laser an. Der Strahl erlosch, ging wieder an, brannte eine Sekunde, erlosch, ging wieder für eine Sekunde an und erlosch.
Erik blickte auf die dunkle Wand, dann war er wieder da, der grüne Punkt – für eine Sekunde, nur um zweimal kurz zu blinken und wieder für eine Sekunde zu leuchten.
Lang, kurz, kurz, lang. Ein Code.
Tatsächlich folgte eine weitere Sequenz: Kurz, kurz, lang, kurz. Pause.
Lang, lang, lang. Pause.
Lang, kurz, kurz, lang.
Eriks Herzschlag begann zu rasen. Das war der internationale Morsecode!
»Scheiße!« Er fingerte abermals nach den Zigaretten, steckte sich eine zweite an, um den Strahl mithilfe des Rauchs besser sichtbar zu machen. Wie war das Morse-Alphabet gegangen? Er hatte es in der siebten oder achten Klasse des Gymnasiums in Informatik gelernt, nicht unbedingt sein Lieblingsfach. Wer konnte schon ahnen, dass man so einen Mist dreißig Jahre später im wahren Leben brauchen würde?
Lang, lang, lang fiel ihm als Erstes wieder ein, weil es Bestandteil des wichtigsten Codes war, den wohl jeder kannte. Es stand für den Buchstaben O, der Mittelteil des Notrufs SOS.
Dann kam auch die Codefolge lang, kurz, kurz, lang in sein Gedächtnis zurück, weil sie symmetrisch angelegt war. Sie stand für den Buchstaben X.
Die letzte Codefolge, mit der die Nachricht gestartet hatte, erriet er mehr, als dass er sie wusste, aber es konnte nur ein Buchstabe sein: F.
FOX.
Erik beugte sich aus dem Stockbett zum Fenster, stützte sich mit einem Arm auf eine Querstrebe der inneren Vergitterung, verbrannte sich beinahe an der Glut der Zigarette und spähte hinaus in die Nacht. Er sah das Altgewohnte: eine verlassene Straße – momentan mit gefrorenen Schneehaufen alle paar Meter –, die Baustelle schräg gegenüber und dahinter die schwarzen Umrisse des Stadtparks, bis ihn der Laser ins Auge traf und blendete. Er riss den Kopf zur Seite.
Kurz, kurz, lang, kurz.
Die Nachricht begann sich zu wiederholen.
Wer wollte ihn da erreichen? Und warum? Suchte jemand nach seiner Zelle, um … ja, um was? Ihm Informationen zukommen zu lassen? Ihn rauszuholen? Ihn zu ermorden? Alles war möglich, doch Letzteres eher unwahrscheinlich. Wenn jemand den Fuchs tot sehen wollte, bräuchte derjenige nur einen Häftling wie den Romanello bestechen; und es wäre nicht mal teuer. Der würde sogar seine Mutter für ’ne Dose Pulverkaffee erdrosseln.
Eriks Finger tasteten zum dritten Mal nach dem Feuerzeug. Er würde eine Antwort absetzen. Selbst wenn nichts dabei rumkam, war es ein willkommener Zeitvertreib.
Er hielt das Feuerzeug ins Fenster zwischen die Gitterstäbe, ließ die Flamme erblühen – und gleich wieder erlöschen. Das war Schwachsinn. Ein starker Laserstrahl reichte kilometerweit, wer sah aus so einer Entfernung ein mickriges Flämmchen? Mit einem Zielfernrohr vielleicht? Erik verzog das Gesicht. Möglich, aber es gab auch Laserpointer ohne Zielfernrohr. Er brauchte eine besser sichtbare Antwort.
Johansson lag auf der Seite mit dem Gesicht zur Wand, die Haare schweißnass, als Erik aus dem Stockbett kletterte. Mit einem Satz war er an ihrem gemeinsamen Tisch an der gegenüberliegenden Wand. Darauf stand eine Leselampe mit beweglichem Reflektorschirm. Erik richtete ihn aufs Fenster und schaltete das Licht an. Was sollte er morsen? Eine Bestätigung natürlich, ein simples Ja. Nur wie ging ein J? Er erinnerte sich nicht.
Sein Zeigefinger verharrte auf dem Schalter der Lampe. Er musste etwas tun. Das Licht brennen zu lassen war keine Option, das sagte dem Sender rein gar nichts, verwirrte ihn eher. Erik! Tu was! Sein Hirn gehorchte und lieferte die Erinnerung an zwei weitere Buchstaben: seine Initialen. Das E war der einfachste Code: Kurz, das K war länger: lang, kurz, lang.
Er begann sofort, die beiden Buchstaben mit der Nachttischlampe zu morsen. Knacknack.
Währenddessen rührte sich Johanssons massiger Rücken, aber der ehemalige Polizist drehte sich nicht um. Zur Wand hin fragte er: »Erik?«
Der Schalter der Schreibtischlampe knackte und knackte und knackte. Knack … knack, Knacknack, Knack … knack. »Ja.«
»Was wird das?«
»Nichts.« Knacknack. Pause. Knack … knack, Knacknack, Knack … knack.
»Nichts?«
»Nur so was wie ’n epileptischer Anfall. Gleich vorbei.« Knacknack. Pause. Knack … knack, Knacknack.
»Erik.« Das Wort kam gefährlich leise, zwischen Zähnen hindurchgepresst.
»Ja.« Knack …
»Wenn du nicht sofort aufhörst, dann …«
Knack. »Schon fertig.« Dreimal hatte er seine Initialen gesendet, was reichen sollte. Er sank gegen die Stuhllehne, blickte hoch zur Decke. Die zweite Zigarette war bis zum Filter abgebrannt, die Glut auf den Schreibtisch gefallen und zu Asche erstarrt.
Komm schon!, forderte Erik. Antworte!
Nichts geschah. Der Laserstrahl zeigte sich nicht mehr.
Erik schluckte hart. Bleib ruhig! Wer auch immer dir gemorst hat, hat sicher deine Antwort erhalten und verstanden, dass du es bist. Nur, wer war dort draußen? Wer wollte den Fuchs kontaktieren? Und wozu?
Erik wischte sich Schweiß von der Stirn, betrachtete einen Moment lang Noah Johanssons breiten Rücken. Der Hüne hatte sich wieder entspannt und offenbar von der eingegangenen Botschaft nichts mitbekommen. Gut. Erik kletterte zurück aufs Bett, um von dort ein weiteres Mal aus dem Fenster zu spähen.
Direkt vor dem Gebäude – einem Ende des achtzehnten Jahrhunderts errichteten dreigeschossigen Sandsteinquaderbau mit Walmdach – lag die von kniehohen Hecken begrenzte Rasenfläche. Von dort aus warfen drei Fassadenscheinwerfer das Licht herauf in den ersten Stock. Um nicht geblendet zu werden, schirmte Erik mit der Hand sein Gesicht ab. Hinter der schneebedeckten Rasenfläche verlief parallel zum JVA-Gelände die Fauststraße. Nicht ein Auto war darauf unterwegs, nur am gegenüberliegenden Straßenrand parkten hinter einer Absperrung einige Baustellenfahrzeuge im Lichtschein zweier Laternen. Das von Mutterboden befreite Eckgrundstück dahinter glich einem Krater, von Schnee- und Erdwällen begrenzt. Angeblich wurde dort ein JK’s-Supermarkt errichtet. Ein gewaltiger Radlader stand wie ein Räumfahrzeug inmitten des Lochs. Von dort war der Laser nicht gekommen, der Winkel stimmte nicht. Er musste von noch weiter hinten, aus Richtung des Wohngebiets, gesendet worden sein.
Erik kniff die Augen zusammen, versuchte, in der Nacht Gestalten auszumachen, doch die Dunkelheit blieb nichts als Dunkelheit. Nur auf der gut einhundert Meter entfernten Hauptstraße, auf die man von der kreuzenden Martinstraße gelangte, huschten auf vier Fahrbahnen Pkws vorbei.
Er atmete tief durch. Welchen Sinn hatte es, ihn als Empfänger einer Botschaft zu adressieren, ohne einen Inhalt zu übermitteln? War dem Sender etwas dazwischengekommen? Musste er warten, bevor er weitersenden konnte?
Abermals ließ Erik seinen Blick über Fauststraße, Kreuzung Martinstraße und das Baustellengelände schweifen, bevor er sich zurück aufs Bett legte, um die Wand über der Zellentür zu fixieren. Sie war grau und trist, nicht tapeziert und bar jeder Verzierung. Der Putz war unregelmäßig aufgetragen.
Kein grüner Punkt erschien.
Er hielt es im Bett nicht aus, schwang die Beine über die Kante, ließ sich hinabgleiten und schlüpfte in seine Turnschuhe, um in der Zelle auf und ab zu gehen, immer die Wand über der Tür im Blick. Der Fuchs marschierte häufig, um zu grübeln.
Nach der zweiten Runde knarrte wieder Johanssons Matratze. Sein Gesicht glänzte wächsern, die Augen lagen in dunklen Höhlen. »Muss das sein?«
Erik sah nur kurz zu seinem Zellengenossen. Er kannte diesen Blick eines Leidenden, der einfach nur seine Ruhe haben wollte. »Mein Bein ist eingeschlafen«, log er. »Ich leg mich gleich wieder hin.«
Johansson ließ den Kopf zurück aufs Kissen sinken, musterte die Unterseite von Eriks Bett. Seine Hände drückten ungeniert auf seinem Unterbauch herum, bis er erneut furzte und erleichtert seufzte. »Warum beichtest du mich eigentlich nicht?«
»Soll ich?«, fragte Erik ohne innezuhalten. »Zweifelst du an deinem Platz im System? Zweifelst du am System selbst?«
Johanssons Lachversuch endete in einem Keuchen. Sein Magen gluckerte laut. »Ich weiß, wo mein Platz ist«, presste er hervor, »aber weißt du das auch?«
»Selbstverständlich.«
»Und warum pochst du dann nicht gegen diese verdammte Tür und schreist nach einem Wärter? Warum leide ich noch?«
»Weil du dich nie negativ gegenüber unserem Herren geäußert hast.«
»Und die Magenschmerzen? Die Fürze? Die riecht man sogar in der Knastschlosserei!«
Erik blieb ruhig, erklärte mit seiner Apothekerstimme: »Die können verschiedene Ursachen haben: Fäulnisflora, Candida albicans, Lebensmittelunverträglichkeit, Gallensteine. Alle vier Möglichkeiten sind bei unserer Ernährungsversorgung hochwahrscheinlich. Ich weiß, wovon ich rede.«
»Aber das glaubst du doch selbst nicht!«
Nein, das glaubte er selbst nicht, aber Ahnung hatte er auch keine. Er seufzte. »Soll ich dir ’nen Strick knüpfen?« Er sah wieder hoch zur Wand über der Zellentür, an der immer noch kein Laser zu sehen war. Scheiße.
Johanssons Stimme war leise. »Vielleicht wäre es das Beste.«
Erik drehte sich nun doch zu seinem Zellengenossen um. Der lag wieder in Embryonalstellung mit dem Gesicht zur Wand, eine Hand schützend um seinen Bauch geschlungen. Vielleicht sollte ich ihn wirklich zum Schweigen bringen, bevor er mir gefährlich wird. Aber Erik Krenkel war kein Mörder, und beichten wollte er auch nicht, nicht jetzt, wo er eine Laser-Morse-Botschaft in seine Zelle erhalten hatte. Da brauchte er kein Aufsehen, keinen neuen Zellengenossen, keinen Gardisten oder gar einen Konfessor, der ihm Fragen über Noah Johanssons Abwinde stellte.
Erik wollte wieder aufs Stockbett klettern, als sich wie der klagende Ruf einer Frau Sirenengeheul im Gebäude erhob. Es fuhr ihm durch Mark und Bein. Der Feueralarm.
Um 23.41 Uhr ging auch in der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Kronthal der Alarm los. Die Wachleute der Justizvollzugsanstalt meldeten per Telefon extrem starke Rauchentwicklung am Hauptgebäude, Verdacht auf Großbrand. Alarmstufe B4 wurde ausgerufen, Garde und Notarzt wurden verständigt. Die ersten Einsatzkräfte saßen wenige Minuten später in ihren Fahrzeugen. Da bei einem Brand in einer Justizvollzugsanstalt besondere Sicherheitsmaßnahmen samt Evakuierungsvorschriften griffen, wurden zur Verstärkung die freiwilligen Wehren der umliegenden Gemeinden angefordert. Insgesamt rückten elf Fahrzeuge und fast siebzig Kameraden aus.
Sie sammelten sich vor dem Gefängnis an der Kreuzung Martin- und Fauststraße, direkt vor der Baustelle. Im ganzen Straßenzug und um die JVA herum erschwerte Qualm die Sicht. Die seit zwei Tagen anhaltende Inversionswetterlage ermöglichte es dem Rauch nicht, nach oben abzuziehen. Mit jeder Minute wurde es nebliger.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die JVA-Beamten schon mit der Räumung des Haftbereichs begonnen und brachten die Gefangenen vor den möglicherweise giftigen Dämpfen in Sicherheit.
Überall in der JVA donnerten Häftlinge mit Fäusten gegen Zellentüren, schrien, was los sei, dass es brenne, dass man sie rauslassen solle, dass die Wärter verdammte Arschlöcher seien, die sie einfach im Feuer verrecken ließen. Die Wärter brüllten dagegen, beruhigten, schimpften, fluchten, schwere Schlüsselbunde klimperten, Stiefelsohlen pochten, Sicherheitsschleusen knackten, und über allem hing das klagende Heulen der Sirene.
Auch Erik stand an der Zellentür, musterte das taubengrau lackierte Metall, während sich seine Hände schlossen und öffneten. Klopfen war sinnlos. Es gab im Falle eines Brandes einen Evakuierungsplan; man würde sie in einer vorgegebenen Reihenfolge aus den Zellen holen und aus dem vom Feuer betroffenen Trakt in einen sicheren Bereich bringen. Nur wohin, wenn das einzige Gebäude brannte? In den Innenhof, in dem sonst der Hofgang stattfand?
Auf dem Bett hatte sich Johansson aufgerichtet und musterte ihn aus glasigen Augen, als Erik zu ihrem gemeinsamen Schrank trat. »Hat das was mit deinem epileptischen Anfall zu tun?«, fragte Johansson.
Erik sparte sich eine Antwort, zog seine Trainingsjacke hervor und schlüpfte hinein. Der Zipper surrte nach oben. Die von Johansson warf er ihm zu.
»Was wird das?«
»Vermutlich Hofgang. Ich würd Schuhe anziehen. Ist verdammt frisch draußen.« Erik kramte nach seiner Wollmütze der Marke Knastmasche, die von Insassen Kronthals unter Aufsicht gehäkelt und ihm gegen eine Flasche Fuchsspritz vermacht worden war. Der Wollstoff dämpfte den Lärm.
Die Stimmen und das Klimpern eines Schlüsselbunds hörte er trotzdem. Beides näherte sich, es folgte das Knacken des Zellenschlosses. Die Tür schwang auf. Die Wachmänner Kaimann und Gosig standen im Türrahmen, beide blass mit gehetzten Blicken. An ihren Gürteln hingen Funkgeräte, die knackten und kratzige Worte ausspuckten.
»Krenkel! Johansson!« Gosig schwenkte zwei Handschellen. »Raus! Beeilung! Beeilung! Und keine Faxen machen!«
Erik trat über die Schwelle, hielt Gosig folgsam die Hände hin. Die Handschelle schnappte zu. Dann war Johansson an der Reihe. Er hatte sich tatsächlich noch schnell Turnschuhe angezogen, die Schnürsenkel hingen ungebunden auf den Boden. Um seine Handgelenke schlossen sich ebenfalls Handschellen.
Flankiert von den Wärtern ging es Richtung Treppenhaus. Auch aus anderen Zellen wurden Häftlinge geholt und jeweils von zwei Wachmännern begleitet, alles lief korrekt nach Vorschrift.
Auch wenn er innerlich nervös wurde, lief Erik ruhig den Flur entlang, von dessen Wänden ihre Schritte zurückhallten. Je mehr Häftlinge aus den Zellen geholt wurden, desto mehr nahm der Lärm ab, bis auf die Sirene.
Auf dem Weg nach unten ins Erdgeschoss passierten sie eine Reihe Schleusen und Gittertore, und Kaimann sperrte immer eines vor ihnen auf und hinter ihnen wieder zu, auch wenn nur zehn Meter nach ihnen das nächste Paar hinausgeführt wurde. Ständig zeigte er seinen Ausweis an einer Kontrolle einem wartenden Beamten, als würde nicht gerade das Gebäude abfackeln.
Die letzte vergitterte Tür öffnete sich. Eisige Luft wallte ihnen entgegen, geschwängert mit Rauch und dem Geruch von Verbranntem. Fast wie an Silvester oder im Stadion. Die Stacheldrahtrollen auf den Mauern blitzten von Blaulichtern, selbst die neblige Luft schien zu glühen. Weitere Sirenen waren zu hören, Motoren brummten, Dieselgeneratoren ratterten – die Feuerwehr war vermutlich eingetroffen.
Ein weiterer Beamter der JVA wartete neben dem Ausgang und bestätigte Eriks Vermutung, indem er zu Kaimann sagte: »Die zwei müssen noch zum Sammelpunkt H3, dann fehlt von euch nur noch Zelle einhundertzwei. Beeilt euch! Die Feuerwehr will zum Löschen sicherheitshalber den Saft abdrehen.«
Kaimann nickte nur und deutete auf den hinteren Bereich des Hofs. Ein gutes Dutzend Gefangener wartete zwischen Tischtennisplatte und Klimmzugstange, bewacht von drei Wachleuten. Ähnliche Sammelpunkte gab es auch in den anderen Ecken des Innenhofs. Erik schätzte, dass bereits knapp 70 der 106 Inhaftierten in die Kälte gebracht worden waren.
Als sie sich zu den Männern gesellten, blickte Erik hoch zum Gebäude. An mehreren Stellen stieg zäher Qualm vom Walmdach auf, suchte sich jedoch sofort den Weg nach unten. Erik verzog das Gesicht. Inversionswetterlage. Das konnte ja heiter werden. Oder war das gerade ideal?
Neugierig sah er sich um. Hinter der Mauer, die sich direkt ans Gefängnisgebäude anschloss, lag die Fauststraße. Dort gingen grelle Strahler an, ausgerichtet aufs Dach. Feuerwehrleute brüllten Befehle. Weitere Gefangene wurden herausgeführt. Noch mehr Sirenen heulten mit ihren Brüdern und Schwestern.
Curtis Romanello trat neben Erik. »Endlich mal was los, wa?« Begeisterung blitzte in den Augen des Mittdreißigers, der wegen räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung zu acht Jahren verurteilt worden war.
Erik zuckte nur mit den Schultern, versuchte, sich auf alles gleichzeitig zu konzentrieren.
Offenbar wurden die letzten zwei Häftlinge herausgeführt, begleitet von Kaimann und Gosig. Ein dritter Wachmann verriegelte den Eingang und plärrte in sein Funkgerät, dass alle Insassen evakuiert seien. Einige Sekunden später erlosch die Beleuchtung des Hauptgebäudes, die Fenster wurden dunkel. Die Strahlen der Scheinwerfer und Blaulichter draußen auf der Straße schnitten schärfer durch die immer dichter werdende Luft. Einige Gefangene grölten vor Begeisterung, schlugen ihre Handschellen lautstark gegeneinander.
Erik wollte lieber die Hände in den Taschen seiner Trainingsjacke vergraben, was wegen der Handschellen nicht ging, also ließ er sie sinken. Sein Atem hing als grauer Dunst vor seinem Gesicht.
Plötzlich röhrte etwas. Entsetzensschreie folgten, ließen alle zur Außenmauer blicken. Zwei Lichtkegel näherten sich, angeschnitten von der oberen Mauerkante. Metall kreischte. Leute brüllten. Etwas splitterte. Dann erzitterte der Boden.
Erik suchte Halt an der Klimmzugstange, und das keinen Moment zu spät. Der Boden bebte abermals, es röhrte noch lauter, dann rumste es so ohrenbetäubend, als wäre Gottes Faust gegen die Mauer gesaust – und tatsächlich: Die Gefängnismauer mit den Stacheldrahtrollen obenauf neigte sich nach innen, weiter, weiter und weiter … und kippte. Mauersteine gaben nach, es knirschte, Mörtel platzte in alle Richtungen davon, und mehrere Tonnen Stein krachten in den Innenhof. Eine Staubwolke walzte Erik entgegen. Im letzten Moment drehte er ihr den Rücken zu, umklammerte das Metall des Sportgeräts und schloss die Augen. Wie Sandpapier schmirgelten Staub und Mörtel über seine Wangen, nahmen ihm den Atem, fanden den Weg in seine Augen.
Das Röhren kam näher. Jemand schrie vor Schmerz. Der Boden vibrierte heftiger.
Erik spuckte aus, keuchte, blinzelte. Ein gewaltiger Radlader walzte sich über die Mauerreste und quer über den Innenhof, das Schaufelmaul mit den handtellergroßen Zähnen weit aufgerissen. Staub wallte um das Ungetüm, einzelne Mauerbrocken fielen wie Krümel aus dem Schlund. Ein Wärter verschwand kreischend unter einem der Räder.
Erik riss sich von dem Anblick los, richtete seine Aufmerksamkeit auf die umgekippte Mauer. Die Freiheit war knapp sieben Meter breit, eingehüllt in wallenden Rauch. Feuerwehrfrauen und -männer standen auf der Straße, nur als Schemen zu erkennen, und verfolgten ungläubig die Amokfahrt des Radladers. Andere rannten bereits in den Innenhof, darunter Sanitäter und Gardisten, um Verletzten zu helfen und die Gefangenen an der Flucht zu hindern.
Erik stolperte auf die Freiheit zu, genauso wie etliche Mithäftlinge. Zum Glück hatte er Schuhe angezogen. Lose Backsteine und Mörtelbrocken wollten ihn zu Fall bringen. Einer heruntergerissenen Stacheldrahtrolle wich er aus. Ein Feuerwehrmann in Vollmontur, Atemmaske und heruntergeklapptem Visier eilte auf ihn zu. Erik wollte ihm ausweichen, doch der Kerl war unglaublich schnell. Seine behandschuhten Hände griffen nach ihm, packten ihn, doch statt ihn aufzuhalten, zerrten sie ihn weiter, legten ihm dabei eine Feuerwehrjacke um die Schultern. Aus einem Ausrüstungsrucksack zog der Kerl eine weitere Atemmaske, drückte sie Erik übers Gesicht. Das Visier war völlig mit Ruß verschmiert, sodass Erik nur noch schlierenhaft die Umgebung erkennen konnte. Viel musste er aber auch nicht sehen. Er spürte, wie der Feuerwehrmann ihm steife Handschuhe mit Unterarmschutz überstreifte, die die Handschellen verbargen, dann stützte er ihn, zischte etwas, das Erik wegen des Lärms nicht verstand, und brachte ihn aus dem Innenhof. Gemeinsam wankten sie an den versammelten Feuerwehrleuten vorbei, stiegen über Löschwasserschläuche, wichen Fahrzeugen, Strahlern und Gardisten aus. In Eriks Kopf pochte es – die Sirenen, der Lärm, die Schreie.
Ein Notarzt wollte ihnen helfen, doch sein Retter winkte ab, deutete auf den Gehsteig. Man ließ von ihnen ab, und unbehelligt erreichten sie erst die andere Straßenseite, dann die Kreuzung zur Martinstraße und dort einen geparkten schwarzen Mittelklassewagen. Die Blinker leuchteten auf. Sein Begleiter öffnete die Beifahrertür, drückte ihn in den Sitz, umrundete die Motorhaube und sank hinters Steuer. Die Atemmaske riss er sich vom Gesicht, warf sie achtlos auf die Rücksitzbank, genauso wie den Helm. Zum Vorschein kam ein bärtiges Gesicht, darüber feuchte Haare.
Der Wagen fuhr an, noch bevor Erik die Beifahrertür zugezogen hatte.
Die nächste Kreuzung war wenige Sekunden später heran. Der Pkw bog rechts ab, nahm die lang gezogene Auffahrt zur Hauptstraße mit der vorgegebenen Geschwindigkeit und reihte sich in den Verkehr ein. Auf der Gegenfahrbahn blitzten Blaulichter, und mehrere Gardefahrzeuge bogen von der Hauptstraße ab, um vermutlich die JVA anzusteuern.
Der Bärtige hinterm Steuer blieb ruhig. Er setzte den Blinker, wechselte auf die linke Spur und beschleunigte. Im Licht der vorbeihuschenden Straßenlaternen glänzte an seinem Handgelenk unter der Feuerwehrmontur eine silberne Armbanduhr.
Erik betrachte den falschen Feuerwehrmann, das verstrubbelte Haar, den sauber gestutzten Vollbart und die dünne silbrige Narbe parallel zur Nase. Er nahm sich selbst die Atemmaske ab. »Hätt ich mir denken können.« Er lachte, bekam Staub in den Rachen, hustete, dann schüttelte er den Kopf. »Ein Radlader. Wie kreativ!«
Ein grimmiges Lächeln huschte über das Gesicht des Fahrers.
»Und erst die Rauchbomben«, fuhr Erik fort. »Und der Laser-Morse-Code. Wie dämlich war der bitte? Ohne Inhalt.«
»Du warst vorgewarnt.«
»Super! Du hättest ruhig ’ne ganze Botschaft schicken können. Ich hätt sie schon entziffert. Ich bin nicht umsonst der Fuchs.«
»Das nächste Mal vielleicht.« Malek Wutkowski grinste, nahm die Rechte vom Lenkrad und hielt sie Erik hin.
Der schlug mit seinen gefesselten Händen ein. »Schön, dich zu sehen!«
Kapitel 2
Nahe Kronthal
Der schwarze Pkw glitt als einziges Fahrzeug auf der Landstraße dahin, schlängelte sich in sanften Kurven durch das hügelige Gelände. Laut der Uhr im Armaturendisplay waren siebzehn Minuten vergangen, seit Erik und Malek von der Martinstraße auf die Bundesstraße und nach einigen Kilometern auf die abgelegene Landstraße gefahren waren, die vermutlich parallel zur Bundesstraße, ohne nennenswerten Verkehr, Richtung München führte.
Seit der Begrüßung schwiegen sie. Erik blickte zur Seitenscheibe hinaus. So viele Fragen brannten ihm auf der Zunge, doch er brauchte erst einen klaren Kopf. Zum Glück hatte Malek keine Eile, verstand vermutlich sogar, dass Erik in den ersten Minuten nach der Flucht ein wenig Zeit benötigte.
Allerdings weigerte sich Eriks Kopf beharrlich, klar zu denken. Ihm fiel nur die wunderschöne Nacht auf. Der Mond stand prächtig zwischen den Sternen, warf sein silbriges Licht über mit Schnee bedeckte Felder, verschaffte ihnen einen geisterhaften Schein. Er stellte sich vor, über eines von ihnen zu rennen. Der gefrorene Schnee würde unter seinen Füßen knarren und bei jeder Bewegung funkeln. Dazu füllte frische Luft seine Lunge, die Kälte brannte auf der Haut, während der Schnee unter seinen Fingern schmolz.
»Halt an!«, sagte der Fuchs heiser.
Malek warf einen Blick herüber, runzelte die Stirn. »Ist dir schlecht?«
»Überhaupt nicht. Halt trotzdem an! Nur drei Minuten.«
Malek zuckte mit den Schultern und bog in den nächsten abzweigenden Feldweg ein. Den Motor ließ er im Leerlauf tuckern.
Erik hatte die Beifahrertür schon aufgestoßen. Nur mit seiner Wollmütze auf dem Kopf und dem Trainingsanzug am Leib eilte er aufs Feld und hinein in den Schnee. Der knarrte tatsächlich – und knackte und funkelte und rutschte in seine Turnschuhe. Erik beschleunigte seine Schritte, rannte, flog dahin, und mit jedem Schritt drängte es näher an die Oberfläche – ein unbändiges Lachen. Es ließ ihn erzittern, seine Nasenflügel beben, erfasste ihn ganz, ließ ihn brüllen und jubeln.
Schließlich sank er auf die Knie, grub die Hände in das harte Weiß und rieb es sich über die Wangen, die Nase, die Lippen. Er steckte sich einen Eisbrocken in den Mund, lutschte daran, schmeckte die Süße des gefrorenen Wassers und spuckte es wieder aus. Einige Herzschläge lang verharrte er so, atmete schwer, bevor er ein letztes Mal all seine Emotionen hinausschrie, sich aufrappelte und leichter ums Herz zurück zu Malek Wutkowski stapfte.
Der hatte die Feuerwehrmontur abgelegt und lehnte am hinteren Kotflügel, die Hände in den Hosentaschen der schwarzen Jeans vergraben. Neben ihm stand griffbereit ein Bolzenschneider.
»Puuuh! Das solltest du auch mal machen. Lockert auf.« Erik blieb grinsend vor Malek stehen, der gut zehn Zentimeter größer war als er, und hielt ihm die Handgelenke hin. »Dann mal los.«
Malek schnappte sich den Bolzenschneider und zwickte die Kette durch. Das zerstörte Glied fiel zu Boden.
»Ahh!« Erleichtert streckte Erik die Arme. »Das tut gut. Hast du auch Werkzeug dabei, um die Schellen abzukriegen?«
Malek schüttelte den Kopf.
»Wie?! Du holst mich aus dem Knast, ohne an das Entfernen von Handschellen zu denken?«
»Die Flex war mir zu sperrig.« Malek verstaute den Bolzenschneider auf der Rücksitzbank neben der zusammengefalteten Feuerwehrmontur, drückte die Tür ins Schloss, umrundete das Heck und schwang sich hinters Steuer.
»Die Flex war mir zu sperrig«, wiederholte Erik in Maleks Tonfall, schluckte und stieg ebenfalls ein.
Während Malek den Wagen zurücksetzte, fragte Erik: »Wohin fahren wir?«
»Richtung München.«
»Kommen wir da zufällig an ’nem Imbiss oder einer Tanke vorbei?«
»Hunger?«
»Natürlich hab ich Hunger! Du weißt doch, dass es im Knast die letzte Mahlzeit um achtzehn Uhr gibt. Das ist mehr als sechs Stunden her.«
»Und?«
»Ja, kannst du dir nicht vorstellen, was so eine Befreiungsaktion einen zart besaiteten Mann wie mich an Blutzuckerreserven kostet?«
»Du wirst nicht gleich sterben.«
»Vermutlich nicht.« Erik rieb sich mit den Händen übers Gesicht. »Aber wenigstens was zu trinken hast du dabei? Und sag ja nicht, das war dir zu sperrig! Ich hab noch den ganzen Staub von der Gefängnismauer im Mund. Fühlt sich an wie Baumwolle.«
Malek griff neben sich in das Fach der Türverkleidung und holte eine schmale Thermoskanne aus Edelstahl hervor. Erik nahm sie entgegen und schraubte sie auf. Dampf puffte ihm ins Gesicht, ließ ihn irritiert aufblicken.
»Ist das Grog?«
»Hast du jetzt Durst oder nicht?«
»Ja, Mann!«, zitierte Erik einen seiner ehemaligen Mithäftlinge und probierte. Tatsächlich war es eine Mischung aus heißem Wasser, Zucker und Rum, und sie schmeckte ausgezeichnet. Er trank die Hälfte, bevor er Malek die offene Thermoskanne reichte. Der nahm selbst einen kräftigen Schluck, was Erik grinsen ließ.
»Alkohol am Steuer. Keine Angst vor ’ner Polizeikontrolle?«
Malek reichte ihm die Kanne zurück und wischte sich einen Tropfen aus dem Bart. »Dann ist der Grog unser kleinstes Problem. Außerdem heißt das mittlerweile Gardekontrolle. Das müsstest du noch mitbekommen haben. Von einer neuen Militäreinheit hast du damals in Grauach gesprochen. Erinnerte dich an den Geschichtsunterricht.«
Und das tat es mehr als je zuvor. Damals hatte Erik täglich über die Änderungen in der Gesellschaft vor Malek und Tymon monologisiert. Über Johann Kehlis’ Aufstieg, seine Machtergreifung, die Änderung der Verfassung, die Etablierung seiner Garde, seiner Konfessoren. Und dann hatte man ihn abgeholt.
Eriks Blick wanderte hinaus auf die Straße, er beobachtete die vorbeihuschenden Straßenbegrenzungspfosten mit ihren weißen Hauben aus Schnee. Leise sagte er: »Damals wart ihr auch skeptisch gegenüber Kehlis und dem Mist, oder? Nee, brauchst nicht antworten, ihr wart es. Ihr wart nur so schlau, euer Maul zu halten. Das hätt ich damals auch machen sollen.«
Malek schwieg, und Erik seufzte.
»Ja, ja, ich weiß, das habt ihr mir immer wieder gesagt: Reden ist Silber, Schweigen Gold. Mein Mundwerk war schon immer meine Schwäche. Wenn ich das besser im Griff hätte, würd ich heute noch unterm Ladentisch Rohypnol an Junkies verkaufen.«
»Glaub ich nicht.«
»Warum?«
»Weil Apotheken unter Staatsbeobachtung stehen.«
»Apotheken?«
»Deine grauen Zellen haben in Kronthal ganz schön gelitten. Zu viel Fuchsspritz?«
Erik winkte ab. »Liegt am Blutzuckerspiegel. Außerdem sind die Zellen nicht grau, sondern rosafarben. Aber im Ernst: Du weißt offenbar, was abgeht. Ich hab zwar ’nen ganzen Sack voll Vermutungen, aber wirklich wissen tue ich nur, dass der Karren ziemlich im Dreck steckt.«
»Ziemlich? Eher Unterkante Oberlippe.«
»Bringst du mich auf den aktuellen Stand?«
»Nicht jetzt.«
»Weil du mir nicht traust?«
Malek fixierte den Fuchs, der den Blickkontakt hielt. Ohne auf die Straße zu schauen, sagte Malek: »Traue niemanden. Jeder ist dein Feind.«
Erik hob eine Augenbraue. »Du auch? Du hast mich eben aus dem Knast geholt, hast dein Leben riskiert. Das sieht für mich nicht nach Feind aus. Natürlich machst du so eine Aktion nicht aus Spaß an der Freude. Vermutlich brauchst du mich für irgendeinen Plan. Ihr habt immer einen Plan. Wo steckt er eigentlich, der alte Gauner Tymon?«
Malek widmete seine Aufmerksamkeit wieder der Straße. Dabei verschloss sich sein Gesicht.
Erik war klar, dass sein Befreier die nächsten Minuten kein Wort mehr von sich geben würde. Irgendetwas war mit seinem Kumpel Tymon geschehen – und zwar nichts Gutes. Entweder war er tot oder … Für einen Moment dachte Erik wieder an die dreizehn Tage in der Gardedirektion 4 und erschauerte. Er schaltete das Radio ein, um die unangenehme Stille zu füllen, allerdings kam keine Musik aus den Boxen, sondern Johann Kehlis’ sonore Stimme.
»… uns ist damit der Durchbruch gelungen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Spätestens nächste Woche steht an allen mobilen Gesundheitsstationen, in jeder Gardedirektion und bei jedem Arzt eine kostenlose Impfung gegen den Amygdala-Grippevirus für Sie bereit. Lassen Sie sich gleich morgen früh gegen diese unsägliche Krankheit impfen. Sie brauchen nur Ihren Personalausweis mitzubringen, ansonsten sind keine Formalitäten notwendig. Wir helfen Ihnen einfach und unbürokratisch. Es sind keine Komplikationen mit anderen Medikamenten bekannt, die Forschungsgruppe Gesundes Deutschland hat eine einzigartige Leistung vollbracht. Meine lieben Mitbürgerinnen und …«
Malek knipste das Radio aus. »Okay«, sagte er. »Bevor wir den Mist anhören, erkläre ich es dir. An sich ist die Sache recht einfach: Unser netter Herr Bundeskanzler, der früher Lebensmittelchemiker war, hat einen Weg gefunden, um unser Denken übers Essen und Trinken zu manipulieren. Er bestückt Nanopartikel mit Informationseinheiten, verbreitet sie flächendeckend übers Trinkwasser und seine Firma JK’s, wir nehmen das Zeug auf und zack – in unseren Gehirnen speichert sich langsam ab, was auch immer Kehlis möchte.«
Eriks Stirn furchte sich, ganz tief, ganz tief.
»So sah ich auch aus, als ich es das erste Mal gehört habe. Aber je länger du darüber nachdenkst, desto mehr Sinn ergeben die Puzzlestücke und auch unsere damaligen Vermutungen. Lass es mal sacken.«
»Nanopartikel im Essen und Trinken«, wiederholte Erik, und sank in den Beifahrersitz. Er erschauerte, richtete sich wieder auf. »Aber warum sind wir dann anders? Das sind wir doch, oder? Du glaubst genauso wenig wie ich an diesen Allvater Kehlis und seine Propaganda. Du willst mich nicht beichten, nee, nee, nee, du bist anders, sonst hättest du mich nicht rausgeholt. Ganz klar. Und da draußen sind noch mehr Leute anders, so wie wir, die größtenteils gebeichtet werden, oder?«
Malek nickte. »Intolerante, wie das Regime sie nennt. Hat tatsächlich mit einer Intoleranz auf die Nanopartikel und das Trägermaterial, einen Lebensmittelzusatzstoff namens V.13, zu tun.«
»Aha. Und … die Intoleranten werden gebeichtet, weil diese Nanos es den manipulierten Menschen eingeben?«
Malek nickte.
Erik wusste nicht, ob er das wirklich glauben sollte. Schließlich fragte er: »Woher weißt du das? Hast du eine vertrauenswürdige Quelle? Und warum bist du überhaupt auf freiem Fuß? Müsstest du nicht noch so rund … einundzwanzig Jahre einsitzen?«
Malek klemmte das Lenkrad mit dem Oberschenkel fest, nahm die Thermoskanne aus der Mittelkonsole, wohin Erik sie gesteckt hatte, schraubte sie auf und trank. Als er sie zurückstellte, sagte er: »Wie war das mit Reden ist Silber und …«
Erik winkte ab. »Schon verstanden. Du bist immer noch kein Fan vieler Fragen. Außerdem soll ich’s sacken lassen.« Er atmete tief durch und lümmelte sich in den Sitz.
Malek musterte einen langen Moment seinen alten Kumpel, dann kramte er aus der Mittelkonsole einen USB-Stick hervor, fummelte ihn in einen Port am Radio und drückte daran herum, bis US-amerikanische Musik der Fünfziger- und Sechzigerjahre erklang. Es war die Gruppe Seventeen Seventy, wenn sich Erik nicht täuschte, Tymon Króls Lieblingsmusik, doch sicher war er sich nicht. Da ihm die Musik gefiel, hätte er gern nachgefragt, doch angesichts des Glanzes, der sich in Maleks Augen schlich, überlegte es sich der Fuchs anders und konzentrierte sich lieber darauf, für den Rest der Fahrt seine Zunge im Zaum zu halten und die Neuigkeiten sacken zu lassen.
Sie erreichten eine der Satellitenstädte im Außenbezirk von München. Neue Warte stand auf einem Schild. Auf beiden Seiten der Straße erhoben sich Hochhaussiedlungen, ließen den Mond hinter sich verschwinden. In etlichen Fenstern brannte Licht, ein fröhlicher Flickenteppich gelber Lichtquadrate, doch für Erik war es ein trostloser Anblick. Er sah nur öde Großwohnsiedlungen, graue Steinwälle voller Dreck und Ruß und Staub, dazwischen winzige Grünanlagen hinter breiten Straßenzügen für eine autogerechte Großstadt, die die Wohnblöcke grabenartig durchzogen.
Das alles war keine zehn Jahre alt, hätte aber auch siebzig sein können. Als ob man die Erfahrungswerte aus den Neunzehnsechzigerjahren völlig ignoriert hätte. Oder war das ein weiteres Puzzleteil im Gefüge von Johann Kehlis’ Größenwahn? Gefiel es den Menschen im Plattenbau, weil die Nanopartikel ihnen ein tolles Wohngefühl weismachten? War das ein Teil der Wohnraumlösung – einfach die Erwartungen der Bevölkerung herunterschrauben, statt die Bauvorhaben zu verbessern?
Je länger du darüber nachdenkst, desto mehr Sinn ergeben die Puzzlestücke. Es stimmte: die Verblendung der breiten Masse, die Anhimmelung Kehlis’, die JK’s-Supermärkte an jeder Straßenecke, der Schwarzhandel mit seinen Produkten im Knast, die Beichten, Eriks dreizehn Tage in der Gardedirektion, die vielen Fragen, die man ihm gestellt und die Gesundheitschecks, die man an ihm durchgeführt hatte. Und Noah Johanssons Abwinde. Alles passte zu Maleks Aussage – und doch war es schwer, diese Wahrheit zu schlucken, selbst für einen Apotheker, der sich das alles biochemisch vorstellen konnte.
An der nächsten Kreuzung setzte Malek den Blinker und bog ab. Nach wenigen Metern neigte sich die Straße, führte auf einen grell erleuchteten Schacht zu: die Einfahrt in eine Tiefgarage.
»Wir sind wohl am Ziel.« Erik reckte noch einmal den Hals, um sich die Umgebung einzuprägen, doch da verschluckte die Tiefgarage sie bereits. Er sank zurück in den Sitz.
Malek steuerte den Wagen unter gelegentlich quietschenden Reifen eine spiralförmige Betonröhre hinab auf die Etage -2 und dort ein langes Stück geradeaus. Links und rechts reihten sich Pkws in allen Farben und Größen aneinander, eng geparkt und selten von einer leeren Parklücke oder einer Betonsäule unterbrochen. Erst gegen Ende des Parkdecks drosselte er die Geschwindigkeit und parkte in die Lücke mit der Nummer B72 ein. Links stand ein roter Kleinwagen, rechts ein weißer SUV.
Malek wandte sich Erik zu. »Du wartest noch.« Er zog den Schlüssel ab und stieg aus.
»Klar«, sagte Erik zu dem leeren Fahrersitz und beobachtete über die Schulter, wie Malek den Kofferraum öffnete und darin herumhantierte. Es klackerte und knackte, dann kam er vor an die Motorhaube. Er hatte ein Nummernschild in der Hand. Mit dem sank er in die Knie, das Klackern und Knacken ertönte abermals, und Malek richtete sich wieder auf, ging zurück zum Kofferraum. Blech schepperte leise, die Klappe schlug ins Schloss, dann öffnete er gentlemanlike die Beifahrertür.
»Komm.«
Während Erik seinem Befreier folgte, der sich eine Reisetasche am Tragegurt über die Schulter gehängt hatte, warf er einen letzten Blick zurück zum schwarzen Mittelklassewagen. Jetzt hingen Münchner Nummernschilder daran, vorher waren es Frankfurter gewesen, wenn er sich recht erinnerte.
Eine Metalltür führte aus dem Parkbereich in einen Gang aus Beton. LED-Leuchtstreifen tauchten ihn in gleißenden Schein. Am Ende ging es durch eine weitere Metalltür in ein Treppenhaus, über Steinstufen mit Antirutschbeschichtung eine Etage nach oben in einen identisch aussehenden Flur. Mehr Türen zweigten von diesem ab. Alle waren hellgrau lackiert und mit schwarzen Nummern versehen. Vor der mit der 72 blieb Malek stehen. Ein Schlüssel klimperte in seinen Fingern. Er sperrte auf und winkte Erik ins Innere.
Beim Eintreten in den Kellerraum knirschte Sand unter seinen Turnschuhen, und es roch nach zitronigem Reinigungsmittel. Licht flammte auf, und Erik blieb überrascht stehen. Wände und Decke waren vollständig mit dunkelgrauem Noppenschaumstoff verkleidet. Zwischen einigen Fugen der Schaumstoffplatten und an den Rändern zur Deckenleuchte blitzte grasgrüner Kleber. Direkt unter der Lampe lag ein quadratischer Hochflorteppich in Mitternachtsschwarz auf dem Boden. Darauf standen sich zwei schlichte Gartenstühle aus Rattan und Metall gegenüber.
Einziges weiteres Einrichtungsobjekt war ein frei stehendes Regal aus Sperrholzplatten – wegen des Schallschutzes einige Zentimeter von der Wand abgerückt. Darin stapelte sich allerhand Werkzeug wie Zangen, Bohrer, Akkuschrauber neben Reinigungsmitteln, Konserven und Wasservorräten. Auch eine Kiste Bier bemerkte Erik. Und eine Flex, die im untersten Regal lag. Die Diamantscheibe funkelte im kühlschrankkalten Licht der LED-Leuchte.
»Hast es dir ja richtig schnuckelig eingerichtet.«
Malek sperrte hinter sich die Tür ab, deponierte die Sporttasche daneben und trat zum Regal. Dort schaltete er eine Stereoanlage ein, woraufhin Popmusik in angenehmer Lautstärke den Raum erfüllte. Zu Eriks Erleichterung griff Malek nicht nach der Flex, sondern nach einer Rolle stabil aussehenden Drahts. »Setz dich!«
Erik ließ sich auf einen Stuhl sinken. Das Rattan knarzte. »Immer noch nicht in Plauderlaune?«
»War ich das je?« Malek nahm ihm gegenüber Platz und hielt ihm den Draht vors Gesicht. »Wie gut bist du im Schlösserknacken?«
Erik blähte die Wangen auf. »War nie mein Lieblingsfach an der Uni.«
»Dann reich mir einen Arm und halt still.«
Maleks Hände waren warm und trocken. Er führte den Draht in das Schlüsselloch der Handschelle ein und begann, ihn fachmännisch in verschiedenen Winkeln hin und her zu biegen und zu formen.
»Und?«, fragte Erik, der neugierig dabei zusah. »Was ist das hier? Deine neue Homebase? Der Keller davon? Und warum schallgeschützt? Hast du mit dem Schlagzeugspielen angefangen?«
Malek hob nur kurz den Blick, drehte vorsichtig und geduldig den improvisierten Schlüssel hin und her.
»Hätt ich dir auch nicht abgenommen. Das ist, damit du dich ungestört mit anderen Intoleranten unterhalten kannst, nicht? Damit es keine unfreiwilligen Zuhörer gibt, die euch danach beichten.«
Das Schloss klackte, die Handschelle an Eriks rechtem Handgelenk sprang auf.
Ein Seufzer der Erleichterung entwich ihm. »Ahh. Das ist gut.« Er rieb sich kurz das Handgelenk, bevor er Malek das andere hinhielt. »Aber ernsthaft. Dafür ist das doch gebaut, oder?«
»Unter anderem.«
»Also noch für etwas anderes?«
Malek sah auf. »Ich hatte damals auch so viele Fragen und werde dir deine beantworten, aber in meinem Tempo, okay?« Er setzte seine Arbeit fort.
»Damals?«
»Vor sieben Monaten.«
»Was war da?«
Malek sah nicht noch einmal auf. »Da sind Tymon und ich aus Grauach ausgebrochen. Es hat ihn dabei erwischt. Bauchschuss. Wir konnten zwar entkommen, aber die Wunde ist nie ganz verheilt und hat sich drei Monate später entzündet. Er starb daran.«
Erik schluckte. »Das tut mir leid.«
Malek quittierte die Beileidsbekundung mit einem Nicken, fingerte weiter, und kurz darauf sprang auch die zweite Handschelle auf und fiel zu Boden.
Erik unterdrückte ein Seufzen. »Merci.« Er bückte sich und wollte die Handschelle aufheben, bemerkte dabei die Spuren auf dem Teppichboden: zu kleinen Büscheln verklebte Fasern, krustig und rötlichbraun schimmernd. Hier und da und unter seinem Stuhl – überall. Und da begriff er, warum eine feine Schicht Sand den Boden überzog. Gewalt war einfach nicht sein Jargon.
»Die Flecken gehen nicht mehr raus«, sagte Malek. Ganz gelassen saß er auf dem Stuhl, die Hände im Schoß gefaltet, die Rolle Draht dazwischen, und beobachtete Erik aus seinen braunen Augen.
Erik hob die Handschelle auf. »Hast du es mit einer Paste aus Salz und Zitronensaft versucht? Altes Hausmittel gegen eingetrocknetes Blut. Die Paste muss nur flüssig genug sein, damit sie in die Fasern eindringen kann. Lass sie lang genug einwirken, dann spülst du sie mit warmem Wasser aus und behandelst den Teppich mit Gallseife und Wasser.«
Ein Lächeln huschte über Malek Wutkowskis Gesicht. »Immer noch der alte Fuchs.«
»Immer noch der alte Wutkowski.«
Die beiden Männer blickten sich lange an, bis Malek die Drahtrolle beiseitelegte und sich bequemer in seinen Stuhl lümmelte. »Was ist in den dreizehn Tagen in der Gardedirektion vier passiert? Warum hat man dich wieder in eine JVA gesteckt?«
Erik senkte den Blick, bedachte, wie das auf Malek wirken musste, und hob ihn wieder. »Woher weißt du davon?«
»Spielt das eine Rolle?«
»Nein, vermutlich nicht.« Erik platzierte die Handschelle auf seinem Oberschenkel und rieb sich die Hände. Sie waren eiskalt. Überhaupt fror er. Der Kalorienmangel schlug langsam durch. »Okay«, begann er. »Dieser Konfessor mit der Nummer acht hat mich damals direkt in die Gardedirektion vier gebracht. Unterwegs stellte er mir Fragen: Weshalb ich den Herrn als schmierigen Drecksköter bezeichnet habe? Warum ich von einem Regime sprach? Warum ich aufbegehrte?« Erik erschauderte. »Der Typ war so gefühlskalt, als rede man mit einer Maschine. Ein Automat war das. Ein Replikant. Ein T3000. Ich hab in diesem Kleinbus begriffen, dass mir nur eine Chance bleibt: Den findigen Verehrer von Kehlis zu mimen, der versuchte, auf die falsche Tour kranke Mithäftlinge zu entlarven und zu beichten.«
Malek hob eine Augenbraue. »Das hat er dir abgenommen?«
»Keine Ahnung. In der Gardedirektion übergab er mich einem Gardisten, und der steckte mich in eine Zelle. In der wurde ich dreizehn Tage lang wieder und wieder verhört, immer wieder mit Fragen bombardiert und medizinisch untersucht. Ich kam mir vor wie ein Objekt, nein, ich war ein beschissenes Objekt!«
»Mit was für Fragen?«
»Schwer zu sagen. Eine augenscheinlich sinnlose Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten. Wie ich gewählt habe, was meine Lieblingspizza ist, wie ich zum Thema Abtreibung stehe, was ich studiert habe, mit welchem Notenschnitt und so weiter. Hunderte Fragen, in ständiger Wiederholung. Und immer wieder, wie ich das alles fände. Erinnerte mich an einen abgewandelten Turing-Test, als wollte man meine Empathie testen. Unter dem Gesichtspunkt deiner Nanotechniktheorie glaube ich aber, dass man überprüfte, ob die Nanos bei mir die entsprechenden Informationen eingespeist hatten oder nicht. Dazu passen auch die medizinischen Untersuchungen.«
Malek schwieg einige Sekunden, bevor er fragte: »Und was geschah dann?«
»Am letzten Tag gab es abermals eine solche Befragung. Der Gardist hakte bei jeder Frage auf seinem Klemmbrett ein Kästchen ab, dann folgte ein Stempel, und ich wurde abermals in einen Kleinbus verfrachtet. Der brachte mich direkt in die JVA Kronthal.«
»Du bist also für gesund erklärt worden.«
»Deiner Betonung nach hatte ich damit wohl Glück.«
Malek rieb sich mit beiden Händen übers Gesicht, legte den Kopf in den Nacken und strich sich durch den Bart. »Man hat dich dem CMT unterzogen«, sagte er zur Decke.
»Dem was?«
»Dem Commotest, kurz CMT. Wieder so ein lateinisches Gedöns von Kehlis.«
»Vom lateinischen commotus? Beeinflusst?«
»Keine Ahnung. Der Test war dazu da, die Wirkung der Nanos nachzuweisen.«
»War?«
»Der CMT wurde kurz nach deiner Befragung wegen Unzuverlässigkeit abgeschafft. Du hattest wirklich Glück.«
»Weil ich einem heutigen Test nicht standhalten würde?«
Maleks sah ihn wieder an. Die einzige Lampe spiegelte sich in Form zweier gleißender Punkte in seinen Augen. »Es gibt keinen Test mehr. Auch keine Prüfung im Sinne ›beeinflusst oder nicht‹. Das Regime sperrt einfach alle weg, die unter Verdacht geraten. Es kommt anschließend zur sogenannten Humankapitalprüfung, in der entschieden wird, ob die Person aus volkswirtschaftlicher Sicht genügend Wert hat, aufgehoben zu werden, oder nicht. Wenn ja, wird die Person eingesperrt, wenn nicht, wird sie erlöst.«
Erik schluckte und schluckte noch einmal. »Dann hatte ich wirklich verdammtes Glück – oder Pech …«
Malek blieb ganz ruhig, doch seine Finger spannten sich. »Wie meinst du das?«
»Schon mal daran gedacht, dass es mir in Kronthal gefallen hat?«
»Wärst du lieber dort geblieben?«
»Kann ich noch nicht beurteilen.« Erik beugte sich vor, bis sein Gesicht einen Meter von Maleks entfernt war. Die Narbe auf der Wange glänzte silbern. Er roch den Grog und etwas Knoblauch.
»Weißt du, Malek, du holst mich aus dem Knast und zerrst mich in eine Welt, die ich noch nicht begreife. Ich weiß nur, dass es draußen gefährlicher zu sein scheint als drinnen.«
»Die Freiheit hat ihren Preis.«
»Ja, nur wie hoch sind die Zinsen? Du hast mich nicht wegen meines knackigen Hinterns rausgeholt. Du brauchst mich. Wofür?«
Jetzt war es an Malek, sich vorzubeugen, den Abstand auf zwei Handspann zu verringern. »Wegen meines Bruders.«
»Dominik? Ich dachte, der ist damals bei eurer Festnahme gestorben.«
»Ist er auch. Er ist nur wiederauferstanden.«
»Auferstanden … im Sinne von man hat ihn wiederbelebt oder im Sinne von er war gar nicht tot?«
»Letzteres.«
»Okaaay … Und wo ist er jetzt?«
»Auf der Suche nach dir.«
»Nach mir?«
»Du hast am alten CMT teilgenommen und bist aus der JVA ausgebrochen. Schon vergessen?«
In Eriks Brustkorb breitete sich ein Kribbeln aus. Es kroch über seine Schultern, die Oberarme entlang, direkt unterhalb der Haut, lief mit tausend Ameisenbeinen über seine Unterarme bis zu den Fingerspitzen. Seine Stimme vibrierte, als er fragte: »Was tut dein Bruder heute?«
»Jagen.«
Kapitel 3
Südbayern, Justizvollzugsanstalt Kronthal
Steine und Mörtelreste knirschten unter Nummer Elfs polierten Lederschuhen. Bei jedem Schritt wirbelten sie Staub auf, der den schwarzen Glanz tilgte und sich einem roten Schleier gleich bis zu den Knien auf die Stoffhose legte. Der Wollmantel in Mitternachtsschwarz darüber blieb verschont, genauso wie das faltenfreie Hemd aus schwarzem Baumwolle-Seide-Mix. Einzig das Kollar blitzte im Herzschlag der Blaulichter abwechselnd metallisch grau und blau – genauso wie Nummer Elfs Augen.
Konfessorenanwärter Thomas Borchert trat neben ihn. »Ich habe eben mit Anstaltsleiter Berger gesprochen. Ein Wachmann namens Gersthof ist tot, wurde vom Radlader überrollt. Ein zweiter, mit Namen Kaimann, wird ins Krankenhaus gebracht, es sieht jedoch schlecht aus – ihn hat ein Teil der Mauer erwischt. Des Weiteren fehlt seit zwei Tagen ein Beamter namens Boit. Er hat sich weder krankgemeldet noch entschuldigt. Von den Inhaftierten sind zwei verstorben, vier verletzt und noch drei auf der Flucht: Erik Krenkel, Curtis Romanello und ein Sam Paganini. Noah Johansson, der Zellengenosse von Krenkel, sitzt für Sie in einem der Verhörräume bereit.«
Nummer Elf quittierte den Lagebericht mit einem Nicken. Borchert wollte daraufhin etwas ergänzen, doch Nummer Elf hob die Hand, was seinen Begleiter verstummen ließ. Die Parallelen waren unübersehbar. Vor vier Monaten hatte er eine ähnliche Szenerie erlebt, in einem Wald neunzig Kilometer entfernt von Grauach und bei Tag: das Durcheinander, die brüllenden Gardisten, die Spurensicherer, die Toten in Zinksärgen und die Gerüche nach Chaos und Furcht. Nicht ganz, korrigierte er sich, der Backsteinstaub war damals nicht gewesen …
»Kümmern Sie sich um die weitere Beweissicherung«, sagte er.
Borchert neigte sein Haupt. »Wird gemacht, aber sagen Sie, das sieht doch stark nach dem Werk von Malek Wutkowski aus, oder?«
Nummer Elf zuckte mit den Schultern, ließ den Konfessorenanwärter stehen und überquerte den Innenhof der Justizvollzugsanstalt. Zwei JVA-Beamte öffneten den Haupteingang, damit er sein Tempo nicht reduzieren musste. Im Vorbeilaufen fragte er: »Johansson?«
»Sitzt im Verhörraum drei. Moment, ich bringe Sie hin!« Der junge Wärter eilte zackig den Flur voraus, um rechtzeitig die nächste Gittertür für ihn zu öffnen.
Nummer Elf folgte mit versteinerter Miene. Seine Schritte hallten von den Wänden wider. Es folgten vier Sicherheitsschleusen, die er alle ohne Unterbrechung passierte. Schließlich blieb der Beamte vor einer Stahltür stehen und sperrte sie ihm auf.
»Sie warten hier«, war alles, was Nummer Elf sagte, dann trat er ein und zog die Metalltür hinter sich ins Schloss.
In der Zelle war es warm und stickig. Ein blonder Hüne saß inmitten des Raums, die Hände mit Handschellen und einer Kette an einen angeschweißten Ring im Tischgestell gefesselt. Der Häftling sah krank und mitgenommen aus, voller Staub und Dreck und Schweiß. Seine Tränensäcke waren dick und dunkel. Er stank säuerlich.
Nummer Elf legte seinen Mantel ab, faltete ihn und hängte ihn über die Stuhllehne. Er setzte sich dem Gefangenen gegenüber. Für ihn bereit lag Noah Johanssons Akte. Ohne sie aufzuschlagen, fragte er ihn: »Wo ist er?«
»Wer?«
»Ihr Zellengenosse.«
»Woher soll ich das wissen? Seit der Radlader die Mauer umgeworfen hat, hab ich ihn nicht mehr gesehen.«
Nummer Elf musterte den Häftling, bevor er aufstand und die Hände locker in die Hosentaschen steckte. Der Schulterholster aus schwarzer Kunstfaser drückte ihm unter der Achsel ein wenig ins Fleisch. »Sie wissen vermutlich, dass er früher in der JVA Grauach einsaß. Hat er je von dieser Zeit erzählt?«
»Nein.«
Nummer Elf schlenderte durch den Raum, lehnte sich an die Wand gegenüber. »Überhaupt nichts?«
»Nein.«
»Sie lebten mit Erik Krenkel in einer Zelle, und er hat nichts erzählt?«
»Nein. Warum sollte er?«
»Er gilt als recht geschwätzig.«
Johansson pfiff abfällig durch die Zähne. »Der Mann hat ständig gelabert. Ich hab schon lange nicht mehr zugehört.«
»Hat er je den Namen Malek Wutkowski erwähnt?«
»Keine Ahnung, ich glaube, nicht.«
»Und den Namen Tymon Król?«
Johansson schüttelte den Kopf. »Wer soll das sein?«
Nummer Elf sah es in seinen Augen. Er hat keine Ahnung, und doch … Er löste sich von der Wand und trat neben Johansson. »Hat Erik Krenkel von seinem bevorstehenden Ausbruch erzählt? Eine Andeutung gemacht? Nur ein auffälliges Wort fallen gelassen?«
»Nein.«
»Ist Ihnen irgendetwas in der letzten Zeit aufgefallen? Eine Veränderung an ihm, seltsame Ereignisse, andere Verhaltensmuster?«
»Nein.« Doch es flackerte in den Augen des Blonden.
Nummer Elf beugte sich zu ihm herab, damit ihre Gesichter auf gleicher Höhe waren. »Was?«
Johansson presste die Lippen aufeinander, sodass für eine Sekunde ein bläulicher Strich in seinem Gesicht entstand, bevor er sagte: »Da war nichts.«
Nummer Elf überlegte, ob er Johanssons Kopf packen und auf die Tischplatte dreschen sollte, bis die Worte zusammen mit ausgeschlagenen Zähnen herauspurzelten, doch er richtete sich nur wieder auf, lief langsam um den Mann herum zu seinem Stuhl und setzte sich. Die Metallfüße knarrten. »Warum decken Sie ihn?«
»Ich decke niemanden.«
Nummer Elf schlug die Mappe aus Recyclingpapier auf, überflog Johanssons Akte. Es war so einfach. »Hier steht, dass Ihre damals fünfjährige Tochter – Saskia Maria Johansson – mehrfach sexuell missbraucht wurde, vorwiegend durch orale Penetration.«
Johansson wandte den Blick ab.
»Sie haben zufällig den Täter auf frischer Tat ertappt, als sie früher als geplant von der Arbeit nach Hause kamen, und ihn unter vorgehaltener Dienstwaffe gezwungen, sich mit einem Brotzeitmesser zu entmannen. Anschließend zwangen sie ihn, das abgetrennte Glied zu schlucken. Der Mann erstickte daran. Ihr Verteidiger plädierte auf Schuldunfähigkeit im Zuge einer Affekthandlung. Das Gericht erkannte das aufgrund Ihrer herausragenden psychischen wie physischen Belastbarkeit als Polizist nicht an. Sie hätten sich im Griff haben müssen.«
Die nächsten Worte kamen gepresst: »Hätten Sie sich im Griff gehabt, wenn so ein Drecksack Ihrer Tochter …«
»Ja.«
Johanssons Blick flatterte zu Nummer Elf. Seine Mundwinkel zuckten, doch kamen keine Worte über seine Lippen.
Nummer Elf tippte auf die Papiere in der Akte. »Hier steht außerdem, dass sich Ihre Frau nach Ihrer Verurteilung scheiden ließ und mit Saskia Maria nach Aschaffenburg zu ihren Eltern zog.«