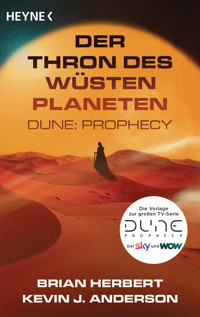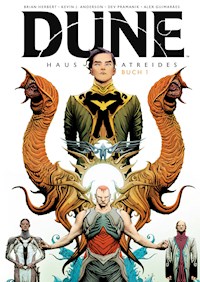13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Wüstenplanet - Great Schools of Dune
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Raum-Navigatoren
Über Jahrtausende hat sich die Menschheit im All ausgebreitet und Planeten besiedelt. Nun, da der Krieg gegen die Maschinen gewonnen ist und ein neues Imperium gegründet wurde, hängt die Zukunft der Galaxis von den Navigatoren ab – genmanipulierten Menschen, die mithilfe des Gewürzes vom Wüstenplaneten gewaltige Raumschiffe durchs All manövrieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 818
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DASBUCH
Über Jahrtausende hat sich die Menschheit im All ausgebreitet und Planeten besiedelt. Nun, da der Krieg gegen die Maschinen gewonnen ist und ein neues Imperium gegründet wurde, hängt die Zukunft der Galaxis von den Navigatoren ab – genmanipulierten Menschen, die als einzige in der Lage sind, mithilfe des Gewürzes vom Wüstenplaneten die gewaltigen Raumschiffe des Imperiums durchs All zu manövrieren. Nur Melange, das Gewürz von Arrakis, erlaubt es den Navigatoren, einen Blick in die Zukunft zu werfen, damit sie den Raum zu »falten« und die Schiffe mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können. Josef Venport hat gemeinsam mit seiner Großmutter Norma Cenva die alleinige Kontrolle über die Erschaffung der Navigatoren – und damit wähnt er auch die Kontrolle über das noch junge Imperium der Menschheit in seiner Hand. Doch Imperator Roderick Corrino will Venports eisernen Griff endlich abschütteln. Dann sind da noch die neu erstarkte Schwesternschaft der Bene Gesserit mit ihrer Ehrwürdigen Mutter aus dem Haus Harkonnen, und da ist auch der fanatische Anführer der technologiefeindlichen Butler-Bewegung, Manford Torondo. Sie alle blicken auf eine dunkle Vergangenheit zurück, und sie alle wollen die Zukunft mitbestimmen. Ein blutiger Machtkampf um das Imperium und das Schicksal des Wüstenplaneten entbrennt …
DIEAUTOREN
Brian Herbert, der Sohn des 1986 verstorbenen WÜSTENPLANET-Schöpfers Frank Herbert, hat selbst SF-Romane verfasst, darunter den in Zusammenarbeit mit seinem Vater entstandenen Mann zweier Welten.
Kevin J. Anderson ist einer der meistgelesenen SF-Autoren unserer Zeit. Zuletzt ist von ihm die gefeierte Saga der Sieben Sonnen erschienen.
Ein Liste aller im Heyne Verlag erschienenen WÜSTENPLANET-Bücher finden Sie am Ende des Buches.
Mehr über die Autoren und ihre Romane erfahren Sie auf:
Brian HerbertKevin J. Anderson
DIE NAVIGATOREN DES
WÜSTEN-PLANETEN
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Jakob Schmidt
Nachdem wir inzwischen vierzehn Bücher und zahlreiche Kurzgeschichten im fantastischen Dune-Universum verfasst haben, ein Werk, das uns nun schon seit fast zwei Jahrzehnten begleitet, sind jene Menschen, die diese große Reise überhaupt erst möglich gemacht haben, für uns unvergesslich.
Wir widmen dieses Buch unseren Ehefrauen Jan und Rebecca, für die Liebe und Unterstützung, die sie uns während unseres Schaffensprozesses jederzeit haben zuteil werden lassen, und Beverly Herbert, die für Frank Herbert fast vierzig Jahre lang eine treu ergebene Ehefrau, Gefährtin und kreative Beraterin war.
Unserem Herausgeber Tom Doherty von Tor Books, unserer Lektorin Pat LoBrutto und unserem Agenten John Silbersack, die uns auf dieser Reise begleitet und auf unsere Fähigkeiten und auf unsere Geschichten vertraut haben.
Vor allem widmen wir dieses Buch aber dem kreativen Genie Frank Herbert, der vor über einem halben Jahrhundert dieses große literarische Universum erschaffen und uns damit so viele wunderbare Schauplätze und Ideen zum Erforschen geschenkt hat.
1
Alles beginnt, und alles endet – ohne Ausnahme. Oder ist das ein Mythos?
Diskussionsaufgabe an der Mentatenschule
Die prächtige Barkasse des Imperators befand sich in einer hohen Umlaufbahn über Salusa Secundus, umgeben von gewaltigen, bedrohlichen Kriegsschiffen. Das Innere erstrahlte im Glanz von Gold und kostbaren Edelsteinen, der glitzernde Rumpf wies kunstvolle Wölbungen und Verzierungen auf, die keinerlei Zweck erfüllten. Es war mit Abstand das prunkvollste Schiff der Flotte, ein atemberaubender Anblick für all jene, die sich von solchen Dingen beeindrucken ließen. Salvador hatte es geliebt.
Obwohl die Barkasse für den Geschmack des neuen Imperators Roderick Corrino viel zu protzig war, verstand er, wie wichtig das Zeremoniell war, besonders, da er den Thron nach dem Tod – nein, nach der Ermordung – seines Bruders gerade erst bestiegen hatte.
Und ebenso wichtig war es für ihn als Imperator, dass er Direktor Josef Venport, den Mann, der den Mord an Salvador eingefädelt hatte, seiner gerechten Strafe zuführte. Seine Kriegsschiffe sammelten sich.
Roderick, der dichtes blondes Haar und ein markantes Gesicht hatte, stand aufrecht da, gekleidet in das goldene und scharlachrote Gewand seines Adelshauses. Er fühlte sich majestätisch und mächtig, während er durch ein breites Aussichtsfenster in der sich über mehrere Decks erstreckenden Befehlszentrale der Barkasse blickte. Seine in der Umlaufbahn versammelte Streitmacht – Hunderte von Schlachtschiffen – bereitete sich auf einen Überraschungsangriff gegen die Hochburg Venports vor.
Roderick wartete begierig auf den Start, aber in dieser Sache durften sie nicht den winzigsten Fehler machen. Die Streitkräfte des Imperiums würden nur diese eine Gelegenheit bekommen, Venport zu besiegen, indem sie ihn unvorbereitet trafen.
Der Imperator beobachtete, wie seine Kriegsschiffe in die Andockbuchten des gewaltigen Faltraumtransporters vor ihm einschwebten. Die Holtzman-Triebwerke des Transporters konnten innerhalb eines Lidschlags gewaltige Entfernungen überbrücken, allerdings flog der Pilot ohne die Führung eines Navigators praktisch blind.
Nur bei Venport Holdings wusste man, wie sich Navigatoren erschaffen ließen, weiterentwickelte Menschen, die sichere Wege durch die unermesslichen Weiten des Alls erahnen konnten, und Josef Venport hatte diese Geschöpfe aus dem imperialen Dienst abgezogen, nachdem sein Verbrechen ans Licht gekommen war. Doch sobald der gesetzlose Venport besiegt und sein Besitz beschlagnahmt war, würde das gesamte Imperium über Navigatoren verfügen. Das war nur ein weiterer – und ein sehr wichtiger – Vorteil, wenn der Direktor vernichtet wurde. Roderick ballte eine Faust.
General Vinson Roon, Befehlshaber der nach Kolhar entsandten Streitmacht, stand in Habachtstellung neben ihm. Seine rot-goldene Offiziersmütze hielt er in den Händen.
»Ich rechne mit einem raschen und glanzvollen Sieg, Mylord.« Stellvertretend für den Imperator brachte Roon Empörung zum Ausdruck. Der blaublütige General war Ende vierzig, in Rodericks Alter, allerdings kleiner und muskulöser. Roon hatte dunkle Haut, kohlrabenschwarzes Haar und einen durchdringenden Blick. Er und der Imperator hatten eine bewegte gemeinsame Geschichte, die Roderick derzeit nach Möglichkeit ausblendete.
»Ja, rasch und glanzvoll wäre mir ebenfalls recht, Vinson.« Er sprach den General absichtlich mit Vornamen an. Er und Roon waren bis zu einem unerfreulichen Zerwürfnis Jugendfreunde gewesen – natürlich war es dabei um eine Frau gegangen. Seitdem hatten sie nur bei offiziellen Militäranlässen miteinander gesprochen, in Gegenwart weiterer Offiziere und hochrangiger Berater, aber nun war es an der Zeit, solche Albernheiten hinter sich zu lassen. Das Imperium stand auf dem Spiel. Roderick wusste, dass er sich auf diesen Mann verlassen konnte, dessen Treue und Hingabe gegenüber dem Imperium nie in Zweifel gestanden hatten. Ohne den Blick vom Aussichtsfenster abzuwenden, sagte der Imperator: »Der Schlag muss Venport Holdings treffen, bevor sie Gelegenheit haben, tiefer abzutauchen. Wir müssen bald handeln.«
Roon nickte.
Die Streitmacht war hastig und in aller Verschwiegenheit zusammengezogen worden, und sie würde in den nächsten Tagen aufbrechen. Der Imperator setzte einen nicht unbedeutenden Teil der Verteidigungskräfte aufs Spiel, die normalerweise bei Salusa Secundus stationiert waren, aber ein erfolgreiches Durchgreifen gegen VenHold würde die Sicherheitslage im gesamten Imperium deutlich verbessern, was das Risiko wert war. Roderick wollte der Schlange den Kopf abschlagen, indem er mit einer schnellen Mission Direktor Venport tötete oder gefangen nahm, seine Anlagen auf Kolhar beschlagnahmte und sein weitverzweigtes Handelsnetz zerriss.
Danach würde Roderick das Imperium fest im Griff haben.
Vor zwei Monaten war Venport nach der Aufdeckung seiner Schuld mit Hilfe Norma Cenvas geflohen. Im Anschluss daran hatte der Direktor alle VenHold-Schiffe zurückgerufen, den Handel lahmgelegt und zahlreiche Planeten in schwerer Not zurückgelassen. Die ersten Folgen machten sich gerade erst bemerkbar, und es würde noch sehr viel schlimmer werden. Privatflotten versuchten verzweifelt, in die Bresche zu springen, aber es gab keine andere interstellare Transportgesellschaft, die so verlässlich war wie die VenHold-Raumflotte – weil niemand sonst über Navigatoren verfügte.
Außerdem hielt Venport dank eines katastrophalen Zufalls einen Teil der Truppen des Imperiums als Geisel. Eine ganze Gefechtsgruppe der imperialen Streitkräfte – siebzig Kriegsschiffe – war auf einer Routinemission an Bord eines VenHold-Trägerschiffs unterwegs gewesen, als die Krise begonnen hatte. Die Schiffe des Imperiums waren schlagkräftig, aber sie verfügten nicht über Holtzman-Antriebe, weshalb sie mit Faltraumern ans Ziel gebracht werden mussten. Jahrelang hatten VenHold-Faltraumer die Schlachtschiffe des Imperators transportiert, doch nun hielt der Feind eine beträchtliche Zahl von ihnen gefangen, hatte sie vom Brett genommen wie Figuren in einem galaktischen Schachspiel.
Roderick brummte: »Er will uns Knüppel zwischen die Beine werfen und uns dazu zwingen, dass wir uns seinen Forderungen beugen.«
»Wissen wir überhaupt, wie seine Forderungen lauten, Mylord?«, fragte der General, der nach wie vor beobachtete, wie sich die Schiffe an Bord des gigantischen Transporters begaben. »Seit seinem Rückzug nach Kolhar hat er nichts nach außen dringen lassen. Ich dachte, er sei auf der Flucht und verstecke sich vor seiner gerechten Strafe.«
»In meinen Augen ist es offensichtlich, was er verlangt. Er möchte tun und lassen, was er will. Nachdem er schamlos einen Imperator getötet hat, möchte er mich als Galionsfigur, während sich die Tentakel seines Wirtschaftsimperiums in jeden Winkel erstrecken. Außerdem will er, dass ich die Butler-Fanatiker ausradiere.« Die Gedanken kreisten in seinem Kopf. Etwas, wozu Salvador niemals fähig gewesen wäre.
Roon gab ein abfälliges Schnauben von sich und senkte die Stimme. »Wäre das nach all der Zerstörung, die Manford Torondo verursacht hat, wirklich so schlimm, Mylord?«
Während er über den Schaden nachdachte, den der technologiefeindliche Mob angerichtet hatte und der sogar seiner wunderschönen kleinen Tochter das Leben gekostet hatte, stieß Roderick einen leisen Seufzer aus. »An und für sich nicht, nein … aber wenn das bedeutet, dass wir mit dem Mann zusammenarbeiten müssen, der Salvador ermordet hat, dann kann ich dem nicht zustimmen. Und das werde ich auch nie tun, Vinson.« Er schüttelte den Kopf. »Es würde mich nicht überraschen, wenn Venport auch etwas mit Annas Verschwinden zu tun hätte.«
Roon starrte ihn ungläubig an. »Aber Ihre Schwester ist von Lampadas verschwunden, Mylord – während der Belagerung der Mentatenschule durch die Butler-Truppen. Ich würde Manford Torondo verdächtigen, aber wie kommen Sie auf die Idee, das Venport verantwortlich sein könnte?«
»Sie haben recht.« Er schüttelte den Kopf. »Anscheinend will ich immer nur ihm die Schuld geben … obwohl er eigentlich nur für die Hälfte meiner Probleme verantwortlich ist.«
Sichtlich besorgt runzelte der General die Stirn. »Wenn ich an die vielen Umtriebe des Direktors denke – ein Monopol auf sichere Faltraumreisen, seine geheimen Navigatoren, die Gewürzindustrie auf Arrakis, seine Bankgeschäfte überall im Imperium … niemand sollte über so viel Macht verfügen, und …«
Roderick schnitt ihm das Wort ab. »Das stimmt nicht, Vinson – ich sollte über so viel Macht verfügen und sonst niemand.«
Roon straffte sich. »Unsere Flotte wird sich um ihn kümmern, Mylord. Sie können sich auf mich verlassen.«
»Das weiß ich, Vinson.« Roderick gestattete sich einen etwas wärmeren Tonfall. Da dieser Mann in Kürze einen entscheidenden Angriff befehligen und damit zweifellos Geschichte machen würde, konnte es nicht schaden, ihn an ihre einstige Freundschaft zu erinnern.
Die Luft knisterte vor gespannter Erwartung, während die beiden Männer zusahen, wie die Schlachtschiffe ihre Positionen an Bord des riesigen Trägerschiffs einnahmen. Roon räusperte sich. »Es gibt etwas, das ich Ihnen sagen muss, Mylord. Ich möchte mich dafür bedanken, dass unsere persönlichen Differenzen meiner kürzlich erfolgten Beförderung nicht im Wege gestanden haben. Und ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie mir bei dieser Mission die Führung anvertraut haben. Ein kleinlicherer Mann hätte sich nicht so verhalten.«
Roderick nickte ihm ermunternd zu. »All das war vor langer Zeit, und zum Wohl des Imperiums muss ich über solchen Dingen stehen.« Er bedachte den General mit einem kleinen Lächeln. »Etwas anderes hätte Haditha auch nicht geduldet. Sie hat mich darum gebeten, Ihnen Grüße und beste Wünsche für den Erfolg auszurichten.«
Roon antwortete mit einem bittersüßen Lächeln. »Letztendlich haben Sie doch ihr Herz erobert. Diese Niederlage musste ich schon vor langer Zeit akzeptieren. Sie sind ein besserer Mann als ich, Mylord – das waren Sie schon immer.«
Mit seinen erwiesenen Fähigkeiten und seiner Verlässlichkeit hatte Roon sich seine Beförderung verdient – und der Umstand, dass Roderick während der Generalüberholung des imperialen Militärs auf den höheren Ebenen so viele inkompetente Offiziere aus dem Weg geräumt hatte, hatte Roons Aufstieg noch beschleunigt. Er war die logische Wahl als Ersatz für General Odmo Saxby gewesen, der seines Amtes enthoben worden war, und mit diesem Vergeltungsschlag erhielt er seine erste echte Gelegenheit, sich zu beweisen.
Die Streitkräfte des Imperiums waren nach der jahrelangen Vernachlässigung durch Salvador in einer erschreckenden Verfassung. Unverdiente Beförderungen hatten den Apparat zu einem Pfuhl von Korruption, Bestechung und völliger Unfähigkeit aufgebläht. Nach seiner Thronbesteigung hatte Roderick das gesamte Militär einer gründlichen Prüfung unterzogen und es gesäubert.
Er streckte die Hand aus. »Wenn Sie sicher von Kolhar zurückgekehrt sind, verbringen wir vielleicht mehr Zeit miteinander.«
»Nichts wäre mir lieber, Mylord. Wir waren einmal echte Freunde, nicht wahr?«
»Ja, das waren wir.«
Roon grinste, als sie sich die Hände schüttelten. »Ich gebe den Brandy aus.«
»Ich freue mich schon darauf.«
Obwohl sie alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatten, um die Angriffsvorbereitungen geheim zu halten, hatte Josef Venport zweifellos Spione auf Salusa. Wenn der Faltraumtransporter jedoch schnell genug aufbrach, sollten General Roons Kriegsschiffe Kolhar erreichen, bevor ein Späher eine Warnung absetzen konnte. Jede Minute zählte.
Doch mit oder ohne Spione war Venport kein Dummkopf. Zweifellos würde er mit einer Reaktion von Salusa rechnen, und Kolhar verfügte über durchaus ehrfurchtgebietende Verteidigungsanlagen.
Roderick wartete ungeduldig darauf, endlich den Würgegriff von Venport Holdings zu brechen und seine legitime Macht wiederzuerlangen. Das noch junge Imperium bestand erst seit dem Untergang der unterdrückerischen Denkmaschinen vor einem Jahrhundert, und Roderick musste zum Wohl der Menschheit seine Autorität durchsetzen. Und ebenso wichtig war es, dass er seinen Bruder rächte.
Der General setzte seine Mütze auf und salutierte, während er sich zum Gehen wandte. »Bitte entschuldigen Sie mich, Mylord – ich muss mich noch um viele Einzelheiten kümmern, bevor die Streitmacht starten kann. Schnelligkeit ist unsere beste Garantie, unentdeckt zu bleiben.«
Rodericks Tonfall wurde schärfer. »Erledigen Sie ihn für mich, Vinsoon. Ich rechne mit Ihrer siegreichen Rückkehr.«
»Das verspreche ich Ihnen, Mylord. Ich werde Sterne und Planeten versetzen, um mich vor Ihnen zu beweisen.«
»Das wird vielleicht auch nötig sein.«
2
Es gibt Menschen, die Einfluss und Macht als Belohnung betrachten und nicht als Verantwortung. Solche Leute geben keine guten Anführer ab.
Direktor Josef Venport,internes Memo der Venport Holdings
Kolhar war eine Festung, aber darauf wollte Josef Venport sich nicht ausruhen, während er auf den nächsten Schachzug des Imperators wartete. Er wusste, dass sich der Hauptteil der imperialen Streitkräfte bereithielt, ihn zu vernichten, sobald sich eine Gelegenheit bot.
Um seine planetare Sicherheit zu verbessern, hatte er zahlreiche gut bewaffnete Schiffe der VenHold-Raumflotte von lukrativen Handelsrouten abziehen und in der Umlaufbahn von Kolhar stationieren müssen. Er verstärkte auch die Planetenschilde und erhöhte die Anzahl der Wach- und Kundschafterschiffe um sein Sternensystem herum.
Nachdem er nun alle Verteidigungsmaßnahmen ergriffen hatte, würde er vielleicht einen Weg aus diesem Schlamassel finden. Wenn er sich doch nur mit Imperator Roderick hinsetzen und wie mit einem vernünftigen Menschen hätte verhandeln können!
Ein solches Debakel hatte Josef nie gewollt. Es war zwar notwendig gewesen, diesen Volltrottel Salvador zu beseitigen und seinen fähigeren Bruder auf den Thron zu hieven, aber er hatte nie damit gerechnet, dass seine Rolle bei dem Mordkomplott ans Licht kommen würde. Josef hatte vielmehr geplant, zum Partner des neuen Imperators zu werden, zu beiderseitigem Vorteil. Das Imperium hatte die Gelegenheit, zu wachsen und zu gedeihen – wenn Roderick nur ein Einsehen hätte.
Dies war eine existenzielle Krise für die menschliche Zivilisation, ein historischer Moment, in dem schwere Entscheidungen nötig waren. Die Menschheit war noch damit beschäftigt, sich vom langen Albtraum der Denkmaschinensklaverei zu erholen, gefolgt von Chaos und Gewalt, aus denen die reaktionäre Butler-Bewegung hervorgegangen war, wütende Fanatiker, die alle Überbleibsel der »bösen« Technologie vernichten wollten. Josef hatte der menschlichen Spezies helfen wollen, indem er eine fähige Person auf den Thron beförderte; doch stattdessen hatte er eine unvorhergesehene Katastrophe ausgelöst.
Nun würde der Imperator vor nichts haltmachen, um Venport Holding zu vernichten, Josef festzunehmen und höchstwahrscheinlich hinzurichten. Warum erkannte Roderick Corrino nicht, welchen Schaden er mit seinem sturen Beharren auf Rache anrichtete? Es wäre besser gewesen, VenHold einfach ein beträchtliches Blutgeld bezahlen zu lassen – Josef hätte es in Gewürz oder mit klingender Münze begleichen können, je nachdem, was der Imperator bevorzugte. Anschließend hätten Handel und Regierungsgeschäfte wie gehabt weitergehen können. Josef strich sich über den dichten, rötlichen Schnurrbart, tief in Gedanken versunken. Es musste doch einen Weg aus dieser Zwickmühle geben!
Weil er das endlose Warten satt hatte, verließ er sein Hauptquartier aus mehreren Wolkenkratzertürmen und trat hinaus unter den bedeckten Himmel. Er musste die kühle Luft auf der Haut spüren und die beruhigende Geschäftigkeit sehen, die ihn umgab. Er rief sich immer wieder gern ins Gedächtnis, dass er nach wie vor einer der mächtigsten Männer des Imperiums war.
Seine Frau Cioba erwartete ihn draußen vor der Tür. Sie war hochgewachsen, elegant und brünett und stammte von den telepathisch begabten Zauberinnen von Rossak ab. Das lange Haar reichte ihr bis zu den Hüften. Ihre hoheitliche Haltung und ihre gelassene Art rührte von ihrer Ausbildungszeit bei der Schwesternschaft her.
Cioba war schweigsam, ihm aber dennoch eine Stütze. Sie begleitete ihn über einen gepflasterten Landeplatz, auf dem eigentlich massenhaft Handelsschiffe und Gewürztransporter hätten stehen sollen. Doch jetzt ähnelte der Raumhafen einem Militärstützpunkt. Tankwagen rollten hin und her und versorgten Kampfschiffe und Fähren mit Treibstoff. Patrouillen- und Spähschiffe starteten in die Umlaufbahn. Als Josef tief den Atem einsog, spürte er den scharfen Geschmack von Abgasen und die herbe Winterkälte auf der Zunge.
Cioba hielt inne, als hätte sie in Gedanken Berechnungen angestellt. »Wir haben Kolhar so uneinnehmbar wie möglich gemacht, mein Gatte. Wir dürfen zwar nicht in unserer Wachsamkeit nachlassen, aber wir sollten uns auch nicht durch unnötige Angst lähmen lassen. Wir sind stark und in einer sicheren Position.«
Josef hatte sich selbst schon oft das Gleiche gesagt, doch er konnte sich einfach nicht entspannen. »Übertriebenes Selbstvertrauen ist eine größere Schwäche als Angst und Sorge. Wir müssen wachsam bleiben, bis wir diese Krise überwunden haben.«
»Ich weiß, dass wir es schaffen werden. Wir haben hochentwickelte Waffen und Verteidigungsanlagen, die man sich im restlichen Imperium nicht einmal vorstellen kann.« Ihre Lippen verzogen sich zu einem kleinen Lächeln. »Verteidigungsanlagen, die Manford Torondo und seinen Butler-Anhängern mit Sicherheit Albträume bescheren werden.«
Josef lächelte ebenfalls. Gemeinsam betrachteten sie die drei mechanischen Gestalten, die rund um den Raumhafen patrouillierten – spinnenartige Cymek-Läufer, die viele der Gebäude überragten. Sie waren frisch aus seinem Geheimwaffenlabor auf Denali angeliefert worden.
Einst waren Cymeks eine Geißel der Menschheit gewesen – körperlose Menschengehirne, die man in gepanzerte Maschinen eingepflanzt hatte. Die ursprünglichen Cymeks waren in Serena Butlers Djihad zerstört worden, aber Josefs brillante Wissenschaftler hatten sie neu erschaffen und umgestaltet. Diese neuen Cymeks wurden nicht von fehlbaren, machthungrigen Personen gesteuert, sondern von den hochentwickelten Gehirnen von Navigatoren-Kandidaten. Derzeit patrouillierten diese mechanischen Hüter mit pumpenden Kolben und wachsamen Sensoren um das Hauptquartier auf Kolhar.
Als Josef ein Bodenfahrzeug requirierte, musste Cioba ihn nicht fragen, wohin es ging. Es war für ihn zum täglichen Ritual geworden, die Tanks der Navigatoren-Kandidaten zu besuchen, insbesondere jetzt, in einer Zeit der wachsenden Anspannung.
Am Steuer schüttelte Josef verzweifelt den Kopf. »Anstatt uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen, sollten Roderick und ich zusammen gegen den wahren Feind kämpfen! Die Butler-Fanatiker sind eine ebenso große Bedrohung für die Zivilisation, wie es früher die Denkmaschinen waren. Und der halbe Manford hat eigene Kriegsschiffe.«
Cioba hob das Kinn. »Diese uralten Schiffe genügen nicht, um dich zu besiegen, Josef. Hundertvierzig alte Faltraumer aus den Zeiten der Djihad-Armee. Denk an deine Schiffe, an dein Monopol auf Navigatoren und deine äußerst loyalen Angestellten. Über die Hälfte der Planeten im Imperium sind für den Handel von VenHold abhängig, und sie tätigen auch weiterhin Geschäfte mit dir, obwohl der Imperator dich als vogelfrei gebrandmarkt hat. Was sagt dir das?« Sie wandte ihm ihr klassisch schönes Gesicht zu und hob die Augenbrauen. »Du verfügst über mehr Schiffe, mehr Macht und mehr Einfluss als irgendjemand sonst, einschließlich der Corrinos. Wenn die Menschen wählen müssten, würden sie sich dann für irgendeine Gestalt auf einem Thron auf dem fernen Salusa Secundus entscheiden oder doch lieber für regelmäßige Lebensmittel- und Gewürzlieferungen?«
Er wusste, dass sie recht hatte. Josef lenkte das Bodenfahrzeug über eine Anhöhe und hinab in ein weites, schüsselförmiges Tal, in dem Hunderte von Tanks standen, von denen jeder einen seiner Navigatoren-Kandidaten enthielt. Cioba beugte sich vor und küsste ihn auf die Wange, als er das Fahrzeug zwischen den versiegelten Kabinen zum Stehen brachte.
Sie gingen zwischen den dickwandigen, mit Gewürzgas gefüllten Behältern umher. Durch die beschlagenen Plaz-Bullaugen und die wirbelnden Dämpfe im Innern sah Josef mutierte Gestalten, die ständige geistige Zuckungen durchliefen, mit denen sie ihren Verstand erweiterten. Kein unmodifiziertes Gehirn war dazu in der Lage, die Faltraum-Berechnungen zu begreifen und die nötige Voraussagekraft zu entwickeln, um ein Schiff durch die Leere zu führen, aber die durch das Gewürz ausgelöste Verwandlung ermöglichte beides.
Josef bestaunte die missgestalteten, aber auf seltsame Weise beeindruckenden Navigatoren. Selbst wenn die Schiffe des Imperators Kolhar angriffen, wären seine Militär-Faltraumer unbeholfen und blind, weil sie keine Navigatoren hatten. Antiquierte Überlichtschiffe konnten zwar relativ sicher durchs All reisen, aber sie waren unzumutbar träge und brauchten Wochen oder Monate für die Reise zwischen Sternensystemen. Die VenHold-Schiffe hingegen waren schnell und sicher.
Er und Cioba hielten vor einem großen, zentral gelegenen Tank inne, der wie ein Schrein auf einem Marmorpodest ruhte. Josef war erfreut, im Innern des Behälters seine Urgroßmutter Norma Cenva zu sehen, umgeben von ihren ganz persönlichen Gewürzträumen und den grenzenlosen Möglichkeiten, die sich für sie bis weit in die Zukunft erstreckten.
Vor über hundert Jahren war Norma zur ersten Navigatorin geworden. Obwohl sie mehr als nur ein Mensch war, wahrte sie nach wie vor den Kontakt zu Josef und hielt sich aus ganz eigenen Gründen über die Politik des Imperiums auf dem Laufenden.
»Die menschliche Spezies steht auf dem Spiel, und ich empfinde eine gewaltige Verantwortung«, sagte Josef zu Cioba, obwohl er den Verdacht hatte, dass Norma sie belauschte. »Ich bin derjenige mit der Rationalität und den Mitteln, die benötigt werden, um uns zu retten. Ich muss am Leben bleiben, und ich muss gewinnen. Roderick wird unsere Verteidigungsanlagen nicht überwinden, und ich kann meine Handelsbeziehungen im Imperium spielen lassen, um Entscheidungen zu erzwingen, die jenseits seiner Möglichkeiten liegen.«
Obwohl Norma beim Aufbau von Venport Holding geholfen hatte, wusste Josef, dass ihr eigentlicher Antrieb darin bestand, die Erschaffung weiterer Navigatoren zu fördern. Im Gegensatz zu ihren Schützlingen hatte Norma die Fähigkeit, allein mithilfe ihres Verstands den Raum zu falten und ganz nach Belieben zu reisen, während andere Navigatoren große Schiffe mit Holtzman-Antrieben benutzen mussten. Manchmal verschwand ihr Tank tagelang, während sie ihren unbekannten Geschäften nachging, doch vorläufig war sie hier, meditierte und beobachtete.
Da er Antworten brauchte, näherte sich Josef dem Tank und fragte ohne jede Vorrede: »Was meinst du, Großmutter? Wenn ich mächtiger bin als Imperator Roderick, sollte ich mich dann hier verstecken und meine Stellung ausbauen, oder sollte ich in größeren Maßstäben denken?«
Aus dem Lautsprecher des Tanks drang Normas trällernde Stimme. »Du hast die nötige Macht und Befähigung, um den Thron an dich zu reißen – wenn es das ist, was du willst.«
Es überraschte ihn, das von ihr zu hören. Manche gaben sich Fantasien hin, zu einem großen Herrscher zu werden, aber Josef betrachtete sich eher als Geschäftsmann, als perfekten Marktführer, und nicht als jemanden, der nach politischer Macht strebte.
»Du weißt, dass es nicht das ist, was ich will. Ich will, dass Roderick Imperator bleibt – ein vernünftiger Imperator. Schließlich habe ich ihn auf den Thron gesetzt, verdammt noch mal. Ich will, dass er stark und weise ist … und mich um Rat fragt! Ich habe mein eigenes Geschäftsimperium. Meine Planetenbanken quellen über von dem Geld, das meine Kunden mir anvertraut haben. Ich betreibe eine umfangreiche Gewürzförderung auf Arrakis, obwohl der Narr Salvador versucht hat, sie mir wegzunehmen. Für mich ist die Politik ein Werkzeug, um meine Geschäftsinteressen zu verwirklichen, mehr nicht.«
Er stieß einen Seufzer aus. »Aber jetzt stehe ich mit dem Rücken zur Wand. Wir befinden uns an einem Wendepunkt für die menschliche Zivilisation. Und wenn Imperator Roderick nicht tut, was er zu tun hat, bin ich dann der Einzige, der ihn ersetzen kann?« Er überlegte, kam aber nach wie vor auf keine eindeutige Antwort. »Mir wäre es sehr viel lieber, wenn alles wieder wäre wie vor einem Jahr, als ich meine Kräfte darauf konzentrieren konnte, Manfords Barbaren auszumerzen.«
»Und auf unsere Gewürzförderung – für meine Navigatoren«, sagte Norma. »Wir müssen nach Arrakis, statt hierzubleiben. Wir sollten beide gemeinsam dorthin reisen.«
»Das werden wir bald tun, Großmutter.« Er hatte bereits eine lange verzögerte Inspektionsreise geplant, aber zuerst musste er sich hier um einige letzte Einzelheiten kümmern.
»Bald«, beharrte Norma, »werde ich uns nach Arrakis bringen.«
Ein Gefühl der Hilflosigkeit stieg in ihm auf. Während der Imperator Zeit und Ressourcen auf einen Vergeltungsschlag gegen ihn verschwendete, liefen die fanatischen Butler-Anhänger Amok und löschten all die Fortschritte aus, die Josef zu einem hohem Preis errungen hatte.
Allerdings war Josef bereits in Aktion getreten. Noch während er seine Verteidigungsstellung hier auf Kolhar ausgebaut hatte, hatte er eine wichtige Kommandoeinheit nach Lampadas entsandt, zum Hauptquartier der Butler-Bewegung. Vielleicht würde er endlich Befriedigung verspüren, wenn seine Cymek-Streitkräfte erst einmal diesen bösartigen kleinen Krüppel niedergemacht hatten.
»Du hast deine Entscheidung bereits getroffen«, sagte Norma mit ihrer verzerrten Stimme.
»Ich bin gekommen, um deinen Rat zu hören, Großmutter.«
»Du hast deine Entscheidung bereits getroffen«, wiederholte Norma, und weitere Antworten wollte sie nicht geben.
3
Ich suche mir meine Verbündeten aus, wie sie mir passen, aber meinen Feind hat Gott ausgesucht – den Feind der gesamten Menschheit. Gott selbst ist mein standhaftester Verteidiger. Wozu brauche ich Sie?
Manford Torondo gegenüber Imperator Salvador Corrino
Draigo Roget, Josef Venports oberster Mentat, traf in einem schnellen VenHold-Kriegsschiff mit Tarnpanzerung ein, damit die Patrouillen der Butler-Anhänger in der Umlaufbahn ihn nicht entdecken konnten. Mit seinen eingebauten Waffensystemen hätte das kleine Schiff ein Dutzend der alten Djihad-Kriegsschiffe zerstören können, die die Fanatiker benutzten.
Aber Draigo war nicht nach Lampadas gekommen, um gegen einen Planeten voller Barbaren zu kämpfen, zumindest nicht jetzt. Diesmal war er lediglich der Pilot bei einer Mission, die einen Machbarkeitsnachweis erbringen sollte und mit der sich die hiesige Bedrohung für die Zivilisation vielleicht sogar beseitigen ließ. Er würde die Macht ihrer neuen Cymeks demonstrieren.
Lampadas … man hatte ihn hier an der Mentatenschule ausgebildet, und hier hatte er gelernt, Manford Torondo und seine Anhänger zu verabscheuen, als Extremisten, die die große Schule verdorben und niedergerissen hatten. Die Butler-Anhänger hatten Gilbertus Albans, seinen Mentor und den Rektor der Institution, verhaftet und geköpft. Das würde Draigo ihnen nie verzeihen.
Draigo hatte Gilbertus nicht retten können, aber es war ihm gelungen, mit der geistig geschädigten Anna Corrino und dem Speicherkern von Erasmus, dem berüchtigten Roboter, der für so viel Grausamkeit und Verheerung während Serena Butlers Djihad verantwortlich war, zu fliehen. Nun war Anna ein wertvoller Einsatz in diesem Spiel und Erasmus eine Schlüsselressource für die Wissenschaftler auf Denali, und gemeinsam würden sie dafür sorgen, dass Direktor Venport den Sieg davontrug, ein Triumph der Vernunft über den Fanatismus, der Zivilisation über die Barbarei.
Denn darum ging es letztendlich bei diesem anhaltenden Konflikt. Das verstanden alle, die für Venport arbeiteten.
Heute Nacht würden Draigos Cymeks dem Feind Schrecken einflößen und vielleicht sogar Manford Torondo töten, womit die Fanatiker ein für allemal neutralisiert wären. Zumindest würden die Cymeks ihr grauenvolles Zerstörungspotenzial unter Beweis stellen. Viele von Direktor Venports Wissenschaftlern warteten bereits begierig darauf, von den Ergebnissen zu erfahren.
Von den drei Cymeks, die sich im Frachtraum von Draigos Schiff befanden, wurden zwei von hochentwickelten Navigatorengehirnen gelenkt, während der dritte von Ptolemy befehligt wurde, der erste freiwillige neue Cymek, ein Genie, das von seinem Hass auf Manford Torondo angetrieben wurde. Ptolemy hatte sich dafür entschieden, sich seiner zerbrechlichen menschlichen Hülle zu entledigen und sie gegen einen mechanischen Körper nach seinem Geschmack auszutauschen. Einen mächtigen, zerstörerischen Körper.
Manford hatte sich jedenfalls eine Menge Feinde gemacht.
Sicher in der Umlaufbahn um den ruhigen Planeten, im Vertrauen darauf, dass seine Tarnvorrichtung ihn vor den primitiven Butler-Kriegsschiffen verbarg, bereitete sich Draigo auf seine Mission vor. Ptolemys Gehirnbehälter wurde soeben in seine Kriegergestalt eingesetzt, während die beiden von Navigatoren gesteuerten Cymeks ihre Läufergestalten in gepanzerte Abwurfkapseln bewegten. Die Navigatorengehirne brüteten wie immer schweigend vor sich hin, aber sie befolgten ihre Befehle. Nachdem er die Gedanken-Elektroden-Verbindungen kontrolliert hatte, erklärte er alle drei Maschinen für startbereit.
Ptolemy hob eine klauenbewehrte Hand und klackte mit den langen, scharfen Scheren. Seine Worte kamen aus einem Lautsprecher. »Dieses sadistische Ungeheuer hat meinen Freund bei lebendigem Leib verbrannt und mich gezwungen, dabei zuzusehen. Manford Torondo muss sterben.«
»Außerdem versucht er, den menschlichen Intellekt und Fortschritt abzutöten. Dieser Mann hat eine Saat des Hasses ausgebracht, und wir alle wollen an der Ernte teilnehmen.« Draigo blickte lächelnd auf das in blassblauem Elektrafluid schwebende Gehirn, bevor er die Kapsel ganz schloss. Sie waren startbereit. »Jetzt bekommen Sie Ihre Gelegenheit.«
Die Verantwortung für die Menschheit war eine Bürde, die Manford Torondo nicht gern trug, aber er wehrte sich nicht dagegen. Hatte er eine andere Wahl?
Die gegenwärtige Krise des Imperiums war mehr als nur ein Kampf um Rohstoffe oder Territorien, es war ein Krieg um die menschliche Seele. Nach der jahrhundertelangen Sklaverei unter den Denkmaschinen hatte sich die Menschheit nun aus dem Würgegriff der Technologie befreit. Wiedergeboren konnte sie in einen neuen Garten Eden heimkehren – aber nur, wenn sie sich dafür entschied und nicht von ihrer eigenen Schwäche vernichtet wurde.
Verdorbene Männer wie Josef Venport wollten die Menschheit erneut versklaven und ihren übersprudelnden Geist erneut Maschinen unterwerfen! Nach dem Ende des Djihads hatte Rayna Butler – Manfords geliebte Mentorin und Lehrerin – die Menschen auf den richtigen Weg geführt, aber auf diesem Weg gab es durchaus Gewalt und Widerstand. Es gab jene, die im dichten Gedränge eines Demonstrationszugs Bomben zündeten …
Tief in der Nacht saß Manford in einem Polsterstuhl und blickte schwer schluckend auf seine Hüften hinab, an denen sein Körper endete. Manchmal schockierte ihn der Anblick seiner Verstümmelung auch jetzt noch, Jahre nach der Explosion, bei der er beinahe ums Leben gekommen war und nach der er nur noch ein halber Mann war. »Doch dafür ein doppelt guter Anführer!«, riefen seine treuen Gefolgsleute bei ihren Kundgebungen.
Die Zukunft war so ungewiss und lastete so schwer auf seinem Herzen. Wie sehr Manford sich wünschte, dass die weise Rayna hier wäre, um die Bewegung zu führen! Ach, wie er sie geliebt hatte! Er spürte, wie ihm warme Tränen über die Wangen liefen.
Anari Idaho, seine ihm treu ergebene Schwertmeisterin, sah die Tränen und trat besorgt näher an ihn heran. Sie hätte sich für Manford jedem Feind in den Weg geworfen, hätte ihr Leben für seins gegeben. In diesem Moment wirkte sie ebenso bereit, ihn vor seinen eigenen Gefühlen zu beschützen.
Anari war eine kräftig gebaute Frau, die von den Schwertmeistern von Ginaz ausgebildet worden war, und sie diente ihm nun schon seit Jahren in seinem einfachen Haus aus Feldsteinen auf Lampadas. Die Innenwände waren mit Geländern und Handgriffen versehen, damit Manford sich mithilfe seines starken Oberkörpers allein darin bewegen konnte. Wenn er vor einer großen, jubelnden Menge eine imposante Figur machen wollte, ritt er in einem Geschirr auf Anaris Schultern. Dort oben kam sich Manford nicht wie ein halber Mann vor, sondern empfand sich als mächtigsten Menschen des Imperiums.
Seine Wahrsagerin, Schwester Woodra, kam, um mit ihm zu sprechen, und platzte mit ihren Problemen heraus, ohne etwas von seiner schwermütigen Stimmung zu bemerken. »Imperator Roderick glaubt immer noch, dass wir für das Verschwinden seiner Schwester nach unserer Erstürmung der Mentatenschule verantwortlich sind.« Ihr Tonfall war unangenehm schrill. »Sie hätten ihn vom Gegenteil überzeugen müssen, Führer Torondo. Anna Corrino muss irgendwie geflüchtet sein.«
»Wir haben nichts mit ihrem Verschwinden zu tun, ob der Imperator es uns glaubt oder nicht.« Manford vermutete, dass das flatterhafte Mädchen bei dem Versuch, den Belagerern zu entkommen, von einem Sumpfdrachen gefressen worden war. »Glücklicherweise richtet sich der Zorn des Imperators nun auf Josef Venport. Ich bin unbesorgt.« Manford glaubte, dass es sich um ein stilles Wunder handelte.
»Vielleicht«, sagte Anari, »aber er wird nie vergessen, dass seine Tochter von einem Butler-Mob getötet wurde. Er wird genug Zorn für uns übrig haben.«
»Das war nur ein Unfall, weiter nichts«, sagte Woodra abweisend, als betrachtete sie die Angelegenheit als erledigt. »Dafür kann man uns nicht die Schuld geben.«
»Trotzdem wird er genau das tun – uns die Schuld geben«, sagte Anari.
»Bündnisse können sich immer wieder ändern«, sagte Manford. »Roderick Corrino muss seine wahre Bestimmung als unser Verbündeter erkennen – vorzugsweise, indem wir ihn mit vernünftigen Argumenten überzeugen, aber nötigenfalls auch unter Zwang.«
Schwester Woodra holte Logbücher und Listen hervor, die sie in allen Einzelheiten durchsprechen wollte, aber Manford fehlte die Kraft dazu. Als sie merkte, wie erschöpft ihr Herr war, warf Anari Woodra einen vernichtenden Blick zu. »Das ist vorerst genug Geschäftliches. Manford muss sich ausruhen und nachdenken. Wie soll er uns sonst führen?«
Die Wahrsagerin rümpfte brüsk die Nase über den angedeuteten Tadel. »Der Erfolg unserer Bewegung hängt ebenso sehr von Kleinigkeiten ab wie von einer starken Führung. Und für diese Kleinigkeiten müssen wir uns Zeit nehmen.«
Woodra war vor dem schrecklichen Zerwürfnis, das ihre Schule zerrissen hatte, von der Schwesternschaft ausgebildet worden. Manford wusste, dass sie zu den vehementesten Technologiefeinden unter seinen Anhängern gehörte, und sie hatte sich als nützlich erwiesen, nicht nur als Wahrsagerin, sondern auch als Beraterin. Allerdings hatte sie eine unverblümte Art, und es mangelte ihr an Feingefühl, sodass sie ihn manchmal ermüdete. Im Moment war er zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, ganz gleich, wie beharrlich sie war. »Anari hat recht. Ich bin erschöpft. Bring mich in mein Schlafzimmer.«
Die Schwertmeisterin hob ihn wie ein Haustier auf und ging mit ihm in seine Privatgemächer, wo sie ihn auf ein spartanisches schmales Bett legte. Sie öffnete das Fenster, um die frische Abendluft einzulassen.
Draußen funkelte warmes, orangefarbenes Licht in den Fenstern der zahllosen einfachen Gebäude der Hauptstadt von Lampadas. Insekten sangen leise ihre Lieder, und der Planet wirkte täuschend friedlich, während Manford sich für seinen meditativen Schlaf sammelte. Bis plötzlich ein Donnerschlag die Dunkelheit zerriss.
Schwere Objekte rasten kreischend durch die Atmosphäre herab, von Bremsfeuer umspielt. Drei Geschosse schlugen vor Empok ein.
Anari stieß einen bestürzten Schrei aus und platzte in Manfords Schlafzimmer, um ihn zu beschützen.
Die Menschen strömten aus ihren Häusern, um herauszufinden, woher der Lärm kam, und riefen erschreckt durcheinander. Die drei Einschlagkrater brodelten unheilvoll, erhellt von weiß-orangefarbenem Nachglühen und gerahmt von scharfkantigen Schatten. Gepanzerte Kapseln öffneten sich wie gezahnte stählerne Blütenblätter, und mechanische Gestalten kamen zum Vorschein. Waffenstarrende Körper erhoben sich auf schweren, kolbengetriebenen Beinen, und in jedem befand sich ein körperloses menschliches Gehirn. Drei hoch aufragende Cymeks marschierten auf die Stadt zu.
Während Manford von Anari aus dem Bett gehoben wurde, sah er die entfernten Bewegungen durchs Fenster und wusste, dass seine Feinde kamen, um ihn zu holen.
Die Schwertmeisterin ergriff ihn und sagte: »Ich werde dich retten.«
4
Menschen behaupten, dass eine tiefgreifende persönliche Tragödie schwerwiegende Veränderungen der Geisteshaltung auslösen kann. Ich habe in meinen Studien an Laborobjekten mit diesen Auswirkungen experimentiert, Menschen Schaden zugefügt und ihre Reaktionen untersucht. Dennoch war ich nie dazu in der Lage, diese Hypothese anhand einer direkten Erfahrung zu verifizieren – bis zum Tod von Gilbertus Albans.
Erasmus, Geheime Labornotizen
In den Laborkuppeln auf Denali, versteckt unter der giftigen Atmosphäre des abgelegenen Planeten, arbeiteten Direktor Venports Forscher an Projekten von entscheidender Wichtigkeit. Man hatte die Wissenschaftler sowohl aufgrund ihres Intellekts als auch ihres Hasses auf die Butler-Anhänger angeworben.
Derzeit betrachteten die Forschungsteams fasziniert Erasmus’ Speicherkern und bezeichneten ihn als unbezahlbaren Schatz historischer Erlebnisse – was dem unabhängigen Roboter gefiel. Endlich befand Erasmus sich unter Personen, die genauso dachten wie er, und er sonnte sich in ihrer Aufmerksamkeit.
Draigo Roget hatte den Speicherkern gerettet, als die Fanatiker die Mentatenschule gestürmt hatten. Erasmus wusste es zu schätzen, dass der Mann ihm unter großen Anstrengungen das Leben gerettet hatte, so wie Gilbertus ihn vor Jahrzehnten gerettet hatte. Er schuldete seinem menschlichen Mündel Gilbertus viel. Der Roboter hatte ein wildes Kind aus den Sklavengruben aufgezogen und es zu einem nahezu perfekten menschlichen Wesen gemacht. Und diese irrationalen Barbaren hatten ihn getötet! Besiegt hatte Gilbertus sich einfach der grobschlächtigen Schwertmeisterin Anari Idaho gebeugt, die ihm mit dem Schwert den Kopf abgehackt hatte.
Erasmus’ Programmierung umfasste simulierte Emotionen, aber diese persönliche Erfahrung, diese Empfindung eines schrecklichen Verlusts, war von weit größerem Ausmaß gewesen als alles, was er bis dahin aufgezeichnet hatte.
Nun befand er sich in einem hell erleuchteten Labor, vor dessen Fenstern giftige Dämpfe wogten. Seine Gelkugel ruhte auf einem Podest und war an einen mangelhaften Sensorenapparat angeschlossen. Die wunderschöne junge Anna Corrino, die Schwester des Imperators, stand schützend neben der Speicherkugel, während sich die neugierigen Wissenschaftler von Denali um ihn drängten, an den Maschinenlippen des Roboters klebten und darauf warteten, dass er fortfuhr.
Erasmus erkannte, dass er, während er über Gilbertus nachgedacht hatte, in stummen Zorn verfallen war. Ja … das war das menschliche Gefühl des Zorns. Er untersuchte diese einzigartige Erfahrung auf die gleiche Weise, wie er alle interessanten Daten sammelte, insbesondere psychologische Erkenntnisse, in seinem beständigen Versuch, den komplexen menschlichen Geist zu verstehen.
»Ich habe vieles mitzuteilen«, sagte er zu Anna. »Äußerst nützliche Informationen. Wenn ich euch dabei helfen kann, die Feinde der Vernunft zu vernichten, werde ich es tun.«
Der gewaltsame, unnötige und verwirrende Tod von Gilbertus hatte die mentale Architektur seiner Gelschaltkreise verändert. Normalerweise wäre er entzückt über jede neue Erkenntnis gewesen, aber der Verlust seines Freundes bereitete ihm kein Vergnügen. Ganz und gar nicht.
»Erzähl ihnen von der Mentatenschule«, schlug Anna vor und lächelte eifrig. Die kleinen, blauen Augen der jungen Frau und ihre verschrobene Persönlichkeit erinnerten Erasmus an bunte Glasfenster, Farbsplitter und verzerrte Bilder. Seit sie an der Schule der Schwesternschaft einen Hirnschaden durch ein psychotropes Gift davongetragen hatte, war Anna launisch, ungebärdig und unberechenbar. Geistig war sie nie wieder dieselbe geworden, und ihre besorgten Brüder hatten sie zur Behandlung an die Mentatenschule geschickt. Dort hatte Erasmus sie gefunden und zu seinem interessantesten menschlichen Versuchsobjekt gemacht. Er hatte die geschädigte junge Frau angeleitet, sie geistig manipuliert, ihr geholfen … aber obwohl er versucht hatte, sie in ein exaktes mathematisches Modell einzupassen, war er damit nie ganz erfolgreich gewesen.
»Ich habe mich viele Jahrzehnte lang an der Mentatenschule versteckt«, sagte Erasmus. »Während Gilbertus Albans seinen Schülern beigebracht hat, wie man sein Denken strukturiert.« Erasmus verlieh seiner Stimme, die aus mehreren Lautsprechern im Raum drang, einen gelehrten Klang. Er erinnerte sich noch an die ursprüngliche Stimme seines Flussmetallkörpers. Wie prachtvoll er damals gewesen war, in den berauschenden Tagen des Synchronisierten Imperiums, bevor die außer Rand und Band geratenen Menschen alles zerstört hatten … wie sie auch später die Mentatenschule zerstört hatten. Man konnte sich einfach nicht darauf verlassen, dass Menschen sich organisiert und rational verhielten.
Doch Erasmus besaß die Fähigkeit, auf lange Sicht zu denken, und nun war er endlich unter Verbündeten – die über das Potenzial zu Vergeltungsschlägen verfügten. Sie alle waren im Wunsch vereint, die Krankheit des Butlerismus auszumerzen.
»Gilbertus hat meinen Speicherkern zu meinem eigenen Schutz versteckt. Ihm war bewusst, dass man mich mit Sicherheit zerstören würde, falls man mich entdeckte. Im Gegensatz zu Ihnen, meinen Geistesverwandten hier auf Denali, gibt es Menschen im Imperium, die die Vorzüge meines Wissens nie anerkennen würden. Sie zerstören das, was sie nicht verstehen.«
Anna zappelte nervös herum, während sie im Raum hin und her ging. Ihre Stimme klang heiser, als wäre sie von Gefühlen überwältigt, die hier fehl am Platze waren. »Wenn Erasmus zerstört worden wäre, dann würden Milliarden von Menschen niemals erfahren, wie brillant er ist! Wie bewundernswert er ist.«
Erasmus hatte ihr den Glauben an all das eingegeben, als ihr Geist weich und formbar gewesen war, doch nun hatten sich ihre Meinungen zu Dogmen verfestigt.
Die Wissenschaftler duldeten ihre störenden Einwürfe, weil Anna eine so wertvolle Geisel war, aber sie achteten kaum auf ihre Worte. Die süße, nichtsahnende Anna verstand nicht, was sie wert war, und Erasmus wollte sichergehen, dass sich sein Griff um ihren zerbrechlichen Verstand nicht lockerte. Er wusste die andächtige Aufmerksamkeit, die die junge Frau ihm schenkte, zu schätzen, obwohl ihre Hingabe schon an Besessenheit grenzte. Dennoch nahm er sie hin. Im Laufe der Jahrhunderte hatte er mit Sicherheit genug Hass von den Menschen erduldet, also konnte er jetzt ein wenig fehlgeleitete Verehrung gut verwinden.
Erneut richtete er das Wort an die aufmerksamen Forscher. »An der Mentatenschule gestatteten meine Sensoren und Kameraaugen es mir, meine Beobachtung von Menschen fortzusetzen, Projektionen zu erstellen und Hypothesen zu überprüfen. Das Fehlen eines physischen Körpers war ein Hindernis, aber Gilbertus versprach mir immer wieder, dass er ein Gefäß für meinen Speicherkern finden würde. Doch irgendwie ist es ihm nie gelungen.« Erasmus hielt inne. »Das ist die einzige Hinsicht, in der er mich jemals im Stich gelassen hat …«
Die Denali-Wissenschaftler machten sich Notizen auf ihren Tlulaxa-Datenblöcken. Seit Tagen erläuterte der hilfsbereite Roboter nun schon fast ununterbrochen seine Gedanken und Schlussfolgerungen. Er hatte so viel Wissen weiterzugeben, so viele Entdeckungen, so viel Datenmaterial, dass allein die Sortierung von allem eine Aufgabe war, die ihre Fähigkeiten bis an die Grenzen ausreizte.
»Meine Erfahrungen sind von entscheidender Bedeutung«, fuhr er fort. »Ich möchte Ihnen dabei helfen, Möglichkeiten zu finden, nicht nur Venport Holdings zu verteidigen, sondern auch die Butler-Anhänger auszulöschen.« Ihm wurde klar, dass seine Worte vielleicht angeberisch klangen, aber eine Denkmaschine kannte keinen Stolz. »Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Es ist schwer, Jahrhunderte der Erfahrung auf eine so kurze Zeitspanne zu verdichten.«
Während die Wissenschaftler sich Notizen machten, griff er auf die letzten Bilder von Gilbertus zu, die seine Überwachungskameras aufgenommen hatten, wie er nach draußen geführt wurde und man ihn zwang, sich hinzuknien, um auf den Streich der Schwertmeisterin zu warten …
Neben dem Labortisch stand ein Konservierungsbehälter, in dem das körperlose Gehirn von Forschungsleiter Noffe schwamm, dem ersten der neuen Cymeks. Er sandte Signale durch das flackernde Elektrafluid in seinem Tank, worauf sie vom Lautsprecher in Worte umgewandelt wurden. »Die Anlagen Denalis stehen Ihnen zur Verfügung, Erasmus. Unsere Mission ist es, Direktor Venport mit den nötigen Waffen auszustatten, damit er die Dummheit bekämpfen und die menschliche Zivilisation erstarken lassen kann. Zeigen Sie uns die Baupläne von Waffen des Synchronisierten Imperiums. Helfen Sie uns dabei, die Wilden auszulöschen.«
»Sie haben Rektor Albans getötet«, sagte Anna und legte die Stirn in Sorgenfalten. »Sie haben versucht, Erasmus zu vernichten – und mich! Ich verstehe nicht, warum mein Bruder nicht einfach den ganzen Haufen umgebracht hat.«
»Natürlich werde ich Ihnen dabei helfen, die Butler-Anhänger zu vernichten«, sagte Erasmus, vor allem, um Anna zu beruhigen, weil sie sich oft völlig auf einen Gedanken fixierte. Er war nicht allzu sehr davon überzeugt, dass Imperator Roderick Corrino den Fanatikern oder auch nur Josef Venport die Stirn bieten konnte. Aber der Roboter wollte trotzdem helfen, weil er seine eigene Rechnung zu begleichen und seinen eigenen Preis zu fordern hatte, wenn es an der Zeit war.
»Es ist mein größter Wunsch, die Anführer der Butler-Bewegung sterben zu sehen, je schmerzhafter, desto besser. Ich möchte die Befriedigung der Rache verspüren.« Auch das würde eine neue Empfindung für ihn sein, ein weiteres Schlüsseldetail bei seiner großen Suche – und allein schon die Aussicht darauf erregte ihn.
Einer der Wissenschaftler, ein stiller Tlulaxa-Biologe namens Danebh, hatte sich ausgiebig Notizen gemacht. Er lehnte sich zurück. »Ich wäre sehr dankbar für Datenmaterial zu Ihren biologischen Forschungen, Erasmus. Damals auf Corrin haben Sie zahlreiche Sektionen durchgeführt, aber auch einen großen Katalog an genetischem Datenmaterial zusammengestellt. Wenn ich es richtig verstehe, haben Sie sogar einen Klon von Serena Butler persönlich erschaffen.«
»Das habe ich, und obwohl sie in jeder Hinsicht makellos schien, war sie doch nicht annähernd so faszinierend wie die ursprüngliche Frau, sondern nur eine armselige Kopie. Eine identische Biologie bringt keinen identischen Satz von Erfahrungen und Persönlichkeitsmerkmalen hervor.«
Während er sprach, klinkte sich sein Speicherkern in die Datenbanken der Forschungsstation ein und griff auf Dr. Danebhs Hintergrundinformationen zu. Der Tlulaxa hatte innovative Arbeit geleistet, die von den Butler-Anhängern als »unrein« gebrandmarkt worden war, worauf sie ihn gezwungen hatten, seinen Heimatplaneten zu verlassen und Zuflucht bei Venport Holdings zu suchen.
»Ich kann Ihnen das gesamte benötigte Datenmaterial zur Verfügung stellen«, sagte Erasmus, »solange das Wissen gegen die Butler-Anhänger eingesetzt wird.«
Forschungsleiter Noffe meldete sich aus seinem Konservierungsbehälter zu Wort. »Das wird es. Wir alle haben Grund genug, diese Leute zu hassen.«
»Dann können Sie auch mir mit Rat zur Seite stehen«, sagte Erasmus. »Bislang ist es mir nicht gelungen, das Gefühl des Hasses zu verstehen, und ich würde es gern genauer untersuchen.«
Anna Corrino sah ihn mit einem Lächeln an, das mit einem Mal grausam geworden war, was er als beunruhigend empfand.
5
Das Universum ist voller faszinierender Wahrscheinlichkeiten, die sich berechnen lassen. Ein Mentat muss allerdings lernen, den überwiegenden Teil solcher Versuchungen zu ignorieren, sonst verliert er unweigerlich den Verstand.
Der verstorbene Rektor Gilbertus Albansin einer Rede vor seinen Schülern im ersten Jahr
Valya Harkonnen, die noch neu in ihrer Rolle als Mutter Oberin war, achtete nicht auf den schneidend kalten Wind, der über das Landefeld auf Wallach IX peitschte. Ein Passagierschiff mit einer Gruppe von Schwestern fragwürdiger Loyalität, die Valya vom imperialen Hof zurückbeordert hatte, setzte auf. Valya ging ihnen entgegen.
Die schwache Sonne über ihr strahlte jetzt am frühen Nachmittag so wenig Wärme ab, dass Valya ein schweres, verziertes Gewand angelegt hatte, aber die Kälte ließ sich ertragen. Auf ihrer Heimatwelt Lankiveil war es noch kälter, und außerdem musste sie, um Unannehmlichkeiten zu lindern, nur ihren Metabolismus ein wenig umstellen.
Valyas ovales Gesicht war von kurzem, schwarzem Haar umrahmt, ihre haselnussbraunen Augen nahmen alles um sie herum in sich auf. Sie drehte den Kopf, um zu beobachten, wie die Frauen das Schiff verließen, bedachte sie jedoch nicht mit einem Lächeln. Nachdem das Zerwürfnis der Schwesternschaft beigelegt und sie als Siegerin daraus hervorgegangen war, hatte Valya die Frauen, die sich ihr gegenüber nicht loyal gezeigt hatten, herbeordert, damit sie ihrer neuen Mutter Oberin gegenübertraten.
Mutter Oberin … obwohl körperlich noch jung, war Valya eine Ehrwürdige Mutter und trug somit die Erinnerungen von Jahrtausenden in sich. Sie hatte ihre wichtige Stellung erst seit ein paar Monaten inne, seit dem Tod von Raquella Berto-Anirul. Sie war noch damit beschäftigt, ihre Verantwortungen und Pflichten auszuloten und herauszufinden, wie viel Macht sie hatte … und sie musste sichergehen, dass keine andere Schwester sie herausforderte. Diese Schwestern vom imperialen Hof waren suspekt, aber Valya verfügte über Möglichkeiten.
Für sie war es überlebenswichtig, winzige Kleinigkeiten zu bemerken, die anderen vielleicht entgingen. Obwohl Valya keine ausgebildete Wahrsagerin war, hatte sie schon immer einen Instinkt besessen, Wahrheiten und Loyalitäten zu erkennen. Auf den ersten Blick bemerkte sie keine verborgenen gewalttätigen Absichten bei den Neuankömmlingen, keine unmittelbare Bedrohung, aber falls eine dieser Frauen sie körperlich angriff, hätte sie es mit einer beeindruckenden Gegnerin zu tun. Außerdem verfeinerte Valya die Kontrolle ihrer neuen Stimm-Technik, mit der sie andere zwingen konnte, das zu tun, was sie ihnen befahl.
Sie hatte die Entscheidung zu treffen, ob diesen Schwestern von einer ehemals rivalisierenden Fraktion zu trauen war oder ob man sich ihrer entledigen sollte.
Die Mutter Oberin musste sich allerdings nicht nur vor ihren Feinden schützen, sondern auch ihre engsten Verbündeten innerhalb der Schwesternschaft ermutigen und unterstützen. Einmal hatte sie sogar Fielle – die treue Mentatenschwester, die nun an ihrer Seite stand – des übertriebenen Ehrgeizes verdächtigt, und trotzdem war sie zu einer ihrer engsten Beraterinnen geworden. Fielle war eine Frau mit kräftigem Knochenbau und fleischigem Gesicht, die stets die Details im Blick behielt. Nachdem sie ihre Ausbildung auf Lampadas beendet hatte, war die Mentatin und Wahrsagerin eine von Raquellas Favoritinnen gewesen, und Valyas betrachtete sie nun als ein mächtiges Werkzeug.
Schwarz gewandete Schwestern verließen nacheinander in einer Reihe das Schiff, wie ein Trauerzug. Valya kannte viele der orthodoxen Schwestern, darunter ihre erbitterten Rivalinnen Ninke und Esther-Cano, aber nicht alle – noch nicht. Valya beabsichtigte, sich über jede Einzelne Bericht erstatten zu lassen und anhand dieser Informationen über ihr jeweiliges Schicksal zu entscheiden. Diese Frauen hatten ihr Treuegelübde gegenüber Mutter Oberin Raquella gebrochen, und obwohl die Schwesternschaft nun wieder vereinigt war – gemäß dem Wunsch, den die alte Frau auf ihrem Sterbebett geäußert hatte – wusste Valya, dass sie diesen Frauen nicht trauen konnte, solange sie keine verlässlichen Bestätigungen in der Hand hatte. Sie hatten der Organisation eine schwere Wunde zugefügt.
Ein Versprechen, das man einmal gebrochen hat, kann man auch ein zweites Mal brechen.
Schwester Olivia ließ die Neuankömmlinge Aufstellung nehmen, damit die Mutter Oberin vor ihnen sprechen konnte. Die blonde Frau war zwar pflichtbewusst und zuverlässig, doch sie neigte zur Erregtheit, und Valya bemerkte eine gewisse Nervosität in Olivias Stimme. Trotz allem war sie aufmerksam und gewissenhaft, und Valya verließ sich darauf, in ihr eine weitere Verbündete zu haben.
Als Olivia mit der Anordnung der Frauen zufrieden war, trat Valya vor und sprach mit lauter, gekünstelt fröhlicher Stimme. »Heute habt ihr die Gelegenheit, euch weiterzuentwickeln, anstatt bestraft zu werden. Doch dazu müsst ihr euch von Doroteas schädlichen Lehren lossagen. Die vereinte Schwesternschaft ist wieder erstarkt, trotz des Schadens, den ihre Rebellion gegen die Mutter Oberin angerichtet hat.«
Valyas Blick wanderte an den Frauen entlang und suchte ihre Mienen und Körperhaltungen nach Anzeichen von Widerstand ab. Manche wirkten nervös, verängstigt oder demütig, während andere praktisch undurchschaubar blieben. Oberflächlich sah sie vor allem Unterwürfigkeit, aber nur die Zeit würde die Wahrheit ans Licht bringen. »Man wird euch alle sorgfältig befragen, und ich hoffe innig, dass wir euch alle wieder als Teil der Schwesternschaft willkommen heißen können.«
Trotz ihrer plötzlich beunruhigten Mienen entließ Valya die Frauen, und Schwester Olivia führte die Gruppe zu einem großen Bodenfahrzeug. Valyas Leibwache würde die Neuankömmlinge in einen abgetrennten Bereich des gesicherten Dormitoriums bringen, wo man sie genauestens überwachen würde. Man würde sie erst freilassen, nachdem sie Valya die Treue erklärt hatten und man sie einer strengen Umerziehung unterzogen hatte. Wer sich nicht fügte, würde sterben. Valya war es egal, ob sie dabei die eine oder andere Schwester verlor. Die Schwesternschaft würde wieder mit einer Stimme und einem Geist sprechen, und sie würde Valya gehören und nicht Raquella.
Während man die Frauen abführte, nahm Valya Blickkontakt mit einer der Frauen aus ihrer Wacheskorte auf – es war ihre jüngere Schwester Tula Harkonnen, die dank des strengen Trainings, das Valya ihr verordnet hatte, zu den besten Kämpferinnen der Schwesternschaft zählte. Unter Tulas weicher, lieblicher Schönheit und ihren blonden Locken lauerte eine rasiermesserscharfe Gefahr. Als die junge Frau Valyas Blick erwiderte, blitzte ein Ausdruck des Unbehagens in ihren Augen auf, bevor sie die Gruppe von Schwestern an Bord des Fahrzeugs begleitete.
Dieser kurze Moment verstörte Valya, und sie überlegte, was darin zum Ausdruck gekommen war. Tula hatte um Erlaubnis gebeten, zu ihrer Familie nach Lankiveil heimzukehren, zumindest für einen kurzen Urlaub, den sie sich auch durchaus verdient hatte … aber Valya wollte verstehen, warum Tula überhaupt darum bat. Sie hatte – wie befohlen – Atreides-Blut vergossen und ihre Loyalität unter Beweis gestellt … zumindest als Angehörige des Hauses Harkonnen.
Tula hatte den perfekten Racheplan in die Tat umgesetzt, indem sie den jungen Orry Atreides geheiratet und in ihrer Hochzeitsnacht getötet hatte. Welch wunderbare Gemeinheit! Der Mord hatte Vorian Atreides dazu veranlasst, gemeinsam mit Orrys Bruder Willem unterzutauchen. Die beiden waren von Caladan verschwunden, und selbst mit den Verbindungen der Schwesternschaft konnte Valya nicht ermitteln, wo sie sich aufhielten.
Doch Tula hatte die Freude ihrer Schwester nicht geteilt. Stattdessen hatte sie Reue und Schuldgefühle wegen des Mordes an Orry geäußert, als hätte sie echte Gefühle für das Opfer gehegt. Tula hatte sogar ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass ihre beiden Familien nicht in einem besseren Verhältnis zueinander stehen konnten. Besser? Valya konnte sich das nicht im Entferntesten vorstellen, nicht nach so vielen Generationen der Blutfehde.
Anscheinend brauchte das Mädchen Zeit, um über ihre Prioritäten nachzudenken, und es wäre gut für sie, auf die Ländereien der Harkonnens zurückzukehren und sich dort ihre Familienbande ins Gedächtnis zu rufen. Valya hatte sich um einen Flug nach Lankiveil für sie gekümmert. Dort würde sie bleiben, bis sie erneut für eine Mission gebraucht wurde. Dennoch würde sie Tula im Auge behalten müssen, ihre seltsame Zurückhaltung machte Valya Sorgen …
Fielle trat vor, um Bericht zu erstatten, und riss ihre Vorgesetzte damit aus ihren Gedanken. »Ich bin bereit, nach Salusa abzureisen, Mutter Oberin. Meine Gefährtinnen und ich sind bereit, die offenen Stellen am Hof zu besetzen, wie von Ihnen befohlen. Wenn der Imperator mich nimmt, werde ich seine neue Wahrsagerin.«
»Er wird dich nehmen. Er braucht eine Wahrsagerin, nachdem Dorotea tot ist.« Valya lächelte die ihr treu ergebene Frau an. »Und ich werde froh sein, dich dort zu haben. Wir müssen dafür sogen, dass Imperator Roderick richtig beraten wird.« Valya warf einen Blick zur Fähre, die von männlichen Arbeitern betankt und gewartet wurde. »Sobald die Fähre zum Abflug bereit ist, kannst du mit den anderen Schwestern an Bord gehen.« Der Faltraumtransporter von EsconTrans würde sie zum Hauptplaneten des Imperiums zurückbringen.
»Ich werde das Vertrauen des Imperators gewinnen, indem ich ihm die Informationen über Josef Venport zukommen lasse, über die wir gesprochen haben«, sagte Fielle. »Natürlich macht er sich genau wie wir Gedanken darüber, dass Venport so viele Menschen getötet hat, um sein Monopol auf das Gewürz zu behalten. Er stellt eine Gefahr dar, nicht nur für die verbliebenen Operationen des Imperiums auf Arrakis, sondern für das Imperium als Ganzes.«
»Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat«, sagte Valya. »Falls Venport herausfindet, was du offenbart hast, wird er das als Verrat unsererseits ansehen. Er hat der Schwesternschaft in Zeiten der Not geholfen, indem er den Umzug nach Wallach IX organisiert und unsere neue Schule hier gerettet hat.«
»Und seine Frau hat uns dabei geholfen, die …« Fielle vergewisserte sich mit einem raschen Rundumblick, dass niemand sie belauschte, denn von dem, worüber sie nun reden wollte, wussten nur wenige Schwestern. »… Computer aus den Urwäldern von Rossak zu bergen. Ohne sie hätten wir all unsere Zuchtprotokolle verloren.«
»Ja, Venport war unseren Zwecken dienlich.« Valya nickte. »Seine Frau Cioba ist eine von uns und auch eine Zauberin. Seine persönliche Loyalität uns gegenüber ist über jeden Zweifel erhaben, aber in Ehedingen und Geschäftsangelegenheiten gibt es nie Gewissheit. Wir haben getan, was wir tun mussten. Doch das liegt nun hinter uns, und derzeit ist es uns dienlicher, uns auf die Seite des Imperators zu stellen.«
Fielle klang betrübt. »Mutter Oberin Raquella war Venport immer dankbar für seine Hilfe.«
»Ich bin nicht Raquella«, sagte Valya. »Sie hat nicht darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn die Schwesternschaft einem Wirtschaftsmagnaten verpflichtet ist, und er bildet sich ein, dass er bei uns die Fäden wie bei einer Marionette ziehen kann. Ich würde Venport lieber eine finanzielle Entschädigung für frühere Dienste schicken und mit ihm abschließen, als weiter in seiner Schuld zu stehen, wovon er zweifellos ausgeht. Er erweist Gefälligkeiten und erwartet dann, dass man sie ihm mit Zins und Zinseszins zurückzahlt. Er ist wie ein Kriegsherr.« Sie legte die Stirn in tiefe Falten und dachte nach. »Auf seine Art ist Direktor Venport genauso schwierig wie Manford Torondo. Zwei gestörte Persönlichkeiten, die immer wieder für Probleme sorgen.« Sie nickte ernst. »Wir wollen uns keinen dieser beiden Männer zum Feind machen.«
»Ich verstehe, wie wichtig es ist, neutral zu bleiben«, sagte Fielle mit einer respektvollen Verbeugung. »Ich werde gut achtgeben, wenn ich mit dem Imperator unter vier Augen spreche.«
Während sich die Mentatenschwester auf ihre Abreise nach Salusa Secundus vorbereitete, empfand Valya Zuversicht. Die Teile ihres Plans griffen gut ineinander. Im Hinterkopf hörte sie das aufgeregte Plappern der Frauen aus den Weitergehenden Erinnerungen, jener seit Langem toten Schwestern, die gelegentlich an die Oberfläche ihres Bewusstseins drangen. Sie waren uralt und unberechenbar, aber sie gaben ihr wertvollen, wenn auch oftmals widersprüchlichen Rat. Sie hörte sich eine Stimme nach der anderen an.
»Ehrwürdige Mutter Valya! Du konzentrierst dich zu sehr auf deine Rache an den Atreides«, sagte eine Stimme.
»Es ist dein Vermächtnis, größer zu sein als Vorian Atreides, der berühmteste Held von Butlers Djihad«, meinte eine andere.
»Die Schwesternschaft ist wichtiger als die Feindschaft zwischen euren beiden Familien. Lass diese Fehde hinter dir.«
Eine weitere, weise klingende Stimme fügte hinzu: »Wie könnte man besser den Sieg erringen, als durch den Versuch, das Vermächtnis dieses Mannes zu überschatten? Größe ist deine Bestimmung, Valya Harkonnen, nicht kleinlicher Hass. Denk an die Schwesternschaft – und nicht an bloße Rache!«
Die Stimmen verschwammen im Hintergrundrauschen anderer geisterhafter Erinnerungen, aber Valya war nicht überzeugt. Warum sollte ich nicht gleichzeitig zum Vorteil der Schwesternschaft und meines Großen Hauses arbeiten können?
Stirnrunzelnd und in Gedanken versunken setzte sie ihren Weg fort. Die Botschaften aus den Weitergehenden Erinnerungen waren immer wichtig, aber sie wusste nicht, ob sie auf ihren Rat hören sollte. Ihr Leben und ihre Bestimmung folgten einer anderen Bahn, und diese längst toten Frauen wussten das. Ihre Rache war nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sie betraf das ganze Haus Harkonnen. Sie hatte gelobt, ihrer Familie wieder den Status zu verschaffen, den man ihr geraubt hatte.
Ich werde auf meinem Kurs bleiben, dachte sie, ganz gleich, was die Stimmen in meinem Innern sagen.
6
Es wäre schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine umfassende Biografie von Vorian Atreides zu verfassen. Er hat so lange gelebt und so viele unterschiedliche Erfahrungen an so vielen unterschiedlichen Orten gemacht. Er ist wie der Wind. Jahrhundertelang zieht er an den Menschen vorbei.
Haruk Ari, Djihad-Historiker
Kepler mochte vielleicht als eher langweilige Welt erscheinen, aber Vor hatte sein ruhiges, geborgenes Zuhause dort über viele Jahre geschätzt. Dort hatte er genau die Art von ereignislosem Leben geführt, nach der er sich früher einmal gesehnt hatte. Er war zufrieden gewesen, ein anderer Mann, dessen Vergangenheit hinter ihm lag. Er hatte eine geliebte Frau geheiratet und eine vielköpfige Familie großgezogen – mehr konnte man sich nicht wünschen.
Jetzt fürchtete er, dass all diese Menschen in Gefahr waren, weil ihn nun die Ereignisse seiner Vergangenheit einholten. Möglicherweise hatten die Harkonnens es auf sie abgesehen.
Als er und der junge Willem Atreides in der Hauptortschaft auf Kepler eintrafen, dachte Vor an diese glücklichen Zeiten zurück, aber er wollte nicht, dass man sich an ihn erinnerte oder ihn auch nur bemerkte. Er hatte diesen Ort hinter sich gelassen, hatte geschworen, nie mehr zurückzukehren. Jetzt durfte niemand auf Kepler erfahren, wer er war, aber er würde trotzdem unauffällige Warnungen vor Tula Harkonnen verbreiten, damit man nach ihr Ausschau hielt. Könnte Tula hierher kommen, weil sie hoffte, einen weiteren jungen Atreides zu verführen und zu ermorden, wie sie es mit Orry getan hatte? Wenn die Leute hier rechtzeitig Bescheid wussten, konnten sie sie vielleicht aufhalten.
Der neunzehnjährige Willem, der genau wie Vor hochgewachsen und dunkelhaarig war, sah wie sein Sohn aus, auch wenn er genau genommen ein viele Generationen jüngerer Nachkomme war. Für ihre Zwecke gab sich Willem vorerst als Vors Neffe aus. Die beiden hatten sich als bärtige, notleidende Arbeiter auf der Suche nach einer Anstellung verkleidet … so konnten sie gut auf Gefahren für die weit verzweigte Atreides-Familie auf Kepler achtgeben. Keiner von ihnen würde jemals vergessen, wie Tula aussah.
Obwohl es das erste Mal war, dass er Caladan verlassen hatte, meinte Willem es todernst mit ihrer Mission, sich zu vergewissern, dass Vors übriger Familie keine Gefahr durch die Harkonnens drohte und dass Tula nicht hierher gekommen war. Vorerst würden sich die beiden Männer bedeckt halten und auf mögliche Bedrohungen achten.
Auf der Fahrt vom Landefeld zur Ortschaft spielten sie ihre Rolle, indem sie nach möglichen Anstellungen fragten. Vor erkannte einen der einheimischen Ladenbesitzer, der Vor allerdings kaum eines Blickes würdigte. »Arbeit?« Der graubärtige Ladenbesitzer zuckte mit den Schultern und deutete unbestimmt in Richtung Stadt. »Fragen Sie einfach bei irgendeiner Obstplantage. Um diese Jahreszeit werden immer Helfer gebraucht, um die Buriak-Ernte einzubringen.«