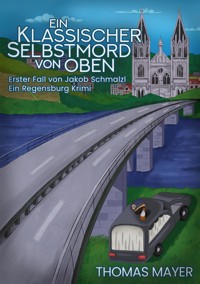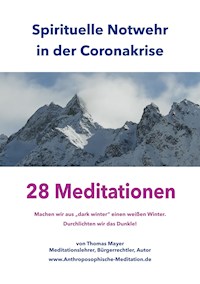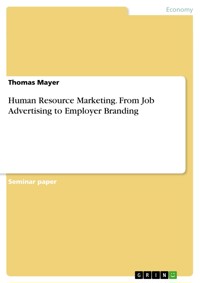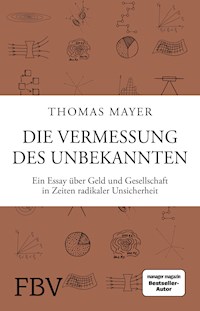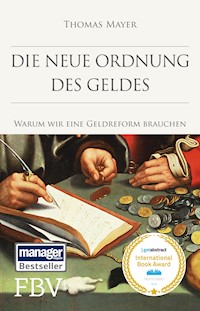
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gewinner des getAbstract International Book Award 2015 Seit der Finanzkrise stehen die Banken unter Generalverdacht und nicht wenige ihrer Kunden fühlen sich von Bankern ausgebeutet. Im Sog der öffentlichen Empörung überzieht die Politik das Bankgewerbe mit Strafen und will es bis ins kleinste Detail regulieren. Die Hohepriester der Ökonomie an den Universitäten und den Zentralbanken liefern dazu bereitwillig die Blaupausen. Doch kratzt man an der Oberfläche der Diskussion um die Banken, stellt man fest, dass sogar unter Experten heillose Verwirrung über die einfachsten Begriffe herrscht. Was ist eigentlich Geld und wie entsteht es? Was machen die Banken wirklich? Was ist Zins? Kann es ein stabiles Geldsystem überhaupt geben? Thomas Mayer – einer der renommiertesten deutschen Wirtschaftsexperten – wagt es, sich dem Konsens der Experten entgegenzustellen und die konventionelle Makroökonomik und Finanztheorie herauszufordern. Seine Antwort auf die Frage nach einer besseren Geldordnung ist eine Geldreform, die unsere gegenwärtige Passivgeldordnung durch eine Aktivgeldordnung ersetzt. Mayer ist kein Krisenprophet. Er glaubt, dass unser mangelhaftes Geldsystems in einem evolutionären Prozess verbessert werden kann – wenn Politiker und Entscheidungsträger es nur wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
3., aktualisierte Auflage 2015
© 2014 by FinanzBuch Verlag
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Jordan Wegberg
Korrektorat: Rainer Weber
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt
Umschlagabbildung: unter Verwendung von gettyimages-Bildern
E-Book Umsetzung: Georg Stadler, Müncheb
ISBN Print 978-3-89879-840-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86248-402-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86248- 403-4
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter
www.muenchner-verlagsgruppe.de
Inhalt
Einleitung 11
Kapitel 1: Was ist Geld? 15
Wie Wirtschaftsbeziehungen organisiert sind 15
Die Geldordnungen nach Eucken 22
Schwundgeld 27
Fazit 29
Kapitel 2: Wie entsteht Geld? 32
Das Passivgeld der Banken 32
Das Passivgeld der Zentralbank 36
Das Passivgeldsystem und der Kapitalmarkt 47
Fazit 49
Kapitel 3: Was machen Banken? 51
Das Missverständnis und die Folgen 51
Die Komplizenschaft der modernen Finanztheorie 61
Warum Kapitalmarktgeschäfte weniger riskant sind 68
Fazit 79
Kapitel 4: Wie entsteht Inflation? 81
Inflation als monetäres Phänomen 81
Inflation und relative Preisänderungen 85
Konsumenten- und Vermögenspreisinflation in der jüngeren Vergangenheit 89
Die dunkle Seite der Geldvermehrung 93
Der Fluch der Deflation 95
Inflation und Deflation im Aktiv- und Passivgeldsystem 97
Fazit 98
Kapitel 5: Was ist Zins? 100
Zins als Leihgebühr für Kapital 101
Zins als Präferenz für Liquidität 103
Robinson Crusoe und die österreichische Kapitaltheorie 106
Der »natürliche« Zins und der Marktzins 110
Kein Wachstum – kein Zins? 112
Wachstumszwang und Umverteilung 113
Fazit 115
Kapitel 6: Gibt es ein stabiles Geldsystem? 117
Der Weg in den bürokratischen Sozialismus 117
Der Staat und das Geld 124
Staatsgeld als System 128
Wider das Staatsgeldsystem 134
Vollgeld – aber wie? 138
Die Aktivgeldordnung 146
Fazit 159
Kapitel 7: Wie geht es weiter mit dem Euro? 162
Die Eurokrise als Reaktion auf den Zinsschock 163
Die Errichtung eines Schattenstaats zur Stabilisierung der EWU 165
Fallstudie Bankenunion 175
Staatsgeld ohne Staat 179
Eine konföderale Struktur für Europa 181
Für eine freiheitliche Geldverfassung 185
Für Währungswettbewerb 191
Unternehmerische Freiheit und Haftung für Banken 195
Fazit 208
Kapitel 8: Was wird aus unserem Papiergeldsystem? 210
Vorhang auf für Papiergeld 210
Der Maestro betritt die Bühne 213
Der große Krach von 2007 und seine Folgen 215
Die »neue Normalität« 221
Wege zur Entschuldung 226
Szenarien für die Zukunft 231
Fazit 233
Quintessenz 234
Anmerkungen und Quellen 238
Über den Autor 248
Für Nina, Lisa und Renate
»I strongly feel that the chief task of the economic theorist or political philosopher should be to operate on public opinion to make politically possible what today may be politically impossible.«
F. A. von Hayek1
Einleitung
Mit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 begann meine Midlife-Krise als Ökonom. Schon beim Krach des Rentenmarkts im Jahr 1994, bei der Krise der Schwellenländer 1998 und natürlich beim Platzen der Technologieblase im Jahr 2000 war mir der Gedanke gekommen, dass an unserer modernen Makro- und Finanztheorie etwas faul sein könnte.
Ich bin von Hause aus Entwicklungsökonom und dachte zunächst, ich hätte etwas in der Makro- und Finanzökonomie verpasst. Also drückte ich mit Ende vierzig noch einmal drei Jahre lang die Schulbank. Die Prüfung in Finanzökonomik legte ich als Methusalem unter jugendlichen Kandidaten im Jahr 2003 ab. Seither darf ich mich als »Charterholder« des Chartered Financial Analysts Institute bezeichnen. Die Erleuchtung brachte diese Zusatzqualifikation allerdings nicht.
Meine Zweifel an der modernen Makro- und Finanzökonomik verdichteten sich zur Gewissheit, als dann 2007 die Kreditblase platzte und die Finanzkrise begann. Das gängige neukeynesianische/neoklassische Fusionsmodell, das als Grundlage für die Geldpolitik der Zentralbanken diente, und die These der rationalen Erwartungen und effizienten Finanzmärkte, die den Finanzsektor regierte, waren offensichtlich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Dennoch machten die meisten Ökonomen und Praktiker weiter wie bisher.
Dies traf insbesondere auf die Zentralbanken und den akademischen Betrieb zu. Falls überhaupt, dann schenkte man der verhaltensorientierten Ökonomie ein bisschen mehr Beachtung und kehrte den Keynesianer der »Animal Spirits« in sich heraus. Im Großen und Ganzen aber blieb man beim Business as usual. Die Zentralbanken hantierten weiter fröhlich mit ihren Dynamic-Stochastic-General-Equilibrium-Modellen, nach denen die Finanzkrise nie hätte geschehen dürfen, und die Finanzindustrie schwelgte unverdrossen in den Verästelungen der modernen Portfoliotheorie, als ob sie mit diesem Navigationssystem nicht gerade mit Vollgas gegen die Wand gefahren wäre.
Ich fand mich immer öfter in öffentlichen Podiumsdiskussionen unter sogenannten Experten wieder, bei denen heillose Verwirrung über die einfachsten Begriffe herrschte. Was ist Geld? Ein Schuldschein? Wenn ja, von wem ausgestellt? Oder ein Vermögenswert? Wie entsteht Geld? Doch wohl nicht mehr dadurch, dass Goldgräber die Früchte ihrer Arbeit gegen Banknoten eintauschen, wie es die Lehrbuchautoren noch immer zu glauben scheinen. Wie aber dann? Und wie kommt es unter die Leute? Was machen eigentlich die Banken? Nehmen sie Einlagen entgegen, um Kredite zu vergeben, wie es der akademische Betrieb lehrt? Oder vergeben sie Kredite, um Einlagen zu erzeugen, wie einige Häretiker behaupten? Was ist Zins? Eine Leihgebühr für Geld? Oder der Grenzertrag von Kapital? Eine Liquiditätsprämie? Ein Maß für Zeitpräferenzen? Oder einfach ein Überbleibsel aus kapitalistischen Zeiten, das in der ökologischen Post-Wachstumsökonomie abgeschafft gehört?
Fragen über Fragen. Traut man sich, sie als Bankvolkswirt zu stellen, so kommt dies einem Outing als Revolutionär oder als Konterrevolutionär gleich, je nach anwesendem Publikum. Die Hohepriester der Ökonomie in den Universitäten oder bei den Zentralbanken reagieren düpiert. Jetzt bloß nicht auch noch eine Grundsatzdebatte! Das ist doch alles längst geklärt. Aber ist es das? Wissen die hohen Vertreter der gültigen Lehre denn, was sie tun?
Ich denke, sie wissen es nicht. In ihrer komplizierten Modellwelt, die mit viel Mathematik verwissenschaftlicht werden soll, haben sie den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Und weil sie sich über die elementaren Fragen im Unklaren sind, sind sie unfähig, unser Geldwesen richtig zu ordnen, den Euro nachhaltig zu stabilisieren und eine Geldkrise als Folge der Finanzkrise abzuwehren. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich auf die elementaren Fragen erst klare Antworten finden musste, sodass ich mir die komplexeren Fragen beantworten konnte. Mit dem Schreiben kommt Ordnung in den Kopf.
Daher hat dieses Buch eine Vorgeschichte in Form einer früheren Veröffentlichung zum Euro und einer Monografie über das Elend der modernen Makroökonomie, und es wird sicherlich auch eine Nachgeschichte haben, weil ich mit dem Denken nie fertig werde.2In dem vorliegenden Buch habe ich aber meine Antwort auf die Frage nach einer vernünftigen Geldordnung gefunden: Um zu einem stabileren Geldsystem zu gelangen, brauchen wir eine Geldreform, die von der Vorstellung von Geld als »Aktivum« ausgeht. Der Übergang von unserem gegenwärtigen Passivgeld zum Aktivgeld muss dabei keine Geldkrise auslösen. Er ist in einem evolutionären Prozess möglich, wenn man denn nur will.
Meine ökonomische Erkenntniskrise hat mich dazu gebracht, mich von der konventionellen Ökonomie scheiden zu lassen. Unser Verhältnis ist zerrüttet, ich habe die Achtung vor ihr verloren. Ohne Zweifel beruht dies auf Gegenseitigkeit, soweit die konventionelle Ökonomie überhaupt von mir Notiz nimmt. Meine neue Liebe gehört den Österreichern. Damit meine ich keineswegs Ökonomen mit österreichischem Pass, sondern eine ökonomische Schule, die man wegen der Herkunft ihrer Begründer die österreichische nennt. Ich bin durch meine Tätigkeit und praktischen Erfahrungen in der Finanzindustrie zu einem Anhänger dieser Schule geworden. Der Ökonometrie, die ich leidenschaftlich betrieb, und dem mathematischen Modellbau, den ich nie wirklich beherrschte, habe ich abgeschworen.
Jedoch gilt mein Interesse nicht der Verfeinerung der reinen österreichischen Lehre, der Abgrenzung von anderen Schulen oder der Ausgrenzung von abweichenden Ansichten. Mein Interesse an den Österreichern gründet auf ihrer Fähigkeit, mir bei der Beantwortung der einfachen Fragen zu helfen, die mich umtreiben. Die Antworten, die ich beim Schreiben dieses Buchs gefunden habe, sind meine eigenen. Wenn Österreicher sie als die Ihrigen ansehen, so gebe ich ihnen gerne dafür den Kredit, mich auf die richtige Spur gebracht zu haben. Wenn sie sie als abseits der reinen Lehre betrachten, so will ich ihnen dennoch gerne die Inspiration zugestehen.
Ich hätte dieses Buch nicht ohne die aktive oder passive freundliche Unterstützung zahlreicher Personen schreiben können. Besonderen Dank schulde ich Philipp Bagus, Benedikt Fehr und Joseph Huber, die so freundlich waren, eine frühere Fassung des Manuskripts sorgfältig zu lesen und mir viele hilfreiche und mich zum genaueren Denken bringende Kommentare zu geben. Es versteht sich von selbst, dass verbleibende Fehler, Unklarheiten und Dummheiten allein mir selbst anzulasten sind.
Dank geht auch an die Teilnehmer meiner Lehrveranstaltungen an der Universität Witten-Herdecke, die mich durch kluge Fragen zu tieferem Nachdenken brachten. Inspiration waren mir des Weiteren die Vorträge zur »Ordnung des Geldes« am Center for Financial Studies der Goethe Universität Frankfurt, die ich organisieren und moderieren durfte.
Nicht zuletzt danke ich meinen früheren Kollegen bei der Deutschen Bank, die mir während meiner Tätigkeit als Berater der Bank den Freiraum ließen, meine Gedanken zu ordnen, die in diesem Buch zusammengefasst sind. Mein nun zum bescheidenen Preis dieses Buchs zu habender Rat an sie ist, über das Geschäftsmodell der Banken grundsätzlich nachzudenken. Denn die anderen tun dies längst.
Nach der Erstveröffentlichung des Buches im Oktober 2014 erhielt ich zahlreiche und sehr hilfreiche Hinweise und Anmerkungen zum Text. Besonderen Dank schulde ich Timm Gudehus für die genaue Lektüre und viele konstruktive Kommentare. Die überraschend große Nachfrage nach dem Buch machte einen Neudruck noch im Dezember 2014 möglich, in den ich die meisten der Anregungen eingearbeitet habe.
Thomas Mayer, im Dezember 2014
Kapitel 1: Was ist Geld?
Ob wir es wollen oder nicht: Geld spielt in unser aller Leben eine herausragende Rolle. Haben wir als Kinder die ersten Rechenfertigkeiten erlernt, dann dauert es nicht lange, bis wir diese auf Geld anwenden. Und manch einer verwendet noch seine letzten klaren Gedanken darauf, wer das Geld, das er zu Lebzeiten angesammelt hat, nach seinem Tod bekommen soll. Entsprechend seiner Bedeutung für unser Leben haben sich die meisten Sozialwissenschaften mit Geld befasst.
In den Wirtschaftswissenschaften nimmt die Geldtheorie und -politik einen prominenten Platz ein. Man sollte daher meinen, wir wüssten, was Geld ist. Doch das ist, so unglaublich es klingt, nicht der Fall. Wie wir in diesem Kapitel sehen werden, gibt es zwei sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was Geld eigentlich darstellt. Für die einen ist Geld eine besondere Ware, die durch gesellschaftliche Konvention zu einem Mittel für den Tausch wirtschaftlicher Güter geworden ist. Für die anderen ist Geld nur ein Maß für die Schuld, in der wir Mitmenschen gegenüber stehen, die uns ein wirtschaftliches Gut überlassen haben.
Wie Wirtschaftsbeziehungen organisiert sind
In der Literatur lassen sich zur Natur des Geldes zwei unterschiedliche Auffassungen finden: eine anthropologisch-historische und eine ökonomische. Der bekannteste Vertreter der ökonomischen Auffassung des Geldes ist der schottische Moralphilosoph und Ökonom Adam Smith, der im 18. Jahrhundert das theoretische Gerüst für die heute gültige Lehre von der Ökonomie schuf. Einer seiner Herausforderer aus unserer Gegenwart ist der Anthropologe und Aktivist David Graeber, der heute an der London School of Economics and Political Science lehrt. In dieser ungleichen Auseinandersetzung stehen sich ein Klassiker der Nationalökonomie aus dem 18. Jahrhundert und ein zeitgenössischer Anthropologe, Kritiker unseres Finanzsystems und erklärter Anarchist gegenüber, was sie umso spannender macht. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Protagonisten.
Adam Smith wurde 1723 in Kircaldy getauft und studierte schon ab seinem vierzehnten Lebensjahr bis 1740 an der Universität Glasgow. Danach ging er ans Balliol College der Universität Oxford, wo er bis 1746 Philosophie studierte. 1748/49 hielt er öffentliche Vorlesungen in Edinburgh. Im Jahr 1751 wurde er Professor für Logik und kurze Zeit später, im Jahr 1752, Professor für Moralphilosophie an der Universität Glasgow. Smith war mit dem Philosophen David Hume befreundet und lernte Voltaire sowie die französischen Physiokraten Jacques Turgot und François Quesnais kennen. Im Jahr 1776 erschien sein bedeutendstes Werk,Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen.
Für Smith bestimmt Arbeit den Wert von Gütern und nicht natürliche Ressourcen wie bei den Physiokraten. Seine Lehre vom Arbeitswert der Güter floss sowohl in die ökonomische Theorie von Karl Marx als auch in die klassische und neoklassische ökonomische Theorie ein, wurde aber von den späteren Ökonomen der Österreichischen Schule, wie Carl Menger, Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek, vehement abgelehnt.
Produktion kann nach Smith durch Arbeitsteilung gesteigert werden. Daraus folgt die Notwendigkeit zum Tausch: »Wie das Verhandeln, Tauschen und Kaufen das Mittel ist, uns gegenseitig mit fast allen nützlichen Diensten, die wir brauchen, zu versorgen, so gibt die Neigung zum Tausch letztlich auch den Anstoß zur Arbeitsteilung.«3Indem jedes Individuum unter Einsatz seiner speziellen Fähigkeiten und innerhalb der gesellschaftlichen Grenzen danach strebt, sein persönliches Glück zu steigern, wird über die »unsichtbare Hand« des Tauschs im Markt die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt erhöht. Der Einzelne »wird ... von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat«.4
Der Herausforderer Smiths, David Graeber, wurde 1961 in New York geboren und ist nach eigenen Aussagen seit seinem sechzehnten Lebensjahr Anarchist. Er studierte an der State University of New York und der Universität von Chicago, wo er 1996 promovierte. Zwei Jahre später wechselte er an die Yale University, wo er als Assistant und Associate Professor tätig war. Im Jahr 2005 entschied der Fachbereich Anthropologie dieser Universität, Graebers Lehrauftrag nicht zu verlängern, sodass er keine ordentliche Professur erhalten konnte. Dies führte zu erheblichen Protesten von Studenten, Aktivisten und Fachkollegen, die jedoch keinen Erfolg hatten. Nach mehreren ehrenvollen Vorträgen erhielt Graeber 2007 einen Lehrauftrag am Goldsmith College der Universität von London, bevor er 2013 zum Professor an der London School of Economics ernannt wurde.
Graeber spielte eine herausragende Rolle in der Occupy-Wall-Street-Bewegung, die im Sog der Finanzkrise im September 2011 in New York City begann. Graebers bisher wichtigstes Werk istSchulden: Die ersten 5000 Jahre,das im Jahr 2011 erschien und in dem er Adam Smiths These vom Tausch als Grundlage wirtschaftlicher Beziehungen infrage stellt.5
Graeber und andere Vertreter der anthropologisch-historischen Sicht betonen, dass in Urgesellschaften und in der Antike wirtschaftliche Beziehungen in Form von Kredit im Vordergrund standen. Tausch spielte vornehmlich dann eine Rolle, wenn nicht die Mitglieder einer Gesellschaft untereinander, sondern Mitglieder verschiedener Gesellschaften wirtschaftliche Beziehungen eingingen. Geld entstand daher nach Graeber nicht als Tauschmittel, wie von den klassischen Ökonomen behauptet, sondern als Maßeinheit für Kredit, oder auch Schuld, insbesondere gegenüber der Obrigkeit.
In seinem Buch zitiert Graeber als Kronzeugin für diese Auffassung seine Anthropologenkollegin Caroline Humphrey: »Nie wurde eine einfache und reine Tauschwirtschaft je beschrieben, und noch viel weniger die Entstehung von Geld daraus. Alle verfügbaren anthropologischen Studien widerlegen die Idee der reinen Tauschwirtschaft.«6Graeber verweist auf zahlreiche Studien primitiver Gesellschaften, in denen wirtschaftlicher Austausch in Form von »Geben und Nehmen«, oder eben Kredit und Schuld, und nicht als Tauschgeschäft beschrieben wird. Tausch kommt nur in dem besonderen Fall ins Spiel, wenn die beteiligten Parteien kein Vertrauen zueinander haben, also wenn zum Beispiel der Austausch zwischen Angehörigen unterschiedlicher Stämme und nicht zwischen denen des gleichen Stamms stattfindet. »Dies bedeutet natürlich nicht, dass Tauschhandel nicht existiert oder dass er nie von der Art von Leuten praktiziert wurde, die Smith ›Wilde‹ nannte. Es bedeutet nur, dass er beinahe nie von Angehörigen der Dorfgemeinschaft verwendet wird. Normalerweise findet er zwischen Fremden, um nicht zu sagen Feinden statt.«7
Graeber führt aus, dass »Geben und Nehmen« auch die dominante Form des Austauschs in den vorchristlichen Gesellschaften Mesopotamiens und Babyloniens war. »Geld« in unserem heutigen Sinne als universelles Maß und Tauschmittel gab es nicht. Wie Felix Martin in seiner »unautorisierten Biografie des Geldes« erklärt, wurden Transaktionen in Mesopotamien lediglich gebucht und verrechnet.8
Berühmt für ein auf Kredit basierendes Geldsystem wurde die Pazifikinsel Yap, nachdem der amerikanische Abenteurer William Henry Furness seine dort gemachten Beobachtungen 1910 in einem Buch beschrieb.9Die Leute von Yap, fand Furness heraus, bezahlten mit Steinmünzen, die so groß wie Mühlsteine waren. Diese Münzen konnten unmöglich physisch bei jeder Transaktion den Besitzer wechseln, weil sie einfach viel zu groß und schwer waren. Tatsächlich lagerten sie einfach in der Landschaft. Ja, einer dieser großen Mühlsteine war bei einem seltenen Transport übers Meer mitsamt dem Schiff vor der Küste von Yap gesunken. Obwohl der Stein auf dem Meeresgrund lag, tat dies der Zahlungsfähigkeit seines Besitzers keinen Abbruch, denn für die Leute von Yap waren die Steine keine Tauschmittel, die von Hand zu Hand wanderten, sondern Zeichen für die Kreditwürdigkeit des Besitzers. Transaktionen wurden getätigt, indem Kredite, die man sich einräumte, gegeneinander verrechnet wurden. Wenn sich die Transaktionen nicht ausglichen, jemand also netto Kreditgeber oder Schuldner war, so wechselte ein Teil des Steins virtuell den Besitzer, ohne dass er seine physische Lage verändert hätte.
Als Verrechnungseinheit kann Geld viele Formen annehmen, zum Beispiel Nutzvieh, Getreide, Nägel oder eben auch Edelmetalle. Im mittelalterlichen England vom 12. bis zum späten 18. Jahrhundert dienten spezielle Weidenstöcke, die an der Themse wuchsen, der Staatskasse zur Verrechnung von Einnahmen und Ausgaben. Die Transaktionen wurden auf die Weidenstöcke geschrieben und der Stock dann der Länge nach entzweigeschnitten, sodass beide Seiten, Gläubiger und Schuldner, einen Nachweis für die Transaktion hatten. Trotz des Gebrauchs dieser Stöcke über 600 Jahre sind heute leider nur noch wenige erhalten. Im Jahr 1782 schaffte das britische Parlament das System der »Kerbhölzer« ab.10Doch die Stöcke wurden noch viele Jahre benutzt und erst 1834 vollständig durch Papiernoten ersetzt. Im Gefühl, dass nun eine neue Zeit angebrochen war, entschloss man sich, die rückständigen Kerbhölzer in einem Ofen des Oberhauses zu verbrennen. Dabei ging man wohl ziemlich fahrlässig vor, denn die Täfelung des Sitzungssaals fing Feuer. Bald stand das ganze Oberhaus in Flammen, die dann auf das Unterhaus übergriffen. Beide Häuser des Parlaments brannten vollständig ab und wurden bis 1852 in der Form, wie wir sie heute kennen, wieder aufgebaut.
Geld verändert seinen Charakter als Maß für Kredit und Schuld und wird zum Tauschmittel erst dann, wenn das Vertrauen innerhalb einer Gesellschaft verloren geht und durch Machtverhältnisse ersetzt wird. So entstand nach Graeber Münzgeld vornehmlich aus militärischen Gründen: Herrscher gaben ihren »Soldaten« Münzen und verlangten, dass die Bauern ihre Steuern in eben diesen Münzen entrichteten. Besonders Soldaten konnten dafür sorgen, dass die Bauern ihrer Steuerpflicht auch nachkamen.
Dem so geschaffenen Geldangebot stand damit eine künstlich erzeugte Geldnachfrage gegenüber. Die Bauern mussten den Soldaten Waren gegen Münzen abtreten, die sie für die Zahlung ihrer Steuern benötigten, um von den Soldaten in Ruhe gelassen zu werden. So erfolgte die Versorgung der Armee wesentlich geordneter und damit auf weniger schädliche Weise für die Wirtschaft, als wenn die Soldaten ihren Bedarf direkt durch Ausplünderung der Bauern befriedigt hätten.
Wenn nun Geld seiner Natur nach vornehmlich ein Maß für die Schuld des Untertanen oder (später) des Bürgers an den Staat ist, so ist es folgerichtig, wenn der Staat das Geld emittiert, mit dem diese Schuld beglichen werden kann, wie es im obigen Beispiel der Herrscher mit den Münzen getan hat. Der Untertan oder Bürger entledigt sich seiner Schuld gegenüber dem Staat und erhält Geld als Quittung dafür. Im obigen Beispiel erkennt der Herrscher die Steuerschuld der Bauern als beglichen an, wenn sie ihm die Münzen zurückgegeben haben.
Der Bürger kann Geld aber auch bei einem Dritten gegen eine Ware oder Dienstleistung eintauschen, und dieser Dritte kann nun seine eigene Schuld gegenüber dem Staat mit dem Schuldgeld begleichen oder es an andere weitergeben, sodass es in der Wirtschaft zirkuliert, bis es der Staat endgültig wieder einfordert. Je weniger aktiv der Staat im Wirtschaftsprozess ist, desto mehr zirkuliert das vom Staat ursprünglich herausgegebene Geld unter den Wirtschaftssubjekten statt zwischen ihnen und dem Staat.
Nach Felix Martin ist Geld kein physisches Transaktionsmittel, sondern eine soziale Technik, die auf drei fundamentalen Elementen beruht. Das erste Element ist eine abstrakte Maßeinheit für Wert. Das zweite ist ein Kontosystem, in dem festgehalten wird, wer wem was schuldet, wenn eine Transaktion stattgefunden hat. Das dritte ist die Möglichkeit, dass der ursprüngliche Gläubiger die ihm zustehende Schuld auf einen Dritten überträgt, um damit eine eigene Schuld abzutragen.11
Im Gegensatz zu der Auffassung der Anthropologen heben die meisten Ökonomen in der Tradition von Adam Smith die Rolle des Geldes als Tauschmittel hervor. Nach dieser Lesart stand am Anfang aller wirtschaftlichen Beziehungen der Tausch von Ware gegen Ware. Adam Smith schreibt dazu:
»Unter Jägern oder Hirten stellt beispielsweise ein Mitglied des Stammes besonders leicht und geschickt Pfeil und Bogen her. Häufig tauscht er sie bei seinen Gefährten gegen Vieh oder Wildbret ein, und er findet schließlich, dass er auf diese Weise mehr davon bekommen kann, als wenn er selbst hinausgeht, um es zu jagen. Es liegt deshalb in seinem Interesse, dass er das Anfertigen von Pfeil und Bogen zur Hauptbeschäftigung macht und somit gleichsam zum Büchsenmacher wird.«12
Damit der Waffenschmied jedoch seine Pfeile und Bögen gegen Vieh und Wild tauschen kann, braucht er einen Partner, der am Tausch in die andere Richtung interessiert ist. Findet er keinen Partner mit der ihm entgegengesetzten Präferenz, kann der Tausch nicht stattfinden. Das Problem wäre wesentlich einfacher zu lösen, wenn er die Transaktion in zwei Teile spalten könnte: den Tausch von Pfeil und Bogen gegen etwas anderes und dann den Tausch dieses anderen gegen Vieh und Wild. Dabei ist dieses andere nichts weiter als ein Mittel zum Tausch.
Um seinen Zweck zu erfüllen, sollte ein Tauschmittel von bekannter und standardisierter Qualität sein und nicht von denen hergestellt werden können, die es zum Erwerb eines anderen Gutes einsetzen. Wenn seine Qualität variiert, verliert es den Charakter eines universalen Gutes und nimmt wieder den eines spezifischen Gutes an, das nicht leicht gegen irgendein anderes Gut getauscht werden kann. Und wenn es leicht von denen hergestellt werden könnte, die es zum Kauf einsetzen, dann würde der Verkäufer zweifeln, ob es wirklich den Wert darstellt, den er zum Kauf eines anderen Gutes durch den Verkauf seines Gutes benötigt.
Daher ist klar, dass einige Güter sich besser zum Tauschmittel eignen als andere. Edelmetalle von genau definierter Qualität, die haltbar und knapp sind, eignen sich besonders gut. Um Menge und Qualität des Edelmetalls für jeden leicht erkennbar zu machen und damit seinen Wert als Tauschmittel zu erhöhen, kann ihm eine anerkannte Autorität, zum Beispiel ein bekannter und geachteter Goldschmied oder eine staatliche Instanz, sein Gütesiegel aufprägen. Noch bequemer für den Tausch ist es, wenn das schwere Edelmetall an einem sicheren Ort, zum Beispiel bei einer Bank, verwahrt wird und dem Besitzer dafür leicht zu transportierende Noten, eben Banknoten, ausgehändigt werden. Der Staat kommt hier ins Spiel, wenn er das Notenbankgeschäft regelt und beispielsweise privaten Geschäftsleuten gegen Gebühr ein Monopol zur Ausgabe solcher Noten einräumt.
Wie wir gesehen haben, kritisieren die Vertreter der anthropologisch-historischen Sicht die ökonomische Begründung des Geldes als unhistorisch. Sie verweisen auf Studien, die Adam Smith nicht bekannt waren und nach denen die Tauschwirtschaft der Kredit- und Schuldwirtschaft folgte. Dies mag durchaus so gewesen sein. Insofern wäre die historische Herleitung des Geldes als Tauschmittel in den gängigen volkswirtschaftlichen Lehrbüchern zu korrigieren.
Aber daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Tauschwirtschaft und das Geld als Tauschmittel nur eine historische Übergangserscheinung wären und das staatliche Schuldgeld die natürliche Wirtschafts- und Geldordnung darstellen würde, wie Graeber gegen Ende seines Buches andeutet. Gegen eine solche Auffassung spricht Karl Poppers Kritik des Historizismus, nach der aus geschichtlichen Abläufen keine Gesetze dieser Abläufe und damit keine Prognosen hergeleitet werden können.
Die Geldordnungen nach Eucken
Ordnung bringt Walter Eucken in die Debatte. Er lebte von 1891 bis 1950 und war von 1927 bis 1950 als Professor an der Universität Freiburg tätig. Eucken gehörte zu den Gründungsvätern der ordo-liberalen Freiburger Schule.13Unabhängig von ihrer konkreten historischen Ausgestaltung unterscheidet er drei reine Geldsysteme, sozusagen Bausteine historisch vorhandener Geldordnungen.14
Im ersten System entsteht Geld dadurch, dass eine Ware zu Geld wird. Dies entspricht der oben erwähnten Idee von Geld als Tauschmittel. Die Palette der Sachgüter, die als Geld dienen, reicht von Edelmetallen über Getreide zu Muscheln. Warengeld kann im Monopol (von einem Herrscher) oder in Konkurrenz (von Städten oder anderen Körperschaften oder sogar Privatpersonen, wie etwa von Münzmeistern im fränkischen Reich des 6. Jahrhunderts) erzeugt werden.Im zweiten System entsteht Geld bei Lieferung einer Ware oder Leistung einer Arbeit als Schuldschein. Beispiel hierfür ist die Ausgabe staatlicher Schuldscheine gegen Warenlieferungen von Babylonien im 3. und 2. vorchristlichen Jahrhundert bis hin zum Deutschland des 18. Jahrhunderts. In die Kategorie des Schuldgelds fällt auch die oben beschriebene Besoldung von Soldaten für ihre Dienste durch den Staat.Im dritten System schafft der Kreditgeber schließlich Geld, das bei der Rückzahlung des Kredits wieder vernichtet wird. Diese Art der Schaffung von Kreditgeld wird von Zentralbanken betrieben, wenn sie zum Beispiel Staatsanleihen in Offenmarktgeschäften kaufen, aber auch von Privatbanken, wenn sie Kredit gewähren und die Kreditsumme dem Schuldner auf seinem Konto gutschreiben.Das Konzept des Kreditgelds führt uns wieder zurück zu der anthropologischen Auffassung von Geld als Maß für Kreditbeziehungen. In der anthropologischen Literatur werden die Kreditbeziehungen einzelner Personen durch die Familie, den Stamm, das Dorf oder einen paternalistischen Staat geregelt. Sie können, müssen aber nicht in Geldeinheiten gemessen werden. Im Kreditgeldsystem werden die Kreditbeziehungen rechtlich geregelt, wobei das Recht die institutionalisierte Form der archaischen Beziehungen darstellt. In diesem System wird Kredit natürlich in Geldeinheiten gemessen und nicht auf Treu und Glauben vergeben.
Traditionell wurde auch Kreditgeld aufgrund persönlicher Beziehungen vergeben. Für den Bankier alter Schule war nichts so wichtig wie die Kenntnis der Person des Kreditnehmers und seiner Lebensumstände. Kredit war für ihn Vertrauenssache. In jüngerer Zeit wurde die persönliche, auf Vertrauen ruhende Beziehung zwischen Bankier und Kreditnehmer durch Finanztechnik ersetzt. Damit wurden die Beziehungen zwischen Schuldnern und Gläubigern entpersonalisiert und die natürliche Grenze in der Produktion von Kreditgeld aufgehoben. Mit den Mitteln moderner Finanztheorie sollte es möglich sein, Kredite auch minderer Qualität, die von den Bankiers alter Schule nie vergeben worden wären, durch Bündelung aufzuwerten. Die Zauberformel dafür war die Zusammenfassung vermeintlich unkorrelierter oder gar negativ korrelierter Einzelrisiken zu einem Kreditprodukt von angeblich geringem Risiko.
Graeber und andere weisen darauf hin, dass Schuldenerlasse Teil der archaischen Kreditgeldsysteme waren. Laut Michael Hudson fand in Babylonien zwischen 1880 und 1636 v. Chr. im Durchschnitt alle 16 Jahre ein Schuldenerlass statt.15Graeber und Hudson leiten daraus her, dass diese auch in unserem modernen Kreditgeldsystem ein elementarer Bestandteil sein sollten. Auf der Ebene der Wirtschaftsunternehmen und privaten Haushalte ist das auch durchaus so. Dort gibt es Insolvenzordnungen, die mit Schuldenerlassen verbunden sind. Auf der Ebene der Nationalstaaten gibt es jedoch keine internationale Insolvenzordnung, und auch im Bankensektor sind Insolvenzordnungen meist die Ausnahme und Insolvenzen rar. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass das Kreditgeld auf einer schwachen Rechtsgrundlage steht. Jesus Huerta de Soto argumentiert, dass ein Vertrag über die Einlage von Geld bei einer Bank von unterschiedlicher rechtlicher Natur ist als ein Kreditvertrag.16Beim Darlehensvertrag wird die gesamte Verfügbarkeit des geliehenen Geldes für die Dauer des Vertrages übertragen. Bei der Bankeinlage liegt dagegen keine Eigentumsübertragung vor, sondern der Deponent kann über sein Eigentum jederzeit verfügen. Eine Bank, die nur einen Teilbetrag der Einlage verwahrt und den Rest weiter verleiht, macht sich nach Huerta de Soto daher der Untreue schuldig. Im römischen Recht wurde folglich die fraktionale Reservehaltung unter Strafe gestellt. Nach dem Untergang des Römischen Reichs löste sich dieses Rechtsprinzip im Mittelalter auf und die fraktionale Reservehaltung wurde zur Standardtechnik im Bankwesen.
Eucken stellt fest, dass alle vorhandenen Geldordnungen Mischformen der reinen Geldsysteme sind, wobei diese mit unterschiedlichen Gewichtungen einhergehen. Sowohl Waren- als auch staatliches Schuldgeld kann mit Kreditgeld kombiniert werden, wenn Banken durch Kreditvergabe über den durch Waren- oder Schuldgeld gegebenen Deckungsstock hinaus privates Buchgeld schöpfen. Im Laufe der Zeit ist das dritte, auf privater Kreditgewährung beruhende Kreditgeldsystem immer bedeutender geworden, während die beiden ersten Systeme an Bedeutung verloren haben.
Doch scheint Eucken das Kreditgeldsystem inhärent instabil. Eucken sah daher die weitere Entwicklung unserer stark auf dem Kreditgeldsystem beruhenden Geldordnung schon in den 1940er-Jahren recht skeptisch: »Vielleicht wird die außerordentliche Unstabilität des Geldes, die in den Währungen der Jahrhundertmitte herrscht, den Anstoß zu Währungsreformen geben, sodass in der Geldversorgung nicht mehr das dritte Geldsystem dominiert, sondern die Geldversorgung mit der Produktion wichtiger Waren verbunden wird.«17Eucken war ein Anhänger der im Jahr 1937 von Benjamin Graham vorgeschlagenen Warenreservewährung. In diesem System soll die Geldmenge entsprechend der Preisentwicklung wichtiger Rohstoffe gesteuert werden. Zu diesem Zweck hält die Zentralbank ein Rohstofflager. Bei einem Preisanstieg der ausgewählten Rohstoffe verkauft die Zentralbank einen Teil ihres Lagers. Das Rohstoffangebot steigt und die Geldmenge schrumpft. Umgekehrt kauft die Zentralbank Rohstoffe auf, wenn die Preise sinken. Das Rohstoffangebot sinkt und die Geldmenge und Preise steigen.18
Euckens Systematisierung des Geldes hilft, den am Anfang dieses Kapitels vorgestellten Gegensatz der Charakterisierung von Geld als Tauschmittel oder als Maß für Schuld zu entschärfen. Den jeweiligen historischen gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechend kann es das eine oder das andere sein. Der Charakter von Geld ist also wandlungsfähig.
Zum noch besseren Verständnis des Charakters von Geld können wir Euckens Klassifizierung der Geldsysteme einen Schritt weiter vereinfachen und zwischen Geld als »Aktivum« und »Passivum« unterscheiden. Hat Geld den Charakter einer Ware, stellt es in der Bilanz der geldschaffenden Institution einen Aktivposten dar. Eine Goldmine wird das geschürfte Gold in ihrer Bilanz auf der Aktivseite und die für die Produktion aufgewendeten Finanzmittel auf der Passivseite aufführen. Schuld- oder Kreditgeld, auch das wie Eigenkapital auftretende Geld der Zentralbanken, stehen jedoch als Passivposten in der Bilanz der geldschaffenden Institutionen. Sie sind Finanzinstrumente. Dies gilt für Banknoten, die mit Forderungen an den Staat oder an andere Schuldner oder überhaupt nicht gedeckt sind, ebenso wie für das durch die Vergabe von Kredit durch die Banken geschaffene Giralgeld.
Im weiteren Verlauf des Buches werden wir daher Aktivgeld, Aktivgeldsysteme und Aktivgeldordnungen von Passivgeld, Passivgeldsysteme und Passivgeldordnungen unterscheiden (siehe Tabelle 1.1 für eine Übersicht). Aktivgeld entsteht durch gesellschaftliche Konvention als Teil der spontanen Ordnung, die ohne staatliche Macht auskommt. Aktivgeld ist mit dem Vertrauen der Nutzer ausgestattet, dass es von anderen Nutzern als Tauschmittel akzeptiert wird.
Aktivgeldordnung
Passivgeldordnung
Warengeld
Giralgeld
Aus einer Ware durch gesellschaftliche Konvention entstandenes Tauschmittel, das entweder in seiner ursprünglichen Form oder als Verwahrschein für das eigentliche Tauschmittel zirkulieren kann
Von Banken mit staatlicher Lizenz über die Kreditvergabe emittiertes privates Schuldgeld
Aktivgeld
Staatliches Zentralbankgeld
Durch gesellschaftliche Konvention entstandenes virtuelles Tauschmittel
Von einer staatlichen Zentralbank aus dem Nichts geschaffenes gesetzliches Zahlungsmittel, das man sich wie das Eigenkapital einer Unternehmung vorstellen kann
Tabelle 1.1 Übersicht der Geldordnungen und Geldformen
Passivgeld ist dagegen ein Finanzinstrument, das den Charakter eines Schuld- oder Eigenkapitaltitels annehmen kann. Der Staat kann Passivgeld direkt ausgeben, um sich zu finanzieren. In diesem Fall handelt es sich um eine eigenkapitalähnliche Verbindlichkeit wie die Aktie eines Unternehmens, das damit sein Anlagevermögen finanziert. Der Staat kann aber auch privaten Banken überlassen, Passivgeld in Form von Kreditgeld zu schaffen. Dann handelt es sich um privates Schuldgeld. Da aber ein Kreditgeldsystem immer durch staatliche Lizenz für die darin handelnden Banken legitimiert sein muss und eine staatliche Rückversicherung für den Fall von Liquiditäts- und Solvenzkrisen braucht, enthält privates Schuldgeld immer auch die Option auf Wandlung in staatliches Passivgeld. Zur Erhöhung seiner Akzeptanz kann staatliches Passivgeld mit Sicherheiten, zum Beispiel Gold oder Silber, teilweise gedeckt werden. Diese können dem Nutzer direkt in die Hand gegeben werden, wie beim Münzgeld, oder sie können per Gesetz als Deckungsstock für Papiergeld festgelegt werden, wie im Goldstandard. Staatliches Passivgeld kann aber auch nur durch das Versprechen gestützt werden, dass seine Kaufkraft durch den Staat erhalten werden wird, wie im »Fiat«-Geldsystem.19Um ein solches Versprechen glaubhafter zu machen, ohne das Geld mit hinterlegten Sicherheiten zu härten, kann der Staat den Auftrag zur Geldproduktion in die Hand einer Zentralbank legen, der er weitgehende Unabhängigkeit vom politischen Tagesgeschäft gibt.
Wie wir noch sehen werden, ist die Kaufkraft von Passivgeld ständig durch die übermäßige Anhäufung von Schuld bedroht. Deshalb entstehen in einer Passivgeldordnung eher inflationäre als deflationäre Tendenzen. Dies ist bei Aktivgeld anders. Hängt die umlaufende Menge an Aktivgeld an der Verfügbarkeit der als Tauschmittel dienenden Ware, kann es knapp werden und sein Preis steigen. Steigt der Preise des Geldes, dann fallen die in Geld gemessenen Preise der Dinge, die damit getauscht werden. Es kommt zur Deflation. Dieses Problem trieb einen Geldtheoretiker um, der sein Wissen über Geld nicht aus der Wissenschaft, sondern aufgrund seiner praktischen Arbeit erworben hatte.
Schwundgeld
Damit Geld seine Funktion als Tauschmittel erfüllen kann, muss es umlaufen. Wird es dem Wirtschaftskreislauf entzogen, gerät der Tausch ins Stocken, und die Wirtschaft leidet. Dieses Problem beschäftigte Silvio Gesell, einen deutschen Unternehmer und Sozialisten, sein ganzes Leben lang. Gesell wurde 1862 im heutigen Belgien geboren, das damals unter preußischer Herrschaft stand. Nach einer kurzen Zeit bei der Reichspost erlernte er bei seinem Bruder den Beruf des Kaufmanns und wanderte 1887 nach Argentinien aus, wo er medizinische Artikel verkaufte und damit Kliniken und niedergelassene Ärzte belieferte. Das brachte ihm zwar keinen Reichtum, machte ihn aber immerhin wohlhabend.20
Im Jahr 1890 fiel die argentinische Wirtschaft in die Krise. Der Grund war eine weltwirtschaftliche Rezession, die das Land mit sich riss. Wegen der Goldanbindung konnte weder der Wechselkurs abgewertet werden noch war eine monetäre Expansion möglich. Geld wurde knapp und das Land sank in die Deflation, wie es vier Jahrzehnte während der Großen Depression auch in den USA der Fall sein sollte. Gesells Geschäfte gingen schlecht, und er fing an, sich Gedanken über die gesamtwirtschaftlichen Gründe für die Krise der Wirtschaft und seines eigenen Unternehmens zu machen.
Dabei fiel ihm auf, dass alles vergänglich war, seien es seine medizinischen Vorräte oder seine Arbeitskraft – außer dem Gold, das den Geldwert bestimmte. Gold oder Geld konnte man aufbewahren, man bekam sogar Zinsen dafür, wenn man es verleihen konnte. Wo aber alles vergänglich ist außer Geld, das mit der Zeit wegen des Zinses sogar noch mehr wird, neigen die Menschen dazu, Geld zu horten. Gehortetes Geld, das unter der Matratze oder in Tresoren verschwindet, steht weder den Konsumenten für ihre Einkäufe noch den Unternehmen für ihre Investitionen zur Verfügung. Der Mangel an Tauschmitteln verringert die Möglichkeit zum Tausch und führt zur Schrumpfung der Wirtschaftskraft. Gesell sah nicht, dass die durch den Anstieg der Geldnachfrage ausgelöste Deflation die reale Kaufkraft des Geldes erhöht, sodass dadurch die reale Nachfrage stabil bleiben kann.
Für Gesell war daher klar: Das Geld musste seine außergewöhnliche Eigenschaft als einziges nicht vergängliches Wirtschaftsgut verlieren und mit der Zeit genau wie Warenvorräte, Maschinen oder Arbeitskraft an Wert verlieren. Nur dann würden die Menschen aufhören, es zu horten, statt es zum Erwerb von Gütern und Dienstleistungen zu verwenden. Man musste also das Geld »rosten« lassen. Da man Gold nicht künstlich mit dieser Eigenschaft versehen konnte, musste der Staat dafür sorgen, dass Geld mit der Zeit an Kaufkraft verliert. Zum Beispiel indem man staatlich ausgegebene Geldscheine regelmäßig mit kostenpflichtigen Wertmarken zu bekleben hatte, damit sie gültig blieben, oder indem die Scheine automatisch nach einem festgelegten Zeitplan an Wert verloren. Man brauchte also »Schwundgeld«, um die Gleichheit des Geldes mit Anlagen, Kapital oder Arbeitskraft herstellen zu können.
Was aber geschieht mit anderen Sachen, zum Beispiel Grund und Boden, die sich wie Geld nicht mit der Zeit abnutzen und deshalb auch nicht an Wert verlieren? Würden die Leute Boden kaufen und horten, anstatt Geld aufzubewahren? Gesell sah diese Gefahr und schlug vor, Grund und Boden gegen Entschädigung zu verstaatlichen. Die Besitzer könnten den Grund weiterhin nutzen, würden aber dem Staat eine entsprechende Pacht zahlen müssen. Dies erinnert zwar an die Nationalisierung von Grund und Boden in den ehemaligen sozialistischen Ländern, ist aber im Grunde näher bei dem britischen Modell des »Lease-hold«, in dem der Erwerber des Grunds staatlichen Instanzen (einschließlich dem Königshaus) einen Preis dafür zahlt, dass er das Objekt eine lange Zeit privat nutzen kann. Nach Ablauf der Mietzeit fällt das Objekt wieder an die staatliche Instanz zurück. In Deutschland wird diese Art des Immobilienerwerbs im sogenannten Erbbaurecht geregelt.
Neben der Förderung des Geldumlaufs war es Gesells Anliegen, die Bildung von privatem Vermögen und Produktivkapital zu verhindern. Anders als die Kommunisten und Sozialisten seiner Zeit wollte er dieses Ziel über eine besondere Ausgestaltung des Geldes erreichen. Der Markt sollte als Instrument zur Verteilung von natürlichen Ressourcen, Arbeit, Gütern und Dienstleistungen erhalten bleiben, aber die Bildung von Kapital durch die Hortung von Geld sollte unmöglich gemacht werden.
Gesell steht also in der zu Beginn dieses Kapitels vorgestellten Debatte ganz auf der Seite Adam Smiths, für den der Tausch die Grundlage wirtschaftlicher Beziehungen war und Geld das Mittel, den Tausch möglich zu machen. Gesell ging sogar noch einen Schritt weiter und wollte die Funktion des Geldes als Wertaufbewahrungsmittel abschaffen.
Dabei übersah er, dass damit Kreditbeziehungen, die in Geld gemessen werden, absterben. Wenn Geld mit der Zeit an Wert verliert, dann tut dies auch der in Geld gemessene Kredit. Da in Gesells Welt die Zinsen wegfallen, weil sie die Attraktivität des Geldes als Mittel zur Hortung widerspiegeln, wird der Verlust auch nicht über Zinserträge ausgeglichen.21Sparer haben daher keinen Anreiz, ihr Geld zu horten und zu verleihen. Sie stellen sich besser, wenn sie es für den Konsum verwenden. Unternehmer müssen dagegen selbst sparen, um neue Anlagen zu erwerben. Diese Anlagen müssen sehr hohe Erträge abwerfen, um den Verlust in der Ansparphase zu ihrem Erwerb auszugleichen, der durch den Schwund des Geldwerts entsteht.
Fazit
Wie ist nun die in diesem Kapitel gestellte Frage zu beantworten? Was ist Geld für uns heute? Es scheint, ein bisschen von alldem, was die hier vorgestellten Theorien behaupten. Wir zahlen mit Geld, um eine Ware zu kaufen, und verlangen es als Lohn oder Gehalt für unsere Arbeit. Es ist also Tauschmittel. Die Banken schaffen aber auch Geld durch die Vergabe von Krediten. Der Kreditnehmer benutzt dieses Geld, um damit eine Immobilie, eine Maschine oder sonst etwas zu kaufen. Also ist Geld auch ein Maß für Kredite, die von den Banken vergeben werden. Wer ein Gut gegen Geld an jemanden abgibt, der dieses Geld als Kredit von der Bank erhalten hat, geht auf indirekte Weise mit der Bank eine Kreditbeziehung ein, die das Geld geschaffen hat. Daraus folgt auch, dass das Geld seinen Wert verlieren kann, wenn der Schuldner den Kredit nicht zurückzahlt.
In den zwei Jahrzehnten bis zum Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 sind Kredite und das damit geschaffene Geld weltweit weit mehr gewachsen als die mit dem Bruttoinlandsprodukt gemessene Wirtschaftsaktivität. Dies deutet darauf hin, dass während dieser Zeit der Charakter des Geldes als Maß für Kreditbeziehungen immer wichtiger geworden ist. Denn hätten wir Geld nur als Tauschmittel benutzt, dann hätte sich unser Geldbedarf enger an der Entwicklung der Wirtschaftsaktivität orientiert, die globale Geldmenge wäre also nicht viel mehr als das globale nominale Bruttoinlandsprodukt gewachsen.
Eben diese Ausweitung der Kreditbeziehungen hat David Graeber motiviert, auf den Charakter des Geldes als Maß für Schuld und auf die historische Praxis des Schuldenerlasses zu verweisen. Wo übermäßig viel Kredit und Schuld aufgebaut wurde, sollte es auch Wege geben, diese Beziehungen auf ein langfristig erträgliches Maß zu reduzieren, könnte man meinen. Von daher wäre es weniger wichtig, den Wert des Geldes zu verringern, um seine Zirkulation zu erhöhen und dadurch den Tausch zu fördern, wie Silvio Gesell meinte, als vielmehr um eine übermäßige Schuld abzutragen.
Obwohl nur wenige der heute tätigen Ökonomen die Thesen von Gesell kennen, haben wir seine Idee des Schwundgelds längst verwirklicht. Dies mag zum Teil daran liegen, dass John Maynard Keynes Gesells Theorie sehr wohl kannte und sich davon beeinflussen ließ. So wirkt Gesell durch Keynes bis heute. Da der Wert unseres Geldes nicht mehr von der Menge des verfügbaren Goldes, sondern, wie wir noch sehen werden, von der durch die Zentralbank gesteuerten Geldproduktion der Banken abhängt, verliert es ständig an Kaufkraft. Wer bei der Währungsreform 1948 von seinem Kopfgeld in Höhe von 40 Mark, 10 Mark aufbewahrt hat, hatte bei der Umstellung der D-Mark auf den Euro noch Geld mit einer Kaufkraft von 2,60 Mark in der Hand. Wer dann die für die 2,60 Mark eingetauschten 1,30 Euro in den Schrank gelegt hat, kann sich im Jahr 2014 damit nur noch Waren im ursprünglichen Wert von rund 1,00 Euro kaufen.
Obwohl wir in der Bundesrepublik keine Währungsreform mit ausdrücklicher Entwertung des Geldes hatten und obwohl sowohl die Bundesbank als auch die ihr nachfolgende Europäische Zentralbank nicht müde werden zu betonen, dass sie die Kaufkraft des Geldes stabil halten, hat sich die Kaufkraft unseres Gelds über die letzten sechs Jahrzehnte um sage und schreibe 80 Prozent verringert. Silvio Gesell wäre mit einem solchen Geldsystem am Ziel seiner Wünsche gewesen. Er lebte aber in einer Aktivgeldordnung, die keinen natürlichen Hang zur Geldentwertung hatte. Dagegen leben wir heute in einer Passivgeldordnung, der die Tendenz zur Überschuldung und Geldentwertung innewohnt.
Kapitel 2: Wie entsteht Geld?
Im vorangegangenen Kapitel haben wir zwei verschiedene Konzeptionen von Geld kennengelernt: Geld als Aktivum, wie es zum Beispiel eine zu Geld gewordene Ware verkörpert, und Geld als Passivum, wie es durch die Ausgabe staatlicher oder privater Schuldscheine entsteht. In diesem Kapitel werden wir sehen, dass Waren- oder Aktivgeld durch fraktionale Reservehaltung der Banken zu privatem Passivgeld transformiert werden kann.