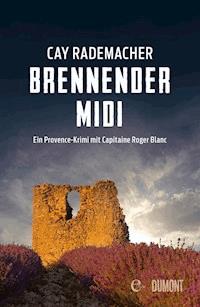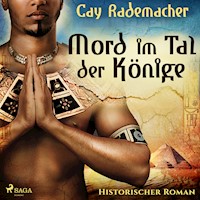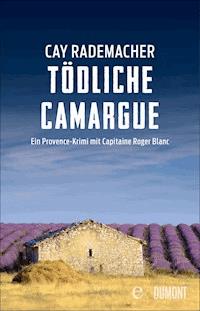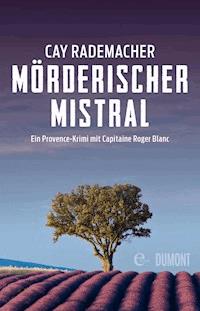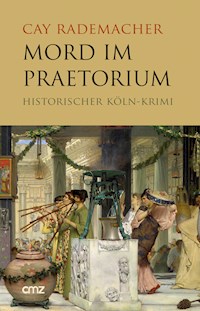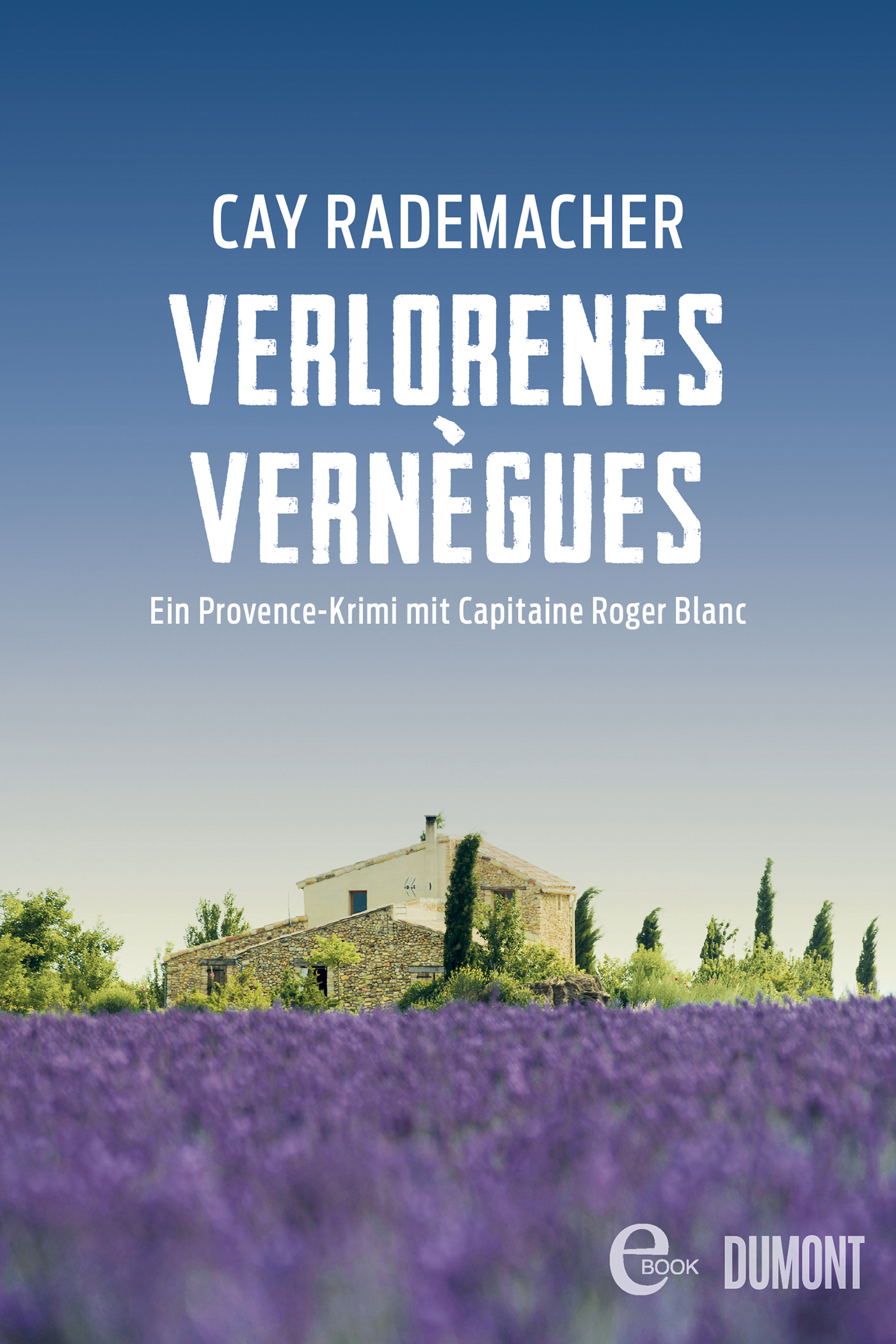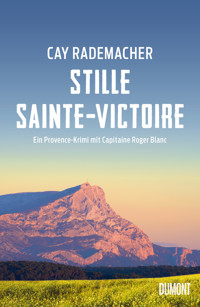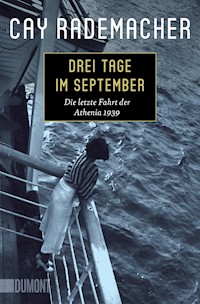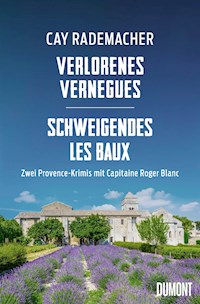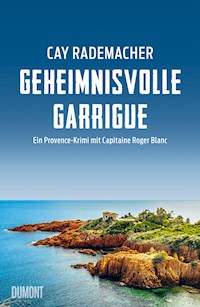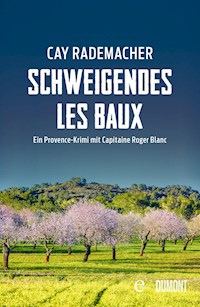Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Spätsommer 1929, der letzte Sommer der Goldenen Zwanziger. Niemand erkennt die Vorzeichen der Weltwirtschaftskrise. Noch bestimmen Luxus und Frivolität, Jazz und Kokain den Rhythmus des Lebens – auch auf dem Ozeanliner Champollion, der von Marseille aus Richtung Orient in See sticht. Zu den illustren Passagieren gehören eine skandalumwitterte Nackttänzerin aus Berlin und ein mysteriöser römischer Anwalt, eine adelige englische Lady, ein Schläger aus der Unterwelt – und Theodor Jung, Kriegsveteran und Fotoreporter der Berliner Illustrirten. Er soll eine Reportage über die Reise machen. Seine Frau Dora begleitet ihn. Sie entstammt der Hamburger Kaufmannsfamilie Rosterg, die nach Maskat reist, um mit den sagenhaften Gewürzen Arabiens zu handeln. Theodor hofft, dass die abenteuerliche Passage die Leidenschaft in ihrer Ehe neu entfacht. Doch Doras Familie verachtet ihn, und Bertold Lüttgen, der intrigante Prokurist der Firma, hat selbst ein Auge auf die Tochter seines Chefs geworfen. Als Dora nach wenigen Tagen spurlos verschwindet, wird die Reise für Theodor zum Albtraum – denn nicht nur die Rostergs, auch die anderen Passagiere und Besatzungsmitglieder behaupten, Dora nie an Bord gesehen zu haben. »Die Dialoge funkeln wie die Kristallgläser auf den Tischen der ersten Klasse. Deswegen und dank Cay Rademachers Talent, die Zwanzigerjahre, das Meer und die Atmosphäre auf dem Ozeanliner ›Champollion‹ sinnlich erfahrbar zu machen, ist man so richtig dabei auf der ›Passage nach Maskat‹.« WELT AM SONNTAG
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Spätsommer 1929, der letzte Sommer der Goldenen Zwanziger. Niemand erkennt die Vorzeichen der Weltwirtschaftskrise. Noch bestimmen Luxus und Frivolität, Jazz und Kokain den Rhythmus des Lebens – auch auf dem Ozeanliner Champollion, der von Marseille aus Richtung Orient in See sticht: Port Said, der Suezkanal, Jemen, Oman … Zu den illustren Passagieren gehören eine skandalumwitterte Nackttänzerin aus Berlin und ein mysteriöser römischer Anwalt, eine adelige englische Lady und ein nur scheinbar naiver amerikanischer Ingenieur, ein Schläger aus der Unterwelt – und Theodor Jung, traumatisierter Kriegsveteran und Fotoreporter der Berliner Illustrirten, der größten Zeitschrift Europas. Er soll eine Reportage über die Reise machen. Seine Frau Dora begleitet ihn. Sie entstammt der Hamburger Kaufmannsfamilie Rosterg, die ebenfalls nach Maskat reist, um mit den sagenhaften Gewürzen Arabiens zu handeln. Theodor hofft, dass die abenteuerliche Passage die Leidenschaft in ihrer Ehe neu entfacht. Doch Doras herrische Eltern und ihr gewalttätiger Bruder verachten ihn, und Bertold Lüttgen, der intrigante Prokurist der Firma, hat selbst ein Auge auf die Tochter seines Chefs geworfen. Als Dora nach wenigen Tagen auf der Champollion spurlos verschwindet, wird die Reise für Theodor zum Albtraum – denn nicht nur die Familie Rosterg, auch die anderen Passagiere und Besatzungsmitglieder behaupten, Dora nie an Bord gesehen zu haben …
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Seine Provence-Serie umfasst neun Fälle, zuletzt erschien ›Geheimnisvolle Garrigue‹ (2022). Bei DuMont veröffentlichte er auch seine Romane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013).
Außerdem erschienen die Kriminalromane ›Ein letzter Sommer in Méjean‹ (2019) und ›Stille Nacht in der Provence‹ (2020). Cay Rademacher lebt mit seiner Familie bei Salon-de-Provence in Frankreich.
Cay Rademacher
DIE PASSAGE NACH MASKAT
Kriminalroman
Von Cay Rademacher sind bei DuMont außerdem erschienen:
Der Trümmermörder
Der Schieber
Der Fälscher
Mörderischer Mistral
Tödliche Camargue
Brennender Midi
Gefährliche Côte Bleue
Dunkles Arles
Verhängnisvolles Calès
Verlorenes Vernègues
Schweigendes Les Baux
Geheimnisvolle Garrigue
Ein letzter Sommer in Méjean
Stille Nacht in der Provence
E-Book 2022
© 2022 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: The Folio Society edition of Agatha Christie’s Death on Nile © Andrew Davidson 2014 / www.foliosociety.com
Karte im Vorsatz: © Rüdiger Trebels
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-8259-5
www.dumont-buchverlag.de
Für Françoise, Leo, Julie, Anouk, die auf der Passage nach Maskat dabei waren – und noch auf manchen anderen Reisen.
You can start this very evening if you choose,
And take the Western Ocean in the stride
Of seventy thousand horses and some screws!
MARSEILLE
Theodor Jung stand auf dem Promenadendeck der Champollion und strich gedankenverloren mit dem Zeigefinger über die lange Narbe auf der Innenseite seines linken Handgelenks. Der Schatten eines Schornsteins lag über ihm. Der Mann, der sich neben ihm gegen die Reling lehnte, stand bereits im Sonnenlicht. Sein Monokel reflektierte die Strahlen so stark, dass Jung ihm kaum ins Gesicht sehen konnte. Der Mann deutete mit seiner Zigarette auf die Narbe und sagte kühl: »Wenn Sie das noch mal versuchen, dann hätten wir beide ein Problem weniger.«
Jung schwieg und zog den Ärmel seines hellen Leinenjacketts über das Handgelenk.
»Sie sind erledigt, wenn Sie an Bord bleiben«, fuhr der Monokelträger fort und inhalierte den Rauch der Zigarette. Er hielt ihn außergewöhnlich lange in der Lunge, bis der bläuliche Qualm endlich aus seiner schmalen aristokratischen Nase entwich.
Wie ein Dämon, der aus ihm fährt, dachte Jung, wie ein Dschinn aus einem orientalischen Märchen. Er würdigte ihn noch immer keiner Antwort; welche sollte das auch sein? Denn er war erledigt, und er hatte Angst. Aber nicht vor diesem Mann – sondern vor dem Schiff. Wenn ich sterbe, werde ich auf dem Meer sterben.
Dabei war die Champollion ein eleganter Dampfer der Messageries Maritimes, 1925 gebaut, erst vier Jahre alt. Der Rumpf war mehr als hundertfünfzig Meter lang, schlank und schwarz, der Bug scharf wie eine Messerklinge. Die Aufbauten leuchteten weiß in der Mittagssonne. Auf dem Promenadendeck waren Rettungsboote in ihren Davits verzurrt, das nächste war nur ein paar Schritte von ihm entfernt. Drei schwarze Schornsteine ragten über ihn in den azurblauen Himmel. Aus den beiden vorderen kräuselten sich dünne, bitter nach Kohle riechende Rauchspiralen in die warme Luft, aus dem dritten, in dessen Schatten er stand, qualmte nichts – er war eine Attrappe, um das Schiff noch imposanter erscheinen zu lassen. Wie alles an Bord Illusion und Hybris war, dachte Jung: dieser unzerstörbare Stahlrumpf. Diese soliden Rettungsboote. Diese weite Kommandobrücke. Alles falsche Sicherheiten. Jung wusste, wie gnadenlos das Meer sein konnte. Wie Spanten unter dem Aufprall von Brechern stöhnten. Wie salzig die Luft schmeckte, wenn der Sturm den Schaum von den Kämmen blies. Und wie leer der Ozean war, wie unglaublich leer. Er war schon viele Seemeilen gefahren, nicht nur auf den Wellen, sondern sogar tief unter ihnen … Er wusste, wie kalt es dort unten war.
»Wir legen in ein paar Stunden ab. Noch ist Zeit. Überlegen Sie es sich noch einmal«, fuhr der Mann neben ihm fort, das linke Auge glitzerte dunkel durch den Qualm seiner Zigarette, vielleicht vor Gier oder Spott. Oder Mordlust. Das rechte Auge blieb hinter dem Monokel verborgen. Er sah aus wie ein Automatenmensch aus einem Film von Fritz Lang, schnippte die Kippe achtlos über Bord, zog ein silbernes Etui aus der Jackettasche und steckte sich eine neue Zigarette an. Er machte sich nicht die Mühe, Jung eine anzubieten.
»Sie promenieren die Gangway hinunter und nehmen ein Taxi«, schlug er vor. »Heute Abend geht noch ein Schnellzug vom Gare Saint Charles nach Paris, morgen könnten Sie schon wieder in Berlin sein. Sie lassen sich von Dora scheiden, Sie verzichten auf Ihre Anteile an der Firma. Dann sind Sie ein freier Mann. Wenn Sie jedoch an Bord bleiben, werden Sie es bereuen.«
Jung musterte ihn. Berthold Lüttgen war achtundzwanzig, nur zwei Jahre jünger als er, aber irgendwo in diesen zwei Jahren verlief die Grenze zwischen alten Menschen und neuen Menschen. Jung war noch im Krieg gewesen, Lüttgen nicht. Die alten Menschen schreckten nachts aus ihren Träumen auf. Die neuen Menschen schliefen traumlos. Lüttgen war schlank, und die Eleganz seiner Kleidung ließ ihn größer wirken, als er in Wirklichkeit war: weißer Sommeranzug, weißer Borsalino, weiße Sommerhandschuhe, auf die Kappen seiner braun-weißen ledernen Sommerschuhe war das Monogramm »BL« gestickt.
»Ich bleibe an Bord. Und ich werde mich nicht von Dora scheiden lassen«, erklärte Jung schließlich ruhig, obwohl er diesen Kerl am liebsten am Kragen gepackt und über die Reling zehn Meter hinunter auf den Pier geschleudert hätte.
Lüttgen deutete auf die Leica, die an einem Lederriemen von Jungs Schulter baumelte. »Fotografie ist doch bloß Schneegestöber. Mit den Bildern, die Sie für dieses Revolverblatt knipsen, werden Sie niemals gutes Geld verdienen. Deshalb klammern Sie sich an diese Ehe. Sie lieben nicht Ihre Gattin, sondern deren Vermögen. Dabei müssen Sie sich nur einen Ruck geben, Mann! Heutzutage liegt doch das Geld auf der Straße. Packen Sie Ihre Siebensachen, solange noch Zeit dafür ist, das ist Ihre Chance auf ein neues Leben. Gehen Sie nach Babelsberg zum Film, wenn Sie unbedingt durch eine Linse gucken wollen. Oder machen Sie Reklame. Oder suchen Sie Ihr Glück an der Börse. Mit Aktien kann man heute gar nicht mehr verlieren.«
»Ich habe Dora geheiratet, weil ich sie liebe – und nicht, weil ihr ein Teil der Firma gehört, die Sie nur zu gerne übernehmen wollen«, erwiderte Jung kalt. Er spürte aber, dass er sich nicht mehr lange würde beherrschen können. Vielleicht war das Lüttgens Ziel? Ihn so zu provozieren, dass er sich noch im Hafen zu einer Schlägerei hinreißen ließ? Damit ihn die Gendarmen festnahmen und er in einem französischen Gefängnis schmorte? Während Lüttgen auf der Champollion in See stach, zusammen mit Dora … »Ich werde bis Maskat an Bord bleiben«, wiederholte er entschlossen, »und Ihre Pläne durchkreuzen.«
Lüttgen warf die erst halb gerauchte Zigarette mit einer heftigen Bewegung über die Reling. »Zwei Wochen können sehr lang sein«, sagte er leise und ging grußlos fort.
Jung blickte über den Hafen. Die Champollion hatte am Môle de la Pinède festgemacht. Die Häuser von Marseille türmten sich dahinter wie Klippen auf: ockergelb, grau oder blassrot verputzt, rußig vom Kohlenqualm unzähliger Dampfer. Auf dem Asphalt des Kais standen Ballen und Kisten vor den weit geöffneten Toren der Lagerhallen. Arbeiter dirigierten mit heiseren Kommandos den Kranführer des Schiffes, der einen bordeauxfarbenen Hispano-Suiza H6 vorsichtig anhob, in einem eleganten Bogen durch die Luft schwenkte und schließlich langsam in den hinteren Frachtraum absenkte. Jung fragte sich flüchtig, für wen und wo diese Limousine wohl wieder ausgeladen werden würde. Für einen Potentaten am Hof zu Kairo oder für einen der Direktoren der Suezkanal-Gesellschaft in Port Said? Für einen Scheich in Aden oder für den Sultan in Maskat? Oder würde der Wagen den langen Weg bis Indochina zurücklegen, um zukünftig vom Prinzen von Siam durch die Straßen Saigons gesteuert zu werden? Die Arbeiter riefen und gestikulierten selbst dann noch, als der Hispano-Suiza längst unter den Stahlplatten der Champollion verschwunden war. In Marseille schienen alle Leute ständig mit Ausrufezeichen zu sprechen. Jung betrachtete die Docker und versuchte zu erraten, woher sie wohl kamen: Italiener, Kabylen, Kambodschaner, Armenier, Senegalesen.
Die aus schwarzen und weißen Steinen gemauerte Kathedrale La Major glänzte im Mittagslicht, eine Festung Gottes in Schachbrettfarben vor dem verruchten Hafenviertel Panier. Panier, das waren verkommene alte Häuser, drei, vier, fünf Stockwerke hoch, dazwischen Gassen wie Risse im Erdboden, geschmückt mit den zahllosen bunten Fahnen der Wäsche, die an kreuz und quer gespannten Leinen in der Glut dörrte. Zur Rechten blickte Jung bis auf das Fort Saint-Jean, eine von der Zeit zernagte Festung. Dahinter der Vieux Port, in dem schon die alten Griechen geankert hatten. Quer über den Alten Hafen spannte sich die Schwebebrücke, ein stählernes Ungetüm, zwei Eiffeltürme, zwischen die Ingenieure eine Art Himmelsbrücke gebaut hatten: eine eckige Gondel, die an einem Turm in die Höhe fuhr wie ein Aufzug, dann unter einem Stahlrahmen wie eine Schwebebahn in etlichen Metern Höhe das Wasser querte, um am anderen Turm wieder in die Tiefe zu sinken. Genialität und Größenwahn. Sie hätten ja auch einfach eine Fähre einsetzen können, um Menschen und Fracht von einer Seite des Hafens zur anderen zu bringen, doch das hätte nicht zu Marseille gepasst.
Jung nahm seine Leica, schraubte das 3,5-Zentimeter-Objektiv ab, steckte es in seine Jacketttasche und holte von dort das 9-Zentimeter-Elmar hervor. Mit dem Teleobjektiv schoss er in dem Moment ein Foto, als die Gondel mitten über dem Vieux Port schwebte, während eine wettergegerbte Dreimastbark in den Hafen glitt: Das zwanzigste Jahrhundert schwebte über dem neunzehnten, das Versprechen der Zukunft über dem Veteranen der Vergangenheit – genau solche symbolträchtigen Bilder liebte sein Schriftleiter Kurt Korff.
Korff hatte »TJ« zum Markenzeichen gemacht – Jung war einer der wenigen Lichtbildner der Berliner Illustrirten, unter dessen Fotos der Chef Initialen druckte, in winziger Schrift, aber immerhin: Wer die Hauptstadtpresse kannte, der kannte Jung.
Dabei hatte Jung eigentlich nichts, das ihn zum Darling der Berliner Salons machte. Seit er aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, schnitt er seine hellblonden Haare so kurz, dass die Kopfhaut hindurchschimmerte. Er war hager, seine blauen Augen hinter der runden Nickelbrille schienen seit dem Krieg zu groß für sein Gesicht zu sein. Durch Zufall war er an eine Leica und an die erste Reportage für die Berliner Illustrirte gekommen, 1,8Millionen verkaufte Hefte jede Woche, Hektik, Ruhm, Reisen in die Welt – es war wie eine Droge, die ihn davon abhielt, noch einmal das Rasiermesser an den Unterarm zu legen. Er war für seine Redaktion in den Alpen geklettert, hatte den Testflug einer neuen Junkers mitgemacht, war mit dem Fallschirm abgesprungen und mit Dr.Hugo Eckeners Zeppelin über dem Bodensee geschwebt. Er hatte heimlich im Gericht von Moabit fotografiert, obwohl das streng verboten war, und dabei Frauenschänder, Fememörder und falsche Adelige abgelichtet. Er war in Rapallo und Locarno und bei all den anderen Konferenzen gewesen, auf denen müde Staatsmänner Europas Zukunft verhandelten. Gustav Stresemann hatte Jung neulich sogar einmal auf die Schulter geklopft und ihn begrüßt wie einen alten Bekannten, und hätte Jung da geahnt, dass der Außenminister ein paar Wochen später sterben würde, er hätte mit mehr als einer Floskel geantwortet. Korff zahlte Jung für jede Fotostrecke neunzig Reichsmark, das Dreifache dessen, was ein Arbeiter bei Borsig nach Hause brachte – aber nur die Hälfte dessen, was ein Paar monogrammbestickter Sommerschuhe kostete. Lüttgen gab einen Dreck auf winzige Initialen unter einem Foto. Und auch für Doras Familie würde Jung immer der »Fotoprolet« bleiben, Spitzwegs armer Poet als Nachkriegsversion.
Für die Familie … Jung umklammerte die Reling so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. Hugo Rosterg, der Patriarch. Marthe Rosterg, die Gattin. Ernst Rosterg, der Junior. Und Dora Jung, geborene Rosterg. H. Rostergs Spezereien & Cie., Import von Gewürzen aller Art, Kontorhaus in der Speicherstadt, eine Kogge mit einem »R« auf den geblähten Segeln als Wappenzeichen.
Der Senior wollte bis nach Oman reisen, wollte sich im Sultanat vielleicht Muscatnüsse sichern oder Weihrauchharz oder Nelken oder Pfeffer oder Kaffee, egal – wenn er es nur ja ballen-, kisten-, säckeweise kaufen konnte. Halb Europa hatte sich zerfleischt, war noch gar nicht so lange her, doch jetzt fraß die überlebende Hälfte den Erdball leer und machte Männer wie Hugo Rosterg dabei reich. Der Patriarch nahm Gattin, Sohn und Tochter auf die lange Reise nach Arabien mit, und selbstverständlich seinen unentbehrlichen Prokuristen Lüttgen. Für Jung allerdings war kein Platz an Bord vorgesehen gewesen.
Doch Jung wollte Dora nicht allein in die Ferne ziehen lassen, weil er spürte, dass er sie für immer verlieren würde; um ihre Ehe stand es schon lange schlecht. Also hatte er Schriftleiter Korff überzeugt, es war gar nicht schwer gewesen: eine Reise nach Arabien, die Mysterien des Orients, der Suezkanal, das Tal der Könige, wo Howard Carter noch immer Tutanchamuns Schätze barg. Und Maskat – der duftende Suk, in dem die Gewürze der Welt gehandelt wurden. Es war das Jahr 1929, verdammt, der Krieg war bereits halb vergessen, an der Börse regnete es Geld, der Jazz regierte die Welt, und die Berliner Illustrirte brachte die besten Fotoreportagen, also hatte Jung den Auftrag bekommen.
So stand er nun als Reporter auf der Champollion, und Lüttgen hatte keine Möglichkeit, das zu verhindern. Die Sache hatte bloß einen Haken: Jung litt Todesängste auf jedem Schiff. Eine Fahrt im Zeppelin, ein Fallschirmsprung über Tempelhof oder eine Saalschlacht zwischen Rotfront und Hakenkreuzlern, das machte ihm nicht viel aus. Er fotografierte alles, als sei er unverwundbar. Denn seit dem Weltkrieg wusste Jung: Wenn ich sterbe, werde ich auf dem Meer sterben.
Um die Last zu mildern, die sich auf seine Seele legte, schoss er Fotos, legte schon die nächste Filmrolle ein. Ein gutes Bild, das war die Harmonie von Gehirn, Augen und Händen, das forderte den ganzen Geist, da blieb kein Platz mehr für Ängste und Erinnerungen. Inzwischen war der Schornsteinschatten unter der Sonne verdampft. Es war der 14.Oktober, aber Marseille fühlte sich an wie August. Wo kam bloß diese Hitze her? Keine Böe, obwohl er bei früheren Reisen nach Marseille den Mistral erlebt hatte, der gnadenlos eisig die Canebière hinunterfegte und Blätter, Staub, Zeitungen und Papiertüten weit hinaus aufs Meer blies. Jetzt stank die Stadt nach fauligem Fisch und überreifem Gemüse und nach den Kloaken von Panier, wo sie noch nicht einmal fließendes Wasser und Kanalisation hatten. Die Glocken von Notre-Dame-de-la-Garde schlugen die Stunde, ihr Klang verlor sich über den Dächern, als sei selbst der Lärm in dieser Hitze erschöpft.
Jung ging langsam über das Promenadendeck nach vorn, wo die Kommandobrücke wenigstens noch einen schmalen Streifen Schatten spendete. Er blickte auf das Vordeck hinunter. Die Luken zu den Frachträumen standen offen, der Kran schwenkte pausenlos hin und her, Docker und Matrosen liefen in einer Ordnung, die er nicht durchschaute, mal hierhin, mal dorthin, und überboten sich mit Gesten und Geschrei. Jung sprach ganz passabel Französisch, doch die Hälfte der Wörter, mit denen sich die Männer bedachten, hatte er noch nie gehört, sie standen vermutlich nicht einmal im Wörterbuch, und wahrscheinlich waren es keine Komplimente.
Auf der Jagd nach dem nächsten Motiv hob er die Leica vor die Augen – und hatte plötzlich Dora im Sucher. Sie stand auf dem Vordeck, warum war sie dorthin gegangen? Sie hatte sich doch in der Kabine erholen wollen, eine Siesta, bis die schlimmste Hitze aufs Meer geweht war. Seine Frau war so alt wie er, sie hatte schwarze Locken, ihre Augen waren dunkel wie Kohlen. Dora führte seit Jahren einen stummen Kampf mit Diäten und Wundermitteln gegen ihre Üppigkeit und wollte nicht auf Jung hören, der ihr immer wieder sagte, dass er sie genau so begehrte, wie sie war. Sie waren sich als Unterprimaner in Hamburg begegnet, während jener gar nicht so fernen und doch hoffnungslos untergegangenen Epoche, als noch ein Kaiser über Deutschland geherrscht hatte. Sie wäre beinahe über seine Füße gestolpert, er war so linkisch.
Ein später Nachmittag, der erste warme Tag des Frühlings, das Licht war wie Honig, die Luft duftete nach Flieder, er kam allein vom Gymnasium, sie hatte sich mit zwei Freundinnen von der Höheren Mädchenschule untergehakt und ihn angelächelt, und in der folgenden Nacht und noch in vielen weiteren Nächten konnte er gar nicht schlafen, oder wenn doch, dann träumte er von diesem Lächeln. Jetzt sah er nicht ihr Gesicht durch den Sucher, sondern den Hinterkopf, sie stand am Bug und hatte ihm den Rücken zugekehrt. Dora hatte vor einiger Zeit ihre Locken glätten und zum Bubikopf schneiden lassen. Sie trug einen Glockenhut und ein modisches Pailettenkleid, es funkelte in der Sonne, als sei sie in Diamanten gehüllt. Sie war die perfekte Reisende, eine elegante Frau an der Reling, dahinter Marseille, Sinnbild für Aufbruch, Abenteuer, Fernweh. Jung drückte auf den Auslöser; der Verschluss der Leica war so leise, dass die Möwe, die sich dicht über ihm auf einem Stahlträger der Kommandobrücke niedergelassen hatte, nicht einmal den Kopf in seine Richtung drehte.
Ein eleganter Mann schlenderte nun über das Vordeck, ein Mann mit pomadisierten Haaren und Monokel. Lüttgen begrüßte Dora mit Verbeugung und angedeutetem Handkuss – der Prokurist und die Tochter des Patriarchen, sie gäben ein gutes Paar ab, dachte Jung bitter. Worüber sich die beiden wohl unterhielten? Dora warf den Kopf in den Nacken und lachte laut auf, sie sah wunderschön aus. Jung ließ die Leica sinken, er würde dieses Tête-à-tête nicht auch noch im Bild verewigen.
Vor zwei Tagen hatten sie dem Hausmeister den Schlüssel gegeben, damit er in ihrer Abwesenheit die Zimmerpflanzen goss. Berlin-Westend, Hölderlinstraße 11, 287Reichsmark Jahresmiete, vier Zimmer, hell, reichlich Platz, auch für Kinder, aber Kinder wollten sich einfach nicht einstellen. Sie hatten ein Taxi zum Bahnhof Zoo genommen, der Chauffeur war Exil-Russe, ob allerdings ein Weißer oder Anarchist oder Trotzkist, das wurde Jung während der ganzen langen Fahrt nicht klar. Sie hatten einen riesigen Umweg bis zum Wertheim am Leipziger Platz genommen, wo Dora unbedingt noch ihr neues Paillettenkleid abholen musste. Sie waren hupend durch die Großbaustelle am Alex gerast, vorbei an einer Litfaßsäule, auf der für den neuesten Film von Charlie Chaplin geworben wurde, daneben ein Reklameplakat für Tempo-Taschentücher. Tempo, Tempo, Tempo. Die Hochbahn ratterte über ihren Köpfen, ein brummender Doppeldecker zerteilte den Himmel mit einem Banner, das wie eine monströse Flagge dicht unter den Wolken flatterte. Das Taxi schwankte so stark in den Kurven, dass Jung nicht einmal lesen konnte, für was der Flieger warb, vielleicht für eine Seife oder eine Revue im Friedrichstadtpalast oder für die Hitlerpartei. Auf dem Potsdamer Platz tanzten Autos, Lastwagen und Droschken einen wilden Reigen zum Licht der Verkehrsampel. Über die Friedrichstraße zogen die Kokain-Schieber ruhelos hin und her, »Zsssigaretten, Zsssigaretten«. Mitten zwischen den Kokainisten stand ein Leierkastenmann, ehemaliger Landsturm mit Bauchschuss, wie ein Pappschild auf seinem Instrument kundtat, Melodienfetzen, »Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren«. Neben einem Pfeiler der Hochbahn warteten Frauen und Männer vor einer Suppenküche der Heilsarmee. Und als sie am Bahnhof angekommen waren und den Chauffeur bezahlten, kreuzten Holzsammler das Trottoir, Mann, Frau, Kind, die zersplitterte Obstkisten und Reste von Bauholz aus dem Rinnstein klaubten und in ihre Rucksäcke stopften. Jung hätte das alles fotografieren mögen, wenn er Zeit gehabt hätte, aber der Schnellzug nach Paris stand schon am Gleis. Tempo, Tempo, Tempo.
Sie hatten zwei Plätze in einem Erste-Klasse-Coupé reserviert, eine Rosterg würde niemals Zweiter Klasse fahren. Das Coupé war außen rußschwarz, aber innen ruhig und sauber, und die Polster waren so weich wie Hotelbetten. Der Schaffner lochte ihre Billetts, Stunden später kontrollierten Zollbeamte Pässe und Visa, zuerst auf deutscher Seite, dann auf französischer. Dazwischen betrat niemand ihr Coupé, es wurde eine sehr lange, sehr stille Reise. Paris, die Lichterstadt. Doch für sie war es nur eine Taxifahrt vom Gare du Nord zum Gare du Lyon, ein anderes Coupé, andere Billetts, und wieder langes Schweigen.
Sie waren gestern Nachmittag in Marseille angekommen. Jung hatte auf eine leicht absurde Art Lokalpatriotismus empfunden, obwohl er doch bloß ein paar Mal in dieser Stadt gewesen war und stets nur für wenige Tage. Eine Fotoreportage hatte er vor zwei Jahren für die Berliner Illustrirte gemacht, Korff fand die Bilder gelungen, doch die Überschrift, die Jung sich ausgedacht hatte, viel zu seriös. Der Schriftleiter hatte einen anderen Titel darüber gesetzt: »Das Chicago des Mittelmeers«. Stolz hatte Jung seiner Dora an diesem Nachmittag die Schönheit dieser Stadt vorführen wollen, nicht die Gassen der Schieber und käuflichen Mädchen; er hatte ein Taxi gerufen, den Chauffeur zum Vieux Port fahren lassen.
Benzinpfützen glänzten auf dem Asphalt. Am Straßenrand standen zwei Männer in Hemdsärmeln und wuschen einen Ford-Wagen, oder sie reparierten ihn, die Motorhaube war jedenfalls angehoben. Kriegsversehrte querten die Straßen, Einbeinige, Einarmige, Einäugige. Aus einem großen Gebäude strömten junge, übermütige Frauen, die Stenotypistinnen oder Telefonistinnen waren und um die Kriegsversehrten herumtanzten, als wären sie Gespenster. Das Taxi war auf die Canebière eingebogen: Kopfsteinpflaster, Tramwayschienen, Trottoirs, sechsstöckige Häuser mit Säulen, Stuck, schmiedeeisernen Balkongittern, mannshohen Fenstern – ein Boulevard wie in Berlin, nur dass in Berlin kein Boulevard bis zum Mittelmeer führte. Eine Prachtstraße zum Großen Blau. Cremeweiße Straßenbahnen ruckelten über die Schienen, hinter einem Wagen trat ein syrischer Straßenhändler auf den Boulevard, ein Junge von höchstens fünfzehn Jahren, sein Kopf unter einem schwarzen Fez halb verborgen, ein viel zu großer Bauchladen mit gerösteten Mandeln vor seinem Leib. Das Taxi hätte ihn beinahe erfasst, der Fahrer fluchte. Sie rollten an der Börse vorbei. Jung stellte seine Armbanduhr nach der Uhr in der prunkvollen Fassade des Gebäudes, wie es jedermann in Marseille tat. Die Börse gab die Zeit vor, und das konnte man in dieser Hafenstadt in mehr als einem Sinne wörtlich nehmen. Jung ließ den Chauffeur vor einem Café im orientalischen Stil anhalten, der alte Rosterg hatte wie immer den richtigen Riecher, der Orient war Mode in ganz Europa, der Patriarch würde in Maskat ein Vermögen machen. Sie promenierten die letzten Meter bis zum Quai de la Canebière, wo der Boulevard sich zum Vieux Port hin öffnete. Fischhändlerinnen und Muschelverkäufer hatten längs der Molen Stände aufgebaut, andere verkauften direkt von Bord der angeleinten Fischerboote aus. Ein junger Mann kreuzte ihren Weg, grauer Borsalino, sein schwarz und dunkelgrau gestreifter Anzug und das malvenfarbene Hemd maßgeschneidert, nur die gezackte Narbe auf seiner rechten Wange wollte nicht zur Eleganz passen. Chicago des Mittelmeers, dachte Jung und wollte lieber nicht wissen, womit dieser Monsieur sein Geld verdiente. Dora bemerkte ihn nicht. Sie hatte sich bei Jung untergehakt, etwas, was sie schon sehr lange nicht mehr getan hatte. Sie spazierten am Kai entlang, es stank nach Fisch, doch das Licht war golden. Hoch über ihnen stand Notre-Dame-de-la-Garde, die leuchtende Jungfrau schwebte im Himmel, la Bonne Mère, die Gute Mutter, die über Marseille und seine Seeleute wachte und, warum nicht?, vielleicht auch über zwei Reisende aus Deutschland. Doch als Jung darüber einen Scherz machte, drehte sich eine vor ihnen flanierende Frau um, Bourgeoisie, streng gekleidet, schon älter. »Boche«, zischte sie, starrte sie an, spuckte dann sogar auf das Straßenpflaster, bevor sie sich abrupt umdrehte.
Dora schüttelte sich, das Schimpfwort hatte sie wie eine Ohrfeige getroffen, plötzlich war ihr bei dreißig Grad kalt. Sie eilten die Canebière wieder hinauf, Nummer 49, Grand Hôtel du Louvre et de la Paix. Ein livrierter Diener öffnete ihnen, der Eingang war ein Portal zwischen vier strengen steinernen Frauenstatuen, Karyatiden eines Tempels, der dem Luxus geweiht war. Die monumentalen Figuren symbolisierten vier Kontinente, Europa und Amerika züchtig verhüllt, Asien und Afrika mit nackten Brüsten, und vielleicht bedeutete das, dass sich die Seeleute und Händler dort holen konnten, was sie wollten.
Ihr Zimmer ging auf den Innenhof, wo sich einige Gäste auf Korbstühlen unter den gefächerten Schatten von Topfpalmen ausruhten. Still war es hier, zu still. Jung hätte lieber einen Raum gehabt, dessen Fenster sich zur Canebière hin öffnete, dann wäre der Straßenlärm zu ihnen hinaufgeflutet und hätte die Stille zwischen Dora und ihm übertönt. Doch alle zweihundertfünfzig Zimmer waren reserviert, Reeder, Kaufleute, Adelige, Offiziere, Touristen aus Wien oder Philadelphia oder Manchester, ganz Marseille, ganz Frankreich, die ganze Welt schien Geld zu haben.
Jung hatte ein Seufzen unterdrückt. Er hatte am Fenster gestanden, einen letzten Blick hinunter auf den Hof geworfen, sich dann Dora zugewandt. Sie hatte auf dem Bett gelegen und die Augen geschlossen.
Ihm hatte eine lange Nacht bevorgestanden.
Am nächsten Morgen hatten sie im Salon des Hotels gefrühstückt und auf die Rostergs gewartet, um gemeinsam zum Schiff zu fahren. Der Patriarch war von Hamburg aus in einer Junkers der Luft-Hansa angereist und hatte vor dem Abflug telegraphiert: Gutes Flugwetter – stopp – erwarte keine Verspätung – stopp – unnötig, uns abzuholen – stopp – Wagen sind schon gemietet.
Tatsächlich hatten schon kurz darauf zwei Berliets vor den Karyatiden geparkt, gelbe Karosserien, schwarze Dächer. Der Fahrer, ein älterer Mann, dessen mageren Leib ein weißer Staubmantel umflatterte, hatte geflissentlich die Tür geöffnet. Hugo Rosterg war herausgetreten wie ein General, der eine eroberte Stadt inspizierte. Er war sechsundfünfzig, glatzköpfig, der Stiernacken quoll über den Hemdkragen, sein Gesicht war gerötet, vielleicht von der Hitze, vielleicht hatte er während des Fluges auch schon einen Cognac getrunken. Quer über sein linkes Jochbein verlief ein Schmiss. »Schmiss und Zweites Juristisches Staatsexamen sind meine Erinnerungen an Heidelberg«, pflegte er zu sagen, »aber das Staatsexamen hat mir mehr Qualen verursacht.«
Seine Frau war ihm gefolgt, wenige Jahre jünger, doch das genaue Gegenteil ihres Mannes: schmal, blass, verschlossen, und sie trug keine Erinnerungen an Heidelberg mit sich herum, an gar keine Universität, denn als sie jung gewesen war, da hatte ein Fräulein aus gutem Hause noch nicht studiert; obwohl Marthe viel intelligenter war als Hugo, und vielleicht war das der Grund, warum sie immer missmutig zu sein schien. Zumindest einer von vielen Gründen.
Der Fahrer des zweiten Berliets hatte sich nicht die Mühe gemacht, den Verschlag zu öffnen. Das hatte daran liegen mögen, dass dieser Chauffeur jünger war und womöglich vor ein paar Jahren noch in Verdun gegen die Boches gekämpft hatte. Oder er hatte einfach verstanden, wer von seinen Kunden der Boss war, die beiden Gäste auf der Rückbank waren es jedenfalls nicht. Ernst Rosterg hatte schließlich die Wagentür selbst aufgedrückt. Er war siebenundzwanzig, sah aber älter aus. So massig wie der Vater, so blond wie die Mutter, ein Arier mit Bierbauch, furchterregenden Oberarmen und wasserblauen Augen. Jung hatte erleichtert aufgeatmet: Der Junior war Sturmbannführer, und er hatte befürchtet, dass er mit seiner braunen Uniform in Frankreich aufkreuzen würde, aber das hatte er dann doch nicht gewagt. Ernst Rosterg hatte sich in einen weißen Leinenanzug gezwängt, und man sah ihm an, wie unwohl er sich darin fühlte. Ein Schwergewichtsboxer, der sich in Frack geworfen hatte.
Lüttgen war als Letzter ausgestiegen. Er hatte die Bezahlung der Fahrer geregelt, während die Rostergs bereits in die Hotellobby getreten waren. Als die Türen mit ihren Rauchglasscheiben aufgeschwungen waren, hatte Lüttgen den Kopf gehoben und über die Schulter des Patriarchen hinweg zu Jung geblickt. Er hatte kalt gelächelt und sich an die Kehle gefasst, als würde er seine Krawatte richten.
Doch Jung hatte genau gewusst, was damit tatsächlich gemeint war.
Jung beobachtete Dora auf dem Vordeck der Champollion. Sie unterhielt sich noch immer angeregt mit Lüttgen, sie schien ihren Mann im Schatten der Brücke nicht bemerkt zu haben. Sie deutete mit ausgestrecktem Arm auf den Pier und sagte etwas, Lüttgen nickte dazu. Jung folgte der Geste seiner Frau mit dem Blick und sah einen Lieferwagen, der offenbar die Grandhotels von Marseille abgefahren hatte und auf seiner Pritsche einen Turm aus Schrankkoffern trug. Die meisten Gepäckstücke waren wuchtige braune Ungetüme aus dunklem Leder, Holz und eisernen Schlössern. Nur ein Schrankkoffer war mit hellbeigem Leder bespannt, er fiel schon von Weitem auf. Es war ihrer. Jung atmete tief durch, er wusste, was ihm jetzt bevorstand. Jeder Erste-Klasse-Reisende der Messageries Maritimes durfte einhundert Kilogramm Gepäck an Bord bringen. Stewards brachten die kleineren Koffer mit Schmuck, Necessaires und der Kleidung fürs Mittelmeer auf die gebuchten Kabinen. Der große Rest – die Wüstenkleidung, die Tropenkleidung, Abendgarderoben, was auch immer – verschwand in Schrankkoffern. Und diese Schrankkoffer verschwanden im vorderen Frachtraum der Champollion. Der vordere Frachtraum wiederum lag tief im Schiffsbauch, unter der Wasserlinie …
Der Zahlmeister hatte ihnen, als sie an Bord gingen, geraten, beim Verstauen des großen Gepäcks dabei zu sein, damit man sich merkte, wo der eigene Koffer stand. So kam man später während der Reise schneller an das Gepäck, um etwa die Kleidung zu tauschen. Die meisten Erste-Klasse-Passagiere ignorierten diesen Ratschlag und begaben sich niemals freiwillig dort hinunter, lieber würden sie die Stewards stundenlang suchen lassen, denn wozu bezahlte man diese Leute? Dora jedoch fürchtete, dass ihr sündhaft teurer neuer Koffer von den rauen Händen der Schauerleute und Matrosen beim Stapeln beschädigt werden würde, also hatte sich Jung auf ihr Drängen hin bereit erklärt, das Verladen zu beobachten, obwohl er wusste, was ihm bevorstand. Aber er hatte mit seiner Frau niemals über das Meer und die Furcht, die es in ihm auslöste, geredet, und er würde jetzt nicht damit anfangen.
Er stieg über stählerne Treppen die Decks hinunter, mit jedem Schritt wurden seine Beine schwerer: vom Deck E, dem Promenadendeck, hinunter zu Deck D, zu Deck C, Erste Klasse, hier lag ihre Kabine; dann hinunter zu Deck B, Zweite Klasse, das unterste Deck in den Aufbauten; schließlich Deck A im Schiffsrumpf, vorne Zweite, hinten Dritte Klasse. Das Licht fiel nur noch durch schmale Bullaugen in den Gang, aber immerhin: Sonnenlicht. Noch war er über der Wasserlinie. Die nächste Treppe, ein schweres eisernes Schott, dann wieder einen Gang hinunter zum Frachtraum, tiefer und immer tiefer. Keine Bullaugen mehr, bloß noch elektrisches Licht, und wenn er genau hinhörte, vernahm er das leise seufzende Geräusch der Wellen, die um den Rumpf spülten. Nur zwei Zentimeter Stahl trennten ihn jetzt noch vom Meer. Die Luft fühlte sich an wie zäher Schleim, er musste Kraft aufwenden für jeden Atemzug.
Nimm dich gefälligst zusammen, sagte er sich. Bloß noch eine Luke vor ihm, zum Frachtraum hin. Er drückte den massiven Griff nach unten und schwenkte sie auf, sie fühlte sich an, als würde sie eine Tonne wiegen.
Im Frachtraum war es besser als im Gang, zumindest ein wenig besser. Der Raum war wie eine stählerne Halle, schon zur Hälfte gefüllt mit Ballen und Kisten, viel größer, als man das erwarten würde, wenn man die Champollion vom Kai aus sah. Zehn Meter über ihm war die Luke weit geöffnet, ein Rechteck aus blauem Himmel, der Kran ein großer schwarzer Galgen, die Fracht, die an seinem Seil hing, sah oben winzig aus und wurde immer größer, je tiefer sie in den Raum sank. Matrosen packten die hölzernen Paletten, hievten die Schrankkoffer auf ihre Schultern und stapelten sie längs zu beiden Seiten der stählernen Halle. Sie fluchten oder scherzten, das klang alles gleich, und niemand achtete auf ihn und die wenigen anderen Passagiere, die sich eingefunden hatten.
Jung sah auf seine Armbanduhr. Er war jetzt seit zwei Minuten unten, sein Herz hämmerte. Er spürte, wie ihm der Schweiß das Rückgrat hinunterlief, ein ekelhaft kalter Finger, der über jeden Wirbel strich. Er wollte keinem Mitreisenden ins Gesicht sehen. Drei Minuten. Irgendwann mussten sie doch den hellen Koffer verladen, verdammt.
Er starrte auf ein stählernes Schott, zählte die Nieten, betrachtete die Spur aus Schmierfett im unteren Bereich der Metallplatte – und plötzlich war er nicht länger auf der Champollion. Plötzlich war er wieder Fähnrich Theodor Jung auf UB 68, wo eine ähnliche Fettspur ein Schott beschmutzt hatte. Oktober 1918, irgendwo östlich von Malta. Oberleutnant Dönitz griff einen britischen Geleitzug an, doch irgendetwas funktionierte auf einmal nicht mehr, ein Ventil, ein Tiefenruder, was auch immer. Das U-Boot sackte ab, zehn Meter, zwanzig Meter, es war wie ein Fahrstuhl in den Abgrund. Dreißig Meter, vierzig, fünfzig. Fünfzig Meter, das wusste jeder an Bord, war die magische Grenze. Dafür war ihr Boot gebaut, das konnte es aushalten, ohne vom Wasserdruck zerquetscht zu werden. Sechzig Meter. Dönitz schrie Befehle. Siebzig Meter. Der stählerne Rumpf seufzte unter dem Druck. Achtzig Meter. Neunzig. Irgendwo platzte eine Leitung, Wasser schoss hinein, Männer riefen durcheinander. Hundert Meter. UB 68 stöhnte wie ein gequältes Tier, zitterte, stampfte. Aber es sank nicht weiter. Und dann ging es auf einmal hoch. Neunzig Meter. Achtzig. Jung hätte jubeln mögen. Doch Dönitz brüllte wieder Befehle, er sah das Gesicht des Oberleutnants und begriff, dass sie nicht gerettet waren, im Gegenteil. So unkontrolliert, wie sie in die Tiefe gesackt waren, so hilflos schossen sie nun nach oben, was die Männer auch taten, das Boot gehorchte nicht mehr. Fünfzig Meter, vierzig, dreißig. Jung hörte das Wasser draußen rauschen und blubbern, so schnell stiegen sie auf. Zwanzig Meter, zehn, dann krängte und schwankte UB 68, sie schwammen wie ein Korken auf der Oberfläche, wurden steuerlos von den Wellen hin und her geworfen. »Raus, raus, raus!« Jung taumelte mit den anderen zur Leiter. Endlose Sekunden wartete er im Gedränge. Stufe um Stufe hoch durch den Turm. Draußen klare Luft, Nacht, Sternenhimmel – und Schiffe überall und Mündungsfeuer von Geschützen, Maschinengewehren. Sie waren mitten im englischen Geleitzug hochgekommen. Die Matrosen eines Zerstörers hatten sie bereits entdeckt, sie schossen mit allem, was sie hatten. Ein anderer raste auf sie zu, um sie zu rammen, der Bug wie eine Guillotine, die durchs Wasser rauschte. Jung sprang vom Turm, Mittelmeer im Oktober, das Wasser war wie ein Schlag mit einer eisigen Faust, Salz verklebte die Augen, Salz in den Haaren, er hustete und würgte Salz aus den Lungen und …
»Ça va, Monsieur?« Ein Matrose vor Jung, ein Senegalese, schwarzes Gesicht im dunklen Raum, riesige helle Augen. »Vous cherchez votre valise?«
Jung starrte ihn an, atmete durch, sein Hemd war tatsächlich so nass, als wäre er ins Meer gesprungen. Er starrte auf seine Uhr. Dreizehn Minuten, mein Gott. »Ça va, merci«, stammelte er. Nimm dich zusammen. Er ließ sich von dem Matrosen die Galerie der Schrankkoffer zeigen, an Backbord und Steuerbord ordentlich gestapelt, mittendrin der hellbeige Lederkoffer, nicht einmal eine Schramme.
»Voilà«, keuchte Jung, nickte bestätigend, »encore merci.« Er taumelte vor den anderen Passagieren zur Luke, zum Gang, zur Treppe, zum Licht, er musste sich mit unfassbarer Gewalt zwingen, nicht panisch davonzustolpern.
»Bon voyage!«, rief ihm der Senegalese nach. Es klang nicht so, als meinte er das spöttisch, sondern aufrichtig und freundlich und vielleicht auch mitleidig.
Jung stieg diesmal über die Haupttreppe nach oben. Sobald er wieder Sonnenlicht sah, verlangsamte er seine Schritte, atmete durch, warf einen verstohlenen Blick auf einen der zahllosen Spiegel, um sicherzugehen, dass er präsentabel aussah. Er wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß vom Gesicht. Sein weißes Hemd war nass, daran war nichts zu ändern, doch das fiel unter dem Jackett kaum auf. Also weiter. Die Champollion war im ägyptischen Stil eingerichtet, eine Anspielung auf die Reiseziele entlang ihrer Route, aber auch eine Verbeugung vor der aktuellen Mode, denn seit der Entdeckung von Tutanchamun war die Welt verrückt nach Ägyptica. Das schmiedeeiserne Geländer war mit stilisierten Lotosblüten geschmückt, ein gemalter Fries aus Papyruspflanzen schien die Decke zu stützen, an der Stirnwand am oberen Treppenausgang leuchtete ein Fresko, das eine pharaonische Barke mit geblähtem Segel auf dem Nil verherrlichte. Links und rechts davon standen lebensgroße ägyptisch anmutende Statuen, eine Frau, ein Mann, ihre Gesichter starr gen Unendlichkeit gerichtet, Pharaonen vielleicht oder Priester. Jung schüttelte sich unwillkürlich. Mode hin oder her: Wusste denn niemand, dass diese antike Kunst in Grabkammern gefunden worden war? War denn niemandem klar, dass die Champollion dekoriert war wie eine Pharaonengruft?
Er gelangte zum Deck C, ging Steuerbord nur wenige Schritte den Korridor entlang bis zu einer weiß lackierten stählernen Tür mit der Nummer »66«, einer Erste-Klasse-Kabine ungefähr in der Mitte des Schiffs – sein Zuhause für die nächsten zwei Wochen. Seufzend öffnete er die Tür. Der Raum war nicht sehr groß, die Handkoffer standen auf dem Teppich, jemand hatte das einzige Bullauge geöffnet, sodass Licht und Luft hereinströmten, aber auch Hitze und Hafengestank. Jung sah sich um: ein Sofa rechts, ein Schrank mit einem geschwungenen, irgendwie orientalisch wirkenden Spiegel links, ein schmaler Schreibtisch mit Stuhl, das Bett an der Außenwand, direkt unter dem Bullauge. Die Wände waren mit weiß lackierten Holzpaneelen verkleidet, doch die Decke war nackter, vernieteter Stahl, kaum anders als im Innern von UB 68. Nicht daran denken, sagte er sich, bloß nicht an das verdammte U-Boot denken, das seit elf Jahren auf dem Meeresgrund vor Malta ruhte, das Grab für einen Kameraden, für den einen Seemann, der nicht mehr rechtzeitig herausgekommen war, der eine Seemann, der auch er hätte sein können.
Jung räumte seine Kleidung in den Schrank, wechselte das Hemd, lauschte den Geräuschen, die von draußen hereingeweht wurden, Möwenkreischen, Flüche, Motorenlärm – normale Welt, alltägliches Leben, langsam beruhigte sich sein Puls.
Trotzdem riss er erschrocken den Kopf herum, als die Tür aufging.
»Ich bin es nur. Warum starrst du mich an, als wäre ich der Klabautermann?« Dora lachte unbeschwert und gab ihm einen flüchtigen Kuss. »Alles in Ordnung mit dem Schrankkoffer?«
Jung nickte und bemühte sich, so gelassen zu wirken, wie es ein Mann von Welt tun sollte. »Der ist so sicher aufgehoben wie in Abrahams Schoß. Was hast du währenddessen gemacht?«
»Oh«, sie vollführte mit der linken Hand eine vage Geste, während sie mit der rechten ihre kleine Handtasche aufs Bett warf. »Ich habe mich auf dem Schiff umgesehen. Du weißt, wie das ist: Wenn man neu an Bord ist, dann verläuft man sich ständig. Alle diese Treppen und Gänge sehen doch gleich aus. Ich bin schon froh, dass ich unsere Kabine wiedergefunden habe.«
»Hast du schon Mitreisende kennengelernt?«
»Ich habe mit niemandem gesprochen.«
»Mit niemandem?«
»Mit niemandem. Heute Abend beim Dinner werden wir ja sehen, wer alles an Bord ist. Ich habe da Gerüchte gehört …« Sie schnalzte mit der Zunge, verriet aber nicht mehr. Dora kramte in ihrer Handtasche und fischte eine Pappschachtel heraus: Königin von Saba, die Packung zeigte eine orientalische Oase. Wie passend, fiel Jung auf, als hätte sie die extra für diese Reise gekauft. Doch das war nicht so, Dora rauchte diese Marke schon seit Jahren, sogar schon vor dem Krieg, als es noch unschicklich gewesen war, dass eine Dame in der Öffentlichkeit rauchte, und schon gar nicht eine so junge Dame. Sie holte eine Zigarette heraus, steckte sie in eine Spitze, ließ sich von ihm Feuer geben und inhalierte genüsslich.
Jung musterte sie verstohlen. Dora hatte eine wundervolle Altstimme, früher hatte sie gesungen, Schubert oder Offenbach, wenn ihr danach gewesen war. Doch mit der Qualmerei ruinierte sie sie langsam, was vielleicht auch gleichgültig war, denn Dora sang schon lange nicht mehr, zumindest nicht für ihn. Jung machte sich keine Illusionen, er wusste, dass es an ihm lag. Ihre Affäre hatte vor dem Krieg begonnen, eine Schülerliebe, und da Dora einen starken Willen hatte, hatte sie sich ihm ganz hingegeben, mochten ihre Eltern sie auch für noch so unmoralisch halten. Nicht, dass die Rostergs damals allzu großen Widerstand geleistet hätten, im Gegenteil, sie hatten in ihm eine gute Partie erkannt: Jungs Vater war Abteilungsleiter bei Ballin, und Ballin wiederum war ein Ratgeber Seiner Majestät des Kaisers. Jungs Mutter stammte gar aus einer holsteinischen Adelsfamilie, sodass einem Sprössling seiner Herkunft im Kaiserreich alle Türen offenstanden. Wenn denn das Kaiserreich überdauert hätte.
Nach dem Krieg war der Monarch ins holländische Exil geflohen, Ballin hatte seinem Leben aus Verzweiflung über die Niederlage ein Ende gesetzt, das Vermögen von Jungs Vater war verbrannt, der Adelstitel seiner Mutter zählte in der neuen Republik nichts mehr. Als Jung aus englischer Gefangenschaft zurückgekehrt war, hatte er Dora geheiratet, weil er ein Ehrenmann war, der das Mädchen, das er entjungfert hatte, auch zum Traualtar führte. Und sie hatte ihn geheiratet, weil sie eine ehrenhafte Dame war, die einem heimgekehrten Kriegshelden nicht den Laufpass gab. Dora hatte sich in den drei Jahren zwischen ihrer ersten Begegnung Anfang 1917 und der Hochzeit Ende 1919 kaum verändert, drei Jahre, mein Gott, das war nichts, Jung hielt noch immer die Frau in Armen, in die er sich verliebt hatte. Doch drei Jahre, das war auch eine Ewigkeit, denn Dora hielt nicht länger den Mann in den Armen, den sie als Schülerin das erste Mal geküsst hatte. Jung war als anderer Mensch zurückgekehrt, ernster, verschlossener, schroffer gar, nicht länger interessiert an einem respektablen Leben, an manchen Tagen nicht einmal mehr interessiert am Leben an sich. Jung hatte Dora aus Liebe geheiratet, Dora ihn aus Pflichtgefühl. Kein Wunder, dass sie nicht mehr sang. Kein Wunder, dass sie in all den Jahren nie ein Kind bekommen hatten. Kein Wunder, dass sie mit anderen Männern sprach und ihn darüber anlog.
Dora holte einen roten Baedeker aus einem Koffer und legte ihn auf den Nachttisch an ihrer Seite des Betts. Jung las den Titel: Ägypten.
»Wann fährt man schon mal durch den Suezkanal?«, sagte sie heiter. »Ich habe gehört, dass man unterwegs sogar die Gelegenheit hat, einen Ausflug ins Tal der Könige zu machen. Wir werden am Grab des Tutanchamun stehen! Vielleicht ist sogar Howard Carter selbst da!«
»Das ist durchaus möglich«, gab Jung zu.
Ihr Lächeln erlosch. »Das klingt ja nicht gerade begeistert. Dabei bist du derjenige, der hier die Fotos macht, mit denen wir unsere Miete bezahlen. Interessiert dich das denn gar nicht?«
»Doch«, erwiderte Jung hastig. Er war zu erschöpft für einen Streit, lieber zwang er sich zum Optimismus. »Wer weiß, vielleicht entdecken wir sogar noch einen antiken Schatz? In Ägypten ist längst noch nicht alles ausgegraben worden.«
Dora nickte, nur halb versöhnt. »Welches Buch hast du für die Reise mitgenommen?«
»Einen Roman«, antwortete er bloß. Er hatte plötzlich das Gefühl, dass es keine gute Idee wäre, ihr das Werk zu zeigen, zumindest nicht jetzt schon.
Seine Frau hielt inzwischen eine kleine Gürteltasche in der Hand: Das Leder war hart wie Blech und poliert von der Zeit, eine Soldatentasche, das obskure Erbstück von irgendeinem Rosterg, der in Sedan gekämpft hatte. Dora hatte diese Tasche nach dem Blutsonntag vor gut sechs Monaten aus einem vergessenen Winkel ihres Kleiderschranks geholt. An jenem 1.Mai hatten in Berlin zehntausend Rotfrontler gegen mindestens ebenso viele Polizisten gekämpft, Tote, Verletzte, Verhaftete, und manche Straßen hatten danach ausgesehen wie im Bürgerkrieg. Dora hatte noch in der Nacht der Schießereien ein Bündel Reichsmarkscheine, Wertsachen und irgendwelche Papiere in die Tasche gestopft und sie unter der Matratze versteckt. »Falls die Kommunisten kommen und das Haus plündern«, hatte sie Jung erklärt. Seither hatte sie diese Angewohnheit beibehalten, doch er war überrascht, dass seine Gattin selbst auf dem Schiff nicht davon lassen wollte.
»Wir sind doch nicht in Berlin. Hier werden dich garantiert keine Roten überfallen«, sagte er, während er ihr dabei zusah, wie sie die kleine Ledertasche unter die Matratze des Bettes schob.
In diesem Moment klopfte es an der Tür, und noch bevor Jung »Herein!« rufen konnte, schwang sie bereits auf.
Eine Stewardess in der Uniform der Messageries Maritimes trat ein. Jung schätzte, dass sie etwa so alt war wie er, sie war zierlich, hatte ihre schwarzen Haare zum Bubikopf geschnitten, ihre Augen waren sehr dunkel, beinahe schwarz, ihre Nase war lang und gerade, etwas zu groß für ihr fein geschnittenes Gesicht, trotzdem fand er sie schön.
Zumindest eine Sekunde lang – dann fing er den Blick aus ihren Augen auf: Verachtung lag darin, oder Hass, oder beides.
»Madame, Monsieur, ich bin Fanny Philip, Ihre Kabinenstewardess auf dieser Reise.« Sie sprach, soweit Jung das mit seinen mittelprächtigen Französischkenntnissen beurteilen konnte, mit südfranzösischem Akzent, wahrscheinlich kam sie aus Marseille, vielleicht hatte sie schon als kleines Mädchen die Schiffe am Horizont verschwinden sehen und wollte schon immer hinaus … Manchmal begegnete er Menschen, zu denen ihm sofort Geschichten einfielen, kleine Romane ihres Lebens, obwohl er doch von diesen Leben noch gar nichts wusste.
»Wenn Sie etwas benötigen oder eine Frage haben«, fuhr sie fort, »so zögern Sie nicht, mich anzusprechen.« Dann jedoch drehte sie sich so rasch um, dass sie nicht einmal dazu kamen, ihr zu danken, geschweige denn, ihr eine Frage zu stellen.
Dora hatte sich hastig aufgerichtet und das Bettzeug über der Stelle, an der sie die Ledertasche versteckt hatte, glattgestrichen. Nun schüttelte sie verwundert den Kopf. »Wir leben in hektischen Zeiten«, meinte sie spöttisch, »aber man kann es mit der Hektik auch übertreiben.«
Jung dachte an die »Boche«-Schmähungen in den Straßen von Marseille und an die bürgerliche Dame, die vor ihnen aufs Trottoir gespuckt hatte. Er war sich ziemlich sicher, dass nicht die moderne Hektik Fanny Philip aus ihrer Kabine getrieben hatte, sondern ein elf Jahre alter Hass. Und vielleicht war es doch nicht so dumm, unter der Matratze eine Notreserve für alle Fälle zu verstecken, als Deutsche auf einem französischen Schiff.
»Lass uns an Deck gehen und frische Luft schnappen«, schlug er vor. Er sah auf seine Uhr. »Wir sollten bald ablegen.«
Es war inzwischen Nachmittag geworden, und jetzt täuschte der Oktober niemanden mehr. Es war nicht gerade kalt, es gab kühlere Hochsommertage in Berlin, doch die drückende Hitze war verdampft. Vom Meer her wehte eine Brise wie eine Verheißung auf ihre Reise, die Luft schmeckte nach Salz, Marseille badete in einem Licht, als würde die ganze Stadt von einem Kaminfeuer illuminiert werden. Die Muttergottes auf Notre-Dame-de-la-Garde glänzte heidnisch golden, der Maske des Tutanchamun näher als irgendeinem christlichen Bildwerk. Jung hielt seine Leica in den Händen und wünschte, dass es Farbfilme gäbe. Er konnte die Welt in tausend Grautönen zeigen, aber es gab Momente, da reichte das nicht.
Jung hatte Dora auf dem Promenadendeck nach achtern geführt. Sie blickten auf das Deck der Dritten Klasse hinunter. Dort stand eine Frau an der Reling, einfach gekleidet, vielleicht eine Syrerin oder Armenierin, sie trug ein Baby in den Armen, drei Jungen, vielleicht sechs, vier und drei Jahre alt, schätzte Jung, hielten ihren Rocksaum umklammert. Dora betrachtete die Passagierin und ihre Kinder. Mein Gott, dachte Jung, vier Kinder, und diese Frau ist jünger als Dora. Es war so ungerecht, wieso hatten manche Menschen so früh so viele Kinder und anderen war kein einziges vergönnt? Er deutete auf Notre-Dame-de-la-Garde und schwatzte einfach drauflos, erzählte mit übertriebener Heiterkeit die erste Geschichte, die ihm dazu einfallen wollte. Dora durchschaute den Trick wahrscheinlich, trotzdem war Schwadronieren besser, als schweigend auf eine Mutter mit vier Kindern zu blicken.
Matrosen verschlossen die Frachtluken mit unterarmlangen Eisenbolzen, als wollten sie den Schiffsrumpf nie wieder öffnen. Die Kräne auf dem Môle de la Pinède und auf der Champollion standen nun bewegungslos wie riesige Kreuze. Docker zogen die Tore der Frachthallen zu.
»Sieh mal, eine Chanteuse des Rues!«, rief Jung und deutete nach unten. Eine Straßenmusikerin schleppte ihr Akkordeon über den Kai. Sie war klein, hager, die langen Haare pechschwarz, die Haut sonnengebräunt, unmöglich zu sagen, ob sie dreißig oder sechzig war. Sie setzte sich auf einen eisernen Poller und spielte eine melancholische Melodie, die er noch nie zuvor gehört hatte, den Text verstand er nicht. Über die Decks der Champollion wehte der Klang der Bordglocke: das Zeichen für die Begleiter der Passagiere, das Schiff nun zu verlassen. Frauen und Männer strömten über eine steile Laufplanke vom Heck hinunter auf den Kai, verteilten sich längs des Dampfers, suchten ihre Angehörigen und Freunde, riefen sich über fünf Stockwerke hinweg Abschiedsworte zu. Ein älterer Herr mit einem Strohhut warf der Musikerin eine Handvoll Scheine in den Korb, beugte sich zu ihr, sagte etwas. Sie spielte daraufhin ein anderes Lied, doch auch das kannte Jung nicht.
Vier Nonnen standen auf dem Môle de la Pinède, ihre Hauben leuchteten wie weiße Schwäne. Sie winkten heftig, was ihnen eine ganz unreligiöse, jungmädchenhafte Aura verlieh. Dora beugte sich weit über die Reling, um zu sehen, wen sie wohl verabschiedeten – es waren sechs Nonnen auf dem Vordeck, wo sich die Passagiere der Zweiten Klasse versammelt hatten.
»Was machen die Nonnen an Bord?«, fragte sie einen vorbeikommenden Matrosen.
Der Seemann spuckte eine Prise Kautabak in das schmutzige Wasser zwischen Kai und Bordwand und zuckte mit den Achseln. »Vielleicht fahren sie zu einer Mission nach Siam. Oder zu einem Leprahospital auf den Philippinen.«
Dora sah die Nonnen ehrfürchtig an. »Wie lange werden sie dort bleiben?«
»Für immer«, antwortete der Matrose lachend und ging davon.
Rumpelnd wurde die Gangway eingezogen. Seeleute rannten über Vor- und Achterdeck, Kommandos wurden gebrüllt, mit schrillen Pfiffen aus den Bootsmannspfeifen trieben Maate ihre Männer an. Arbeiter lösten die Trossen von den Pollern, sie klatschten ins schmutzige Wasser, bevor sie von den Matrosen hochgezogen und auf dem Deck zu riesigen Schnecken zusammengerollt wurden. Mit einem metallischen Rasseln verschwand die Kette Glied für Glied im Rumpf, bis der schlammüberzogene, tropfende Anker an der Klüse hing. Am Heck schäumte das Wasser auf, als die Schraube anfing, sich zu drehen. Ein Zittern lief durch die Champollion, als würden durch die Tausenden Tonnen Stahl unablässig Stromstöße gejagt. Zentimeter für Zentimeter löste sich der Koloss vom Kai. An Land und auf den Decks hatten sie Taschentücher gezogen und winkten, schwenkten Hüte, riefen sich letzte und allerletzte und allerallerletzte Grüße, Schwüre, Abschiedsworte zu. Die Musikerin spielte jetzt die Marseillaise, aber das hörte Jung im allgemeinen Lärm kaum und dann gar nicht mehr, als das Schiffshorn mit einem lang gezogenen dumpfen Tuten Marseille Adieu sagte.
Die Champollion glitt langsam durch den Hafen. Die Luft schmeckte nach Salz und Rauch. Möwen segelten neben den Schornsteinen und der Funkantenne. Sie wirkten auf Jung wie entschlossene Krieger, die knapp unterhalb der Rußwolken, die aus den vorderen beiden Schornsteinen quollen, einem fernen Ziel unbeirrbar entgegenstrebten. Der Himmel war zu dunkel, um noch blau zu sein, aber noch nicht nachtschwarz. Am Ufer flammten die Bogenlampen auf, ihr Leuchten spiegelte sich grün im Hafenwasser. An einem Kai lag ein Dampfer, die Bullaugen waren hundert Lichtpunkte in seinem dunklen stählernen Panzer. Ein Boot, vielleicht ein Fischerkahn, tuckerte der Champollion entgegen, umkurvte sie in weitem Bogen; Jung sah einen Schatten, ein rotes und ein grünes Positionslicht, das weiße »V« der Hecksee, das sich im schwarzen Meer verlor. Zwischen den Streben der Hochbrücke funkelte der Abendstern. Ein Leuchtturm, weit draußen auf dem Meer, schickte alle paar Sekunden seinen Strahl zu ihnen. Und voraus lag das Château d’If, eine winzige Insel, eine Bergkuppe aus Felsen und Festung im Meer, wo einst Edmond Dantès geschmachtet hatte. Jung hatte Der Graf von Monte Christo in unbeschwerten Tagen verschlungen, er erinnerte sich kaum noch an die verworrene Handlung. Und doch gab ihm das Château d’If plötzlich einen Stich ins Herz, es war ein Ruf aus seiner Kindheit, und irgendwie wusste er in diesem Augenblick, dass er nicht bloß von Marseille und von Europa Abschied nahm, sondern auch von seiner Jugend.
Unauffällig musterte er die Passagiere. Wie viele Menschen mochten an Bord sein? Zweihundert? Dreihundert? Vierhundert? Ob es irgendeinen anderen gab, der sich so pathetisch fühlte wie er? Die meisten Reisenden standen an der Reling, blickten auf die Stadt oder auf das Meer oder zu den Sternen hoch, manche hielten noch ihre Taschentücher in den Händen, nutzlose kleine Gespenster, aus denen das magische Leben gewichen war. Vier rotgesichtige Männer, alle in hellen Leinenanzügen und weißen Schuhen, hatten sich unter einem Rettungsboot versammelt und unterhielten sich laut, sie hatten schon keinen Blick mehr für die Welt. Die bis zu ihm hinüberwehenden Wortfetzen ließen Jung vermuten, dass es Kolonialbeamte waren, jedenfalls Männer, die schon viel zu oft auf Dampfern gestanden hatten. Ein junges Mädchen hielt sich krampfhaft am glatten Holzlauf der Reling fest, sie war sehr blass; Jung wusste nicht recht, ob sie sich aus Verzweiflung über Bord stürzen wollte oder ob sie bereits von den harmlosen Wellen zwischen Vieux Port und Château d’If in die Qualen der Seekrankheit getrieben wurde. Zwei Wochen würde er mit allen diesen Menschen zusammenleben, würde sich eine kleine Ewigkeit lang ein paar Quadratmeter Deck, Restaurant, Rauchsalon mit ihnen teilen. Er suchte nach sympathischen und unsympathischen Gesichtern, nach Mitreisenden, mit denen er gern ins Gespräch kommen würde, und anderen, denen er lieber aus dem Weg gehen wollte. Er war nicht der Einzige, der mit forschenden Augen die Menge musterte.
Dora stand schweigend neben ihm. Er folgte ihrem Blick: Sie beobachtete wieder die junge Orientalin mit den vier Kindern, bis diese ihren Söhnen etwas sagte und sie gehorsam hinter ihr her unter Deck trotteten.
»Wo ist deine Familie?«, fragte Jung, um sie abzulenken.
Sie zuckte mit den Achseln. »Papa und Mama sind garantiert in der Kabine und takeln sich für das Dinner auf. Du weißt, wie lange das bei ihnen dauert, vor allem bei Mama. Mit jedem Jahr, das sie älter wird, steht sie zehn Minuten länger vor dem Spiegel.«
»Sei nicht so gehässig. Sie ist eine elegante Dame, und wir werden nun mal alle älter.«
»Ja«, pflichtete sie ihm seufzend bei, »wir rasen alle auf den Abgrund zu.« Sie steckte sich eine Zigarette in die Spitze und ließ sich Feuer geben. »Mein lieber Bruder guckt wahrscheinlich irgendeinem jungen Steward hinterher.« Sie stieß den Qualm so kraftvoll aus, als wollte sie ihre Seele aufs Meer hinausblasen. »Und Berthold«, sie schnippte Asche über die Reling, »hockt vermutlich in seiner Kabine und kalkuliert zum hundertsten Male, wie viele Penunsen uns diese Reise einbringen wird.«
Vielleicht sollte das abschätzig klingen, doch Jung war nicht entgangen, dass Dora den Prokuristen bei seinem Vornamen genannt hatte. Er sah sich noch einmal gründlich auf Deck um. In der Tat war Lüttgen nirgendwo zu sehen. Er fragte sich, was der Kerl wirklich in diesem Augenblick machte und wo er sich wohl herumtrieb.
»Wir sollten uns ebenfalls in Schale werfen«, schlug Dora vor.
»Beim ersten Abendessen der Reise erscheint man traditionell nicht in Abendkleid und Smoking«, erinnerte sie Jung. »Straßenanzug reicht.«
»Für dich vielleicht. Aber mir werden ein wenig Kajal und Lippenstift guttun.«
Etwa eine Stunde später betraten sie das Restaurant der Ersten Klasse auf dem B-Deck. Dora hatte es sich nicht nehmen lassen, schwarze Glacés anzuziehen, und nun ihre behandschuhte Rechte auf seinen Unterarm gelegt, ein Lächeln umspielte ihre Lippen, als Stewards die Flügeltüren vor ihnen öffneten, sie genoss es, wie eine Fürstin aufzutreten.
Oder eine Pharaonin, dachte Jung.
Denn auch das Restaurant sah aus, als hätte man es aus dem Palast des großen Ramses auf den Ozean verlegt. Es war so hoch und weit wie eine Thronhalle, über die sich eine Decke aus Milchglas wölbte, in das ägyptische Muster eingeritzt waren. Lotosblüten und Papyrusstengel schmückten die fünf Meter hohen Säulen, die das Glasdach trugen. Über die Wände verliefen Fresken, die Fellachen bei der Ernte zeigten, Lastenträger, Nilfischer und einen Pharao, der mit Pfeil und Bogen Löwen und Krokodilen nachstellte.
Die Tische waren opulent mit weißem Porzellan, Kristallgläsern, Spitzenservietten und Gestecken frischer Blumen gedeckt. Lichter funkelten, es duftete nach Blüten, Wein und Bratensoßen. Jung hätte sich in einem schicken Pariser Restaurant wähnen können, wenn sich der mit Teppich ausgelegte Boden unter seinen Füßen nicht ganz leicht im Rhythmus der Wellen gewiegt hätte. Hinter dieser Pracht waren Stahlplatten verborgen, und hinter diesen Stahlplatten wiederum lauerte das dunkle Meer.
Dora blieb mitten im Restaurant stehen für einen bewundernden Blick. Er nutzte dies, um sich unauffällig mögliche Fluchtwege einzuprägen.
Viele Gäste waren schon da, niemand achtete auf sie. Die vier Kolonialbeamten saßen mit drei Priestern in langen schwarzen Soutanen, wahrscheinlich jesuitische Missionare, an einem Tisch und unterhielten sich dröhnend, sie waren offenbar bereits bei der zweiten Weinflasche. Viele Männer an den anderen Tischen trugen, wie Jung, leichte dunkle Anzüge, einige von den jüngeren hatten sogar noch ihre modischen Jockeymützen auf dem Kopf. Die Frauen hatten die Haare onduliert oder sie zu Bubikopf und Eton geschnitten, sie hatten sich in Charlestonkleider geworfen, als würden sie gleich noch auf ein Tanzfest gehen. Viele trugen Glockenhüte, doch einige hatten sich, der Mode und ihrem Reiseziel huldigend, feder- und perlengeschmückte Turbane aufgesetzt. Sie fanden den Tisch, an dem die Rostergs und Lüttgen bereits saßen, am anderen Ende des Restaurants.
»Da kommt ja unser Dichter der Neuzeit«, rief Lüttgen und hob zum spöttischen Gruß sein Whiskeyglas. Der alte Rosterg war dem Cognac treu geblieben, Ernst hatte sich ein Bier geholt und musterte das Glas aus irgendeinem Grund finster.
»Der Geist denkt, das Geld lenkt«, sagte Hugo Rosterg unvermittelt. Jung fragte sich, was er mit diesem Spengler-Zitat andeuten wollte und wie viele Cognacs er wohl schon getrunken haben mochte.
»Meine Dame, meine Herren«, begrüßte Jung die Runde und verbeugte sich formell. Gute Manieren waren auch ein guter Schutzschild. Er rückte Dora den Stuhl zurecht, setzte sich danach selbst. Dora bestellte sich beim lautlos hinzugeeilten Steward einen Chablis wie ihre Mutter, Jung blieb lieber erst einmal beim Selters. Er deutete auf den einzigen noch freien Platz an ihrem Tisch. »Wir werden in Begleitung speisen?«
»An jedem größeren Tisch der Ersten Klasse diniert ein Offizier der Besatzung«, belehrte ihn der Patriarch gönnerhaft. »Wir werden die Ehre haben, den Ersten Offizier der Champollion in unserer Mitte begrüßen zu dürfen, Roland Dorgelès, gewissermaßen ein alter Freund von mir.«
Jung sah ihn überrascht an. Er hatte diesen Namen noch nie gehört. »Ich wusste nicht, dass Sie mit einem französischen Offizier befreundet sind.« Der alte Rosterg hatte vor dem Krieg mit den Alldeutschen sympathisiert und zu denen gehört, die Frankreich demütigen und die halbe Welt in deutsche Kolonien verwandeln wollten.
»Du weißt doch, dass ich seit mehr als zwanzig Jahren in die Levante und den Orient reise«, erwiderte sein Schwiegervater, als würde das alles erklären.
Jung zuckte mit den Achseln und vertiefte sich in die Speisekarte, deren Titelblatt ein Aquarell zierte, das die Champollion in voller Fahrt zeigte, dahinter, groß wie die aufgehende Sonne, der Sphinx und die Pyramiden. Er las die Menuvorschläge des Abends:
Consommé aux cheveux d’ange
Crème Lison
Œufs au choix
Filet de sole au Chablis
Baron d’Agneau à la Judée
Croustade de grives aux senteurs de Provence
Poulet de printemps rôti
Pommes Chatouillard
Salade Romaine
Haricots verts sautés au beurre
Suprème au Moka
Puits d’amour
Brie – Gruyère
Corbeille de fruits
Er würde auf dieser Fahrt nicht verhungern – vorausgesetzt, er schaffte es, seine Angst vor dem Meer so weit zu bezwingen, dass er einen Happen hinunterbekam. Er blickte auf, als ein Offizier an ihren Tisch trat und sie mit einer knappen, militärisch aussehenden Verbeugung begrüßte.
Roland Dorgelès war, schätzte Jung, wohl schon sechzig Jahre alt, aber sein Körper war so bullig, dass er jünger wirkte und noch größer, als er sowieso schon war. Sein Haupt war kahl, die Haut glänzte wie poliert, sein grauer Bart war im Empire einmal Mode gewesen. Er musterte sie der Reihe nach aus seinen dunklen Augen. »Mesdames, Messieurs, gestatten Sie, dass ich mich zu Ihnen setze?« Als er Platz nahm, atmete Jung den Hauch einer kalten Zigarre ein. Dorgelès sprach Deutsch mit einem starken französischen Akzent, Jung fragte sich, wo er es gelernt hatte. Der Offizier sah nicht so aus, als stamme er aus dem Elsass, sondern als komme er direkt aus den Gassen von Marseille. Ernst starrte Dorgelès finster an, er war, wie die meisten Sturmtruppler, seit dem Ruhrkampf nicht gut auf Franzosen zu sprechen. Jung zweifelte, dass der Offizier wusste, dass der Sohn seines »alten Freundes« Rosterg in Hamburg am liebsten in brauner Uniform herumstolzierte.
Sie bestellten beim Steward, die meisten entschieden sich für die Scholle. Doch Jung fand, dass er platten Fisch ja schon bei jedem Besuch der hanseatischen Schwiegereltern aß, und wenn man schon in Marseille ablegte, dann sollte man das auch schmecken. Also wählte er das Drosseltörtchen mit provenzalischen Gewürzen und dazu dann auch einen Weißwein.
»Drossel?«, kommentierte Ernst, laut genug, dass Dorgelès es hören musste. »Ich kann mit diesem dekadenten Fraß der Franzmänner nichts anfangen.«
»Warum sollte eine Drossel dekadenter sein als ein Huhn?«, erwiderte Jung freundlich. Ernst Rosterg war nicht gerade Albert Einstein, meist reichte ein Satz, um ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen. Auch jetzt glotzte er ihn bloß an.