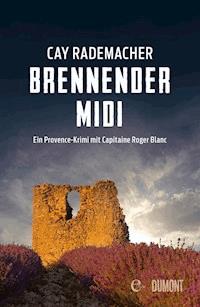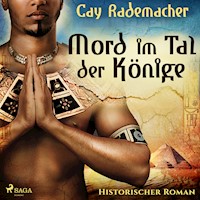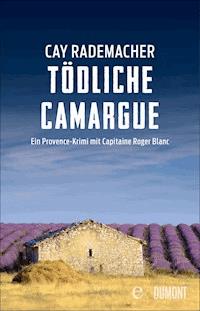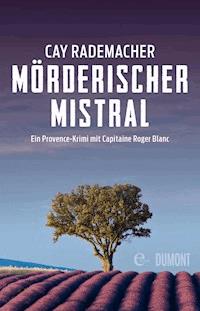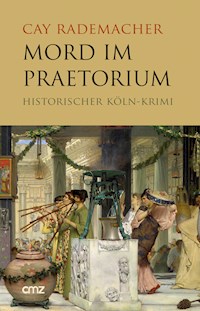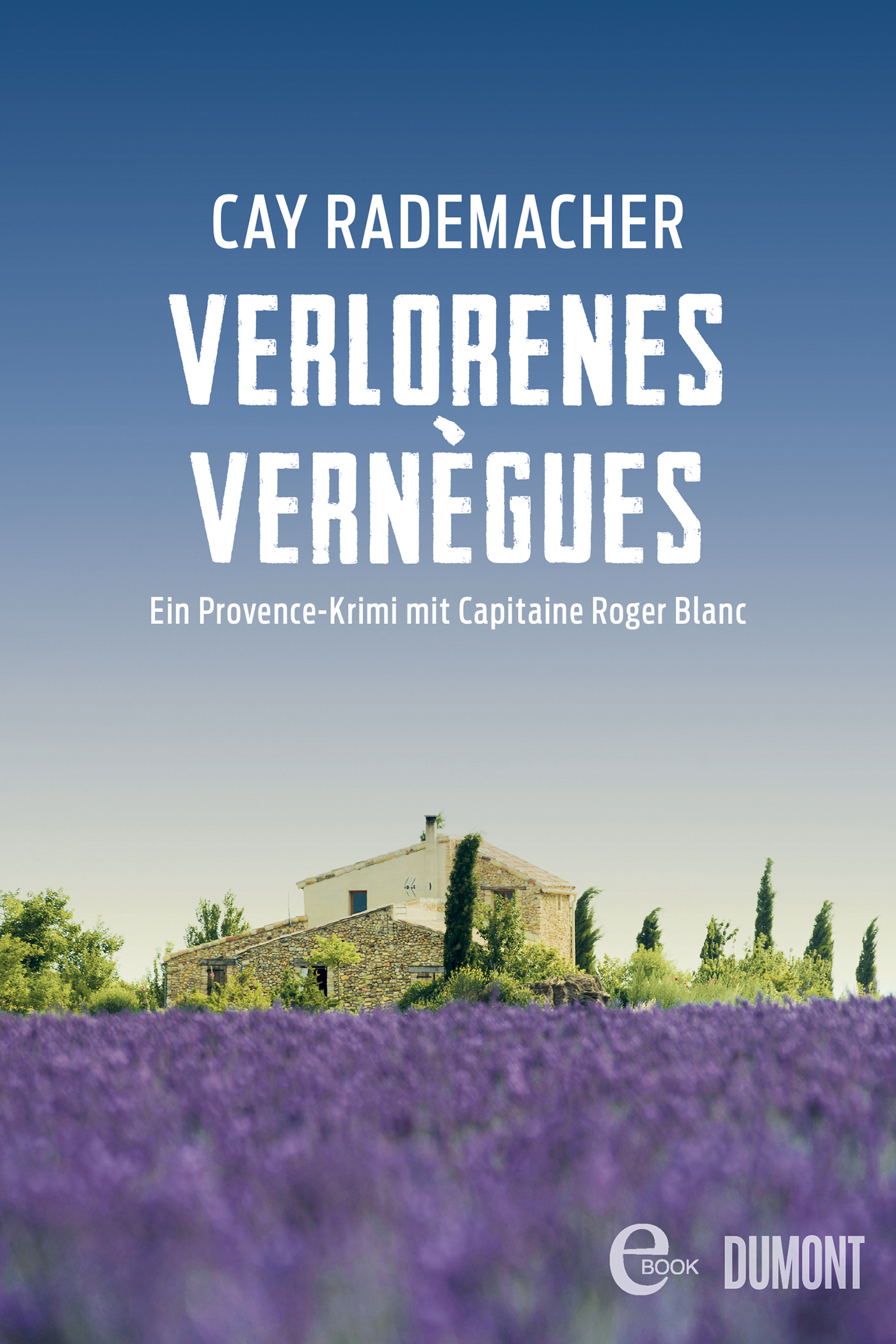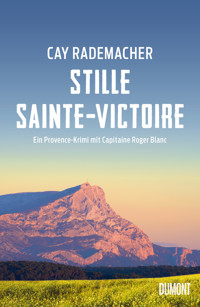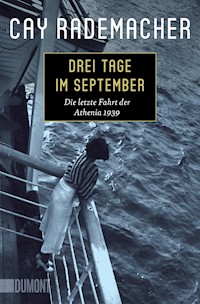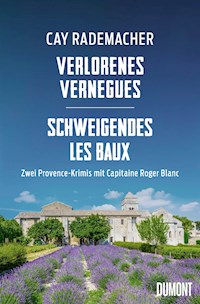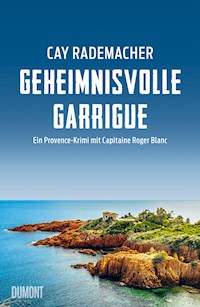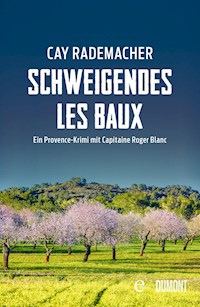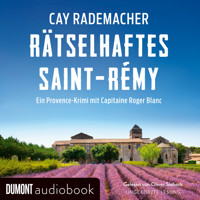
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Capitaine Roger Blanc ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der zwölfte Band der bekannten Krimireihe mit Capitaine Roger Blanc Juni in der Provence, mit dem Sommer kommen die Touristen gerade auch nach Saint-Rmy, einem der schönsten Orte in Südfrankreich. Ganz in der Nähe des malerischen Städtchens erheben sich die Alpilles, ein Gebirgszug mit schroffen Felsgipfeln und dicht bewaldeten, fast menschenleeren Tälern. Und genau zwischen Stadt und Bergen, zwischen Betriebsamkeit und Einsamkeit, erstreckt sich die seit mehr als anderthalb Jahrtausenden verlassene antike Metropole Glanum, das Pompeji der Provence. Inmitten der Ruinen arbeitet ein junger Archäologe der Sorbonne, der mit seiner Chefin und einem Kollegen für einige Wochen eine Ausgrabung durchführen soll. Routine, so scheint es. Bis der Forscher eines Nachts im düsteren Schacht einer Quelle ermordet wird, die schon den Kelten, den Griechen und den Römern heilig war. Blanc und seine Kollegen Marius Tonon und Fabienne Souillard, beide aus privaten Gründen angeschlagen, nehmen die Ermittlungen auf und finden bald heraus, dass der Tote nicht nur seinen offiziellen Forschungen nachging, sondern sich auch auf einer geheimnisvollen Suche befand einer Suche, die ihn möglicherweise das Leben gekostet hat. Mord in der Provence Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Cte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Cals Band 7: Verlorenes Verngues Band 8: Schweigendes Les Baux Band 9: Geheimnisvolle Garrigue Band 10: Stille Sainte-Victoire Band 11: Unheilvolles Lanon Band 12: Rätselhaftes Saint-Rmy Band 13: Bedrohliche Alpilles Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juni in Südfrankreich: Mit dem Sommer kommen die Touristen nach Saint-Rémy, einem der schönsten Orte der Region. Nur wenige Kilometer hinter den Cafés, Galerien und pittoresken Plätzen erheben sich die Alpilles – ein Gebirgszug, dessen schroffe Felsgipfel wie stumme Wächter über dicht bewaldete, fast menschenleere Täler ragen. Und zwischen Stadt und Bergen liegt die seit mehr als anderthalb Jahrtausenden verlassene antike Metropole Glanum, das Pompeji der Provence. Inmitten der Ruinen arbeitet ein junger Archäologe der Sorbonne mit seiner Chefin und einem Kollegen an einer Ausgrabung. Routine, so scheint es. Bis der Forscher tot aufgefunden wird – ermordet im düsteren Schacht einer heiligen Quelle. Blanc und seine Kollegen Marius Tonon und Fabienne Souillard, beide aus privaten Gründen angeschlagen, nehmen die Ermittlungen auf. Schon bald finden sie heraus, dass der Tote nicht nur seinem offiziellen Forschungsauftrag nachging, sondern sich auch auf einer mysteriösen Suchmission befand. Dass ein fast vergessenes, nie aufgeklärtes Verbrechen dabei eine Rolle spielte. Und dass es ausgerechnet im malerischen Saint-Rémy mehr als einen Menschen mit einem dunklen Geheimnis gibt.
© in medias res
Cay Rademacher, geboren 1965, schreibt in mehrere Sprachen übersetzte Kriminalromane, etwa die ›Trümmermörder‹-Trilogie aus dem Hamburg der Nachkriegszeit oder die erfolgreiche Provence-Serie um Capitaine Roger Blanc. Außerdem erschienen bei DuMont ›Ein letzter Sommer in Méjean‹ (2019), ›Stille Nacht in der Provence‹ (2020), ›Die Passage nach Maskat‹ (2022), ›Nacht der Ruinen‹ (2025) sowie das historische Sachbuch ›Drei Tage im September‹ (2023). Cay Rademacher lebt mit seiner Familie bei Salon-de-Provence.
CAY RADEMACHER
RÄTSELHAFTES SAINT-RÉMY
Ein Provence-Krimimit Capitaine Roger Blanc
Von Cay Rademacher sind bei DuMont außerdem erschienen:
Der Trümmermörder
Der Schieber
Der Fälscher
Mörderischer Mistral
Tödliche Camargue
Brennender Midi
Gefährliche Côte Bleue
Dunkles Arles
Verhängnisvolles Calès
Verlorenes Vernègues
Schweigendes Les Baux
Geheimnisvolle Garrigue
Stille Sainte-Victoire
Unheilvolles Lançon
Ein letzter Sommer in Méjean
Stille Nacht in der Provence
Die Passage nach Maskat
Drei Tage im September
Nacht der Ruinen
E-Book 2025
© 2025 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Karte: Kartografie Angelika Solibieda, Cartomedia Karlsruhe
Satz: Angelika Kudella, Köln
Lektorat: Leonora Tomaschoff
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1093-3
www.dumont-buchverlag.de
Et demain n’existe pas.
Der Tod kommt in die alte Stadt
Capitaine Roger Blanc lebte nun schon beinahe ein Jahr in der Provence und hatte in dieser Zeit eine Theorie über Morde entwickelt. Eine Theorie, die er allerdings besser für sich behielt, weil sie nach Aberglauben klang: Je schöner der Tatort, desto hässlicher das Verbrechen. Und der Tatort, zu dem sie an diesem Morgen gerufen wurden, war im ganzen Süden berühmt für seine Schönheit.
Seine Kollegen Marius Thonon und Fabienne Souillard saßen mit ihm im schweren Peugeot 5008 der Gendarmerie, während sie mit Blaulicht und Martinshorn über die Route Départementale 5 rasten. Blanc kannte die beiden inzwischen sehr gut, und doch fragte er sich, ob ihnen wohl je ähnliche Überlegungen durch den Kopf gegangen waren wie ihm. Vermutlich hätten sie seine Gedanken als seltsam unprofessionell empfunden. Ein Mord blieb ein Mord, ob er nun in einer modernen Villa im Luberon oder in einer heruntergekommenen Wohnung der Quartiers Nord von Marseille begangen worden war, und es war nun einmal der Job der Flics, eine Bluttat so schnell wie möglich aufzuklären. Also schwieg Blanc lieber.
Die Sonne stand tief im Osten, ihr Licht war gelb, sanft, schmeichelnd. Die älteren Einheimischen wie Marius, der ewige Provenzale, schwärmten vom Juni als dem schönsten Monat des Jahres, dem üppigen Frühlingsfinale, das noch nicht mehr als eine Vorahnung des glühend langen Sommers war. Doch eigentlich hatte es schon seit ein paar Jahren keinen milden Juni mehr gegeben. Es war erst der zehnte Tag des Monats, und der Wetterbericht von Météo France kündigte für die nächste Woche bereits Temperaturen von bis zu vierzig Grad an. Bauern und Zimmerleute würden in der Glut arbeiten, Schüler in saunaheißen Klassenräumen ihre Abschlussklausuren schreiben, Krankenschwestern wie Blancs Geliebte Paulette in Altersheimen und Hospitälern einen verzweifelten Kampf gegen die Dehydrierung ihrer Patienten führen – und Flics fuhren mit Vollgas zum Tatort, weil sie wussten, was diese Junisonne innerhalb weniger Stunden mit einer Leiche anrichtete.
Doch noch war die Morgenluft mild, die durch heruntergelassenen Seitenscheiben strömte und Blancs Stirn kühlte. Vor ihnen ragten die Alpilles auf, aus der Ferne wirkten sie wie Berge aus blauem Glas, fast glaubte man, durch sie hindurchsehen zu können. Mit jedem Kilometer, den er näher heranraste, schälten sich jedoch immer feinere Details aus dem dunstigen Frühlicht: graue Felsklippen, wohl zweihundert, dreihundert, vierhundert Meter hoch, mürbes Gestein, an den Hängen Wälder wie Flickenteppiche, weil der Boden zu steil und karg war, als dass die Bäume dicht an dicht wachsen könnten. Der Luftstrom trug den Duft von Aleppo-Kiefern und Pinien ins Auto. An den Berghängen, die bereits im Sonnenlicht badeten, erwachten die Zikaden. Ihr tausendfacher sägender Lockruf füllte die Täler und übertönte sogar das Grummeln des schweren Dieselmotors. Die Garrigue blühte, weiße, violette, gelbe, rote Farbkleckse leuchteten im Gesträuch. Aus den Augenwinkeln sah Blanc einen Schatten, der unter einem Ginster verschwand, vielleicht ein Kaninchen oder ein Fuchs, ein flinkes Tier jedenfalls, das erschrocken vor dem Streifenwagen flüchtete, der nun mit quietschenden Reifen die Serpentinen im Vallon de Notre-Dame-de-Laval erklomm, ein Tal, das sich wie eine Schneise quer das Gebirge zog. Er schaltete das Martinshorn ab, endlich waren sie allein auf der Straße.
Ihr Ziel war Glanum, eine antike Stadt am Nordrand der Alpilles, das Pompeji der Provence, griechische und römische Ruinen. Musste ganz toll sein, Blanc hatte schon viel davon gehört, wollte mit Paulette auch immer mal hin, aber wie das so war: Sie hatten nie Zeit gefunden. Er seufzte so leise, dass die Kollegen es nicht hörten. Jetzt würde er vermutlich mehr als genug Zeit haben, sich dort umzusehen.
Der Notruf war vor etwas mehr als einer halben Stunde eingegangen, die Direktorin von Glanum hatte die Gendarmerie alarmiert. Die Ruinen lagen nur einen Steinwurf von Saint-Rémy entfernt, dem populärsten Touristenort der ganzen Region. Da viele Besucher zu den antiken Stätten strömten, wurden die Zugänge bereits am frühen Morgen aufgeschlossen. Die Direktorin hatte, offenbar war das Routine, zuvor einen Kontrollgang gemacht – und war dabei auf einen Toten zwischen den Ruinen gestoßen. Die Frau hatte am Telefon ziemlich gefasst gewirkt. Sie wusste auch, wer der Tote war: Gaspard Rouge, achtundzwanzig Jahre alt, ein Archäologe der Sorbonne, der vor zwei Wochen mit Kollegen aus Paris angereist war, um in Glanum Grabungen durchzuführen.
»Können Sie mir irgendeinen Hinweis auf die Todesursache geben?«, hatte Blanc die Anruferin gefragt. Einen Augenblick lang hatte er die Hoffnung gehabt, nun ja, »Hoffnung« mochte zynisch klingen, aber, ja doch, die Hoffnung gehabt, dass es sich um einen Unfall handeln könnte, denn Unfälle waren zwar tragisch, doch taten sich da nicht solche menschlichen Abgründe auf wie bei Morden. Ein junger Archäologe bei der Arbeit, mon Dieu, vielleicht war er unaufmerksam gewesen und von einer Klippe gestürzt oder von einer umstürzenden antiken Säule erschlagen worden oder was auch immer.
»Die Wunde am Kopf sieht für mich aus wie ein Axthieb oder ein Einschuss«, hatte die Direktorin ruhig geantwortet, »jedenfalls ist alles voller Blut.«
Schöner Tatort, hässliches Verbrechen, eh merde.
Irgendwann wurde Blanc das Schweigen seiner beiden Mitfahrer dann doch zu belastend. »Warum ermordet man einen Archäologen bei der Ausgrabung?«, murmelte er. Das war, wenn man es genau nahm, eine idiotische Frage, denn was sollten seine Kollegen schon darauf antworten? Mon Dieu, irgendetwas mussten sie sagen.
Fabienne bequemte sich zu einem »Wir werden es ja gleich sehen. Es sind nur noch zwei oder drei Kilometer«. Sie war schwanger, sie wollte fort aus dem Süden, ihre Ehe kriselte – eine frische Leiche war so ziemlich das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte.
»Ist ja nicht mal sicher, dass der Kerl ermordet wurde«, brummte Marius. »Du kannst auch auf anderen Wegen mit blutigem Schädel in die Ewigen Jagdgründe wandern, Selbstmord zum Beispiel.« Er kratzte sich am Kopf und brachte sein ungekämmtes schwarzes Haar noch mehr in Unordnung. Unter seinen Augen lagen dunkle Ringe, er trug ein Hawaiihemd in schrillsten Farben, das hatte ihm seine Lebensgefährtin Soumia garantiert nicht herausgelegt.
Fabienne ist angeschlagen, und Marius wird doch nicht etwa verkatert sein? Blanc musste sich eingestehen, dass er nicht gerade mit der besten Gendarmerietruppe Frankreichs anrückte.
Über Funk meldete sich ein Beamter der Police Municipale von Saint-Rémy. »Wir haben das Gelände abgesperrt, mon Capitaine«, berichtete er. »Aber Sie können direkt bis zum Eingang von Glanum fahren. Wir haben einen Code D-C-D.«
Code D-C-D, auch das noch, dachte Blanc. Sprach man die Buchstaben schnell hintereinander aus, dann klang es wie décédé, »verstorben« – Flics, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter benutzten diese Abkürzung, wenn Menschen in der Nähe waren, denen man diese Wahrheit nicht zumuten wollte.
»Bei mir sitzt niemand im Auto, der nicht hierhergehört«, versicherte er. »Schießen Sie los: Was wissen Sie?«
»Schießen ist das richtige Stichwort«, antwortete der Polizist. »Das sieht verdammt nach Kopfschuss aus, direkt in die rechte Schläfe.«
»Das zu den vielen Wegen in die Ewigen Jagdgründe«, flüsterte Blanc und blickte zu Marius hinüber.
Der zuckte mit den Achseln. »Bleibt immer noch Suizid als Möglichkeit.«
»Liegt eine Waffe neben dem Toten?«, wollte Blanc über Funk wissen.
»Ich glaube nicht. Wir haben zumindest noch keine gefunden.«
»Putain«, fluchte Marius, als sei es die Schuld des Opfers, von fremder und nicht von eigener Hand getötet worden zu sein.
Blanc beschloss, den Ausbruch seines Kollegen zu ignorieren. »Gibt es einen Verdächtigen, eine heiße Spur, gar einen Verhafteten?«
»Die Direktorin des Museums hat die Leiche heute Morgen gefunden und die 17 gewählt. Sie war die einzige Person weit und breit. Den eingetrockneten Blutspuren nach zu urteilen wurde der Mann aber schon vor einigen Stunden erschossen, irgendwann in der Nacht, vermute ich. Und Spuren? Eh bien, hier sieht alles aus wie immer.«
»D’accord, Kollege, vielen Dank, gute Arbeit«, gab er durch. »Noch handelt es sich nur um eine Voruntersuchung der Gendarmerie, aber das ist nur eine Formsache. Der Staatsanwalt wird sicher eine Enquête de flagrance einleiten, volle kriminalistische Ermittlungen, das ganze Programm: Spurensicherung, Gerichtsmedizin und, das lässt sich wohl kaum vermeiden, dann auch die Presse. Wir brauchen Parkplätze für mehrere Streifenwagen, den Transporter der Spurensicherung, das Auto der Rechtsmedizinerin, den Leichenwagen. Gleichzeitig dürfen die Reporter nicht zu nahe herankommen. Sie müssen den Zugang also filtern können. Glanum liegt nicht mitten in der Stadt, sondern am Rand der Alpilles, richtig?«
»Ja, mon Capitaine, die Ruinen erstrecken sich in einem Tal, das in die Berge hineinreicht. Ziemlich einsam, obwohl man von Saint-Rémy aus zu Fuß hinkommen kann.«
»Dann müssen Sie nicht bloß die Straße und den Haupteingang absperren, sondern auch die Wanderwege in der Umgebung, die Wälder, die Garrigue, einfach alles. Niemand darf sich auf Umwegen dem Tatort nähern. Vielleicht brauchen wir auch Planen, Zelte, irgendeine Form von Sichtschutz.«
»Das … nun, ich habe bloß ein paar Leute.«
»Ich fordere Verstärkung an. Und bis dahin nehmen Sie jeden, den Sie kriegen können: Arbeiter vom städtischen Bauhof, die Sekretärin des Bürgermeisters, wen auch immer.«
»Wird gemacht!«
»Ich glaube, ich kann Glanum schon erkennen. Wir sind gleich da.«
»Ja, ich sehe Ihr Blaulicht.« Der Beamte klang sehr erleichtert.
Es war kurz vor zehn Uhr, sie hatten fast eine Dreiviertelstunde von Gadet gebraucht. Vögel sangen im Wald neben der Straße, doch sie flogen nicht: Fast hätte Blanc geglaubt, ein künstliches Gezwitscher aus versteckten Lautsprechern zu hören, es war beinahe zu laut, zu intensiv, zu lebensfroh. Er fragte sich flüchtig, wo sich all diese Vögel verstecken mochten, ob sie wohl brüteten, balzten, jagten, oder ob dieser Lärm nicht so etwas wie das Nachrichtengeflecht der Tiere war, ein ständiger Informationsaustausch über Wipfel und Buschwerk hinweg. Vielleicht waren die Vögel bloß aufgeregt, weil letzte Nacht das schlimmste Raubtier auf Erden sein Unwesen getrieben hatte: der Mensch. Du bist kein Dichter, ermahnte sich Blanc dann, konzentriere dich auf das, was du kannst.
Der kurze Zufahrtsweg wurde von zwei uniformierten Beamten aus Saint-Rémy kontrolliert, die den Streifenwagen durchwinkten. Blanc konnte noch ein paar Meter weiterfahren, bis er die Route Départementale nicht mehr sah, dann hielt er an einer Barriere neben einem kleinen weißen Suzuki-Geländewagen der Police Municipale und sah sich um: Glanum lag eingebettet in einem schmalen, wenige Hundert Meter langen Tal, das nach Süden hin anstieg. Er sah jenseits der modernen Umzäunung brusthohe Steinmauern, Säulen, mit Steinplatten gepflasterte uralte Straßen und Plätze. Die Ruinen waren so grau wie die Felsen der Alpilles, die Griechen und Römer hatten vermutlich ihr Baumaterial aus Steinbrüchen irgendwo in der Nähe geholt. Zuerst mussten die Besucher ein modernes, flaches Gebäude durchqueren, in dem sich die Kasse befand, der unvermeidliche Souvenirshop, neben dem, bemerkte Blanc flüchtig, einige Architekturmodelle standen, die wohl zeigen sollten, wie Glanum einst ausgehen hatte.
Neben den Modellen wartete ein weiterer Beamter der Police Municipale auf sie. Er war etwa vierzig Jahre alt, hatte den Körper und den Stiernacken eines durchtrainierten Rugbyspielers und die schwarzen Haare und den dunklen Teint eines Südseeinsulaners. Polynesier, dachte Blanc, auf welchen verschlungenen Pfaden des öffentlichen Dienstes war wohl jemand von Papeete bis nach Saint-Rémy gekommen? Auf seinem Namensschild las er: Jean-Marc Tuaiva, seine Schultern zierten die drei Streifen des Chefs de Service Principal, er war der Anrufer von vorhin gewesen. Er schüttelte Blanc und seinen Kollegen die Hand, Tuaivas Griff war wie ein Schraubstock, mon Dieu, der Mann würde es schon schaffen, die Schaulustigen von Glanum fernzuhalten.
»So etwas haben wir hier noch nie gehabt«, sagte Tuaiva und klang dabei beinahe entschuldigend. »Bei uns besteht die Kriminalität eigentlich aus Taschendieben, die es auf Touristen absehen, Jugendlichen, die mal ein Bier zu viel getrunken haben, und Bauern, die sich um das Wegerecht auf ihren Feldern streiten.«
»Kennen Sie das Opfer?«
Tuaiva hob die mächtigen Schultern. »Das wäre übertrieben zu sagen. Ich habe die Archäologen hin und wieder gesehen, seit sie hier graben, aber ich habe kaum mehr als ein ›Salut‹ mit ihnen gewechselt. Das sind ruhige, unauffällige Leute, sympathisch, fleißig. Die kriechen den ganzen Tag zwischen den Ruinen herum, denen macht die Hitze nichts aus. Vielleicht kann Ihnen die Direktorin der Anlage mehr zu dem Mann sagen.«
»Die Dame, die den Toten gefunden und den Notruf abgesetzt hat?«
»Sie wartet im Büro hinter der Kasse. Sie ist … Nun, Madame musste sich sammeln.«
»Verstehe ich. Den Anblick eines Toten vergisst man nicht so schnell«, erwiderte Fabienne. Sie war blasser als sonst und wirkte bereits erschöpft.
»Du musst nicht …«, begann Blanc.
»Mon Capitaine, ich weiß genau, was du jetzt sagen willst, und meine Antwort lautet: Natürlich komme ich mit.«
Tuaiva sah Fabienne einen Moment lang erstaunt an, räusperte sich und führte sie in einen kleinen Raum. Das einzige Fenster stand offen und ließ bereits unangenehm aufgeheizte Luft herein, noch nicht die angedrohten vierzig Grad, aber sicher schon dreißig. Neben dem Fensterbrett stand eine Frau und rauchte eine E-Zigarette. Bläulicher Qualm stieg auf, süßlich duftend nach irgendeinem künstlichen Aroma, mon Dieu, sollte das Erdbeere in der Zigarette sein? Die Frau war groß und schlank, in ihrem langen schwarzen Haar schimmerten einzelne graue Strähnen, auch ihre Augen leuchteten grau, ihre Nase war etwas zu prominent, ihr Mund etwas zu klein, um dem Ideal eines Fotomodels zu entsprechen, doch Blanc, der ihr Alter auf etwa fünfzig Jahre schätzte, fand sie trotzdem – oder vielmehr: gerade deswegen – sehr schön. Sie war ungeschminkt, trug Jeans und eine ockerfarbene, gemusterte Bluse von Souleiado mit jener Selbstsicherheit, die nur Frauen ausstrahlen, die sich ihr ganzes Leben lang elegant gekleidet haben.
»Endlich! Gut, dass Sie da sind.« Sie legte ihre Zigarette quer über einen Aschenbecher, der mit einem, dem Design nach, ziemlich alten Werbeslogan des Office du Tourisme von Saint-Rémy beschriftet war, ging auf Blanc zu und schüttelte ihm die Hand, anschließend auch Marius und Fabienne. Sie duftete dezent nach einem leichten Parfum. »Ich bin Milène Oreal.«
»Die Situation ist sicher sehr schwierig für Sie, Madame«, begann Blanc, nachdem die Vorstellung beendet war, »doch wir würden es sehr schätzen, wenn Sie uns behilflich sein könnten.«
»Ich tue alles, was in meiner Macht steht.« Milène Oreal wirkte mitgenommen, aber gefasst – und durchaus neugierig, was ein gutes Zeichen war, dachte Blanc. Die wird nicht gleich in Ohnmacht fallen, und klug ist sie vermutlich auch. Eine gute Zeugin.
»Wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen. Und wir möchten, dass Sie uns zu dem Toten führen.« Natürlich hätte er auch Tuaiva bitten können, doch Blanc wollte die Gelegenheit nutzen: Milène Oreal war die Direktorin von Glanum, das war ihr Reich. Mit dem, was sie sagte, wie und auf welchen Wegen sie sich bewegte, würde sie ihm unbewusst – anders konnte er es nicht formulieren – ein Gefühl für diesen Ort geben. Es war eine Sache, mit der Navigationsapp eines Handys vor der Nase einen Weg zurückzulegen, und eine ganz andere, einen Ort wirklich zu ergehen. Und Blanc glaubte bereits jetzt, dass dieser Tatort nicht zufällig gewählt worden war: Glanum könnte etwas mit dem Verbrechen zu tun haben, vielleicht verbarg sich in den Ruinen gar das Motiv für den Mord. Zumindest wollte er sich die Chance auf überraschende Erkenntnisse nicht entgehen lassen, falls es wirklich so war.
Milène Oreal zögerte kurz, holte tief Luft und zwang sich zu einem Lächeln. »Selbstverständlich, Capitaine. Ich zeige Ihnen, wo Gaspard liegt.«
»Gaspard?«
Wieder lächelte sie, diesmal echt und ein wenig wehmütig. »Hier im Team duzen wir uns alle. Und die drei Archäologen aus Paris sind zwar nur für ein paar Wochen vor Ort, aber sie sind halt Profis und gehören irgendwie dazu. Wenn Sie mir nun folgen wollen?«
»Bitte nehmen Sie denselben Weg, den Sie heute Morgen genommen haben, Madame. Die Runde, die Sie durch den Ort machen, bevor Sie aufschließen.«
»Selbstverständlich. Von einigen wenigen Nebenwegen abgesehen gibt es sowieso nur einen Zugang, und der hat sich seit mehr als zwei Jahrtausenden kaum verändert: über die antike Hauptstraße.«
Sie verließen das Gebäude durch die Hintertür, die zum antiken Ausgrabungsgelände führte. Auf einer Steinbank saßen dort zwei junge Leute, ein Mädchen und ein Junge, noch keine zwanzig, dachte Blanc. Beide sprangen erschrocken auf, als sie die Gendarmen erblickten. Die junge Frau trug einen breitkrempigen, geschwungenen Strohhut, unter dem ihre langen blonden Haare hervorquollen, sie hatte milchweiße Haut (mon Dieu, dachte Blanc, der selbst schon leidvolle Erfahrungen im Midi gemacht hatte, wie schützt sie sich vor Sonnenbrand, geht das allein mit diesem übergroßen Hut?), blaue Augen, einen vollen Mund, die Lippen rot gefärbt, zum Küssen schön, und fast dieselbe prominente Nase wie Milène Oreal, denselben schlanken, langen Körper, ja, sie hatte dieselbe Art, sich zu bewegen. Der Junge an ihrer Seite war noch größer als sie, ebenfalls sehr schlank, dabei muskulös, er hätte Basketballer oder Volleyballer sein können, die dunklen Haare fielen ihm in die Stirn und bis in die Augen, sodass er beinahe wie maskiert wirkte.
»Meine Nichte Féline Chapot und ihr Freund Olivier Taix«, stellte die Direktorin vor. »Sie sind noch auf dem Lycée, aber jetzt ist Klausurenzeit, da haben sie einzelne Tage frei und helfen an der Kasse aus.«
»Sind Sie gemeinsam mit Ihrer Tante angekommen, Mademoiselle?«, fragte Blanc.
»Nein.« Féline schüttelte rasch den Kopf und warf ihrem Freund einen Blick zu, als wolle sie sagen: ›Nun rede du schon!‹ Doch der schwieg, und hinter dem Vorhang seiner Haare glaubte Blanc, einen abweisenden, gar misstrauischen Blick zu erkennen.
»Féline und Olivier sind kurz nach mir angekommen, wie immer«, erklärte die Direktorin, zögerte, korrigierte sich dann. »Das heißt, Féline kam nach mir an, ihr Freund war mit seinem Motorroller schon da.« Sie deutete auf eine rote Vespa, die neben einer Zypresse stand. »Aber er hat vor dem Eingang auf mich gewartet. Die jungen Leute haben, eh bien, die schreckliche Szene in den Ruinen nicht gesehen, und es wäre mir recht, wenn das auch so bliebe. Ich habe den beiden gesagt, Sie sollen wieder nach Hause gehen, doch Monsieur Tuaiva …«
»Sie haben selbst angeordnet, dass ich jeden nehmen soll, den ich kriegen kann, mon Capitaine«, fiel der Polizist ein. »Also dachte ich, da Féline und Olivier sowieso an der Kasse arbeiten, können sie sich um diesen Bereich kümmern und Neugierige fernhalten. Ich kenne die beiden, sie sind sehr zuverlässig und gewissenhaft. So habe ich zwei Beamte frei, die ich ins Umland schicken kann.« Er deutete auf die bewaldeten Hügel, die den gesamten südlichen Teil von Glanum wie steil ansteigende Theaterränge umschlossen. Von dort hatte man sicher einen guten Blick auf die Ruinen, sie würden früher oder später Schaulustige anziehen.
»Gute Idee.« Blanc nickte Féline und Olivier zu. »Sie halten hier vorerst die Stellung. Begeben Sie sich bitte in das Gebäude, während Ihre Tante mit uns durch die Ruinen geht. Vermutlich werden Polizei und Gendarmerie das Gelände weiträumig absperren, und kein Neugieriger sollte es bis zur Kasse schaffen, aber man kann nie wissen. Wahrscheinlich wird es auch Anrufe geben. Vielleicht vom Bürgermeister, von der Untersuchungsrichterin, von anderen offiziellen Stellen. Die nehmen Sie an und notieren sich deren Anliegen. Wir kümmern uns später darum. Journalisten werden möglicherweise versuchen, Ihnen Informationen zu entlocken. Die wimmeln Sie ab.«
»Sie können sich auf uns verlassen«, erwiderte Féline eifrig. Ihr Freund hatte noch immer kein einziges Wort gesagt, er nickte nicht einmal.
Blanc und seine Kollegen folgten Milène Oreal auf einem Weg, der vom Empfangsgebäude über eine Felskuppe bis hinunter zum Talgrund führte. Als sie näher kamen, erkannte Blanc kleine weiße Muscheln, die in dem antiken Mauerwerk eingeschlossen waren. So etwas hatte er in den Alpilles schon öfter gesehen. Das Gebirge war vor Äonen der schlammige Grund eines Ozeans gewesen, bevor gewaltige tektonische Kräfte es zu Stein gebacken und aufgefaltet hatten. Und selbst ein archäologischer Laie wie er erkannte auf den ersten Blick die Hauptstraße, von der die Direktorin gesprochen hatte. Sie zog sich wie ein Rückgrat längs durch das Tal, war breit wie eine moderne Route Départementale, mit polierten Steinplatten gepflastert. An manchen Stellen waren links und rechts noch Bürgersteige erhalten, andernorts gaben aufgeplatzte Steinplatten den Blick frei auf Entwässerungskanäle, die vor zwei Jahrtausenden unter der Straße verlaufen waren. Blanc dachte an die vielfach geflickten Asphaltbänder, die sich durch manche provenzalischen Dörfer wanden, und musste zugeben, dass an dem Klischee, früher sei alles besser gewesen, offenbar doch etwas dran war.
Er blieb vor einem der vielen nummerierten Hinweisschilder stehen und studierte es kurz. Dann bat er Milène Oreal mit einer Geste zu sich und deutete auf den Infotext.
»Diese Schautafeln stehen doch nicht erst seit gestern hier«, bemerkte er. »Das Eingangsgebäude, die Parkplätze, das muss alles schon vor Jahren gebaut worden sein. Seit wann ist Glanum ein Freilichtmuseum?«
»Die ersten Grabungen begannen vor mehr als einem Jahrhundert. Und so, wie Sie das jetzt alles sehen, existiert es seit beinahe fünfzig Jahren.«
»Wenn hier seit fünfzig Jahren jedermann herumspazieren kann – was haben Archäologen dann noch zu tun?«, wunderte sich Blanc. »Forscher graben Neues aus, sie entdecken etwas. Aber hier liegt doch schon alles frei!«
Die Direktorin schüttelte lächelnd den Kopf. »Das, was Sie, wie jeder Besucher, sehen können, ist schätzungsweise ein Zehntel der antiken Siedlung. Gewissermaßen die Altstadt und die Innenstadt der Griechen und Römer. Alles andere«, sie vollführte mit ihrer rechten Hand einen Halbkreis von den Alpilles im Süden bis nach Saint-Rémy im Norden, »ist noch nicht ausgegraben. Und selbst der Teil von Glanum, in dem Sie und ich gerade stehen, wird immer noch erforscht. Hier haben die Archäologen noch für Generationen zu tun, Capitaine. Kommen Sie.«
Während er Milène Oreal folgte, fügten sich die Trümmer zu beiden Seiten der Hauptstraße für ihn nach und nach zu einem Muster zusammen. Er erkannte Hausmauern, Eingänge, von Säulen umsäumte Innenhöfe, in denen einst Springbrunnen – oder waren es gar antike Schwimmbecken? – geplätschert hatten. Sie passierten einen massiven Bau mit auffallend gut erhaltenen Mauern, fünf, sechs Meter hoch. Vielleicht, so vermutete er, war es einmal eine Gerichtshalle oder das Rathaus gewesen, jedenfalls wirkte es auch heute noch offiziell und irgendwie einschüchternd. Die fein aus Steinblöcken gemeißelten Säulen eines Tempels mussten vor nicht allzu langer Zeit gereinigt und wieder zu alter Pracht aufgerichtet worden sein, sie leuchteten heller, beinahe weiß, wirkten fast wie neu und sahen doch fragil aus. An einer Stelle lagen Gesimse nebeneinander auf dem nackten Boden, wuchtige, mit Reliefs verzierte Mauersteine – als hätte sie in der Antike ein Steinmetz für Kunden bereitgelegt, die das Material nie abgeholt hatten. Vielleicht waren ja vorher die Barbaren gekommen, dachte Blanc.
»Das sind die Thermen, wir haben sie vor einiger Zeit restauriert«, sagte Milène Oreal und deutete auf eine Reihe großer und kleiner steinerner Becken zu ihrer Linken. »Aus den Brunnenmasken sprudelte in der Antike das Wasser. Gelungene Kopien, finden Sie nicht? Die Originale sind inzwischen von der Verwitterung bedroht und stehen heute im Hôtel de Sade in Saint-Rémy. In dem Museum sind alle kleineren Funde aus Glanum ausgestellt. Lohnt einen Besuch. Es sind fantastische Relikte, sie …« Sie errötete leicht, weil ihr erst jetzt wieder einfiel, wer ihre Besucher waren und warum sie hier herumgeführt wurden. »Verzeihen Sie meine Taktlosigkeit. Mich begeistern diese alten Hinterlassenschaften auch nach all den Jahren, in denen ich mit ihnen arbeite, immer noch so sehr, dass ich selbst dann ins Schwärmen gerate, wenn es unpassend ist.«
»Das macht gar nichts, Madame, im Gegenteil.« Blanc mochte Menschen, die für etwas brannten, und scheiß drauf, wenn es unpassend war. Er besah sich die steinernen Brunnenmasken, die für ihn authentisch antik aussahen. (Flüchtig überlegte er, ob das vielleicht ein Mordmotiv sein könnte: Täuschend echt nachgebildete antike Skulpturen, vielleicht wollte sie jemand stehlen, ein Archäologe, der noch spät arbeitete und Einbrecher überraschte, er musste diese Möglichkeit im Hinterkopf behalten …) Die Masken waren Fratzen, ein alter Mann und eine Frau unbestimmbaren Alters, die Gesichtszüge grotesk verzerrt, die Münder, aus denen Wasser sprudeln sollte, auf ewig zu einem stummen Schrei geöffnet. Ihn schauderte, warum stellten sich die Römer solche Schreckensbilder an den Pool?
»Glanum verdankt seine Existenz dem Wasser«, riss ihn die Direktorin aus seinen Gedanken. »Am südlichen Ende des Tals, dort, wo es eng wird und zu den Alpilles hin ansteigt, entspringt eine Quelle, die schon den Kelten, den ursprünglichen Bewohnern, heilig war. Leider«, sie atmete tief durch, »wurde Gaspard ausgerechnet an diesem außergewöhnlichen Ort ermordet.«
Blanc erwiderte darauf nichts. Bevor sie diese höher gelegene Engstelle erreicht hatten, hielt er noch einmal inne und blickte zurück auf die antike Stadt. Zwischen den Ruinen standen weit ausladende Judasbäume. Ihre mächtigen Wipfel mit den hellgrünen Blättern beschatteten die Monumente, zwischen den Zweigen leuchteten die Samenschoten so rot wie Blüten. Rot leuchtete auch der Mohn, der hier und da aus den Ritzen des Hauptstraßenpflasters, ja sogar aus Mauerstümpfen und steinernen Beckenumrandungen hervorlugte. Aus dieser leicht erhöhten Position sah Glanum wie mit Blutstropfen gesprenkelt aus. Es duftete nach Blüten, aber er konnte nicht entscheiden, welche Blume die Luft so intensiv parfümierte. Und dann erst fiel ihm auf, dass es unfassbar still war. Kein Vogelgesang mehr, kein Rauschen einer Windböe in den Judasbäumen, kein Steinchen, das leise klappernd einen Hang hinunterrollte. Auch das war Blanc schon oft aufgefallen, auch darüber mochte er mit niemandem reden, weil ihn keiner verstanden hätte: Je schlimmer das Verbrechen, desto stiller der Tatort.
Blanc konnte sich gut vorstellen, dass die Quelle von Glanum für die antiken Bewohner ein magischer Ort gewesen war: Der felsige Boden stieg hier schon recht eindrucksvoll an, das Tal war auf ein, zwei Dutzend Meter Breite zusammengeschnürt, schon beinahe ein Canyon zwischen steil aufragenden, schroffen Klippen. Die Berge wirkten abweisend, karg und vor allem trocken. Doch auf der linken Talseite, direkt am Fuß eines Berges, glitzerte tief in einer Felsspalte Wasser in der Morgensonne. Schon in der Antike hatten die Bewohner einen aus großen, sorgfältig behauenen Steinen gemauerten Schacht etwa fünf Meter bis zu dieser Wasserstelle hinuntergetrieben. Ein Bogen wölbte sich noch darüber, vermutlich war die Quelle einst komplett überbaut worden. Heute zeichnete die Sonne eine scharfe, schräge Schattenlinie auf die Mauern, hier und da wuchsen Grasbüschel aus den Fugen, die untersten Steinreihen waren mit einem Pelz aus grünlichem Moos überzogen. Die Luft im Schacht roch süßlich und war so feucht, dass Blanc, als er sich von oben darüber beugte, das Gefühl hatte, in flüssiger Atmosphäre zu atmen. Treppenstufen führten von der antiken Straße hinunter zum Wasser.
Es war eine Quelle, die, wie Blanc bei näherer Betrachtung feststellte, eher unheilig wirkte. Unten schwappte eine träge algengrüne Suppe, in der doch tatsächlich faule Goldfische schwammen – gänzlich unbeeindruckt von der Leiche, die auf den untersten Stufen lag, den rechten Arm ausgestreckt, die Hand wurde vom Wasser benetzt.
Gaspard Rouge musste zu Lebzeiten ein attraktiver Mann gewesen sein: Mit weit aufgerissenen braunen Augen schien er den Schacht hinauf zu ihnen und bis in den fernen Himmel zu starren. Sein halblanges braunes Haar war leicht gewellt, er hatte markante Jochbeine, eine aristokratische Nase, einen sinnlichen Mund, er war mittelgroß und sportlich, trug T-Shirt, Jeans und Trekkingschuhe.
Blanc wäre am liebsten sofort zu dem Toten hinuntergestiegen, doch er bezwang seine Ungeduld und wartete auf die Kriminaltechniker. Die würden in ihren weißen Ganzkörperschutzanzügen kommen, die Umgebung des Opfers gewissenhaft nach Spuren absuchen – erst dann durften Blanc und seine Kollegen und mit ihnen die Gerichtsmedizinerin Fontaine Thezan sich der Leiche nähern. Bis dahin blieb ihnen nichts anderes übrig, als von oben auf den Unglücklichen zu starren. Es waren bloß fünf Meter, das Sonnenlicht schien inzwischen grell, man sah mehr Einzelheiten, als einem lieb war.
»Ich stehe ja nicht auf Männer, aber ich muss zugeben, dass er sogar besser aussieht als Indiana Jones in seinem ersten Film«, sagte Fabienne.
Blanc musterte sie verstohlen. Sie gab sich cool, um ihre Erschütterung zu verbergen: Der Tote war in ihrem Alter, so etwas konnte jeden umhauen. Gaspard Rouge lag so auf den Treppenstufen, dass sein Hinterkopf auf den Steinen ruhte. In seiner rechten Schläfe klaffte ein beinahe kreisrundes Loch, die Haut am Rand war blutig und schwarz verfärbt, wie verbrannt. Aus dem Loch war ein kleines, inzwischen eingetrocknetes Rinnsal Blut bis auf die Stufen geflossen. Seine linke Schläfe war eine Masse aus Fleisch, Knochensplittern und blutverklebten Haaren. Auf dem Boden hatte sich eine riesige Lache ausgebreitet, und auf die Wände des Schachtes waren Schleier aus winzigen roten Tropfen gespritzt.
»Einschuss in der rechten Schläfe, Austritt der Kugel aus der linken«, vermutete Marius. Er wirkte traurig, irgendwie resigniert, als er sich umwandte und in Richtung Hauptstraße blickte. Milène Oreal war schon wieder von der Treppe zurückgetreten und neben der Ruine eines kleinen Tempels am Rand des Quellenheiligtums stehen geblieben. »Wissen Sie, ob Gaspard Rouge Rechts- oder Linkshänder war?«, fragte Marius.
Sie brauchte ein, zwei Sekunden, um den Sinn der Frage zu begreifen, zu sehr hatte sie der erneute Anblick der Leiche erschüttert. »Rechtshänder, glaube ich«, antwortete sie zögernd, dann entschiedener: »Ja, Rechtshänder. Ich erinnere mich, dass er mit der rechten Hand geschrieben hat. Gaspard hat sich ständig Notizen gemacht, er hatte immer mehrere Hefte bei sich.«
»Ein lebensmüder Rechtshänder würde sich die Kugel in die rechte Schläfe schießen«, brummte Marius.
Blanc ignorierte ihn vorerst und betrachtete den Toten. Mochte sein, dass sich in der Tasche seiner Jeans noch ein Notizblock verbarg, das würden die Spurensicherer herausfinden. Aber sonst gab es hier nichts, worauf er einen Abschiedsbrief hätte schreiben können. Er beugte sich weiter über den Schacht, kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Auf Rouges rechter Wange, vielleicht drei Zentimeter unterhalb des Einschusslochs, schimmerte ein weiterer kleiner roter Fleck von unbestimmbarer Form, doch schwächer leuchtend, zudem schien er stärker eingetrocknet zu sein. Eine ältere Schürfwunde? Ein Sonnenbrand? Eine Allergie? Fontaine Thezan würde sich darum kümmern, vielleicht hatte es nichts zu bedeuten, vielleicht doch.
Nach und nach traf die von Blanc angeforderte Verstärkung ein. Gendarmen postierten sich am Rand von Glanum, man sah blaue Uniformen zwischen den Aleppo-Kiefern an den Hängen der Alpilles. Schließlich stapften die Techniciens en identicifation criminelle in ihren Raumanzügen heran, beladen mit ihren Koffern und Kameras und ihrem Misstrauen gegenüber all den Stümpern, die unabsichtlich Tatorte kontaminierten und Spuren verwischten. Blanc begrüßte Saad Ben-Rouijal, den Leiter der Einheit. Der schob seine Brille von der Nasenspitze um eine Winzigkeit nach oben und äugte dann missmutig über die Mauern bis in den Schacht hinunter.
»Wir müssen mitten durch«, sagte er unzufrieden.
Mon Dieu, seine Stimme klang von Mal zu Mal heiserer, irgendwann würde sich Ben-Rouijal während eines Einsatzes ein Stimmband reißen. Blanc ahnte, warum der Kollege unzufrieden war: Normalerweise näherten sich Kriminaltechniker einem Verbrechensopfer auf Umwegen, um möglichst wenig Spuren zu verwischen. Hier aber gab es nur die Route, die auch Täter und Opfer genommen haben mussten: die Steintreppe nach unten.
»Tut mir leid, dass es ein schwieriger Job wird«, antwortete er. »Durch Glanum laufen täglich Hunderte von Besuchern, und Sie sehen ja, dass die Treppe nicht abgesperrt ist: Die können alle bis ans Wasser gehen.«
Ben-Rouijal blickte nachdenklich zum Himmel. »Und es hat seit Wochen nicht geregnet«, ergänzte er. »Ein ordentlicher Schauer vor ein, zwei Tagen hätte viele ältere Spuren vernichtet und für uns die Tafel gewissermaßen freigewischt. Aber so werden wir Fingerabdrücke, Haarspuren und was auch immer von Hunderten Menschen aus den letzten Wochen oder gar Monaten finden.« Er starrte immer noch von oben auf die Leiche. »Sieht nach Durchschuss aus«, brummte er. »Hoffentlich finden wir die Kugel. Vielleicht steckt sie in einem Stein. Aber wenn sie als Querschläger herumgeflogen ist, dann liegt sie jetzt möglicherweise im Wasser.« Nun betrachtete er die Goldfische mit, wie es Blanc schien, deutlich mehr Abscheu als den Toten. »Wissen Sie, wie tief die Quelle ist?«
»Sie werden es herausfinden.«
Ben-Rouijal brummte eine Antwort, die Blanc glücklicherweise nicht mehr verstand, weil sich der Spezialist eine Maske vors Gesicht zog. Danach stülpte er sich die Kapuze über den Kopf, streifte sich Handschuhe über und winkte einige Kollegen heran. »Dann wollen wir mal.« Seine Stimme klang dumpf.
Die nächste gute Stunde wartete Blanc geduldig, während die Kriminaltechniker Fotos machten, mal hier, mal dort am Boden oder an der Wand des Schachts etwas markierten oder abkratzten, ohne den Toten je zu berühren. Da ihm aber niemand von dort unten ein Zeichen gab, schienen sie nichts Sensationelles zu entdecken. Fabienne saß auf einer Steinmauer im Schatten eines Judasbaums und tippte wie wild auf ihrem iPhone herum. Vermutlich viele private Nachrichten, vermutlich mit ihrer Frau, und ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen vermutlich keine neckischen Scherze. Marius hatte sich hingesetzt und lehnte an einem Stein, in den eine lateinische Inschrift eingemeißelt war – eine Weiheinschrift für Herkules, wie Blanc einer Schautafel entnahm, was auch immer der antike Muskelprotz ausgerechnet in Glanum zu suchen gehabt hatte. Marius schnarchte, merde, der Kerl war wirklich weggetreten. Milène Oreal warf ihm einen irritierten Blick zu, Blanc versetzte ihm einen Stoß.
»Nimm dich zusammen«, zischte er.
»Ich nehme meine Kräfte zusammen«, verteidigte sich Marius gähnend und nicht im Geringsten verlegen. »Das solltest du auch tun, bis Ben-Rouijal fertig ist.«
»Ich nutze meine Zeit«, erwiderte Blanc, zog seinen zerfledderten Notizblock und einen angekauten Bleistift aus einer Tasche seiner Jeans und ging zur Direktorin hinüber. »Was können Sie mir noch über Gaspard Rouge sagen? War dies seine erste Grabung in Glanum? War er vorher schon mal in der Gegend, privat oder beruflich?«
»Soweit ich weiß, war Gaspard das erste Mal hier«, erwiderte Milène Oreal. »Ganz sicher bin ich mir nicht, Saint-Rémy ist ja immer voller Besucher, also vielleicht war er auch schon mal privat hier, aber er hat nie davon erzählt. Als Archäologe jedenfalls war das definitiv sein erster Besuch.«
»Was genau hat er hier gemacht?«
Sie deutete auf eine relativ freie Fläche inmitten der Ruinen. »Das war mal das Forum, der römische Marktplatz. Bevor die Römer kamen, hatten die Griechen hier Gebäude errichtet, die die Römer dann abgerissen haben. Man sieht aber bis heute die griechischen Fundamente unter den römischen Ruinen und, nun, die Sache ist kompliziert. Die Archäologen wollen herausfinden, wie die griechischen Bauten aussahen, welchen Zweck sie hatten und so weiter. Gaspards Kollegen werden Ihnen mehr sagen können.«
»Wo finde ich die?«
Sie hob die Schultern. »Es ist ein kleines Team von der Sorbonne gekommen: eine Leiterin und zwei Mitarbeiter, einer von ihnen ist Gaspard. War Gaspard.« Sie schluckte schwer. »Die Grabungsaktion soll noch etwa zwei Wochen dauern. Dann beginnen die Sommerferien, und es wird hier so voll, dass man nicht mehr ungestört arbeiten kann. Die Archäologen sind im Hôtel du Soleil in Saint-Rémy untergebracht. Von dort sind es bloß wenige Minuten zu Fuß bis nach Glanum. Eigentlich müssten Gaspards Kollegen jeden Moment hier eintreffen.«
»Oder sie sind schon da und kommen nicht durch die Absperrung«, erwiderte Blanc. »Ich kümmere mich darum.« Er zückte sein Handy und rief Maréchal Sylvain an, einen der fähigsten jüngeren Beamten der Einheit. »Fahren Sie zum Hôtel du Soleil und postieren Sie sich vor dem Zimmer von Gaspard Rouge. Ich schicke ein paar Kriminaltechniker hin. Vielleicht finden sie ja was.« Danach informierte er Ben-Rouijal.
»Da ist noch etwas …« Milène Oreal hatte höflich gewartet, bis er seine Anrufe getätigt hatte, nun zögerte sie. »Eh bien, vielleicht hat es gar nichts zu bedeuten, doch …« Sie nahm sich zusammen. »Gaspard hat praktisch jeden Tag länger gearbeitet als seine beiden Kollegen. Er hat morgens früher angefangen und abends später aufgehört. Ich habe ihn nie danach gefragt, und streng genommen ging es mich auch nichts an, denn er hat in seinen Überstunden allein und außerhalb von Glanum gegraben.«
»Was meinen Sie mit außerhalb?«
Die Direktorin deutete auf die Alpilles. »Glanum ist ein Museum und als solches Staatseigentum. Aber das Land jenseits des antiken Bezirks ist entweder kommunaler Wald oder in privater Hand, die meisten Parzellen gehören Bauern aus Saint-Rémy. Ich habe dort nichts zu sagen, ich kenne mich dort nicht einmal wirklich gut aus. Doch ich habe Gaspard mehrmals zwischen den Hügeln gesehen.«
»In den Bergen jenseits der Ruinen?«
»Ja, nur ein paar Hundert Meter entfernt, höchstens, aber eindeutig nicht mehr auf dem Museumsgelände.« Sie deutete auf die Südseite des Tals, dorthin, wo es immer schmaler wurde, bis es wie eine Spalte zwischen den Bergen zu verschwinden schien. »Im Tal, an den Hängen … Einmal habe ich ihn bei einem meiner Kontrollgänge dort überrascht und ihm irgendeine Belanglosigkeit zugerufen. Da schien er mir regelrecht erschrocken zu sein. Er hat nicht mal zurückgewunken.«
»Was hatte er dort zu suchen?« Blanc dachte an das, was ihm die Direktorin kurz zuvor erzählt hatte: Neun Zehntel von Glanum waren noch unerforscht.
»Das weiß ich wirklich nicht. Da müssen Sie seine Kollegen fragen. Obwohl … Nun, ich hatte den Eindruck, dass weder seine Chefin noch der andere Assistent etwas davon wussten.«
»Vielen Dank, Madame.« Blanc starrte zum engen Tal, auf das Milène Oreal gezeigt hatte. Es war nur wenige Schritte von der heiligen Quelle entfernt.
»Mon Capitaine!« Tuaiva stürmte heran, massig wie ein Stier und mindestens genauso schnell.
»Was gibt es?«
Auch Fabienne und Marius wurden jetzt munter und eilten hinzu.
»Ich habe etwas gefunden!« Der Polizist hielt eine schwarze Sporttasche in der Hand, öffnete sie und zog triumphierend ein Portemonnaie heraus. »Sehen Sie sich das an!«
Blanc blickte auf einen Führerschein, eine Kreditkarte und einen Bibliotheksausweis der Sorbonne, alles ausgestellt auf den Namen Gaspard Rouge.
»Was haben Sie auf der Polizeischule gelernt?!« Ben-Rouijal war die Treppe hochgestapft. Seine heisere Stimme klang plötzlich schneidend. »Das dürfen Sie doch nicht einfach anfassen und damit herumfuchteln! Geben Sie schon her! Und wo zur Hölle haben Sie die Tasche überhaupt gefunden?«
Tuaiva errötete, ob vor Verlegenheit oder Wut, mochte Blanc nicht entscheiden, doch er wollte diesen Koloss gar nicht erst richtig wütend erleben. »Hauptsache, Sie haben die Tasche gefunden!«, fuhr er rasch dazwischen, nahm Tuaiva den Gegenstand ab, und scheiß drauf, dass nun auch seine Fingerabdrücke die Spur kontaminierten, dann reichte er sie an den grollenden Kriminaltechniker weiter.
»Wo haben Sie das gefunden?«, wiederholte er Ben-Rouijals Frage, allerdings in höflicherem Ton.
»Na, bei einer Ruine«, druckste der Polizist herum.
Jetzt stöhnte auch Milène Oreal vernehmlich auf. »Welcher Ruine?«
»D’accord«, sagte Blanc und hob beschwichtigend die Hand. »Führen Sie uns einfach dorthin.«
»Ich komme mit.« Bei Ben-Rouijal klang das wie eine Drohung.
»Ich auch«, sagte die Direktorin. Bei ihr klang es auch wie eine Drohung.
»Ein bisschen Verstärkung kann nie schaden.« Endlich grinste Fabienne wie früher und stieß Marius in die Rippen. »Komm, wir sehen uns das gemeinsam an.«
Tuaiva führte sie vielleicht hundert, zweihundert Meter auf demselben Weg zurück, den sie gekommen waren. Neben der antiken Hauptstraße und, soweit Blanc das abschätzen konnte, ungefähr im Zentrum von Glanum, stand ein steinerner, mit gelben Flechten gesprenkelter Altar, kaum mehr als hüfthoch. Das Monument erschien ihm inmitten der anderen Relikte so unscheinbar, dass er vorhin achtlos daran vorbeigegangen war. Erst jetzt sah er genauer hin und staunte: In die Vorderseite des Altars war ein Lorbeerkranz eingemeißelt, und dieser Kranz umschloss – zwei Ohren. Der ringförmige Kranz mit den beiden menschlichen Körperteilen wirkte aus der Entfernung fast wie ein Mondgesicht, nur dass dort, wo man normalerweise Augen einzeichnen würde, Ohren waren. Über dem Kranz entzifferte er mühsam das erste Wort einer verwitterten Inschrift: LOREIA.
»Hier hat die Tasche gelegen«, erklärte der Polizist und deutete auf einen Steinsockel vor dem Altar.
»Interessant«, murmelte Milène Oreal.
»Das ist ein Stein unter vielen«, erwiderte Marius, der erkennbar wieder schlechte Laune bekam.
Blanc warf ihm einen warnenden Blick zu. Auch wenn Marius sein Freund war, würde er ihn fortschicken, wenn er weiterhin grundlos wichtige Zeugen provozierte. »Ist Loreia eine Art Gottheit?«, fragte er die Direktorin.
»Nein, das ist der Name einer Priesterin. Der Altar ist der Bona Dea gewidmet, der ›Guten Göttin‹. Sie beschützt die Gläubigen und spricht zu ihnen in Orakeln. Loreia war eine Priesterin aus Glanum, die, wie der Rest der Inschrift verkündet, diesen Altar ›zu den Ohren‹ der Göttin errichtete. Das bedeutet, dass die Priesterin hoffte, die Göttin würde ihr Flehen erhören. Oder dass die Bona Dea sie bereits erhört hat und die Frau ihr dafür danken will. Eine Frau, verstehen Sie?« Sie sah Blanc an und bemerkte an seinem ratlosen Gesichtsausdruck, dass der das Entscheidende offenbar nicht kapiert hatte. »Die meisten antiken Kulte waren mehr oder weniger Männersache: Priester, Kaiser, Würdenträger haben Tempel gestiftet, Opfer dargebracht, Orakel befragt«, fuhr sie geduldig fort. »Bei der Bona Dea war das aber anders: Ihr Kult war erstens geheim und zweitens nur eingeweihten Frauen vorbehalten. Männer durften nicht teilnehmen – was für uns Heutige insofern ein Problem ist, als in der Antike auch fast ausschließlich Männer Bücher geschrieben haben. Männer haben am Kult der Bona Dea nicht teilgenommen, also haben sie fast nichts darüber geschrieben, also wissen auch wir fast nichts darüber. Nicht einmal den richtigen Namen: ›Bona Dea‹ ist eine Art Ehrentitel, aber wie die Göttin wirklich hieß, welche Macht sie wirklich hatte, welche Riten die Frauen zelebrierten, all das ist verloren gegangen. Nur ein paar steinerne Denkmäler sind erhalten geblieben, wie dieser Altar.«
Blanc strich sich nachdenklich über die Haare. »Meinen Sie etwa, jemand hat die Tasche des Toten als eine Art Opfergabe vor den Altar gelegt? Das klingt, verzeihen Sie die Anspielung, in meinen Ohren sehr weit hergeholt.«
»In meinen Ohren auch«, warf Ben-Rouijal ein. Sie hatten den Altar betrachtet und ihn nicht mehr beachtet. Er hatte mit behandschuhten Händen die Tasche geöffnet und präsentierte ihnen nun einen Skizzenblock, Millimeterpapier, DIN-A4-Format, er wirkte eher technisch als künstlerisch. Das einzige bereits bearbeitete Blatt zeigte eine erstaunlich genaue, allerdings noch unvollendete Zeichnung des Altars. Dann hielt ihnen der Kriminaltechniker ein Handy entgegen und öffnete den Fotoordner. Die letzten zehn mit dem Gerät aufgenommenen Bilder zeigten verschiedene Details des Altars; dem Abendlicht nach zu urteilen, in dem der Stein rötlich leuchtete, waren sie kurz vor Sonnenuntergang aufgenommen worden.
»Sieht eher so aus, als hätte Gaspard hier gearbeitet«, sagte Milène Oreal nachdenklich. »Seltsam, hier gibt es eigentlich seit Jahren nichts mehr auszugraben. Und der Altar ist in der Fachliteratur bereits ausführlich beschrieben worden.«
»Sie haben keine Ahnung, woran Gaspard Rouge hier geforscht haben könnte?«, vergewisserte sich Blanc erstaunt.
Sie schüttelte den Kopf. »Da müssen Sie seine Kollegen fragen, vielleicht wissen die mehr«, erklärte sie noch einmal. »Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, einen der beiden anderen Archäologen jemals vor dem Altar gesehen zu haben.«
Blanc blickte zurück und versuchte, sich Glanum am gestrigen Abend vorzustellen, nachdem die letzten Besucher gegangen waren und die Mitarbeiter die Anlage abgeschlossen hatten. Antike Ruinen, ein einsamer Archäologe, der diesen Altar zeichnet, ganz in seine Arbeit vertieft … Warmes, weiches Abendlicht, doch in der tief stehenden Sonne warfen Ruinen und Judasbäume bereits lange Schatten … Ein Altar im Zentrum der uralten Stadt, doch nur wenige Schritte entfernt ein Brunnen, fünf Meter tief in der Erde …
»Du hast hier gearbeitet, auch wenn niemand weiß, woran«, flüsterte Blanc so leise, dass die anderen ihn nicht hören konnten; er sprach nun zu dem Toten. »Aber getötet wurdest du in der heiligen Quelle, weil dich in diesem engen Schacht niemand sehen und hören konnte. Hast du freiwillig dein akribisches Zeichnen unterbrochen, um dorthin zu gehen? Aber warum? Hat dich jemand gelockt? Aber womit? Oder hat dich jemand gezwungen, hat dich abgeführt wie zu einer Exekution?« Gaspard Rouge war erst seit zwei Wochen hier gewesen, Glanum war ein einsamer Ort – wie hatte er sich in so kurzer Zeit und ausgerechnet hier einen Todfeind schaffen können? Einen Todfeind, der Glanum kannte, vermutete Blanc. Denn vom Altar der Bona Dea aus konnte er zwar die Mauern und den steinernen Bogen sehen, doch dass sich dahinter eine Treppe verbarg, die in die Tiefe bis zum Wasser führte, das konnte man unmöglich erkennen – das musste man schon vorher gewusst haben.
Fabienne winkte ihn zu sich. Nun, da sie die Leiche gesehen hatte und die Ermittlungsarbeiten anliefen, schien sie zu ihrer alten Form zurückzufinden, stellte Blanc erleichtert fest. Das Jagdfieber vertrieb ihre Depression. Sie hielt ihr iPhone in der Hand und zeigte darauf.
»Ich habe ein bisschen recherchiert. Rouge hat zwar an der Sorbonne studiert, kommt aber aus dem Süden«, erklärte sie, »wenn auch nicht aus der Provence. Es gibt eine Website der Universität, auf der sich alle Assistenten vorstellen. Außerdem habe ich seinen Instagram-Account und ein paar andere Websites mit persönlichen Informationen gefunden, man kann nicht gerade behaupten, er hätte sich im Netz versteckt. Er stammt aus Bormes-les-Mimosas, schicker Ort, Département Var, nicht weit von Saint-Tropez. Seine Eltern leben noch dort – soweit ich das auf die Schnelle überblicken kann, seine engsten, vielleicht einzigen Verwandten. Er scheint weder Partnerin noch Partner noch Kinder zu haben, auch Geschwister gibt es nicht.«
»Aber die Eltern leben beide noch?«, vergewisserte sich Blanc. Einerseits war das gut, denn so hatten sie zwei exzellente Zeugen, die ihnen viel über das Leben des Opfers erzählen konnten. Andererseits war es schlecht, denn so musste er den Todesboten spielen, der ihnen die schreckliche Nachricht überbrachte.
»Ich habe ihre Festnetznummer herausgefunden.«
»Schick sie mir bitte auf mein Handy.« Blanc atmete tief durch und entfernte sich ein paar Schritte vom Altar der Bona Dea, zu dem Ben-Rouijal inzwischen zwei weitere Kriminaltechniker gerufen hatte. Wenn sie etwas gefunden haben sollten, so ließen sie es sich nicht anmerken. Langsam umkreisten sie den steinernen Klotz und schienen eher ratlos, was sie hier eigentlich suchen sollten. Blanc wählte die Nummer in Bormes-les-Mimosas. Schon beim zweiten Klingeln wurde abgehoben – doch er kam aus dem Konzept, als die Mailbox ansprang. Eine Frauenstimme, sie klang älter, warm, etwas schüchtern: »Bonjour, Sie rufen bei Edwige und David Rouge an. Wir sind leider nicht zu Hause.« Eine kurze Pause, dann, als wäre es ihr erst jetzt eingefallen: »Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir rufen zurück. Merci.«
Merci für diese Nachricht, dachte Blanc, eh merde …DAS konnte er dem Ehepaar Rouge doch nicht einfach auf den Anrufbeantworter sprechen. Also hinterließ er bloß seinen Namen, seinen Rang, seine Telefonnummer, er sprach sehr langsam, wiederholte die Nummer, und schließlich: »Bitte rufen Sie mich so schnell wie möglich zurück.« Ging es noch banaler und zugleich unheilvoller? Aber wie hätte er so etwas taktvoller formulieren können?
»Es ist doch immer wieder ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten, mon Capitaine.«
Blanc blickte erstaunt auf. Er hatte gar nicht bemerkt, dass Fontaine Thezan zu ihm gekommen war. Er küsste sie zur Begrüßung auf die Wangen. »Ich fürchte, das kann man nicht als Vergnügen bezeichnen, Doktor.«
Die Rechtsmedizinerin schob ihre Sonnenbrille ins Haar und bedachte ihn mit einem leicht spöttischen Lächeln. »Sie und ich, wir machen unseren Job freiwillig, und das hat schon seine Gründe.«
Blanc starrte sie einen Moment lang verblüfft an, ihre Bemerkung war beinahe schon geschmacklos, doch dann wurde ihm klar, dass Fontaine Thezan, wie meistens, auch diesmal recht hatte. Als Rechtsmedizinerin bekam sie vom Staat 57,50Euro, wenn sie zum Tatort fuhr, um ein Mordopfer zu untersuchen, und 138Euro für eine Autopsie – wenig Geld für viele Stunden nicht gerade angenehmer Arbeit. (Und Blanc fragte sich immer wieder aufs Neue, wer in welchem Ministerium und nach welchen Kriterien bloß solche krummen Summen festlegte.) Fontaine Thezan machte diesen »Job« jedenfalls nicht, um damit reich zu werden – sie war, wie Blanc, auf eine Weise vom Tod fasziniert, über die sie beide vielleicht gar nicht so genau nachdenken wollten.
Er brachte für einen kurzen Moment ein komplizenhaftes Grinsen zustande. »Der Tote liegt an einem versteckten Ort. Ich führe Sie hin.«
Diesmal hatte die Médecin légiste ein Publikum wie auf einer Theaterbühne, doch falls sie das störte, so ließ sie es sich nicht anmerken. Denn die Gendarmen respektierten zwar, wie stets bei Mordfällen, dass sie sich dem Opfer für eine erste Untersuchung alleine näherte. Doch in Glanum zog sich niemand diskret ein paar Meter weit zurück: Blanc und seine Kollegen, Ben-Rouijal und die Kriminaltechniker, Tuaiva und sogar die Direktorin Milène Oreal blieben am Schachtrand stehen und starrten hinunter. Die Ärztin umkreiste den leblosen Körper, soweit das auf dem engen Raum zwischen Treppenstufen, Mauerwerk und Wasser überhaupt möglich war, ohne ihn zunächst zu berühren, es wirkte wie ein makabres Ballett auf einer tiefen Bühne, und oben stand das Publikum und staunte. Die Medizinerin schoss mehrere Fotos mit ihrem Handy und nutzte es als Diktiergerät für ihre Bemerkungen, die man allerdings nicht verstehen konnte. Erst nach einiger Zeit ging sie neben Rouge in die Hocke und tastete mit behandschuhten Händen, wie es Blanc schien, behutsam, fast zärtlich, den Toten ab. Sie beugte sich dicht über das Gesicht, während sie die beiden Wunden an den Schläfen untersuchte. Dann umfasste sie den rechten Arm und hob ihn langsam an. Die Gliedmaßen des Toten waren steif wie Bretter, die Rechtsmedizinerin bewegte den ganzen Körper, als sie den Arm ergriff. Leichenstarre, dachte Blanc. Am linken Oberarm trug Rouge eine alte, längst verheilte Narbe, der die Ärztin kaum Beachtung schenkte. Sie interessierte sich mehr für die rechte Hand, die, soweit Blanc das von seinem Beobachtungsposten aus beurteilen konnte, mit grünlichem Schleim aus dem Wasser bedeckt, aber unverletzt war. Dann wandte sich Fontaine Thezan dem linken Arm und der linken Hand zu, wo sie offenbar auch nichts Ungewöhnliches zu entdecken schien. Kein Ring an irgendeinem Finger, dachte Blanc, Rouge hatte tatsächlich keine Beziehung, zumindest keine, die er zeigen wollte.
Schließlich drehte die Rechtsmedizinerin den Körper um. Auch das wirkte rührend behutsam, obwohl sie sicher viel Kraft aufwenden musste, um den starren Leichnam zu wenden. Auf dem Rücken war Rouges weißes T-Shirt von Schmutzstreifen gezeichnet, die vermutlich von den Treppenstufen stammten, auf denen er einige Stunden gelegen hatte. Doch vom Hals bis zu den Fersen schien sein Körper unverletzt, seine Kleidung unbeschädigt. Kein Niederschlag, überhaupt kein Angriff von hinten, sagte sich Blanc, ein Schuss in die Schläfe und das war’s, eh merde.
Er fragte sich, ob Rouge seinen Mörder so gut gekannt hatte, dass der ihm nahekommen konnte. Oder ob Marius nicht doch recht hatte und es gar keinen Mörder gab, sondern einen Suizid.
Fontaine Thezan stieg die Treppe wieder hinauf. Zwei Kriminaltechniker gingen den umgekehrten Weg. Sie würden nun, da die Leiche umgedreht war, alles noch einmal gründlich absuchen. Später würden die Leichenträger kommen und den Körper ins Institute Médico-légale des Krankenhauses von Salon-de-Provence bringen, wo ihn die Gerichtsmedizinerin obduzieren konnte. Blanc überlegte, welchen Kollegen er als Beobachter hinzuziehen sollte. Fabienne sicher nicht. Marius. Verkatert, schlecht gelaunt, vielleicht war eine Leichenöffnung als Schocktherapie gar nicht so verkehrt.
»Was ist Ihr vorläufiger Befund, Doktor?«, fragte Blanc ohne große Hoffnung auf Neuigkeiten.
Fontaine Thezan streifte die langen Gummihandschuhe ab und zündete sich eine Mentholzigarette an. Das war in der antiken Stadt garantiert verboten, doch die Rechtsmedizinerin sah nicht so aus, als würde sie sich je um derartige Verbote scheren. Und Milène Oreal machte nicht den Eindruck, als wolle sie ausgerechnet jetzt ein derartiges Verbot durchsetzen, im Gegenteil. Sie fingerte in ihrer Tasche und steckte sich eine E-Zigarette zwischen die Lippen, deren bläulicher Qualm noch süßlicher roch als die Mentholzigarette der Medizinerin. Vielleicht doch nicht Erdbeere, vermutete Blanc, eher Himbeere.
Fontaine Thezan inhalierte tief und dachte eine Zeit lang über ihre Antwort nach. »Die Todesursache ist höchstwahrscheinlich der aufgesetzte Kopfschuss. Sie sehen es an den Schmauch- und Brandspuren auf der Haut, der Lauf hat die Schläfe berührt. Der Lauf einer Pistole oder eines Revolvers vermutlich, nicht der eines Gewehrs, die Verletzungen deuten zumindest auf ein eher kleines Kaliber hin.«
»Hat Rouge sich gewehrt? Oder war er gefesselt?«
»Soweit ich das nach der ersten Beschau beurteilen kann: weder noch. Keine Fesselungsmarken an den Handgelenken, keine Abwehrverletzungen an den Händen. Die Narbe am linken Oberarm ist mindestens mehrere Jahre alt, die hat sicher nichts mit dem Mord zu tun. Weitere Hieb- oder Stichverletzungen scheint das Opfer auch nicht zu haben, außer …« Sie nahm wieder einen tiefen Zug. »Außer einem kleinen Hämatom, das ich am Hinterkopf ertasten konnte. Vermutlich hat es sich Rouge allerdings erst zugezogen, nachdem ihn die Kugel getroffen hatte. Der Sterbende bricht zusammen und schlägt dabei mit dem Hinterkopf auf eine steinerne Treppenstufe.«
»Aber wir können nicht hundertprozentig ausschließen, dass es umgekehrt war«, warf Blanc ein. »Rouge wird hinterrücks niedergeschlagen und dann erst erschossen.«
Die Rechtsmedizinerin deutete den Schacht hinunter, wo sich die Kriminaltechniker wieder am Körper zu schaffen machten. »Sehen Sie sich den Tatort an, mon Capitaine. Erstens ist die Treppe ziemlich schmal. Hätte der Mörder sein Opfer zuerst so niedergestreckt, dass es mit dem Hinterkopf auf dem Boden liegt, dann hätte er ihm die Kugel von oben in die Stirn geschossen, nicht seitlich in die Schläfe. Denn dazu hätte man sich schon sehr weit nach unten beugen müssen, und das in diesen beengten Verhältnissen. Und sehen Sie sich zweitens die fächerförmig verlaufenden Blutspritzer an der gegenüberliegenden Wand an. Die Kriminaltechniker werden Ihnen später einen detaillierten Bericht liefern, doch ich schätze, dass die meisten Blutstropfen die Mauer in einer Höhe von eineinhalb bis zweieinhalb Metern über dem Niveau der untersten Treppenstufen getroffen haben. Das bedeutet, dass die Kugel den Schädel des Opfers durchschlug, als der Mann noch stand. Wäre Rouge erst liegend erschossen worden, würde sein Blut nicht in dieser Höhe an den Steinen kleben.«
»Rouge steht auf der untersten Stufe der heiligen Quelle«, murmelte Blanc.
»Und sein Mörder steht in dem engen Schacht direkt neben ihm, hält ihm die Pistole an die Schläfe und drückt ab«, beendete Fontaine Thezan. »Ja, so könnte es gewesen sein.«
»Wann ist er gestorben? Ich weiß, Sie können es mir nicht auf die Minute genau sagen. Aber könnte er gestern Abend ermordet worden sein?«
»Sie haben es ja gesehen, mon Capitaine: Die Leichenstarre ist voll entwickelt. Bei den warmen Temperaturen, die wir selbst abends haben, hat der Rigor mortis spätestens nach sechs Stunden den ganzen Körper erfasst. Nach etwa vierundzwanzig Stunden würde die Starre sich allmählich lösen. Ich vermute also, dass Gaspard Rouge vor mehr als sechs und weniger als vierundzwanzig Stunden getötet wurde.«
Blanc sah auf die Uhr seines Handys. Fast Mittag. Gestern um diese Zeit mussten noch unzählige Besucher durch Glanum geschlendert sein, unmöglich, dass ihnen der Tote entgangen war. Also fand der Mord nach Betriebsschluss statt – doch theoretisch hätte das Verbrechen auch noch am frühen Morgen des heutigen Tages verübt werden können. Was hatte Milène Oreal ausgesagt? Gaspard Rouge hatte oft früher und später als die anderen Archäologen gearbeitet. Es war Juni, die Tage waren lang, bis spät abends und schon am frühen Morgen war es so hell, dass selbst dieser enge Schacht von den Sonnenstrahlen erleuchtet wurde.
»Sonst noch etwas, Doktor?«
»Seine Armbeugen weisen keine Einstichstellen auf, die Finger sind nicht nikotinverfärbt, seine Nase ist nicht entzündet. Das ist selbstverständlich noch kein Beweis, doch es würde mich schon sehr wundern, wenn ich bei der Obduktion irgendwelche Spuren von Drogen in seinem Körper finden würde. Rouge war jung, muskulös, gut in Form …« Ihre Stimme verlor sich.
Blanc wusste, dass Fontaine Thezan sich gerne jüngere Liebhaber aussuchte, und vielleicht hatte der Anblick dieses Toten sie mehr erschüttert als die Anblicke der vielen anderen Toten in ihrer Karriere. Gaspard Rouge hatte das Gesicht eines griechischen Gottes. Das Gesicht …
»Doktor«, sagte Blanc, der sich wieder daran erinnerte, »was ist mit dem roten Fleck auf der Wange des Toten? Ist das eine Verletzung?«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist vermutlich eine Farbanhaftung.«
»Rote Farbe?« Für Blanc war Glanum eine Stadt der grauen Steine. Rot, das waren hier höchstens die Mohnblumen und die Früchte der Judasbäume. Und die Skizze, die Ben-Rouijal aus der Tasche des Toten gezogen hatte, war mit Bleistift gezeichnet. Er machte sich im Geiste eine Notiz zu überprüfen, ob in der Tasche nicht doch ein roter Stift steckte, für Korrekturen oder was auch immer.
»Ich werde eine Probe chemisch untersuchen. Vielleicht bringt uns das weiter.« Sie drückte ihre Zigarette an einem Stein aus, auf dem wahrscheinlich in zwei Jahrtausenden noch nie eine Zigarette ausgedrückt worden war, warf die Kippe aber immerhin nicht achtlos zwischen die Ruinen, sondern behielt sie in der Hand. »Schicken Sie mir möglichst bald einen Beamten ins Krankenhaus? Ich will mit der Obduktion keine Zeit verlieren.«
»Lieutenant Tonon wird Sie begleiten«, sagte Blanc und winkte Marius zu sich.
Sein Freund und Kollege fürchtete die Rechtsmedizinerin, die ihn auch nicht besonders schätzte. Marius nickte unglücklich.
Fontaine Thezan bedachte ihn mit einem Diagnoseblick. »Ich werde Ihnen ein kreislaufstärkendes Mittel verabreichen, mon Lieutenant, bevor ich mich um den Toten kümmere.«
Marius verabschiedete sich kurz darauf, er müsse sich »stärken für das, was kommt«. Fontaine Thezan wollte noch etwas bleiben, um, wie sie sagte, »die Antiken zu studieren, bis die Leichenträger den Körper abgeliefert und meine Assistenten ihn vorbereitet haben«. Blanc vermutete, dass sie allein durch Glanum spazieren wollte, um die Schönheit zu genießen und sich von dem Gesehenen abzulenken.
Die Ärztin hatte Marius angeboten, ihn später in ihrem alten weißen Jeep mitzunehmen, doch Marius zog es vor, im Streifenwagen zu fahren. Er war so blass, als solle er auf den Obduktionstisch klettern.
Die Leichenbestatter kamen und gingen kurz darauf wieder mit einer Bahre, deren Last unter einem weißen Tuch kaum noch als menschlicher Körper zu erkennen war. Die ersten Kriminaltechniker hatten sich aus ihren Schutzanzügen geschält, sie waren schweißgebadet. Die Luft hatte sich auf mindestens fünfunddreißig Grad erhitzt.
Eine junge Gendarmin hatte Milène Oreal eine Flasche Wasser gebracht. Blanc bedankte sich bei der Direktorin für ihre Mühen und entließ sie nach Hause. Sie war gefasst, doch ziemlich erschöpft. Tuaiva meldete zwischendurch, dass »die Lage unter Kontrolle« sei. Doch Blanc glaubte, hier und da in den Hügeln hinter Glanum Gestalten zu erkennen, die keine Uniform trugen. Er war sich nicht sicher, dass wirklich alle Schaulustigen weit genug auf Abstand gehalten wurden.
Alles fühlte sich schon nach Aufbruch an, als ein Ruf aus dem Schacht ertönte. Blanc und Fabienne eilten hin und stürzten die Treppen hinunter bis ans grünliche Wasser. Sie hatten einen Taucher der Gendarmerie herbeigerufen, der seit einer Viertelstunde das kleine, glücklicherweise nicht sehr tiefe Brunnenbecken absuchte. Nun reichte der Mann Ben-Rouijal, der als Einziger noch in seinem Schutzanzug steckte, tatsächlich eine kleine, deformierte, messingfarben schimmernde Kugel. Das Geschoss, vermutete Blanc, hatte Rouges Kopf durchschlagen, war gegen eine Mauer geprallt und ins Wasser gefallen. Doch deshalb hatte Ben-Rouijal nicht gerufen. Er deutete auf den zweiten Fund, den der Taucher auf die Stufen gelegt hatte.
Eine schwarze Pistole.
Blanc dachte an Marius’ Vermutung und an die grünlich verfärbte Hand des Toten, die im Wasser lag. Was, wenn Rouge nun doch Selbstmord begangen und die Waffe aus der Hand des Sterbenden in die heilige Quelle gefallen war?
Blancs uraltes Nokia vibrierte. Er sah auf das Display und erkannte die Nummer, die er vor Kurzem angerufen hatte. Er atmete tief durch und rannte, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf, bevor er das Gespräch annahm.
»Hier ist David Rouge. Sie hatten angerufen.« Die Stimme eines älteren Mannes. Sie zitterte vor Aufregung.
»Danke, dass Sie so rasch zurückrufen.« Fabienne folgte ihm und formte lautlos zwei Worte mit den Lippen: Viel Kraft.