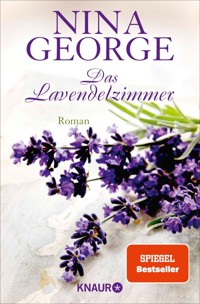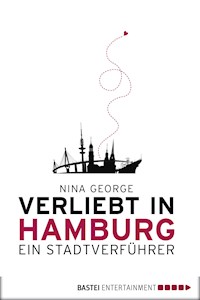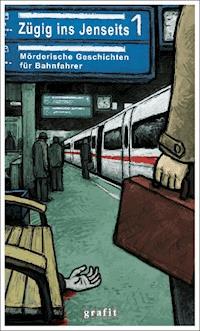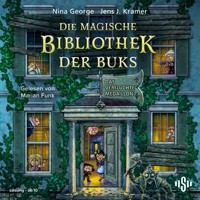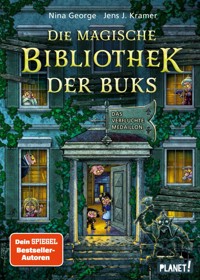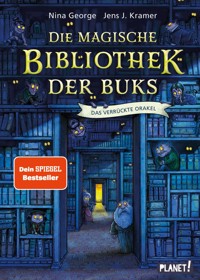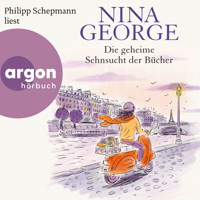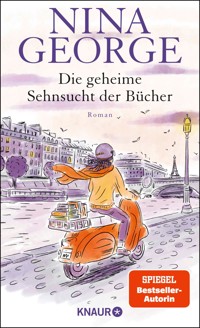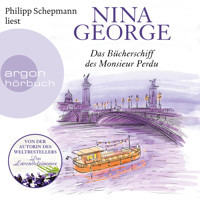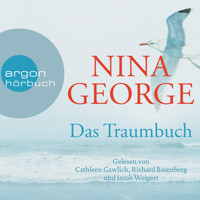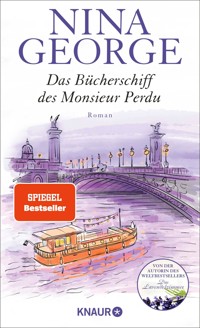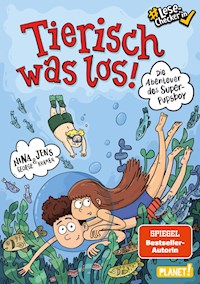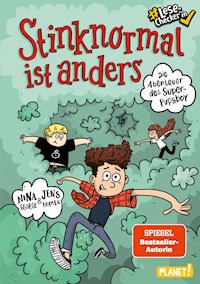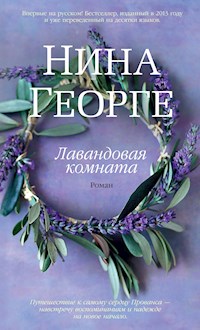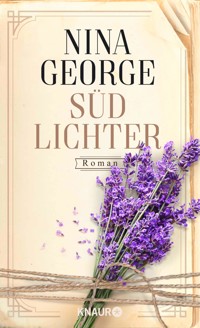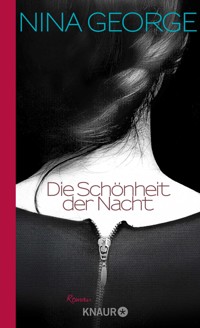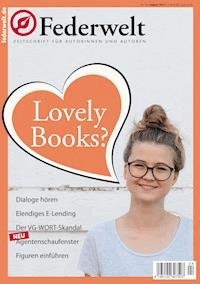18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die gefeierte Filmikone Jeanne Patou erfährt aus dem Fernsehen, dass sie für tot gehalten wird. Für Jeanne ist es die Chance, unterzutauchen und so ihrem Ehemann zu entkommen, der gleichzeitig ihre größte Obsession und ihre fatalste Leidenschaft ist. Sie verschwindet in die Anonymität – und in einen Kosmos der untergetauchten Frauen, mit denen sie ein altes Haus in Barcelona bewohnt. Während sie ihre Schicksale kennenlernt, wird ihr auch ihr eigenes immer deutlicher.
Viereinhalb Jahre später streift Jeanne über die La Rambla, eine Passantin unter vielen, als sie plötzlich ihrem Mann begegnet. Ihr ist klar: Sie muss sich stellen – ihrem Mann, aber vor allem sich selbst.
Die Passantin ist ein empathischer, rasanter und zorniger Roman über eine Selbstfindung, eine Starkwerdung, eine Emanzipation, ein Auftauchen aus festgefahrenen Strukturen, um zum wahren Kern zurückzufinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
Über die Autorin
Nina George (*1973) ist Schriftstellerin, Journalistin, Übersetzerin und Moderatorin. Ihr Roman Das Lavendelzimmer wurde in 36 Sprachen übersetzt und war u. a. ein New-York-Times-Bestseller und Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen der USA. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Schriftsteller Jens J. Kramer, schreibt Nina George außerdem Kinderbücher. Für ihr literarisches Werk sowie ihr kulturpolitisches Engagement, u. a. als politische Beauftragte des European Writers’ Council, als Gründern des Netzwerks Autorenrechte und als Initiatorin der Initiative #frauenzählen, wurde Nina George als BücherFrau des Jahres ausgezeichnet und erhielt das Bundesverdienstkreuz. Nina George lebt in Berlin und in der Bretagne. www.ninageorge.de
Über das Buch
Die gefeierte Filmikone Jeanne Patou erfährt aus dem Fernsehen, dass sie für tot gehalten wird. Für Jeanne ist es die Chance, unterzutauchen und so ihrem Ehemann zu entkommen, der gleichzeitig ihre größte Obsession und ihre fatalste Leidenschaft ist. Sie verschwindet in die Anonymität – und in einen Kosmos der untergetauchten Frauen, mit denen sie ein altes Haus in Barcelona bewohnt. Während sie ihre Schicksale kennenlernt, wird ihr auch ihr eigenes immer deutlicher.
Viereinhalb Jahre später streift Jeanne über die La Rambla, eine Passantin unter vielen, als sie plötzlich ihrem Mann begegnet. Ihr ist klar: Sie muss sich stellen – ihrem Mann, aber vor allem sich selbst.
Die Passantin ist ein empathischer, rasanter und zorniger Roman über eine Selbstfindung, eine Starkwerdung, eine Emanzipation, ein Auftauchen aus festgefahrenen Strukturen, um zum wahren Kern zurückzufinden.
ERSTES BUCH
JEANNE
1
2019
Eben ist mein Mann an mir vorbeigegangen. Auf der La Rambla, er mochte Barcelona eigentlich nie, und die Frau an seiner Seite studierte konzentriert die Schaufensterauslagen der geschlossenen Läden, während er sie am Ellenbogen mit seiner weichen Hand unerbittlich weiterführte. Mein Mann hielt die Frau fest und starrte jedem, der mit einer Estelada-Flagge Richtung der Basilika Sagrada Família hastete, mit saurer Verachtung ins Gesicht.
In der Ferne das Geräusch hochdrehender Motoren der Wasserwerfer, die die Innenstadt einkesselten. Brandgeruch.
Mein Mann sah mich an, als er an mir vorbeiging, und ich ihn, flüchtig, vage, eine Passantin im wachsenden Strom der Demonstranten. Er hatte mich nicht erkannt, oder vielleicht doch, und sich gesagt, dass es nicht sein konnte, denn schließlich war ich seit viereinhalb Jahren tot.
2
2015
Jeanne Patou sitzt am Tresen der Bar Central in der La Boqueria Markthalle. Niemand sieht sich nach ihr um, niemand erkennt sie. Niemand erwartet, dass jemand wie sie sich an Orten materialisiert, wo sonst nur normale Leute hingehen und es nach Tapas, Bier und warmem Fett riecht. Als hätten berühmte Menschen wie Jeanne eine andere Welt nur für sich zur Verfügung.
Ich habe es mir angewöhnt, über mich als »Jeanne« zu denken. Ich ist eine andere. Ich trage einen anderen Namen, aber ich bin längst getilgt, aufgegangen in der Rolle der Patou. Es ist, als beobachtete ich Jeanne von jenseits der Haut, die wir uns teilen. Ich sehe ihr zu, wie sie trinkt, und wir reden nicht miteinander, schon lange nicht mehr.
Jeanne trinkt Rotwein, neben ihrem Barhocker steht ihr kleiner Rollkoffer. Sie hat Pata Negra, Croquetas de Jamón und heiße, knusprige Churros bestellt, die sie nicht anrührt. Sie bleibt beim Rotwein, ein Tempranillo, so trocken, dass er ihr in den Gaumen sticht. Zu früh für den Tag, genau rechtzeitig für den Schmerz, den sie empfindet. Luc nennt sie den Schmerz, aber Luc ist nur das Dekor. Es ist ein Schmerz, der aus den Sedimenten ihres Seins quillt. Eine unendliche Müdigkeit, zäh, träge, klebrig. Jeanne will hier nur noch sitzen und das Weinglas in den Fingern drehen. Dieser unglaubliche Widerwille, weiterzugehen.
Es birst vor Farben und Überfluss im Bauch von Barcelona. Dutzende von der Decke hängende Serrano- und Pata-Negra-Schinken, überquellende Tische mit Früchten, Gemüse, Regale voller Weinflaschen. Mallorquinischer Hierbas, spanischer Sherry, Brandy und Cava. Nassglatte Fische, Kraken, Krebse, Hummer. Es summt von Stimmen, die TV-Bildschirme, die in den Hallengängen hängen, erzählen Neues aus der Welt.
Die spanischen Nachrichten berichten im Liveticker, dass im US-Bundesstaat Utah die Todesstrafe durch Erschießen mit dem Gewehr vollstreckt werden kann, sofern kein Giftstoff zum Spritzen vorrätig sei. Die Weigerung europäischer Chemikalienhersteller zur Lieferung von Todesspritzen hätten wiederholt zu Verzögerungen geführt. Und jetzt zum Wetter.
Jeanne dreht das Rotweinglas in den Fingern, und erst als sie wieder einen Schluck nimmt, da fällt es ihr auf.
Niemand schaut mehr woanders hin als zu den Fernsehbildschirmen, an jedem Tresen in der Markthalle. Das Reden der zeitig gekommenen Einkäufer ist verstummt, niemand wagt es mehr, Geräusche zu machen. Hände haben sich über Münder gelegt. Stille senkt sich über die zweihundertfünfzig Stände, und an jedem Ende der Markthallengänge sind die acht Quadratmeter großen TV3-Displays randvoll gefüllt mit verwaschenen Bildern eines verheerend zerstörten Flugzeugwracks.
Jeanne stellt das Rotweinglas auf den Tresen. Vorsichtig. Leise.
Der Wirt dreht den Ton seines Fernsehers über dem Tresen lauter. Unterbrechung des Programms, Eilmeldung.
Ein Flugzeugabsturz in den südfranzösischen Alpen.
Germanwings Flug 4U9525 ab Barcelona. Alle einhundertvierundvierzig Passagiere und die Crew tot. Zwei Opernsänger, sechzehn Schülerinnen und Schüler aus Haltern am See, einundfünfzig Spanier.
Und Jeanne Patou, die gefeierte, bepreiste, geliebte Film- und Theaterschauspielerin. Eine Ikone.
Ich bin tot?, denkt Jeanne, die am Vorabend eingecheckt hat, online. Ein Rollkoffer, schnell rein, schnell raus.
Ich bin tot?
Aber, ja, da steht es, auf Spanisch, Jeanne Patou unter den Opfern, und: Tragödie.
Tragödie ist, denkt Jeanne, als sie ein Foto von ihr einblenden, übergroß und überirdisch schön, dass die berühmten Namen all den anderen die Einzigartigkeit ihres Todes stehlen.
Und für einen schwebenden Moment glaubt sie es. Dass sie tot ist, aber es selbst nicht bemerkt hat.
Sie zeigen Wrackteile im Fernsehen und dieses ikonische Bild von Jeanne. In der Rolle der Lulu, sie war Mitte dreißig. Vor zehn Jahren, ein schönes Bild, eine perfekte Illusion. Die Leute vom spanischen Sender haben einen schwarzen Rahmen darum gesetzt. Das Licht fällt auf Jeannes Stirn, betont ihre Wangenknochen, ihr Blick ist nach oben gewendet, als würde sie beten und gleichzeitig hilflos der Verehrung ausgesetzt sein, unfähig, sich selbst zu begreifen, unfähig, ihre Macht zu erkennen. Auch das besitzt etwas Religiöses, Enthobenes.
Das gute alte Top Lighting.
Jeannes Gedanken werden jählings zornig, laut. Schon immer selektieren Männer nur wenige Frauen und erheben sie aus der Menge an Vaginen, denkt Jeanne; Männer entwerfen eine neue Skizze von ihr, setzen das Studiolicht auf ihre Stirn wie der heiligen Maria, und erst dann ist sie kein Miststück mehr, nicht mehr »wie die anderen Frauen«. Diese erhobene Frau hernach für diese Männer weiter arbeiten zu lassen, damit die Selektierte zufrieden ist und andere Frauen kleinhalten will, die es von selbst schaffen wollen und ihr den Platz streitig machen: Das ist die Macht der Männer. Eifersüchtige Äffinnen im Käfig zu erschaffen.
Jeanne drückt fest mit beiden Händen auf ihre Schläfen. Als hätte das je genutzt, diese Gedanken zu dämpfen. Die Wut, die sie mit sich trägt, ist gewachsen und so alt wie sie selbst. Die Wut, selbst jetzt, im Tod, schön und jung präsentiert zu werden.
Der Sender blendet François Hollande ein. Für einen Moment wird Jeannes’ unwirklich schönes Bild kleiner, und der gut frisierte französische Staatspräsident gibt eine Erklärung ab. Er ist erschüttert. Stammelt angemessen. Wegen allem, auch wegen ihr.
Jeanne hat ihn ein paar Mal getroffen. Er mochte es, mit ihr zusammen fotografiert zu werden. Es machte ihn sympathisch.
Tot nutzt sie ihm wenig.
Jeanne denkt an Luc, von dem sie sich getrennt hat, kurz zuvor, sie hat ihn in der graugelben Lufthansa-Senator-Lounge sitzen lassen, sagte: »Ich muss zum Flug.« Es sollte eine Trennung sein, »wir werden uns nicht wiedersehen«, jetzt wird es ihm prophetisch vorkommen und nicht wie die Zurückweisung, die es sein sollte. Von einer Frau an ihren Liebhaber. Luc war der Erste, mit dem Jeanne als verheiratete Frau geschlafen hatte, sie hatte achtzehn Jahre lang nicht mal daran gedacht, es mit jemand anderem als ihrem Ehemann zu tun.
Es.
Die einen nennen es Betrug, Seitensprung, Sünde und so weiter, die anderen Leben, Neugier.
Es war Notwehr.
Sie haben es ein paar Mal im Jahr getan, nur dort, wo sie eine fremde Tür hinter sich schließen konnten. Auch gestern Abend. Ein Zimmer in einem Hostel, Casa Gràcia, der schmale Steinbalkon zum Boulevard Passeig del Gràcia im kalten Schatten.
Haut und Berührung. Etwas wie Hunger. Und Durst.
Die Glätte seiner Haut.
Weder Jeannes Mann Bernard noch Lucs Frau Ana haben gewusst, dass Luc und Jeanne ein gelegentliches Paar waren. Oder was man so ein »Paar« nennt, das die Drehpläne abstimmt, die An- und Weiterflugzeiten, die wenigen Stunden, die man in einem dieser Hotels, angedockt an die Flughäfen, in einem quadratischen Zimmer auf einem rechteckigen Bett verbringt. Immer Barzahlung. Um mit Luc in Hotels zu schlafen, in Restaurants zu essen, Taxi zu fahren, sich einen Wagen zu mieten. Um diesem Mann, der ihr fremd ist, außer wenn sie miteinander schlafen, ein Geschenk zu machen, und alles ohne die Spur einer Kreditkartenabrechnung. Jeanne hat immer fünfundzwanzigtausend Euro in bar dabei.
Wie sie zu Beginn darauf gefiebert hatte, Luc wiederzusehen, diesen freundlichen, in seiner Lust auf sie verzweifelten Mann. Der erste Kuss, der immer mehr ein Beißen gewesen war.
Und schon wenige Minuten später der Wunsch, es möge vorbei sein, damit sie allein sein konnte, mehr Stunden zwischen ihn und sich und ihrer aneinanderreibenden Haut bringen, ihrer beiden Gerüche, die nur entstanden, wenn er bereit war, hart, und sie, entschlossen, feucht.
Allein sein. Endlich einmal allein sein.
Unbeobachtet. Nicht genötigt, sich zu verhalten.
Jeanne hat sich heute Morgen von Luc zu befreien versucht, von der Heimlichkeit, von den WhatsApps, von der Anspannung des miserablen Gewissens. Luc, der innere Notausgang aus ihrer Ehe, doch der Notausgang führte nur in einen Hinterhof mit Mauern.
Ihr Bild bleibt auf dem Bildschirm stehen, während der Nachrichtensprecher berichtet, was sie alles nicht wissen. Warum, zum Beispiel, warum hat sich der Airbus A320-211 mit der Nase voran in das Bergmassiv Trois-Évêchés gerammt?
Jeannes Bild bleibt weiter stehen, und sie, an dem Tresen, tastet nach ihrer Sonnenbrille und setzt sie auf.
Jeanne hat heute Früh als Erste angestanden am Boarding. Sie wurde eingebucht, registriert, man hat ihr eine gute Reise gewünscht, und Jeanne ist rasch weitergeschritten, durch die Tür, die langen Flure, sie hat die anderen Reisenden hinter sich und den verwinkelten Flurecken gelassen. Der Flughafen Barcelona wird gerade umgebaut, und die Fluggäste mussten sich durch ungenügend überwachte Abfolgen von Fluren und Gängen suchen, in denen Plastikplanen vor Baustellen gehängt waren, auf denen selten jemand arbeitete.
Jeanne dachte an Luc. An Luc, an Bernard, an ihre beiden Töchter. Mathilde. Katja.
Jeanne hatte ihnen Kaschmirtücher in Barcelona gekauft, ein dunkelrotes für Mathilde, ein hellblaues für Katja, und sie dachte daran, während sie an den unfertigen, nach Baustaub riechenden, nackten Wänden vorbeiging, dass in Kriegsgebieten niemand Farben trägt. Um nicht die Aufmerksamkeit der Sniper auf sich zu lenken. Die Blicke der Kampfpiloten, jener Männer, die sich von Vätern und Söhnen und Liebhabern verwandeln in Jäger und Mordende und für immer Unglückliche, die bis zu ihrem Tod an den roten Schal denken, auf den sie zielten, und deren Kinder sich schämen werden über den nachts weinenden Mann am Ende eines Flures. Die Agonie eines stillen Zimmers.
Am Ende dieser mäandernden Gedankenattacke, da widerfuhr es Jeanne, zwischen Boarding, der Wanderung durch Baustellen und dem Erklimmen der Treppe in das Flugzeug.
Mehr ein Gefühl. Weniger Gedanke, weniger Entschluss.
Ich kann nicht.
Ich will nicht.
Ich will das nicht.
Alles will ich nicht.
Verschwinden zu wollen ist ein verschlingendes Gefühl. Es beginnt im Hals, es zieht ihn zu, bis der Atem keinen Weg mehr findet. Ein Ertrinken von innen, ein Drang, sich aufzulösen, um sich zu schlagen, zu sterben, um alldem zu entgehen. Überall zu sein, bloß nicht hier.
Es waren nur zwei Schritte, die sie gehen musste. Eins, zwei.
Jeanne trat am Ende eines Ganges, kurz vor dem Rollfeld, in die schmale Aussparung zwischen zwei grauen Plastikplanen, ein senkrechter Schlitz, dessen Ränder raschelten.
Sie stieg mit dem Rollkoffer in der Hand über offene Kabel und aufgestemmte Mauern.
Sie hörte männliches Gelächter und die Geräusche von Werkzeug, Bohrer, kreischende Sägen am Ende der Halle. Sie wandte sich in die andere Richtung.
Sie lehnte sich an eine kahle Wand, nahm das hellblaue Tuch, das für Katja, und schlang es sich um den Kopf, setzte die Sonnenbrille auf und verließ die Baustelle durch eine offene Tür. Wenig später öffnete Jeanne die nächste, sie führte zum Terminal, Jeanne schwamm mit in dem Strom der Ankommenden, und sie verschwand vom Flughafen, mit gesenktem Kopf, ohne dass sie jemand aufhielt, ohne dass sie jemand beachtete, und sie nahm einen Shuttle-Bus zurück in die Stadt, bar bezahlt, ohne zu wissen, wohin. Ohne zu wissen, warum.
Ihr Handy schaltete sie ganz aus.
Jeanne Patou ist nie in dieses Flugzeug gestiegen, aber das weiß nur sie.
Und jetzt ist sie tot, und das weiß die ganze Welt.
3
2019
Ich hätte weitergehen können. Mich nicht noch einmal umdrehen. Ich tat es nicht.
Sie gingen in die Markthalle La Boqueria, und es war Bernards Körperhaltung anzusehen, dass er sich davor ekelte. Vor den Menschen, den Gerüchen, dem Essen, dem Summen der Gespräche, den Geräuschen der offenen Küchen. Es war etwas in seiner Körperhaltung, ein mühsames Unterdrücken seiner Abscheu vor ungeordnetem, vor freundlichem Leben. Vor Gruppen, die ihn nicht kannten, die ihn deswegen nicht als Spitze ihrer Menschenpyramide behandelten.
Mein Mann konnte es noch nie leiden, wenn man ihn nicht beachtete.
Wäre Bernard nicht in Paris geboren, in französischer Konformität erzogen und vorhersehbar erfolgreich geworden, hätte man sich ihn vorstellen können als jemand, der in paramilitärischen Gruppen das Sagen hatte. Nahost, Ostafrika, Kolumbien. Grünes Militärhemd, Waffengürtel. Oder ein moderner Richard Francis Burton, manischer Abenteurer, Lügner, Kamasutra-Übersetzer. Aber die Welt war schon entdeckt und bot wenig Raum für narzisstische Exzentriker.
Vielleicht gab es deshalb Krieg, überall und immer mehr, weil da etwas war, in Menschen, etwas Kriegslüsternes. Die Erregung, Angst und Gewalt zu bringen. In einem Brief an Albert Einstein schrieb Sigmund Freud von diesem Menschentrieb nach Hass und Vernichtung, und er sehe keinerlei Anzeichen, dass dies von selbst weggehe.
Mein Mann Bernard hätte so gern ein heroisches, orthodox-männliches Leben geführt, aber das Paris und das Europa des 21. Jahrhunderts war keine Wüste, keine Insel, kein Urwald, kein Dschalalabad, an dem es an genau diesem Freitag im Oktober 2019 einen Anschlag gab; in Bernards Lebensraum herrschten Kletterrosen und Papieruntersetzer, eine Akademie der Sprache, und Kreisel, die den Verkehr manierlich lenkten.
Mein Mann sehnte sich oft nach einer Möglichkeit, seine Sehnsucht nach Gewalt zu transformieren. Jemanden schlagen. Auf etwas schießen. Etwas sprengen.
Diese bebende Urlust in ihm. Als hätte sich Moloch, der Feuergott, einen zu engen, zu stolzen Menschenkörper ausgesucht. Was mich einst so anzog, so sehr, dass alles in mir schwach wurde und in seinem Feuer zerschmolz.
Ma Vie.
Mein Leben: So hatten wir uns in den guten Stunden genannt.
Ma Vie, komm her, umarme mich.
Ma Vie, lass mich in dir hinein verstecken.
Bernard würde heute noch viel schweigen, um der Frau an seiner Seite damit zu bedeuten, was sie ihm zumutete, mit ihrer unnützen Lust am Flanieren. Und das ausgerechnet, während sich überall in Barcelona erneut die Separatisten sammelten. Der wachsende Demonstrationszug wälzte sich zwar noch als eine ruhige, satte Schlange durch die Straßen, zur Kathedrale, und dann weiter den Boulevard Gràcia hoch. Friedlich, so würde es später in den Polizeiberichten heißen, eine halbe Million Menschen. Da ist friedlich nur Firnis. Darunter kochte die Stadt vor Wut, das war der Trieb, und ein falsches Wort zum schlechtesten Zeitpunkt, und die Straßen würden brennen.
Wenn ich ihnen nachginge, musste ich auf die neuen Kameras in der Markthalle achten. Die meisten Stände waren immer noch geschlossen, seit vier Tagen schon. Es gab keine dichte Menge, die mich verbergen konnte, nur wenige Touristen wagten sich heute in die Innenstadt.
Sie wird die Idee gehabt haben. Die Frau an Bernards Seite. Nicht im Hotel zu bleiben und sich über die durch den Generalstreik ausgefallenen Flüge und Züge zu ärgern, sondern rauszugehen, sich das Leben der anderen anzusehen. Was hatte sie ihm wohl dafür versprochen?
Ich musste auch auf die nervösen Beamten schauen. Die Gummigeschosse. Es roch nach brennendem Müll. Aus den Seitenstraßen strömten Menschen, die husteten.
Ich tastete nach der schwarzen Maske in der Tasche. Eine, wie sie die Demonstranten trugen, um die Überwachungskameras der Bullen zu täuschen. Sie war noch da.
Also folgte ich meinem Mann und der Frau weiter, getrieben von einem Willen, der mir fremd war.
4
2015
Jeanne trinkt von dem Wein. Ein Schluck, zwei. Einen dritten. Ich sehe ihr zu, von der Innenseite ihrer Haut, und ich weiß, der Alkohol wird die Membran zwischen uns fragiler machen. Ist Jeanne betrunken, kann ich besser atmen; und fast bin ich wieder da. Fast.
Sie fragt den Wirt, in ihrem akzentfrei gelernten Spanisch, ob sie eine Zigarette von ihm haben kann, er sieht weiterhin, mit der Hand vor den Mund gedrückt, zum Fernseher, während er ihr eine Schachtel Marlboro reicht. Er sieht weiterhin dorthin, wo ein weiteres Foto von ihr gezeigt wird. Ein neueres, kein so ikonisches, schmeichelndes, es wird noch oft zu sehen sein in den kommenden Tagen, so lange, bis Bernard, Jeannes Mann, und ihre Testamentsvollstreckerin, alle Sender in Europa und den USA auffordern werden, es gegen ein anderes, erneut emblematisches auszutauschen. Ihr Tod soll Jeanne Patou gut stehen, alles ist Image, alles ist Legende.
Jeanne raucht, es kümmert niemanden, sie denkt: Ich bin tot.
Ich bin also tot.
Alle denken, ich bin tot.
Bernard.
Sie spielt mit ihrem abgeschalteten Mobiltelefon.
Sie denkt: Aber es war doch nicht meine Schuld.
Eine verbotene Zigarette lang will sie sich Zeit nehmen, zu entscheiden. Sie kann ihren Mann anrufen und ihm sagen: Ich bin immer noch in Barcelona. Ich lebe. Ich liebe dich, trotz allem, diese Liebe hat nie aufgehört.
Oder doch, die Liebe hat aufgehört, aber ich weiß nicht, wohin sonst mit mir. Ich bin nur Jeanne, wenn ich bei dir bin.
Wer bin ich ohne dich?
Wenn du jetzt gehst, mein Kind, dann für immer, raune ich, sie überhört mich.
Sie denkt, sie könnte später lügen, und dass sie vom Flughafen ans Meer gefahren sei. Ja. Um nachzudenken. Sie habe gar nichts mitbekommen. Sie hat noch den ganzen Tag Zeit zu entscheiden, ob sie tot bleiben will.
Oder nicht.
Ihr Überleben würde eine bombastische Nachricht werden, und sie würde die kommenden Jahre immer wieder dazu Stellung nehmen müssen. Zu dem Impuls, der Vorahnung, der Intuition, dem Grund, der Absicht, dem Hergang, dem Auslöser, den Gedanken, der dazu führte, dem unausweichlichem Tod auszuweichen. Sie würde sich Worte zurechtlegen müssen, über ihr Mitgefühl, ihren Schreck, ihren Trost für all jene, die gefangen waren im Todesflug.
Sie könnte nicht einfach sagen, »ich weiß nicht«, das wäre die Wahrheit. Dinge passieren, man sagt Ja, weil das Nein sich nicht traut, man sagt Nein, weil nichts sich je ändern soll, und es ändert sich doch, egal ob Ja oder Nein.
In einem Buch haben alle Gedanken und Geschehnisse einen Grund und einen Plot und einen Sinn. Das Leben aber ist absichtslos, eine Abfolge von Fragmenten und ich-weiß-nicht, und jedes Leben endet genau gleich.
Sie müsste etwas sagen, über Gott, eine Meinung haben zum Teufel, eine Idee vom Schicksal. Und wer weiß, zu Schutzengeln, zu Astrologie, zu Karma, zu tausend Dingen, um es zu einem Wunder zu machen, dass sie nicht in das Flugzeug gestiegen ist.
Wunder glauben Menschen immer. Wahrheiten nie.
Sie würde gefragt werden, ob sie sich schuldig fühle, noch zu leben.
Sie würde gefragt werden, was sie nun damit anfange, mit dem zweiten, mit dem geschenkten Leben.
Irgendjemand würde auf die Idee kommen zu fragen, was sie in Barcelona gemacht habe. Ein Dreh sei ja nicht gewesen.
Gefickt, wissen Sie.
Fragen, ein Fluss an Fragen, und an den Ufern nur Schuld oder Sühne.
Ihre Agentin würde eine genau konzertierte Pressekampagne fahren. Sie würden Jeanne an die Absturzstelle bringen, um »gute Bilder« zu bekommen. Lange würde sie darüber nachdenken, ob ein Hut mit Schleier angemessen wäre oder lächerlich.
Jeanne steckt sich die dampfende Zigarette zwischen die Lippen, nimmt einen Zahnstocher aus dem Olivenschälchen vor ihr auf dem Tresen und bohrt ihn tief in das kleine Loch der Seitenklappe ihres Mobiltelefons. Der winzige Schuber öffnet sich. Sie zieht die SIM-Karte heraus und zerbricht sie im Aschenbecher. Sie drückt die Zigarette darauf aus.
Na also, denkt Jeanne. Also bin ich erst mal tot.
»Erst mal« ist eine Hintertür, und das weiß sie.
Sie kann immer noch von einem anderen Telefon aus daheim anrufen, sie kann immer noch beschließen, zu leben, ganz gleich, was die Nachrichten oder der französische Präsident behaupten.
Wie viele Stunden kann ein Nichtanruf funktionieren – drei, vier?
Vielleicht zwölf.
Nicht länger als vierundzwanzig Stunden, dann muss sie sich endgültig entschieden haben. Danach gibt es keinen Weg zurück.
Ab jetzt tickt die Uhr; sie tickt, seitdem die Eilmeldung in allen Fernsehsendern der Welt unablässig am unteren Bildrand entlangläuft.
Eine Nacht, Jeanne. Eine Nacht bist du frei, wispere ich, dicht an ihrem Sein.
Sie wedelt mit der Hand, als wollte sie meine Stimme verscheuchen. Nice try.
Der spanische Sender hat einige Daten von ihr zusammengepanscht. Zuletzt in der Rolle eines Mannes in einem Tschechow-Stück; wer als Schauspielerin etwas gelten wollte, durfte nicht nur drehen, man musste auf den Brettern nah am Atem des Publikums sein und sich den feindseligen, lüsternen Blicken dicklicher Beflissener und Kulturpudeln aussetzen.
Kritisiert, gefeiert, nie ausfallend, eine moderne Göttin, eine geliebte Ikone, so wandelbar, so demutsvoll, wie schrieb es der Figaro: »Es ist, als hielte Jeanne Patou ihren kurtisanenhaften Körper bereitwillig für den nächsten Gast, die nächste Figur, das nächste Leben hin. Sie lässt die Rollen in sich eindringen und vermag sich selbst auf eine Art und Weise zu ignorieren, dass wir ebenso vergessen, dass sie es ist, die dem fiktionalen Charakter Obdach gewährt. Die Bereitschaft, dienstbare Hülle zu sein, die eigene innere Leere permanent mit fremder Leute Angst, Rausch und Scheitern zu ersetzen – das ist eine Schauspielkunst, die nah am Wahnsinn ist, aber noch näher am Genie.« Was Männer eben so über Frauen schreiben, wenn ihnen der Stift ausrutscht. Selten gelingt es einem Journalisten, den Körper oder den Mund einer Frau zu ignorieren und nur bei ihrer Leistung zu verbleiben.
Es ist zu befürchten, dass der Figaro sich wiederholen wird, wenn er den Nekrolog aus dem Stehsatz zieht. Jede größere Zeitung legt Nachrufe auf Vorrat an, um nicht kostbare, geldwerte Zeit zu verplempern, wenns endlich so weit ist.
Tod macht Auflage.
Jeanne greift nach meiner Hand.
So sitzen wir da, zwei Frauen in einem Körper, ihre linke Hand mit meiner rechten verschränkt.
Sie zittert.
Und jetzt?, fragt Jeanne Patou. Was machen wir jetzt?
Sie redet das erste Mal seit einem Jahrzehnt mit mir; sie ist gut darin, zu ignorieren, dass sie nicht Jeanne Patou ist, dass ich es bin, die ihr Obdach gewährt, dass sie eine Rolle ist, die ich mir angezogen habe, ich habe mir ihre Haut, das Leben und den Namen übergestülpt.
Ich bin die dienstbare Hülle.
Nicht sie, aber auch das weiß nur ich, und nicht die ganze Welt.
Sie fragt wieder: Und was machen wir jetzt?
5
2019
Einige Chaoten des schwarzen Blocks lungerten vor der Markthalle herum und konnten es nicht erwarten, sich ihre Masken überzustreifen, Steine und Flaschen zu werfen; man hörte von organisierten Aufständen, die es in der Nacht vor der Polizeiwache im Gotischen Viertel geben würde, sie nannten sich »Demokratischer Tsunami«. Sie wollten Gerechtigkeit, nicht Krieg, aber sie würden Gewalt als einzige Antwort auf das begangene Unrecht gegen die Freiheitsbewegung in Kauf nehmen. Organisiert über Telegram und eine eigene Protest-App. Ich besaß kein Handy mehr, aber ich wusste, wo ich mir eins leihen konnte. Die Sorte leihen, bei denen man vergaß, das Geliehene zurückzugeben. So wusste ich, wo der Tsunami anrollen würde.
Ich kaufte mir vor dem schmiedeeisernen Tor am Eingang der Markthalle eine Tüte mit Pata-Negra-Schinkenfetzen, die ich mir Stück für Stück in den Mund steckte, und sah Bernard dabei zu, wie er ohne Jeanne Patou weiterlebte. Ich aß direkt aus der Tüte, es war, als schaute ich einen Kinofilm.
Die Frau an seiner Seite hatte es für den Moment geschafft, ihren Ellenbogen zurückzuerobern, und ließ ihre Blicke über Auslagen voller Süßigkeiten streicheln.
Schliefen sie jede Nacht miteinander?
War es gut für sie?
Hatte er immer noch diese Usance, seinen nass geleckten Daumen ungefragt in einen weiblichen Anus zu stecken?
Wollte ich, dass er sich umdrehte, weil er spürte, dass ich ihm folgte? Wollte ich prüfen, ob mir das wirklich egal war oder mich doch noch interessierte? Wollte ich wissen, ob er in den viereinhalb Jahren ohne mich ein anderer geworden war?
Glücklicher.
Oder wenigstens unglücklicher.
Ich hatte Herzklopfen, als ich meinen Mann sah, vielleicht aus Liebe, vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht aus Angst. Vielleicht vor Glück, ihn noch einmal zu sehen, dieses Glück, das so großherzig über all das Unglück hinwegschaute und flüsterte: »Schau, da ist er. Der Liebste.« Diese Selbstverzauberung; dieser Mann, der immer noch etwas in mir in Bewegung brachte, ins Rotieren, einen in mir sonst schlafenden Motor, der nur durch reines, fremdes Feuer angetrieben wurde.
Es gab eine Theorie, von vielen, aber eine, die sich mir deutlich leichter erschloss als Astrologie oder Engel oder Kismet oder freudianische Psychologie: das Human Design. Sie ging davon aus, dass jeder Mensch einen individuellen, mechanischen Bauplan besaß. Eine innere Architektur aus Winkeln, Toren, Motoren, Verbindungen, die Informationen und Impulse funkten. Vier Motoren, die bestimmte Emotionen und Handlungen antrieben, manche davon aktiv, die meisten inaktiv. Je mehr aktive Motoren jemand besitze, desto weniger beeinflussbar sei er oder sie, denn die inaktiven Motoren würden nur durch eine äußere Begebenheit, einen anderen Menschen, in Bewegung gesetzt. Deswegen lebten die meisten Menschen in Lethargie, aber könnten durch einen anderen Menschen in Bewegung gebracht werden. Wenn sie sich dann zum ersten Mal komplett fühlten, wenn all ihre Motoren rundliefen, wenn sie sich und das Leben ganz und prall spüren könnten.
Verlasse dieser Mensch sie, stünden die Motoren still, und sie fielen wieder in sich zusammen. Ausgeschaltet.
Die Illusion von Getrenntheit, Unabhängigkeit und freiem Willen jedes einzelnen Menschen war in dieser Theorie der menschlichen Mechanik und Interaktion zwischen den Motoren aufgehoben: Manche begegneten einander als zwei komplementäre Bauteile einer größeren Mensch-Maschine, die auf Hochtouren lief, wenn genau diese zwei Körper beieinander waren. Und wie es eben so war mit Maschinen: Liefen sie heiß, zerstörten sie sich. Und sie konnten sich selbst nicht ausschalten, nur durch Zerstörung. Trennung. Nullkontakt.
6
2015
Der Dienstag, an dem wir für die Welt gestorben sind und Jeanne mich gefragt hat: Und was machen wir jetzt?
Am liebsten möchte ich ihr sagen, dass sie sich die Nacht abschminken kann. Das erst mal. Wenn sie sich nicht bis heute Abend bei ihrer Familie meldet, dann, weil sie es längst so will. Nicht mehr Dasein. Auch wenn sie nicht weiß, warum.
Erinnerst du dich an Emma May?, antworte ich stattdessen.
Natürlich, sagt Jeanne. Ich war gerade mit Katja schwanger, als gedreht wurde und ich die blöde Kuh gespielt habe. Emma hätte alles für diesen schwindsüchtigen Burschen getan, der ihr vorgaukelte, ohne sie nicht leben zu können. Mein Gott. Das war reine Zuhälterei, verkleidet als Kunstfilm.
Sie hat ja alles für ihn getan, sage ich. Am Ende gab sie ihr Leben für seines. Ihr Leben für etwas, was er verbrochen hatte, nicht sie.
So weit muss es aber jetzt nicht kommen, oder?, fragt Jeanne. Außerdem ging Emma deshalb auf den Henkersplatz, weil sie den Burschen damit demütigen wollte, dass sogar im Angesicht des Todes ihre Liebe zu ihm größer und edler war als seine Feigheit, zu gestehen, dass nicht sie sein Verbrechen begangen hatte. Emma war stolz darauf, am Ende, stärker zu sein als er. Sie wusste, er würde sie nie vergessen.
Eigenartiger Stolz, sage ich.
Das ist Rache, sagt Jeanne. Ihn damit strafen, dass er mit ihrem Tod weiterleben muss.
Ich halte mich nicht damit auf anzumerken, dass es bestimmten Menschen hervorragend gelingt, gegenüber dem Tod anderer absolut gleichgültig zu bleiben und munter vor sich hin zu leben. Frauen wird bereits Hybris vorgeworfen, wenn sie sich gleichauf mit einem Mann empfinden. Ihr Tod jedoch ist in den Augen der meisten drittklassig. Und dann noch einer aus Liebe? Lachhaft.
Ich habe nie bemerkt, dass auch ich so wütend bin.
Und als ich es bemerkt habe, habe ich nicht geahnt, für wie viele Leben die Wut reichen muss.
Jeanne ist in Schweigen versunken. Ihr Tod nimmt sie mit.
Ich lasse mir deshalb Zeit, versuchsweise selbst zu handeln.
Ich weiß nicht mehr genau, wer ich bin, ohne Jeanne und ihren exakt ausgearbeiteten Rollencharakter.
Ich schaue umher. Aber in der direkten Nähe der Bar Central finde ich nicht, nach was ich suche.
Ich sage Jeanne in meinem Kopf, dass wir ihre Jacke hängen lassen werden und den Rollkoffer stehen und die Gabel so an den Teller legen, als würden wir gleich die lauwarm gewordenen Kroketten weiteressen.
Aber die Taschendiebe, sagt Jeanne.
Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Und nehme mir eine abgelesene Illustrierte vom Tresen, eine ¡Hola!.
Ich gehe langsam vorbei an Dutzenden Köpfen, die auf Fernseher starren, in kollektivem Entsetzen und in kollektiver Erleichterung, selbst noch am Leben zu sein. Wir sind alle allein mit unserer Angst vor dem Tod, und alle gleich darin.
Geduldig gehe ich die Hallengänge ab und zähle die Überwachungskameras. Vier.
An einem Tresen, an dem Salat und dickflüssige bunte Obstsäfte verkauft werden, finde ich, wonach ich suche.
Im Vorbeigehen nehme ich das Portemonnaie aus der rotledernen Handtasche der Frau, die sie mit dem Riemen über die Rückenlehne des Barhockers gehängt hat. Und vergaß, in dem Augenblick, als die Bilder aus den südfranzösischen Alpen kamen. Sie hat meine Größe, meine Augenfarbe, das muss reichen.
Sehr ruhig gehe ich in den nächsten Gang, lege das fremde Portemonnaie in die Mitte der aufgeschlagenen Zeitung, die so als Sichtschutz dient, nehme den Ausweis und den Führerschein, stecke beides in meine hintere Hosentasche, gehe zurück und lasse das Portemonnaie aus der zusammengerollten Zeitschrift zurück in die Tasche der Frau gleiten.
Ich wiederhole das Verfahren an einem anderen Tresen, der Stockfischbällchen verkauft und dazu das kräftige Mahou-Bier, und dasselbe tue ich an einem Stand mit Nähmaterialien, Knöpfen und riesigen Nadeln, und ich tue es noch einmal an einem Stand mit Wildfleisch, eingelegte Rehschenkel und Wildhasenwurst.
Ich bin taub und stumm, und in mir dröhnt es doch. Es ist, als suchte ich einen Weg durch Nebel, und der nächste Streifen Pfad zeigt sich erst, wenn ich ihn gehe.
Drei Frauen und einen Mann bestehle ich auf diese Art, ich nehme ihre Papiere, aber kein Geld. Geld hat Jeanne, die Scheine in verschiedenen Größen sind in ihrem Koffer, ihrer Tasche und im Innenfutter ihres Mantels verteilt.
Ich habe am Ende vier Ausweise und drei Führerscheine von Menschen, deren wesentliche Merkmale mir ähneln: Größe, Augenfarbe, Gesichtsschnitt, Alter. Irgendwas mit vierzig.
Sie werden denken, sie hätten sie verlegt oder irgendwo liegen lassen. Mit ein bisschen Glück. Mehr verlange ich gerade nicht.
Nur flüchtig erreicht mich die Erkenntnis, dass, kaum dass ich Jeanne loswerden könnte, schon wieder anfange, mir eine neue fremde Identität zu suchen, die ich mir überstreifen kann.
Aber gut. Eins nach dem anderen.
An einem Stand kaufe ich ein billiges braunes Tuch, ockerfarben, unfassbar scheußlich, und schlinge es mir statt des hellblauen Tuches um den Kopf. Keine Farben, damit mich die Sniper nicht finden.
Ich denke wieder an Emma May. Eine frühe viktorianische Rolle, sie hat Jeanne das gebracht, was man »Durchbruch« nennt; man steht auf einmal auf Gästelisten, und die Anfragen der Presse häufen sich genauso wie die Google-Abfragen nach »Jeanne Patou nackt«. Jeanne hat für Emmas Rolle ein Jahr Unterricht bei einem alternden Bühnenmagier genommen, dessen Finger kein Alter und keine Skrupel kannten. Er hieß Cleo, halb Mann, halb Frau, ganz Satyr. Ein Illusionszauberer und enthusiastischer Taschendieb.
Emma May stahl, log, prostituierte sich. Unschuldig schuldig, ein Opfer ihrer eigenen Liebe, eine beliebte Rolle für junge Frauen, die man gern halb bekleidet und mit aufgerichteten Brustspitzen auf großen Leinwänden sehen will. Am Ende stirbt immer die Frau in den Dramen, die von Männern geschrieben, von anderen Männern finanziert, von ihren Männerfreunden konzipiert und dirigiert und von Frauen angesehen werden, die glauben, die wahre Liebe erkenne man daran, dass sie wehtut.
Von Cleo hatte Jeanne das Stehlen gelernt, und da ich gerade nichts weiter zu tun hatte, lernte ich es auch. Schließlich waren es immer noch meine Finger, die ich Jeanne zur Verfügung stellte.
»Du musst es in Ruhe tun und innerer Vergnügtheit. Deine Hand ist schnell, doch in dir bist du langsam, du kennst keine Aufgeregtheit. Es ist wie beim Singen: Du denkst einen tiefen Ton, wenn du hoch singst. Wie beim Tanzen: Du atmest ruhig, während deine Beine sich schnell bewegen. Wie beim Stehlen: Du tust es verstohlen, und in dir bist du ganz offen, ganz selbstverständlich, denn es ist deins. Und warte auf einen Moment, an dem die Reizüberflutung hoch ist und dein Kunde in seiner Wahrnehmung völlig woanders.«
Cleo arbeitete mit Jeanne erst an Puppen, deren Kleidung Glöckchen trugen, die bimmelten, wenn sie zu ungeschickt war. Dann übte sie an ihm, und eines Abends vergnügten sie sich bei einer der César-Verleihungen – Cleo in seinem schönsten Kleid als schillernder Transvestit –, allen Männern die Schlüssel, Feuerzeuge, Visitenkarten und Koks aus Hosen- und Innentaschen zu ziehen und einem anderen wieder unterzuschieben. Es ist unglaublich, wie viele Männer Kleingeld und Fussel in Kleinfamilien in ihren Taschen aufziehen.
Was für ein herrliches Chaos wir anrichteten. Wir steckten Kondome in Taschen von Menschen, deren Ehen daraufhin kriselten, wir schmuggelten Kokstütchen in Mäntel, wir tauschten Autoschlüssel reihum und erfreuten uns an dem Streit auf den Parkplätzen und dem Stau der Taxis, die daraufhin gerufen wurden.
Einige Jahre später wurde Cleo erschlagen, auf der Straße.
Von irgendwelchen Bücklingen, die es nicht ertragen konnten, die Ironie, den Witz, die Cleo so zu eigen waren, und die Lust auf Pailletten und Ohrringe.
Cleo starb in der Gosse, allein.
Zurück an unserem Tresen in der Boqueria, beiße ich von den inzwischen kalt gewordenen Schinkenbéchamelkroketten ab, sie sind köstlich, ich stopfe mir Pata Negra nach, spüle alles mit Tempranillo herunter und lege die vier Ausweise vor mir auf die bunten Fliesen.
Und?, fragt Jeanne. Sie legt rasch die linke Hand über die Papiere.
Sie sind alle so groß wie ich, sage ich, zwei einige Jahre jünger, eine älter, der Mann ist mein Jahrgang, alle braune Augen, dunkles Haar, die Gesichtsform ist ähnlich, und das ist das Wichtigste: Wir werden Ausweise brauchen in den nächsten Tagen. Und Wochen. Und danach.
Danach?, fragt Jeanne. Gibt es denn ein Leben nach dem Tod?
Ich weiß es nicht.
Jeanne wünscht sich, ihre Hosen gegen Jeans zu tauschen, ihr raffiniertes Seidenoberteil gegen einfache Baumwolle, ihre halbhohen Stiefeletten gegen flache Turnschuhe. Sich das Make-up aus dem Gesicht zu reiben. Sie fantasiert davon, sich jetzt sofort und gleich Haarfärbemittel zu kaufen.
Stopp, sage ich. Das ist kein Film.
Ihre Panik schwillt. Sie denkt daran, dass sie heute früh vielleicht doch auf Kameras zu sehen gewesen ist, wie sie den Flughafen verlässt. Unschuldig, da noch völlig unschuldig. Dass die Kabinenchefin die Passagiere mit ihrem Handklicker doch durchgezählt hat, fehlt da nicht jemand? – nein, ich bin auf hundertvierundvierzig gekommen – na, gut, wir sind eh schon spät dran –, und dass die ganze Welt erfahren wird, dass Jeanne lügt, dass sie allen zumutet, um sie zu trauern.
Ihr Atem wird hektisch und flach.
Wir müssen hier weg, murmelt sie. Irgendwohin, die Tür schließen und abwarten, es kann jederzeit jemand mit dem Finger zeigen: »Aber da ist sie doch!«
Wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand die Aufzeichnungen ansieht, auf der Suche nach Passagieren, die in einem Flugzeug eingeschlossen waren und starben, deren Gliedmaßen unter der Wucht auseinandergerissen wurden?
Wie oft kommt so etwas vor, was ich getan habe?, fragt sie.
Gar nicht, sage ich.
Aber die Lebensversicherung, sagt Jeanne. Die Tantiemen. All das Geld. Mein Geld. Sie werden sichergehen wollen, dass ich wirklich tot bin, bevor sie all das freigeben. Sie werden mich suchen. Sie werden in jede Bergritze schauen, und wenn sie mich nicht finden? Was wird Luc sagen? Wird er jetzt etwas sagen, wo ich tot bin, und sich wichtig damit tun, dass er in mir war?
Du hast zu viele Filme geschaut, sage ich. Jeanne steckt mich an mit ihrer Angst.
Wieso der Mann?, fragt sie. Tippt auf den Ausweis.
Ich spiele mit dem Gedanken, überzulaufen auf die andere Seite, erkläre ich. Vielleicht wird man dich suchen. Aber nicht ihn.