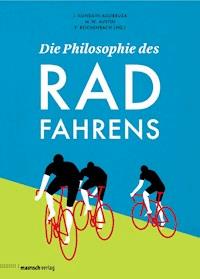
Die Philosophie des Radfahrens E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Die Philosophie des Sports
- Sprache: Deutsch
Warum macht Fahrradfahren glücklich - trotz Regen, Gegenwind und steiler Berge? Warum geht alles schief, wenn man sich zum ersten Mal auf eine lange Fahrradtour wagt? Wie sieht der ideale Radweg aus? Was bedeutet Critical Mass? Warum passieren die kuriosesten Ereignisse der Tour de France immer am Alpe d'Huez? Und sollte das schnellste Fahrrad der Welt weiterhin verboten bleiben? In Die Philosophie des Radfahrens zeigen internationale Autoren aus verschiedenen Disziplinen - Philosophieprofessoren, Sportjournalisten, Radprofis - kenntnisreich und leicht verständlich, dass Philosophie und Radfahren ein perfektes Tandem bilden können. Sie nehmen Helden und Anti-Helden aus der Welt des Radsports ins Auge, schreiben über die Ethik von Wettbewerb und Erfolg, finden auf dem Rad Momente der Muße und zeigen, wie Radfahren unsere Sicht auf die Welt dauerhaft verändern kann. Und sie geben stichhaltige Argumente für das Radfahren in all seinen Ausformungen: Als tägliche Fahrt zur Arbeit, als Sport, als Reise, als Lebensart. Ein Buch für alle, die es glücklich macht, sich tagtäglich auf den Sattel zu setzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Peter Reichenbach - Vorwort
Steven D. Hales - Auf die Harte Tour - Rad fahren und philosophische Lektionen
Maximilian Probst - Der Drahtesel - Die letzte humane Technik
Robert H. Haraldsson - Philosophische Lektionen vom Radfahren in der Stadt und auf dem Land
Steen Nepper Larsen - Radfahrer werden
Peter M. Hopsicker - Rad fahren lernen
Catherine A Womack und Pata Suyemoto - Rad fahren wie ein Mädchen
Zack Furness - Critical Mass gegen die Automobil-Kultur
Holger Dambeck - Dem Paradies so nah
Heather L. Reid - Mein Leben als Philosophin auf zwei Rädern
Michael W. Austin - Aus den Schuhen auf den Sattel
Bryce T. J. Dyer - Lasst dem Tier freien Lauf - Das Zeitfahren und die Technik
Raymond Angelo Belliotti - Außer Kontrolle
Andreas de Block und Yannick Joye - Eddy Merckx - Ist der Kannibale ein fairer Sportler?
Andreas Zellmer - Der Gipfel der Tour de France
Tim Elcombe und Jill Tracey - Die Tour de France, das Leiden und das bedeutungsvolle Leben
Herausgeber
Impressum
PETER REICHENBACH
VORWORT
Radfahren verändert unsere Sicht auf die Welt. Und fast immer geht dieser neuen Sichtweise ein Schlüsselerlebnis auf dem Fahrrad voraus: Das kann das Meistern einer Bergetappe bei der Tour de France sein, die Teilnahme an einer Critical-Mass-Demonstration oder auch einfach die tägliche Fahrt zur Arbeit gegen Wind, Regen, Hitze und Verkehr. Alle AutorInnen dieses Buches sind leidenschaftliche Radfahrer und haben solche Momente selbst erlebt. Als radfahrende Philosophen schildern sie aber nicht nur ihre eigenen Erfahrungen, sondern bringen auch das nötige Rüstzeug mit, um ihre Erlebnisse und Erkenntnisse in einen größeren Zusammenhang zu stellen und in die richtigen Worte zu fassen.
Aus Fehlern lernt man – das gilt auch für das Radfahren. Also startet dieses Buch mit einem unterhaltsamen Text von Steven D. Hales, in dem er beschreibt, was alles passieren kann, wenn man sich ohne Training, Ausrüstung und ausreichende Ernährung auf längere Touren wagt. Gleichzeitig zeigt er aber auch Aspekte und Konsequenzen auf, die unkalkulierbar und daher umso wichtiger fürs Radfahren sind – und damit nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus philosophischer Sicht interessant werden.
Ähnliche Erfahrungen hat Robert H. Haraldsson gemacht, allerdings im isländischen Winter seiner Heimatstadt Reykjavík. Er hat für seine tägliche Fahrt zur Arbeit das Auto gegen das Fahrrad eingetauscht und berichtet darüber, warum er verdammt froh ist, diese Entscheidung getroffen zu haben.
Auch in südlicheren Gefilden kann uns das Fahrrad etwas beibringen. Der Däne Steen Nepper Larsen wirft einen phänomenologischen Blick darauf, wie er eins wird mit seinem Fahrrad und wie eine Radtour durch Wind und Regen auf Mallorca ihn erst zehn Jahre älter und dann wieder zehn Jahre jünger gemacht hat – und ihm obendrein eine ganze Reihe an Erkenntnissen beschert hat.
Aber wie fängt man überhaupt mit dem Radfahren an? Für uns scheint das eine Selbstverständlichkeit zu sein, wir denken nicht nach über Balance und Schwerkraft. Peter M. Hopsicker zeigt uns, dass das nicht immer so war, und nimmt uns mit in die Anfänge des Fahrradfahrens – sowohl ins 19. Jahrhundert als auch in die eigene frühe Jugend.
Das Fahrrad kann, vor allem in den Städten, nicht ohne das Automobil gedacht werden. Jeder Radfahrer kennt den Moment, in dem er von Autofahrern übersehen, geschnitten oder gedrängelt wurde. Doch wie sähe eine Welt aus, in der es nur noch Fahrräder gäbe? Welche Rolle kann der Protest in Form der Critical-Mass-Aktionen spielen, und welche konkreten baulichen Maßnahmen sind denkbar, um ein besseres Miteinander von Autos und Fahrrädern zu ermöglichen? Maximilian Probst, Holger Dambeck und Zack Furness geben erhellende Antworten auf diese Fragen.
Denkt man an Radsport, fällt einem natürlich sofort die Tour de France ein. Von deren Highlights und Kuriositäten erzählt Andreas Zellmer, während Tim Elcombe und Jill Tracey versuchen, die Leistungen der Fahrer zu beschreiben. Schnell wird aber auch klar, dass der Mensch versucht ist, diese Leistungen immer weiter zu steigern, und so kann das Thema Doping nicht ausbleiben. Heather L. Reid beschreibt in ihrem Bericht ausführlich, wie es sich anfühlt, gegen gedopte Rivalinnen zu verlieren. Raymond Angelo Belliotti zeigt am Beispiel des Fahrers Marco Pantani, dass man auch aus philosophischer Sicht lieber auf Dopingmittel verzichtet.
So unterschiedlich die Ansätze in diesem Buch auch sein mögen – allen gemeinsam ist, dass sie das Radfahren als Lebensgefühl begreifen, als einen Freiraum und als eine Art, die Welt neu zu erfahren und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Diese neue Sicht auf die Welt macht also hoffentlich nicht nur weise, sondern auch glücklich.
STEVEN D. HALES
AUF DIE HARTE TOUR – RAD FAHREN UND PHILOSOPHISCHE LEKTIONEN
Übersetzung: Peter Reichenbach
Aus der Höhle fahren
Meine erste ernst zu nehmende Fahrradtour unternahm ich von meinem Wohnort in Pennsylvania bis zu dem kleinen Dorf Carlisle, in der Nähe von Harrisburg. Mein Freund Tim, der gerade anfing, Radsport zu betreiben, und dessen Onkel und Tante in Carlisle wohnten, hatte mich überredet mitzufahren. Wir entschieden uns, den gesamten Hinweg – 152 bergige Kilometer inklusive zwei Bergüberquerungen – an einem Tag zu fahren. Meine längste gefahrene Strecke war bis dahin 48 Kilometer. Ich dachte, ich sei in einigermaßen guter Verfassung: Ich spielte zwei- bis dreimal pro Woche Tennis, fuhr die zehn Kilometer zum Training sogar immer mit dem Fahrrad und ging jeden Tag zu Fuß zur Arbeit. Mein damaliges 18-Gang-Fahrrad war ein Schwinn World Sport mit dick gepolstertem Sattel. Ich dachte mir, dass es klug wäre, vor der großen Tour nach Carlisle eine etwas längere Strecke zu fahren, und fuhr in die nächstgelegene Stadt: Eine schöne, flache 37-Kilometer-Strecke entlang des Susquehanna-Flusses. Ich fuhr diese Strecke mehrmals und fühlte mich gut vorbereitet. Ich kann die erfahrenen Fahrradfahrer jetzt schon lachen hören.
In Platons Höhlengleichnis halten angekettete Gefangene die flackernden Schatten an den Wänden für die Wirklichkeit. Es ist die Philosophie, die uns aufsteigen lässt – schmerzhaft und mit Widerständen – hinaus in das blendende Licht des Wissens. Wie Platons Gefangene musste ich viel lernen. Im Folgenden also meine sechs philosophischen Lektionen, die ich beim Herausfahren aus der Höhle gelernt habe.
Tim holte mich ab. Ich schnappte mir meinen kleinen Rucksack und wir fuhren los. Die ersten 65 Kilometer fuhren wir problemlos und ohne anzuhalten, dann entschlossen wir uns, eine Pause zu machen und Sandwiches zu essen. Nach einer guten Stunde Pause stand ich wieder auf: Meine Beine fühlten sich an, als wären sie aus Gummi. Okay, kein gutes Zeichen. Wir setzten uns wieder auf unsere Räder, und nach 20 Minuten Fahrt war ich total fertig. Mein Gesäß schmerzte, meine Beine taten weh, mein Rücken auch und ich war vollkommen erschöpft. Wir hielten an, um eine weitere Pause einzulegen. Danach fuhren wir 15 Kilometer, bis wir erneut eine Pause brauchten. Danach schafften wir acht Kilometer. Wir waren beide komplett hinüber. Hatte ich schon erwähnt, dass einer der langen Anstiege am selben Tag frisch geteert worden war und unsere Reifen in heißem Asphalt versanken? Und abgesehen von der Erschöpfung war ich auch nicht auf die Langeweile vorbereitet.
Meine gesamte Familie spielt Golf, und auch ich versuchte mich als Jugendlicher darin, langweilte mich beim Spielen aber wahnsinnig. Nach einem schlechten Abschlag muss man 130 Meter laufen, ärgert sich währenddessen furchtbar und bekommt dann erst eine Chance, sich zu verbessern. Tennis hingegen passte viel besser zu mir. Tennis ist ein schneller Sport: Nach einem schlechten Schlag hat man nach wenigen Sekunden die Möglichkeit, es besser zu machen. Ein zwei Stunden dauerndes Tennismatch bedeutet höchste Konzentration und maximale sportliche Anstrengung. Die endlosen Stunden auf dem Fahrradsattel dagegen, die wir mühselig durch die Landschaft Pennsylvanias fuhren, waren langweilig. Und schmerzhaft.
Endlich, endlich hielten wir vor dem Haus von Tims Tante und Onkel. Ich fühlte meinen Hintern nicht mehr und mein Nacken hatte die Kraft eines verwelkten Spargels. Tims Tante hatte angenommen, wir wären am Verhungern, und hatte ein großes Abendessen für uns vorbereitet, doch ich war so erschöpft, dass ich kaum einen Bissen hinunterbekam. Sogar einzuschlafen schien viel zu anstrengend. Noch Wochen später überkam mich Angst, wenn ich einen Anstieg hochfuhr, selbst wenn ich im Auto saß. Die Heilung der psychischen Wunden dauerte lange.
Disziplin und Diät
In Jenseits von Gut und Böse schrieb der große deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche in Sektion 188: »Das Wesentliche, im Himmel und auf Erden, wie es scheint, ist, […] dass lange und in Einer Richtung gehorcht werde: dabei kommt und kam auf die Dauer immer Etwas heraus, dessentwillen es sich lohnt, auf Erden zu leben, zum Beispiel Tugend, Kunst, Musik, Tanz, Vernunft, Geistigkeit, – irgendetwas Verklärendes, Raffiniertes, Tolles und Göttliches.«1 Nietzsche sagt hier also, dass nichts von Wert leicht zu erreichen ist, und dass es selten vorauszusehen ist, was einmal von Wert sein wird. Ich verstand das schnelle, variable und actionreiche Tennisspiel. Aber die vergleichsweise langsamen und systematischen Bewegungsabläufe einer Langstreckenfahrt auf dem Fahrrad erforderten nicht nur einen anderen Einsatz meiner Kräfte, sondern auch eine andere geistige Haltung.
Der bloße Entschluss, eine lange Tour zu fahren, reicht nicht aus, auch nicht, es einfach zu versuchen. In Also sprach Zarathustra schreibt Nietzsche: »Wenn ich je mit dem Lachen des schöpferischen Blitzes lachte, dem der lange Donner der That grollend, aber gehorsam nachfolgt […].«2 Eine neue Idee, ein neues Projekt, Ziel oder Abenteuer ist immer aufregend und man freut sich, doch die tatsächliche Durchführung ist oft anstrengend und benötigt Zeit. Beim Radfahren musste ich lernen, mich dem Donner der Tat, beinah meditativ, hinzugeben. Ich erinnere mich, dass ich mich bei einer 130 Kilometer langen Fahrt durch strömenden Regen wie eine Maschine fühlte: Meine Beine waren Kolben, die sich rhythmisch bewegten, Kilometer fraßen, während das Regenwasser an mir herablief wie Maschinenöl. Während dieser Fahrt im kalten Regen, bespritzt mit Schmutz von der Straße, fühlte ich eine Art perversen Stolz. Nur durch das Befolgen der impliziten Regeln des Radfahrens konnte ich seine Tugenden, die Stille, die Einsamkeit, die beinah überlebenskünstlerische Natur des Fahrens weit weg von zu Hause erlernen. Radfahren bedeutet, das Leben auf das Nötigste zu reduzieren, ohne einen anderen Anspruch als den, immer weiter in die Pedale zu treten. »Warum sollen wir in solcher Eile, solcher Lebensverschwendung leben?«3, schreibt Thoreau in Walden. Vereinfache, vereinfache!
Im darauffolgenden Sommer versuchte Tim mich zu einer weiteren Fahrradtour zu überreden. Es sollte von Providence in Rhode Island bis nach Provincetown am Ende von Cape Cod und wieder zurück gehen. Nach den vielen Steigungen auf unserer Tour nach Carlisle schwor Tim, dass die Strecke dieses Mal so flach sein würde wie die Gehirnstromanzeige eines Toten. Nun, die Erinnerung an die Schmerzen des vorherigen Sommers war weitgehend verblasst und ich sagte zu. Trotz allem hatte ich aus den Erfahrungen des letzten Jahres gelernt: Ich musste trainieren. Ich hatte mir einen vergleichsweise kurzen 18-Kilometer-Rundkurs als Trainingsstrecke auserkoren, der allerdings in der Mitte einen (für mich!) Killeranstieg aufwies. Ich benötigte ein halbes Dutzend Versuche, bevor ich es ohne abzusteigen nach oben schaffte. Das Training zahlte sich aus. Ich war immer noch nicht gut auf langen Strecken, aber Steigungen beunruhigten mich nicht mehr. Was mir bei unserer langen Tour auffiel, war, dass wir sehr viele Kalorien verbrannten. Auf halber Strecke nach Cape Cod übernachteten wir bei unseren Freunden Jim und Lynn, die beeindruckt davon waren, welch unglaubliche Mengen an Muscheln, Hummer und Chardonnay wir vertilgen konnten. Selbst Jim dachte darüber nach, mit dem Radfahren anzufangen, nachdem er gesehen hatte, wie wir zum Frühstück Gebäck verputzten, das eine halbe Konditorei gefüllt hätte. Aber die eigentliche Erkenntnis hieraus wurde mir erst im folgenden Sommer klar.
Im nächsten Jahr wollte Tim eine noch größere Tour fahren. Wir beschlossen, die mehr als 720 Kilometer von Montreal in Kanada bis nach Providence, Rhode Island zu fahren. Wir packten unsere Fahrräder ein und fuhren mit dem Bus bis Montreal. Am ersten Tag fuhr ich zum ersten Mal knapp unter 170 Kilometer bis Derby Line in Vermont. Ich fuhr immer noch das Schwinn-Fahrrad mit dem schwammigen Sattel, hatte einfache Pedale ohne Klicksystem und trug mein gesamtes Gepäck im Rucksack auf meinem Rücken. Meine fahrradspezifische Ausrüstung bestand aus zwei Trinkflaschenhaltern, einer kleinen Tasche unter meinem Sattel und einer Fahrradhose. Ich glaube, ich trug alte Gewichtheber- statt Fahrradhandschuhe. Offensichtlich war meine Lernkurve steiler als die Steigung des Mont Ventoux. Wir wachten auf, aßen ein herzhaftes Frühstück und fuhren los. Nachdem wir die Stadt verlassen hatten und ländlichere Gegenden erreichten, stellten wir fest, dass es die reine Freude ist, in Kanada Fahrrad zu fahren: breit angelegte Seitenstreifen, vergleichsweise höfliche Autofahrer und viele Fahrradwege. Wir kamen schnell voran und waren zur Mittagszeit in Granby, seit unserem Frühstück hatten wir nichts zu uns genommen. Wir sahen eine reizende Crêperie und dachten bei uns, dass diese altmodischen französisch-kanadischen Häppchen perfekt wären für … zwei knallharte Hardcore-Radfahrer, die gerade dabei waren, 200 Kilometer zu fahren? Ich gebe zu, wir waren dumm – was für eine Art Ernährung sollten Crêpes für Sportler schon sein? Hätten wir nur Nietzsches Idee befolgt, dass man allem voran eine Philosophie der Ernährung braucht, um die Moral zu studieren, und – etwas allgemeiner gesprochen – hätten wir die psychologischen Effekte unterschiedlicher Nahrung besser beachtet.4 Wir aßen jedenfalls Crêpes zu Mittag und fuhren weiter.
Zu diesem Zeitpunkt begann ich, meinen Rücken zu spüren. Ich war etwa 130 Kilometer gefahren, beladen mit diesem kleinen grünen Rucksack, und mein Rücken begann zu schmerzen. Tim war schlauer und hatte seinen Rucksack auf den Gepäckträger geschnallt. Ich sagte ihm schließlich, dass wir einen Fahrradladen finden müssten, ich bräuchte auch einen Gepäckträger. Tatsächlich hatte ich schon länger von diesen Panniers genannten Fahrradtaschen geträumt. Sie waren für mich wie die Doppelseite in einem Penthouse-Magazin für einen Computernerd – eine wunderbare, unerreichbar scheinende Erlösung. Wir fanden einen Fahrradladen mit einer riesigen Auswahl an Fahrradtaschen, Gepäckträgern und anderem exotischem Zubehör. Mein Rücken schmerzte inzwischen so gewaltig, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes jeden Preis für einen Gepäckträger und eine Fahrradtasche gezahlt hätte. Wenn Du musst trainieren die erste Lektion ist, dann ist Du musst eine angemessene Ausrüstung haben Lektion zwei. Man benötigt nicht unbedingt einen Carbonrahmen, ein Shimano-Dura-Ace-Schaltwerk und ein GPS-Navigationsgerät, aber für eine Mehrtagestour sollte es schon etwas Besseres sein als ein schäbiger Rucksack.
Inzwischen waren wir auf der Zielgerade nach Derby Line. Jetzt hatten wir allerdings ein neues Problem. Längst hatten wir die Kalorien der Crêpes verbrannt und unsere Gehirne waren schon völlig unterzuckert. Wann immer wir auf unsere Karte sahen, versuchten wir uns die Strecke zu merken: »Drei Kilometer geradeaus, bei der Ampel rechts abbiegen und danach die erste links.« Nachdem wir die drei Kilometer gefahren waren, hatten wir schon wieder alles vergessen. Wir mussten also anhalten, vom Fahrrad steigen, die Karte aufwändig hervorkramen und erneut versuchen, uns die nächsten zwei Abzweigungen zu merken. Wir waren wie zwei aus dem Heim entflohene Alzheimer-Patienten. Als wir es endlich geschafft hatten, irgendwie in Vermont anzukommen, gab es auf der ganzen Welt nicht genügend Essen, um uns satt zu bekommen: Wir gingen in eine Pizzeria und aßen Salate, teilten uns die größte Pizza, die sie hatten, voll beladen mit allen möglichen Belägen, am Schluss aßen wir auch noch einen Nachtisch. Selbst in unserer Pension war Tim immer noch so hungrig, dass er alle Bonbons aß, die am Empfang in einer Schale lagen. Er konnte einfach nicht aufhören.
Am nächsten Tag kamen wir drauf, dass es so etwas Magisches gibt wie Sportriegel. Unsere Leben würden nie mehr dieselben sein. Man könnte denken, zwei Doktoren mit Ivy-Abschluss hätten schlauer sein können, doch offensichtlich war dem nicht so. Von einem Philosophen wie mir erwartet man nicht, dass er irgendeinen Bezug zur echten Welt hat, doch von Tim, dem Physiker, schon. Für ihn gab es eigentlich keine Entschuldigung. Jedenfalls stellte sich heraus, dass die üblichen drei Mahlzeiten pro Tag nicht das sind, was Radfahrer brauchen. Nur eine regelmäßige Kalorienzufuhr lässt die Beine weitertreten und hält das Gehirn wach, um sich die Strecke zu merken.
Die Vorstellung, dass unsere rational denkenden Köpfe (nützlich, um sich Abbiegungen zu merken) und unser physischer Appetit (die Notwendigkeit, regelmäßig Nahrung zu sich zu nehmen) voneinander getrennt sind, ist sehr alt. In Politeia argumentiert Platon, dass die Seele dreigeteilt sei, in einen vernunftbegabten, einen emotionalen und einen begehrlichen Seelenteil. Der vernunftbegabte Seelenteil ist dem Wissen und der Orientierung zugetan, der emotionale Seelenteil dagegen befriedigt unsere animalischen Instinkte, wie unser Verlangen nach Essen, Getränken und Sex. Dem begehrlichen Seelenteil wird das Streben nach öffentlicher Anerkennung und Ehre zugeschrieben. Es mag sein, dass wir häufig mit unterschiedlichen Interessen zu kämpfen haben: Sollen wir zum Beispiel den Schokoladenkuchen essen oder uns doch lieber an die Diät halten? Sollen wir uns entscheiden, unseren moralischen Prinzipien zuwiderzuhandeln, nur um in ein Amt gewählt zu werden? Platon erläutert diese Konflikte mithilfe der drei Teile der Seele, die uneins miteinander seien, und er argumentiert, dass das tugendhafte, gute Leben nur erreicht wird, wenn sich alle drei Seelenteile im Gleichgewicht befinden.
Im 17. und 18. Jahrhundert neigten Philosophen dazu, unsere rationale Seite und unsere emotionale Seite im Konflikt miteinander zu sehen, und befanden, dass unsere Leidenschaften von unserer Vernunft in Schach gehalten und kontrolliert werden müssten. 1649 veröffentlichte der französische Philosoph René Descartes seinen Aufsatz Die Leidenschaften der Seele. In diesem argumentiert er unter anderem, dass es sechs primitive Leidenschaften gäbe: Verwunderung, Liebe, Hass, Traurigkeit, Freude und Begierde. »Die Weisheit«, schreibt er, »dient vorzüglich dazu, dass sie lehrt, sich so zu dem Herrn der Leidenschaften zu machen und sie mit so viel Geschick zu leiten, dass die Übel, welche sie bringen, sich leicht ertragen lassen, und dass man aus allem sich Freude bereiten kann.«5
Der schottische Philosoph David Hume vertritt einen eher gegensätzlichen Standpunkt. Im Jahr 1739 behauptet er: »Die Vernunft ist nur der Sklave der Affekte und soll es sein; sie darf niemals eine andere Funktion beanspruchen, als die, denselben zu dienen und zu gehorchen.«6 Kontrolliert also die Vernunft unsere Leidenschaften oder ist die Vernunft einfach das Werkzeug, das zur Verfügung steht, um unsere Leidenschaften rational einzuordnen?
Was wir auf unserer Montreal-Tour lernten, war, dass weder Descartes noch Hume so ganz richtiglagen. Man muss ausreichend Nahrung zu sich nehmen, damit der Verstand funktioniert; unser Verstand ist nicht gänzlich unserem Appetit unterworfen, doch richtig kontrollieren kann er ihn auch nicht. Wir sind keine rein aus Intellekt bestehenden Wesen, deren abstrakte Fähigkeit zu logischem Denken durch Empfindungen und Gefühlsregungen brutal korrumpiert wird. Andererseits ist es aber auch nicht so, dass wir nur rein instinktgelenkte Tiere sind und die Fähigkeit zur Reflexion nur eine begrenzte Verlängerung ebendieser Instinkte darstellt. Vielleicht war Platon näher an der Wahrheit, als er vorschlug, dass Weisheit im harmonischen Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Komponenten der Seele liegt. Ich bin mir sicher, dass zumindest Nietzsche eine Philosophie der Fahrradfahrerernährung vertreten hätte, die den Willen nach Sportriegeln beinhalten würde. Die dritte Lektion des Radfahrens lautet: Achte drauf, dass Benzin im Tank ist.
Nicht nachgeben
Nach unserer Montreal-Tour beschloss unser Freund Jim, dass er es auch einmal mit dem Radfahren versuchen und uns auf unserer nächsten Sommertour begleiten wollte. Ich freute mich über seine Entscheidung, doch ich wollte ihm auch das wenige Wissen, das ich mir bis hierhin angeeignet hatte, weitergeben. Warum sollte er es auf die gleiche harte Tour wie ich lernen?
Also sagte ich Jim, dass er trainieren müsse, und zwar hart. Wir trainierten zusammen und begannen mit einem 37-Kilometer-Rundkurs mit einer Reihe von Steigungen. Bei einer der Abfahrten fuhr ich einmal knapp 80 km/h schnell. Manchmal fuhren wir die Strecke gleich zwei Mal oder fuhren Berge noch mal hoch, sobald wir unten angekommen waren. Wir wurden immer ausdauernder und so beschlossen wir, den Jonestown Mountain hochzufahren. Der Jonestown ist ein Berg mit einer der anspruchsvollsten Steigungen in unserer Umgebung: Eine 30 Kilometer lange Rundstrecke mit einem sehr steilen, 250 Meter langen Abschnitt in der Mitte des Kurses.7
Als Jim mich bei mir zu Hause abholte, fiel ihm auf, dass er seinen Helm vergessen hatte. Ich lieh ihm einen alten Helm von mir und wir fuhren los. Es nieselte ein wenig, doch wir entschieden, dass der Regen uns Männern nichts ausmachen würde, wir würden die Abfahrt einfach sehr langsam angehen. Nach etwa sechs Kilometern bogen wir rechts ab und überquerten die stählerne Gitterbrücke eines kleinen Bachs. Ich war zehn Meter vor Jim, als ich ein fürchterliches Geräusch hinter mir vernahm. Jim war auf dem rutschig nassen Stahl weggerutscht und für mich sah es so aus, als sei er mit dem Kopf voraus über den Lenker geflogen und mit dem Gesicht zuerst aufgeschlagen. Sein Helm war zerstört, seine Brille kaputt, Teile fehlten, Blut floss aus seiner Nase, an seinem Knie klaffte eine Wunde und es schien, als sei sein Handgelenk gebrochen. Jim richtete sich auf und wusste sofort, dass er hinüber war. Er fragte mich immer wieder, wie er aussähe. Ich fühlte mich, als wäre ich in einem dieser Kriegsfilme, in denen ein schwer verwundeter Soldat seinen Vorgesetzten fragt, ob er okay sei. »Du wirst überleben«, sagte ich und versuchte dabei beruhigend zu klingen. Ich nahm mein Stofftaschentuch und band es um sein offenes Knie, hauptsächlich, damit mir nicht schlecht wurde.
Jims Nase war gebrochen, die Wunde an seinem Knie musste genäht werden, sein Handgelenk war verstaucht und er brauchte eine neue Brille. Drei Wochen später saß er wieder auf seinem Fahrrad, um mit Tim und mir zu den Finger Lakes im Bundesstaat New York zu fahren. Gleich am ersten Tag fuhr Jim mit seinem schweren Trek-Hybrid-Fahrrad eine sehr hügelige Strecke von 180 Kilometern, was auch für mich immer noch die längste gefahrene Distanz an einem Tag ist.
Im Handbüchlein der Moral schreibt Epiktet: »Vergiß nicht, bei jedem Vorfall in dich zu gehen, und zu untersuchen, welches Mittel du besitzest, um daraus Nutzen zu ziehen. Kommt Anstrengung, so findest du Ausdauer; kommt Schmach, so findest du Kraft zum Erdulden des Bösen. Und wenn du dich so gewöhnst, so wird dich die Vorstellung nicht hinreißen.«8
Der Grieche Epiktet wurde als Sklave im kaiserlichen Rom im ersten Jahrhundert nach Christus mit einer körperlichen Behinderung geboren und wusste somit vermutlich, was Schmerzen und Leiden bedeuteten. Doch er vertrat stets das Ideal der Stoiker, dass ein gutes Leben darin besteht, unerschütterlich nach dem zu streben, was erreichbar ist.
Ein stoischer Philosoph ist geschützt vor Unglück, denn er misst den weltlichen Dingen keinen Wert zu und ist überzeugt, dass die Tugendhaftigkeit alleine ein gutes Leben ermöglicht. Stoiker erdulden Gefühle einfach: Sie widerfahren einem, und sie unterscheiden sich von Handlungen. Die richtige Einstellung gegenüber Gefühlen ist, sich nicht von ihnen beherrschen und kontrollieren zu lassen, sondern selbstgenügsam und ausgewogen zu sein. Der Stoiker versucht apathisch zu leben, im ursprünglichen Wortsinn, also unbewegt von Gefühlen (»pathe«). Auf diese Weise können wir im Einklang mit der Natur leben. Wie der römische Kaiser und Vertreter des Stoizismus, Marcus Aurelius, schrieb: »Nenne dich nicht unglücklich, wenn dir ein Unglück widerfuhr! […] aber ein Glück ist, es mit edlem Mut zu tragen.«9 Die vierte Lektion, die ich von Jim und den Stoikern lernte: Hör auf zu heulen und reiß dich zusammen. Und: Trag immer einen Helm.
Überraschungen entlang der Straße
Ein paar Jahre später hatte ich erneut die Gelegenheit, etwas vom Radfahren zu lernen. Tim und ich hatten eine Tour von Reading in Pennsylvania nach Ocean City in Maryland geplant. Dieses Mal sollte unser Freund Pete uns begleiten. Pete war ein erfahrener Fahrer, der sich bereits einmal am Nightmare Ride (ein Radrennen in Lancaster County, dessen Strecke rund 320 Kilometer lang ist) versucht und viele Tausend Kilometer auf seinem Fahrrad zurückgelegt hatte.
Am ersten Tag fuhren wir etwa 140 Kilometer bei starkem Gegenwind. Die Sonne ging gerade unter, als wir uns Dover in Delaware näherten. Bei einer Verschnaufpause sahen wir auf der Karte, dass es in Dover eine Art Rennbahn zu geben schien. Wir konnten nur vermuten, für was sie genutzt wurde: Pferderennen? Hunderennen? Vielleicht war es sogar eine Radrennbahn? Als wir später um eine Ecke bogen, sahen wir ein Stadion und wussten sofort, um was für eine Art Rennbahn es sich handelte: NASCAR. Genau, wir brachten es fertig, ausgerechnet während des NASCAR-Wochenendes in Dover anzukommen. Das Stadion hat Platz für 135.000 Besucher und jeder Sitz war belegt.
Als wir in Pennsylvania losgefahren waren, dachten wir nicht, dass irgendwer an einem x-beliebigen Wochenende – besonders nach Labor Day – in Dover sein würde. Wir waren davon ausgegangen, dass es eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten geben und wir problemlos ein normales Hotelzimmer finden würden. Wir fragten im erstbesten Hotel, wo wir von der Empfangsdame einfach ausgelacht wurden. In Dover selbst und in einem Umkreis von 70 Kilometern war seit Wochen alles ausgebucht. Wir überlegten ernsthaft, ob wir im Park schlafen sollten. Wir schnappten uns die Gelben Seiten und fingen an herumzutelefonieren. Tatsächlich fanden wir ein Motel, nicht weit entfernt, bei dem es eine kurzfristige Absage gegeben hatte. Wir teilten uns zu dritt ein Zimmer und bezahlten den NASCAR-Sonderpreis von 350 Dollar für eine Nacht. Weil wir eine heiße Dusche und ein Bett wollten, blieb uns keine andere Wahl.
Am nächsten Tag fuhren wir nach Ocean City. Tim versicherte uns, er sei schon einmal dort gewesen, es sei ein großer Urlaubsort, in dem es Tausende von Hotelzimmern gäbe. Wir würden dort problemlos etwas zum Übernachten finden. Nach einem weiteren Tag bei zermürbendem Gegenwind erreichten wir Ocean City und stellten fest, dass gerade das Sun-Festival-Wochenende begonnen hatte und, richtig, jedes Hotel ausgebucht war. Um es kurz zu machen, wir fanden schließlich eine Übernachtungsmöglichkeit in einem runtergekommenen Motel.
Das philosophische Problem, das wir außer Acht gelassen hatten, war das Problem der Induktion. Wenn wir induktiv schlussfolgern, greifen wir auf frühere Erfahrungen und früher erlangtes Wissen zurück, um Rückschlüsse für das in Zukunft zu Erwartende zu ziehen. Wenn wir zum Beispiel morgens den Wasserhahn in der Küche aufdrehen, dann erwarten wir, dass Wasser fließen wird und nicht Schokolade. Wir erwarten das deshalb, weil bisher nie Schokolade geflossen ist, sondern immer Wasser.
Auch wir schlussfolgerten induktiv: In der Vergangenheit ist es nie ein Problem gewesen, in einem Ferienort an einem Wochenende nach Labor Day eine Übernachtungsmöglichkeit zu bekommen. Deshalb würden wir auch dieses Mal kein Problem haben.
Wie David Hume schreibt: »Von ähnlichen Ursachen erwartet man ähnliche Wirkungen. Darauf laufen alle Erfahrungsbeweise hinaus. Stützte sich nun dieser Schluss auf die Vernunft, so müsste er bei dem ersten Male und für einen Fall ebenso vollkommen gelten, als nach einer langen Reihe von Einzelfällen; aber dies ist durchaus nicht so.«10
Mit anderen Worten: Wenn die Art und Weise, wie wir Erwartungen für die Zukunft alleine aus den vergangenen Erfahrungen ableiten, eine reine Vernunftsache wäre, dann lägen wir immer richtig mit unseren Einschätzungen hinsichtlich unserer Zukunft. Doch wir liegen oft falsch. Der britische Philosoph Bertrand Russell merkt an: Ein Huhn, das den täglichen Besuch des Bauern mit Fütterung assoziiert, wird überrascht sein, wenn es eines Tages selbst zu Futter wird. Induktion ist, wie wir es in Dover und Ocean City erfahren mussten, unvorhersehbar und fehlbar.
Die fünfte Lektion: Erwarte das Unerwartete.
Vom Kummer zur Weisheit
Bei meiner letzten Sommerradtour fuhren wir von Watkins Glen, einem touristischen Städtchen an der südlichen Spitze des Seneca Lake im Hinterland von New York, bis zu den Niagarafällen und wieder zurück. Man brauchte dafür gute vier Tage und wir bewältigten zwei Mal eine Strecke von über 160 Kilometern. Jim fuhr wieder mit, neu dabei war Todd. Todd war schon einige der Strecken in der näheren Umgebung gefahren, keine jedoch länger als 80 Kilometer. Aber er hatte trainiert und war bereit.
Todd fragte mich, was er an Ausrüstung mitnehmen sollte, und so schickte ich ihm eine Liste der Dinge, die ich einpacken würde: ein Satz Straßenkleidung, Straßenschuhe, Regenjacke, Badehose, zwei Paar Fahrradhosen, drei Fahrradtrikots, zwei Trinkflaschen, Fahrradhelm, Handschuhe, Fahrradschuhe, Sonnenbrille, Kettennieter, CO2-Minipumpe, zwei Ersatzschläuche, Flickenset, Reifenheber, ein Dutzend Sportriegel, ein Multitool, schwarzes Klebeband, Kettenfett, Fahrradschloss und Schlüssel, Fahrradseitentaschen, Rasierzeug, Geldbörse, Kamera und Handy. Ronny, der Verkäufer in unserem örtlichen Fahrradladen The Dutch Wheelman, empfiehlt als wichtigste Werkzeuge auf einer Fahrradtour ein Handy und eine Kreditkarte. Mit diesen beiden kann man alles andere bekommen.
Wir waren keine zehn Kilometer gefahren, als ich einen ersten Platten hatte. Natürlich am Hinterrad, was bedeutete, dass ich meine Seitentaschen abnehmen musste und mich mit Öl von der Kette einschmieren würde. Ich zog einen neuen Schlauch auf und wir fuhren weiter. Es war ein schöner sonniger Tag, der uns einen tollen Blick über den lang gestreckten Gletschersee erlaubte, und ich war guter Stimmung. Wenige Kilometer später hatte ich erneut einen Platten. Scheiße. Das war Pech. Wir stiegen alle ab und ich wechselte erneut meinen Schlauch. Jetzt hatte ich bereits meine beiden Ersatzschläuche verbraucht (ich hasse Flicken und benutze sie nur im absoluten Notfall). Nach etwa 20 Kilometern hatte ich wieder einen Platten. Ich konnte es nicht glauben. Hatte ich vielleicht zu wenig Luft auf die Reifen gegeben und hatte snake bites (zwei parallele durch Steinchen verursachte Löcher im Schlauch)? War etwas im Mantel? Ich untersuchte die Innenseite des Mantels. Er sah sauber aus. Ich untersuchte den kaputten Schlauch, fand aber nur ein kleines Loch, keinen snake bite. Ich lieh mir also einen neuen Schlauch von Jim.
Aber ich hatte über die folgenden 150 Kilometer immer wieder neue Platten. Nach sieben Reifenpannen hatten wir alle Ersatzschläuche und alle CO2-Kartuschen aufgebraucht und ich war frustriert, weil ich den Fehler nicht finden konnte. Mir war heiß, ich war müde, schmutzig und unleidlich. Beim nächsten Fahrradladen rüsteten wir wieder auf. Am nächsten Morgen sahen wir uns meinen Mantel nochmals genauer an und Todd entdeckte ein klitzekleines Loch. Wir erklärten es uns so, dass das Loch im Mantel sich durch den Reifendruck ausdehnte, beim Fahren den Schlauch quetschte und so ein Loch darin verursachte. Ich holte mein schwarzes Klebeband hervor und verschloss damit auf der Innenseite des Mantels das Loch: Ich hatte keinen einzigen Platten mehr.
Todd starte mich kopfschüttelnd an: »Als ich schwarzes Klebeband auf deiner Liste gelesen habe, dachte ich, für wen hält er sich, für den verdammten MacGyver, oder was? Jetzt denke ich, ja, genau das ist er.«
Alle lachten. Ich merkte, dass ich diese Art von Pioniergeist und Selbstständigkeit mag, die man beim Fahrradfahren entwickeln muss. Ich hatte Platten, gebrochene Speichen, kaputte Kugellager und einmal einen gerissenen Bowdenzug. Wenn man 30 oder 50 Kilometer vom nächsten Fahrradladen entfernt ist, muss man alleine eine Lösung finden. Søren Kierkegaard schreibt in Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken (1846), wie sehr die Menschheit von den technischen Wundern seiner Zeit – Eisenbahn, Dampfschiffe, Enzyklopädien, Telegrafen – profitiert.11 Sie machen unser Leben einfacher, sogar so einfach, dass wir uns manchmal Schwierigkeiten herbeiwünschen, nur um sie zu überwinden. Kierkegaard glaubt, dass sein Beitrag zum Wohle der Menschheit genau die Bereitstellung dieser Schwierigkeiten ist. Man fragt sich, wie Kierkegaard wohl auf die modernen Vereinfachungen unseres Alltags wie Google, Flachbildschirme und Klimaanlagen reagiert hätte. Für Kierkegaard gehört Grübelei zur Philosophie dazu – die Frage, wie man ein Individuum wird und nicht einfach nur ein Teil einer großen Masse bleibt, wie man richtig lebt und was die Natur der Wahrheit ist – all das ist schwierig. Dieses Philosophieren, diese innere Einkehr kann einem nicht durch das Surfen im Internet abgenommen werden, es bleibt schwierig. Auch das Fahrradfahren stellt einen vor eine ähnliche Herausforderung, es verlangt eine angemessene Aufmerksamkeit gegenüber den Anforderungen. Kierkegaards Freude an der Schwierigkeit meint also nicht Situationen wie die, auf einer Bergtour bei Kilometer 130 zu merken, dass man keine Kraft mehr hat, sondern die weitaus größere Befriedigung, anzukommen und die gesamte Strecke gefahren zu sein. Analog könnte man sagen, dass es wenig Spaß macht, Kierkegaards stumpfe Prosa zu analysieren, aber dass es glücklich macht, sich mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen, sobald man verstanden hat, worum es ihm geht. Welchen Wert hat ein Smartphone, wenn einem mitten im Nirgendwo eine Speiche gebrochen ist, während es dunkel wird und es dazu auch noch anfängt zu regnen? Status, Ego und Geld bringen einen nicht nach Hause. Es sind Situationen wie diese, in denen man etwas über sich selbst lernen kann, über seinen eigenen Einfallsreichtum und seine Selbstgenügsamkeit. Im Kleinen entspricht die Situation des Radfahrers der des Menschseins im Allgemeinen – wir selbst müssen herausfinden, wie wir leben wollen, was wir erreichen wollen und wie wir das bewerkstelligen können. Wie Kierkegaard können wir Freude und Selbsterkenntnis aus diesen Herausforderungen ziehen, jedenfalls viel eher als Langeweile und Verzweiflung.
Die sechste Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass Radfahren einen nach Delphi führen kann, mit dem Wunsch, sich selbst zu erkennen, wie es am Eingang des Orakels geschrieben steht. Man kann Mut schöpfen aus Emersons Satz über die Selbstständigkeit: »Er kann nicht glücklich und stark sein, bis auch er in Einklang mit der Natur lebt, in der Gegenwart, jenseits der Zeit.«12 Mit dem Glück, das einem das Radfahren geben kann, und der Stärke, die der Charakter daraus ziehen kann, findet man seinen Weg zurück.
STEVEN D. HALES
Steven D. Hales ist Philosophieprofessor an der Bloomsburg University. Vor Kurzem war er Gastprofessor an der philosophischen Fakultät der School of Advanced Study, University of London. Er hat eine Reihe von populärphilosophischen Büchern geschrieben, wie Beer and Philosophy (Wiley-Blackwell, 2007), What Philosophy Can Tell You About Your Dog (2008), What Philosophy Can Tell You About Your Cat (2008). Sein Schwerpunkt in seinen langweiligen, wissenschaftlichen Arbeiten liegt auf der Erkenntnistheorie und Metaphysik: Relativism and the Foundations of Philosophy (2006). Er sollte sich öfter auf sein Cannondale R800 Sport setzen.
FUSSNOTEN
1 - Friedrich Nietzsche, »Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft«. Werke in drei Bänden. München 1954, Band 2, S. 643–648.
2 - Friedrich Nietzsche, »Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen«. Nietzsches Werke, Erste Abtheilung, Band VI, Leipzig 1901.
3 - Henry David Thoreau, »Walden«, S. 100.
4 - Friedrich Nietzsche, » Die fröhliche Wissenschaft«, Abschnitt 7, Leipzig 2000.
5 - René Descartes, »Philosophische Bibliothek oder Sammlung der Hauptwerke der Philosophie alter und neuer Zeit. René Descartes‘ philosophische Werke. Über die Leidenschaften der Seele.« Teil 3. Artikel 212. Berlin 1870.
6 - David Hume, »Ein Traktat über die menschliche Natur«. Buch 2: »Über die Affekte«. 3. Teil. Abschnitt 3, Hamburg 1978, Seite 153.
7 - Die Strecke der Jonestown-Tour ist online einsehbar auf http://www.gmap-pedometer.com/?r=2363457.
8 - Epiktet, »Handbüchlein der stoischen Moral«. Berlin, §10.
9 - Marc Aurel, »Selbstbetrachtungen«, Deutsche Bibliothek, Berlin, Buch IV, §49.
10 - David Hume, »Abteilung IV. Skeptische Zweifel in Betreff der Thätigkeiten des Verstandes«. Abschnitt II., 1869.
11 - Vgl. Søren Kierkegaard, »Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken«, Gütersloh 1982.
12 - Ralph Waldo Emerson, »Self-Reliance«,aus: »Essays: First Series«, New York 1841, S. 98.
MAXIMILIAN PROBST
DER DRAHTESEL – DIE LETZTE HUMANE TECHNIK
Fahrradfahren stand für mich immer in einem gefühlten Zusammenhang mit Revolution. Im Rückblick könnte ich es so erklären: Revolutionen sind Umstürze – und war es nicht diese Erfahrung des Umsturzes, der wir uns aussetzten, als wir lernten, Fahrrad zu fahren? Wir eierten los, stürzten um, es schmerzte, aber das schreckte uns nicht ab, wir schwangen uns zurück auf den Sattel und rollen seither fröhlich und gesund durchs Leben ... Es gibt aber auch Leute, denen die Koppelung von Fahrrad und Revolution gar nicht einleuchten dürfte. Samuel Beckett zum Beispiel. In seinem Roman Molloy schrieb er: »Wie beruhigend ist es, von Fahrrädern zu sprechen« (und nicht über seine Mutter)! Wenn der Satz stimmen würde, könnten Fahrrad und Revolution unmöglich zusammenfinden, man hat ja der Revolution allerhand nachgesagt, aber dass sie beruhigend ist? Jedenfalls dann nicht, wenn Philosophie für uns heißt, zu zweifeln oder zu staunen oder sich überraschen zu lassen, weil wir die Dinge mit der Philosophie plötzlich von ihrer Unter- oder Hinterseite sehen, im besten Fall auch mal von ihrer Schokoladenseite. Philosophie kann dann im Ergebnis beruhigend sein, aber eben nur als Ergebnis (selten als die Errungenschaft für immer, von der Thukydides spricht, meist nur als eine kurzlebige, momentane, flüchtige). Wäre es von vornherein beruhigend, über Fahrräder zu sprechen, würden wir nicht philosophieren. Dafür müssen wir das Fahrrad problematisieren. Das Problem sehen, das mit dem Fahrrad in die Welt gekommen ist. Und dann, im Durchgang der Problematisierung des Fahrrads, nach keuchendem Aufstieg, vielleicht, wenn’s glückt, winkt ein entspanntes Hinabrollen.
Was nun ist das Ärgerliche am Fahrrad? Dass es das Paradies ist, aus dem wir vertrieben wurden.
Vom Stand der Technik aus gesehen erscheint das Fahrrad als der Gipfel der Versöhnung von Mensch und Natur. Das Fahrrad als Versprechen einer humanen Moderne, einer humanen Technik, die sich symbiotisch zur Natur verhält. Das Fahrrad reißt den Menschen nicht aus der Natur heraus. Das Fahrrad ist dem Menschen zu Diensten, ohne dass er über ihm thront. Der strampelnde Mensch auf dem Rad taugte nie als Sinnbild von Hybris. Das Fahrrad ist das letzte Versprechen einer Technik ohne Dialektik, ohne Umschlag in die Katastrophe.
Nach dem Fahrrad begann eine neue Zeit. Unsere Zeit. Die Zeit des Krieges und der wechselseitigen Unterwerfung zwischen dem Menschen und einer zur zweiten Natur, zur Post-Natur erwachsenen planetarischen Technik. Es ist diese neue Technik, die sich quasi autonom den Menschen unterwirft, während der noch glaubt, sich über die Natur himmelhoch aufzuschwingen. Der Freiburger Wald-und-Wiesen-Philosoph Martin Heidegger hat das erstaunlich präzise zur Kenntnis genommen. Ebenso Ernst Jünger. Ein Satz aus seinem Skandal-Buch Der Arbeiter, der nicht verständlich würde, wären wir beim Fahrrad geblieben: »Es ist der Sinn des Verkehrs, dass wir überfahren werden.«
Nun aber mal langsamer. Schauen wir einmal ganz genau hin, was beim Fahrradfahren passiert und was im Vergleich dazu beim Auto. Fangen wir mit einer alten denunziatorischen Beschreibung des Fahrradfahrers an: Der Radler buckelt nach oben und tritt nach unten. Höchst unschön, wenn wir diese Haltung innerhalb von gesellschaftlichen Hierarchien einnehmen. Wir können in der Haltung des Radlers aber auch die Haltung des Menschen gegenüber der Welt sehen, dann sieht das schon viel schöner aus. Der gekrümmte Rücken: eine Abkehr vom Himmel und allen Himmelsstürmereien. Hier ist unser Platz, nicht anderswo. Richten wir ihn uns so ein, dass er erträglich wird. Und das Strampeln: na ja, wir haben halt einen Körper. Wir haben nur ihn und wenn wir uns daran gewöhnt haben, ihn von A nach B zu bewegen, dann immer auch, um ihn selbst zu bewegen, er ist nie nur ein Mittel (dafür da, um unseren Geist in die Bibliothek zu lotsen), er ist immer auch Zweck in sich. Das Fahrrad trägt dem Rechnung.





























