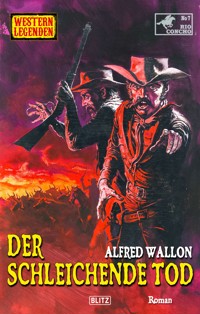Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: ONLY eBook Western
- Sprache: Deutsch
Daniel Boone (1734 - 1820) war einer der ersten Männer der Grenze, die in ganz Amerika bekannt wurden. Seine Expeditionen in das damals noch unbekannte Kentucky ebneten den Weg für weitere Pioniere und Siedler über die legendäre Wilderness Road zur Cumberland Gap.Dieser Weg durch die unbekannte Wildnis führte zur späteren Gründung der Stadt Boonesborough und war die erste weiße Siedlung westlich der Appalachen und bildete das Fundament für die weitere Emigration von über 200.00 Europäern nach Kentucky.Boone war ein Pionier, Jäger und Abenteurer - aber auch ein Mann, der zwei seiner Söhne im Kampf gegen die Shawnees verlor und durch deren Tod geprägt wurde.Die Legenden schildern ihn als einen aufrechten wackeren Pionier, der sich vor nichts fürchtete und stets für Gerechtigkeit zwischen Weiß und Rot kämpfte. Die Wirklichkeit zeichnet ihn jedoch als einen eher düsteren, zu allem entschlossenen Mann, wenn es darum ging, Kentucky für die weißen Siedler zu öffnen und zu erschließen.Das Schicksal der dort ursprünglich lebenden Shawnee-Indianer und vieler anderer Stämme, die die Weißen natürlich als Eindringlinge betrachteten und deshalb ihr Land entschlossen verteidigten, war jedoch zweitrangig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE PIONIERE VON KENTUCKY
EIN HISTORISCHER WESTERN-ROMAN
ONLY EBOOK - WESTERN
BUCH 4
ALFRED WALLON
IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN
© 2024 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Alfred Wallon
Titelbild: Mario Heyer
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Torsten Kohlwey
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 978-3-7579-4164-2
e104v2
INHALT
Vorwort
LAND DER VERHEISSUNG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
SAAT DER GEWALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
DIE PIONIERE VON KENTUCKY
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Historische Anmerkungen zum vorliegenden Roman
Über den Autor
VORWORT
Die Besiedlung Kentuckys war für viele Menschen die Erfüllung eines lang ersehnten Wunsches, denn bereits um 1740 hatte sich ein regelrechtes Landfieber entwickelt. Nachdem einzelne Trapper, Abenteurer und Fährtensucher den Ohio überquert hatten (zu ihnen gehörte auch Daniel Boone), verbreitete sich allmählich die Nachricht von einem weiten und unermesslich schönen Land mit zahlreichen Wäldern, Wiesen und guter Erde. Der einzige Nachteil: es war die Heimat der Waldstämme, die sich natürlich mit allen Mitteln gegen die Expansion der weißen Siedler wehrten.
Zwischen 1764 und 1774 zogen Einwanderer und Siedler von West Virginia über die Berge und begannen mit der Bebauung der Gebiete um die Zuflüsse des Ohio River. Eingezwängt zwischen dem Meer und der natürlichen Barriere der Appalachen sehnten sich die Siedler deshalb schon nach kurzer Zeit nach einem neuen und weiten Land, um hier eine neue Existenz zu gründen.
In Daniel Boone fanden diese Menschen den Pionier, der ihren Traum verwirklichte. Denn er war bereits auf einem seiner Streifzüge über die Cumberland Gap gezogen und hatte einige Monate als Jäger in den Tälern verbracht, die zum Höhenzug des Pine Mountain führten. Boone nutzte einen dieser alten Indianerpfade und zog an der Cumberland Gap über die Appalachen. Über die legendäre Wilderness Road führte er einen ersten Siedlertreck in das heutige Kentucky.
Fern ab der Zivilisation errichteten die Siedler ein massives Fort mit einigen Häusern und einem hohen Palisadenzaun. Zu Ehren Daniel Boones wurde dieser Ort Boonesborough genannt und war von nun an eine Speerspitze der Zivilisation mitten im Indianerland.
Während des Unabhängigkeitskrieges gab es immer wieder Kämpfe und Auseinandersetzungen zwischen britischen Soldaten und amerikanischen Kolonisten, und die Indianer befanden sich oft zwischen den Fronten. Im Mai 1775 waren in Kentucky trotz aller Probleme bereits drei Siedlungen im Aufbau begriffen. Trotz heftiger Konflikte mit den Indianern vermochten sich die Siedler zu halten. 1784 zählte die weiße Bevölkerung von Kentucky schon 30.000. 1792 wurde Kentucky in den Staatenbund aufgenommen.
DIE PIONIERE VON KENTUCKY ist ein Roman aus der Frühzeit der amerikanischen Pioniergeschichte und schildert wichtige Stationen aus der Zeit des Unabhängigkeitskrieges. Die Epoche des sogenannten »Wilden Westens« lag noch in weiter Ferne.
Der Autor James Fenimore Cooper beschrieb in seinen Lederstrumpf-Erzählungen die spannenden Abenteuer eines Trappers und Fallenstellers namens Nathaniel Bumppo, deren Handlung im gleichen Zeitraum angesiedelt war. Vieles spricht aus heutiger Sicht dafür, dass Cooper mit seinen Erzählungen Daniel Boone ein literarisches Denkmal setzen wollte, aber die historische Wirklichkeit zeichnet Boone nicht immer als den strahlenden Helden und Pionier, dem man in Kentucky zur Erinnerung an seine Taten ein Denkmal setzte.
Auch im Fernsehen setzte sich dieser Mythos fort. Die Serie Daniel Boone mit Fess Parker in der Hauptrolle hat diese Heldenverehrung noch unterstützt – und genau dieses Bild manifestiert sich auch heute noch, wenn man an Daniel Boone denkt. Man sieht einen Trapper in Lederkleidung, einer langen Flinte in der Hand und mit einer Waschbärenfellmütze auf dem Kopf. Dabei ist mittlerweile historisch erwiesen, dass Boone niemals solch eine Coonskin-Cap getragen hat.
Mit diesem Buch möchte ich eine Ära der amerikanischen Geschichte wieder zum Leben erwecken, die von den meisten Autoren leider völlig vernachlässigt wird. Dabei ist die frühe Geschichte der Besiedlung Amerikas nicht minder faszinierend und spannend.
Alfred Wallon,
Augsburg – Oktober 2021
LAND DER VERHEISSUNG
KAPITEL 1
»Die weißen Siedler wollen euer Land«, sagte William Bentley. »Sie sind schon auf dem Weg hierher, und sie werden euch sehr bald verjagen. Ihr werdet keine Heimat mehr besitzen. Wollt ihr das?«
Der britische Agent hielt einen kurzen Moment inne und blickte in die Gesichter von Häuptling Blackfish und seinen Shawnee-Kriegern, die sich um das große Feuer zwischen den Langhäusern versammelt hatten.
»Du bist doch selbst ein Weißer«, erwiderte Blackfish. »Woher wissen wir, dass wir deinen Worten trauen können?«
»Ich bin euer Freund, sonst wäre ich jetzt nicht hier«, antwortete Bentley sofort. Er wusste, dass die nächsten Minuten die Entscheidung bringen würden. Jetzt durfte er nur nicht die Nerven verlieren, sondern musste weiterhin ruhig und gelassen bleiben. Obwohl ihm das schwer fiel, denn die Blicke der meisten Shawnee-Krieger waren eindeutig. Sie mochten den Weißen nicht, der zusammen mit sechs weiteren Gehilfen den Ohio überquert hatte, um Häuptling Blackfish aufzusuchen. Bentley hatte ihnen gesagt, dass er aus Detroit komme und nicht länger zusehen könne, welches Unrecht den Shawnees und den anderen Stämmen der zugefügt würde.
Der graubärtige Brite war ein geschickter Redner und spürte sofort, wenn die Stimmung umschlug. Deshalb hatte er seine Worte sehr bedacht gewählt, um das Vertrauen derjenigen Krieger zu gewinnen, die ihn und seine Begleiter am liebsten getötet hätten. Er wusste, was für ein Risiko er mit dieser Mission einging. Aber wenn es ihm gelang, die Shawnees von seinen ehrlichen Absichten zu überzeugen und dafür zu sorgen, dass sich der Hass der Indianer gegen die amerikanischen Kolonisten richtete, dann hatte er genau das erreicht, was er von Anfang an geplant hatte.
»Wir wissen, dass die Weißen den Ohio schon mehrmals überschritten haben«, ergriff nun Häuptling Blackfish wieder das Wort. »Die meisten von ihnen konnten wir ergreifen und bestrafen. Aber du hast Recht, William Bentley. Sie werden immer zahlreicher, und unsere Jagdgründe sind bedroht. Wir werden nicht zulassen, dass sie Kain-tuck-ee jemals zu sehen bekommen.«
»Wir Briten sehen diese Gefahr auch«, fügte Bentley rasch hinzu. »Die Irokesen und Huronen sind verlässliche Partner für uns, und in den Ländern rund um die Großen Seen herrscht deshalb schon lange Frieden. Deshalb bin ich mit meinen Freunden zu euch gekommen, weil der Friede in eurem Land bedroht ist. Glaubt nicht an die falschen Worte, mit denen euch die Siedler zu beschwichtigen versuchen. In Wirklichkeit warten sie nur darauf, dass sie den Boden betreten können, der seit Ewigkeiten eurem Volk gehört. Seit einigen Tagen ist ein weiterer Siedlertreck unterwegs. Diese Männer, Frauen und Kinder haben nur ein Ziel - dass Kentucky ihre neue Heimat wird!«
Zorniges Gemurmel war zu hören. Einige der Krieger erhoben ihre Fäuste und zeigten anhand dieser Geste, dass sie nicht gewillt waren, das jemals zuzulassen. Auch Häuptling Blackfishs Blicke waren eindeutig. Trotzdem wartete er noch einen kurzen Moment, bevor er wieder das Wort ergriff.
»Woher weißt du das, William Bentley?«
»Unseren Spähern entgeht nichts, Blackfish«, kam prompt die Antwort. »Es ist unsere Pflicht, euch rechtzeitig zu warnen. Weil wir wollen, dass Freundschaft herrscht zwischen den Shawnees und dem britischen Empire. Lasst nicht zu, dass die Siedler eurer Land rauben und verjagt sie wieder. Handelt rasch und zeigt ihnen, wer die Herren dieses Landes sind. Ihr Blut muss fließen, damit Kentucky auch zukünftig die Heimat deines Volkes bleibt, Häuptling.«
Blackfishs Miene war steinern. Er ließ sich nicht anmerken, welche Gedanken ihm in diesen Sekunden durch den Kopf gingen. Stattdessen beobachtete er die Mitglieder der britischen Gesandtschaft ganz genau – und zwar jeden einzelnen. Der eine oder andere von Bentleys Leuten wurde dadurch verunsichert und wich dem prüfenden Blick des Shawnee-Häuptlings aus. Bentleys Augen funkelten kurz, als er das sah. Aber er konnte und durfte jetzt nicht einschreiten, sondern musste abwarten, was weiter geschah.
»Ich war noch ein Kind, als der erste Weiße über den Ohio kam«, sagte Blackfish. »Diesen Tag werde ich nie mehr vergessen. Mein Volk und ich boten diesen Menschen an, unsere Gäste zu sein. Aber schon einen Tag später traten sie unser Gastrecht mit Füßen. Das war der Tag, an dem die ersten Krieger meines Volkes starben. Seitdem habe ich aufgehört zu zählen, wie viele es inzwischen sind. Aber du hast Recht, William Bentley. Wir werden nicht länger zusehen, was hier geschieht, sondern das Notwendige tun.«
»Das solltest du auch«, ermutigte ihn Bentley. »Denn diese Siedler werden von Daniel Boone angeführt.«
Als der Name des berühmten Grenzmannes fiel, wurde es auf einmal so still am großen Lagerfeuer, dass man für wenige Sekunden nur noch das Knistern des brennenden Holzes hören konnte. Aber sofort danach erhoben sich die meisten Krieger und stießen wütende Schreie aus. Jeder von ihnen kannte Daniel Boone. Er hatte sich nicht nur bei seinem eigenen Volk, sondern auch bei vielen Stämmen der großen Wälder einen Namen als guter Kämpfer und sicherer Schütze gemacht.
Er war einer der ersten Weißen gewesen, die über den Ohio gekommen waren, und er hatte viele Monate draußen in der Wildnis gelebt, um zu jagen und das Land zu erforschen. Mehrmals hatten die Shawnees versucht, ihn aufzuspüren – aber es war ihnen niemals gelungen. Immer dann, wenn sie gehofft hatten, dass die Falle jeden Augenblick zuschnappte, war es diesem verfluchten Weißen gelungen, ihnen zu entkommen.
»Der Mann mit der Long Rifle«, murmelte Blackfish. »Er ist also zurück gekommen, um hier zu sterben. Nun gut – sein Schicksal wird sich in Kain-tuck-ee erfüllen.«
»Das hoffe ich«, fügte Bentley rasch hinzu. »Und damit das auch wirklich geschieht, haben meine Freunde und ich Geschenke für euch mitgebracht. Sie befinden sich dort drüben auf den beiden Wagen. Curtis und Taylor – los, geht hinüber und zeigt dem Häuptling und seinen Kriegern, welche Geschenke sie jetzt von uns bekommen!«
Die beiden Briten beeilten sich, die Anweisung ihres Anführers zu befolgen, denn mit jeder weiteren Minute fühlten sie sich zusehends unwohler in ihrer Haut. Inmitten dieser zornigen Krieger keine Angst zu zeigen, erforderte einen großen Mut. Mancher von Bentleys Begleitern würde erst dann wieder ruhig schlafen können, wenn er wieder das andere und somit vertraute jenseitige Ufer des Ohio erreicht hatte. Das würde aber noch etliche Tage dauern, denn Bentley und seine Leute hatten Anweisungen von Detroit erhalten, so lange in Kentucky zu bleiben, bis sie die Shawnees von ihren ehrlichen Absichten überzeugt hatten. Auch wenn das mehrere Wochen dauerte.
Bentley beobachtete Blackfish, während seine Männer die Plane zurück schlugen und mehrere Kisten ins Freie hievten. Eine öffneten sie und holten britische Musketen hervor, die sie unter den erstaunten Blicken der Shawnees herum zeigten.
»Diese Waffen sind für dich und dein Volk bestimmt, Häuptling«, sagte Bentley. »Wir Briten vergessen unsere Freunde nicht und wissen, wann sie Hilfe benötigen. Wir haben fünfzig Musketen und ausreichend Pulver und Blei mitgebracht. Nehmt es und versprecht, dass ihr die weißen Siedler verjagt.«
Blackfish erwiderte nichts darauf, sondern fixierte seine Blicke auf die vielen Waffen. Jetzt war es aus und vorbei mit seiner Zurückhaltung. Genau wie die anderen Krieger riss er eine der Musketen an sich und betrachtete stolz die Waffe.
»Diese Geschenke sind eine große Hilfe für uns, William Bentley«, sagte der Häuptling. »Mein Volk wird das niemals vergessen. Wir werden kämpfen – und zwar schon morgen!«
Während die letzten Worte über seine Lippen kamen, reckte er die Muskete empor. Die Krieger stießen laute Triumphschreie aus, während sich die Briten allmählich zurück zogen und die Kisten mit den Gewehren nun den Shawnees überließen.
Bentley lächelte, als er die Krieger beobachtete. Sie freuten sich wie kleine Kinder und fühlten sich in diesen Sekunden unbesiegbar. Mit diesen Waffen würden sie nicht nur die verhassten Weißen aus Kain-tuck-ee verjagen, sondern auch die verfeindeten Stämme ein für alle Mal in ihre Schranken verweisen.
Für Blackfish und sein Volk war es ein guter Tag, denn die Götter hatten ihnen dadurch ein Zeichen gesandt. Bentley jedoch interessierte sich nicht für die Mythologie und den Aberglauben der Waldstämme. Für ihn zählten nur greifbare Resultate. Und eines davon war, dass er es geschafft hatte, die Shawnees gegen die amerikanischen Kolonisten aufzuhetzen!
* * *
Daniel Boone zuckte zusammen, als er plötzlich Hufschläge hörte. Sofort zog er sich wieder ins dichte Gebüsch zurück und hielt seine Long Rifle bereit. Wachsam spähte er in die betreffende Richtung und erkannte wenige Minuten später einen Reitertrupp unten in der Ebene. Seine Anspannung legte sich, als er erkannte, dass es Weiße waren und dass sie keine Uniformen trugen.
Trotzdem verharrte er noch in seiner Deckung, griff nach dem Fernrohr, das er stets bei sich trug und schaute hindurch. Ein Lächeln schlich sich in seine Züge, als er einen der Männer erkannte, die an der Spitze des Trupps ritten.
»John Stuart«, murmelte Boone sichtlich überrascht. »Sieh mal einer an...«
Er verstaute rasch das Fernglas in der Ledertasche, verließ seine Deckung und zeigte sich den Männern, die in seine Richtung geritten kamen. Er hielt seine Long Rifle in der rechten Hand und winkte den Männern mit der Linken zu. Jetzt hatten sie ihn auch gesehen.
»Hallo John!«, begrüßte Boone den Mann, mit dem er vor sechs Jahren schon einmal die Wildnis jenseits des Ohio River erkundet hatte. »Es ist lange her, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Was führt euch hierher?«
»Es hat sich herum gesprochen, dass du mit fünf Familien auf dem Weg nach Kentucky bist, Daniel«, erwiderte der hagere John Stuart. »Diese Männer hier sind fest entschlossen, mitzukommen. Es sind alles erfahrene Grenzer und Waldläufer.«
»Das sehe ich«, erwiderte Boone, der sich schon längst einen Eindruck von den Männern gemacht hatte. Es waren harte raubeinige Burschen. Jeder war bewaffnet und hatte ausreichend Proviant, Pulver und Blei bei sich. Einige Männer hatten sogar zusätzliche Pferde dabei, die sorgfältig verschnürte Lasten trugen. »Aber mir gefällt nicht, dass ihr so schnell unsere Spuren gefunden habt. Was ihr könnt, das schaffen die Shawnees schon lange...«
»Wir haben das Gelände sorgfältig abgesucht, Daniel«, erwiderte Stuart. »In der näheren Umgebung von Powells Valley haben wir jedenfalls nichts bemerkt.«
»Das muss nichts heißen, John. Du weißt, dass die Shawnees erst dann zu sehen sind, wenn sie es selbst wollen. Und dann ist es meistens schon zu spät. Eigentlich hatte ich darauf gehofft, dass ein kleiner Treck unbemerkt bleibt. Mit so vielen zusätzlichen Reitern könnte das schwierig werden.«
»Boone, ich habe keine Angst vor den Rothäuten«, meldete sich ein untersetzter bärtiger Mann zu Wort, der links von Stuart sein Pferd gezügelt hatte. »Mein Name ist Jim Hatfield. Die Burschen hinter mir sind meine Brüder Asa und Leroy. Wir können nicht nur schießen, sondern auch treffen – darauf gebe ich mein Wort.«
»Das glaube ich Ihnen«, antwortete Boone. »Also gut – möglicherweise ist es doch sicherer, wenn wir eine starke Truppe sind. Vielleicht bleiben die Shawnees dann auf Distanz und machen uns keine Schwierigkeiten.«
»Wir jagen sie zum Teufel, wenn sie sich in der Nähe blicken lassen!«, rief ein anderer Grenzer. »Boone, ich habe so viel von diesem sagenumwobenen Kentucky gehört. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich das Land mit eigenen Augen sehen möchte. Ich beneide Sie, dass Sie schon einmal dort gewesen sind.«
Boone erwiderte nicht sofort etwas darauf. Zwar hatte der Mann Recht, dass Kentucky ein wunderschönes Land war, mit vielen Bergen, Wäldern und Tälern, die bisher nur wenige Weiße gesehen hatten. Als Boone vor sechs Jahren mit John Stuart zum ersten Mal die Cumberland Gap überquert hatte, war ihm das Land vorgekommen wie ein unberührtes Paradies. Jetzt wusste er, dass dies nicht mehr lange so bleiben würde. Denn die Zivilisation kannte keine natürlichen Grenzen, sondern drängte unaufhaltsam weiter nach Westen.
»Folgt dem Lauf des kleinen Baches dort unten etwa eine Meile lang«, sagte Boone zu Stuart und dessen Begleitern. »Ihr seht dann eine Senke, die von zahlreichen Büschen und Bäumen umgeben ist. Dort ist der Treck. Ihr findet das schon.«
»Und was ist mit dir?«, wollte Stuart wissen. »Kommst du nicht mit?«
»Ich nehme eine Abkürzung«, antwortete Boone. »Wir sehen uns dann gleich.«
Bevor einer der Männer noch etwas sagen konnte, war Boone auch schon im Gebüsch verschwunden. Stuart musste grinsen. Boone hatte sich nicht im Geringsten verändert. Er war immer noch der Einzelgänger wie vor sechs Jahren. Aber eins war sicher: Boone kannte hier jeden Fußbreit Boden, und deshalb gab es keinen besseren Mann, der diesen Treck ans Ziel bringen konnte – nach Kentucky, in das verheißene Land!
* * *
»Da drüben, Ben«, sagte James Boone. »Dort im Gebüsch müssen wir sie suchen. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis wir unser Abendbrot erlegt haben.«
»Warte mal, James«, versuchte Ben Williams seinen Freund James Boone zurück zu halten. »Wir sollten besser wieder umkehren...«
»Was ist denn mit dir auf einmal los, Ben?«, fragte der siebzehnjährige James Boone ganz erstaunt. »Hast du auf einmal Angst bekommen? Mensch, das Lager ist doch ganz in der Nähe und...«
»Trotzdem wäre es mir lieber, wenn wir uns auf den Rückweg machen«, unterbrach ihn Ben. »Ein Truthahn als Jagdbeute ist es nicht wert, dass wir uns unnötig in Gefahr begeben.«
»Gefahr?« James Boones Stimme klang leicht gereizt. »Was ist denn nur mit dir los, Ben? Eben warst du noch Feuer und Flamme, als ich dir vorschlug, dass wir auf Truthahnjagd gehen. Oder läuft dir bei dem Gedanken an einen saftigen Braten nicht das Wasser im Mund zusammen? Mensch, Ben! Wir haben es doch gleich geschafft. Ich würde jede Wette darauf eingehen, dass die Truthähne da drüben in den Büschen stecken. Du hast es doch selbst eben gehört, oder?«
»Das schon«, antwortete Ben. »Aber dein Vater würde es nicht gut heißen, wenn wir uns zu weit vom Camp entfernen.«
James erwiderte nichts darauf, sondern schaute erneut hinüber zu den Büschen. Ein Grinsen schlich sich in seine Züge, als er wieder das Kollern eines Truthahns vernahm. Der Vogel war nur noch wenige Schritte entfernt.
James gab Ben einen kurzen Wink und zeigte auf die Büsche. Sie schlichen sich leise heran und hielten ihre Gewehre bereit. Auch Ben dachte nicht mehr an die Zweifel, die ihn eben noch hatten grübeln lassen. Angesichts der nahen Jagdbeute kreisten auch seine Gedanken jetzt nur noch darum, einen oder mehrere Truthähne zu erlegen und zurück zum Camp zu bringen.
Boones Sohn war der erste, der das Gebüsch erreichte und seine Blicke umher schweifen ließ. Noch war nichts zu sehen. Aber hier irgendwo musste der Truthahn doch sein. James hatte das ganz genau gehört. Auch Ben blickte sich um, konnte aber nichts entdecken.
Genau in diesem Moment erklang wieder das Kollern eines Truthahns. Allerdings weiter drüben. Natürlich, das war die Erklärung. Warum hatte James denn nicht gleich daran gedacht? Er und Ben waren zu laut gewesen und hatten beim Anschleichen vermutlich Geräusche gemacht, die den Vogel gewarnt hatten. Schließlich waren weder James noch Ben erfahrene Waldläufer, sonder nur zwei junge Burschen, die das Jagdfieber gepackt hatte.
James signalisierte Ben, dass er hierbleiben und warten sollte. Er selbst wollte sich von links an die Gruppe Büsche heranschleichen und von dort aus das Feuer eröffnen. Falls die Beute dann noch zu fliehen versuchte, würde sie genau vor Bens Flinte kommen. So konnte nichts mehr schief gehen.
James bahnte sich langsam einen Weg durch das kniehohe Gras und hielt seine Muskete im Anschlag. Seine Blicke fixierten sich auf das Gebüsch. Seltsamerweise waren jetzt aber keine weiteren Geräusche mehr zu vernehmen. Befand sich der Truthahn womöglich gar nicht mehr dort?
Bange Sekunden verstrichen. James blickte noch einmal zurück zu der Stelle, wo sich Ben postiert hatte. Sein Freund winkte ihm kurz zu, um ihm zu signalisieren, dass alles in Ordnung war.
Aber das war es nicht. Auf einmal zeigte sich eine schlanke Gestalt zwischen den Büschen und schaute genau in James Richtung. Es war ein Shawnee-Krieger, dessen kahl geschorenen Schädel eine Skalplocke zierte. Dunkle, von Hass erfüllte Augen richteten sich auf James, der beim Anblick des Shawnee-Kriegers zur Salzsäule erstarrte.
Der Shawnee stieß einen schrillen Kriegsschrei aus und holte mit seinem Tomahawk aus. Bruchteile von Sekunden später traf das Beil James und spaltete seinen Schädel mit einem hässlichen Geräusch. Blutüberströmt brach James Boone zusammen.
Fassungslos beobachtete Ben Williams, wie sein Freund starb. Er war kreidebleich im Gesicht, und seine Hände zitterten, als er die Muskete hochriss und einen Schuss auf den Shawnee-Krieger abgab. Die Kugel streifte den Shawnee am Bein und stieß ihn zur Seite.
Ben wirbelte herum und ergriff die Flucht. Er rannte los so schnell er konnte. Seine Gedanken überschlugen sich vor Angst, als er hinter sich weitere laute Schreie vernahm. Der Krieger war also nicht allein gewesen. Seine Gefährten hatten sich auch im Dickicht des Waldes verborgen. Und jetzt hetzten sie ihn!
Ben stolperte über eine knorrige Wurzel, konnte aber sein Gleichgewicht noch halten. Er keuchte und rannte weiter. Panik erfasste ihn, als die wütenden Stimmen näher gekommen waren. Ausgerechnet jetzt musste er daran denken, was Daniel Boone an einem der letzten Abende am Campfeuer erzählt hatte. Die Shawnees und die anderen Waldstämme waren bekannt dafür, dass sie gute und ausdauernde Läufer waren. Sie konnten dieses Tempo lange durchhalten und deshalb auch große Strecken zu Fuß zurücklegen. Ein Weißer hätte das niemals geschafft.
Ein Schuss bellte auf. Etwas zischte gefährlich nahe an Bens Kopf vorbei. Daraufhin änderte Ben seine Richtung und schlug Haken wie ein aufgeschreckter Hase. Seine Muskete konnte er nicht mehr aufladen, denn das hätte ihn zu viel Zeit gekostet. Er war kein erfahrener Grenzer wie Daniel Boone, der für diese Handgriffe nur wenige Sekunden brauchte. Ben war viel zu eingeschüchtert und fürchtete um sein Leben.
Auf einmal traf ihn etwas glühend Heißes im rechten Oberschenkel und ließ ihn laut stöhnen. Ben taumelte und stürzte zu Boden. Gleichzeitig hörte er hinter sich den Triumphschrei eines seiner Verfolger. Als Ben sich umschaute, zuckte er zusammen. Zwischen den Bäumen erkannte er sieben weitere Shwanee-Krieger, die alle in seine Richtung gerannt kamen. Noch waren sie fast fünfzig Yards entfernt. Aber es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihn eingeholt hatten.
Ich will nicht sterben!, dachte Ben voller Verzweiflung und erhob sich unter Schmerzen. Der Stoff an seinem rechten Hosenbein war blutrot. Die Wunde schmerzte stark. So sehr, dass Ben vor Schmerzen fast geschrien hätte.
Er mobilisierte seine letzten Kräfte und stolperte weiter. Etwas weiter oben gab es eine Stelle, wo das Unterholz besonders dicht war. Vielleicht war das Bens letzte Chance, und die musste er nutzen. Auch wenn sein Schicksal an einem seidenen Faden hing.
Tränen liefen ihm die Wangen herunter, und kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn, während er seine Flucht fortsetzte. Es erschien ihm wie eine halbe Ewigkeit, bis er schließlich das schützende Unterholz erreichte und einfach weiter hastete. Er wusste aber, dass ihm seine Verfolger mit jeder weiteren Minute immer näher kamen. Er musste sich etwas einfallen lassen, sonst war alles aus.
Seine Gedanken kreisten ausschließlich um den bloßen Willen, mit dem Leben davon zu kommen. Deshalb übersah er die Wurzel eines mächtigen Baumes und blieb mit dem rechten Fuß daran hängen. Ben stürzte so hart, dass ein feuriger Schmerz durch sein verletztes Bein jagte und ihn für einen Augenblick lang kaum klar denken ließ.
Als er sich wieder erheben und seine Flucht fortsetzen wollte, holte ihn erneut der Schmerz in seinem Bein ein. Das Brennen im Oberschenkel hatte sich auf das gesamte Bein ausgebreitet. Jetzt war er am Ende!
»Nein...«, murmelte Ben und schaute sich voller Panik um. Der Gedanke, wehrlos seinen Verfolgern ausgeliefert zu sein, überlagerte alles andere.
Erst dann entdeckte er den Windbruch aus drei umgestürzten Bäumen. Es war eine hauchdünne Chance, mehr nicht. Aber er musste sie nutzen, sonst würde er sterben. Stöhnend kroch er auf den Windbruch zu und erreichte ihn, bevor seine Verfolger das dichte Unterholz durchkämmen und ihn sehen konnten. Sein Bein schmerzte entsetzlich, als sich Ben einen Weg durch die verzweigten Äste bahnte und hoffte, dass ihn die Shawnees nicht entdeckten.
Er atmete ganz flach, als er die Verfolger sah. Die Krieger tauchten zwischen den Bäumen auf. Ganz lautlos, wie Geister aus einer anderen Welt. Sie verständigten sich durch Zeichen und teilten sich auf. Drei der Krieger suchten das Gelände weiter südlich ab. Zwei weitere eilten hinüber zur anderen Seite des Windbruchs und suchten dort nach dem Flüchtigen. Die übrigen Krieger verharrten auf ihrem Posten und beobachteten das Gelände.
Ben zitterte am ganzen Körper, als die beiden Krieger sich wenige Augenblicke später dem Windbruch näherten.
Jetzt ist es aus, dachte er voller Panik. Gleich werden sie mich entdecken, und dann werden sie mich umbringen!
Aber dazu kam es nicht. Drei weitere Gestalten tauchten zwischen den Bäumen auf. Ben wollte nicht glauben, was er jetzt sah. Einer seiner Verfolger war ein Weißer! Er trug zwar die Kleidung eines Grenzers, aber Ben hatte ihn noch niemals zuvor gesehen. Der Krieger, der nur wenige Schritte von ihm entfernt stand, war groß und kräftig. Die Befehle, die er den anderen zurief, ließen Ben erkennen, dass dieser Mann der Anführer war.
Er war zu weit entfernt und konnte nicht verstehen, was der Häuptling mit dem Weißen zu besprechen hatte. Aber die Gesten waren eindeutig. Der Häuptling rief seine Krieger zurück. Darüber war Ben erstaunt. War dies vielleicht die Chance, auf die er gehofft hatte?
Er wagte kaum zu atmen, als die Krieger sich um ihren Häuptling versammelten und auf weitere Befehle warteten. Die ließen auch nicht lange auf sich warten. Mit eindeutigen Gesten signalisierte der Häuptling seinen Kriegern, was sie jetzt tun sollten
Nur wenige Augenblicke später waren sie so schnell verschwunden wie sie aufgetaucht waren. Auch der Weiße, der offensichtlich zu ihnen gehörte, war zwischen den Büschen untergetaucht. Im ersten Moment glaubte sich Ben noch in einem Alptraum gefangen, aus dem er einfach nicht erwachen konnte. Erst dann wurde ihm bewusst, was das bedeutete. Er war unfreiwillig Zeuge von etwas geworden, was für ihn und die ahnungslosen Siedler noch verhängnisvolle Folgen haben konnte. Zumal die Krieger genau in die Richtung gerannt waren, aus der er und James gekommen waren.
»James«, flüsterte Ben, als er an den schrecklichen Tod seines Freundes dachte. »Warum nur...?«
Er biss die Zähne zusammen, weil der Schmerz in seinem Bein wieder jeden anderen Gedanken überlagerte. Die Wunde blutete immer noch, und er konnte das Bein kaum noch bewegen.
Dennoch versuchte er es, weil ihm klar wurde, dass die anderen Siedler in großer Gefahr waren. Jemand musste sie warnen, sonst würde etwas Schlimmes geschehen. Obwohl Ben durch den Blutverlust ziemlich geschwächt war, zwängte er sich durch die Äste und bemühte sich wieder auf die Beine zu kommen.
Ein weiterer Schwächeanfall stoppte dieses Vorhaben. Ben fiel zurück und sah bunte Kreise vor seinen Augen tanzen. Sekunden später fiel er in eine tiefe Ohnmacht.
* * *
Daniel Boones Miene verdüsterte sich, als er erfuhr, dass sein Sohn James zusammen mit Ben Williams das Camp verlassen hatte. Er sah den sorgenvollen Blick seiner Frau Rebecca und las in ihren Augen die große Sorge, die sie erfasst hatte.
»Mit dem Jungen werde ich ein ernstes Wort reden, Rebecca«, sagte er mit grimmiger Stimme. »Er kann doch nicht einfach alle Warnungen in den Wind schlagen. Wie lange ist er schon weg?«
»Ich bin mir nicht sicher, Daniel«, seufzte Rebecca. »Vor einer Stunde habe ich ihn noch drüben am Bach gesehen. Ben Williams war bei ihm.«
»Das stimmt, Vater«, meldete sich nun auch Israel Boone zu Wort, Daniels ältester Sohn. »Ben hatte eine Muskete dabei. Ich habe es gesehen, mir aber nichts dabei gedacht. Selbstverständlich komme ich mit, wenn du James suchen gehst.«
»Gut«, erwiderte Boone nickend. »Dann halte dich bereit. Ich werde nur noch kurz mit Stuart und seinen Leuten sprechen. In zehn Minuten geht es los.«
Israel kannte seinen Vater zur Genüge und wusste, wann es besser war, nicht länger über eine bestimmte Sache zu sprechen. James war zwei Jahre jünger als Israel und betrachtete das Leben noch als ein einziges Abenteuer. Er war an der Schwelle, erwachsen zu werden, ließ sich damit aber noch Zeit. Stattdessen war er immer mit Ben zusammen. Für die beiden war der Treck nach Kentucky das Abenteuer ihres Lebens. Dass ein solches Unternehmen natürlich auch mit zahlreichen Risiken und Gefahren behaftet war, interessierte James erst im Nachhinein. Deshalb war es eigentlich typisch für ihn, dass er die erstbeste Gelegenheit nutzte, um das zu tun, was er sich in den Kopf gesetzt hatte.
Es war gerade mal eine knappe halbe Stunde vergangen, seit John Stuart und seine Gefährten ins Camp der Siedler gekommen waren und sich untereinander bekannt gemacht hatten. Boone hatte an einigen dieser Gespräche teilgenommen und sich deshalb erst zuletzt um seine eigene Familie gekümmert. Hätte er gewusst, was James vorgehabt hatte, dann wären die Dinge ganz anders vonstatten gegangen.
Boone brauchte nicht lange, um Stuart und seine Leute zu informieren. Spontan erklärten sich Stuart und zehn weitere Männer bereit, mitzukommen, während die anderen vorsorglich Wachen aufstellten und Boone versprechen mussten, jetzt ganz besonders aufzupassen.
Boone und sein Sohn Israel bildeten die Spitze der Gruppe, die sich nun in den Wald begab. Jeder von ihnen hatte seine Rifle schussbereit und rechnete mit dem Schlimmsten. Dieser Verdacht verstärkte sich noch, als in einiger Entfernung plötzlich das rollende Echo eines Schusses zu hören war.
»Kommt!«, rief Boone seinen Begleitern zu und beschleunigte seine Schritte. Während dessen fiel ein weiterer Schuss, und Boones Gedanken überschlugen sich. Sein Gefühl signalisierte ihm Schlimmes.
Wenige Augenblicke später hatten die Männer den Wald betreten und schauten sich wachsam nach allen Seiten um. Es war alles still bis auf das Zwitschern einiger Vögel hoch oben in den Baumwipfeln. Boones Blicke glitten hinüber zum dichten Unterholz. Täuschte er sich, oder hatte er gerade dort eine huschende Bewegung bemerkt? Aber als er einige Schritte in diese Richtung ging, konnte er nichts Auffälliges erkennen.
»Was ist, Daniel?«, rief John Stuart. »Hast du was entdeckt?«
»Nichts«, antwortete Boone. »Zumindest glaube ich das. Lasst uns weiter gehen. James und Ben müssen hier irgendwo stecken. So weit können sie doch gar nicht gekommen sein...«
Er sagte das, um sich selbst Mut zu machen. Aber tief in seinem Herzen verstärkte sich der Verdacht, dass die beiden Jungen Probleme bekommen hatten. Es fielen keine weiteren Schüsse mehr, und auch sonst war kein verdächtiger Laut zu hören. Bis auf das Knacken der Äste unter den Schuhen der Männer.
»Hier drüben!«, rief nun einer der Hatfield-Brüder. »Da ist jemand. Verdammt, das könnte einer der beiden Jungen sein!«
Boone machte auf der Stelle kehrt und rannte so schnell er konnte. Asa Hatfield stand vor einem Windbruch und beugte sich in diesem Moment über den Körper eines Bewusstlosen, dessen Kleidung blutig war. Erst als Boone näher kam, erkannte er, dass es Ben Williams war. Aber von seinem Sohn James war weit und breit nichts zu erkennen.
»Er kommt allmählich zu sich«, riss ihn Hatfields Stimme aus seinen verzweifelten Gedanken. »Ganz ruhig, Junge«, redete er auf ihn ein. »Du bist in Sicherheit. Es ist alles in Ordnung...«
Panik zeichnete sich in den blassen Zügen Bens ab, als er im ersten Moment verwirrt um sich schaute. Als er Israel und seinen Vater entdeckte, wirkte sein Gesicht auf einmal verschlossen. John Stuart und zwei seiner Leute gingen weiter und suchten das Gelände nach Spuren ab. Boone registrierte dies am Rande, während er seinen Blick auf Ben richtete.
»Was ist passiert?«, fragte er den Verletzten. »Wo ist James?«
»Shawnees«, keuchte Ben. »Sie waren auf einmal da. Einer von ihnen tauchte aus dem Gebüsch auf. Er hatte das Kollern eines Truthahns nachgeahmt. So täuschend echt, dass James und ich darauf reingefallen sind.«
»Wo ist mein Sohn, Ben?«, fragte Boone noch einmal. Diesmal allerdings in sehr ungeduldigem Ton. Seine Miene wirkte angespannt, als er bemerkte, dass Ben mit einer Antwort immer noch zögerte.
»Ich konnte nichts tun, Mr. Boone«, rückte er mit der Wahrheit heraus. »Verdammt, es ging alles so schnell. Der Shawnee schleuderte sein Kriegsbeil, und James...«
Er brach ab. Ein Schluchzen stieg aus seiner Kehle empor.
»Vater, was hat das zu bedeuten?«, wandte sich Israel an ihn. »Um Himmels Willen, wir müssen James suchen.«
»Das weiß ich selbst«, erwiderte Boone etwas heftiger als er das eigentlich beabsichtigt hatte. Sekunden später murmelte er eine rasche Entschuldigung, als er sah, dass sich Israels Miene verdüsterte. Schließlich konnte sein ältester Sohn nichts dafür, dass James etwas zugestoßen war. Dass dies der Fall war, davon musste Boone jetzt ausgehen.
Er erhob sich, während der junge Ben immer noch weinte. Er war nicht in der Lage, zu sprechen. Während zwei Männer sich um die Wunde des Verletzten kümmerten, schaute Boone in die Richtung, wo er John Stuart und die beiden anderen Männer zuletzt gesehen hatte. In diesem Moment tauchten sie im Gebüsch auf.
Boone brauchte Stuart nur kurz anzusehen, um zu wissen, dass sich seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt hatten.
»Wo ist mein Junge, John?«, fragte Boone und bemerkte, wie der alte Freund seinem Blick nicht länger Stand halten konnte.
»Geh nicht weiter, Daniel«, erwiderte Stuart. »Es ist kein schöner Anblick. Meine Leute und ich machen das schon...«
»Aus dem Weg!«, sagte Boone in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete. Als Stuart nicht schnell genug reagierte, versetzte Boone ihm einfach einen Stoß mit dem Ellenbogen. Stuart fluchte, hinderte Boone aber nicht daran, hinüber zu den Büschen zu gehen.
Um Boones Mundwinkel zuckte es, als er seinen Sohn James sah. Seine Hände zitterten, als er sich über den blutigen Leichnam beugte und mit der linken Hand fast zärtlich über den Haar strich.
»James...«, murmelte er und ließ den Kopf sinken. Von Trauer geschüttelt, registrierte er überhaupt nicht, was um ihn herum geschah. Erst als er Schritte hörte, hob er mühsam den Kopf und sah Israel neben sich stehen. Israels Miene war ebenfalls sehr angespannt, und in seinen Augenwinkeln glitzerte es feucht.
»Er ist tot«, murmelte Boone mit einer hilflosen Geste. »Und ich habe es nicht verhindern können.«
»Keine hätte das gekonnt«, versuchte Israel seinen Vater zu trösten. »James hatte immer einen ziemlichen Dickkopf, wie du weißt. Mach dir keine Vorwürfe, denn das macht James auch nicht wieder lebendig. Diese verdammten Rothäute...«
Israels Stimme geriet ins Stocken, und seine Fäuste ballten sich vor Zorn über den Tod seines jüngeren Bruders. Boone sah, wie schwer es Israel nahm. Deshalb erhob er sich rasch, ging auf seinen ältesten Sohn zu und legte ihm tröstend die Hand auf die Schulter.
»Rebecca wird es schwer zu schaffen machen, mein Junge«, murmelte er. »Wir müssen James zurück zum Camp bringen und ihn begraben.«
Israel erwiderte nichts darauf. Aber Boone sah die Zustimmung in dessen Augen. Gemeinsam bückten sie sich und hoben den toten James ganz vorsichtig hoch. Als wenn sie Angst hätten, ihn zu verletzen.
»Es tut mir sehr leid, Daniel«, sagte John Stuart, als Boone und Israel mit der Leiche zurückkehrten. »Wir helfen dir natürlich...«
Boone erwiderte nichts darauf. Er war blass im Gesicht und blickte hinüber zum Windbruch, wo die anderen Männer jetzt den verletzten Ben Williams herausgeholt hatten. Der Junge schaute zu Boone und ließ den Kopf sinken, als er erkannte, welche traurige Last Vater und Sohn jetzt trugen.
»Warum nur?«, murmelte Boone so leise, dass es noch nicht einmal Israel hören konnte. »Er war doch noch so jung...«
Aber er wusste auch, dass er auf diese Frage niemals eine Antwort erhalten würde. Manchmal ging das Schicksal eben grausame Wege – und in diesem Falle hatte es Boones Familie hart getroffen.
Rasch bauten die Männer aus einigen stabilen Ästen zwei Tragen, während Asa Hatfield und ein weiterer Grenzer das Gelände im Blickfeld behielten. Aber es blieb alles ruhig. Nichts wies darauf hin, dass noch Indianer in der Nähe waren. Nur der verletzte Ben und der tote James waren ein eindeutiger Beweis dafür, dass diese Ruhe sehr trügerisch war.
»Daniel!«, rief einer der Männer und riss damit Boone aus seinen trüben Gedanken. »Hier drüben sind Spuren. Das musst du dir ansehen!«
Boone kam näher und sah, wie der Mann ganz aufgeregt auf einige Fußabdrücke im Waldboden zeigte.
»Die Spuren sind nicht zu übersehen, Daniel«, sagte er. »Es sind mindestens zehn Krieger. Was meinst du?«
»Stimmt«, bestätigte Boone den Verdacht des Mannes, nachdem er sich selbst einen kurzen Überblick verschafft hatte. »Horace, das gefällt mir nicht. Die Spuren führen genau in die Richtung, wo sich unser Lager befindet.«
»Ob sie es schon entdeckt haben?«, fragte der Siedler und wurde jetzt blass.
»Wahrscheinlich«, seufzte Boone. »Wir müssen zurück – und zwar so schnell wie möglich. Sonst...«
Er kam nicht mehr dazu, diesen Satz zu vollenden. Denn genau in diesem Moment erklangen gellende Kriegsschreie. Gefolgt von mehreren Musketenschüssen.
»Diese Bastarde«, sagte Boone voller Zorn. »Sie haben nur darauf gewartet, dass wir uns vom Camp entfernen. Los, wir müssen uns beeilen!«, wandte er sich an seine Gefährten. »Jede Minute zählt.«
KAPITEL 2
William Bentley grinste in freudiger Erwartung, als er durch die Zweige der Büsche die Planwagen in der Nähe des kleinen Baches sah, der sich sein Bett durch die Senke grub. Es war ein friedliches Bild. Einige der Frauen wuschen ihre Wäsche am Fluss, mehrere Kinder spielten in der Nähe der Wagen, und die meisten Männer waren damit zugange, notwendige Ausbesserungsarbeiten an ihren Gerätschaften vorzunehmen.
»Sie sind ahnungslos – trotz der Wachen, die sie aufgestellt haben«, sagte Häuptling Blackfish zu dem britischen Agenten. »Meine Krieger werden sie schneller überrumpeln als sie glauben.«
»Die Waffen, die ihr bekommen habt, werden euch dabei helfen«, goss Bentley noch ein wenig Öl ins Feuer, um den Hass auf die amerikanischen Siedler weiter zu schüren. »Die ersten Gegner habt ihr ja schon getötet...«
»Das waren fast noch Kinder«, erwiderte Blackfish. »Das ist keine große Ehre für einen Shawnee. Wir tun es, damit kein Weißer Kain-tuck-ee zu sehen bekommt.«
»Der Moment ist günstig«, sagte Bentley. »Jetzt sind die Weißen schwach, weil ein Teil von ihnen nach den beiden Jungen sucht. Du hast gesehen, dass auch Boone bei ihnen war?«
»Er war so nahe«, murmelte Blackfish mit unterdrücktem Zorn. »Ich hätte ihn töten können, William Bentley. Aber das muss noch warten.«
Während er das sagte, gab er den Kriegern, die sich in unmittelbarer Nähe zwischen den Büschen verborgen hielten, einen kurzen Wink. Für Bentley bedeutete das, dass der Angriff jeden Augenblick beginnen würde. Deshalb wurde es nun auch Zeit für ihn und seine Männer, sich auf den Kampf vorzubereiten. Denn Blackfish erwartete natürlich von seinen neuen Verbündeten, dass sie Seite an Seite mit dem Shawnees kämpften.
Bentley beobachtete, wie geschickt die Shawnees ans Werk gingen. Sie waren Meister im lautlosen Anschleichen. Niemand von den Wachposten bemerkte, in welcher Gefahr sich die Siedler befanden. Und als es ihnen klar wurde, war es bereits zu spät.
Das Aufbellen eines Musketenschusses zerriss die Stille. Einer der Wachposten wurde von der Kugel getroffen und brach zusammen. Bruchteile von Sekunden später fielen weitere Schüsse. Ein alter Mann, der unweit eines Planwagens mit einem Wassereimer in der Hand stand, war das nächste Opfer.
Jetzt brach die Hölle los. Die Shawnee-Krieger verließen ihre Deckung und stürmten von zwei Seiten hinunter in die Senke. Ihre lauten und durchdringenden Kriegsschreie gellten in den Ohren der entsetzten Weißen, die im ersten Moment überhaupt nicht wussten, wie ihnen geschah. Auf sie wirkten die heranstürmenden Shawnees wie Racheengel aus einer anderen Welt.
»Schießt doch!«, hörte Bentley jemanden rufen. »Um Gottes willen!«
Nur einen Atemzug später brach die Stimme dieses Mannes ab. Einer der Krieger hatte sein Beil geschleudert und das anvisierte menschliche Ziel natürlich auch getroffen. Der Mann stürzte zu Boden und rührte sich nicht mehr. Seine Frau schrie vor Entsetzen, weil sie den Tod ihres Mannes aus nächster Nähe mitbekommen hatte. Ihr Schrei brach ab, als ein anderer Siedler zu ihr gerannt kam und sie hastig zu Boden riss. Danach eröffnete er das Feuer auf einen der Krieger und streckte ihn mit einem gezielten Schuss nieder.
Auch Bentley und seine Gefährten griffen jetzt in den Kampf ein und schossen auf die bedrängten Siedler. Sie kannten nicht die geringsten Skrupel, auf Menschen zu schießen, die die gleiche Hautfarbe wie sie hatten. Letztendlich ging es nur darum, wer die Vorherrschaft in diesem unermesslich weiten Land erringen würde. Die Indianer, die Bentley aufgehetzt hatte, waren nichts anderes als Mittel zum Zweck. Aber das wussten sie zum Glück nicht.
Bentley und seine Leute brachten dadurch die Verteidiger noch in größere Bedrängnis. Alles musste schnell vonstattengehen. Die Siedler durften nicht einmal den Hauch einer Chance bekommen, sich zu wehren. Nur wenn es den Shawnees gelang, ihre verhassten Gegner im ersten Ansturm zu überrennen, würden die Verluste gering bleiben. Außerdem gab es da noch Boone und die übrigen Grenzer, die Bentley am meisten fürchtete. Deshalb mussten die Shawnees jetzt siegen, um sich dem nächsten Feind zu stellen.
Die Gedanken des Briten brachen ab, als einer seiner Leute plötzlich durchdringend aufschrie und seine Muskete fallen ließ. Sein Gesicht war blutig, als er stürzte. Bentley duckte sich und suchte hastig in einer Bodenwelle Deckung. Gerade noch rechtzeitig. Eine zweite Kugel pfiff gefährlich nahe an seinem Kopf vorbei. Unter den Siedlern und Grenzern gab es gute Schützen. Bentley musste sich vorsehen.
Als er einen weiteren Blick von seiner Position aus riskierte, sah er, dass der Kampf Mann gegen Mann bereits in vollem Gange war. Die ersten Shawnees hatten das Camp erreicht und droschen mit ihren Kriegsbeilen auf jeden Weißen ein, der sich ihnen in den Weg zu stellen versuchte. Eine heftige Auseinandersetzung erreichte nun ihren Höhepunkt. Die Siedler wehrten sich verbissen gegen die Angreifer und kämpften um ihr Leben.
Häuptling Blackfish stand an vorderster Front und feuerte seine Krieger mit einem lauten Schrei an, jetzt nicht locker zu lassen. Der groß gewachsene Shawnee hieb wie ein Berserker um sich und streckte mit einem gezielten Schlag seines Kriegsbeils einen weiteren Weißen nieder, der ihn von der Seite anspringen und zu Boden reißen wollte. Blackfish hatte die Absicht seines Gegners jedoch schon geahnt und entsprechend rasch reagiert.
Der Siedler taumelte zurück und geriet ins Wanken. Blackfish wollte gerade nachsetzen und seinem Gegner den Rest geben, als plötzlich weitere Schüsse fielen – aber aus einer ganz anderen Richtung. Vier Shawnees starben, bevor sie zwei weitere Siedler töten konnten.
Überrascht schaute Bentley zum Waldrand und zuckte zusammen, als er auf einmal eine Gruppe Weißer dort auftauchen sah.
Verdammt! grübelte Bentley. Das sind Boone und seine Leute. Sie waren doch nicht so weit entfernt vom Camp, wie ich eigentlich gehofft hatte. Und jetzt sind sie da und fallen uns in den Rücken!
* * *
Boones Sorge wuchs, als er die gellenden Kriegsschreie der Indianer hörte. Immer wieder fielen Schüsse, gefolgt von verzweifelten Rufen der Siedler, die sich in tödlicher Gefahr befanden. Boone dachte jetzt nicht mehr an seinen toten Sohn, sondern hoffte nur noch, dass Rebecca und Jemina nichts Schlimmes zugestoßen war.
Israel war an seiner Seite. Er hatte seine Rifle schussbereit, genau wie sein Vater. Die beiden waren die ersten, die sich den letzten Büschen am Waldrand näherten und Sekunden später erkannten, welche dramatischen Szenen sich unten im Camp der Siedler abspielten. Pulverrauch hing in der Luft, und reglose Körper lagen in der Nähe des Baches, Weiße und einige Indianer.
»Schieß, mein Junge!«, forderte Boone seinen Sohn auf. »Noch sind wir nicht verloren!«
Noch während er das sagte, hatte er seine Long Rifle bereits hochgerissen, visierte einen der kämpfenden Indianer an und drückte ab. Bruchteile von Sekunden später fiel der Schuss und streckte den Gegner nieder.
Sofort nahm Boone Pulver und Blei aus dem Kugelbeutel, lud seine Long Rifle wieder nach und landete einen zweiten Treffer. So rasch, dass Israel nicht aus dem Staunen kam. In der Zwischenzeit hatte er erst einen Schuss abfeuern können. Der Junge war aufgeregt angesichts der tödlichen Bedrohung und hatte seinen Gegner nur leicht verwunden können. Dennoch blieb der hinkende Shawnee eine Bedrohung für die Frauen und Kinder.
Boone vollendete das, was Israel begonnen hatte und erschoss den Krieger. All dies spielte sich in kürzester Zeit ab. Während dessen hatten auch John Stuart und seine Gefährten das Feuer auf die Shawnees eröffnet. Die erfahrenen Grenzer hatten sofort erkannt, dass das Schicksal der Siedler auf der Kippe stand und schickten den Indianern einen tödlichen Kugelhagel entgegen.
Nachladen und erneut schießen – jeder der Männer in Boones Begleitung konnte das in wenigen Augenblicken. Nur eine knappe Minute später schickten die Grenzer den Shawnees eine weitere Salve entgegen, die die Indianer das Fürchten lehrte. Der Angriff geriet ins Stocken, und die ersten Krieger zogen sich zurück, als die Tapfersten von ihnen von Kugeln niedergestreckt wurden.
»Zielt auf den großen Krieger da drüben!«, rief Boone seinen Gefährten zu, weil er den Shawnee erkannt hatte. »Das ist Häuptling Blackfish. Wenn wir den erwischen, dann geben die anderen auf!«
Aber Boones Hoffnung erfüllte sich leider nicht. Blackfish schien zu ahnen, dass die Situation immer brenzliger wurde und die Krieger sich notgedrungen zurück ziehen mussten. Sie bekamen Unterstützung von einer Gruppe Weißer, die sich jetzt zwischen den Büschen zeigten und mit gezielten Schüssen Boone und seine Leute auf Distanz halten wollten.
»Daniel, was hat das zu bedeuten?«, rief John Stuart, der die Weißen ebenfalls erspäht hatte und sich ducken musste, damit er den Angreifern kein Ziel bot. »Das sind doch Weiße – wie wir!«
»Das sehe ich!«, antwortete Boone grimmig und feuerte einen weiteren Schuss auf die Feinde ab. Diesmal erwischte er einen der weißen Halunken, der sich etwas zu weit vorgewagt und seine Deckung sträflich vernachlässigt hatte. Diesen Mut bezahlte er jetzt mit seinem Leben. Boone traf ihn in den Magen.
Der Mann brüllte wie ein Tier, als er zusammen brach. Aber niemand half ihm. Seine Kumpane waren zu sehr damit beschäftigt, einen halbwegs geordneten Rückzug der Shawnees vorzubereiten und die Verluste jetzt so gering wie möglich zu halten.
»Sie fliehen!«, schrie Asa Hatfield. »Ihnen nach!«
»Halt!«, ließ ihn Boones Stimme innehalten. »Das ist viel zu gefährlich. Darauf warten sie doch nur. Lasst uns erst nach den anderen unten im Camp sehen. Beeilt euch – sichert das Gelände. Worauf wartet ihr noch?«
Jeder der Männer erkannte Boones Führungsrolle an. Auch wenn einige der Grenzer die Indianer verfolgen wollten, so begriffen sie rasch, dass Boone Recht hatte. Jetzt galt es erst einmal, die Lage zu sondieren und heraus zu finden, wie groß die Verluste in den eigenen Reihen waren.
Boones Blicke schweiften hinüber ins Camp. Panik erfasste ihn, als er Rebecca und Jemina nicht gleich entdeckte. Aber dann atmete er erleichtert auf, als Rebecca und Jemina vorsichtig unter einem Planwagen hervor krochen und ihren Rettern zuwinkten. Beide kamen auf Boone zugeeilt, als sie ihn und Israel sahen.
»Dem Himmel sei Dank, Daniel«, seufzte seine Frau und warf sich ihm in die Arme. »Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Aber wir haben es überstanden.«
Boone erwiderte nichts. Seine Miene war angespannt – genau wie die seines Sohnes. Rebecca bemerkte das erst jetzt.
»Was ist denn los?«, fragte sie mit nervöser Stimme und ließ ihre Blicke in die Runde schweifen. »Wo...wo ist James?«
Als Boone nicht gleich darauf antwortete, begann ihre Stimme zu zittern. Vor allen Dingen, als sie bemerkte, dass Israel ihrem Blick auswich und betreten zu Boden blickte.
Jemina ahnte Schlimmes und schlug entsetzt die Hand vor den Mund, als sie auf einmal ahnte, was geschehen war. Nur ihre Mutter hatte noch Hoffnung und schaute immer wieder abwechselnd von ihrem Mann zu Israel.
»Wir konnten es nicht verhindern, Rebecca«, murmelte Boone. »James und Ben haben einen Fehler gemacht. Sie entfernten sich zu weit vom Camp und gerieten in einen Hinterhalt der Shawnees. Ben wurde verletzt – aber James...er ist tot.«
Noch nie war ihm etwas so schwer gefallen wie seiner Frau diese schreckliche Nachricht zu überbringen. Rebecca Boone zitterte am ganzen Körper als ihr bewusst wurde, was ihr Mann gerade gesagt hatte. Unstet huschten ihre Blicke umher.
»Ich will ihn sehen«, flüsterte sie keuchend. »Wo ist er?«