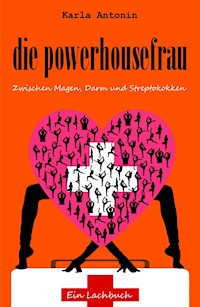
3,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gretchen von Rindt, hochbegabt und trotzdem blöd, hat als Einzige ihres Jahrgangs ein Einser-Abi hingelegt. Ihr Traum, Medizinerin zu werden, scheitert an ihrer Faulheit und so landet sie als Kassiererin bei "Prengelmann". Damit das inventurbedingte Zählen tiefgefrorener Hähnchenkeulen nicht der einzige Höhepunkt im langweiligen Leben der Achtunddreißigjährigen bleibt, stürzt sich Gretchen in Affären. Nach Feierabend aktiviert sie ihr Powerhouse und gibt sich den männlichen Auszubildenden auf der Käsetheke des Kölner Discounters hin. Eine kurzzeitige Ohnmacht bringt die Wende: Gretchen verliebt sich in den Kunden Georg Zimmerli. Der ist nicht nur äußerst attraktiv, sondern hat etwas, was sie auch gerne hätte: einen Doktortitel. In der Hoffnung auf ein Leben im Luxus beschließt sie, Ehefrau des heißesten Kinderarztes diesseits des Mississippi zu werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wer denkt sich sowas aus?
Karla Antonin stammt aus der hessischen Provinz. Lange vor dem Abitur reifte in ihr der Wunsch, eine erfolgreiche Schauspielerin zu werden. Kurz nach dem Abitur stellte sie fest: das wird nix mehr.
Sie absolvierte ein Volontariat in der lokalen Presse und schrieb viele Jahre Kolumnen für das heimische Anzeigenblatt, mit dem sie als Teenager ihren Hasenstall gedämmt hatte. Eine unschöne Ehe und ein wunderbares Kind später, verliebte sie sich in den Kinderarzt ihres Sohnes und sprang vorübergehend als Arzthelferin ein. Aus vorübergehend wurde ein fast zehnjähriges, erlebnisreiches Dauerpraktikum.
Inspiriert von ihren Erfahrungen mit hilfsbedürftigen Kindern, sowie als Resultat ihrer Tierliebe, entschied sich Karla, die Praxis zu verlassen, ein lustiges Buch zu schreiben und eine Ausbildung zur Reittherapeutin zu machen.
Karla lebt mit ihrem Sohn und ihrem Kinderarzt noch immer in der Provinz. Zur Familie gehören weiterhin vier Ponys, ein Hund und ein Dackel.
Für meinen geliebten Sohn KarlUnd, damit von mir was bleibt
Karla Antonin
die powerhousefrau
Zwischen Magen, Darm und Streptokokken
© 2019 Karla Antonin
Umschlag, Illustration: Karla und JessicaLektorat, Korrektorat: Jani Henrich
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7497-0907-6
Hardcover
978-3-7497-0908-3
e-Book
978-3-7497-0909-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Wat kütt? Dat kütt!
Apfelsine mit Nebenwirkung
Kummer kommt von Kümmern…
Meysel gegen Pauschke
Arthrosa
Kein Porsche.
Bruno
Grau und trotzdem auf Sühült
Noch mehr Chaos
Powerhouse
Murmeltierwochen
Wat fott es, es fott….
Vorsicht, bissiger Hund.
Anastasia
Unheiligabend
Gefährliche Anamnese….
Geflüchtet
Dornröschen
Et hätt noch emmer joot jejange..
Noch kurz erklärt
Kein Pipi, kein Stinki, keine Würmer. Absolut null Kontakt mit Exkrementen und allem, was krabbelt. Das waren die Bedingungen, unter denen ich bereit war, für kurze Zeit in der Praxis meines Mannes auszuhelfen. Und zwar genau so lange, bis wir eine Nachfolgerin für jene Arzthelferin gefunden hätten, die uns kurz zuvor glücklicherweise verlassen hatte. Es wurden fast zehn Jahre daraus. Auch, weil es ein Leichtes war, die abtrünnige Kollegin zu ersetzen. Schließlich konnte ich, ganz im Gegensatz zu ihr, gut mit Menschen umgehen. Und es begann mir zu gefallen. Mein neuer Job wies zwar relativ wenig Gemeinsamkeiten mit meiner beruflichen Vergangenheit in unserer Zeitungsredaktion auf, aber er war interessant. Und da ich nur wenige Qualifikationen vorweisen konnte, die mich zu einer guten Medizinischen Fachangestellten gemacht hätten, tat ich einfach, was mir leicht fiel:
Ich war freundlich. Ich lächelte. Immer und in allen Sprachen.
Freundlich kann ich, ganz gleich, in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde. Und meist ist es genau das, was die Eltern kranker Kinder brauchen: Trost und Zuspruch. Ich fing
an, die Kleinen in mein Herz zu schließen. Nicht die Arschkinder … die anderen, von denen gibt es nämlich mehr. Zum Glück. Und keins ist wie das andere.
Weder für meinen Mann, noch für mich und meine Kolleginnen spielt es eine Rolle, welche Hautfarbe die Kleinen haben. Kinder sind uns anvertraut. Kinder brauchen uns. Egal ob sie aus Sri Lanka kommen oder dem Hochsauerland.
Es dauerte übrigens nicht lange und ich war bereit für den nächsten Schritt: Ich beschäftigte mich aus, wie ich dachte sicherer Entfernung, mit der Anatomie von Läusen, die mein Mann mit Tesafilm auf seinem Schreibtisch festgeklebt hatte, um überforderten Muttis zu zeigen, was auf den Köpfen ihrer Sprösslinge so gar nichts zu suchen hat.
Leider buchten sich die Totgeglaubten kurzerhand auf meinem Haupt zur Untermiete ein. Aber davon erzähle ich dann in meinem nächsten Buch.
Vielleicht.
Humor ist die beste Medizin
Tiefschwarz ist er nicht, mein Humor. Aber so ein bisschen grau schon. Na gut, dunkelgrau. Und er ist immer noch die beste Medizin. Was er soll, mein Humor: meine Leserinnen und Leser zum Lachen bringen. Sie für eine Buchlänge aus dem Alltag holen und auf eine lustige Reise schicken. An regnerischen Nachmittagen im Strandkorb die wärmende Sonne hervor holen. Humor ist das, was uns am Leben hält. Ob im Urlaub auf Sylt, zu Hause auf dem Sofa, oder meinetwegen auf dem Klo.
Was er nicht soll, mein Humor: Menschen aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Herkunft, oder wegen ihres Berufes diskriminieren. Schon gar nicht aufgrund ihres Andersseins. Ich mag nämlich Menschen, die in kein Raster passen, die eine andere Sprache sprechen oder die einfach ein Leben leben, das zu leben ich mich nie trauen würde. Und genau deswegen entfliehe ich meinem Alltag durch Schreiben. In diesem Falle ein lustiges und natürlich maßlos übertriebenes Buch.
Viel Spaß beim Lesen!
Apfelsine mit Nebenwirkung
„DOKTORRR MUSS KOMMEN! SOFFORT! Meine Sonn hat tolle Wutt. Überrrall Schaum. Nix vertragen Medizin!“
Herr Metin hyperventlierte am anderen Ende der Leitung.
„Ich sagen kommen!! SOFFORT! Nix gleich, nix in einer Stunde. SOFFORT!“
Im Hintergrund waren eigenartige Geräusche zu hören. Etwa so, als würde jemand pausenlos in die Badewanne pupsen.
„Was ist passiert, Herr Metin?“, fragte ich unseren Fünfvorzwölftürken mit beruhigender Stimme.
„Meine Sonn nix vertragen Medizin und wenn du nix legen ein paar Zähne zu, ich dir nächstes Mal drehen Gesicht auf Rücken!“ Metin, der mehrfach im Quartal um fünf Minuten vor Zwölf in der Praxis hereinschaute, weil Ömer entweder über bedrohliche Längsrillen im Fingernagel, oder sein älterer Bruder Sayed beim Husten über Auswurf von Brötchenresten klagten, schien diesmal tatsächlich ein ernstes Problem zu haben. Selten störte ich den Doktor bei wichtigen Telefonaten, doch in diesem Falle sah ich es als unumgänglich an, sein Gespräch mit der renitenten Vorzimmerdame vom Gesundheitsamt zu unterbrechen.
„Schahatz, kannst du bitte selbst mit Herrn Metin sprechen? Ich glaube, heute ist es wirklich ernst“, bat ich den Mann hinterm Schreibtisch mit flehendem Blick.
Sie sind der Meinung, es schickt sich für eine Arzthelferin nicht, ihren Chef als Schatz zu bezeichnen? Stimmt, ich sehe das eigentlich ähnlich, wenngleich ich inzwischen begriffen habe, dass die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Helferin nicht selten in amourösen Überstunden endet. Im Hinblick darauf, dass der Doktor schon lange Bett und sogar Tisch mit mir teilt, nenne ich ihn allerdings, wie´s mir gerade passt.
Außerdem hatte ich keine Lust mehr, mir Metins Tollwutgeschichte ins Ohr schreien zu lassen und so zog ich es vor, den Hörer in kompetentere Hände abzugeben. Metin, der noch immer ins Telefon brüllte, merkte nicht einmal, dass er inzwischen dort angekommen war, wo er ursprünglich hin wollte: am Trommelfell seines
Kinderarztes nämlich.
Georg hielt den Hörer in etwa zwanzig Zentimetern Entfernung zum Ohr. Nicht zu weit, um eine Atempause Metins zu verpassen und somit endlich selbst reden zu können, aber eben doch nicht nah genug, um genanntes Trommelfell zum Platzen zu bringen. Übrigens ist mir bis heute rätselhaft, wie man zwanzig Jahre in diesem Beruf tätig sein kann, ohne je einen Hörsturz erlitten zu haben. Nicht wegen der kreischenden Babys, sondern schlichtweg als Folge des täglichen Umgangs mit hysterischen Mamas, für die Impfungen gleichbedeutend sind mit lebensgefährlichen Attacken auf ihr Liebstes. Naht der Doktor mit der Spritze, klammern sie sich an ihren Nachwuchs, als wünschten sie sich sehnlichst, das Kleine in die auf Knopfdruck jederzeit weit zu öffnende Gebärmutter zurückzustopfen, bis der Böse das Mordwerkzeug wieder weggepackt hat.
Das Gebärmutterproblem stellte sich bei Metin natürlich schon deshalb nicht, weil er erstens ein Mann - in diesem Falle ein Papa - und zweitens entgegen seiner Fünf-vor-zwölf- Gewohnheit lediglich am Telefon zu hören war.
„DU KOMMEN! SOFFORT!“
War es das kurze Räuspern meines Mannes, das männliche Atemgeräusch (falls es so was gibt) oder einfach nur die Tatsache, dass am anderen Ende der Leitung niemand mehr versuchte, ihn zu unterbrechen? Jedenfalls schien Metin begriffen zu haben, dass er nun endlich den Mann am Telefon hatte, der eigentlich längst mit Lalülala auf dem Weg zu ihm nach Hause sein sollte, um Klein Ömer zu retten.
Warum er denn so aufgeregt sei, fragte der Doktor in übertrieben gelassenem Tonfall. Und er solle versuchen, ihm so detailgenau wie irgend möglich zu erklären, warum Ömer seiner Meinung nach in Lebensgefahr sei.
Um die innere Ruhe des Doktors zu verstehen, muss man wissen, dass mein Mann während seiner Zeit als Kinderarzt einen großen Erfahrungsschatz anreichern konnte. Es braucht in diesem Beruf nicht allzu lange, um festzustellen, dass Kinder mit juckender Kopfhaut in den seltensten Fällen eine ernsthafte Hauterkrankung, sondern lediglich ein paar aktive Mitbewohner haben, die allgemein als Läuse bezeichnet werden. Deren Befall zu diagnostizieren und vor allem zu kommunizieren, erfordert fast noch größeres Feingefühl, als einer Mutter zu sagen, dass sich ihr Kind mangels IQ um einen Studienplatz in diesem Leben keine Sorgen machen muss.
Klein Ömer jedoch plagten weder Läuse noch eine unterdurchschnittliche Intelligenz. Ömer schäumte und obgleich er bisher wohl noch nicht versucht hatte, seinen Papa zu beißen, schien dieser ganz und gar von der Tollwut-Theorie überzeugt zu sein.
„Kind Tablette nix gudd vertrage, jetzt tolle Wutt.“ Seine Stimme bebte derart laut, dass ich jedes Wort verstehen konnte, obwohl ich fast zwei Meter vom Schreibtisch entfernt stand.
Der Doktor erinnerte sich gut daran, dass der Vierjährige am Tag zuvor wie gewohnt um fünf vor Zwölf auf dem Rückweg vom Einkauf mit Papa einen Schlenker in unsere Praxis gemacht hatte. Allerdings war er sicher, ihm keine Tabletten, sondern lediglich ein Rezept für Fieberzäpfchen in die Hand gedrückt zu haben, weil Papa Metin meinte, Klein Ömer habe erhöhte Temperatur.
Da wir Bett und wie ich bereits erwähnte sogar Tisch teilen, teilen mein Mann und ich natürlich all das, was auch andere Paare teilen. Wir teilen die Brötchen, wir teilen (ungern) die Fernbedienung, wir teilen das Badezimmer. Manchmal teilen wir sogar Trauer und Freude. Und weil der Doktor beim Thema Freude zeigen ebenso zurückhaltend ist wie bei der aufdringlichen Dame vom Gesundheitsamt, erschrak ich fast zu Tode, als er just in diesem Moment schallend zu lachen begann. Georg klopfte sich mindestens zehnmal auf den rechten Oberschenkel, fegte seine Kugelschreiber vom Schreibtisch und bog seinen Oberkörper beim Lachen dermaßen weit nach hinten, dass der Zusammenstoß mit der stets hinter seinem Stuhl geparkten Babymessschale das Telefon quer durchs Behandlungszimmer katapultierte.
„DAS ZÄPFCHEN WAR DOCH FÜR´N ARSCH“, brachte der Doktor die Problematik quietschend auf den Punkt. Dabei warf er, der sich sonst stets gewählt auszudrücken pflegte, jegliche Contenance über Bord. Weil auch seine Brille aufgrund des ekstatischen Anfalls abhanden gekommen war, robbte er ein wenig ungalant über den Fußboden, um schließlich laut grunzend die Stelle zu erreichen, wo er das Telefon vermutete. Mein Versuch es ihm anzureichen scheiterte kläglich, da er mich aufgrund eines Krampfanfalls, ausgelöst durch ein falsch verabreichtes türkisches Zäpfchen, nicht mehr wahrnehmen konnte.
Leider bekam der Doktor keine Chance, Herrn Metin den Unterschied zwischen oral und rektal zu erläutern: Metin sowie seine Kinder Ömer und Sayed wurden bereits am übernächsten Tag um fünf vor Zwölf beim Betreten der Praxis von Doktor Sturmschläger gesehen, der zwei Straßen weiter sein Unwesen trieb.
Die Sache mit dem verfütterten Zäpfchen geschah – natürlich – an einem „laschDo“, einem Langen-scheiß-Donnerstag! Diese Bezeichnung soll den grausamsten aller Arbeitstage vom „schlaDo“ (Scheiß-langer-Donnerstag) meiner Freundin Anneliese unterscheiden, die zwar beruflich keine Kinder quält, jedoch große Freude daran hat, ihrer Kundschaft am Bankschalter lächelnd zu erklären, dass der Dispo mal wieder bis zum Anschlag überzogen ist.
„Tja, da muss die neue Sitzgarnitur wohl noch ein bissl warten, gell?“ So oder zumindest so ähnlich klingt einer von Annelieses Lieblingssätzen. Und obwohl sie nach eigener Aussage ihren Traumberuf ergriffen hat, hat auch sie unter „schlaDo“ zu leiden.
Erstaunlicherweise habe ich noch nie in irgendeiner Zeitschrift eine Erklärung zu den Hintergründen dieses schrecklichen Tages gelesen. Sehr wohl weiß ich, dass den Menschen vor Montagen graust, sie an Sonntagen Migräne haben und samstags Schuhe putzen müssen. Warum jedoch Bankangestellte und sämtliche Mitarbeiter einer Kinderarztpraxis kurz vorm Wochenende derart leiden müssen, konnte mir bis heute niemand erklären.
Bereits kurz nachdem ich meinen Mann kennen gelernt hatte, war mir aufgefallen, dass er am Donnerstag ein anderer ist. Er ignoriert den Wecker und quält sich erst aus dem Bett, wenn der Drache auf dem Ziffernblatt mit Feuerspucken beginnt. Georg verzichtet an Donnerstagen auf den Kaffee am Morgen, zerfleddert die Tageszeitung und schimpft mit seinem ebenfalls zerfledderten Spiegelbild. Nun könnte man meinen, der Doktor sei so einer Art ungewollter Konditionierung zum Opfer gefallen, nach dem Motto: Dreimal ist an Donnerstagen Scheiße passiert, also hasse ich fortan alle Donnerstage. Leider erklärt das nicht, warum auch ich den vierten Tag der Woche nicht ausstehen kann. Es sagt ebenso nichts darüber aus, warum Anneliese am Bankschalter genervt ist und es erklärt schon gar nicht, warum Metin ausgerechnet an einem Donnerstag den Kinderarzt gewechselt hat.
Glücklicherweise habe ich meinen Mann erstmals an einem Dienstag getroffen, wobei man sagen muss, dass eher er mich getroffen hat. Mit einer Apfelsine nämlich, die ihm aus der Hand geflutscht war, als er, wie immer in Eile, in einer langen hustenden Schlange an meiner Kasse stand. Er hibbelte von einem Bein aufs andere und meckerte irgendwas Unverständliches vor sich hin. Dann fragte er den Familienvater vor ihm in seiner angeboren zynischen Art, ob es in Anbetracht der Menge an Zigaretten in seinem Einkaufswagen nicht sinnvoller sei, sich direkt eine Kugel in den Kopf zu schießen.
„Sie könnten sich und Ihren Kindern einen langen und qualvollen Abschied ersparen“, war das letzte, was ich ihn sagen hörte, bevor mich die Wucht, mit der die Apfelsine auf meinen Schädel aufschlug, mit einem Mal ausknockte. Ich spürte noch, dass sich die Rolle mit Wechselgeld, die ich soeben geöffnet hatte, lustvoll zwischen meinen Beinen ergoss. Dann sank ich vom Kassenstuhl auf den grauenvoll kalten, stets schlecht geputzten Fußboden meines Lieblingsdiscounters und war mit einem Mal: eine
KASSENPATIENTIN!
Keine Ahnung, wie lange ich so benebelt dagelegen hatte, doch als ich meine Augen wieder öffnen konnte, sah ich statt der leckeren Kernlosen für Einsneunundvierzig, die wir immer mal wieder im Angebot hatten, eine unfassbar riesige Menschentraube. Inmitten dieser aufgebrachten, müffelnden, völlig geschockten Menge stand der Attentäter. Attraktiv wie eine Mischung aus leicht angegrautem Brad Pitt und Johnny Depp, mit einem Blick, so bezaubernd und süß, dass selbst eine schielende Beutelratte vor Neid erblasst wäre. In diesem Moment übermannte mich das durchaus befriedigende Gefühl, soeben durch eine außer Kontrolle geratene Apfelsine beinahe zu Tode gekommen zu sein.
Dass ich mich nicht, wie ich gerade noch zu verspüren glaubte, im Paradies befand, sondern um eine Gehirnerschütterung reicher auf Pren- gelmanns Fußboden lag, wurde mir klar, als ich draußen jenes hochfrequente Lalülala-Geräusch vernahm, welches ich zum letzten Mal als Zehnjährige gehört hatte. Damals war beim Reiten, beziehungsweise beim unplanmäßigen Abstieg aus dem Sattel, mein Schlüsselbein zu Bruch gegangen. Wenn ich nicht ein zweites Mal hilflos zwischen zwei kernigen Rettungssanitätern eingeklemmt in eine Krankenanstalt eingeliefert werden wollte, um mir dort mehr Viren einzufangen, als es bei Prengelmann Vitamine gab, musste ich, soviel war klar, schnell reagieren.
Ich schüttelte mir das Kleingeld aus den Haaren, setzte einen überzeugenden „Mir geht´s prima“-Blick auf und robbte zurück auf meinen Kassenstuhl. Während der Raucher irgendwas von „Simulantin“ murmelte und sich auch der Rest der Kernlosen nach Hause trollte, bekam ich nun endlich die Gelegenheit, die Apfelsine näher kennenzulernen.
„Ähh, …tschuldigung“, flüsterte diese, sichtlich erleichtert, dass ich den Anschlag ohne größere Blessuren überstanden hatte. „Man sollte wohl mit frisch eingecremten Händen kein Obst kaufen gehen.“ Er schüttelte peinlich berührt den schönen Kopf. „Dass mir so etwas an einem Dienstag passiert … also, wenn ich noch irgendetwas für Sie tun kann?“
Nun kam mein Einsatz. Keine Ahnung, wie viele meiner achtunddreißig Lebensjahre ich bis zu diesem Tag damit verbracht hatte, auf solch eine einmalige Gelegenheit zu warten. Ich lebte nämlich stets in der Hoffnung, dass der Tag kommen möge, an dem meine zahllosen Liebschaften mit fantasielosen Azubis der Vergangenheit angehörten. Die Begegnung mit der attraktivsten Apfelsine diesseits des Mississippi kam mir da gerade recht.
„Natürlich können Sie etwas für mich tun. Laden Sie mich zum Essen ein. Heute um zwanzig Uhr. Im besten Restaurant der Stadt“ , platzte es aus mir heraus.
Ich war ob meines frontalen Angriffs so unfassbar stolz, dass ich die Antwort des Fremden nur wie im Nebel wahrnahm.
„Heute geht´s nicht, heute hat meine Frau Geburtstag“, erwiderte er lächelnd.
Obwohl er mich erst vor wenigen Minuten zum ersten Mal gesehen hatte, war ihm trotzdem schnell klar, dass er zurückspulen und möglichst flott einen neuen Text aufsprechen musste, wenn er nicht das Risiko eingehen wollte, mich erneut vom Fußboden ablösen zu müssen.
Während also die Farbe meines Desktops sekundenschnell von frischem Rosé über Dunkelrot bis hin zu Kotzgrün wechselte, versuchte er mich zu überzeugen, der Spruch sei nicht nur blöd, sondern vor allem bloß ein Scherz gewesen. Verheiratet sei er schon lange nicht mehr, keine seiner Exen habe heute Geburtstag, und ich könne ihm keine größere Freude machen, als mit ihm zu Abend zu essen.
„Das Lokal können Sie sich natürlich aussuchen. Verraten Sie mir, wo Sie wohnen. Ich stehe um neunzehn Uhr dreißig vor Ihrer Haustüre und dann geht´s los!“ Dann fragte er nach meinem Namen und meiner Telefonnummer, stopfte sich die zermatschte Apfelsine in die Jackentasche und war verschwunden. Ohne zu bezahlen!
Allerdings auch ohne all das mitzunehmen, wofür er gefühlte zwei Stunden in einer miefigen Schlange rauchender Selbstmörder gestanden hatte.
Als der Abend zu Ende ging, befand ich mich in der Horizontalen. Ich lag lang gestreckt auf einer viel zu kurzen Untersuchungsliege, der Mann meiner Träume über mir schwebend. Sein Atem keuchte und die Tränen, die meine Wangen hinunter kullerten, schmeckten so bitter wie der Geruch des Putzwassers, welches die geduldige Reinigungsfachkraft vom Discounter allabendlich verdunsten ließ.
Ich erinnerte mich an die letzte Inventur, während der ich fünfundachtzig abgelaufene Hähnchenkeulen, unzählige Packungen Putenge- schnetzeltes von unglücklichem Federvieh mit rudimentären Gehwerkzeugen sowie mindestens sechzig Eierkartons gezählt hatte, deren Inhalt ich gerade noch zum Schlüpfen vor die Türe bringen konnte. Zum ersten Mal seit langer Zeit, verdammt langer Zeit quasi, bereute ich wieder, mein geplantes Medizinstudium nicht aufgenommen zu haben. Stattdessen hatte ich den alternativen Weg eingeschlagen, der mich sicher eines Tages als einzig hochbegabte Kassiererin zunächst in die Geschichte des örtlichen Discounters und schließlich ins Guinessbuch der Rekorde würde eingehen lassen. Und wie ich so da lag, fiel mir auch wieder ein, dass meine Mama niemals müde geworden war, mich vor dem Verzehr von Meeresgetier zu warnen.
„Kind“, hatte sie stets gemahnt „lass dir bloß die Fischstäbchen aus dem Bauch. Du verträgst die Dinger nicht!“
Alle Kinder liebten Käpt´n Iglo, so dass Mama mich damals fortwährend daran erinnern musste, dass Montezuma die Messer schon zu wetzen begann, wenn wir bloß damit begonnen hatten, Urlaubspläne für den nächsten Nordseeurlaub zu machen.
Mein Magen HASST Fischstäbchen. Nicht einmal zählen konnte ich Sie.
Nun, da ich sie dummerweise gegessen hatte, fühlte ich mich wie eine Schwangere im elften Monat. Mein Körper wollte die fischigen Fremdkörper schnell wieder loswerden. In Anbetracht dessen, dass es inzwischen bereits weit nach Mitternacht war und ich mich bis dahin etwa fünfunddreißig Mal übergeben hatte, wunderte mich kaum noch, dass Georg inzwischen nicht mehr annähernd aussah wie Pitt oder Depp (obwohl … DAS vielleicht schon eher).
Meine Eroberung glich vielmehr einem Überlebenden des Dschungelcamps, der sieben Tage und Nächte zwischen Rainer Langhans und Costa Cor- dalis genächtigt hatte. Meine heftigen Eruptionen zwangen ihn, sich im Gleichschritt mit Infusionsständer in der rechten und einer Kotzschüssel in der linken Hand zu bewegen. Er tat dies mit einer stilvollen Gelassenheit, die ich noch heute an ihm bewundere. Seine Contenance führte letzten Endes auch dazu, dass ich meine Scham nach anfänglicher Wehrhaftigkeit der Vernunft unterordnete und brav an genau der Stelle liegen blieb, an der für gewöhnlich die Eltern kleiner Türken erklärt bekommen, warum man Zäpfchen besser nicht essen sollte.
Keine Frage, mein Schatz hatte mir das Leben gerettet. Und zwar mit der Zufuhr einer gigantischen Menge Flüssigkeit. Sie hätte wahrscheinlich gereicht, den riesigen Karpfenteich meiner Großeltern mit Frischwasser zu befüllen.
Ein Grund für Georgs aufopferungsvollen Einsatz war womöglich, dass er an diesem Abend tief in meiner Schuld stand. Statt um neunzehn Uhr dreißig hatte er mich erst weit nach zweiundzwanzig Uhr zu Hause abgeholt. Statt Nouvel- le Cuisine im hippsten Lokal der Stadt gabs Fischstäbchen nach Kinderarztart in seiner popeligen Dachgeschossküche.
Mit Erschrecken hatte ich feststellen müssen, dass Georgs Wohnung ungefähr der Größe eines Karnickelfreilaufgeheges entsprach, das für zwei Tiere gerade noch reichte, bei dem man jedoch, würde man die Häschen zu dritt halten, die Tierschützer am Halse hätte. Der fließend staubige Übergang von Küche, Bad und Schlafbereich ließ schnell den Verdacht (oder besser: die Hoffnung) aufkommen, dass hier lange keine weibliche Hand gewirkt zu haben schien.
Zu Georgs Entschuldigung muss ich anmerken, dass er an diesem grauen Novembertag nicht den Hauch einer Chance hatte, die Apfelsinennummer wieder gut zu machen. In der Überzeugung, fünfundzwanzig von vierundzwanzig Stunden, die der Tag so bietet, erreichbar sein zu müssen, wusste er schon damals nicht, dass man Handys auch ausschalten kann.
Das fiebernde Russenkind Romanov und der Notruf des kleinen Kevin, der zum wiederholten Male einen Kruppanfall hatte, waren schuld. Schuld daran, dass wir statt des Fünf-Gänge-Menüs mit abgelaufenen Fischstäbchen Vorlieb nehmen mussten. Und schuld natürlich, dass die attraktivste Apfelsine, die Kassiererin Gret- chen von Rindt je begegnet war, nach der ersten gemeinsamen Nacht plötzlich aussah wie durch die Mangel gedreht.
Ich schämte mich zutiefst, doch wusste ich jetzt, dass der Mann, der mich ein wenig uncharmant aus dem Dornröschenschlaf geweckt hatte, nur um mich kurz darauf mit einem Fischstäbchen erneut flachzulegen, im wahren Leben als Kinderarzt tätig war. Was mich natürlich sehr überraschte, denn nicht im Traum hätte ich daran gedacht, dass Mediziner wie Doktor Georg Zimmerli (Georg Senior war Schweizer, daher der belämmerte Name) im Discounter einkaufen gehen. Doch damals kannte ich die sogenannte Gebührenordnung noch nicht und als ich sie wenig später kennenlernte, erinnerte ich mich so manches Mal wehmütig an meine schöne Zeit an Prengelmanns Kasse. Laut dieser Gebührenordnung stehen einem Kinderarzt nämlich pro Patient und Quartal gerade mal fünfzig Euro zu. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob dieser dreimal wöchentlich zur sogenannten Hafenrundfahrt, sprich Prostatamassage kommt, oder einmal im Vierteljahr zum Abhorchen.
Wenige Tage nach Georgs artistischer Infusions-Einlage brachte er mir bei, dass man auf kurzen Kinderliegen nicht nur Leben retten und Zäpfchen schieben, sondern auch eine Menge Freude haben kann. Der erste Sex mit meiner neuen Liebe war von einer Leidenschaft geprägt, die meinen männlichen Azubis schon deshalb fern lag, weil es sich mit halbem Arsch auf Kühlregal einfach nicht sehr lange vögeln lässt.
Eine Arztpraxis ist gegenüber einem grell beleuchteten Discounter geradezu romantisch. Lediglich das Gefühl, pausenlos von einem hässlichen Gummischwamm beäugt zu werden, den ein kleiner Spongebobfan für meinen Schatz gebastelt hatte und der genau über der Vielzweckliege von der Decke baumelte, verhinderte einen Orgasmus. Meinen jedenfalls!
Es dauerte kaum ein halbes Jahr, bis Marta, Georgs schwangere rechte Hand, sich in den Mutterschaftsurlaub verabschiedete. Was für meinen Mann anscheinend völlig überraschend kam, sich unter Martas Kittel jedoch bereits darstellte, als sei der Bulle von Tölz unter ihren Rock gekrochen.
„Ich glaube, Sie spinnen! Man kann doch heute auch JENSEITS der Vierzig noch Kinder kriegen. Muss dat denn ausjerechnet jetz sinn?“, schimpfte mein Schatz in holprigem Kölsch, als Marta ihm eröffnete, dass in Zukunft der Hechelkurs Priorität habe.
„Wehen veratmen lernt man eben nicht von heute auf morgen, Chef“, schien sie ihren Zustand beinahe entschuldigen zu wollen. „Sich auf ein Baby einzustellen braucht nun mal Zeit.“
Zugegeben, auch ich konnte damals nicht so recht verstehen, wieso eine Frau vom Fach, die sich seit mehr als fünfzehn Jahren hauptamtlich mit Kinderpüpsen, Stinki, Kotzi und unerklärlichen Bauchschmerzen beschäftigte, ÜBERHAUPT den Wunsch nach eigenem Nachwuchs verspürte. Was ich dagegen verstand war die Tatsache, dass mein Schatz alsbald mit nur noch einer einzigen Mitarbeiterin dastehen würde, und dass das ganze System zusammenbrechen würde, sollte Sabine einmal kränkeln.
ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS SUCHEN WIR ZUM SOFORTIGEN EINTRITT EINE DEUTSCHSPRACHIGE MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE MIT BERUFSERFAHRUNG.
FLEXIBILITÄT UND FREUDE AN DER ARBEIT MIT KINDERN WERDEN VORAUSGESETZT.
Als unser Stellenangebot am darauffolgenden Samstag im heimischen Tageblatt erschien, hatten wir nicht im Traum damit gerechnet, bereits am „laschDo“ in einer Badewanne voller Bewerbungen schwimmen zu können. Mehr als fünzig Damen und zwei nette Herren schienen nur darauf gewartet zu haben, Georgs geschrumpftes Team verstärken zu dürfen.
Das Studieren der Lebensläufe bereitete mir derart viel Freude, dass ich nach einer Nachtschicht in der Bewerbungswanne fast vergessen hätte, meine Frühschicht im Discounter anzutreten.
Dabei traten neben vielen Anderen Irina Kerzhakova, Galina Sychevkova, Romana Bystranova, Ariana Vinovic und Mikalska Roskovich gegeneinander an.
Nach der Begutachtung eines Großteils der Bewerbungen war ich allerdings nicht mehr sicher, ob die Damen tatsächlich in einer Arztpraxis arbeiten oder nach seiner siebten Scheidung achte Ehefrau von Loddar Matthäus werden wollten.
„Die taugen alle nix!“, teilte ich meinem Liebsten beim Abendessen in unserem neuen, etwas geräumigeren und vor allem GEMEINSAMEN Zuhause mit. Dabei ließ ich kein noch so kleines Detail aus. Dass Irina ein dreijähriges Kind und sicher keine zuverlässige Betreuung hatte. Dass Galina eine Allergie gegen Allergiespritzen hatte und Romana schon deshalb nicht für uns arbeiten konnte, weil ihr Vorname nach Tiefkühlpizza klang. „Ariana stammt aus dem Kosovo und hat sicher noch unter den Folgen des Krieges zu leiden und Mikalska hat ein beschissenes Zeugnis.“
Georg saß mir mit leicht geöffnetem Mund gegenüber und schüttelte ungläubig den Kopf.
„Gretchen, du bist absolut sicher, dass keine, WIRKLICH GAR KEINE der Bewerberinnen in Frage kommt?“
„Ganz sicher!“ schleuderte ich ihm patzig entgegen. Die Art und Weise seiner Nachfrage ließ den Schluss zu, dass er mir in Sachen Bewerbungscheck nicht über den Weg traute. Mit einem Hechtsprung über den Esstisch, der die Gurken das Glas kostete, konnte ich gerade noch verhindern, dass Georg sich selbst einen Einblick über die gestapelten Lebensläufe verschaffte.
Während also mein Schatz dabei war, sich seiner Gurkenwasserhose zu entledigen, raffte ich in Windeseile Irina und Co. zusammen, um sie so schnell als möglich in den Tiefen des ebenfalls neuen und gemeinsamen Kellers verschwinden zu lassen.
„Ich möchte doch nur, dass du dich neben der vielen Arbeit nicht auch noch DAMIT belasten musst“, säuselte ich Georg anschließend ins Ohr. Und weil er nun schon mal so nackig vor mir stand, verführte ich ihn inmitten einer Ladung herumliegender Prengelmann-Gurken. Von denen wurde mir nicht schlecht und zählen konnte ich sie auch.
Noch heute weiß ich nicht, ob etwas Verschweigen die gleiche Bedeutung hat wie Lügen, und so manches Mal in der Vergangenheit wünschte ich mir, ich hätte das erste Lagerfeuer der Saison damals nicht mit den Bewerbungsunterlagen, sondern mit herkömmlichem Grillanzünder gespeist. Mein schlechtes Gewissen sprach anfangs fast täglich zu mir, denn eines war sicher: Hätte Georg die Unterlagen in die Hände
bekommen, wären Sabine viele Überstunden erspart geblieben.
Wahrscheinlich hätte er sich gar nicht satt sehen können an Ariana, Galina und Mikalska. Denn, wenn er auch nur einen einzigen Blick auf die Fotos geworfen hätte, wäre die medizinische Vorbildung der Bewerberinnen sogleich zur Nebensache geworden. Eine hübscher als die andere, hätten sie mir zuerst den Mann, dann den Stolz und zuletzt den schweineteuren Ring geraubt, mit dem Georg mir hoffentlich bald die Ehe versprechen würde. Um all das zu verhindern, raubte ich ihnen die Hoffnung auf einen Job und gab Loddar Matthäus seine verdiente Chance.
„Wer soll denn jetzt die Gurken zählen?“, war der einzige Kommentar, den sich mein Chef im Hinblick auf die nächste Inventur erlaubte, während ich ihm eröffnete, meinen Liebsten künftig in der Praxis unterstützen zu wollen. Wir tauschten Schlüssel gegen Papiere und ich bedankte mich bei unseren beiden männlichen Azubis. Dafür, dass sie für mich die Fischstäbchen gezählt und vor allem dafür, dass sie mir hin und wieder den Feierabend versüßt hatten.
„Wir wünschen dir alles Liebe, Gretchen. Wir werden dich schrecklich vermissen“, säuselten die Jungs im Gleichklang und fast sah es aus, als würden die beiden ein paar Tränchen verdrücken. Vielleicht, weil ich ihnen gezeigt hatte, dass Sex mit entsprechend gymnastischer Vorbereitung auch auf der Käsetheke funktionieren kann. Vielleicht aber auch, weil wir einfach ein ziemlich gutes Team waren.
Bereits an meinem ersten Arbeitstag wurde mir klar, dass es unzählige Parallelen zwischen Prengelmann-Kasse und meinem neuen Job an der Anmeldung gab. Der einzige Unterschied schien mir der zu sein, dass die Kunden jetzt Patienten hießen.
Und natürlich, dass man bei Prengelmann tatsächlich JEDES MAL bezahlen musste.
Eine Kinderarztpraxis schneidet nämlich im direkten Vergleich mit dem Discounter ziemlich mies ab. Man muss sich das in etwa so vorstellen: Der Kunde geht in den Markt, lädt sich für fünzig Euro den Einkaufswagen voll, bezahlt und geht nach Hause. In den kommenden drei Monaten darf er nun so oft wiederkommen, wie er möchte, und er darf sich so viel in den Einkaufswagen stopfen, wie er will. Bezahlen muss er nämlich erst wieder, wenn ein Vierteljahr vergangen ist. Und auch dann wieder nur fünfzig Euro!
Super, oder?
So, oder jedenfalls so ähnlich, läuft die Sache bei den Ärzten.
Nun kommt es glücklicherweise nicht allzu oft vor, dass Mütter ihre Kinder zum Arzt schleppen, um eine Prostatamassage zu bestellen. Auch gibt es bei uns keine gelangweilten Rentner, die ihre Freizeit statt im Stehkaffee lieber im Wartezimmer ihres Hausarztes totschlagen.
Nein – unsere Patienten sind wirklich krank. Zumindest glauben die Muttis, die Kleinen seien krank. Oder die Papis. Oder die Omis. Oder die Opis. Oder die Tanten und Onkels. Oder, oder, oder. Und nicht selten drängen alle gleichzeitig in ein klitzekleines Behandlungszimmer, um zu sehen, wie der Doktor Hand anlegt.
Es mögen drei, vielleicht vier Wochen vergangen sein, als ich zum ersten Mal zutiefst bereute, Irina und ihren Freundinnen keine Chance gegeben zu haben. Sabine hatte ihren freien Tag und ich keine freie Minute. Das Telefon klingelte ohne Unterbrechung, das Wartezimmer platzte aus allen Nähten und ich machte Bekanntschaft mit Romanov, dem Russenkind.
„Meine Kind hat digges Schwällung an Hodden- sack, aber Pännis immer noch klein sein.“ Die Lautstärke, mit der Papa Ivo vom Zustand seines Sohnes berichtete, führte dazu, dass sich die Eltern aus dem Wartezimmer nacheinander aus der Türe beugten, um einmal leibhaftig ein Russenkind mit dicken Eiern zu sehen. Und nachdem auch die letzte rot eingefärbte Mutti ihr Köpfchen zurückgezogen hatte, fügte Romanov-Senior flüsternd hinzu: „Wär ja alles niieecht so
schlimm, aber tut dem Kind jucken wie Schweinchen.“
Der Siebenjährige nickte zustimmend. Dabei versuchte er mit der linken Hand Ordnung in seine kneifende Hose zu bringen und reichte mir gleichzeitig die rechte zum Gruße.
In einer Art Übersprungshandlung zupfte ich mir den Kragen meiner Bluse zurecht, um dem russischen Handschlag zu entgehen. Nicht etwa, weil Romanov zuvor mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die rechte zum Eiersuchen benutzt hatte, sondern weil ich von Sabine wusste, dass der Fünfundvierzigkilobrocken beim Handschlag gerne mal die Knochen von Medizinischen Fachangestellten knacken ließ.
Um den Zweitklässler nicht der kichernden Meute im Wartezimmer zum Fraß vorzuwerfen, entschied ich mich, ihn sofort in eines der beiden Behandlungszimmer zu setzen. Die Entscheidung erwies sich allerdings schnell als falsch, denn die wartenden Mütter fielen über mich her, als hätte ich ihren Lieblingen jedes Haar einzeln herausgerissen. Mit Bemerkungen wie:
„Wir waren doch zuerst da!“ oder „Haben wir Deutschen eigentlich überhaupt keine Rechte mehr?“ taten sie ihre Empörung derart überzeugend kund, dass ich einen Moment lang glaubte, sie seien wirklich in großer Eile. In Wahrheit hätten sie die russischen Riesen-Eier wohl zu gerne noch einmal aus der Nähe gesehen …
„Verdammt, wo steckt denn nun wieder die Zeckenzange?“, fluchte der Doktor, nachdem er Romanovs Giganto-Hoden inspiziert hatte. Grinsend fegte er von Zimmer zu Zimmer und hielt Ausschau nach dem Werkzeug, das den kleinen Russen von seinem Leid befreien sollte. Mit einem Zwinkern deutete er an, dass er bei der Entfernung des Ungeziefers meine Hilfe benötigte, da Romanov, nachdem er die vollgesaugte Riesenzecke an seinem Hoden entdeckte hatte, nicht mehr zu bändigen war. Vom Ekel gepeinigt, sprang er quasi über Tische und Bänke, schlug nach seinem verzweifelten Vater und schien der festen Überzeugung, vom Teufel besessen zu sein.
Kurz davor, sich übergeben zu müssen, flüchtete Papa Ivo ins Wartezimmer und überließ den Nachwuchs seinem Schicksal.
Ob es denn in Russland keine Zecken gebe,
fragte Georg den Zweitklässler, darauf hoffend, dass dieser sich wenigstens ein kleines bisschen ablenken ließe. Leider hatte Romanov keine Lust auf Frage-Antwort-Spielchen. Als mein Schatz nun die Zeckenzange in Stellung gebracht hatte, zuckte der Kleine mit einem derartigen Ruck zurück, dass der Doktor ihn um Haaresbreite nicht nur vom Schmarotzer, sondern gleich vom ganzen Hoden befreit hätte. Und während Romanov sich schluchzend in meinen Haaren verfangen hatte, hüpfte der Blutsauger von der Größe eines Minigolfballes fröhlich durch die Praxis, als wolle er sich im Wartezimmer sein nächstes Opfer suchen. Glücklicherweise konnte ihm Georg gerade noch den Weg versperren, bevor er eines Tages das Maß von Woody Allens legendärer Killertitte angenommen und eine ganze Nation in Angst und Schrecken versetzt hätte.
Viel weniger Probleme gibt es mit unseren türkischen Patienten. Wo immer ihr Leid auch herrühren mag, wo immer es auch zwickt und zwackt: Türkische Väter und türkische Mütter
legen größten Wert darauf, dass türkische Kinder ausreichend mit Antibiotika versorgt werden. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob Ibrahim hustet, Mohammed Durchfall oder Ayse den Fuß gebrochen hat.
„WENN DU IHM GÄBBEN HEUTE ANTIBIOTT, MORGEN ALLES SEIEN GUDD", wissen große Türken stets, was kleine Türken brauchen.
Auch Gökhan Yilmaz bestellte die Wundermedizin, als er eines Tages mit Klein Mustafa an unserer Anmeldung stand. Sabine erklärte ihm in ihrer stets höflichen Art, dass der Doktor zunächst einen Blick auf seinen Sohn werfen müsse, und beäugte dabei skeptisch das blasse Kind, das wie ein nasser Sack über Papas Schulter hing.
„Was hat er denn für Beschwerden?“, wollte ich von Papa Yilmaz wissen, doch als dieser sich zu mir umdrehte, hatte sich die Antwort erübrigt.
Mustafa hatte zahllose Schrammen an Armen und Beinen, der kleine Finger seiner linken Hand schien am seidenen Faden zu hängen und er klagte über starke Schmerzen an der Kniescheibe.
„Musti in Kinderrgarrten von Kletterrgerrüst gefallen. Immer sagen Aua. Er brauchen großes Flasche Antibiott, dann morgen alles seien gudd.“
Unsere Versuche, ihn davon zu überzeugen, dass es besser sei, den Dreijährigen in der Chirurgie der nahe gelegenen Kinderklinik vorzustellen, scheiterten, so dass ich Georg, was ich selten tat, bitten musste, die Behandlung von Asthma-Anna zu unterbrechen, um sich den starrsinnigen Papa Yilmaz vorzuknöpfen.





























