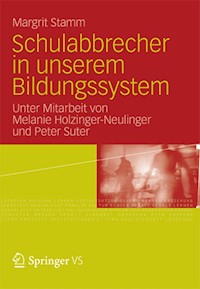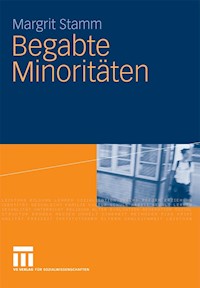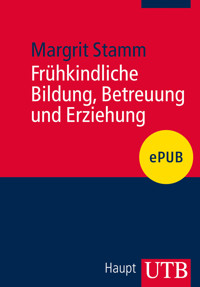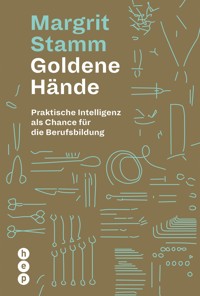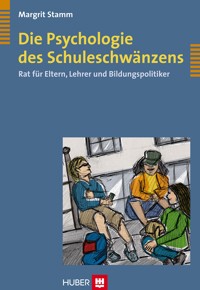
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum gehen Kinder und Jugendliche manchmal einfach nicht in die Schule? Wie viele Schuleschwänzer sind das überhaupt? Welche Merkmale zeichnen Sie aus? Und vor allem: Was kann man dagegen tun? Auf der Grundlage eines groß angelegten Forschungsprojektes beantwortet die Professorin Margrit Stamm diese wichtigen Fragen: Sie zeigt, dass sich hinter schulabsentem Verhalten komplexe Fragen verbergen und Schuleschwänzen nicht nur eine, sondern viele verschiedene Ursachen hat, die eng miteinander verschränkt sind. Kinder und Jugendliche, die die Schule schwänzen, sind in den seltensten Fällen ausschließlich allein für ihr Tun verantwortlich. Vielmehr kann auch die Schule erheblich dazu beitragen, das Schuleschwänzen noch weiter zu fördern oder aber es in den Griff zu bekommen. Dies ist besonders wichtig vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es eine beachtliche Gruppe massiver Schuleschwänzer gibt, die zwar zu den risikogefährdeten, nicht jedoch immer nur zu den leistungsschwachen Jugendlichen gehören. Auch Hochbegabte können massive Schwänzer sein! Um mit Schuleschwänzern wirksam umgehen zu können, müssen Lehrkräfte, Eltern und Behörden nicht nur Kenntnisse, sondern auch fundierte Handlungsstrategien zur Verfügung haben. Deshalb richtet die Autorin den Blick auf die Strategien, wie das Absentismusproblem präventiv und interventiv angegangen werden kann. Das Buch gibt einen für den deutschen Sprachraum einzigartigen Gesamtüberblick über die aktuelle Forschungslandschaft, und scheut sich nicht, bildungspolitische Argumente vorzutragen, die in unserer Gesellschaft bisher kaum diskutiert wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Margrit Stamm
Aus dem Programm Verlag Hans Huber
Die Psychologie des
Psychologie Sachbuch
Schuleschwänzens
Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Dieter Frey, München
Prof. Dr. Kurt Pawlik, Hamburg
Prof. Dr. Meinrad Perrez, Freiburg (CH)
Prof. Dr. Franz Petermann, Bremen
Prof. Dr. Hans Spada, Freiburg i. Br.
Im Verlag Hans Huber sind außerdem erschienen – eine Auswahl:
Françoise D. Alsaker
Quälgeister und ihre Opfer
Mobbing unter Kindern – und wie man damit umgeht
323 Seiten (ISBN 978-3-456-83920-2)
Jürg Frick
Die Kraft der Ermutigung
Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe
374 Seiten (ISBN 978-3-456-84349-0)
Gustav Keller
Disziplinmanagement in der Schulklasse
Unterrichtsstörungen vorbeugen – Unterrichtsstörungen bewältigen
128 Seiten (ISBN 978-3-456-84583-8)
Gustav Keller
Ich will nicht lernen!
Motivationsförderung in Elternhaus und Schule
141 Seiten (ISBN 978-3-456-84511-1)
Monika Löhle
Wie Kinder ticken
Vom Verstehen zum Erziehen
332 Seiten (ISBN 978-3-456-84496-1)
Dan Olweus
Gewalt in der Schule
Was Lehrer und Eltern wissen sollten – und tun können
128 Seiten (ISBN 978-3-456-84390-2)
Ulrike Stedtnitz
Mythos Begabung
Vom Potenzial zum Erfolg
Mit einem Vorwort von Prof. Lutz Jäncke
211 Seiten (ISBN 978-3-456-84445-9)
Informationen über unsere Neuerscheinungen finden Sie im Internet unter: www.verlag-hanshuber.com
Margrit Stamm
Die Psychologie des Schuleschwänzens
Rat für Eltern, Lehrer und Bildungspolitiker
Verlag Hans Huber
Prof. Dr. Margrit Stamm
Ordinaria für Erziehungs-
wissenschaft
Universität Freiburg
Rue de Faucigny 2
CH-1700 Fribourg
Lektorat: Monika Eginger, Susann Seinig
Umschlag: Atelier Mühlberg, Basel
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Verlag Hans Huber
Hogrefe AG
Länggass-Strasse 76
CH-3000 Bern 9
Tel: 0041 (0)31 300 45 00
Fax: 0041 (0)31 300 45 93
© 2008 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
EPUB-ISBN: 978-3-456-74609-8
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Schuleschwänzen: seine Erklärung und seine Folgen
2. Ausmaß von und Gründe für das Schuleschwänzen
3. Formen von Schulabsentismus
4. Ursachen von Schulabsentismus
5. Schulen, Lehrkräfte und Schuleschwänzer
6. Die Perspektive des Schuleschwänzers und die Rolle der Familie
7. Schuleschwänzen und abweichendes Verhalten
8. Prävention und Intervention
Literatur
Schuleschwänzer Quiz
Auflösung
Zusammenfassung und Ausblick
Personenregister
Sachregister
Vorwort
Dieses Buch ist dem unerlaubten Fernbleiben von der Schule gewidmet. Der Volksmund nennt dieses Phänomen «Schuleschwänzen», die Fachwelt bezeichnet es als «Schulabsentismus». Zwar ist Schulabsentismus ein pädagogisches Unwort, aber es ist nicht sachlich grob oder unangemessen. Schulabsentismus umfasst weit mehr als nur das traditionelle Schuleschwänzen, nämlich all die vielfältigen Formen unerlaubten Fernbleibens von der Schule. Dazu gehören die Schulverweigerung, das Zurückhalten des Kindes durch die Eltern, das Schwänzen einzelner Lektionen oder das Fehlen mehrerer Tage oder Wochen inklusive dessen gelegentliche Legitimation durch ein Arztzeugnis. Den Schuleschwänzern nehmen sich neuerdings insbesondere die Medien mit teils reißerischen Titeln an. Sie behaupten, dass die Zahl der Schuleschwänzer riesig sei, viele von ihnen in die Kriminalität abdriften würden und Schulabsentismus damit ein direkter Weg ins Abseits sei. Auch viele Publikationen zeichnen ein äußerst düsteres Bild der schwänzenden Kinder und Jugendlichen. Vom zukünftigen Leben in Randständigkeit und sozialer Abhängigkeit ist die Rede, von ihrem äußerst schwierigen Übergang von der Schule in die Berufswelt, von Desintegration und insbesondere auch von ihrem Hang zur Delinquenz. Solchen Behauptungen gelingt es zwar, das öffentliche Bewusstsein für diese bislang wenig beachtete Problematik zu schärfen und auch das Tabu zu brechen, indem Schuleschwänzen nicht mehr verschwiegen wird. Aber solche Behauptungen übermitteln damit der Gesellschaft die verdeckte Botschaft, als seien alle Schuleschwänzer Problemfälle, und eine kriminelle Laufbahn sei vorprogrammiert. Das Schuleschwänzen wird damit zu Unrecht zu einem skandalisierten und kriminalisierten Verhalten einer ganzen Generation emporstilisiert. Gleichzeitig entsteht dadurch der Eindruck, als ob die Zahl der Schuleschwänzer in den letzten Jahren massiv gestiegen sei. Das wissen wir jedoch nicht. Denn dazu liegen keine repräsentativen empirischen Daten vor, welche diesen Sachverhalt bestärken könnten. Gleiches gilt für Präventions- und Interventions-programme. Wir wissen wenig darüber, welche Programme eingesetzt werden und wie erfolgreich sie sind.
Richtig ist, dass das Schuleschwänzen ein falsch eingeschätztes Problem darstellt. Weder in den Schulen noch in den Bildungsverwaltungen wird es als Problem wahrgenommen oder offen diskutiert, und auch Eltern scheinen es über weite Strecken als legitimes Verhalten zu akzeptieren – und wie wir noch sehen werden, manchmal sogar zu unterstützen. Die am häufigsten gehörte Antwort von Schulen auf unsere Frage nach ihrem Umgang mit Schuleschwänzern ist etwa die: «Bei uns ist Schuleschwänzen kein Problem. Wir haben ein klares System und eine gute Schulordnung, die Schwänzen verhindern. Vor Jahren hatten wir einmal einen Schüler, aber das war ein ganz gravierender Fall.» Schuleschwänzen wird somit großenteils als geringfügige Störung des täglichen Schulbetriebs angesehen und nach außen hin tabuisiert. Viele Schulen verstecken sich oft hinter der formalen Schulordnung und hinter der Funktionalität ihrer Institution. Vielleicht ist das Nicht-Hinschauen aber auch eine Möglichkeit, um den Glauben aufrecht zu erhalten, dass es an der eigenen Schule keinen Absentismus gibt und sich deshalb jede präventive oder interventive Aktivität erübrigt.
Tatsache ist, dass Schüler die Schulpräsenz bei weitem nicht so ernst nehmen, wie wir uns dies wünschen würden. Schuleschwänzer führen uns deshalb auf ein Thema, das aus einem anderen Blickwinkel Fragen der Schulqualität aufwirft: Schuleschwänzer ernst nehmen, heißt Schule und Schulpflicht ernst nehmen. Die Schulpflicht wurde für das Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft eingeführt. Deshalb muss der Stellenwert der Schule dem einzelnen Schüler auf spezifische Weise ersichtlich gemacht werden. Schulpflicht ernst nehmen heißt aber auch, den sozialen Rechtsstaat ernst nehmen. Eltern, welche das Schwänzen ihrer Kinder tolerieren, und Schüler, welche gegen die Präsenzpflicht verstoßen, verletzen damit eine verbindliche, gesellschaftliche Erwartung. Vor allem diejenigen Kreise, welche den ordnungspolitischen Aspekt betonen, weisen zu Recht immer wieder auf die steigenden sozialen Kosten hin, welche mit Schulversagen und damit auch mit fehlender Schulpräsenz verbunden sind. In diesem Sinne haben Schüler eine Leistungspflicht gegenüber dem Staat. Andererseits hat genau dieser Staat allen Kindern und Jugendlichen zu garantieren, dass er ihnen ausreichende Bildung anbietet.
Das vorliegende Buch versucht, traditionelle Sichtweisen zur Pädagogik und Psychologie des Schuleschwänzens zu korrigieren und die Thematik differenzierter anzugehen, als dies bis anhin in der Medien-Öffentlichkeit getan worden ist. Es beleuchtet Schuleschwänzen sowohl als pädagogische als auch als ordnungspolitisch zu lösende Aufgabe. In seinem Mittelpunkt stehen die nachfolgenden Fragen. Sie sind bislang von der Forschung weitgehend unbeantwortet geblieben. Aber sie sind besonders bedeutsam, wenn man sich praktisch mit der Thematik auseinandersetzen will:
• Wie kommt es, dass Kinder und Jugendliche trotz Schulpflicht die Schule nicht regelmäßig besuchen?
• Wie viele Schuleschwänzer gibt es überhaupt?
• Welche Merkmale kennzeichnen sie?
• Aus welchen Gründen bleiben sie der Schule fern?
• Und vor allem: Was kann man dagegen tun?
Beantwortet werden diese Fragen auf der Basis unserer Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir im Rahmen des Forschungsprojektes «Schulabsentismus in der Schweiz – ein Phänomen und seine Folgen» gewonnen haben. Das vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Projekt ist unter meiner Leitung am Departement für Erziehungswissenschaften der Universität Fribourg/Schweiz zwischen 2005 und 2007 durchgeführt worden. Mit beteiligt war mein Kollege Prof. Marcel Alexander Niggli, Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Rechtsphilosophie, Kriminologie und Rechtssoziologie an unserer Universität. Das Besondere an unserer Studie ist, dass wir nicht nur die Schüler selbst zu ihren Schwänzgewohnheiten befragt, sondern auch die Lehrkräfte und die Schulleitungen in die Befragung einbezogen haben. Wir verfügen somit über einen umfassenden Kenntnisstand darüber, wie, warum und wozu geschwänzt wird, wie es gehandhabt, kontrolliert und sanktioniert wird und wie es präventiv angegangen wird. In positiver Wendung liefert das Buch somit einen zeitgenössischen Beitrag zur Frage der Schulpräsenz. Aus dieser Perspektive ist es auch geschrieben worden. Sein Zweck ist ein dreifacher:
• Erstens soll es die wichtigsten Ergebnisse aus unserem Forschungsprojekt bündeln. Damit trägt es dazu bei, unser Wissen über das Schuleschwänzen zu erweitern und auch zu objektivieren. Das Buch zeigt auf, dass sich hinter schulabsentem Verhalten komplexe Fragen verstecken und Schuleschwänzen nicht nur eine, sondern sehr viele verschiedene Ursachen hat, die alle miteinander verschränkt sind. Wenn es gelingen soll, die Schulpräsenz zu stärken und Schuleschwänzer wieder zum regelmäßigen Schulbesuch anzuleiten, dann sind Schulen und Lehrkräfte genötigt, solche Ursachen zu verstehen.
• Zweitens geht es um die Erkenntnis, dass Kinder und Jugendliche, welche die Schule schwänzen, in den seltensten Fällen ausschließlich die erbärmlichen Opfer der Umstände sind. Ich möchte aufzeigen, dass die Schlüsse, die wir aus der Forschung ziehen können, in die entgegengesetzte Richtung gehen: Schuleschwänzen ist kaum das Ergebnis eines persönlichen Defizits der Kinder und Jugendlichen. Auch ist es nicht ausschließlich die Schule, welche für das Schuleschwänzen verantwortlich zu machen ist. Schüler müssen eher als rational denkende Individuen betrachtet werden: Sie bewerten die schulische Situation und fällen dann die Entscheidung für oder gegen die Schulpräsenz. In dieser Hinsicht unterschätzen wir die Fähigkeit heutiger junger Menschen, die Organisation der Schule zu verstehen, sie zu kalkulieren und so zu managen, dass ihr Schwänzverhalten gar nicht entdeckt wird. Viele von ihnen sind dazu fähig, die Risiken zu kalkulieren, die mit der Schulabsenz verbunden sind: Sie wissen, dass sie nichts lernen, wenn sie nicht in der Schule sind und dadurch auch schlechte Noten in Kauf nehmen müssen. Sie wissen aber auch genau, wann sie präsent sein und wie viel sie lernen müssen, dass die Leistungen genügend sind. Vielen jedoch gelingt diese Strategie nicht, und sie geraten in eine Versagensspirale, aus der sie sich ohne Unterstützung nicht befreien können.
• Drittens will ich in diesem Buch darlegen, welche unterschiedlichen Absentismusprofile unsere Gesellschaft produziert. Nicht alle sind dabei gravierender Art und nicht alle führen über einen direkten Weg ins Abseits. Das Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher, gelegentlich die Schule zu schwänzen, kann als Aufbegehren gegenüber der Welt der Erwachsenen verstanden werden. Dies ist ein Kennzeichen des Jugendalters. Jugendliche brauchen Möglichkeiten, sich gegenüber Autoritäten aufzulehnen, das Gesetz einmal übertreten zu können oder sich riskant zu verhalten. In diesem Sinne ist gelegentliches Schuleschwänzen ein jugendtypisches Phänomen, das auch einen identitätssteigernden Einzel- oder Gruppeneffekt hat. Aber aus gelegentlichem kann sich leicht massives Schuleschwänzen entwickeln und zu großen Anschlussproblemen führen. Die massiven Schuleschwänzer sind eine Gruppe Jugendlicher, welche dem eingangs gezeichneten düsteren Bild entsprechen, weil sie auf mögliche Langzeitprobleme von Schulabsentismus verweisen. Diese Jugendlichen gehören unzweifelhaft zu den risikogefährdeten Schülern, weil sie ihr Schuleschwänzen nicht mehr so kontrollieren können, wie dies gelegentliche Schuleschwänzer tun. In unserer globalisierten Wissensgesellschaft ist lang andauernder und massiver Schulabsentismus besonders gravierend. Wir müssen davon ausgehen, dass er nicht nur mit schlechten Schulleistungen einhergeht, sondern auch zu erschwerten Übergängen in die berufliche Ausbildung führt. Massives Schuleschwänzen gilt deshalb als Risikomarker für spätere Fehlentwicklungen. Daneben gibt es jedoch andere Absentismusformen, die keine solchen Bezüge aufweisen.
• Um mit Schuleschwänzern wirksam umgehen zu können, müssen Lehrkräfte, Eltern und Behörden nicht nur Kenntnisse, sondern auch Handlungsstrategien zur Verfügung haben. Deshalb versuche ich viertens, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass präventiven und interventiven Maßnahmen eine große Bedeutung zukommt. Entsprechend richte ich den Blick auf das, was die Wissenschaft fast immer vernachlässigt: auf die Umsetzung des theoretischen und empirischen Wissens in die pädagogische Praxis und damit auf den Umgang mit schulabsenten Kindern und Jugendlichen. Deshalb stelle ich das notwendige Maß an Wissen zusammen und stelle Strategien vor, wie die Schulen das Absentismusproblem präventiv und interventiv angehen können. Meine Hauptbotschaft ist die, dass Schulen die Frage von Schulpräsenz und Schulabsenz weit stärker als bis anhin als Entwicklungsproblematik verstehen sollten, auch wenn der Schulalltag den Blick auf solche Sachverhalte nicht automatisch preis gibt. Schulleitung und Lehrerschaft sollten die Notwendigkeit einer frühen, klaren und transparenten Intervention erkennen und eine aufklärerische, präventive Haltung einnehmen. Prävention ist deshalb in erster Linie eine Angelegenheit der Schule, die jedoch der Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, externer Unterstützungssysteme und der Schulbehörden bedarf.
Schulen können Absentismus nicht eliminieren, aber reduzieren. Gleiches gilt für die immer wieder formulierte Behauptung, Schulen seien für «Schulaversion» oder «Schulmüdigkeit» verantwortlich. Es kann lediglich darum gehen, dass Schulen derartige Einstellungsmuster abfedern und ausgleichen, nicht jedoch vermeiden können. Sicher ist, dass die Schule in allen Menschen tiefe Spuren hinterlässt. Sie ist aber nicht immer für alle Spuren verantwortlich. Jeder Mensch baut auf Grund seiner schulischen Erfahrungen negative oder positive Leistungsbilder oder Erfolgsmuster auf. Der Aufbau positiver Leistungsmuster geht häufig mit der Entwicklung positiver Leistungsmotivation, Hilfs- und Handlungsbereitschaft einher. Negative Leistungsbilder sind jedoch häufig mit der Entwicklung von Schulmüdigkeit und Schuldistanz verknüpft. Solche Muster sind dem Schulerfolg abträglich und begünstigen schulabsente Verhaltensformen. Besonders bedeutsam sind sie bei Jugendlichen mit schlechten Schulleistungen.
Insgesamt wäre es jedoch eine falsche Konklusion, aus dem bisher Gesagten die Forderung abzuleiten, die Schulen hätten ihre schulpädagogische gegen eine sozialpädagogische Kompetenz einzutauschen und ihr Kerngeschäft zu relativieren. Die schulischen Leistungsansprüche dürfen keinesfalls hinterfragt werden. Im Zentrum sollte vielmehr die Schaffung von Bedingungen stehen, welche allen Schülern, auch den Risikogruppen, anspruchsvolle Schulleistungen ermöglicht und die Jugendlichen an die Schule bindet. Ein wesentliches Qualitätskriterium der Schule ist deshalb ihre Fähigkeit, eine Haltekraft für alle Schüler zu entwickeln. Dazu gibt es eine große Bandbreite an Lösungen. Das Herzstück aller schulischen Präventions- und Interventionsbemühungen sollte jedoch sein, Schüler von der Bedeutung der Schulpräsenz für ihren Schulerfolg zu überzeugen. Solche Bekräftigungen bleiben jedoch so lange hohle Worte, wie Unterricht und Schulorganisation nicht so aufgebaut sind, dass sie sinnvolles und adressatenspezifisches Lernen ermöglichen, unterstützen und herausfordern. Aus diesem Blickwinkel zwingt uns die Problematik des Schulabsentismus daran zu zweifeln, dass Schule in ausreichendem Ausmaß das Zentrale vermittelt – das, was relevant ist für die Zukunft und den Jugendlichen den Weg in Gesellschaft und Arbeitswelt eröffnet.
Dieses Buch lege ich in der Hoffnung vor, es möge einen Beitrag zu einer breiten Diskussion der Pädagogik und Psychologie des Schuleschwänzens in Bildungspolitik, Schule und Gesellschaft liefern. Es soll Einsichten in seine Hintergründe ermöglichen, Konsequenzen und Lösungen aufzeigen und so das Verständnis fördern, ihm wirksam begegnen zu können. Aus diesem Grund hat das Buch eine praxisorientierte und keine wissenschaftliche Ausrichtung. Entsprechend zitiere ich nur diejenige Literatur, die ich für die Leserschaft als empfehlenswert und aus wissenschaftlicher Sicht als grundlegend einstufe. Gleiches gilt für die Ergebnisse unserer Studie. Ich stelle lediglich diejenigen Resultate dar, welche für die hier aufgeworfenen Fragen bedeutsam sind. Leserinnen und Leser, die detaillierte Literaturangaben und Forschungsergebnisse sichten möchten, werden auf meiner Website fündig: perso.unifr.ch/margrit.stamm/.
Schließlich möchte ich mit diesem Buch auch ein Dankeschön verbinden. Zunächst danke ich den vielen unbekannten Personen, welche am Projekt teilgenommen haben – Lehrkräften, Schulleitungen und vor allem den 4000 Schülern. Sie waren es, welche uns bereitwillig schriftlich und mündlich Auskunft gegeben haben und so das zentrale Fundament unseres Wissens überhaupt darstellen. Herzlich danken möchte ich aber auch meinen Forschungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Es sind dies: Christina Gnos, Matthias Felix, Michael Niederhauser, Angela-Livia Nydegger, Jordi Pürro, Christine Ruckdäschel, Karin Schmid, Franziska Templer und Martin Viehhauser. Der Dank geht schließlich auch an die vielen interessierten Fachleute und Laien, welche mir im Rahmen meiner Referate und schriftlichen Arbeiten immer wieder Rückmeldungen gegeben und mich so zur vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik angeleitet haben.
Für die Fertigstellung des Buches schulde ich auch persönlich vielen Menschen Dank. An erster Stelle möchte ich Frau Monika Eginger und Frau Susann Seinig vom Verlag Hans Huber danken, die sich mit großer Sorgfalt dem Manuskript gewidmet hat. Der Qualität verpflichtet waren mit ihrem Gegenlesen auch Jordi Pürro und Matthias Felix. Der größte Dank geht jedoch an meine Familie, meinen Partner Walter Stamm und an unsere beiden Kinder Sibylle und Ralph. Sie haben mir nicht nur den Rücken frei gehalten, damit ich mich dieser Thematik widmen konnte, sondern mir durch unsere Erfahrungen während der vielen Jahre gemeinsam erlebter Schul- und Ausbildungszeit und der damit verbundenen Präsenzprobleme immer wieder geholfen, die Fragen um die wissenschaftliche Perspektive an die gelebte Praxis anzubinden.
Einleitung
Alle deutschsprachigen Staaten gehörten bis vor wenigen Jahren nicht zur Avantgarde der Länder, die den Schuleschwänzern Beachtung schenkten. Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich trifft dies auch heute noch für die Schweiz zu. Anders ist die Sachlage in Wirtschaft und Industrie. Dort wird Absentismus, das Fehlen am Arbeitsplatz, als weit verbreitetes Phänomen unserer Gesellschaft anerkannt. Es hat erhebliche Auswirkungen auf die Produktivität des Unternehmens, auf die Arbeitszuweisung und auf die Mitarbeiterführung. Versicherergruppen stellen heute den Unternehmen bereits Ärzte- und Expertenteams zur Verfügung, damit sie Maßnahmen ausarbeiten können, die zur Verbesserung der Mitarbeiterpräsenz führen. Problematisch ist dabei, dass fast alle Präventions- und Interventionskataloge einer theoretischen Basis entbehren. Es ist kaum grundlagenorientiertes Wissen verfügbar, das den Namen «Absentismusforschung» rechtfertigen könnte. Deshalb befindet sich die Absentismusthematik aktuell lediglich in einem Spannungsfeld innerhalb der Praxis, kaum jedoch zwischen Praxis und Wissenschaft.
Ganz ausgeprägt gilt diese Feststellung für das Phänomen des Schul-absentismus. Pädagogisch-psychologisch ist die Thematik wenig erforscht. Auch international besteht ein großer Mangel an Erkenntnissen. Ganz besonders gefehlt hat bislang eine intensive Bearbeitung der Thematik durch andere Disziplinen, wie etwa das Schul- oder Strafrecht oder die Kriminologie. Weil auch repräsentative Daten fehlen, haben wir bisher kaum etwas darüber gewusst, wie viele Schuleschwänzer es tatsächlich gibt, wer sie sind, aus welchen Motiven sie der Schule fern bleiben, welche Rolle die Schule dabei spielt und ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Intensität schulabsenten Verhaltens und Delinquenz gibt.
Unser Verhältnis zum Schuleschwänzen
Zum Schuleschwänzen haben wir ein gespaltenes Verhältnis. Mit Blick auf die persönliche Schulkarriere herrscht in unserer Gesellschaft die Meinung vor, dass doch fast jeder Schüler während der Schullaufbahn die Schule geschwänzt habe und jedoch trotzdem aus den allermeisten etwas geworden sei (Whitney, 1994). Schuleschwänzen gehöre ganz einfach zum guten Ton, zum notwendigen Repertoire eines emanzipierten Schülers. Unerlaubtes Fernbleiben von der Schule sei nichts anderes als eine Lust am verdeckten Revoltieren. Notorische Schuleschwänzer gäbe es zudem überall. Damit müsse sich die Schule abfinden. Denn da helfe auch das beste Schulgesetz oder Absenzensystem nichts. Diese Auffassung ist zwar verständlich, trotzdem jedoch stark verkürzter Natur. Bei leistungsstabilen Schülern kann Schuleschwänzen zwar sehr wohl lediglich ein Kavaliersdelikt sein. Dies trifft dann zu, wenn sie zwar hin und wieder ‹blau› machen, das damit verbundene Risiko jedoch zu kalkulieren wissen und ihren Schulerfolg dadurch nicht gefährden. Begünstigen die schulischen und familiären Bedingungen und der Umgang mit Gleichaltrigen jedoch den Absentismus, dann kann sich ein gelegentliches zu einem massiven Schwänzen weiterentwickeln. Damit bekommt das bislang tolerierte und wenig beachtete Fehlen plötzlich einen Bezug zum Dramatischen oder gar zur Delinquenz. Dies gilt insbesondere dann, wenn massive Schuleschwänzer mit der Schule nicht zurechtkommen, sich zunehmend von ihr zurückziehen und in eine Karriere des Scheiterns hineinzurutschen drohen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es vielfältige Formen von schulabsenten Verhaltensweisen gibt. Schuleschwänzer sind verschieden, den Schuleschwänzer gibt es nicht. Schuleschwänzen bricht auch nicht über Nacht aus. Häufig hat es eine lange Vor- und Nachgeschichte. Es kann ein Haupt- oder Folgeproblem oder auch eine Begleiterscheinung von mehr oder minder schwierigen außerschulischen Belastungen sein. Eine isolierte Ursache, die wie ein Blitz aus heiterem Himmel einschlägt, gibt es selten.
Das Schuleschwänzen wird unterschätzt
Die oben genannten Fragen – mit wie vielen Schuleschwänzern wir etwa rechnen müssen, wer sie sind, warum sie die Schule meiden, welche Rolle die Schule dabei spielt und ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Schuleschwänzen und Delinquenz gibt – können wir auf der Basis unseres Forschungsprojekts beantworten. Den Begriff Schulabsentismus verwenden wir in unserem Projekt als Oberbegriff für das Fernbleiben vom Unterricht aus einem gesetzlich nicht vorgesehenen Grund, unabhängig davon, ob die Eltern informiert sind und dies durch Entschuldigungen legitimieren.
Unsere Ergebnisse belegen eindeutig: Hinter dem Schuleschwänzen ist mehr als ein kleines Übel versteckt. Diese Auffassung wird aber von vielen Bildungsdepartementen, Schulen und Lehrkräften nicht geteilt. Entsprechend häufig behandeln sie das Phänomen lediglich als Bagatelle. Viele gehen davon aus, dass es in der Schweiz deshalb kaum Schuleschwänzer geben kann, weil man die Angelegenheit mit den in vielen Kantonen gesetzlich festgelegten Tagen, so genannten Joker-Tagen (gemeint ist damit eine bestimmte Anzahl schulfreier Tage, die außerhalb der üblichen Absenzenregelung eingezogen werden können), im Griff habe. Wie wirksam solche Joker-Tage jedoch sind, und ob sie Schuleschwänzen tatsächlich – wie dies von den Bildungsdepartementen erwartet wird – verhindern können, ist fraglich. In unserem Forschungsprojekt haben wir eher den Eindruck gewonnen, das Konzept der Joker-Tage käme einem problementschärfenden Etikettenschwindel gleich, das den Schulabsentismus als ‹bearbeitet› schubladisieren lässt. Zwar scheint die Thematik nicht offen diskutiert zu werden, trotzdem gibt es ein verdecktes, aber doch reges Interesse. Dafür sprechen zwei Aspekte: Erstens haben in den letzten Jahren einige bildungspolitische Ereignisse mediales Interesse gefunden, die mit Problemen des Schuleschwänzens verflochten waren. Dazu gehören neben dem Bundesgerichtsentscheid zum Schulausschluss im Kanton Bern (unter anderem auch aufgrund unerlaubter Schulversäumnisse) parlamentarische Vorstöße zum Schuleschwänzen in den Kantonen Basel-Stadt, Luzern und St. Gallen. Zweitens waren die Reaktionen auf die Medienmitteilung des Schweizerischen Nationalfonds vom 29. November 2006 zu den ersten Ergebnissen unserer Studie enorm. Unter dem Titel «Das Schuleschwänzen wird unterschätzt» wurde aufgezeigt, dass Schuleschwänzen auch in der Schweiz ein weit verbreitetes Verhalten vieler Schüler ist. Nahezu alle Tageszeitungen sowohl in der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz als auch im rätoromanischen Sprachraum berichteten davon. Bis auf wenige Ausnahmen waren die Medienberichterstattungen jedoch reißerischer Art. Verschiedentlich wurde beispielsweise generalisierend festgestellt: «Wer die Schule schwänzt, wird eher kriminell.» (heute, 29.11.2006). Die Neue Zürcher Zeitung berichtete gar, dass es insbesondere die Rahmenbedingungen wie Kleinklassen, schlechte Noten und Klassenrepetition seien, die «die kriminelle Bereitschaft von Schuleschwänzern» erhöhe (30.11.2006, S. 15). Solche Titel sind zum einen spekulativ, weil sie der Sache kaum dienen und von der in der Medienmitteilung seriös dargestellten Bestandsaufnahme ablenken. Zum anderen fragt sich, was hinter solchen Berichterstattungen steckt. Ein Eingeständnis, dass das Schwänzerproblem von unserer Gesellschaft als solches anerkannt wird? Ein Umdenken zu mehr Offenheit und deutlicherem Problembewusstsein? Antworten auf solche Fragen bleiben in jedem Fall Spekulation. Bis heute fehlt eine seriöse öffentliche Diskussion.
Die Forschung zum Schulabsentismus
Die deutschsprachige Schulabsentismusforschung steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist zu hoffen, dass sich dies in den nächsten Jahren ändern wird, wurde doch im Jahr 2004 eine große EU-Studie zum Schulabsentismus gestartet, an der neun Länder beteiligt sind (Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Niederlande, Polen, Russland, Spanien und Großbritannien). Ziel der Studie ist es, die Schulabsentismus-Modelle der einzelnen Länder zu evaluieren und Materialien für die Lehreraus- und -weiterbildung zu entwickeln. Parallel dazu haben in Deutschland auch einige Universitäten und Hochschulen angefangen, sich mit Schulabsentismusforschung zu beschäftigen und auch Präventions- und Interventionsstrategien zu entwickeln (Hamburg, Bremen, Leipzig, Halle, Oldenburg). Im Gegensatz dazu ist die Thematik in der Schweiz bislang nicht als eigenständige Fragestellung bearbeitet worden. Unsere Nationalfondsstudie ist die erste Untersuchung zu dieser Thematik. Die in der Schweiz unter der Schirmherrschaft der WHO regelmäßig stattfindende Befragung Jugendlicher zu ihrem Gesundheitsverhalten enthält auch einzelne Fragen zum Schwänzen (Schmid et al., 2001). Überblickt man die aktuelle Diskussion, dann ist sie in Deutschland und auch in Österreich weit fortgeschrittener als in der Schweiz.
Die angelsächsische Schulabsentismusforschung ist weit fortgeschritten und ein bildungspolitisch stark beachtetes Thema. Dabei lassen sich sechs Schwerpunkte unterscheiden:
1. Persönlichkeitsmerkmale und Schuleschwänzen: Dazu gehören Arbeiten, die sich auf individuelle Merkmale von Schülern wie Geschlecht, Herkunft, Intelligenz und Schulleistung konzentrieren. Ein gutes Beispiel ist das Buch von Reid (1999).
2. Soziale Integration und schulmeidendes Verhalten: Zu diesem Schwerpunkt gehören Arbeiten zum Zusammenhang von auffälligem, renitentem Verhalten, schlechten Schulleistungen und schulabsenten Verhaltensformen, die mit Schulausschluss verbunden sein können. Auf solche Zusammenhänge verweisen zwei Schweizer Evaluationsstudien zu den so genannten Time-out-Schulen (Mettauer & Szaday, 2005; Hascher et al., 2005). Time-out-Schulen sind alternative Bildungseinrichtungen für Schüler, die wegen ihres Verhaltens vorübergehend oder definitiv nicht mehr am regulären Unterricht und/oder am Schulleben teilnehmen dürfen. Zu erwähnen sind aber auch Arbeiten von Thimm (1998; 2000) und Schreiber-Kittl & Schröpfer (2002) zu Schulverweigerern.
3. Schullaufbahnen von Schwänzern: Zu diesem Schwerpunkt gehören Studien, welche die Schulkarrieren von Schuleschwänzern längsschnittartig mit dem Ziel untersuchen, Risikofaktoren herauszufiltern. Dazu gibt es im deutschsprachigen Raum keine Arbeiten. Aus den USA gehören Arbeiten von Garnier, Stein und Jacobs (1997) oder Alexander et al. (2001) dazu. Auffallend ist dabei der große Zusammenhang mit späterem Schulabbruch, niedrigen Bildungsabschlüssen und erschwertem Berufseinstieg.
4. Schulabsentismus und Delinquenz: Insbesondere aus den USA (Garry, 1996; Baker et al., 2001) und aus England (Reid, 1999), vereinzelt nun auch aus Deutschland (Wetzels et al., 2000; Wilmers & Greve, 2002; Wagner et al., 2004), liegen Hinweise zu diesem Zusammenhang vor. Sie weisen nach, dass massives schulabsentes Verhalten mit delinquentem Verhalten einhergeht.
5. Schulleistung und Schwänzen: Zu diesem Schwerpunkt gehören Studien, die Schuleschwänzen und schulische Leistung gemeinsam betrachten. Im Rahmen der PISA-Studie wurde das Ausmaß des Schuleschwänzens deutscher Schüler ebenfalls untersucht (Schümer et al., 2003). Zudem gibt es Untersuchungen zum Zusammenhang von Schuleschwänzen und Klassenwiederholung (Grisson & Shepard, 1989; Roderick, 1994) und Schuleschwänzen, Schulabbruch und Hochbegabung (Renzulli & Park, 2002; Stamm, 2005). International vergleichende Befunde liegen aus der TIMSS-Studie vor (TIMSS, 1999).
6. Schulqualität und Schuleschwänzen: Zu diesem Schwerpunkt liegen einige Arbeiten aus dem angelsächsischen Sprachraum vor. Wegbereiter war die berühmte Rutter-Studie (Rutter et al., 1980), die erstmals auf die großen Unterschiede in den Absentismusquoten zwischen den einzelnen Schulen hingewiesen hatte. Inzwischen haben weitere Studien die Rolle der Schule im Zusammenhang mit Schulabsentismus, Schulpräsenz und Drop-out aus verschiedenen Blickwinkeln unter die Lupe genommen (Lee & Burkam, 1992; 2003).
Im Gesamtüberblick ist die internationale Forschung zwar relativ umfassend, gleichzeitig jedoch auch einseitig, weil sie sich vorwiegend auf den schulschwachen oder leistungsschwachen Risikoschüler konzentriert. Nur vereinzelt nimmt sie auch die Tatsache in den Blick, dass es auch überdurchschnittlich begabte bzw. sehr leistungsfähige Schüler gibt, welche zu den Schuleschwänzern gehören. Gleiches gilt für das Präsenzproblem an anforderungshohen Schultypen, d.h. an Gymnasien, das kaum zur Kenntnis genommen wird. Im Weiteren fehlt eine breitere Diskussion, die sich auf die positive Seite des Schulabsentismus konzentriert und die Frage der Schulpräsenz mit der Schulqualität in Zusammenhang bringt. Im deutschsprachigen Raum fehlt diese Fragestellung fast vollständig (Stamm, 2006).
Welches sind unsere Haupterkenntnisse?
Bevor in diesem Buch die Pädagogik und Psychologie des Schuleschwänzens dargelegt werden, gilt es vier grundlegende Erkenntnisse unserer Studie zur Kenntnis zu nehmen. Sie zeigen auf, dass die Problematik zwar vorhanden ist, aber kaum als solche wahrgenommen wird. Als Erstes geht es deshalb darum, Gesellschaft und pädagogische Praxis dafür zu sensibilisieren. In erster Linie sind dabei vier Punkte hervorzuheben:
1. Gemäß der berühmten Studie von Rutter et al. (1980) sollten Schüler während ihrer Schullaufbahn ca. fünfzehntausend Stunden in der Schule verbringen. Für einen Großteil dürften es jedoch bedeutend weniger sein. Erstens wird viel häufiger, vielfältiger und raffinierter geschwänzt als Lehrkräfte dies wahrnehmen. Schulen scheinen Schulabsentismus massiv zu unterschätzen. Denn nur wenige Lehrkräfte gehen von der Annahme aus, dass sie Schuleschwänzer in ihren Klassen haben. Dies gilt insbesondere auch für anforderungshohe Schulniveaus mit gymnasialer Ausrichtung. In diesen Schulen gibt es auch einen beträchtlichen Anteil leistungsstarker Schuleschwänzer. Und auch ebenso wenige haben uns ihre Hilflosigkeit dem Phänomen gegenüber signalisiert.
2. Zweitens gibt es sehr unterschiedliche Schwänzertypen. Es gibt diejenigen, welche hin und wieder einen halben Tag oder mehr blau machen. Von ihnen zu unterscheiden sind diejenigen Schüler, die zwar jeden Tag in der Schule auftauchen, aber ganz gezielt bestimmte Fächer oder Lehrkräfte («Lektionenschwänzer») meiden, und diejenigen, die zwar auf dem Schulareal sind, den Unterricht aber nicht regelmäßig besuchen. Die kleine Gruppe der massiven Schuleschwänzer hebt sich dabei besonders ab, weil sie Merkmale auf sich vereinigt, die ihr das Etikett einer Problemgruppe verleiht. Dazu gehören ungünstige Lehrerbeziehungen, eine beachtliche Schuldistanz, einen Hang zu leichter Delinquenz und teilweise schlechte Schulleistungen, die mit drohender Klassenrepetition einhergehen. Lehrkräfte scheinen jedoch kaum zwischen diesen Schwänzertypen zu unterscheiden. Ebenso wenig scheinen sie zu bedenken, dass sich gelegentliches Schuleschwänzen, das toleriert und nicht geahndet wird, relativ leicht zu massivem Schuleschwänzen mit problematischen Verhaltensmustern verfestigen kann.
3. Drittens verfügen die meisten Schulen zwar über Absenzensysteme, die in Organigrammen festgehalten sind. In der Praxis scheinen sie jedoch kaum umfassend, d.h. von allen Lehrerinnen und Lehrern und einheitlich, angewendet zu werden. Die Tatsache, dass ein Absenzensystem besteht, wird offenbar als genügend erachtet, während die Frage, ob und wie es verwendet wird, nur eine marginale Rolle zu spielen scheint. Weil Absenzen nur in den seltensten Fällen systematisch und verpflichtend erhoben werden, wissen nur wenige Schulen, wie es tatsächlich um Präsenz und Absenz ihrer Schülerschaft bestellt ist.
4. Daraus folgt viertens, dass sich kaum eine Schule bislang mit präventiven oder interventiven Maßnahmen beschäftigt hat. Dementsprechend selten sind ausgearbeitete Programme, die in Schulen zum Einsatz gelangen.
5. Grundlegend für die Entwicklung eines Programmes sind folgende Faktoren: eine Schulleitung, welche schulabsentes Verhalten als manifeste Störung schulischer Ordnung taxiert und ihm mit einem effektiven Management entgegentritt. Maßgebend ist zweitens das Lehrerverhalten: Neben der professionellen und schüleradäquaten Vermittlung von Unterrichtsinhalten ist die Beziehungsebene das Herzstück der Prävention. Lehrpersonen sind durch die Schulleitung zu motivieren und zu verpflichten, sich für abwesende Schüler einzusetzen und den Kontakt mit den Erziehungsberechtigten zu suchen. Dies gilt auch dann, wenn eine Kontaktaufnahme schwer fällt, weil die Eltern ihren Sprössling durch Entschuldigungsschreiben decken oder wenn abwesende Schüler den Unterrichtsalltag häufig erleichtern und für die Beschäftigung mit weniger schwierigen Schülern Raum geben. Lehrpersonen, die auf freundliches und optimistisches Auftreten achten, positives Feedback geben, klare Erwartungen äußern und Verhaltensregeln vorgeben sowie selbst gute Modelle in Bezug auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind, wirken absentismushemmend. Das Herzstück und die Voraussetzung der Prävention sind drittens das Erkennen des Problems und die genaue Erfassung der Präsenz und der Versäumnisse. Unerkannter Absentismus wirkt verstärkend. Die ungünstigste Variante ist deshalb ein passiver Umgang mit Schulabsentismus, der sich in Abwarten, Wegschauen, Ignorieren und in sporadischen Abwesenheitskontrollen manifestiert.
Das Verstehen von Schulabsentismus ist eine wichtige Voraussetzung für den Umgang mit ihm und seiner Prävention. Wenn Kinder und Jugendliche beginnen, schulmeidende Verhaltensweisen zu entwickeln, müssen wir davon ausgehen, dass sie aus verschiedenen Gründen unfähig sind, die Schule zu bewältigen. Schulabsentismus wird zu ihrem Problem. Jeder Versuch, der ihre Schulpräsenz stärken soll, muss sich mit den Defiziten auseinandersetzen, die in der Familie, im Umgang mit den Gleichaltrigen und in der Schule entstanden sind. Wenn wir akzeptieren, dass Schulabsentismus die negativste Form schulischer Partizipation darstellt, dann liegt es auf der Hand, dass er letztlich in die Frage nach der Qualität von Schule mündet.
Weshalb ist Schulabsentismus nicht lediglich eine ordnungspolitische Bagatelle?
Wer sich mit aktuellen Fragestellungen im Bildungswesen beschäftigt, kommt somit nicht darum herum, sich auch mit Fragen der Schulpräsenz und Schulabsenz zu beschäftigen. Ein Mangel an Schulpräsenz ist immer problematisch. Weshalb? Schule stellt heute den Anspruch, dass sie neben der Fachkompetenz auch Sozial- und Selbstkompetenz vermittelt, Kompetenzen, die in unserer Wissensgesellschaft unabdingbar sind. Vor diesem Hintergrund muss die Idee, wonach nicht genügend beschulte Menschen sozial inkompetent seien, in Rechnung gestellt werden. Anzunehmen ist, dass ihnen Wissen und Fähigkeiten fehlen und dass dieser Mangel nur wenig erfreuliche Zukunftsaussichten erlaubt. Massives Schuleschwänzen wird deshalb immer wieder mit späterer Arbeitslosigkeit in Verbindung gebracht.
Kennzeichnend für die aktuelle pädagogische Praxis ist, dass Schulabsentismus kaum zur Kenntnis genommen und – wenn überhaupt – nur als bürokratische Last abgehandelt wird. Damit tolerieren die Schulen stillschweigend eine schleichende Abkoppelung und zunehmende Schuldistanzierung ihrer Schüler. Die Durchsetzung der Schulpflicht und der Umgang mit Schulpräsenz sind jedoch zwei fundamentale, pädagogische Aufgaben. Die Art und Weise, wie Schulen Fragen der Schulpräsenz bearbeiten, ist auch ein Hinweis darauf, wie sie mit Wertschätzung, Partizipation, Integration und Ausschluss umgehen. Zentral geht es dabei um die Frage des Respekts, den die Lehrkräfte ihren Schülern und diese wiederum ihren Lehrkräften entgegenbringen. Gerade mit Blick auf die zukünftige Einmündung in die berufliche Ausbildung Jugendlicher geht es auch darum, Partizipation und Höflichkeit einzuüben. Berichte zur Lehrstellensuche Jugendlicher zeigen immer wieder, wie stark solche Aspekte von Lehrmeistern bei ihrer Auswahl der Berufslernenden gewichtet werden. Absenzen und Verspätungen haben einen großen Einfluss auf eine erfolgreiche Lehrstellensuche. Auf einer Informationsbroschüre des Kantons Basel-Stadt ist zu lesen: «Dein Zeugnis zeigt mir, was du bisher geleistet hast. Mich interessieren aber nicht nur deine Schulnoten, sondern auch deine Absenzen. Mit unentschuldigten Absenzen im Zeugnis fällst du bei mir sofort durch. Auch zu viele entschuldigte Absenzen sehen nicht gut aus. Bleibe nicht wegen jeder Kleinigkeit zu Hause!» Solche Broschüren verweisen nicht nur darauf, dass Schuleschwänzen im Bewusstsein der Schulen sein muss, sondern auch darauf, dass Schuleschwänzen für eine erfolgreiche Lehrstellensuche einen hinderlichen Faktor darstellt.
Der Aufbau dieses Buches
Diese Publikation richtet sich an alle, die im Bildungswesen tätig sind oder planen, in ihm tätig zu werden, aber auch an Eltern und interessierte Laien. Sie möchte einen Einblick geben, wie die Frage des Schulabsentismus zu verstehen und zu bearbeiten ist. Dies tut sie in fünf Schwerpunkten: In einem ersten Kapitel geht es um den Schulabsentismus und seine Folgen, d.h. um die Einsicht, dass seine Bewertung und Behandlung je nach Definition, Verständnis und Diagnostik sehr unterschiedlich ist und deshalb auch unterschiedliche Beachtung erfährt. Das zweite und dritte Kapitel widmen sich der Frage, wie verbreitet Schuleschwänzer in unserem Bildungssystem sind, weshalb sie der Schule fern bleiben und welche Typen und Formen von Schulabsentismus sich unterscheiden lassen. Aufgezeigt wird dabei, dass es zwar eine ganze Reihe von charakteristischen persönlichkeits- und auf die soziale Herkunft bezogenen Merkmalen gibt. Aber sie erlauben nicht, per se von dem Schuleschwänzer zu sprechen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen und Stile. Schwänzer sind nicht nur die erfolglosen Schüler und diejenigen aus benachteiligten Familien. Ebenso gibt es relativ erfolgreiche Jugendliche aus privilegierten Familien, die massive Schuleschwänzer sind. Aber sie bleiben der Schule aus anderen Gründen fern als die erst genannte Gruppe. Neben den gelegentlichen und massiven Schuleschwänzern gibt es auch die Lektionenschwänzer, die Schulverweigerer und die von den Eltern zurückgehaltenen Schüler, die gewissermaßen unter elterlicher Anweisung von der Schule fern bleiben. Ein besonderes Augenmerk gebührt dabei der Gruppe der Schulabsentisten, die durch Entschuldigungsschreiben und/oder Arztzeugnisse elterliche Rückendeckung erhalten. Kapitel vier fragt nach den Ursachen, weshalb Jugendliche nicht zur Schule gehen. Untersucht werden dabei soziale, psychologische und schulische Ursachen. In Kapitel fünf wird der Blick auf den Einfluss der Schulen und Lehrkräfte auf das Absentismusverhalten ihrer Schüler gelenkt, und es wird gefragt, welche Faktoren die Schulpräsenz fördern. Kapitel sechs konzentriert sich auf die familiären Hintergründe und auf die Frage, welche Rolle Eltern und Erziehungsberechtigte im Hinblick auf das Schuleschwänzen ihres Kindes spielen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Problematik der entschuldigten Absenzen und auf Arztzeugnisse gelegt. In Kapitel sieben steht der Zusammenhang zwischen Schulabsentismus und deviantem Verhalten zur Diskussion. Untersucht wird, inwiefern die vielfach vermutete Annahme bestätigt werden kann, wonach Schuleschwänzen mit kriminellen und devianten Verhaltensweisen einhergeht. Um Prävention und Intervention geht es in Kapitel acht. Im Mittelpunkt steht dabei die Schule und die Frage, was sie im Rahmen ihrer Qualitätsentwicklung zur Lösung der Absentismusproblematik beitragen kann. Abschließend wird Bilanz gezogen: Es werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und in die zukünftigen Aufgaben von Bildungsverwaltungen, Schulen, pädagogisch-psychologischen Beratungsstellen, Sozial- und Elternarbeit eingebunden.