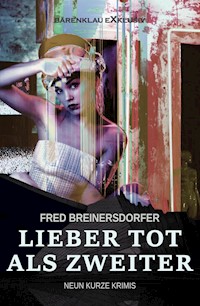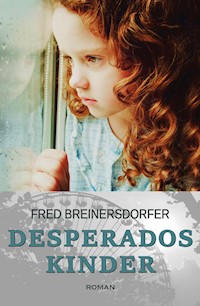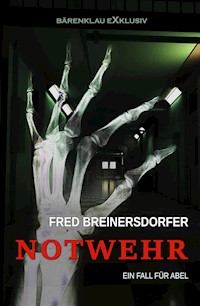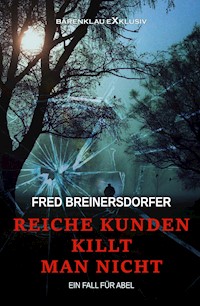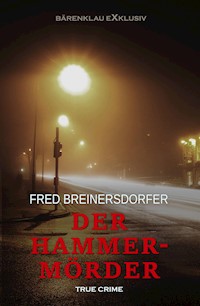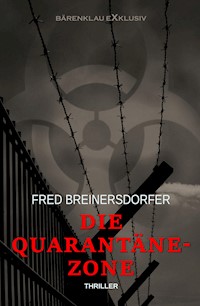
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als der Amtsrichter Andreas Betz gemeinsam mit seiner Freundin Gisa Wormser, die Geburtstagsfeier an Bord des Schiffes lustvoll in den handfesteren Freuden der Liebe ausklingen lässt, ist die Welt noch in Ordnung. Doch zu diesem Zeitpunkt ist das Unfassbare, das das Leben des Richters nachhaltig beeinflussen und die ganze Welt verändern soll, bereits geschehen: Ein junger Mann, ein Bluter, verletzt sich, sein Blut wird einer Routinekontrolle unterzogen – das erschreckende Ergebnis lautet »serumpositiv«.
Weitere gentechnische Analysen, die an ihm vorgenommen werden, weisen auf einen neuen Virus hin, einen kleinen, vielfach gefährlicheren Bruder der bisher bekannten Form der Immunschwächekrankheit. Er ist jedoch ansteckend wie eine Grippe und absolut tödlich, ohne dass die Medizin wirklich etwas dagegen tun könnte. Ein Wettlauf mit dem Tod beginnt. Innerhalb nur kurzer Zeit verändern sich Welt und Leben der Menschen radikal. Immer mehr Krankheitsfälle treten auf, die Presse kommt der Sache auf die Spur, und die Seuchengefahr wird öffentlich. Die Gesellschaft reagiert hysterisch; außer Hygiene zählt nichts mehr. Das Leben erstarrt in Eiseskälte. – Nur jene Menschen, die sich mit dem neuen Virus infiziert haben, brauchen sich nicht zu fürchten. In der Quarantänestation entwickelt sich eine neue Qualität menschlichen Lebens.
Dieser Roman wurde 1989 im deutschen Fernsehen mit Günther Maria Halmer in der Hauptrolle verfilmt. Das Drehbuch dazu schrieb Fred Breinersdorfer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Fred Breinersdorfer
Die Quarantäne-Zone
Thriller
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Christian Dörge mit Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Quarantäne-Zone
Sonntag, Nacht
Sonntag, nach Mitternacht
Sonntag, nach Mitternacht
Montag, lange vor Sonnenaufgang
Montag, früher Morgen
Montag, Arbeitsbeginn
Montag, Vormittag
Montag, Vormittag
Montag, später Vormittag
Montag, später Vormittag
Montag, gegen Mittag
Montag, Nachmittag
Montag, später Nachmittag
Montag, Abend
Montag, Abend
Montag, später Abend
Montag, Nacht
Dienstag, Vormittag
Dienstag, Vormittag
Dienstag, Mittag
Dienstag, früher Nachmittag
Dienstag, später Nachmittag
Dienstag, später Nachmittag
Dienstag, später Nachmittag
Dienstag, Abend
Dienstag, Nacht
Dienstag, Nacht
Dienstag, Nacht
Dienstag, Nacht
Dienstag, Nacht
Mittwoch, Morgen
Mittwoch, später Morgen
Mittwoch, gegen Mittag
Mittwoch, Mittag
Mittwoch, Nachmittag
Mittwoch, später Nachmittag
Mittwoch, später Nachmittag
Mittwoch, Abend
Mittwoch, Nacht
Donnerstag, Morgen
Donnerstag, Vormittag
Donnerstag, gegen Mittag
Donnerstag, Mittag
Donnerstag, früher Nachmittag
Donnerstag, später Nachmittag
Donnerstag, später Nachmittag
Freitag, vor dem Morgengrauen
Freitag, früh am Morgen
Freitag, Vormittag
Freitag, Vormittag
Freitag, Mittag
Freitag, Mittag
Freitag, später Nachmittag
Freitag, später Nachmittag
Freitag, später Nachmittag
Freitag, gegen Abend
Freitag, gegen Abend
Freitag, Abend
Freitag, Abend
Freitag, später Abend
Freitag, später Abend
Freitag, Nacht
Freitag, Nacht
Samstag, vor dem Morgengrauen
Samstag, im Morgengrauen
Samstag, früher Morgen
Samstag, Morgen
Samstag, gegen Mittag
Samstag, früher Nachmittag
Samstag, früher Nachmittag
Samstag, Nachmittag
Samstag, später Nachmittag
Samstag, gegen Abend
Samstag, später Abend
Samstag, Nacht
Samstag, Nacht
Sonntag, früher Morgen
Sonntag, früher Morgen
Der Autor Fred Breinersdorfer
Folgende Romane des Autors Fred Breinersdorfer sind ebenfalls erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Als der Amtsrichter Andreas Betz gemeinsam mit seiner Freundin Gisa Wormser, die Geburtstagsfeier an Bord des Schiffes lustvoll in den handfesteren Freuden der Liebe ausklingen lässt, ist die Welt noch in Ordnung. Doch zu diesem Zeitpunkt ist das Unfassbare, das das Leben des Richters nachhaltig beeinflussen und die ganze Welt verändern soll, bereits geschehen: Ein junger Mann, ein Bluter, verletzt sich, sein Blut wird einer Routinekontrolle unterzogen – das erschreckende Ergebnis lautet »serumpositiv«.
Weitere gentechnische Analysen, die an ihm vorgenommen werden, weisen auf einen neuen Virus hin, einen kleinen, vielfach gefährlicheren Bruder der bisher bekannten Form der Immunschwächekrankheit. Er ist jedoch ansteckend wie eine Grippe und absolut tödlich, ohne dass die Medizin wirklich etwas dagegen tun könnte. Ein Wettlauf mit dem Tod beginnt. Innerhalb nur kurzer Zeit verändern sich Welt und Leben der Menschen radikal. Immer mehr Krankheitsfälle treten auf, die Presse kommt der Sache auf die Spur, und die Seuchengefahr wird öffentlich. Die Gesellschaft reagiert hysterisch; außer Hygiene zählt nichts mehr. Das Leben erstarrt in Eiseskälte. – Nur jene Menschen, die sich mit dem neuen Virus infiziert haben, brauchen sich nicht zu fürchten. In der Quarantänestation entwickelt sich eine neue Qualität menschlichen Lebens.
Dieser Roman wurde 1989 im deutschen Fernsehen mit Günther Maria Halmer in der Hauptrolle verfilmt. Das Drehbuch dazu schrieb Fred Breinersdorfer.
***
Die Quarantäne-Zone
Sonntag, Nacht
Das Schiff wiegt sich im Strom, tanzt an den Tauen, die wie alte gebrechliche Weiber ächzen. Betz sitzt im oberen Salon des Schiffes, der während der Feier unzugänglich geblieben ist, weil er mit Bänken zugestellt war, und trinkt Rotwein aus der Flasche. Er ist sicher, dass ihn das Getränk umhauen wird, nach all dem Bier, Sekt und Schnaps. Aber er liebt das Lutschen und Suckeln und den herben Geschmack. Draußen glänzt hinter Regenschleiern die Stadt.
Vor dem Anleger blinkt ein Auto mit den Scheinwerfern ein sinnloses Morsealphabet. Kreischen, Gelächter von den letzten Gästen. Als ein Rest vom Feuerwerk furzen Schweizer Kracher auf dem Asphalt herum. Auf jeden der feuchtigkeitsgedämpften Schläge folgen wieder Johlen und Grölen. Es scheint, als finde der sonntägliche Brunch nun endlich sein verdientes Ende.
Schließlich fährt das Auto doch noch ab. Ein zweites folgt. Zurück bleibt ein Paar, das Betz im gelben Gegenlicht der Straßenlaterne unter einem Schirm miteinander knutschen sieht, die Körper aneinander geschmiegt. Die Köpfe gehen hin und her wie Pendel einer langsamen Uhr. Bis schließlich eine der beiden Silhouetten mit stoßenden Bewegungen des Unterkörpers beginnt, die von der anderen Silhouette harmonisch aufgenommen werden. Der Pendelschlag der Kopfuhren geht schneller.
Betz, nun aufmerksam geworden, steht auf und tritt ans Fenster. Aber er kann nicht erkennen, wer wem das Kopulieren verspricht. Er grinst, auch wenn er nicht herausbekommt, ob Melanie von der Geschäftsstelle es vielleicht mit dem Vorstand des Amtsgerichts zu treiben verspricht oder die so gesetzt erscheinende Amtsrichterin Schultheiß, über welche die Kollegen wegen ihrer gierigen Augen so gerne lästern. Wenn die Schultheiß, dann aber mit wem?, fragt sich Betz und schneidet eine Grimasse, suckelt an der Flasche, zuckt mit den Schultern, feixt für sich und beobachtet mit Gelassenheit, wie nun die nicht erkennbare Frau, ihr Geschlecht ist an der Silhouette des Rockes zu definieren, ihren Liebhaber der nächsten Stunde mit sich zieht. Beide verschwinden in der nassen Dunkelheit. Bald heult ein Motor auf und ein Fahrzeug schießt unter Fernlicht davon.
Die Scheinwerfer streifen ein rundes, glatt rasiertes Gesicht, dessen Stirn in einer Glatze ausläuft, die von militärisch kurzem, braunem Haar bekränzt wird. Die Augen scheinen im grellen Licht für den Bruchteil einer Sekunde in ihrer grünen, prächtigen Farbe. Der ein wenig gebückte, trotzdem athletisch wirkende Körper mit seltsam schmalen, ja fast zierlichen Händen, die mit der Beaujolaisflasche spielen, pendelt hin und her. Betz schließt für eine Sekunde die Augen, dann ist der Lichterspuk vorbeigeflogen. Das Brüllen des Motors vergurgelt an der Kurve hinter den Lagerhäusern.
Nun kann sich Andreas Betz wieder zurücklehnen, den Geräuschen des tanzenden Schiffs lauschen und auf seine eigene Liebhaberin warten, die ja versprochen hat zu kommen. Unter dem Kiel gluckst und schlürft das Wasser. Betz schnüffelt, riecht den alten Lack und den Duft des Flusswassers, Tang und Algen. Seltsame Laute mischen sich in seine Wahrnehmung, metallische Schläge wie an Heizungsrohre, Schnarren ungeölter Scharniere. Es scheint, als schließe jemand das Schiff ab. Da, endlich klappern lustig Pfennigabsätze über das Holz des Anlegers.
»Komm, gib den Schlüssel her, alter Herr«, hört Betz die helle Stimme Gisas rufen und hinzufügen: »Hab dich nicht so, ich kann auch deinen Kahn abschließen. Taue fest?«
Ein Gebrumm ist die Antwort. Schließlich nimmt Betz stampfende Schritte wahr, die sicher zum Schiffer gehören. Dann ist es ruhig auf dem Kahn.
Kein Geräusch, außer jenen, die das Schiff in seinem Ruhezustand verursacht. Betz ertappt sich bei der Überlegung, ob Gisa sich irgendwo, vielleicht auf der metallenen Bordtoilette, die überall Rostsprenkel hat, für die nächste Stunde herrichtet? Ob sie sich schminkt, kritisch ihr Gesicht überprüft? Oder sie pinkelt sich ganz einfach aus und bohrt dabei in der Nase. Für Betz ist nur wichtig, dass sie bald kommt. Nicht, dass er vor Erregung geplatzt wäre, er sitzt hier gut und süffelt, aber irgendwie muss es weitergehen mit dieser Nacht, denkt er. Er stößt mit der Spitze seines linken Fußes an die gegenüberliegende Bank und stellt dabei fest, dass diese nicht fest montiert ist und sich bewegt. Ein wenig unkonzentriert mustert er das Szenarium um sich, sich gleichzeitig fragend, wie denn technisch ein zärtlicher Liebesakt auf all diesen übereinandergestapelten hölzernen Sitzgelegenheiten zu bewerkstelligen sei.
Die Schiebetür rasselt. Betz fährt heftig zusammen, weil er vorher keine Schritte gehört hat. Er fühlt sich ertappt, lächelt, als er Gisa im schrägen gelben Licht sieht, das die Straßenlaterne draußen spendet. Sie ist klein, fast winzig, zerbrechlich. Ihre rötlichblonden Haare wirken in dieser Beleuchtung dunkler, fast brünett, das Sommersprossengesicht wie gut gebräunt. Die kleine Nase, die volle Unterlippe gleichen aus der Distanz betrachtet Strichen. Und die burschikos geschnittenen, kurzen Haare verbergen die ein wenig abstehenden Ohren, an denen Betz sie vorhin beim Tanzen gezupft hat, um sie zu ärgern. Er fühlt sie nähertreten. Er riecht ihren frischen Duft nach Parfüm, Alkohol und Schweiß. Er ist froh, dass sie nicht ihre Brille trägt. Statt sie aber mit offenen Armen leidenschaftlich zu empfangen, steht er da wie ein Esel mit hängendem Kopf, in einer Hand die Weinflasche, und schnüffelt mit bebenden Nüstern. Gisa hustet ein wenig, ihre Hand berührt streichelnd, aber nur sehr flüchtig seine Wangen und seinen Hals. Er will sie an sich ziehen, sie umarmen, diesen tiefen Kuss voller Hitze von vorhin wiederholen. Doch sie schlüpft ihm weg, kniet auf eine Bank, die ein gequältes Quietschen von sich gibt, und macht sich rasch mit kundigen Händen über seinen Hosenladen her, kramt, ja, muss kramen, denn was ihr da in die Hände fällt, ist ein kleines, schüchternes Schnippelchen, vierzigjährig und fast kalt anzufühlen. Sie nimmt es in den Mund, küsst es, beißt ein wenig mit spitzen Zähnchen darauf herum. Und Betz hält immer noch seine Weinflasche in der Hand, starrt nun mit aufgerissenen Augen hinaus auf die Straße, auf der im Schritttempo nun ein Polizeiwagen patrouilliert. Er tastet nach ihrem Kopf, streichelt die kurzen Haare so zärtlich es gerade geht, immer noch atemlos und sprachlos wegen der plötzlichen Attacke ihrer körperlichen Liebe. Er klappert mit der Weinflasche auf einer Bank herum, bis er einen scheinbar sicheren Platz gefunden hat, dann fasst er den Kopf des Mädchens mit beiden Händen, entwindet sich ihrem saugenden Mund und kniet auf den Sitz der Bank nieder. Jetzt endlich kommt der lange, feuerheiße Kuss, mit dem der Amtsrichter Betz in seinem Liebesszenarium üblicherweise die Zärtlichkeiten beginnt. Auf diese Weise gewinnt er ein wenig seine Sicherheit zurück. Ihr Mund fühlt sich weich und voll an, die Zunge geht flink auf seine trägen Vorschläge ein. Mit der linken Hand tastet er sich geschickt unter ihr Polohemd und an die kleinen Brüste, deren Spitzen so steif sind, wie ein gerade vierzigjähriger Amtsrichter sich gerne seinen Schwanz wünscht. Dieser nämlich, der ungewohnten Nachtluft ungeschützt ausgesetzt, noch feucht von der liebevollen Behandlung, hat sich trotz des innigen Kusses, kaum dass er sich ein wenig gestreckt hatte, in seine schrumpelige Ausgangssituation zurückgezogen. Andreas legt nun umso mehr Feuereifer in die Finesse seiner Zärtlichkeiten, züngelt an ihrem Ohr herum, schnauft schon heftig und behandelt mit spitzen Fingern tastend die kleinen Nackenhärchen.
Und plötzlich gleitet sie ihm wieder weg, nach unten, nimmt wieder genauso selbstverständlich ihre für Betz so verblüffende Tätigkeit auf, lässt Umsicht und Geschick walten, obwohl die ganze Sache mit dem nun auf der Bankkante knienden Liebhaber ein wenig umständlich und unbequem erscheint. Der, wie heute viele gebildete Männer, ganz voller Rücksicht, will das ändern, erhebt sich mit einem Grunzen, sodass ihre Zähne an Schwanz und Schamhaar zupfen und reißen. Sie lacht darüber, glucksend, so wie vorhin, sodass die aus seiner subjektiven Sicht straffe, objektiv gesehen aber eher halbstraffe Männlichkeit sofort wieder sensibel zu schwinden beginnt. Sie kommt hoch, krault ihn hinter den Ohren und flüstert schnurrend: »Du Einfaltspinsel! Warum darf man nicht einmal beim Schmusen lachen? Ihr meint, ihr müsst immer bierernst mit einem Ständer herumrennen und stoßen wie der Hirsch im Wald.« Lachen, Glucksen.
Betz räuspert sich, versucht in seine Stimme Schmelz und Zärtlichkeit zu legen. »Nein, nein«, sagt er.
»Macht doch nichts«, schnurrt Gisa, »ich will sowieso nicht mit dir schlafen. Schlafen eigentlich schon, aber nicht vögeln. Ich habe die Tage. Ich hasse diese Blutsudelei.«
So kommen sie schließlich fast ernüchtert nebeneinander zum Sitzen, zwischen sich die fast leere Flasche Beaujolais. Ihr hängt der Saum des Polohemdes noch knapp unterhalb der Brüste, und seine halb offene Hose zeigt den Schwanz und einen weißlichen Hoden. Sie beginnen einträchtig aus der Flasche zu saufen, kräftige Schlucke, kein Schnuckeln. Sie streicheln und küssen sich dabei.
Der Alkohol durchzieht warm und freundlich Magen und Kopf. Betz hebt den Hintern und fädelt sich wieder in seine Unterhose ein. Die Jeans lässt er offen, sozusagen als Kompromiss. In diesem Augenblick schwingt sich Gisa rittlings auf ihn. Im Halbdunkel schwebt für einen kurzen Augenblick ihr Gesicht über seinem, bevor sie ihren Kopf in seine Halsbeuge bettet, wo sie lange und warm ruht. So sieht sie nicht, dass der Streifenwagen der Polizei mit grell flackerndem Blaulicht, aber ohne Martinshorn, draußen vorbeijagt.
Sonntag, nach Mitternacht
Irgendwie sind sie zusammen, trotz beträchtlichen Rausches, in Gisas Dachwohnung gekommen, haben in der Küche gesessen; aus der Hand Käse und Brot gegessen; ein Bier getrunken und haben miteinander unsinniges Zeug über den unsäglichen Gerichtsbetrieb geredet, nur damit geredet wird.
Kaum dass die Bierflasche geleert war und der Käse aufgegessen, beginnt Gisa, sich mitten in der Küche auszuziehen, als sei man schon Jahre zusammen. Mit gekreuzten Armen greift sie nach dem Saum des Polohemdes und streift es über den Kopf, sie schüttelt die Haare zurecht, sodass die Brüste ein wenig pendeln, was Betz für einen Augenblick beim Bierschlucken innehalten lässt. Dann streift sie die Leinenhose ab und strampelt sich aus einer Winzigkeit von Slip. Zum ersten Mal fällt Betz auf, dass sie für ihre zierliche Figur etwas zu breite Hüften hat. Und dieses rötliche, durchsichtig wirkende Schamhaar! Aber sie gefällt ihm trotzdem. Und so spürt er, da augenblicklich nichts bewiesen werden muss, ganz plötzlich ein auffälliges Ziehen in den Lenden. Sehr angenehm. Gisa geht einfach hinaus, sanft mit dem Hintern wiegend, und schaltet an der Tür das Küchenlicht aus. Sie sagt, dass sie nun zusammen mit ihm schlafen will, sie meint aber offensichtlich nur »übernachten«. Betz, ein ordentlicher Mensch, verstaut die angebrochene Bierflasche im Kühlschrank, folgt ihr dann, sich Hemd und Hose im Gehen auf dem Flur entledigend, schließlich auch nach kurzem Zögern der Unterhose, sucht das Bad, schaut kurz hinein, um sich die Zähne mit Zahnpasta und den Fingern zu putzen. Und schließlich tastet er sich in der ohnehin nicht sehr großen Wohnung weiter bis zum Schlafzimmer mit einem erstaunlich breiten Bett, auf dem, unter vielfältig geschichteten französischen Decken liegend, sich der Körper seiner nächtlichen Freundin abzeichnet. Eine Lampe mit weißem Schirm spendet freundlich kühles Licht. Gisa rührt sich nicht.
Betz schläft sehr unruhig. Schon lange, viele Monate vor seiner Scheidung, war er nicht mehr über Nacht mit einer Frau zusammen gewesen, hat nur hier und da eine Damenbekanntschaft gehabt, allesamt verheiratete Frauen in seinem Alter, aus deren Gemächern er sich – meist tagsüber – wie ein Tagedieb davongestohlen hatte, als die Sache vorbei war. Da macht ein nackter, warmer Frauenkörper, der nach Parfüm und laszivem Schlaf duftet, ganz schön unruhig.
Und irgendwann im Morgengrauen merkt Gisa, wie ihm nun endlich das morgendliche Glück einer prallen Erektion beschieden ist. Halb wachend, halb schlafend zieht sie ihn auf sich und hilft ihm dabei, nach kurzem, erregtem Stoßen sich auf ihrem Bauch zu ergießen. Monatsblut hin, Monatsblut her. Sie schubst ihn dann, endlich ein wenig wacher, zirpt ihm in die Ohren und summt »Strangers in the Night«. Dann fragt sie, warum er seinen Freund herausgezogen hat, heute kann doch nichts passieren?
Betz, ein wenig ratlos über das, was er angerichtet hat, will ins Klo, Papier holen, um sein Sperma abzuwischen. »Nur so«, sagt er. Doch Gisa zieht ihn an sich, reibt sich an ihm und flüstert:
»Das lassen wir einfach drauf.« Dann schläft sie, halb auf ihm liegend. Schwer wie ein Stein.
Sonntag, nach Mitternacht
Genau zur selben Stunde, oben auf dem Gelände der Universität, herrscht in den Kliniken tiefe Ruhe. Nachtbeleuchtung, die Wachstationen flimmern blau. Virologisches Institut: Arnold Krön steht an einem Eichenschreibtisch aus der Zweiten Zeit und stützt die Fäuste auf die Platte. Auf dem Bildschirm des Monitors, der vor seinen Fäusten steht, laufen grüne Zahlenkolonnen herunter. Krön nagt an den Lippen und verfolgt die Kaskade der Ziffern. Immer wenn sie ins Stocken geraten, drückt er auf dem Keybord, das zwischen dem Monitor und ihm liegt, einige Tasten – und schon wieder setzen sich die Kolonnen und Zahlen in Bewegung. Wie im Kopf von Musikern Noten Töne erzeugen, so bewirken die Zahlenkaskaden hinter der schmalen Stirn des Forschers Krön Unsicherheit und Spannung.
Erneut klimpern seine Finger über das Keybord. Die Elektronik reagiert und formt auf dem Monitor eine bunte Grafik, in der gelbe, grüne und rote Linien in einem Koordinatensystem elegant auf und ab schwingen.
»Herrgott!«, zischt Krön zwischen den Zähnen durch und wiederholt die Prozedur. Die Grafik verschwindet, Zahlen flimmern vom oberen Bildschirmrand zum unteren.
Krön setzt sich und wühlt in dem Papierhaufen auf dem Schreibtisch herum. Alles ist ungeordnet, übersät mit Einwegfilzschreibern in jeder nur denkbaren Farbe, befleckt vom Kaffee, beladen mit Filmkartuschen, da liegt ein Brieföffner, zwei überquellende Aschenbecher. Endlich finden die fliegenden Finger einen kleinen Stapel ziehharmonikagefalteter Computerbögen aus grauem, umweltschonendem Papier. Seine Augen suchen die Spalten durch, vergleichen die Werte mit dem Bildschirm. Zurück zum Keybord: ein Tastendruck. Die Ziffern bleiben auf dem Monitor stehen. Krön blättert. Er sucht eine Zeile. Er vergleicht. Wie ein Kind, das erst lesen lernen muss, tastet er mit dem Zeigefinger auf Bildschirm und Papier in die richtige Reihe. Hier steht 83,7, dort 11,49. 83,7 und 11,49. Eine banale Kombination, ohne Aussagewert für Laien, doch Krön versetzt sie in Nervosität, Ungeduld. Plötzlich lässt er alles liegen, hastet zur Tür, hinaus auf den Flur, hinüber in die großen, hellen Laborhallen, belegt mit Forschungsgerät und Versuchseinrichtungen. Er zwingt sich zu einem Lächeln, obwohl ihn keiner sieht, ist von dem Gerenne ein wenig außer Atem und ruft: »Fräulein Cerzig, geben Sie mir noch einmal die zweite Probe auf drei – aber dieses Mal mit zehn Prozent Serum mehr.«
Das Fräulein Cerzig, gedrillt wie beim Militär, wiederholt den Befehl ihres Chefs, gibt den Versuch auf den dritten Kanal und die zehn Prozent Serum dazu. Sie ist schnell, geschickt, verlässlich. Das weiß Professor Krön, deshalb hat er sie in dieser Nacht telefonisch aus dem Bett geholt und hergejagt. Denn Fräulein Cerzig ist die älteste PTA im Stall und kennt sich bei allen Versuchen aus, und sie ist besser als viele der jungen Mediziner, die hier überall herumwuseln und denen Professor Krön misstraut, weil sie seiner Auffassung nach nur gute Noten und kein Fingerspitzengefühl mitbringen. Deshalb stutzt er auch nicht, als das Fräulein Cerzig, ohne von der Aufregung ihres Chefs angesteckt zu sein, antwortet, ob man nicht vielleicht mit zwölf Prozent Serum besser darangeht, dann könnte man ja immer noch mit zehn fahren.
Krön fuchtelt mit den Händen, was so etwas wie Zustimmung signalisieren soll, dann rennt er voller Ungeduld zurück in sein Zimmer, einen dieser von ihm gehassten, farblosen Assistenten vom Nachtdienst zur Seite stoßend. Doch auf halbem Wege hält er an, stürzt zurück, noch einmal in die Versuchshalle, sogleich hin zu Fräulein Cerzig, die, mit Gummihandschuhen über den Händen, durch die man wie mit weißlichem Schleier den roten Nagellack schimmern sieht, die Versuchseinrichtung justiert. Professor Krön, sich scharrend am unrasierten Kinn kratzend, sieht ihr für wenige Sekunden zu, dann fragt er fast flüsternd, sich konspirativ umsehend, weil er niemanden in die Sache hineinziehen will, ob das schon die Proben aus dem Tierversuch sind.
»Ja«, sagt das Fräulein Cerzig nüchtern. Krön steht neben ihr, registriert im Widerschein des Laserlichts die feinen Härchen auf ihrer Wange, die, vom Make up nicht bedeckt, abstehen. Eine hübsche Frau, denkt er, sie führt abends und an Wochenenden ein glückliches Leben, draußen, irgendwo in der Vorstadt. Jetzt sieht sie besorgt aus, unruhig, aber beherrschter als ihr Chef. »Ja, aus dem Versuch mit den Ratten«, sagt sie, »genau die Probe, wie Sie gesagt haben.«
»Es ist zum Mäusemelken, es ist zum Mäusemelken …«, murmelt Krön zwischen den Zähnen und scharrt fortwährend am Kinn, mit zusammengekniffenen Augen die Versuchsanordnung visitierend. Und als er sieht, dass alles in Ordnung ist, rennt er wieder weg. Die Schritte seiner weißen Turnschuhe quietschen leise auf dem versiegelten Kunststoffboden.
Montag, lange vor Sonnenaufgang
Der rein technische Ablauf der Analyse war Krön nicht bekannt gewesen, weshalb er sich die Details von der PTA Cerzig hat erklären lassen, bevor er sie nach Hause geschickt hat. Sie ist maulend gegangen, weil sie gemerkt hat, dass hier ein außergewöhnlich wichtiger Versuch läuft. Doch Krön hat sie hinausgescheucht, weil er es nicht gebrauchen kann, wenn Leute um ihn herum sind, die ihn beobachten können, wenn er nervös ist, unsicher, gehetzt. Ein Tag, den er schon am Nachmittag beschlossen hat zu verfluchen und über den er gelegentlich Notizen machen wird, die er zu Hause bei sich in ein Stahlfach genauso einschließen wird wie bestimmte Forschungsergebnisse, deren Geheimnis er hüten will.
Ein schwarzer Tag!
Endlich ist er völlig alleine, in Ruhe, kann seine Motorik entfalten. Er reißt den weißen Kittel herunter, zieht sogar den Norweger Pullover über den Kopf, fährt nur flüchtig durch die schwarzen Haare. Nun krempelt er noch die Ärmel auf, er sieht aus wie einer, der ans Holzhacken geht und sich ein gewaltiges Pensum vorgenommen hat. Nur die Gummihandschuhe, die er sich schnalzend überstreift, stören das Bild. Obwohl er voller Ungeduld ist, zwingt er sich, nicht noch einmal nach den Ratten zu sehen, weil seine Ratio ihm sagt, dass die Versuchstiere genauso stumpf und pfeifend durcheinanderwieseln, gleichgültig, ob eines der Brüder oder Schwestern das Virus auf den eigenen Körper übertragen hat oder nicht. Die Tiere bewirten das Virus; es vernichtet sie nicht. Sie können jedoch Aufschluss über den Ansteckungsvorgang geben.
So begibt sich der Forscher Krön zu einem Plastikgestell, das Glasträger enthält, auf die teilweise Serum, teilweise Blut aus der zweiten Probe verteilt ist, die man einem jungen Mann namens Vogel abgenommen hat. Mit dieser zweiten Testreihe will Krön sich Zeit lassen; die erste Probe wurde zu schnell vergeudet. Den zweiten Versuch hat er persönlich überwacht, genau angeordnet, in welche Kulturen Serum und Blut eingeimpft werden, durchaus wild improvisiert, um zu prüfen, wie sich das Virus in Urin- und Speichelproben verhält.
Er selbst ist aufs Klo gelaufen, um persönlich ein Tröpfchen für den Versuch abzuzweigen, nachdem die PTA und die Assistenten sich kichernd gesträubt haben. Er will, nein, er muss einfach sehen, ob dieses Virus bei den vielfältigen Behandlungen, die er ihm zugedacht hat, am Leben bleibt, nachdem er durch reinen Zufall bei einer Routinekontrolle auf seine Spur geraten ist. Die aufwendige gentechnische Analyse läuft. Doch Kröns Erfolg als Forscher ist nicht nur auf penible Systematik begründet, sondern auch auf Fantasie, Erfindungsreichtum und Mut. Und wenn ihm die Kollegen, teils bewundernd, teils nicht ohne Neid, eine große Karriere und eine kleine Anwartschaft auf einen großen wissenschaftlichen Preis voraussagen, dann nur wegen seiner Spürnase, seiner Sherlock-Holmes-haften Kombinationsgabe. Krön ist eine ebenso wütende Intoleranz gegenüber den Lehrmeinungen seiner Kollegen zu eigen, wie er japanischen Pragmatismus an den Tag legen kann, wenn er ihm plausible Forschungsergebnisse anderer kurzerhand übernimmt. Krön ist mit seinen fünfundvierzig Jahren ein weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus bekannter und angesehener Forscher, ein Freigeist und gleichzeitig Dogmatiker – und vor allen Dingen ein beharrlicher Arbeiter.
Er geht ans Werk.
Es wird zwei, es wird drei Uhr. Krön hat sich zuerst die unorthodoxen Proben vorgenommen, wie gesagt Urin und Speichel, die Proben jeweils zur Sicherheit dreimal durch den Test laufen lassen: positiv! Die Messwerte und Ergebnisse gibt er in den Computer ein, im Augenblick bedeutet das alles noch nichts, kann es doch auf Zufälle und Verunreinigungen basieren. Doch die Systematik der Datenerfassung ist wichtig. Krön grübelt, läuft rastlos hin und her, blickt aus dem Fenster, wartet. Er probiert fast eine halbe Stunde an der Software im Betriebssystem herum. Die nächsten Proben: verschiedene Milieus, basisch, sauer. Doch immer dasselbe Ergebnis, jeweils dreimal gemessen: serumpositiv.
Kröns Hände klappern über die Tastatur des Computers, Zahlenkolonnen entstehen, Diagramme, ein Umbruch, der Bildschirm zeichnet Kurven in Koordinatensystemen. Kröns Augen schmerzen schon lange, er reibt sie, bis die Augenlider ein fast wohliges Gefühl zwischen Schmerz und Jucken ausstrahlen. Er setzt sich und starrt wieder auf die Diagramme, die von Versuch zu Versuch regelmäßige Ergebnisse liefern. Alles lässt nur einen Schluss zu:
Das Virus lebt!
Anders als die bisher bekannte Form, die tot war, sobald ein Blutstropfen eingetrocknet war, weder in Wasser noch in Luft außerhalb des menschlichen Körpers überlebte, ist dieses neue Virus aus der Blutprobe des jungen Patienten Vogel immer noch aktiv, auch wenn schon Stunden vergangen sind.
In Kröns Fantasie entstehen Horrorvisionen.
Er zwingt seinen Verstand zur Intervention. Bevor eine definitive Feststellung möglich ist, müssen Tausende von Versuchen durchgemessen werden. Aber er hat jetzt schon fast vierzig Proben analysiert, und noch immer kein abweichendes Ergebnis. Krön verfällt ins Grübeln und gibt noch einige zusätzliche Daten in den Rechner ein, doch das erzeugt keine plausiblen Modelle. Krön betrachtet heimlich die Gummihandschuhe, die er vorhin beim Versuch getragen hat. Nein, sie haben keinen Riss. Gott sei Dank! Vorsichtig trägt er die verbliebenen Proben zurück und stellt sie an ihren Platz, dann nimmt er sich die wenigen Kulturen, die er über Stunden, bei minus fünf Grad, aufbewahrt hat, und beginnt sie zu messen. Später kommen die Proben an die Reihe, die bei fünfzig Grad Celsius Hitze gelagert worden sind. Und es wird vier Uhr in der Früh, als Krön glücklicherweise eingeben kann, dass die Temperaturresistenz des Virus zwischen minus fünf und plus fünfzig Grad Celsius zu liegen scheint – scheint, wohlgemerkt.
Er macht eine kleine Pause, geht aufs Klo, wäscht sich lange und sorgfältig die Hände, setzt sich endlich auf die Toilettenbrille, starrt durch die offenen Türen hinaus auf den neonbeleuchteten Flur und erleichtert sich dröhnend, wobei er die Konsequenzen aus seinen Untersuchungen im ermüdeten Gehirn zusammenzuaddieren versucht. Als er fertig ist, wäscht er sich wieder fast zehn Minuten lang die Finger, wie er es früher getan hat, bevor er in den OP ging. Dabei kreisen die Gedanken erneut um das »was tun«. Dann hat er eine Idee, rennt im Dauerlauf den Flur hinunter, die Schritte knallen über den Bodenbelag, er spurtet in sein Zimmer, kramt sein privates Telefonverzeichnis aus der Schreibtischschublade, schlägt bei »Sch« nach. Da ist er, Schummberger. Die Geschäftsnummer im Innenministerium interessiert nicht, aber dort, mit einem kleinen p markiert, die private. Beim Wählen blickt Krön auf die Uhr. Halb fünf. Immerhin besteht die Chance, dass Schummberger ein extremer Frühaufsteher ist.
Krön wartet darauf, dass jemand abhebt. Er schaut noch einmal in seine Notizen. Ja, die Nummer stimmt. Er hat sich auch nicht verwählt. Freizeichen um Freizeichen. Endlich knackt es, am anderen Ende brummt eine Stimme: »Ja.« Krön ist ruhig, gelassen, es geht jetzt um die Sache. Und aus dem Alter, in dem man vor Autoritäten, besonders politischen, Respekt hat, ist er längst heraus.
»Krön, Virologisches Institut, Herr Schummberger?«
»Ja.« Das klingt mürrisch und verschlafen. Der Name Krön signalisiert allerdings Wichtigkeit, sodass der Angerufene nicht gleich wieder auflegt.
»Sind Sie schon wach?«, fragt Krön fast einfältig. Schummberger schweigt, also fährt der Professor fort: »Wir haben hier einen Fall, serumpositiv, ein Bluter. Ich habe das Virus isoliert. Es passt in keine bisher bekannte Kategorie.«
Es klingt ächzend und unendlich träge, als Schummberger antwortet: »Ich habe etwas eingenommen, ich schlafe, ich bin nicht, ja sagen wir, ich bin nicht verhandlungsfähig. Geht’s nicht auch morgen früh?«
Nun gewinnt Kröns Stimme jene Kälte, die seine wissenschaftlichen Assistenten gelegentlich fürchten lernen. Er sagt: »Ich hatte noch nicht das Vergnügen zu schlafen, Herr Staatssekretär. Wir haben hier einen Fall, der auch die Verwaltung angeht, nicht nur die Wissenschaft. Es besteht, wie man heute so schön in politischen Worthülsen sagt: Handlungsbedarf. Wie viel Zeit zum Schlafen brauchen Sie noch?«
Eine Pause entsteht. Plötzlich ist der Staatssekretär Dr. Schummberger da, hellwach, wie in einer Kabinettssitzung. Er fragt: »Was passiert in den nächsten drei Stunden? Es ist vier Uhr achtundvierzig.«
»Ich weiß es nicht, niemand kann das sagen«, kommt das abgewogene Urteil eines Forschers, aus dem der Jurist Schummberger sofort Konsequenzen zieht. Er spricht schnell:
»Ich habe vor acht Uhr die Möglichkeit, Sie zu sehen. Wo?«
Doch Krön lässt sich nicht ohne Weiteres in das Ritual der Terminabsprache einwickeln.
»Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich nicht die Verantwortung übernehmen kann, wenn es Zeitverzug gibt.«
»Verstanden«, sagt Schummberger, »wo treffen wir uns am Morgen?«
»Hier im Labor, da kann ich Ihnen alles zeigen.«
Der Staatssekretär sagt: »Gute Nacht« und wartet nicht eine Äußerung des Professors ab. Er legt auf.
Krön lässt sich in seinen Sessel zurückfallen, gähnt lange mit weit offenem Mund und massiert sich die Stirn. Dann gibt er noch drei, vier Befehle in den Rechner ein, bevor er sich zurücklehnt, um ein wenig zu dösen.
Montag, früher Morgen
Andreas Betz hat wegen seines dicken Schädels nicht mehr schlafen können. Er ist schließlich aufgestanden und gegangen. Wie ein Tagdieb.
Nun steht er, regenumflossen, an einer Bushaltestelle, der Vandalen die Scheiben zerschlagen und die Sitze besprüht haben, und hat die Hände in der Tasche. Gesicht und Glatze sind nass. Er niest, atmet die kalte Morgenluft ein, die eher aus dem März als aus dem Juli stammen könnte, und vertritt sich die Beine. Er weiß, dass in spätestens fünf Minuten die Bedienung kommen wird, die das schräg gegenüberliegende Bistro aufschließt, um mit dem Frühstücksbetrieb zu beginnen. Hier ist Betz öfters zu Gast, wenn er nachts nicht schlafen kann, spazieren geht, um den Kopf zu klären, die Einsamkeit seines Bettes fürchtend. Sie haben sogar ein Klavier in dem Bistro, und sie erlauben stillschweigend, dass er, der passionierte Feierabendpianist, für sich vor den übriggebliebenen Nachtschwärmern, den frühen Gleitzeit Sekretärinnen, den melancholischen Säufern und den Spätheimkehrern vom Oberstufen-Internat außerhalb der Stadt spielt.
Da, dort drüben trippelt die Bedienung, den Schirm mit einer Reklameaufschrift gegen die Regenböen gestemmt. Betz sprintet hinüber zu ihr und gesellt sich schiebend und händereibend unter den Schirm. Sie lacht, als sie ihn erkennt, stößt ihm die Ellenbogen in die Seite und sagt, er sähe so abgerissen aus, als habe er die Nacht mit einer Frau zugebracht.
Betz schweigt und wartet, bis sie aufgeschlossen hat. Gemeinsam betreten sie den buchengetäfelten Raum, in dem es nach kaltem Rauch und Korken riecht. Die Bedienung schüttelt den Schirm aus und stellt ihn in die Ecke, dann beginnt sie, hinter dem Tresen zu hantieren. Geschirr klappert, die Kaffeemaschine setzt zischend zur Arbeit an. Betz erhält den Schlüssel, damit er die Zeitung aus dem Briefkasten hole. Als er wiederkommt, wirkt der Raum des Bistros schon fast heimelig, denn Kaffeedunst zieht durch die Luft. Der Bäckerjunge bringt drei große Tüten frisches Gebäck, das appetitlich duftet.
Die Bedienung ist eine nicht so ganz schlanke Studentin der Kunstgeschichte und noch sehr jung. Sie arbeitet nicht für den Luxus, sondern fürs Auskommen. Betz weiß es, weil er mit ihr schon oft an solchen kalten Morgen geredet hat. Er hätte sich durchaus vorstellen können, mit ihr etwas anzufangen, damals nach der Scheidung. Immerhin, er kann mit seinen Bezügen eine Studentin aushalten. Und sie bräuchte nicht mehr zu arbeiten, könnte in ihre Vorlesungen und Kurse gehen. Aber er weiß aus den Gesprächen, dass sie einen Freund hat, den sie stolz als »Verlobten« bezeichnet und der ihr Herz besitzt. Da hilft alles nichts, sie verlässt den Freund nicht, auch wenn ein anderer Mann ein Auskommen bieten könnte und nicht so eine arme Kirchenmaus ist wie jener Verlobte. So denkt Betz.
Die Bedienung stellt ihm einen großen Espresso auf das Klavier und hört einige Augenblicke zu, wie er voller Melancholie »Summertime« spielt. Aber er spielt es nicht für sie, sondern für seine Träume, in denen er dem Körper dieser hellhaarigen Kollegin und unwirklichen Geliebten der gerade vergangenen Nacht nachhängt. Er hat sich nach der Scheidung vorgenommen, ganz bestimmt nicht mehr an irgendeine Zukunft mit einer Frau zu denken. Aber das klappt nicht immer, und dann verspottet er sich insgeheim, sich und seinen Körper, der sich gerade anschickt, ein fünftes Jahrzehnt zu leben. Er verspottet auch seine sentimentalischen Träume von einem Verhältnis voller Zärtlichkeit und Harmonie, von gemeinsamen häuslichen Abenden zu zweit – und noch dazu mit einer Juristin. Umso inbrünstiger kommt nun das »Summertime« heraus. Und er kann singen, der Richter Betz, und, als wäre er vollgekifft, zaubern seine Träume nun heiße, sonnenbeschienene Strände vor sein Gesicht, Strände, die sich lieblich dahinschwingen und mit dem Türkis eines ruhigen Ozeans kontrastieren oder, besser zu »Summertime« passend, ein kühles, weiß lackiertes Pflanzer-Haus mit schattiger Veranda, umgeben von hohen Maulbeerbäumen, in denen Zikaden ihr monotones Lied singen. Und auf allen Ferienbildern steht Gisa mit ihrem kess frisierten Bubikopf, lächelnd, harmlos und ohne ihre Brille.
Doch »Summertime« verklingt, und an den großen Scheiben des Bistros sprenkeln graue Regentropfen. Die Bedienung bringt ein Croissant, das sie mit Schinken, Gürkchen und einem Salatblatt belegt hat.
Betz beißt hinein und sagt mit vollem Mund, dass er bald Urlaub habe.
»Wo fährst du hin?«
»Weiß noch nicht, das hängt davon ab«, brummt Betz beim Kauen.
»Nimmst du mich mit?«, fragt die Bedienung und wirft ihm ein kokettes Lächeln zu.
»Du hast doch einen Kerl.«
»Ist egal, wir müssten doch nicht miteinander bumsen, im Urlaub, wir zwei, oder?«, sagt die Bedienung und fügt hinzu, dass ihr Verlobter an seiner Diplomarbeit schreibt und diesen Sommer nicht weg kann.
»Künstlerpech«, sagt Betz und beginnt mit den Fingern auf dem Instrument an einem neuen Stück herumzuprobieren. »Ich reise nur mit Frauen, die mir sexuell hörig sind«, sagt er lachend und hat plötzlich den richtigen Ton gefunden: »Bei mir biste scheen«, er spielt die Nummer rasant herunter und kriegt wieder träumerische Augen.
Andreas Betz hat tatsächlich einen kurzen Gedanken daran verschwendet, an diesem Morgen nach sieben ins Gericht zu gehen und die Arbeit aufzunehmen, dabei die Ruhe zu genießen, die das öde Haus ausstrahlt. Doch dieses alte Gerichtsgebäude ist in der Frühe noch unbehaglicher als am Tage, zu kühl bei der Witterung draußen, weil amtlich Sommer ist und die Heizung abgestellt bleibt. Und außerdem erklärt man einen Richter für verrückt, der morgens vor zehn Uhr erscheint. Nur ein oder zwei Halbtags-Richterinnen treiben sich zu dieser Stunde in den Amtsstuben und auf den Gängen herum, weil sie nur anwesend sind, solange die Kinder in der Schule sitzen.
Betz, von den Kollegen nicht so sehr wegen seiner Arbeitsfreude und seines Einsatzes jedoch wegen der Akkuratesse seiner Arbeit und der Präzision seiner Gedankenführung geschätzt, entschließt sich ohne langes Ringen, zumal am Tag nach seinem Geburtstag, keinen Anlass für falsche Eindrücke zu geben und dem Gericht fernzubleiben – heute vielleicht sogar bis elf.
Er hat das Frühstück bezahlt, die Pause zwischen zwei Schauern abgewartet und ist mit eingezogenem Genick davongegangen, die Bedienung in einer Flaute des Morgengeschäfts zurücklassend, diese mit den Gedanken beschäftigt, ob es zu auffällig wäre, mit einem solchen alten Kerl – eigentlich ist er ja noch nicht wirklich alt – irgendwo am Meer aufzutauchen, und wenn es Nacht ist, ob er dann zudringlich wird und ob es was ausmacht, wenn das passiert …
Betz wird unterdessen von einer Bö in eine Ladenpassage gejagt, die noch ruht. Er geht versonnen an den Fenstern entlang, prüft sein leicht über die Schaufensterscheiben dahinschwebendes Spiegelbild in Gang, Haltung und Ausdruck. Er strafft sich, die Krümmung in seinem Rücken verschwindet. Um ihn herum hasten frühe Angestellte, meist Tippfräulein und Verkäuferinnen, zu Schreibtisch und Tresen, stöckeln zwei und zwei nebeneinander her, flüchtig geschminkt. Oft sind sie grau im Gesicht von der vergangenen Nacht, Geheimnisse sich zutuschelnd. Betz genießt den frühen Tag in der Stadt, diesen Aufbruch ins Neue; er beschließt sogar, gelegentlich wieder einmal früher aufzustehen, um diese Stimmung einzufangen.
Er tritt hinaus in die Regenschleier unter die Bäume einer Allee. Von einer nahen Brauerei stinkt es nach Malz, dazwischen weht der Geruch nasser Blätter. Straßenbahnen rattern, Hupen bellen, regenglänzende Autos bewegen sich im Takt, den die Ampeln schlagen. Betz kauft sich eine Zeitung, ein Blatt, das er sonst nicht bezieht, und liest es unter einem Vordach stehend, ganz in der Nähe einer Haltestelle, von der er weiß, dass von hier aus ein Bus in die Nähe seiner Wohnung fährt. Es kommen auch kurz hintereinander zwei dieser modernen, mit Werbung bunt lackierten Ungetüme herangeglitten. Einer von beiden trägt die falsche Nummer, und der andere ist gestopft voll. Er hält nicht und fährt einfach vorbei.
Gerade als Betz erwägt, die für einen Richter nicht unbeträchtliche Ausgabe für ein Taxi in Kauf zu nehmen, rollt der nächste Linienbus heran, scheinbar genauso voll wie der andere, doch er hält, die Türen geben zischend den Eingang frei, und Betz drängt sich zwischen die Wartenden hinein in einen Brodem von Rasierwasser, Deodorant, frühem Schweiß und nassem Stoff. Die Fenster sind beschlagen, die Körper der Passagiere dicht aneinandergedrängt, man hört leise Gespräche. Zeitungen stehen wie kleine Segel auf dem Meer der Köpfe.
Betz fährt seine sieben, acht Haltestellen, gerät dabei durch neu zu- und aussteigende Fahrgäste fast auf die andere Seite des Busses, von der er sich, Entschuldigungen murmelnd, durch die Menge schiebt, um erleichtert auszusteigen und die paar Schritte zu dem Haus, wo er wohnt, hinüberzutraben. Er beschließt, sofern er Orangensaft zu Hause hat, ein großes Glas zu trinken, vielleicht einen Schuss Wodka hineinzugeben, sich ins Bett zu legen, zuzudecken bis unters Kinn und die Zeitung zu lesen, die vom Regen angeweicht unter seinem Arm klemmt, und dann noch zu schlafen, bevor er ins Gericht geht.
Er eilt dem Haus entgegen, das mit seiner gelbbraunen, von halb abgeschlagenen Schmuckelementen überladenen Fassade schmutzig zwischen zwei Neubauten mit jungen Gesichtern steht. Man findet solche knorrigen Gesellen unter den Gebäuden heute gemütlich und erhaltenswert; hinter den zugigen, nicht mehr abdichtbaren Fenstern dieses Exemplars freilich wohnen noch nicht die arrivierten Freiberufler und hohen Beamten, die Ehepaare mit Doppeleinkommen. Die Sanierung kommt erst noch. Betz hat die hundertzwanzig Quadratmeter große Beletage gemietet, die Wohnungen über ihm stehen bereits leer, bis auf das Dachgeschoss mit alten Dienstbotenkammern, in denen Studenten hausen, meist emsige junge Leute, die, wenn sie ihm auf der Treppe begegnen, höflich grüßen.
Gerade als Betz mit den Händen seine Taschen abklopft, um den gewichtigen Schlüssel für die Eingangstür zu finden, geht der eine Flügel des wettergezeichneten Eichenportals auf, der Bewohner der Erdgeschosswohnung, ein gewisser Jonason, tritt Betz entgegen.
»Ei, ei, der Herr Amtsgerichtsrat«, sagt er mit einer merkwürdig brüchigen, hohen Stimme. Es klingt ironisch, weil Jonasons Gesicht wegen der mächtigen roten Narbe zu lächeln scheint und er den Kopf schräg trägt. Betz weiß, dass diese Anrede höflich gemeint ist. Seinesgleichen waren früher tatsächlich »Rat«, auch wenn es in seinem Metier nichts zu raten, nur zu entscheiden gibt.