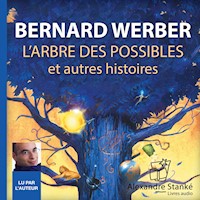3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Revolution von unten
Unterhalb von Paris lebt eine gigantische Kolonie Roter Waldameisen, deren kollektive Intelligenz von Edmondo Wells, einem genialen Wissenschaftler, so gesteigert wurde, dass sie derjenigen der Menschen gleichkommt. Als Edmondo stirbt und sein Haus inklusive der Kolonie seinem Neffen Jonathan vermacht, löst dieser nichts ahnend einen Krieg aus: Er vernichtet eines der Ameisennester im Keller. Die Insekten schlagen zurück und nehmen Jonathan und einige Mitglieder seiner Familie gefangen, um mehr über ihre Feinde zu erfahren. Die Königin plant einen Rache- und Vernichtungsfeldzug gegen die allein durch ihre Größe schier übermächtigen Menschen. Doch der Kontakt zwischen Ameisen und Menschen fördert mehr als nur Hass zwischen den Spezies: Ein Teil der Kolonie beginnt, die Menschen als Götter zu verehren. Eine davon ist Ameise 103 683. Als sie auf die Studentin und Musikerin Julie Pinson trifft und deren Musik hört, verändert sich nicht nur die Sicht dieser einen Ameise auf die Welt, sondern sie löst eine wahre Revolution aus – der sich die Königin mit aller Macht entgegenstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 883
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Unterhalb von Paris lebt eine gigantische Kolonie Roter Waldameisen, deren kollektive Intelligenz von Edmondo Wells, einem genialen Wissenschaftler, so gesteigert wurde, dass sie derjenigen der Menschen gleichkommt. Als Edmondo stirbt und sein Haus inklusive der Kolonie seinem Neffen Jonathan vermacht, löst dieser nichts ahnend einen Krieg aus: Er vernichtet eines der Ameisennester im Keller. Die Insekten schlagen zurück und nehmen Jonathan und einige Mitglieder seiner Familie gefangen, um mehr über ihre Feinde zu erfahren. Die Königin plant einen Rache- und Vernichtungsfeldzug gegen die allein durch ihre Größe schier übermächtigen Menschen. Doch der Kontakt zwischen Ameisen und Menschen fördert mehr als nur Hass zwischen den Spezies: Ein Teil der Kolonie beginnt, die Menschen als Götter zu verehren. Eine davon ist Ameise 103 683. Als sie auf die Studentin und Musikerin Julie Pinson trifft und deren Musik hört, verändert sich nicht nur die Sicht dieser einen Ameise auf die Welt, sondern sie löst eine wahre Revolution aus – der sich die Königin mit aller Macht entgegenstellt.
Der Autor
Bernard Werber, geboren 1962 in Toulouse, begann bereits im Alter von 14 Jahren, Geschichten für Fanmagazine zu schreiben. Er studierte Kriminologie und Journalismus und arbeitete danach zehn Jahre lang als Wissenschaftsjournalist für den Nouvel Observateur. Mit seinem Debütroman »Die Ameisen« gelang ihm auf Anhieb ein weltweiter Erfolg: das Buch wurde von Publikum und Presse gleichermaßen gefeiert, verkaufte sich über zwei Millionen Mal und wurde mit dem Prix des lecteurs de Science et Avenir ausgezeichnet. Die beiden Fortsetzungen, »Der Tag der Ameisen« und »Die Revolution der Ameisen«, waren nicht minder erfolgreich. Bernard Werber lebt und arbeitet in Paris.
BERNARD WERBER
Die Revolution der Ameisen
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der Originalausgabe
LA RÉVOLUTION DES FOURMIS
Aus dem Französischen von Alexandra von Reinhardt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1996 by Bernard Werber
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-24130-8V002
www.penguinrandomhouse.de
Für Jonathan
(zumindest hoffe ich das von ganzem Herzen)
EDMOND WELLS
Enzyklopädie des relativen und absoluten Wissens, Bd. 3
ERSTES SPIEL
HERZ
1. Ende
Die Hand hat das Buch aufgeschlagen.
Die Augen wandern von links nach rechts und dann, sobald sie am Ende einer Zeile angelangt sind, nach unten.
Die Augen weiten sich.
Nach und nach ergeben die vom Gehirn ausgewerteten Wörter ein Bild, ein riesiges Bild.
Hinten im Schädel leuchtet der breite innere Panoramabildschirm des Gehirns auf. Das ist der Anfang.
Das erste Bild zeigt …
2. Waldspaziergang
… das riesige Weltall, meerblau und eiskalt.
Richten wir unseren Blick auf eine Region, die mit unzähligen bunten Galaxien übersät ist.
Am Rand einer dieser Galaxien: eine alte, gleißende Sonne.
Stellen wir das Bild noch etwas schärfer ein.
Um diese Sonne kreist ein kleiner, warmer Planet, marmoriert mit perlmuttfarbenen Wolken.
Unter diesen Wolken: violette Ozeane, gesäumt von ockerfarbenen Kontinenten.
Auf diesen Kontinenten: Bergketten, Ebenen, riesige grüne Wälder.
Unter dem Geäst der Bäume: Tausende von Tierarten, darunter zwei besonders weit entwickelte.
Schritte.
Jemand ging durch den Frühlingswald.
Es war ein junges Menschenkind mit langem, glattem schwarzem Haar. Das Mädchen trug eine schwarze Jacke und einen langen Rock von derselben Farbe. Komplizierte reliefartige Muster zeichneten die hellgraue Iris der Augen.
Beschwingt lief sie durch den frühen Märzmorgen. Ihre Brust erzitterte unter der Bewegung.
Auf ihrer Stirn und über dem Mund perlten Schweißtropfen, die sie rasch einsog, sobald sie ihr in die Mundwinkel liefen.
Das junge Mädchen mit den hellgrauen Augen hieß Julie und war neunzehn Jahre alt. Sie streifte mit ihrem Vater Gaston und ihrem Hund Achille durch den Wald. Plötzlich blieb sie abrupt stehen. Vor ihr ragte ein Granitfelsen wie ein riesiger Finger über einer Schlucht auf.
Sie trat bis zur Felsspitze vor.
Unterhalb schien ein Weg zu verlaufen, der abseits der ausgetretenen Pfade zu einem kleinen Tal führte.
Julie legte ihre Hände trichterförmig vor den Mund. »He, Papa, ich glaube, ich habe einen neuen Weg entdeckt! Komm her!«
3. Verkettung
Sie läuft geradeaus, rast den Abhang hinunter, weicht den Pappelschösslingen aus, die wie purpurrote Spindeln um sie herum emporragen.
Flügelschlagen. Schmetterlinge entfalten ihre schillernden Flügel und jagen einander in der Luft.
Ein hübsches Blatt zieht ihren Blick auf sich, ein köstliches Blatt von der Sorte, die einen alle Vorhaben vergessen lässt. Sie weicht von ihrem Weg ab, nähert sich.
Ein wunderbares Blatt! Man braucht es bloß viereckig zurechtschneiden, ein bisschen zu zermahlen und einzuspeicheln, damit es in Gärung übergeht und eine kleine weiße Kugel voll süß duftender Myzelien ergibt. Mit ihren Mandibeln trennt die alte rote Waldameise den Stiel ab und wuchtet das Blatt wie ein riesiges Segel über ihren Kopf.
Bedauerlicherweise kennt sich das Insekt nicht mit den Gesetzen des Segelns aus. Kaum ist das Blatt gehisst, fängt es den Wind. Trotz ihrer Kraft ist die alte rote Ameise als Gegengewicht viel zu leicht. Sie gerät aus dem Gleichgewicht und ins Schwanken. Mit allen Beinen klammert sie sich an den Ast, aber die Brise ist viel zu stark. Die Ameise wird fortgerissen und hebt ab.
Sie lässt ihre Beute gerade noch rechtzeitig los, bevor die Höhe bedrohlich werden könnte.
Das Blatt schwebt träge nach unten.
Die alte Ameise beobachtet es und sagt sich: Nicht weiter schlimm, es gibt genügend andere, kleinere Blätter.
Das Blatt kreiselt sehr lange, bis es sanft auf dem Boden landet.
Eine Nacktschnecke bemerkt das hübsche Pappelblatt. Welch leckerer Schmaus in Aussicht!
Eine Eidechse sieht die Schnecke und will sie verschlingen, da entdeckt auch sie das Blatt. Lieber warten, bis die Schnecke es sich einverleibt hat, dann wird sie noch saftiger sein. Sie belauert die Mahlzeit aus der Ferne.
Ein Wiesel wird auf die Eidechse aufmerksam und macht sich bereit, sie zu fressen, als es bemerkt, dass diese darauf zu warten scheint, bis die Schnecke das Blatt verzehrt. Es beschließt, sich ebenfalls zu gedulden. Drei Lebewesen, die einander ökologisch ergänzen, harren geduldig aus.
Plötzlich sieht die Schnecke, dass eine andere Schnecke angekrochen kommt. Ob die ihr den Schatz rauben will? Ohne Zeit zu vergeuden, macht sie sich über das verlockende Blatt her und verschlingt es bis zur letzten Faser.
Kaum hat sie ihre Mahlzeit beendet, stürzt sich die Eidechse auf sie und saugt sie wie eine Nudel auf. Jetzt ist der Augenblick für das Wiesel gekommen, einen Satz zu machen und sich die Eidechse zu schnappen. Es läuft los, springt über die Wurzeln, stößt aber unvermutet gegen etwas Weiches …
4. Ein neuer Weg
Das junge Mädchen mit den hellgrauen Augen sah das Wiesel nicht kommen. Es sprang plötzlich aus einem Dickicht und prallte gegen ihre Beine.
Vor Schreck glitt ihr Fuß über den Rand des Granitfelsens. Aus dem Gleichgewicht gebracht, sah sie den gähnenden Abgrund unter sich. Nicht fallen, bloß nicht fallen!
Sie ruderte wild mit den Armen. Die Zeit schien stillzustehen.
Würde sie abstürzen oder nicht?
Einen Augenblick lang glaubte sie, es schaffen zu können, aber eine leichte Brise griff in ihre langen schwarzen Haare und verwandelte sie in ein zerzaustes Segel.
Alles verschwor sich gegen sie. Der Wind blies. Ihr Fuß rutschte noch ein Stück weiter ab. Der Boden gab nach. Sie riss ihre hellgrauen Augen weit auf. Ihre Pupillen weiteten sich. Die Wimpern flatterten.
Es gab kein Halten mehr. Sie stürzte in die Schlucht. Beim Fallen bedeckten die langen schwarzen Haare ihr Gesicht, als wollten sie es schützen.
Sie versuchte sich an den wenigen Pflanzen festzuklammern, die auf dem Steilhang wuchsen, aber sie boten keinen Halt, und Julies Hoffnungen schwanden, denn ihre Finger vermochten nur Blüten abzureißen. Sie rollte über Kieselsteine, verbrannte sich an einem Vorhang aus Brennnesseln, riss sich die Hände an einem Dornbusch blutig und schlitterte in ein Feld von Farnen, wo sie ihren Sturz zu beenden hoffte. Doch leider verbarg sich hinter den großen Wedeln ein zweiter, noch steilerer Abgrund. Sie verletzte sich an dem Gestein. Auch ein zweites Farndickicht erwies sich als trügerisch. Immer weiter ging es abwärts. Insgesamt durchbrach sie sieben Pflanzenvorhänge, zerkratzte sich an wilden Himbeersträuchern und wirbelte Sträuße von Gänseblümchen durcheinander. Ihr Fuß stieß gegen einen spitzen Felsen, und stechender Schmerz zuckte in ihrer Ferse. Endlich landete sie in dem klebrig-braunen Schlamm einer Pfütze.
Sie setzte sich auf, rappelte sich mühsam hoch und wischte sich mit Pflanzenwedeln ab. Ihre Kleider, ihr Gesicht, ihre Haare – alles war mit bräunlichem Morast überzogen. Er war ihr sogar in den Mund geraten und schmeckte bitter.
Während sie ihren schmerzenden Fuß massierte und sich von dem Schreck zu erholen versuchte, glitt etwas Kaltes und Schleimiges über ihr Handgelenk. Sie zuckte zusammen. Eine Schlange! Sie war in ein Schlangennest gefallen: Da waren sie und krochen auf sie zu.
Sie stieß einen gellenden Schrei aus.
Schlangen haben zwar kein Gehör, können aber mit ihrer überaus empfindlichen Zunge Luftschwingungen wahrnehmen. Dieser Schrei kam für sie einer Explosion gleich. Verängstigt flohen sie in alle Richtungen. Besorgte Mutterschlangen legten sich schützend um ihre Nachkommen, indem sie ein zuckendes S bildeten.
Julie fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, schob eine lästige Haarsträhne beiseite, die ihr in die Augen hing, spuckte die bittere Erde aus und versuchte, den Abhang zu erklimmen, aber er war zu steil, und ihre Ferse schmerzte. Sie gab es auf, setzte sich wieder hin und rief: »Hilfe, Papa, Hilfe! Ich bin hier unten. Hilf mir! Hilfe!«
Sie schrie sich heiser. Vergebens. Allein und verletzt saß sie auf dem Grund einer Schlucht, und ihr Vater unternahm nichts. Ob er sich ebenfalls verirrt hatte? Wer würde sie dann hier tief im Wald finden, unter so dichtem Farngestrüpp?
Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Wie sollte sie nur aus dieser Falle herauskommen?
Julie wischte sich die Schlammspritzer von der Stirn und blickte um sich. Rechts, am Rand des Grabens, sah sie einen dunkleren Bereich im hohen Gras. Mühsam humpelte sie dorthin. Disteln und Zichorien verdeckten den Eingang zu einer Art Erdtunnel. Sie fragte sich, welches Tier diesen Riesenbau gegraben haben mochte. Für einen Hasen, Fuchs oder Dachs war er zu groß. Bären gab es in diesem Wald nicht. Ob es vielleicht die Behausung eines Wolfs war?
Die Höhle war zwar ziemlich niedrig, aber ein mittelgroßer Mensch konnte mühelos hineinkriechen. Ihr war dabei nicht ganz geheuer, aber sie hoffte, dass es irgendwo einen zweiten Ausgang gab. Deshalb kroch sie auf allen vieren in den Lössstollen.
Sie tastete sich voran. Der Tunnel wurde immer dunkler und kälter. Unter ihrer Hand lief etwas Stachliges davon. Ein ängstlicher Igel hatte sich zur Kugel zusammengerollt, ehe er in die Gegenrichtung flüchtete. In völliger Dunkelheit robbte sie weiter, mit gesenktem Kopf, auf Ellbogen und Knien. Sie hatte einst sehr lange gebraucht, um laufen zu lernen. Während die meisten Kinder schon mit einem Jahr dazu imstande sind, hatte sie sich achtzehn Monate Zeit gelassen. Der aufrechte Gang war ihr gefährlich vorgekommen. Auf allen vieren fühlte sie sich wesentlich sicherer. Man sah alles, was auf dem Boden herumlag, aus größerer Nähe, und wenn man hinfiel, war es kein Sturz. Gern hätte sie den Rest ihres Lebens auf dem Teppichboden verbracht, wenn ihre Mutter und die Kindermädchen sie nicht gezwungen hätten, aufrecht zu gehen.
Dieser Stollen nahm überhaupt kein Ende. Um sich Mut zu machen, zwang sie sich, ein Liedchen zu trällern:
Eine grüne Maus
lief durchs grüne Gras.
Wir packen sie am Schwanz,
zeigen sie den Leuten.
Sagen uns die Leute:
Taucht sie doch in Öl,
taucht sie dann in Wasser,
und schon habt ihr
eine schöne warme Schnecke!
Sie sang das Lied viermal hintereinander, immer lauter. Ihr Gesangslehrer, Professor Jankelewitsch, hatte ihr beigebracht, sich in die Vibrationen ihrer Stimme wie in einen schützenden Kokon einzuhüllen. Aber hier war es zu kalt, um sich die Kehle aus dem Hals zu schreien. Vor ihrem eisigen Mund bildeten sich Dampfwolken, und schließlich verklang das Liedchen in einem heiseren Räuspern.
Wie ein dickköpfiges Kind, das eine Dummheit zu Ende führen will, dachte Julie nicht daran umzukehren. Sie kroch unter der Oberhaut des Planeten immer weiter voran.
In der Ferne glaubte sie ein schwaches Licht zu sehen.
Erschöpft nahm sie an, dass es sich um eine Halluzination handle, doch dann spaltete sich das Licht in viele winzige gelbe Punkte auf, von denen manche blinkten.
Das junge Mädchen stellte sich einen Moment lang vor, in dieser Höhle seien Diamanten verborgen, doch als sie näher herankam, erkannte sie Leuchtkäfer, die auf einem Würfel saßen.
Ein Würfel?
Sie streckte die Finger aus, und sofort erloschen die Leuchtkäfer und verschwanden. In dieser totalen Finsternis konnte Julie sich nicht auf ihre Augen verlassen. Sie musste sich ausschließlich ihres Tastsinns bedienen. Der Würfel war glatt. Er war hart und kalt. Es war weder ein Stein noch ein Felsbrocken. Ein Griff, ein Schloss … dieser Gegenstand war von Menschenhand geschaffen.
Ein kleiner, würfelförmiger Koffer.
Mit letzter Kraft kroch sie aus dem Tunnel zurück ins Freie. Fröhliches Bellen von oben verkündete ihr, dass ihr Hund und ihr Vater sie gefunden hatten. Mit einer Stimme, die wegen der Entfernung sehr gedämpft klang, rief er: »Julie, bist du da unten, mein Mädchen? Antworte bitte, gib mir ein Zeichen!«
5. Ein Zeichen
Sie vollführt mit dem Kopf eine Dreiecksbewegung. Das Pappelblatt zerreißt. Die alte rote Ameise nimmt sich ein anderes und verspeist es unter dem Baum, ohne es lang gären zu lassen. Die Mahlzeit schmeckt zwar fade, ist aber wenigstens nahrhaft. Pappellaub gehört nicht zu ihren Lieblingsgerichten, sie bevorzugt Fleisch, aber da sie seit ihrer Flucht noch nichts gegessen hat, kann sie jetzt nicht wählerisch sein.
Nach beendetem Mahl vergisst sie nicht, sich zu säubern. Mit dem Ende eines Beins packt sie ihre lange rechte Antenne und biegt sie bis zu ihren Lippen herunter. Dann schiebt sie sie unter den Mandibeln hindurch bis zur Mundöffnung und saugt an ihr, um sie zu reinigen.
Sobald beide Antennen mit Speichelschaum überzogen sind, poliert sie sie in der kleinen borstigen Ritze unterhalb ihrer Beine.
Die alte rote Ameise dehnt die Gelenke ihres Unterleibs, ihres Oberleibs und ihres Halses, bis zur Grenze des Möglichen. Dann säubert sie mit ihren Beinen die Facettenaugen. Ameisen haben keine Lider, die ihre Augen schützen und feucht halten könnten. Wenn sie nicht dauernd daran denken, ihre Linsen zu pflegen, sehen sie bald nur noch verschwommen.
Je sauberer die Facetten werden, desto besser erkennt sie, was sie vor sich hat. Halt, da ist etwas! Es ist groß, sogar riesig, es ist voller Stacheln, und es bewegt sich.
Vorsicht – Gefahr! Aus einer Höhle kommt ein mächtiger Igel.
Nichts wie weg! Der Igel, eine imposante Kugel voll spitzer Pfeile, greift sie mit weit aufgerissenem Maul an.
6. Begegnung mit einem erstaunlichen Menschen
Sie war am ganzen Körper zerkratzt. Instinktiv reinigte sie die tiefsten Verletzungen mit ein wenig Speichel. Humpelnd trug sie den würfelförmigen Koffer in ihr Zimmer und setzte sich aufs Bett. Von links nach rechts hingen über ihr an der Wand Poster von der Callas, von Che Guevara, den Doors und Attila, dem Hunnen.
Mühsam stand Julie wieder auf und ging ins Bad. Sie duschte heiß und rieb sich kräftig mit ihrer Lavendelseife ab. Dann hüllte sie sich in ein großes Handtuch, schlüpfte in Badeschlappen und fing an, ihre schwarzen Kleider von den lehmfarbenen Erdklumpen zu reinigen.
Ihre Schuhe konnte sie nicht mehr anziehen, denn ihre Ferse war dick angeschwollen. Sie holte ein altes Paar Sommersandalen aus dem Schrank, deren Riemen nicht auf die Ferse drückten und ihren Zehen Platz ließen. Julie hatte nämlich kleine, aber sehr breite Füße. Die große Mehrheit der Fabrikanten stellte für Frauen nur schmales, spitzes Schuhwerk her, was leider zu vielen schmerzhaften Schwielen führte.
Erneut massierte sie sich die Ferse. Zum ersten Mal spürte sie, was sich alles in diesem Körperteil befand, so als hätten ihre Knochen, Muskeln und Sehnen nur darauf gewartet, sich durch einen Unfall bemerkbar machen zu können. Jetzt waren sie alle da und bekundeten ihre Existenz durch Schmerzsignale.
Leise sagte sie vor sich hin: »Hallo, Ferse.«
Es amüsierte sie, einen Teil ihres Körpers so zu begrüßen. Sie interessierte sich für ihre Ferse nur, weil diese wehtat. Aber wenn sie es sich genau überlegte: Wann dachte sie schon an ihre Zähne, solange sie sich nicht mit Karies meldeten? Ebenso nahm man das Vorhandensein eines Blinddarms nur im Fall einer Entzündung zur Kenntnis. In ihrem Körper musste es eine ganze Menge Organe geben, von deren Dasein sie nichts wusste, weil sie bisher nie so unhöflich gewesen waren, durch Schmerzsignale auf sich aufmerksam zu machen.
Ihr Blick fiel wieder auf den Koffer. Dieses Ding aus dem Innern der Erde faszinierte sie. Sie nahm ihn zur Hand und schüttelte ihn. Das Schloss war mit einer Zahlenkombination aus fünf Zahnrädern gesichert.
Der Koffer bestand aus dickem Metall, dem nur eine Bohrmaschine etwas anhaben könnte. Julie betrachtete das Schloss. Jedes Zahnrad war mit Ziffern und Symbolen versehen. Sie spielte auf gut Glück daran herum. Die Chance, zufällig die richtige Kombination zu finden, war vielleicht eins zu einer Million.
Erneut schüttelte sie den Koffer. Er enthielt etwas Wichtiges, einen einzigartigen Gegenstand, davon war sie überzeugt, und das Geheimnis spannte sie auf die Folter.
Ihr Vater kam mit dem Hund ins Zimmer. Er war ein großer, rothaariger Kerl und trug einen Schnurrbart. In seiner Golfhose sah er wie ein schottischer Jagdhüter aus. »Geht's dir besser?«, fragte er.
Sie nickte.
»Du bist in eine Schlucht gefallen, zu der man nur durch eine Mauer aus Brennnesseln und Dornen gelangt«, erklärte er. »Die Natur hat sie vor Neugierigen und Spaziergängern geschützt. Sie ist nicht einmal auf der Karte eingezeichnet. Zum Glück hat Achille dich gewittert. Was wären wir ohne Hunde!«
Er tätschelte liebevoll seinen Irish Setter, der zum Dank einen silbrigen Speichelfaden auf das Hosenbein tropfen ließ und freudig japste.
»Was für eine Geschichte!«, fuhr Gaston fort. »Merkwürdig, dieses Zahlenschloss. Vielleicht ist es eine Art Tresor, den Einbrecher nicht aufbekommen haben.«
Julie schüttelte ihre dunkle Mähne. »Nein.«
Ihr Vater dachte über die Sache nach. »Wenn Münzen oder Goldbarren drin wären, wäre er viel schwerer, und wenn es Geldscheine wären, würde man sie rascheln hören. Vielleicht sind es Drogen. Oder … eine Bombe.«
Julie zuckte mit den Schultern. »Oder der Kopf eines Menschen.«
»Dann hätten Jivaro-Indianer erst einen Schrumpfkopf daraus machen müssen«, wandte er ein. »Dein Köfferchen ist für einen normalen Menschenkopf viel zu klein.«
Er schaute auf die Uhr, erinnerte sich an eine wichtige Verabredung und verließ das Zimmer. Sein Hund folgte ihm schwanzwedelnd und laut hechelnd.
Wieder schüttelte Julie ihren Koffer. Sollte sich tatsächlich ein Kopf darin befinden, hatte sie ihm durch das viele Rütteln bestimmt die Nase gebrochen. Plötzlich widerte das Ding sie an, und sie beschloss, sich nicht mehr damit zu beschäftigen. In drei Monaten hatte sie Abitur, und wenn sie nicht noch ein Jahr in der letzten Klasse verbringen wollte, musste sie jetzt ihren Stoff wiederholen.
Also nahm sie ihr Geschichtsbuch heraus und fing mit der Lektüre an. 1789. Die Französische Revolution. Der Sturm auf die Bastille. Chaos. Anarchie. Die Größen jener Zeit: Marat, Danton, Robespierre, Saint-Just. Terror. Die Guillotine …
Blut, Blut und nochmals Blut. Die Geschichte ist nur eine Aneinanderreihung von Gemetzeln, dachte sie und klebte sich ein Pflaster auf eine Abschürfung, die wieder blutete. Je weiter sie las, desto deprimierter fühlte sie sich. Die Guillotine erinnerte sie an den Kopf im Koffer.
Fünf Minuten später machte sie sich mit einem großen Schraubenzieher über das Schloss her. Der Koffer ließ sich nicht knacken, nicht einmal, als sie mit einem Hammer auf den Schraubenzieher klopfte, um die Hebelwirkung zu verstärken. Ich bräuchte eine Brechstange, dachte sie, und dann: Verdammt, ich schaffe das nie!
Sie nahm sich wieder ihr Geschichtsbuch und die Französische Revolution vor. Der Volksgerichtshof. Der Konvent. Die Hymne von Rouget de Lisle. Die blau-weiß-rote Fahne. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der Bürgerkrieg. Mirabeau. Chénier. Der Prozess gegen den König. Und immer wieder die Guillotine … Wie sollte man sich für diese vielen Massaker erwärmen?
In einem Deckenbalken knisterte es. Eine Termite. Das rührige Insekt brachte sie auf eine Idee.
Horchen.
Sie legte ein Ohr ans Kofferschloss und drehte langsam am ersten Rädchen, bis sie ein ganz leises Klicken hörte. Das Zahnrad war eingeschnappt. Diesen Vorgang wiederholte sie noch viermal, und tatsächlich sprang das Schloss quietschend auf. Ihr empfindliches Gehör war ein besseres Werkzeug gewesen als Schraubenzieher und Hammer.
An den Türrahmen gelehnt, staunte ihr Vater: »Du hast es aufgekriegt? Wie denn?«
Julies Vater zog seine rotblonden Brauen hoch und strich sich den Schnurrbart glatt: »So bist du doch draufgekommen, stimmt's?«
Julie betrachtete ihn mit einem spöttischen Leuchten in ihren hellgrauen Augen. Ihr Vater mochte es nicht, wenn man sich über ihn lustig machte, sagte aber nichts. Sie lächelte. »Nein.«
Dann drückte sie auf den Verschluss, und der Deckel des würfelförmigen Koffers sprang auf.
Vater und Tochter beugten sich darüber.
Mit ihren zerkratzten Händen holte Julie den Gegenstand heraus und hielt ihn unter die eingeschaltete Schreibtischlampe.
Es war ein Buch. Eine dicke Schwarte, aus der an manchen Stellen eingeklebte Zeitungsausschnitte ragten. In kalligraphischen großen Lettern stand ein Titel auf dem Umschlag:
Enzyklopädie des relativen und absoluten Wissens
von Professor Edmond Wells
»Komischer Titel«, knurrte Gaston. »Dinge sind entweder relativ oder absolut. Sie können nicht beides zugleich sein. Das ist ein Widerspruch.«
Darunter stand in kleinerer Schrift:
Bd. 3
Und wieder darunter war eine Zeichnung: ein Kreis um ein Dreieck, dessen Spitze nach oben wies, und darin ein Ypsilon. Wenn man genauer hinschaute, sah man, dass das Ypsilon aus drei Ameisen bestand, die sich mit ihren Fühlern berührten. Die linke Ameise war schwarz, die rechte weiß, und die mittlere, die den Stamm des Ypsilons bildete, war halb weiß und halb schwarz.
»Sieht wie ein altes Zauberbuch aus«, murmelte Gaston. Dagegen glaubte Julie, als sie den glänzenden Einband betrachtete, dass es ganz neu sei. Sie strich zärtlich darüber. Er fühlte sich glatt und zart an.
Sie schlug die erste Seite auf und las.
7. Enzyklopädie
Guten Tag: Guten Tag, unbekannter Leser.
Zum dritten Mal guten Tag oder auch zum ersten Mal. Ehrlich gesagt, ob Sie dieses Buch als Erstes oder als Letztes entdecken, spielt überhaupt keine Rolle.
Dieses Buch ist eine Waffe, um die Welt zu verändern.
Nein, lächeln Sie nicht. Das ist möglich. Sie können es. Jemand braucht etwas nur wirklich zu wollen, damit es wahr wird. Eine winzige Ursache kann eine große Wirkung zeitigen. Es heißt, der Flügelschlag eines Schmetterlings in Honolulu genüge, um in Kalifornien einen Taifun zu entfesseln. Und Ihr Atem ist doch stärker als der Flügelschlag eines Schmetterlings, oder?
Ich bin tot. Leider kann ich Ihnen deshalb nur indirekt helfen, mit diesem Buch.
Ich schlage Ihnen vor, eine Revolution anzuzetteln. Oder vielleicht sollte ich lieber sagen: eine »Evolution«. Denn unsere Revolution braucht weder so gewaltsam noch so spektakulär wie die früheren Revolutionen zu sein.
Ich stelle sie mir eher als geistige Revolution vor. Eine Revolution der Ameisen. Unauffällig. Gewaltlos. Eine Reihe kleiner Veränderungen, die man für unbedeutend halten könnte, die aber zusammengenommen schließlich Berge versetzen.
Ich glaube, dass frühere Revolutionen sich durch Ungeduld und Intoleranz versündigten. Auch die Utopisten planten nur kurzfristig voraus, weil sie um jeden Preis noch zu ihren Lebzeiten die Früchte ihrer Arbeit sehen wollten.
Man muss aber lernen zu säen, damit andere später und andernorts ernten können.
Reden wir darüber. Während unseres Dialogs steht es Ihnen frei, mir zuzuhören oder wegzuhören. (Dem Kofferschloss haben Sie bereits gelauscht, das ist also ein Beweis, dass Sie zuhören können, nicht wahr?)
Möglicherweise irre ich mich. Ich bin kein Meisterdenker, auch kein Guru oder Heiliger. Ich bin ein Mensch, der sich dessen bewusst ist, dass das Abenteuer der Menschheit erst ganz am Anfang steht. Noch sind wir prähistorische Individuen. Unsere Unkenntnis ist grenzenlos, und es gilt noch fast alles zu erfinden.
Es gibt so vieles zu tun … Und Sie sind zu so vielen wunderbaren Dingen imstande.
Ich bin nur eine Welle, die sich mit Ihrer Welle – der Welle des Lesers – überlagert. Diese Begegnung oder Interferenz ist hochinteressant. Darum wird dieses Buch für jeden Leser anders sein. Fast so, als ob es lebendig wäre und sich Ihrer jeweiligen Bildung anpasste, Ihren jeweiligen Erinnerungen, Ihrer jeweiligen Sensibilität.
Wie werde ich mich als Buch verhalten? Ganz einfach – indem ich Ihnen einfache kleine Geschichten über Revolutionen erzähle, über Utopien, über das Verhalten von Menschen und Tieren. Dann liegt es an Ihnen, die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen, nach Antworten zu suchen, die Ihnen auf Ihrem persönlichen Weg weiterhelfen. Ich selbst habe Ihnen keine Wahrheiten zu verkünden.
Wenn Sie es wollen, wird dieses Buch lebendig. Und ich hoffe, dass es Ihnen zum Freund wird, zu einem Freund, der Ihnen helfen kann, sich selbst und die Welt zu verändern.
Wenn Sie jetzt bereit sind und es wirklich wollen, schlage ich vor, dass wir gemeinsam etwas Wichtiges tun: umblättern.
EDMOND WELLS
Enzyklopädie des relativen und absoluten Wissens, Bd. 3
8. Kurz vor dem Platzen
Daumen und Zeigefinger ihrer rechten Hand berührten die Ecke der Seite, hoben sie an und wollten umblättern, als aus der Küche die Stimme ihrer Mutter ertönte: »Das Essen ist fertig!«
Zum Lesen blieb keine Zeit mehr.
Mit ihren neunzehn Jahren war Julie sehr zierlich. Ihre glänzend schwarze Mähne fiel glatt und seidig wie ein Vorhang bis auf ihre Hüften herab. Die blasse, fast durchsichtige Haut ließ manchmal die bläulichen Adern an Händen und Schläfen durchscheinen. Die hellen, mandelförmigen Augen waren lebhaft und warm, ständig in Bewegung, so dass sie wie ein unruhiges kleines Tier wirkte. Mitunter brach jedoch ein jäher Blitzstrahl aus ihnen hervor, als ob dieser alles vernichten wollte, was ihr missfiel.
Julie hielt ihr Äußeres für unscheinbar. Darum betrachtete sie sich nie im Spiegel, benutzte nie Parfum oder Make-up, auch keinen Nagellack. Wozu auch – ihre Nägel waren sowieso immer abgekaut.
Auf Kleidung legte sie ebenfalls keinen Wert. Sie versteckte ihren Körper unter weiten, dunklen Gewändern.
Ihre Schullaufbahn war ungleichmäßig verlaufen. Bis zur letzten Klasse war sie ihren Mitschülern um ein Jahr voraus gewesen, und alle Lehrer hatten ihr intellektuelles Niveau und ihre geistige Reife gerühmt. Aber seit drei Jahren ging gar nichts mehr. Mit siebzehn war sie durchs Abitur gefallen. Mit achtzehn wieder. Jetzt, mit neunzehn, wollte sie es zum dritten Mal versuchen, obwohl ihre Noten mittelmäßiger denn je waren.
Ihr schulisches Versagen hatte mit einem bestimmten Ereignis begonnen: dem Tod ihres Gesangslehrers, eines alten, schwerhörigen Tyrannen, der mit originellen Methoden unterrichtete. Er hieß Jankelewitsch und war überzeugt, dass Julie Talent hatte und daran arbeiten sollte.
Er hatte ihr die Zwerchfell- und die Lungenatmung ebenso beigebracht wie die richtige Hals- und Schulterhaltung. All das wirkte sich nämlich auf die Qualität des Gesangs aus.
Sie hatte bei ihm bisweilen das Gefühl, ein Dudelsack zu sein, den ein Instrumentenbauer mit aller Gewalt vervollkommnen wollte. Von ihm lernte sie, wie man die Herzschläge mit der Atmung in Einklang brachte, aber er vernachlässigte auch die Arbeit am Mienenspiel nicht und lehrte sie, wie man Gesichtszüge und Mundstellung verändern musste, um eine maximale Wirkung zu erzielen.
Schülerin und Lehrer hatten sich wunderbar ergänzt. Obwohl der ergraute Lehrer fast taub war, konnte er allein durch die Beobachtung ihrer Mundbewegungen und dadurch, dass er ihr seine Hand auf den Bauch legte, die Qualität der Töne erkennen, die sie hervorbrachte. Die Schwingungen ihrer Stimme vibrierten in seinen Knochen.
»Ich bin taub? Na und! Beethoven war es auch und hat trotzdem ganz gute Arbeit geleistet«, knurrte er oft.
Er hatte Julie erklärt, dass der Gesang eine Macht besäße, die weit über Klangschönheit hinausginge. Er lehrte sie, ihre Gefühle zu modulieren, um Stress zu überwinden und allein durch ihre Stimme Ängste zu vergessen, und er lehrte sie auch, dem Gesang der Vögel zu lauschen, die einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Ausbildung leisten könnten.
Wenn Julie sang, wuchs aus ihrem Innern ein Energiestrahl wie ein Baum empor, und ihr Empfinden dabei kam der Ekstase nahe.
Der Lehrer wollte sich nicht mit seiner Taubheit abfinden und hielt sich deshalb über neue Heilverfahren auf dem Laufenden. Eines Tages gelang es einem besonders fähigen jungen Chirurgen, ihm eine elektronische Prothese in den Schädel zu implantieren, die seine Behinderung vollständig behob.
Von da an nahm der alte Gesangslehrer den Lärm der Welt wahr, die wirklichen Töne, die wirkliche Musik. Er hörte die Stimmen der Leute und die Hitparade im Radio. Er hörte Autohupen und Hundegebell, das Prasseln des Regens und das Rauschen der Bäche, das Klappern von Schritten und das Quietschen von Türen. Er hörte Niesen und Lachen, Seufzen und Schluchzen. Und überall in der Stadt hörte er ununterbrochen dröhnende Fernsehgeräte.
Der Tag seiner Heilung, der eigentlich ein Glückstag hätte sein müssen, wurde zu einem Tag der Verzweiflung. Jankelewitsch stellte fest, dass die realen Töne keineswegs dem ähnelten, was er sich vorgestellt hatte. Alles war nur Krach und Missklang, alles war schrill, plärrend, unerträglich. Die Welt war nicht voller Musik, sondern voller Lärm. Eine so große Enttäuschung konnte der alte Mann nicht verkraften. Er dachte sich einen Selbstmord aus, der seinen Idealen entsprach, stieg auf den Glockenturm der Kathedrale Notre-Dame und legte seinen Kopf unter den Klöppel. Punkt zwölf starb er, hinweggefegt von der Wucht der gewaltigen und musikalisch vollkommenen Glockenschläge.
Julie hatte durch seinen Tod nicht nur einen Freund verloren, sondern auch den Mentor, der ihr geholfen hatte, ihre größte Begabung zu entwickeln.
Gewiss, sie hatte einen anderen Gesangslehrer gefunden, einen von denen, die sich damit begnügten, ihre Schüler Tonleitern üben zu lassen. Er zwang Julie, ihre Stimme auf Register auszudehnen, die ihren Kehlkopf überforderten. Das war sehr schmerzhaft, und kurz darauf diagnostizierte ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt Knötchen an ihren Stimmbändern. Der Gesangsunterricht musste sofort abgebrochen werden, sie wurde operiert und war, während ihre Stimmbänder vernarbten, mehrere Wochen lang völlig stumm. Und danach war es ihr schwergefallen, ihre Stimme auch nur zum Sprechen zu gebrauchen.
Seither suchte sie nach einem echten Gesangslehrer, der sie anleiten könnte, so wie Jankelewitsch es getan hatte. Weil sie keinen fand, kapselte sie sich immer mehr von der Umwelt ab.
Jankelewitsch hatte immer behauptet, wenn man eine Begabung besitze und sie nicht nutze, gleiche man jenen Kaninchen, die nichts Hartes kauten: Nach und nach verlängerten sich deren Schneidezähne, würden krumm, wüchsen ohne Ende, bohrten sich durch den Gaumen und schließlich von unten nach oben ins Gehirn. Um diese Gefahr zu veranschaulichen, hatte der Lehrer bei sich zu Hause einen Kaninchenschädel stehen, bei dem die Schneidezähne oben wie zwei Hörner herausragten. Dieses makabre Ding zeigte er gern schlechten Schülern, um sie zum Arbeiten anzuhalten. Er hatte sogar mit roter Tinte auf den Schädel geschrieben:
Seine natürliche Begabung nicht zu pflegen ist die größte aller Sünden.
Da Julie ihre Begabung nun nicht mehr pflegen konnte, wurde sie zunächst sehr aggressiv und litt danach eine Zeit lang an Magersucht, gefolgt von Bulimie, wobei sie kiloweise Gebäck verschlang, mit leerem Blick, Abführ- oder Brechmittel immer griffbereit.
Sie machte keine Hausaufgaben mehr, schlief während des Unterrichts ein, hatte Probleme mit der Atmung und litt bald auch an Asthmaanfällen. Alles, was ihr das Singen Gutes gebracht hatte, wendete sich nun zum Schlechten.
Julies Mutter setzte sich als Erste an den Esstisch.
»Wo wart ihr heute?«, fragte sie.
»Wir sind im Wald spazierengegangen«, antwortete der Vater.
»Hat Julie sich dort so aufgeschürft?«
»Sie ist in eine Schlucht gefallen«, erklärte Gaston. »Zum Glück ist nicht allzu viel passiert, aber sie hat sich an der Ferse verletzt. Außerdem hat sie dort unten ein seltsames Buch gefunden …«
Die Mutter interessierte sich aber nur noch für die dampfenden Speisen auf ihrem Teller. »Das könnt ihr mir später erzählen. Essen wir schnell! Gebratene Wachteln darf man nicht warten lassen. Sie müssen heiß sein, damit sie schmecken.«
Ein gezielter Gabelstoß ließ aus der Wachtel Dampf aufsteigen, so als würde Luft aus einem Fußball entweichen. Sie packte den Vogel, saugte ihn durch die Schnabelöffnung aus, brach mit den Fingern die Flügel ab, schob sie sich zwischen die Lippen und knackte schließlich mit den Zähnen die kleinen, widerspenstigen Knochen.
»Isst du nichts? Schmeckt es dir nicht?«, fragte sie Julie.
Das Mädchen starrte den gebratenen Vogel an, der mit einem dünnen Faden zusammengebunden war und schnurgerade auf ihrem Teller lag. Sein Kopf war mit einer Rosine geschmückt, die wie ein Zylinder wirkte. Die leeren Augenhöhlen und der halb geöffnete Schnabel erweckten den Eindruck, als wäre der Vogel plötzlich durch ein schreckliches Ereignis mitten aus seinen Beschäftigungen gerissen worden, durch ein Ereignis, vergleichbar dem Vesuvausbruch, der Pompeji unter sich begraben hatte.
»Ich mag kein Fleisch«, murmelte Julie.
»Das ist kein Fleisch, sondern Geflügel«, korrigierte die Mutter, fuhr dann aber in versöhnlichem Ton fort: »Du willst doch nicht wieder magersüchtig werden. Du musst bei Kräften bleiben, damit du dein Abitur schaffst und Jura studieren kannst. Nur weil dein Vater sein Examen in Jura gemacht hat, leitet er jetzt die Rechtsabteilung des Forstamtes, und nur weil er diese Position innehat, haben es dir seine entsprechenden Beziehungen ermöglicht, die Abiturklasse noch einmal wiederholen zu dürfen. Jetzt bist du an der Reihe, Jura zu studieren.«
»Ich pfeif auf Jura!«, verkündete Julie.
»Du musst dein Studium schaffen, um ein vollwertiger Teil der Gesellschaft zu werden.«
»Ich pfeif auf die Gesellschaft!«
»Was interessiert dich denn dann?«
»Gar nichts.«
»Womit verbringst du deine Zeit? Hast du eine große Liebe?«
»Ich pfeif auf die Liebe.«
»Ich pfeif auf … ich pfeif auf … Etwas anderes bekommt man von dir nicht mehr zu hören. Irgendwas oder irgendwer muss dich doch interessieren«, beharrte die Mutter. »So hübsch, wie du bist, müssen die Jungen sich doch um dich reißen.«
Julie schnitt eine Grimasse. Ihre hellgrauen Augen funkelten. »Ich habe keinen Freund, und ich weise dich darauf hin, dass ich noch Jungfrau bin.«
Das Gesicht der Mutter spiegelte empörtes Erstaunen wider. Dann lachte sie schallend: »Neunzehnjährige Jungfrauen gibt es heutzutage nur noch in Science-Fiction-Romanen.«
»Ich habe weder die Absicht, mir einen Liebhaber zu nehmen, noch will ich heiraten«, fuhr Julie fort. »Und weißt du auch, warum? Weil ich Angst habe, so zu werden wie du.«
Die Mutter hatte sich wieder gefasst. »Meine arme Kleine, du bist einfach ein Problembündel. Zum Glück habe ich für dich schon einen Termin bei einem Psychotherapeuten vereinbart. Für nächsten Donnerstag.«
Solche Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Tochter waren nichts Ungewöhnliches. Diese dauerte noch eine ganze Stunde, und Julie verzehrte von ihrem Abendessen nur eine eingelegte Kirsche, die als Verzierung auf der Mousse aus weißer Schokolade lag.
Der Vater verzog trotz der vielen Tritte, die Julie ihm ans Schienbein versetzte, wie üblich keine Miene und hütete sich, in den Streit einzugreifen.
»Also, Gaston, nun sag doch was!«, forderte seine Frau ihn endlich auf.
»Julie, hör auf deine Mutter«, erklärte er lakonisch, während er seine Serviette faltete. Gleich darauf stand er auf und sagte, dass er früh schlafen gehen wolle, weil er am nächsten Morgen in aller Frühe mit seinem Hund eine große Wanderung vorhabe.
»Darf ich mitkommen?«, fragte seine Tochter.
Er schüttelte den Kopf. »Diesmal nicht. Ich möchte mir die Schlucht, die du entdeckt hast, etwas näher anschauen, und außerdem hat deine Mutter Recht – anstatt im Wald herumzulaufen, solltest du lieber büffeln.«
Als er sich hinabbeugte, um ihr einen Gutenachtkuss zu geben, flüsterte Julie: »Papa, lass mich nicht im Stich.«
Er tat so, als hätte er nichts gehört. »Träum schön«, sagte er nur und verließ das Zimmer.
Julie hatte keine Lust auf ein weiteres Zwiegespräch mit ihrer Mutter. Sie tat so, als müsste sie dringend auf die Toilette, verriegelte die Tür und setzte sich auf den Klodeckel. Sie hatte das Gefühl, längst in einen Graben gefallen zu sein, in einen viel tieferen als den im Wald, in einen Abgrund, aus dem niemand sie befreien konnte.
Um ganz mit sich allein zu sein, machte sie das Licht aus, und um sich zu trösten, summte sie wieder vor sich hin: »Eine grüne Maus lief durchs grüne Gras …«, aber sie verspürte eine schreckliche Leere. Sie fühlte sich verloren in einer Welt, die über ihren Verstand ging. Sie fühlte sich ganz klein, so winzig wie eine Ameise.
9. Von der Schwierigkeit, sich zu behaupten
Die Ameise galoppiert mit aller Kraft ihrer sechs Beine dahin; ihre Fühler fliegen im Wind nach hinten, ihr Unterkiefer rasiert Moos und Flechten ab.
Sie hastet im Zickzack zwischen Ringelblumen, Stiefmütterchen und Ranunkeln hindurch, aber ihr Verfolger gibt nicht auf. Der Igel, dieser mit spitzen Stacheln gepanzerte Riese, verpestet die Luft mit seinem schrecklichen Moschusgestank. Die Erde erbebt unter seinen Pfoten. Fetzen von Feinden hängen in seinen Stacheln, und wenn die Ameise sich die Zeit nähme, ihn genauer zu betrachten, könnte sie sehen, dass unzählige Flöhe sich auf ihm tummeln.
Die alte rote Ameise springt über eine Böschung hinweg, in der Hoffnung, ihren Verfolger abzuschütteln. Der Igel wird jedoch nicht einmal langsamer. Seine Stacheln sind auch als Stoßdämpfer äußerst nützlich. Er rollt sich einfach zur Kugel zusammen, wenn es bergabwärts geht, und stellt sich dann wieder auf seine vier Beine.
Die Ameise läuft noch schneller. Plötzlich taucht ein glatter weißer Tunnel vor ihr auf. Sie erkennt zunächst nicht, was das sein könnte. Der Eingang ist jedenfalls breit genug, um eine Ameise passieren zu lassen. Was das wohl sein mag? Für den Bau einer Heuschrecke oder Grille ist die Öffnung viel zu groß. Vielleicht die Heimstatt eines Maulwurfs oder einer Spinne?
Ihre Antennen sind so weit nach hinten gebogen, dass sie das Gebilde nicht abtasten kann. Deshalb ist sie gezwungen, sich ganz auf ihr Sehvermögen zu konzentrieren, das aber nur aus nächster Nähe völlig scharfe Bilder liefert. Viel zu spät erkennt sie, dass dieser weiße Tunnel kein Zufluchtsort ist, sondern der gähnende Schlund einer Schlange.
Von einem Igel verfolgt, und vor sich eine Schlange! Diese Welt ist wirklich nicht für Einzelwesen geschaffen.
Die alte rote Ameise sieht nur einen einzigen Ausweg: einen Zweig, an dem sie rasch hochklettern kann. Schon dringt die lange Schnauze des Igels in den Rachen der Schlange ein.
Höchste Zeit für ihn, sich hastig zurückzuziehen und die Schlange in den Hals zu beißen, die sich schon zusammenringelt, weil sie es gar nicht schätzt, wenn jemand ihren Schlund heimsucht.
Von ihrem Zweig aus beobachtet die alte rote Ameise interessiert den Kampf ihrer beiden Feinde.
Langer, kalter Schlauch gegen warme, stechende Kugel. Die schwarz gesprenkelten Augen der Viper verraten weder Furcht noch Hass, nur äußerste Konzentration hinsichtlich der Aufgabe, ihren Kopf in die günstigste Position zu bringen. Der Igel gerät hingegen in Panik. Er bäumt sich auf und versucht, den Bauch des Reptils mit seinen Stacheln anzugreifen. Das Tier ist unglaublich beweglich. Seine kleinen, krallenbewehrten Beine schlagen auf die Schuppen ein, die den Stacheln Widerstand leisten. Doch die eisige Peitsche rollt sich zusammen und geht ihrerseits zum Angriff über. Die Viper öffnet den Mund und entblößt klickend ihre Giftzähne, aus denen flüssiger Tod sickert. An und für sich sind Igel gegen die giftigen Bisse von Vipern gut geschützt, es sei denn, diese verletzen sie genau an der zarten Schnauze.
Bevor die Schlacht entschieden ist, wird die Ameise davongetragen. Zu ihrer großen Überraschung setzt sich der Zweig, an den sie sich geklammert hat, langsam in Bewegung. Anfangs glaubt sie, der Wind sei schuld daran, doch als der Zweig sich von seinem Ast löst und zu kriechen beginnt, versteht sie gar nichts mehr. Der Zweig klettert schwankend auf einen anderen Ast, legt eine kurze Rast ein und beginnt, den Baumstamm zu erklimmen.
Verblüfft lässt sich die alte Ameise von dem Zweig forttragen. Nach einer Weile wirft sie einen Blick nach unten und begreift endlich. Der Zweig hat Augen und Beine. Kein botanisches Wunder, nein. Das ist gar kein Zweig, sondern eine Gespenstschrecke.
Diese Insekten mit länglichen, feingliedrigen Körpern schützen sich durch Mimikry gegen ihre Feinde: Sie nehmen das Aussehen der Zweige, Blätter oder Stängel an, auf denen sie sich niederlassen. Der Gespenstschrecke ist ihr Täuschungsmanöver so gut gelungen, dass ihr Körper sogar eine typische Holzfaserung aufweist, mit braunen Flecken und Kerben, so als hätte eine Termite daran genagt.
Ein weiterer Trumpf der Gespenstschrecke: Ihre Langsamkeit trägt noch zur Mimikry bei. Niemand greift etwas fast Unbewegliches an. Die alte Ameise hat einmal ein Liebesspiel zwischen zwei Gespenstschrecken beobachtet. Das Männchen hatte sich dem etwas größeren Weibchen genähert, indem es alle zwanzig Sekunden ein Bein vor das andere setzte. Das Weibchen hatte sich ein wenig entfernt, und das Männchen war viel zu träge gewesen, um es einzuholen. Doch das war nicht weiter tragisch. Bedingt durch die legendäre Langsamkeit der Männchen, haben die Weibchen eine originelle Lösung des Problems der Fortpflanzung entwickelt: die Parthenogenese, die Jungfrauengeburt. Eine Befruchtung ist nicht mehr notwendig. Gespenstschrecken brauchen keinen Partner mehr zu finden, um Nachkommen zur Welt bringen zu können. Es genügt, sich Kinder zu wünschen, um sie auch zu bekommen.
Die Gespenstschrecke, auf der die rote Ameise sitzt, erweist sich als Weibchen, denn plötzlich beginnt sie, Eier zu legen, eines nach dem anderen, natürlich ganz langsam. Sie fallen von Blatt zu Blatt, wie harte Regentropfen. Die Tarnungskünste dieser Insekten sind so perfekt, dass ihre Eier wie Körner aussehen.
Die Ameise knabbert ein bisschen an dem vorgeblichen Zweig, um festzustellen, ob er essbar ist. Doch die Gespenstschrecken verstehen es auch, sich tot zu stellen. Sobald das Weibchen die Spitzen der Mandibeln spürt, erstarrt es und lässt sich zu Boden fallen.
Die alte rote Ameise lässt sich davon jedoch nicht irreführen. Nachdem die Schlange und der Igel inzwischen das Weite gesucht haben, folgt sie der Gespenstschrecke nach unten und verspeist sie. Das seltsame Geschöpf zuckt sogar im Todeskampf kein einziges Mal. Zur Hälfte aufgefressen, bleibt es genauso regungslos wie ein echter Zweig. Nur eine Kleinigkeit ist verräterisch: Aus seinem Hinterleib fallen immer noch körnige Eier.
Genug Aufregungen für diesen Tag! Es wird kühler – Zeit zum Schlafen. Die Ameise gräbt sich zwischen Erde und Moos ein. Morgen wird sie wieder versuchen, den Weg zu ihrem Geburtsort zu finden. Sie muss die anderen unbedingt warnen, bevor es zu spät ist.
In aller Ruhe reinigt sie ihre Antennen, um die Umgebung klar und deutlich identifizieren zu können. Dann verschließt sie ihre kleine Höhle mit einem Steinchen, weil sie nicht mehr gestört werden will.
10. Enzyklopädie
Unterschiedliches Wahrnehmungsvermögen: Man nimmt von der Welt nur das wahr, worauf man vorbereitet ist. Für ein physiologisches Experiment wurden Katzen von Geburt an in einen kleinen Raum gesperrt, der mit vertikalen Mustern tapeziert war. Sobald sie das Alter erreicht hatten, in dem das Gehirn voll ausgebildet ist, wurden sie aus diesem Raum entfernt und in Kisten gesetzt, die mit horizontalen Linien tapeziert waren. Diese Linien führten zu Essensverstecken und zu Klapptüren ins Freie, doch es gelang keiner der Katzen, sich zu ernähren oder ins Freie zu gelangen. Ihr Wahrnehmungsvermögen war auf vertikale Linien eingeschränkt.
Unser eigenes Wahrnehmungsvermögen ist genauso begrenzt. Wir können gewisse Gegebenheiten nicht begreifen, weil wir perfekt darauf konditioniert wurden, die Dinge nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrzunehmen.
EDMOND WELLS
Enzyklopädie des relativen und absoluten Wissens, Bd. 3
11. Die Macht der Wörter
Ihre Hand öffnete und schloss sich nervös, krallte sich sodann ins Kissen. Julie träumte. Sie träumte, sie wäre eine mittelalterliche Prinzessin. Eine Riesenschlange hatte sie gefangen und wollte sie verschlingen. Sie hatte Julie in schmutzigbraunen Treibsand geschleudert, wo es von jungen umherkriechenden Schlangen nur so wimmelte, und Julie drohte darin zu versinken. Ein junger Prinz in einer Rüstung aus bedrucktem Papier galoppierte auf einem weißen Hengst herbei und kämpfte mit der Riesenschlange. Er schwenkte ein langes, spitzes rotes Schwert und flehte die Prinzessin an, durchzuhalten. Er komme ihr gleich zu Hilfe.
Doch die Riesenschlange setzte ihr Maul wie einen Feuerwerfer ein, und die Papierrüstung war dem Prinzen von geringem Nutzen. Ein einziger Funke genügte, um sie in Brand zu setzen. Mit einer Schnur gefesselt, lagen er und sein Pferd bald auf einem Teller, umgeben von aschgrauem Püree.
Der schöne Prinz hatte seine ganze Pracht eingebüßt: Seine Haut war schwarzbraun, seine Augenhöhlen waren leer, und sein Kopf wurde von einer Rosine gekrönt.
Die Riesenschlange packte Julie mit ihren Giftzähnen, zog sie aus dem Treibsand heraus und schleuderte sie stattdessen in eine Mousse aus weißer Schokolade mit Grand Marnier.
Sie wollte schreien, aber die Mousse überschwemmte sie, drang in ihren Mund und hinderte sie daran, auch nur einen Ton hervorzubringen.
Julie fuhr aus dem Schlaf hoch. Ihre Angst war so groß, dass sie sich sofort vergewissern musste, ob sie nicht wirklich die Stimme verloren hatte. »A-a-a-a-a-a, A-a-a-a«, brachte sie mühsam hervor.
Diese Alpträume vom Verlust der Stimme suchten sie immer häufiger heim. Manchmal wurde sie gefoltert, und man schnitt ihr die Zunge ab. Manchmal verstopfte man ihr den Mund mit Lebensmitteln. Manchmal wurden ihr die Stimmbänder mit einer Schere zerschnitten. War es wirklich unvermeidlich, im Schlaf zu träumen? Sie hoffte, wieder einschlafen zu können und die restliche Nacht an nichts mehr zu denken.
Als sie einen Blick auf den Wecker warf, stellte sie fest, dass es sechs Uhr morgens war. Draußen war es noch dunkel. Sterne schimmerten hinter dem Fenster. Sie hörte Schritte im Erdgeschoss, Schritte und leises Gebell. Ihr Vater brach, wie angekündigt, frühzeitig zu einem Waldspaziergang mit seinem Hund auf.
»Papa, Papa …«
Unten fiel die Tür ins Schloss.
Julie legte sich wieder hin und versuchte einzuschlafen, aber vergeblich.
Was verbarg sich jenseits der ersten Seite der Enzyklopädie des relativen und absoluten Wissens von Professor Edmond Wells?
Sie griff nach dem dicken Buch. Darin war sehr viel von Ameisen und Revolutionen die Rede. Es riet ihr ohne Umschweife, eine Revolution anzuzetteln, und es beschrieb eine Zivilisation, die ihr dabei behilflich sein könnte. Sie riss ihre hellgrauen Augen weit auf. Zwischen kurzen Texten in kleiner Schrift tauchte hier und dort plötzlich – manchmal mitten in einem Wort – ein Großbuchstabe oder eine kleine Zeichnung auf.
Sie las aufs Geratewohl:
Der Plan dieses Werkes kopiert den Tempel Salomos. Der erste Buchstabe jedes Kapitelanfangs entspricht einer Maßangabe des Tempels.
Julie runzelte die Stirn. Welcher Zusammenhang konnte zwischen Buchstaben und der Architektur eines Tempels bestehen?
Sie blätterte weiter.
Die Enzyklopädie war ein riesiges Sammelsurium an verschiedenen Informationen, Zeichnungen und Grafiken. Gemäß dem Titel enthielt sie didaktische Texte, aber es gab darin auch Gedichte, ungeschickt ausgeschnittene Prospekte, Kochrezepte, Listen von Computerprogrammen, Zeitschriftenartikel, aktuelle Bilder oder erotische Fotos berühmter Frauen, die wohl den Zweck von Buchillustrationen erfüllen sollten.
Es gab auch Kalender mit genauen Angaben, wann man welche Gemüse- und Obstsorten pflanzen sollte, es gab Collagen seltener Stoffe und Papiere, Karten des Himmelsgewölbes und Linienpläne der U-Bahnen von Großstädten, Auszüge von Privatbriefen, mathematische Rätsel, perspektivische Schemata von Renaissancegemälden.
Manche Abbildungen waren sehr grausam – Bilder von Gewalt, Tod und Katastrophen. Einige Texte waren mit roter, blauer oder parfümierter Tinte geschrieben. Manche Seiten schienen sogar mit unsichtbarer Tinte oder Zitronensaft beschrieben worden zu sein, und anderswo war die Schrift so winzig, dass man sie nur mit einer Lupe hätte entziffern können.
Julie entdeckte Pläne imaginärer Städte, Biografien historischer – aber in Vergessenheit geratener – Persönlichkeiten, Ratschläge zur Herstellung seltsamer Maschinen …
Plunder oder Schatz? Wie auch immer – Julie dachte, dass sie mindestens zwei Jahre benötigen würde, um alles zu lesen. Plötzlich blieb ihr Blick an ein paar ungewöhnlichen Porträts haften. Sie stutzte, aber sie hatte sich nicht getäuscht: Es handelte sich tatsächlich um Köpfe. Nicht um Menschenköpfe, sondern um Köpfe von Ameisen, allem Anschein nach die Büsten bedeutender Persönlichkeiten. Keine Ameise war mit einer anderen identisch. Die Größe der Augen, die Länge der Fühler, die Form des Schädels variierten beträchtlich. Und unter jedem Porträt stand ein Name, der aus einer Zahlenreihe bestand.
Julie blätterte weiter.
Zwischen den Hologrammen, Rezepten und Plänen tauchte das Thema Ameisen wie ein Leitmotiv immer wieder auf.
Partituren von Bach, sexuelle Stellungen aus dem Kamasutra, Codes der französischen Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg … Welcher eklektische und interdisziplinäre Geist hatte das alles zusammengetragen?
Biologie. Utopien. Vademekums. Gebrauchsanweisungen.
Anekdoten über Menschen und Wissenschaften. Techniken der Massenmanipulation. Hexagramme aus dem I Ging.
Sie las einen Satz. Das I Ging ist ein Orakel, das – entgegen einer weit verbreiteten Meinung – nicht die Zukunft vorhersagt, sondern die Gegenwart erklärt.
Weiter hinten fand sie Strategien von Scipio dem Älteren und Clausewitz, und sie fragte sich flüchtig, ob diese Enzyklopädie vielleicht ein Handbuch der Indoktrinierung war, fand dann aber auf einer anderen Seite folgenden Ratschlag:
Misstrauen Sie jeder politischen Partei, Sekte, Korporation, Religion. Sie brauchen nicht darauf zu warten, dass andere Ihnen sagen, was Sie denken müssen. Lernen Sie, selbstständig und unbeeinflusst zu denken.
Es folgte ein Zitat des Sängers Georges Brassens:
Anstatt die anderen ändern zu wollen, sollten Sie versuchen, sich selbst zu ändern.
Ein weiterer Abschnitt erregte Julies Aufmerksamkeit:
Kurze Abhandlung über die fünf äußeren und die fünf inneren Sinne: Es gibt fünf physische und fünf psychische Sinne. Die fünf Körpersinne sind: Gesichts-, Gehör-, Tast-, Geschmacks- und Geruchssinn. Die fünf psychischen Sinne sind: Empfindung, Vorstellungsvermögen, Intuition, universelles Gewissen und Inspiration. Wenn man nur mit seinen physischen Sinnen lebt, so ist das, als würde man nur die fünf Finger der linken Hand benutzen.
Lateinische und griechische Zitate. Neue Kochrezepte. Chinesische Ideogramme. Herstellung eines Molotowcocktails. Getrocknetes Laub. Ein Kaleidoskop von Bildern. Ameisen und Revolution. Revolution und Ameisen.
Julies Augen brannten. Sie fühlte sich berauscht von diesem visuellen und informativen Überfluss. Ein Satz fiel ihr auf:
Lesen Sie dieses Werk nicht der Reihe nach. Benutzen Sie es vielmehr folgendermaßen: Wenn Sie das Gefühl haben, es zu brauchen, schlagen Sie es aufs Geratewohl auf, lesen Sie die Seite, und versuchen Sie herauszufinden, ob sie Ihnen für Ihr aktuelles Problem eine interessante Information liefert.
Und weiter:
Zögern Sie nicht, Passagen zu überspringen, die Ihnen zu langatmig vorkommen. Ein Buch ist kein Heiligtum.
Julie schloss das Werk und versprach ihm, es so zu benutzen, wie man es ihr vorgeschlagen hatte. Sie zog ihre Decke zurecht, und bald atmete sie gleichmäßig, ihre Körpertemperatur senkte sich etwas, und sie schlief ruhig ein.
12. Enzyklopädie
Paradoxer Schlaf: Im Schlaf erleben wir eine besondere Phase, die als »paradoxer Schlaf« bezeichnet wird. Sie dauert 15–20 Minuten und wiederholt sich im Laufe der Nacht alle anderthalb Stunden. Weshalb trägt sie diesen Namen? Weil es paradox ist, dass man sich sogar im tiefsten Schlaf mit einer intensiven Aktivität beschäftigt.
Wenn die Nächte von Säuglingen oft sehr unruhig sind, so wegen dieses paradoxen Schlafes (Proportionen: ein Drittel normaler Schlaf, ein Drittel leichter Schlaf, ein Drittel paradoxer Schlaf). Während dieser Schlafphase kann man bei Babys oft eine seltsame Mimik beobachten, die sie wie Erwachsene – sogar wie alte Menschen – aussehen lässt. Ihre Gesichter spiegeln abwechselnd Wut, Freude, Trauer, Angst und Überraschung wider, obwohl sie diese Emotionen zweifellos noch nie erlebt haben. Man könnte sagen, dass sie jene Mienen einüben, die sie später zur Schau tragen werden.
Bei Erwachsenen reduzieren sich die Phasen des paradoxen Schlafes mit zunehmendem Alter auf ein Zehntel oder sogar ein Zwanzigstel der gesamten Schlafzeit. Sie werden als genussreich empfunden und rufen bei Männern manchmal Erektionen hervor.
Es scheint so, als würden wir jede Nacht eine Botschaft empfangen. Man hat ein Experiment gemacht: Ein Erwachsener wurde mitten in einer paradoxen Schlafphase geweckt und gebeten zu erzählen, wovon er soeben geträumt habe. Dann ließ man ihn wieder einschlafen und rüttelte ihn während der nächsten paradoxen Schlafphase erneut wach. Dabei wurde festgestellt, dass die beiden Träume zwar verschieden sein mochten, aber doch einen gemeinsamen Nenner hatten. Alles läuft so ab, als würde der unterbrochene Traum auf andere Weise fortgesetzt, um dieselbe Botschaft zu vermitteln.
Kürzlich haben Forscher eine neue Theorie entwickelt. Ihrer Ansicht nach ist der Traum ein Mittel, um den sozialen Druck zu überwinden. Im Traum verlernen wir, was wir tagsüber gezwungenermaßen gelernt haben, was jedoch gegen unsere tiefsten Überzeugungen verstößt. Alle uns von außen aufgezwungenen Konditionierungen werden gelöscht. Solange Menschen träumen, ist es unmöglich, sie total zu manipulieren. Der Traum ist ein natürlicher Hemmschuh für den Totalitarismus.
EDMOND WELLS
Enzyklopädie des relativen und absoluten Wissens, Bd. 3
13. Allein unter den Bäumen
Der Morgen ist da. Noch ist es zwar dunkel, aber es wird schon warm. Das gehört zu den paradoxen Eigenschaften des Monats März.
Der Mond wirft sein bläuliches Licht auf das Laubwerk. Dieser helle Schein weckt die Ameise und verleiht ihr die nötige Energie, ihren Weg fortzusetzen. Seit sie allein in diesem riesigen Wald unterwegs ist, gibt es für sie kaum Ruhepausen. Spinnen, Vögel, Sandläufer, Ameisenjungfern, Eidechsen, Igel und sogar Gespenstschrecken verbünden sich, um ihr auf die Nerven zu gehen.
Von all diesen Sorgen wusste sie nichts, als sie noch dort unten lebte, in ihrer Stadt, zusammen mit allen anderen. Ihr Gehirn war damals auf »Kollektivgeist« eingestellt, und es kostete sie keine persönliche Anstrengung, nachzudenken.
Doch nun ist sie fern von ihrer Heimat, fern von den Ihren. Ihr Gehirn muss sich auf »individuelle Funktionsweise« umstellen. Ameisen besitzen die erstaunliche Fähigkeit, auf zweierlei Art funktionsfähig zu sein: im Kollektiv und als Individuum.
Im Augenblick hat sie nur die Möglichkeit, sich als Individuum zurechtzufinden, und ihr kommt es sehr mühsam vor, unablässig an sich selbst denken zu müssen, um zu überleben. Das führt auf Dauer dazu, Angst vor dem Tod zu haben. Vielleicht ist sie die erste Ameise, die ständig um ihr Leben bangt, weil sie allein lebt.
Welche Degeneration!
Sie eilt unter Ulmen dahin. Das Summen eines dicken Maikäfers veranlasst sie, den Kopf zu heben. Wie herrlich doch der Wald ist! Im Mondschein wirken alle Pflanzen weiß oder malvenfarben. Sie richtet ihre Antennen auf und ortet ein Veilchen, auf dem sich Schmetterlinge tummeln. Etwas weiter fressen Raupen mit gestreiftem Rücken Holunderblätter ab. Die Natur scheint sich besonders schön gemacht zu haben, um die Rückkehr der alten roten Ameise zu feiern.
Sie stolpert über einen trockenen Kadaver, weicht etwas zurück und schaut genau hin. Vor ihr liegt eine ganze Menge toter Ameisen, spiralförmig angeordnet. Es sind schwarze Ameisen. Sie kennt dieses Phänomen. Die Ameisen hatten sich viel zu weit von ihrem Bau entfernt, und als der kalte Abendtau einsetzte, wussten sie nicht, wohin, bildeten deshalb eine Spirale und drehten sich im Kreis, bis sie starben. Wenn man die Welt, in der man lebt, nicht versteht, dreht man sich bis zum Tod im Kreis.
Die alte rote Ameise streckt ihre Antennen aus, um die Katastrophe genauer zu untersuchen. Die Ameisen am Rand der Spirale sind als Erste gestorben, die in der Mitte zuletzt.
Sie betrachtet diese seltsame Todesspirale im malvenfarbenen Mondschein. Welch primitives Verhalten! Sie hätten doch nur unter einem Baumstumpf Schutz suchen oder ein Biwak in die Erde graben müssen, um sich gegen die Kälte zu schützen. Diesen törichten schwarzen Ameisen ist aber nichts Besseres eingefallen, als sich im Kreis zu drehen, so als könnte Tanzen die Gefahr bannen.
Mein Volk hat wirklich noch sehr viel zu lernen, meint die alte rote Ameise.
Unter Farnkraut erkennt sie die Gerüche ihrer Kindheit wieder. Der Pollenduft berauscht sie.
Es hat sehr lange gedauert, bis diese Perfektion erreicht wurde.
Zuerst sind die grünen Meeresalgen, die Ahnen aller Pflanzen, auf dem Kontinent an Land gegangen. Um dort Halt zu finden, haben sie sich in Flechten verwandelt. Die Flechten haben daraufhin eine Strategie der Verbesserung des Bodens entwickelt; sie erzeugten Erdreich, auf dem eine zweite Generation von Pflanzen gedeihen konnte, die dank ihrer tieferen Wurzeln höher und kräftiger wuchsen.
Seitdem besitzt jede Pflanze ihren Einflussbereich, aber es gibt immer noch Konfliktzonen. Die alte Ameise sieht eine Feigenbaumliane, die einen kühnen Angriff auf einen passiven Vogelkirschbaum unternimmt. Bei diesem Duell hat der arme Kirschbaum nicht die geringste Chance. Dafür verkümmern jedoch andere Feigenbaumlianen, die sich mit Sauerampfer angelegt haben, denn dessen Saft ist für sie ein tödliches Gift.
Etwas weiter verliert eine Tanne ihre Nadeln, um die Erde zu säuern, damit alle parasitären Gräser und kleinen Pflanzen vernichtet werden.
Jeder hat seine eigenen Waffen, seine eigenen Verteidigungs- und Überlebensstrategien. Die Pflanzenwelt ist gnadenlos. Der einzige Unterschied zum Tierreich besteht vielleicht darin, dass die Morde bei Pflanzen langsamer und vor allem lautlos vor sich gehen.
Manche Pflanzen ziehen blanke Waffen dem Gift vor. Man denke nur an die dornigen Blätter der Stechpalmen, an die Rasiermesser der Disteln, an die Angelhaken der Passionsblumen oder an die Stacheln der Akazien. Die alte Ameise durchquert gerade ein solches Wäldchen von Akazien, was einem Gang durch Reihen voller spitzer Klingen gleicht.
Sie reinigt ihre Antennen und richtet sie sodann steil auf, um alle Gerüche, die durch die Luft wirbeln, schärfer registrieren zu können, denn sie sucht etwas ganz Bestimmtes: eine Spur der Pheromonpiste, die in ihr Geburtsland führt. Jede Sekunde zählt. Sie muss ihre Stadt um jeden Preis warnen, bevor es zu spät ist.
Sofort fängt sie alle möglichen Duftmoleküle auf, die ihr Informationen über Leben und Sitten der hier ansässigen Tiere liefern, für die sie sich aber nicht im Geringsten interessiert.
Trotzdem verlangsamt sie ihr Tempo, um all diese verwirrenden – teilweise sogar unbekannten – Gerüche besser wahrnehmen zu können. Doch auch das nutzt ihr nichts, und deshalb entscheidet sie sich schließlich für eine andere Methode.
Sie erklimmt einen hohen Berggipfel – den Baumstumpf einer Kiefer –, strafft sich und lässt die Sensoren am Ende ihrer Fühler kreisen. Der Bereich der Duftfrequenzen, die sie empfängt, hängt von der Geschwindigkeit ihrer Antennen ab. Bei 400 Vibrationen pro Sekunde nimmt sie nichts Auffallendes wahr. Sie beschleunigt auf 600, 1000, 2000 Schwingungen pro Sekunde. Immer noch nichts Spektakuläres, nur Duftbotschaften von Pflanzen und von Insekten, die aber keine Ameisen sind: von Blumen, Pilzsporen, Käfern, von moderndem Holz und wilder Pfefferminze …
10 000 Vibrationen pro Sekunde. Bei diesem Tempo erzeugen ihre Antennen eine Luftströmung, die Staub ansaugt. Sie muss sie säubern, bevor sie ihre Bemühungen fortsetzen kann.
12 000 Vibrationen pro Sekunde. Endlich fängt sie ferne Moleküle auf, die von der Existenz einer Ameisenpiste zeugen. Gewonnen! Richtung Westsüdwest, in einem Winkel von zwölf Grad zum Stand des Mondes. Vorwärts!
14. Enzyklopädie
Vom Interesse am Unterschied: Wir alle sind Sieger, denn jeder von uns verdankt seine Existenz jenem Spermatozoon, das den Sieg über seine 300 Millionen Konkurrenten davongetragen hat.
Damit erwarb es das Recht, seine Chromosomen weiterzugeben, die bewirkten, dass Sie der sind, der Sie sind, und kein anderer.
Ihr Spermatozoon war wirklich außergewöhnlich begabt. Es hat sich nicht in irgendeinem Schlupfwinkel verkrochen. Es hat seinen Weg gemacht. Vielleicht hat es sogar gekämpft, um rivalisierenden Spermatozoen den Weg zu versperren.
Lange Zeit glaubte man, es wäre das schnellste Spermatozoon, dem es gelinge, das Ei zu befruchten, doch dem ist nicht so. Hunderte von Spermatozoen kommen gleichzeitig dort an. Und dann müssen sie – mit den Geißeln zuckend – warten. Nur ein einziges wird auserwählt sein.
Es ist demnach das Ovulum, das sich für ein ganz bestimmtes Spermatozoon entscheidet, obwohl es von Massen bedrängt wird. Forscher haben sich lange gefragt, nach welchen Kriterien diese Wahl getroffen wird. Kürzlich haben sie die Lösung gefunden: Das Ei erwählt jenes Spermatozoon, das »jene genetischen Eigenschaften aufweist, die sich am meisten von seinen eigenen unterscheiden«. Eine simple Überlebensfrage. Das Ovulum will die Probleme der Blutsverwandtschaft vermeiden. Die Natur will, dass unsere Chromosomen sich durch etwas Andersartiges bereichern, anstatt sich mit etwas Ähnlichem zusammenzutun.
EDMOND WELLS
Enzyklopädie des relativen und absoluten Wissens, Bd. 3
15. Man sieht sie von weitem
Schritte. Es war sieben Uhr morgens, und die Sterne leuchteten noch hoch oben am Firmament.
Während Gaston Pinson mit seinem Hund die gewundenen Pfade im Herzen des Waldes von Fontainebleau entlangging, an der frischen Luft, in der Morgenstille, fühlte er sich wohl. Zufrieden strich er seinen roten Schnurrbart glatt. Hier kam er sich immer vor wie ein freier Mensch.