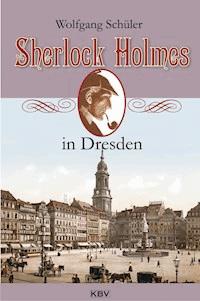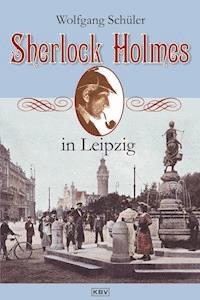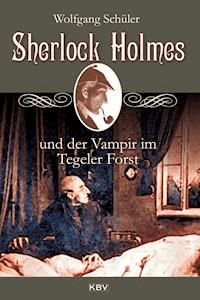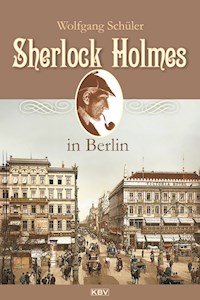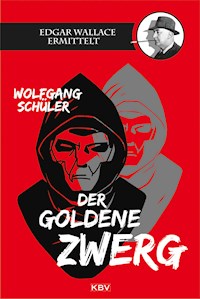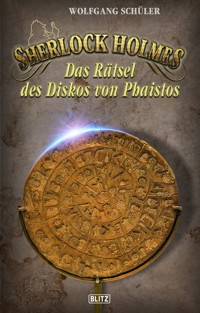Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ostberlin im Frühjahr 1984. Im Stadtbezirk Prenzlauer Berg ist ein Serientäter unterwegs, der nachts junge Frauen bis in ihre Wohnungen verfolgt und sie dort vergewaltigt. Die Kriminalpolizei arbeitet auf Hochtouren, doch der Verbrecher ist überaus clever. Von ihm bleiben nur minimale Spuren zurück, und die Aussagen der traumatisierten Opfer sind äußerst vage. Gleichwohl hat der Dämon in Menschengestalt in allen Fällen etwas hinterlassen: eine einzelne Rose auf dem Fußboden. Nicht nur die Identität des Sexualtäters ist ungeklärt, auch zwei wichtige Fragen bleiben offen: Auf welche Weise hat er die Frauen ausgewählt? Wie ist er unbemerkt in ihre Wohnungen eingedrungen? Die Kriminalpolizei entschließt sich, die Öffentlichkeit einzubeziehen, um den Fahndungsdruck zu erhöhen. Ein Journalist der Berliner Zeitung nimmt sich der Sache an. Doch damit kommt der Polizeireporter dem Verbrecher gefährlich nahe. Bald wird er selbst zum Zielobjekt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Schüler
Die Rosen des Bösen
Ein Berlin-Krimi
Bild und Heimat
eISBN978-3-95958-766-2
1. Auflage
© 2018 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: Fritz Mohr, Berlin
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206109 – 0
www.bild-und-heimat.de
1. Die Karten werden gemischt
Das sechste Opfer
»Die erste umfangreiche Ausstellung mit Werken des bedeutenden englischen Künstlers Henry Moore in der DDR wurde gestern in der Berliner Nationalgalerie eröffnet.«
Berliner Zeitung, Donnerstag, 5. April 1984
Der Schänder hatte bereits fünf Frauen Gewalt angetan. In dieser Nacht würde es sein sechstes Opfer treffen. Ilka Friesecke war ein ausnehmend hübscher Käfer. Wehe ihr, die Spinne lag bereits auf der Lauer.
*
Der Nachname »Moore« kommt im englischen Sprachraum sehr oft vor – vielleicht nicht so zahlreich wie in Deutschland die Zunamen »Müller«, »Schmidt« und »Schneider«, die an der Spitze der hundert häufigsten Familiennamen stehen, aber immer noch weit über dem Durchschnitt. Deshalb lassen sich Verwechslungen nicht vermeiden. Beispielsweise bekam der US-amerikanische Country- und Rock-’n’-Roll-Musiker Johnny Moore häufig Fanpost zugestellt, die eigentlich für einen Rhythm-and-Blues-Sänger oder einen Trompeter bestimmt war, die beide gleichfalls Johnny Moore hießen. Manchmal dauerte es Monate, ehe ein Brief nach langem Rundkurs den richtigen Adressaten erreichte.
Der Brite Roger Moore war nicht als Musiker, sondern als James-Bond-Darsteller weltweit berühmt geworden. Allerdings nicht in der DDR, weil diese Art von Agentenfilmen dort nicht in den Kinos lief. Aber die Fernsehserien »Simon Templar« und »Die Zwei« hatten den attraktiven Schauspieler mit dem charakteristischen Leberfleck links neben der Nase auch im Arbeiter-und-Bauern-Staat bekannt gemacht. Das lag einzig und allein am Westfernsehen. Zum größten Ärger des Politbüros ignorierten die vom Klassenfeind ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen jegliche Grenzbefestigungsanlagen und machten nur vor dem Dresdner Raum, dem sogenannten Tal der Ahnungslosen, halt.
Sämtlichen Funktionsträgern – vom Parteifunktionär über den Volkspolizisten und NVA-Soldaten bis hin zum Feuerwehrmann – war es dienstlich strengstens untersagt, ARD und ZDF einzuschalten. Inoffiziell warfen aber auch viele Parteimitglieder regelmäßig – und die meisten übrigen DDR-Bürger ohnehin – mit Hilfe des Westfernsehens einen Blick hinter den Eisernen Vorhang. Vor allem die täglichen Nachrichtensendungen standen hoch im Kurs.
Die zweite wichtige Informationsquelle war in Ostdeutschland der Buschfunk. Von vertraulichen Berichten bis hin zu den wildesten Gerüchten wurde alles, was nicht in der Zeitung stand oder in den Nachrichten kam, nach dem Prinzip des Kinderspiels »Stille Post« von Ohr zu Ohr weitergetragen.
Die angehende Historikerin Beate Andaman hatte in ihrem sozialistischen Studentenkollektiv etwas unter der Hand erfahren, das sie sofort hellwach werden ließ. Der Tipp stammte aus einer verlässlichen Quelle und würde eine kleine Sensation darstellen, sofern er sich tatsächlich bewahrheitete: An diesem Mittwoch sollte mitten in der Hauptstadt der DDR – also fernab der glamourösen Filmmetropolen Cannes und Hollywood – auf der Museumsinsel eine Moore-Ausstellung eröffnet werden!
Beate war ein großer Fan von Roger Moore. Über ihrem Bett hing ein großes Poster aus der BRAVO.Eshatte ihr bereits sehr intensive Träume beschert. Deshalb wollte und konnte sie sich dieses seltene Ereignis keinesfalls entgehen lassen. Vielleicht kam der Künstler sogar höchstpersönlich angereist. Ein englischer Gentleman konnte nämlich problemlos von London aus nach Tegel oder Schönefeld düsen, dort in ein Taxi steigen – und schon war er da.
Es musste so sein. Alles andere wäre völlig undenkbar. Die meisten Künstler, die in den Osten eingeladen wurden, kamen gern. Eine bessere Publicity als ein Foto vor dem Brandenburger Tor oder ein Small Talk mit Erich Honecker ließ sich kaum denken. Die Bilder würden auf allen Fernsehkanälen laufen, selbst in der »Aktuellen Kamera«. Roger Moore, ganz egal wie berühmt er schon war, würde sich eine solch günstige Gelegenheit kaum entgehen lassen. Mit etwas Glück konnte sie von ihm eine Autogrammpostkarte ergattern. Sein Namenszug würde mehr wert sein als sämtliche Unterschriften von Dean Reed, Gojko Mitić und Frank Schöbel zusammen.
Allerdings war der Buschfunk nicht nur an der Humboldt-Universität zu vernehmen. Roger-Moore-Fans gab es zuhauf. Nicht so viele wie von den Rolling Stones, aber immer noch mehr als genug. Deshalb war mit einigem Andrang auf der Museumsinsel zu rechnen. Beate besaß allerdings ein besonderes Geschick darin, große Menschentrauben vor FDJ-Studentenklubs und HO-Tanzgaststätten zu teilen wie einstens Moses das Rote Meer. Drei wichtige Dinge waren ihr gegeben: eine überragende Körpergröße, ein voluminöser Busen und eine nötige Portion Entschlossenheit. Etwas zusätzliche Unterstützung konnte trotzdem nicht schaden. Schließlich folgt auf den Weltmeeren einem Zerstörer meistens ein Kreuzer als Rückendeckung. Beate hatte deshalb ihre Kommilitonin Ilka Friesecke überredet, die letzte Vorlesung zu schwänzen und mit hinüber zur Museumsinsel zu gehen.
Viel Überzeugungskraft war nicht notwendig gewesen. Ilka hatte nämlich im vorigen Sommer in Budapest den James-Bond-Film Moonraker in englischer Originalfassung gesehen. Seitdem besaß sie ziemlich klare Vorstellungen vom Aussehen ihres zukünftigen Gatten.
Auf der Museumsinsel herrschte nicht mehr Publikumsverkehr als sonst. Kein einziger »Kunde« – also ein langhaariger Hirschbeutelträger mit Parkakutte und Jesuslatschen – war weit und breit zu sehen.
»Irgendetwas stimmt hier nicht«, schlussfolgerte Ilka messerscharf.
»Ach was«, entgegnete Beate betont optimistisch. »Die Kunden hängen nicht vor der Glotze, sondern trampen nach Weimar zum Zwiebelmarkt oder zu einer Bluesmucke an der Ostsee. Von gehobener Schauspielkunst haben sie keinen blassen Schimmer.«
Ilka sollte recht behalten. Der Ausstellungsbesuch entwickelte sich zu einem totalen Reinfall. Der Künstler war zwar zweifellos ein Brite. Er hieß auch tatsächlich »Moore« mit Nachnamen. Aber sein Vorname lautete »Henry« und nicht »Roger«. Bei ihm handelte es sich demzufolge nicht um den berühmten Schauspieler, sondern – was allerdings die beiden Studentinnen nicht die Bohne interessierte – um den nicht minder prominenten Bildhauer. Der englische Botschafter Peter Malcolm Maxey hielt eine Rede. Sie war very british: staubtrocken und völlig humorfrei.
Beate zog einen Flunsch. Auch Ilka war mehr als enttäuscht. Der Rundgang der beiden Freundinnen durch die Ausstellung fiel dementsprechend kurz aus. Mit abstrakten Zeichnungen und großformatigen Fotos von stilisierten Bronzefrauen konnten sie nicht viel anfangen. Mehreren anderen Besuchern ging es offenkundig ähnlich, denn deren Verweildauer fiel ebenfalls recht kurz aus.
Unabhängig davon war die Kunstszene im In- und Ausland über die Tatsache in Aufregung geraten, dass ein britischer Avantgardekünstler seine Werke in der Hauptstadt der DDR ausstellen durfte. Aber seine Plastiken entsprachen offensichtlich dem Zeitstil, der sich in Ost wie West ähnlich entwickelte. In Deutschland war Henry Moore dadurch bekannt geworden, dass der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt im Jahr 1979 eine Skulptur bei ihm bestellt hatte, die er vor dem Bundeskanzleramt in Bonn aufstellen ließ.
Möglicherweise wäre Ilkas weiteres Leben völlig anders verlaufen, wenn sie der Henry-Moore-Ausstellung ferngeblieben wäre und sich stattdessen brav und pflichtbewusst ihren Studien gewidmet hätte. Doch wer weiß das schon mit Bestimmtheit zu sagen? Das Leben schlägt manchmal Haken, und hinterher ist man immer klüger als zuvor.
Jedenfalls beschlossen die Freundinnen, nach dem Reinfall auf der Museumsinsel noch ins Kino zu gehen. Roger-Moore-Filme standen gerade nicht zur Verfügung, aber im Kino Kosmos in der Karl-Marx-Allee wurde um siebzehn Uhr eine französische Komödie aus dem Jahr 1982 gezeigt. Sie hieß Louis und seine verrückten Politessen und zeigte Louis de Funès in seiner letzten Rolle. In dem völlig sinnfreien Streifen ging es um eine Terrorgruppe namens »Das Gehirn«, die es auf die vier Politessen und deren Armbänder mit den Zugangscodes zu nuklearen Raketen abgesehen hatte. Dieser Nonsens war immer noch besser als eine Mosfilm-Produktion über den heldenhaften Kampf von Rotgardisten gegen die Weißen. Der amerikanische Spielfilm Am goldenen See mit Jane und Henry Fonda wäre auch nicht schlecht gewesen, aber der lief im Toni am Antonplatz, und so weit wollten sie nicht fahren.
Nach dem Film suchten die beiden Freundinnen noch die Mokka-Milch-Eisbar auf, die durch ihre sensationelle Schokomilch und einen Titel der Beatband »Team 4« bekannt und berühmt geworden war.
Von der Karl-Marx-Allee bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle war es nicht weit. Aber der Wind pfiff eisig und peitschte Regenschauer vor sich her. In der Mollstraße trennten sich die beiden Freundinnen. Beate fuhr mit der Straßenbahn der Linie 24 zurück ins Internat. Ilka wohnte im Prenzlauer Berg in der Prenzlauer Allee. Sie nahm die Linie 20 bis zur Marienburger Straße. Von da aus hatte sie es bis nach Hause nicht mehr weit.
Ilka Friesecke war zweiundzwanzig Jahre alt, im Gegensatz zu ihrer Freundin Beate nur 1,69 Meter groß und von schlanker Gestalt. Auch mit einem großen Busen konnte sie nicht dienen, was sie allerdings kaum bedauerte. Die Studentin hatte dunkelbraunes, leicht gewelltes schulterlanges Haar, das sie zumeist locker gewunden zu einem Knoten zusammensteckte. Ihr Gesicht war ebenmäßig und wurde von zahlreichen Sommersprossen geschmückt.
Ilka stammte aus der Hansestadt Rostock und studierte im dritten Studienjahr Geschichte an der Berliner Humboldt-Universität. Das Mädchen hatte sich nicht aus freien Stücken für diese Fachrichtung entschieden. Ursprünglich wollte sie Biologin mit dem Fachgebiet Botanik werden. Aber diese Studienplätze waren am Anfang der achtziger Jahre rar gewesen. Damals wurden vor allem zukünftige Ingenieure gesucht. Die einzige andere Alternative wäre ein Pädagogikstudium gewesen, aber eine solche Wahl hatte für sie außerhalb jeglicher Vorstellungskraft gelegen.
Inzwischen fand sie das Geschichtsstudium gar nicht mehr so schlecht. Für Absolventen gab es jede Menge berufliche Möglichkeiten. Ilka konnte beispielsweise Museumsdirektorin werden (und dann Ausstellungen von Henry Moore oder – besser noch – Roger Moore organisieren) oder als Lektorin in einem auf historische Bücher spezialisierten Verlag arbeiten.
Ihr Diplomthema war vollkommen unverfänglich und würde sie bei ihrer späteren Berufswahl in keinerlei Hinsicht einschränken. Es lautete: »Die Manifestation der liberalen Demokratie in England am Ende des 19. Jahrhunderts«.
Der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit klang sehr theoretisch. Er würde es auch bleiben, denn eine Reise zu den einschlägigen Londoner Archiven und Bibliotheken gehörte ebenso wenig zum Studienplan wie ein Gastsemester an einer britischen Universität. Ilkas einzige Vergünstigung bestand darin, dass sie in der Staatsbibliothek eingeschränkten Zugang zum Bereich für sekretierte Literatur hatte, der im Volksmund »Giftstube« genannt wurde. Dort, in einem separierten Leseraum, konnte sie sämtliche Literatur einsehen, die zu ihrem Diplomthema passte. Das eröffnete der Studentin vielfältige Möglichkeiten, auch abseits vom eigentlichen wissenschaftlichen Feld zu grasen. Die Bibliothekare mussten zwar bei jeder einzelnen Buchbestellung nachprüfen, ob ein Sinnzusammenhang zur beantragten und gewährten Literaturfreigabe bestand. Trotzdem gab es immer noch genügend Möglichkeiten, einen Schritt links und rechts vom Weg abzuweichen.
Ilka ging häufig in die Bibliothek. Die historischen Schmöker auf ihrem Tisch hatten nur eine Alibifunktion. Stattdessen verbrachte die Studentin die meiste Zeit mit dem Lesen von aktuellen Nachrichten und Kommentaren. In der »Giftstube« lag ein breites Sortiment westdeutscher und internationaler Presseerzeugnisse aus, über das jeder Leser völlig frei verfügen konnte. Darunter befanden sich beispielsweise Der Tagesspiegel, die Berliner Morgenpost, der Stern und Der Spiegel.
Die Zeitungen und Zeitschriften kamen nicht druckfrisch in den Leseraum. Sie mussten erst einen Umweg über die Registratur machen. Dort wurden sie erfasst und gekennzeichnet. Deshalb waren sämtliche ausliegende Exemplare bereits mehrere Tage bis einige Wochen alt. Das minderte aber nicht das Lesevergnügen. Für eine informationsbegierige Ostberliner Studentin, die nach neuen Nachrichten aus aller Welt dürstete wie ein Dromedar in der Wüste nach Wasser, waren die Beiträge immer noch aktuell genug.
Ilka hatte sich bereits so sehr an ihr regelmäßiges und kostenloses Zeitungsstudium gewöhnt, dass sie es nicht mehr missen mochte. Aus diesem Grund legte sie keine große Eile an den Tag, wenn es um ihre Diplomarbeit ging. Sie lag noch gut im Zeitplan. Der Abgabetermin rückte zwar unerbittlich näher, aber er war problemlos zu halten.
Auch wenn man es ihr weder ansah noch anmerkte: Die junge Studentin hatte bereits ein hartes Schicksal hinter sich. Ilka war seit ihrem sechzehnten Lebensjahr Vollwaise. Das Leben hatte sie nicht geschont. Zuerst war ihr Vater und ein Jahr später ihre Mutter – beide mit Mitte vierzig – an Krebs gestorben. Seitdem musste sich Ilka mehr oder weniger allein durchschlagen. Das war nicht immer einfach gewesen. Es gab zwar eine Tante Hilde in Greifswald, aber die hatte sich kaum um sie gekümmert. Sie züchtete Katzen und trank gern Alkohol. Aber als einzige nahe Verwandte hatte sie wenigstens dafür gesorgt, dass ihre Nichte die elterliche Wohnung behalten konnte und nicht ins Jugendheim umziehen musste.
Zum Studienbeginn in Berlin hatte Ilka einen Internatsplatz zugewiesen bekommen. Aber sie verspürte nicht das geringste Interesse, die vier Studienjahre in einem Wohnheim mit Vierbettzimmern, geregelter Nachtruhe, Reinigungsplänen und Besucherlisten, die unten beim Pförtner auslagen, zuzubringen. Deshalb hatte sie ihre fernbeheizte Rostocker Zweizimmerneubauwohnung vorübergehend gegen ein Berliner Einzimmerdrecksloch mit Außentoilette und Ofenheizung getauscht. Das war vom Wohnkomfort her ein schlechter Handel gewesen, aber die gewonnene Freiheit und die gute Lage mitten im Herzen der Stadt machten alle Nachteile wieder wett. Von ihren Kommilitoninnen wurde sie beneidet, weil sie eine eigene Bude hatte. Sie konnte Herrenbesuch empfangen, wann immer sie wollte. Ihre Mitstudentinnen mussten auf Parkbänke oder in den Heizungskeller vom Internat ausweichen. Es hatte bereits üble Verbrennungen an den kochend heißen Rohren gegeben.
Ilkas Adresse lautete Prenzlauer Allee 37 b. Die heruntergewirtschaftete Mietskaserne erinnerte an einen Invaliden mit gebeugten Schultern, der vom Alter ganz grau im Gesicht war und auf den erlösenden Tod wartet. Dieser Exitus würde bald kommen, daran konnte es selbst für Ilka Friesecke, die alles andere als eine Bausachverständige war, keinen Zweifel geben. Es gab nichts mehr, was den Zerfall hätte aufhalten können. Die zum Teil freiliegenden Balken waren morsch und wurmzerfressen, die Schindeln zerschlagen oder porös, der schwarz verfärbte Putz mit seinen deutlich sichtbaren Einschlägen von Geschossgarben aus dem Zweiten Weltkrieg bröckelte, und die Fundamente lösten sich auf. Die Krallenhände der Mauerrisse zerfetzten die Außenwände, und aus den finsteren Kellergewölben kroch der grüne Schwamm empor, hauchte dumpf seinen kalten Moderatem aus.
Ilka hoffte nur, dass der endgültige Zusammenbruch bis nach dem Ende ihres Studiums auf sich warten lassen würde, damit sie wieder in ihre Rostocker Wohnung zurückkehren konnte. Dort musste sie im Winter keine Kohlen mehr schleppen und sich nicht auf einem unbeheizten Klo den Hintern abfrieren. Außerdem konnte sie daheim wieder dem Luxus frönen, nach Herzenslust zu duschen und zu baden.
Die Studentin stieg die Treppen bis zur vierten Etage hinauf, verriegelte hinter sich sorgsam die Wohnungstür und brühte sich auf dem Gaskocher in der Küche einen Kräutertee auf. Dann zündete sie sich die erste Zigarette des Tages an, rauchte genüsslich und machte es sich in ihrem Lesesessel unter einer Stehlampe bequem, die vom Sperrmüll stammte. Im Antiquariat in der Münzstraße hatte Ilka vor einigen Tagen ein äußerst seltenes Buch aus dem Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch ergattert. Es hieß Fürsorgliche Belagerung und stammte von Heinrich Böll. Der Handelspreis war mit sechzehn Mark im Vergleich zu gebundenen DDR-Büchern mehr als heftig gewesen. Der Schutzumschlag fehlte. Obendrein hatte der Vorbesitzer etliche Textpassagen, die ihm wichtig erschienen, mit Bleistift unterstrichen. Aber das alles schmälerte das Lesevergnügen nicht im Geringsten.
Kurz vor zwölf ging Ilka in die Küche. Sie griff sich ihre Abendzahnbürste, drückte etwas »Chlorodont« darauf und putzte sich über der Spüle die Zähne. In der Wohnung gab es kein Bad, nur eine Plastewanne zum Waschen und Abspülen mit warmem Wasser aus dem Pfeifkessel. Wenn die Studentin duschen wollte, musste sie ins Internat fahren.
Das Bett war riesig und äußerst stabil. Am Kopfende gab es eine kleine Lampe. Ilka knipste sie an, schaltete die Deckenleuchte aus und kuschelte sich ein. Der geblümte Bezug roch frisch gewaschen. Die junge Frau las noch einige Zeilen. Aber es hatte keinen Sinn. Ihre Gedanken schweiften ab. Sie legte das Buch beiseite und löschte das Licht. Wenig später war sie tief und fest eingeschlafen. Ein extrem gutaussehender Mann mit einem Leberfleck neben der Nase sprach sie auf Englisch an: »Hello, sweetheart.«
Plötzlich wurde Ilka hellwach. Direkt neben ihr hatte sich etwas bewegt. Ehe sie einen klaren Gedanken fassen konnte, legte sich eine kräftige Hand auf ihren Mund und drückte fest zu. Die Hand steckte offensichtlich in einem genoppten Gummihandschuh. Es roch nach Chemie und schmeckte eklig. Ilka wollte zubeißen, doch ihre Zähne rutschten auf dem dicken Gummi ab. Dann …
Dienstberatung
»Auf der Marzahner Brücke hielt ein Kraftfahrer verkehrsbedingt, fünf Fahrzeuge fuhren auf,weil weder Geschwindigkeit noch Abstand den Bedingungen angemessen waren.«
Berliner Zeitung, Donnerstag, 5. April 1984
Mitten in der grauen Straßenzeile der Schönhauser Allee stach ein repräsentativer gelber Backsteinbau hervor. Bei dem weit ausladenden Gebäude mit der Nummer 22 handelte es sich um ein ehemaliges jüdisches Altersheim. Es war im November 1883 eröffnet worden. In seiner wechselvollen Geschichte hatte es die ersten neun Jahre der Hitlerdiktatur einigermaßen unbeschadet überstehen können, weil die Pläne zum Holocaust erst 1941 von Hermann Göring in Auftrag gegeben worden waren. Aber dann begann die Vernichtung, und es ging Schlag um Schlag. Wer in einem Altersheim wohnte, hatte in der Regel die letzte Station seines Lebens erreicht. An eine Flucht war für die Allermeisten nicht mehr zu denken. Am 17. August 1942 wurden die greisen Bewohner des jüdischen Altersheims nach Theresienstadt deportiert und dort sofort ermordet.
Das Gebäude blieb nicht lange leer stehen: Die Nazis ließen die Fenster vergittern und quartierten ukrainische Zwangsarbeiterinnen ein. Auch fast alle dieser geschundenen Wesen gingen mit dem »Großdeutschen Reich« zugrunde.
Nach dem Krieg gab es kaum noch Juden in Berlin. An einem Altersheim für sie bestand deshalb kein Bedarf. Das Gebäude wurde in Volkseigentum umgewandelt und erneut einem gänzlich anderen Verwendungszweck zugeführt.
Seit geraumer Zeit residierte in der Schönhauser Allee 22 die Volkspolizeiinspektion Prenzlauer Berg. Der Bestimmungswechsel hatte etliche Umbauarbeiten erfordert. Beispielsweise war der weitläufige Kellertrakt trockengelegt worden. In ihm befanden sich jetzt acht Verwahrzellen, die Wachstube, ein Fotolabor, die Waffenkammer, mehrere Technikräume und ein Atomschutzbunker, der hermetisch verschlossen werden konnte. Bei einem Bombenabwurf über Berlin hätte in ihm der VP-Führungsstab fünf Tage überleben können. Dann wären die Sauerstoffvorräte aufgebraucht gewesen. Fünf Tage sind im Leben eines Menschen eine äußerst kurze Zeitspanne. Für einen Todgeweihten hingegen können fünf Tage außerordentlich wertvoll sein. Zeit ist relativ.
In der dritten Etage der VP-Inspektion, ganz am Ende eines langen, mit braunem Fußbodenbelag ausgelegten Korridors, gingen rechts und links jeweils zwei Zimmer ab. In ihnen war das Dezernat »Allgemeine Kriminalität« (AK) untergebracht. Das Ressort unterstand dem neununddreißigjährigen Oberleutnant der Kriminalpolizei Peter Herbst. Bei ihm handelte es sich um einen erfahrenen und kompetenten Ermittler. Er war 1,85 Meter groß, schlank und sportlich. Sein schwarzes Haar trug er, dem Dienstgrad angemessen, kurzgeschnitten.
Peter Herbst hatte – ganz im Gegensatz zu einigen anderen Dezernatsleitern – den Posten nicht aufgrund politischer Lippenbekenntnisse erhalten, sondern einzig und allein aufgrund seiner fachlichen Leistungen. Darüber hinaus verstand er sich in der Kunst der Menschenführung. Durch geschicktes Taktieren war es ihm gelungen, zwei unfähige Mitarbeiter versetzen zu lassen. Er hatte sie gegen wesentlich talentiertere Kriminalisten austauschen können.
Sein Kollektiv war nicht groß. Es entsprach der allgemein üblichen Struktur und bestand – außer ihm als dem Chef – aus drei weiteren Leuten:
Bernd Ehrenberg, Leutnant der Kriminalpolizei, war zweiunddreißig Jahre alt, klein und pummelig. Mit seinen stacheligen rotblonden Haaren und seinem vollen Gesicht wirkte er wie ein gutmütiger Räuchermecki, verfügte jedoch über einen messerscharfen Verstand und konnte jeden Lügner an der Nasenspitze erkennen. Bei wichtigen Verhören fiel ihm der Part des guten Polizisten zu.
Den bösen Vernehmer musste Gerhard Laskowski spielen. Der achtundzwanzigjährige Unterleutnant der Kriminalpolizei mit einem blassen, nichtssagenden Gesicht und dünnen weißblonden Haaren war außerdem ein Spezialist für Handschriftenerkennung und Bildauswertung. Neben seinem Beruf besaß er keine Hobbys und leistete deshalb bereitwillig Überstunden, wann immer es nötig wurde. Dies konnte er auch problemlos tun: Er war Junggeselle und würde es höchstwahrscheinlich noch für lange Zeit, wenn nicht gar für immer, bleiben.
Die einzige Frau im Team hieß Beate Streich. Sie war neunundzwanzig Jahre alt, Leutnant der Kriminalpolizei und besaß ein gewinnendes Äußeres mit gleichmäßigen Gesichtszügen, lockigem schwarzen Haar, einer schlanken Taille und einem wohlgeformten Busen. Aufgrund dieser Vorzüge, ihrem angeborenen Hang zur Schauspielerei und einer mit Bravour bestandenen Nahkampfausbildung eignete sie sich bestens als Lockvogel. Sie besaß die seltene Gabe, die Herzen von Männern jeglichen Alters und aller Bildungsschichten wie Butter in der Sonne schmelzen zu lassen. Selbst maulfaule Burschen aus dem Norden der Republik verwandelten sich in ihrer Gegenwart in Quasselstrippen und Plaudertaschen.
Damit war die Abteilung komplett. Weitere Hilfskräfte oder eine Sekretärin gab es nicht.
Im gesamten Gebäude herrschte trotz der langen Zimmerfluchten eine akute Raumnot. Eine Besserung war nicht in Sicht. Die marxistisch-leninistische Theorie besagte nämlich, dass der sozialistischen Menschengemeinschaft die Kriminalität – als einem Relikt der kapitalistischen Ausbeuterordnung – völlig wesensfremd sei. Straftaten aller Art würden deshalb im Laufe der Zeit überwunden werden.
Die statistischen Zahlen sprachen tatsächlich für diese Hypothese. Die kriminelle Belastung ging in so gut wie allen Bereichen Jahr für Jahr spürbar zurück. Deshalb würde es für die Volkspolizeiinspektion Prenzlauer Berg in absehbarer Zeit weder ein neues Gebäude noch einen Erweiterungsbau geben.
Das Dezernat AK musste notgedrungen ohne ein eigenes Schreibzimmer auskommen und sich die Stenotypistin sowie die Protokollantin mit dem Dezernat »Sozialistisches Eigentum« (SE) teilen. Aus diesem Grund blieb den Kriminalisten nichts weiter übrig, als die meisten Schriftstücke selbst zu tippen, und zwar auf uralten Continental- und Mercedes-Schreibmaschinen aus Vorkriegszeiten. Sie benutzten dabei das System »Adler«: Den Zeigefinger vorsichtig heben, ihn langsam kreisen lassen und dann blitzschnell zustoßen.
Doch in Kürze würde endlich der Fortschritt in der dritten Etage Einzug halten. Peter Herbst hatte nämlich im vorigen Monat einem Kollegen aus Erfurt bei der Fahndung nach einem betrunkenen Unfallverursacher sozialistische Hilfe leisten können. Gute Taten wurden zwar nicht immer, aber manchmal belohnt. In diesem Fall verfügte der dankbare Thüringer Kriminalist über besondere Kontakte zum VEB Robotron-Optima Büromaschinenwerk, einem Robotron-Kombinatsbetrieb. In dem Erfurter Büromaschinenwerk wurden unter anderem kompakte elektrische Schreibmaschinen hergestellt. Zu »Testzwecken« sollten zwei dieser graublauen Wunderwerke der Technik als sogenannte Dauerleihgaben an das Dezernat AK der Volkspolizeiinspektion Prenzlauer Berg geliefert werden.
Voller Vorfreude auf dieses wichtige Ereignis hatte sich an diesem Vormittag die Mannschaft zur regulären Dienstberatung im Besprechungsraum zusammengefunden.
Jeder Kriminalist bearbeitete stets mehrere Fälle gleichzeitig. Dies geschah allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Entsprechend der zugeteilten Priorität waren die Rückseiten der grauen Aktenordner blau, gelb, grün oder rot gekennzeichnet. An diesem Tag lagen jedoch ausschließlich rotmarkierte Mappen auf dem mit billigem Birkenholzimitat furnierten Konferenztisch.
Peter Herbst machte ein ernstes Gesicht, und er hatte allen Grund dazu. »Genossen«, sagte er, »1110-835 hat wieder zugeschlagen. Heute in den frühen Morgenstunden. Die Meldung kam gerade auf meinen Tisch. Jetzt sind wir bei 1110-836 angelangt. Das Opfer heißt Ilka Friesecke. Hier sind die bislang bekannten Einzelheiten.« Der Oberleutnant ließ ein Dossier herumgehen.
In vielen Strafanzeigen stand oben im Kopf neben der Vorgangsnummer statt eines Namens »Täter unbekannt«. Das konnte auch gar nicht anders sein. Um jedoch die verschiedenen Fälle besser voneinander unterscheiden zu können, wurden sie von den Kriminalisten personifiziert. Das geschah ausschließlich intern und tauchte in keinem offiziellen Protokoll auf. Manche Dezernate wählten für die noch anonymen Gesetzesbrecher je nach wahrscheinlichem Geschlecht Phantasienamen, wie »Anton« oder »Berta«, aus. Andere bevorzugten Begriffe, die in einem Zusammenhang mit dem Fall standen, wie zum Beispiel der »Schnitter« bei einem Messerstecher oder der »Streichholzmann« bei einem Brandstifter.
Das Dezernat AK hatte sich für ein völlig anderes System entschieden. Der Verbrecher erhielt keinen fiktiven Namen, sondern bekam eine zusammengesetzte Zahl zugeteilt, die aus dem Datum der ersten bekannten strafbaren Handlung bestand. Bei Wiederholungstaten wurde an die Jahreszahl die Ziffer der bekannt gewordenen weiteren strafbaren Handlungen angefügt.
Diese Praxis hatte den Vorteil, dass sich die Kriminalisten nicht von vornherein auf ein bestimmtes Täterprofil festlegen mussten. Die Ermittlungen blieben völlig offen, solange es an noch konkreten Anhaltspunkten fehlte. Die Suche nach einem »Streichholzmann« könnte nämlich durchaus bei einem Kind enden, das lediglich gekokelt hatte, und der gesuchte »Anton« könnte in Wirklichkeit eine »Berta« gewesen sein.
Die Zahlenreihe 1110-836 bedeutete, dass sich die erste Tat am 11. Oktober 1983 ereignet hatte und dass ihr inzwischen fünf weitere gefolgt waren. Im vorliegenden Fall handelte es sich um einen Vergewaltiger, der immer nach dem gleichen Muster vorging: Er überraschte alleinstehende Frauen mitten in der Nacht in ihrer eigenen Wohnung! Lediglich in einem einzigen Fall war es bisher zu Handgreiflichkeiten gekommen. Das Opfer hatte glücklicherweise nur geringe äußere Verletzungen davongetragen. Bei den psychischen Schäden sah es hingegen ganz anders aus.
Keine einzige Frau hatte in der Dunkelheit das Gesicht des Verbrechers erkennen können. Sie beschrieben ihn mehrheitlich als mittelgroß, schlank, athletisch, gepflegt und glattrasiert. Er hatte weder nach Alkohol noch nach Schweiß oder nach Tabakrauch gerochen. Es gab keinerlei Einbruchsspuren. In jedem Fall hatte er – offensichtlich, um seine Opfer zu verhöhnen – eine einzelne Rose am Tatort zurückgelassen. Die Wohnungen der Opfer lagen alle in der dritten oder vierten Etage. Es war völlig ausgeschlossen, sie von außen über die Fenster zu erreichen.
Die meisten Frauen konnten sich ziemlich genau daran erinnern, dass sie ihre Wohnungstüren fest abgesperrt hatten. Es blieb daher ein völliges Rätsel, wie es dem Täter gelungen war, in allen sechs Fällen unbemerkt in die fremden Wohnungen einzudringen.
Überdies konnten sich die Kriminalisten keinen Reim darauf machen, auf welche Weise der Verbrecher seine Opfer ausgewählt hatte. Zwischen den Frauen gab es keinerlei erkennbare Verbindungen. Sie besaßen weder den gleichen Freundes- noch Bekanntenkreis. Ebenso wenig arbeiteten sie in denselben Betrieben oder besuchten dieselben Klubs, Lokale und Sportvereine.
Gleichwohl bestanden zwischen ihnen gewisse Gemeinsamkeiten: Alle sechs Frauen waren Anfang zwanzig bis Mitte dreißig, brünett bis dunkelblond und relativ gutaussehend. Sie kleideten sich geschmackvoll und gingen einem anständigen Beruf beziehungsweise einem Hochschulstudium nach: Steffi Jadlowski war Krankenschwester an der Charité und Katja Immerath Schnittassistentin bei der DEFA. Heiderose Schmollak arbeitete als S-Bahn-Aufsicht, und Michaela Wagemann war Stewardess bei der Interflug. Zwei der jungen Frauen studierten noch: Eva Wenzel an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« und Ilka Friesecke an der Humboldt-Universität.
Darüber hinaus wohnten alle sechs Opfer im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, wenn auch weder im selben Haus noch in der gleichen Straße. Alle diese Frauen waren zum Tatzeitpunkt im Prinzip mehr oder weniger alleinstehend gewesen: Heiderose Schmollak und Ilka Friesecke hatten sich kurz davor von ihrem jeweiligen Freund getrennt. Steffi Jadlowski und Katja Immerath waren beide frisch geschieden, was offensichtlich damit zu tun hatte, dass sie häufig Doppelschichten machen mussten und deshalb keine Zeit für ein geregeltes Familienleben hatten. Eva Wenzel unterhielt eine konspirative Liebesbeziehung mit einer Dozentin an ihrer Hochschule. Michaela Wagemann war mit einem verheirateten Piloten der Interflug liiert, mit dem sie sich allerdings nur in Hotels im Ausland traf.
»Wir brauchen dringend einen Erfolg. So kann es nicht weitergehen. Die Genossen im Präsidium werden bereits unruhig«, sagte Peter Herbst bekümmert.
»Ich tippe auf eine Schlosserei im Prenzlauer Berg. Die Frauen haben sich dort Ersatzschlüssel anfertigen lassen. Der Täter hat weitere Duplikate gemacht und behalten«, meinte Unterleutnant Laskowski.
»Das haben wir gleich am Anfang überprüft«, entgegnete Beate Streich. »Lediglich Heiderose Schmollak hat ihr Türschloss wechseln lassen. Das war vor drei Jahren gewesen.«
»Dann ist es ein KWV-Mitarbeiter. Der kommt problemlos an sämtliche Schlüssel heran.«
»Auch das ist eine Sackgasse. Nur vier Gebäude werden von der Kommunalen Wohnungsverwaltung betreut. Zwei Mietshäuser befinden sich noch in Privatbesitz. Sie werden von den Eigentümern selbst bewirtschaftet, und die sind beide über siebzig und bereits recht wackelig auf den Beinen«, ließ Leutnant Ehrenberg auch diese Seifenblase platzen.
»Wir müssen der Spur mit den Blumen nachgehen. Rosen sind sehr schwer im Handel zu bekommen«, warf Beate Streich ein, die sich – anders als die Männer – regelmäßig einen Blumenstrauß für den eigenen Frühstückstisch besorgte.
»Das ist ein wichtiger Hinweis«, ergänzte Bernd Ehrenberg. »Rose ist nämlich nicht gleich Rose. Unsere Kriminaltechniker meinten, die zwei ersten Exemplare seien gewöhnliche Rabattenrosen gewesen. Bei der dritten handelte es sich um eine Edelrose, eine sogenannte Teehybride. Die vierte war eine Floribunda, die durch eine Kreuzung von einer Teehybride mit einer Wildrose entsteht. Die übrigen zwei sind Kletterrosen gewesen. Sämtliche Rosen waren rot, was bei Blumengeschenken gemeinhin als ein Zeichen für Liebe gilt.«
»Du willst mir doch nicht weismachen, der Verbrecher sei in seine Opfer verknallt gewesen?«, unterbrach ihn Beate Streich.
»Auf eine gewisse Weise schon. Die meisten dieser Typen sind sexuell frustriert und verspüren einen latenten Hass auf Frauen im Allgemeinen. Deshalb haben sie nicht den geringsten Skrupel, jeden Widerstand mit roher Gewalt zu brechen. Sie schrecken sogar vor einem Mord nicht zurück, um ihre Tat zu vertuschen. Anders unser Täter. Es scheint fast so, als ob er seine Opfer nachträglich um Verzeihung bitten wollte. Nicht umsonst gibt es eine Symbolik in der Blumensprache. Rote Rosen sind ein Sinnbild der Liebe. Rosa Rosen stehen für Jugend und Schönheit. Orange Rosen gelten als Gleichnis für Glück und Hoffnung. Doch darauf wollte ich gar nicht hinaus.«
»Sondern?«
Leutnant Ehrenberg setzte fort: »Wie Beate richtig sagte, kann der Täter nicht einfach in einen Blumenladen gehen und dort eine Rose kaufen. Er muss deshalb eine andere Bezugsquelle haben. Dazu fallen mir drei Möglichkeiten ein: Entweder arbeitet der Täter in einem Blumenladen, in einer Gärtnerei, oder er ist ein privater Züchter. Wir sollten uns mit dem Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter in Verbindung setzen und dort nach einer speziellen Rosen-Sektion fragen. Unter den Blumenfreunden wird es nicht anders sein als bei den Briefmarkensammlern, wo jeder jeden kennt. Und noch etwas: Alle Exemplare, die unser Täter verwendet hat, wurden zuvor über einen längeren Zeitraum in einem Kühlhaus aufbewahrt.«
»Hast du sie in die Hand genommen und es an der Temperatur festgestellt?«
»Nein, das Labor hat es herausgefunden. Beim Einfrieren bilden sich Eiskristalle, die die Zellstruktur verändern.«
»Dann stammt der Täter womöglich aus Westberlin. Dort kann man Rosen das ganze Jahr über in Blumenläden kaufen. Wenn der Bursche tatsächlich immer nur für wenige Stunden in die Hauptstadt der DDR kommt, ist es reiner Zufall, wenn wir ihn stellen«, gab Unterleutnant Laskowski zu bedenken. »Vielleicht ist es sogar ein CIA-Agent. Diese Burschen verfügen über Spezialwerkzeuge, mit denen sie jede Tür aufbekommen, ohne Spuren zu hinterlassen.«
»Genossen, wir sollten nicht zu sehr vom Wege abkommen«, beendete der Oberleutnant die Spekulationen. »An verkleidete Bonner Ultras oder gar verirrte Außerirdische, die als Rosenkavaliere daherkommen, glaube ich erst, wenn ich sie mit eigenen Augen sehe. Auch die Westberliner ›Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit‹ kommt nicht in Frage, denn sie hat sich bereits 1959 aufgelöst. Aber der Hinweis auf spezielle Dietriche ist nicht von der Hand zu weisen. Konzentrieren wir uns deshalb bei unserer Suche auf einen mittelgroßen, schlanken, athletischen, gepflegten und glattrasierten Mann zwischen zwanzig und dreißig Jahren, der sich für die Rosenzucht interessiert und über ein großes Talent als Schlosser verfügt.«
»Wir sollten die Öffentlichkeit einschalten«, schlug Unterleutnant Laskowski vor. »Das erhöht den Fahndungsdruck, der Täter wird nervös und macht Fehler.«
»Das Verfassen einer Pressemeldung liegt leider nicht in unserer Kompetenz«, erwiderte Leutnant Ehrenberg. »Dafür ist einzig und allein die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und ohne direkten Befehl von ganz oben unternehmen die Genossen dort reineweg gar nichts.«
»Möglicherweise ist die Entscheidung bereits gefallen«, offenbarte der Oberleutnant, »wenn auch nur indirekt. Ich habe nämlich die Mitteilung bekommen, dass uns in der nächsten Woche am Dienstagnachmittag um drei Uhr ein Redakteur der Berliner Zeitung aufsuchen wird. Er schreibt an einer Serie über die Arbeit der Volkspolizei. Eine Station wird unser Dezernat sein. Wir müssen den Burschen mit Material versorgen. Den Fall 1110-833, also den Anschlag auf Katja Immerath, halte ich für besonders gut geeignet. Ich werde nachher den Chef fragen, was er darüber denkt. Alles Weitere ist nicht unser Problem. Die Freigabe des Artikels wird nicht von uns, sondern von der Hauptverwaltung erteilt.«
Schießbude
»Kulturpark Berlin – immer ein Erlebnis! Heute, 13.00 Uhr, Start in die Saison ’84!«
Neue Zeit, Sonnabend, 7. April 1984
Die blecherne Musik tönte sinnlos über den fast völlig leeren Platz. Außer einem betrunkenen Armisten mit Gefreitenstreifen auf den Schulterstücken, der auf einem Papierkorb saß und seinen Kopf in den Händen vergraben hielt, gab es keinen Besucher, der ihr hätte zuhören können. Ein Rummel bei eiskaltem Nieselregen ist so ziemlich die ödeste Sache der Welt. Doch das tätowierte Völkchen der Heimatlosen gab nicht auf. The show must go on. Irgendwann musste die Sonne doch wieder hervorkommen. So war das Wetter im April nun einmal. Lediglich die beiden Kinderkarussells hatten bereits dichtgemacht.
Die alte Frau mit der knorrigen Nase in der Würfelbude schien den Zuckerwattestand zu fixieren – tatsächlich schaute sie nirgendwohin. Ihr Blick ruhte anderswo in naher Zukunft, dort, wo sie bald sein wollte: bei Wilhelm, ihrem kürzlich verstorbenen Mann, Schausteller in der dritten Generation. Es gab keine Nachfahren. Der hölzerne Wohnwagen würde als Geräteschuppen auf einer Datsche enden.
Die beiden langhaarigen Losverkäufer saßen auf den »Stufen zum Glück« und tranken schmatzend Kaffee. Sabrina, die schwebende Jungfrau von einst, schenkte ihnen freudig nach. Sie liebte ihre Jungs. Selten genug blieben die Burschen länger als eine Saison, obwohl (oder vielleicht gerade weil) sie ihnen alles gab, was sie hatte.
Die drei Männer vom »Walzertraum« spielten Skat mit einem abgegriffenen Deutschen Blatt aus Altenburg. Sechs Stunden schon, um die Zehntel. Das Zockerfieber hatte sie ergriffen. Momente wie diese gab es selten genug. Wenn sie da waren, musste man sie ohne Skrupel ausleben.
Enrico Poggio hockte im geräumigen Wohnwagen, beide Söhne plus Schwiegertöchter tuschelten leise. Der Boss strich sich gedankenverloren über sein schmales Bärtchen, die glattzurückgekämmten Haare auf seinem Kopf glänzten im Licht der niedrigen Hängelampe aus Bast. Auf dem Tisch dampfte die Knoblauchsuppe. Keiner wagte, zu essen. Die Mutter an der Tür nickte beruhigend mit dem Kopf. Sie kannte ihren Mann. Es gab keinen Grund zur Besorgnis. Hinter seiner undurchdringlichen Miene verbarg sich mühsam zurückgehaltene freudige Erregung.
Enrico Poggio ergriff seinen Löffel, tauchte ihn in die aromatisch duftende Flüssigkeit und schlürfte geräuschvoll. Damit war das Eis getaut. Die Söhne brachen das Weißbrot und stützten die Ellenbogen auf, die Schwiegertöchter machten spitze Münder.
»Die Bilanz ist gut. Wir verdienen ständig besser, denn die Konkurrenz wird immer weniger. Dafür gibt es große Schwierigkeiten im maschinellen Bereich und beim Personal, wie ihr wisst. Meine alten Methoden taugen nicht länger. Ihr seid jung, jetzt müsst ihr euch bewähren. Ich übergebe euch das Geschäft. Ab sofort, ab heute! Ihr müsst modernisieren, neue Technik besorgen, der Zukunft voraus sein, auch wenn es schwer wird. Versucht, Karussells aus dem Ausland zu beschaffen, denn in der DDR läuft nichts mehr. Mutter und ich bringen die Saison noch zu Ende, dann wollen wir uns zurückziehen – falls wir es tatsächlich fertigbringen.«
»Wer soll der neue Chef sein, Vater?«, fragte Guiseppe, der jüngere der beiden Brüder, erwartungsvoll.
»Franco«, lautete die klare und bestimmte Antwort. Das hoffende Leuchten in Guiseppes Augen erlosch.
Herbert Hartwig an der Schießbude hatte keine Ahnung von diesem Gespräch, und falls er etwas davon gewusst hätte, wäre es ihm auch egal gewesen. Er benutzte die Abwesenheit von Guiseppe, um in Ermangelung von etwas Besserem eine Flasche Lockwitzer Mehrfrucht-Tischwein zu öffnen und gurgelnd aus ihr zu trinken. Die Schmerzen in seinem Körper ließen sich mit nichts mehr betäuben, und die Hände zitterten vor dem ersten Schluck noch genauso wie nach dem letzten. Nur die nächtlich kurzen Momente der totalen Besinnungslosigkeit gaben ihm Ruhe, die restlichen Stunden der Tage waren mit wechselnden Martern ausgefüllt. Nach dem Aufstehen krallte sich die Übelkeit um seinen Hals, erst nach zwei, drei Stunden war er fähig, Nahrung in irgendeiner Form zu sich zu nehmen. Lediglich die Nachmittage versanken in Watte, welche die Qualen dämpfte. Städte, Menschen, Jahreszeiten – ein bunter Wirbel ohne Sinn.
Der Mann von der Schießbude hatte sich trotzdem ein Hobby bewahrt: Begeistert sah er sich, so oft es ging, Pornobilder an. Ständig trug er einen dicken Packen mehrfach abfotografierter Aufnahmen aus den fünfziger Jahren in der Tasche. In natura lief schon lange nichts mehr. Herbert Hartwig, 48 Jahre alt, seit fünf Jahren schwerer Alkoholiker, von der Schnaps-Magersucht befallen, von Krampfadern, Ekzemen und schuppigem Haarausfall geplagt, war möglicherweise seit ein, zwei Jahren mit keiner Frau mehr zusammen gewesen. Er wusste es nicht. Genauso gut hätte er in der vergangenen Woche die knorrige Alte von der Würfelbude gehabt haben können, bevor er nach zwei kleinen Flaschen Goldbrand morgens auf dem Fußboden vor ihrem Bett aufwachte. Oder jene Kräuterhexe aus dem letzten Ort, die hinter dem Bierzelt für eine Flasche Bowle-Wein die rosaroten Schlüpfer herunterzog und ihre grauhaarige Mumu zeigte. Mit der zusammen hatte er auch einige Gläser genommen. Rostrote Nebel ballten sich. Fettige Schlieren auf dem Spiegel der Erinnerung. Alles dahinter blieb unsichtbar. Gestern, heute, morgen – ein diffuser Brei aus Gedankenfetzen im schmerzenden Kopf des schweren Trinkers.
Herr Hartwig hob die Hand und ballte sie zur Faust. Der besoffene Armist war erwacht und winkte grinsend herüber. »Zeehhn Schusss, Meisssder«, lallte er. Der Schießbudenmann nahm Anlauf und füllte das Magazin. Die kleinen grauen Bleikugeln auf dem gelben Staubtuch spritzten auseinander. »Aus Apfelkernen und Nudelsternen hab ich ihr eine kleine Kette gemacht«, brummte er zur Lautsprechermusik. Wer war nur der Sänger gewesen, damals, in den sechziger Jahren? Christian Schafrik oder Frank Schöbel oder …? Es wollte ihm nicht einfallen.
Der Soldat hielt das Luftgewehr wie Gojko Mitić eine Winchester. Peng!Peng! Die Schüsse knallten auf das zerschabte Blech. Die weißen Röhrchen blieben unbeschädigt. Der Gefreite begann, zu weinen. Herbert Hartwig reichte ihm die Flasche Mehrfrucht-Tischwein. »Zieh dir einen rein, Kumpel. Was anderes hilft jetzt auch nicht mehr.«
»Sie hat mich verlassen. Als ich gestern auf Urlaub kam, gab sie mir meine Briefe gebündelt zurück. ›Ich bin des ewigen Wartens leid!‹, schrie sie mich an, die treulose Tomate. Und ich hatte die Verlobungsringe in der Tasche«, sagte der Soldat, ohne zu lallen, mit überraschend fester Stimme.
Der Trinker fragte mitfühlend, um von dem unangenehmen Thema abzulenken: »Willst du ein paar schweinische Fotos sehen?«
Doch der lichte Moment war schon wieder vorüber. Die Augen des Armisten verloren ihre Schärfe, wurden milchig blassblau. Er stolperte nach hinten und wäre beinah hingefallen.
Herbert Hartwig sah dem Davontorkelnden nach und hatte im nächsten Augenblick wieder fast alles vergessen, was bis dahin passiert war. Rein mechanisch füllte er einige Magazine und legte sie auf den zerschlissenen schwarzroten Kokosläufer vor sich. Wie lang würde er hier heute noch stehen müssen? Er wusste es nicht. Genauso wenig, was mit ihm war, wo er sich im Augenblick befand. Letztere Überlegung machte ihm Angst, doch er wusste kein Mittel dagegen. »Pflicht, Pflicht, Pflicht!«, summte es in seinem Schädel. Die Berufsehre war ihm noch geblieben. Er würde an seinem Posten ausharren, mochte da kommen, was wolle!
In der Redaktion I
»Werner Pöppel kommt gerade von der Sitzung des Vorstands seiner Kleingarten-Sparte ›Frohsinn‹. Er ist als Kassierer Mitglied des Vorstands. In aller Ruhe hängt er seine Sachen auf, ehe er seiner Frau berichtet.«
Berliner Zeitung, Montag, 9. April 1984
Michael Riedel, Lokalredakteur bei der Berliner Zeitung, der außerdem seit kurzem auch die Rubrik »Aus der Arbeit der Volkspolizei« mit Artikeln versorgte, entsprach haargenau jenem Klischee, welches mehrere Hollywoodfilme aus der Reihe der sogenannten Enthüllungsgeschichten von einem sportlich-dynamischen Journalisten geprägt hatten: Er trug verwaschene Levi’s-Jeans (das Geschenk einer inzwischen leider verstorbenen Tante aus dem Westen), ein wollenes Cowboyhemd (Eigenimport aus Polen) sowie eine braune Cordjacke mit Lederflicken an den Ärmeln in Höhe der Ellenbogen. Das Jackett stammte aus der Jugendmode, die Flicken hatte der Journalist eigenhändig zugeschnitten und angenäht. Der Unterricht an der Polytechnischen Oberschule im Fach Nadelarbeit zahlte sich nach vielen Jahren immer noch aus.
Michael Riedel hatte kurzgeschnittene Haare, einen gestutzten Vollbart und sympathische Lachfalten um die Augen. Der Lokalredakteur rauchte am liebsten Pfeife, auch wenn er deshalb bereits mehrfach aus Kneipen geflogen war, denn in Ermangelung ausländischer Tabake musste er öfter, als ihm lieb war, auf die Sorte »Gelber Prestige« zurückgreifen. Diese grobgeschnittene Mischung roch aromatisch wie Vanillepudding oder stank ganz fürchterlich – je nach den olfaktorischen Wahrnehmungen der Mitmenschen.
Der Großraum im Gebäude vom Berliner Verlag, einem Hochhaus am Alexanderplatz, erinnerte stark an ein Zeitungsbüro in einem amerikanischen Krimi. Wie bei der Washington Post klingelten auch hier ununterbrochen die Telefone, ratterten Fernschreiber, rauschte die Rohrpost und liefen lautschwatzende Leute hin und her, die gewichtig mit Papieren raschelten. Erst auf den zweiten Blick erkannte der flüchtige Betrachter den gravierenden Unterschied zu jedem anderen Großraumbüro der westlichen Hemisphäre: Was völlig fehlte, waren IBM-Computerarbeitsplätze und Xerox-Kopiergeräte. Statt flacher Tastaturen klapperten hier ausschließlich mechanische Schreibmaschinen.
An diesem Morgen saß Michael Riedel ganz entspannt in seinem zwei Meter mal zwei Meter großen Kästchen hinter einer halbhohen Trennwand, paffte aus einer kurzen Stummelpfeife wie eine dampfbetriebene Rangierlok auf dem Abstellgleis und tat etwas, was nur wenige seiner Kollegen zu tun pflegten: Er blätterte in der neuesten, acht Seiten starken Ausgabe seiner Zeitung. Die Schlagzeilen stimmten zwar nicht neugierig, aber dafür optimistisch: »Höchstleistungsschichten«, »dynamisches Wirtschaftswachstum«, »soziale Sicherheit«, »reale Demokratie«, »Schöpferkraft«, »Wettbewerbsauftakt«, »Bestarbeiter melden sich zu Wort«.
Michael Riedel gähnte laut und vernehmlich. Gegen die heranschleichende Müdigkeit hatte der lauwarme, ölig schimmernde Kantinenkaffee unbekannter Zusammensetzung keine Chance. Darüber konnte auch der niedrige Preis von 50 Pfennigen pro Tasse nicht hinwegtrösten. Die große Uhr über der zweiflügeligen grauen Metalltür zeigte auf zwei Minuten vor zehn Uhr. Der lange Tag des Redakteurs hatte gerade erst begonnen. Rein theoretisch war bereits um neun Uhr Dienstbeginn gewesen. Aber wer wollte, brauchte auch erst um elf Uhr zu erscheinen, ohne sich entschuldigen zu müssen. Dafür ging es abends meist sehr lange. Um die vielen Überstunden kümmerte sich kein Mensch.
Montags galt die Elf-Uhr-Kulanz-Regel allerdings nicht. An diesem Tag mussten alle Journalisten spätestens kurz vor zehn Uhr im Hause sein. Keiner durfte ohne guten Grund zu spät kommen oder ganz und gar fehlen. Immer zum Wochenbeginn fanden nämlich die Dienstberatungen statt. In ihnen verkündete der Abteilungsleiter die neuen Erkenntnisse, die er in der vorausgegangenen Redaktionskonferenz gewinnen konnte.
»Abteilungssitzung, Abteilungssitzung«, zwitscherte Martina Kaatz, die Sekretärin der Lokalredaktion. Martina liebte enge Röcke, Strümpfe mit Naht, hochhackige Schuhe und seidene Blusen, die ihren ansehnlichen Busen weich umflossen. Einmal im Jahr ließ sie sich völlig unverhofft von einem Glücklichen umlegen, ansonsten versuchte sie – mehr oder weniger erfolgreich –, allen Männern im Großraum den Kopf zu verdrehen.
Michael Riedel war ihr bevorzugtes Opfer, weil er gegen gewellte blonde Haare und weitaufgerissene blaue Puppenaugen immun zu sein schien. Nach einer Redaktionsfeier hatte Martina einmal mit voller Absicht den letzten Bus verpasst und Michael gebeten, sie nach Hause zu bringen. Am nächsten Tag erzählte sie dann allen Kollegen unter dem strengsten Siegel der Verschwiegenheit, der Kollege Riedel, ein Lustmolch vor dem Herrn, habe versucht, sie in ein Gebüsch zu zerren. Allerdings war es kein Gebüsch, sondern ihre Wohnung gewesen. Obendrein hatte er nicht an ihr, sondern sie erfolglos an ihm gezogen.
Michaels Ruf in der Redaktion tat diese Skandalgeschichte keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Selbst die größten Moralapostel der Berliner Zeitung waren sich insgeheim darüber im Klaren, dass sie – sofern sie zum männlichen (teilweise aber auch zum weiblichen) Geschlecht zählten – mit der kurvenreichen Blondine allein an einem verschwiegenen Ort ebenfalls wie Butter in der Sonne dahingeschmolzen wären.
Außer vor Michael hätte Martina lediglich noch vor ihrem Abteilungsleiter Lothar Dolling und dessen erstem Stellvertreter Christian Hacker sicher sein können, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen: Der eine wollte nicht, und der andere konnte nicht.
Lothar Dolling lebte (wie viele andere Journalisten auch) in panischer Angst davor, in Ungnade fallen zu können. Infolgedessen war er so unterhaltsam wie eine Schlaftablette. Freiwillig wäre der Abteilungsleiter nie einen Millimeter nach links oder rechts vom Pfad der Tugend abgewichen. Sein Problem bestand nur darin, dass er oftmals nicht die offizielle Linie kannte. Das geschah vornehmlich dann, wenn selbst der Chefredakteur Karl Stellmacher im Dunklen tappte. Es gab genügend Redakteure, die sich nun in abgeschiedenen Kreisredaktionen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen bewähren mussten, weil zu ihrem Pech zwischen Andruck und Auslieferung der Zeitung ein winziger Umschwung in der politischen Meinung der Partei- und Staatsführung erfolgt war. Lothar Dolling vermied deshalb jedes Risiko. Aus den Artikeln, die er zu redigieren hatte (und in der Lokalredaktion gingen grundsätzlich alle Artikel über seinen Tisch), strich er in unterwürfiger Selbstzensur jedes Reizwort, jede kritische Äußerung sofort heraus.