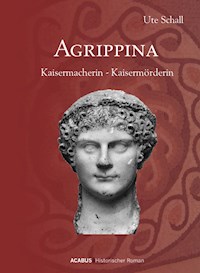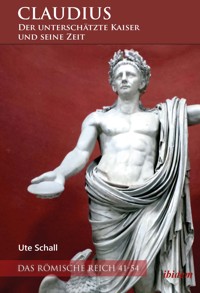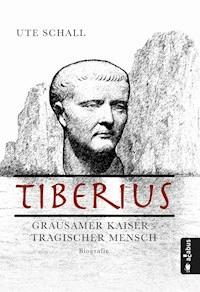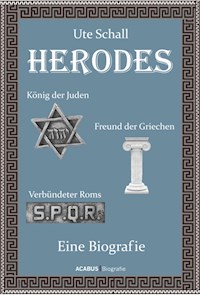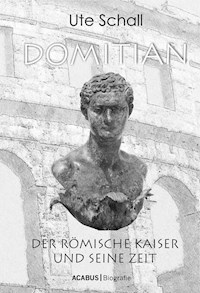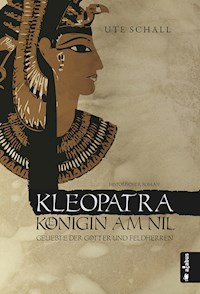29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Noema
- Sprache: Deutsch
Der Niedergang des Habsburger-Reiches läutete in Böhmen und Mähren auch das Ende der jahrhundertealten deutschen Kultur ein. Gleich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wurde ihr Einfluss im Sudetenland nahezu verdrängt, nach dem Zweiten wurden die Deutschen enteignet und aus ihrer Heimat gewaltsam vertrieben. Nur unter schwersten Bedingungen und nach manchen Rückschlägen fanden sie eine neue Heimat. In ihrer groß angelegten Erzählung spürt Ute Schall der wechselvollen Vergangenheit dreier Familien nach – den Lazarus’, Indras und Lehnarts -, die, verwandtschaftlich mit einander verbunden, in Mähren beheimatet waren und deren Spuren sich teilweise bis in napoleonische Zeit zurückverfolgen lassen – eine Geschichte, die stellvertretend steht für all jene, denen ein ähnliches Schicksal beschieden war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1142
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Meiner Schwiegertochter Natalia herzlich zugeeignet
Inhaltsverzeichnis
Aufwärts…
Vorwort
Erster Teil
Die unbequeme Tochter
Am Anfang war ein Forsthaus
Geschichte Napoleon Bonaparte
… und ein herrschaftliches Gut
Abgründe
Alltag einer Ehe
Das Wunder
Geschichte Die Hochzeit des 19. Jahrhunderts
Der Herr und das Mädchen
Der Name Lazarus
Zweiter Teil
Gestatten, mein Name ist Indra
Die Indras
Freude und Leid
Schicksalsjahre
Bitte recht freundlich…
Ereignisse
Die Ehrung und andere Vorkommnisse
Die späte Hochzeit
Wanderer zwischen den Welten
Krieg
Geschichte Das Ende der Habsburger
Dritter Teil
Die andere Seite
Wehe den Besiegten!
Fernes, fremdes Land
Abschied
Die Überfahrt und „Küss die Hand, Großmama!“
Geschichte Die wilden Zwanziger…
Lebenslinien
Glücklos
Traurige Jahre
Geschichte „Heim ins Reich!“
Weitere Schicksale
Wohin soll das „führern“?
Kriegsbeginn
Geschichte Der Zweite Weltkrieg
Geschichte Die Endlösung (1939 bis 1945)
Krieg – der Anfang
… und kein Ende
Am Wendepunkt
Tod
… und Leben
Der Anfang vom Ende
Ende mit Schrecken
Geschichte Die traurige Bilanz
Die Vertreibung
Geschichte Der Neubeginn
Vierter Teil
Neubeginn
Zu unbekannten Ufern
Ein neuer Anfang
Die Nachkriegsjahre
Unruhige Zeiten
Irrungen, Wirrungen
Wie die Zeit vergeht
Eros und Tanatos…
Erinnerungen
Haus ohne Hüter
Ein Wort zum Schluss
anno 1996
Aufwärts…
„Sie ist wieder da, Großmama, die rote Kalesche. Ich habe es dir ja versprochen. Noch ist sie klein und unscheinbar. Aber sie wird groß werden, und stattlich wird sie sein, ein prunkvolles Gefährt, und alle werden sie bewundern und „Ah!“, rufen, und ihr die gebotene Achtung erweisen. Und sie wird uns hinauftragen zu den Sternen.
Per aspera ad astra.
An einem anderen Ort. Zu einer anderen Zeit. In einem anderen Leben.“
Maximilian betrachtete die bleichen Züge, die ihm vertraut und doch so fremd waren. Das Gesicht der Großmutter war eingefallen, strahlte aber Ruhe und Frieden aus. Und für einen kurzen Augenblick war ihm, als husche über die blassen Lippen der Toten ein verschwörerisches Lächeln.
Dann drückte er der alten Dame noch einmal die Hand, stand auf und stieg die wenigen Stufen hinab, die zur Straße führten. Dort wartete, rot lackiert wie dunkles Blut, sein erster eigener Wagen, ein kleines, schnuckeliges Gefährt, das unter der mittäglichen Sonne glänzte.
Noch einmal blickte der junge Mann zurück, zu den Fenstern von Großmutters Haus hinauf, in denen sich das Blau des Himmels spiegelte, klar und makellos. Dann drehte er den Schlüssel um, legte den Gang ein und fuhr davon, einer hoffnungsvollen Zukunft entgegen.
Vorwort
Der Höhepunkt der Geschichte, die ich zu erzählen habe, liegt viele Jahrzehnte zurück. Er reicht in eine Zeit, in der die Röcke der Damen noch züchtig die Knöchel bedeckten, die Hüte, so groß wie Wagenräder, auf hochgesteckten Löckchen schwankten und die Taillen so eng geschnürt waren, dass Ohnmachtsanfälle an der Tagesordnung und geradezu Mode waren. Der Beginn meiner Erzählung aber ruht noch tiefer im Brunnen der Vergangenheit. Es ist die Geschichte einer Familie, der von Generation zu Generation weitergereichte Bericht über ihren Aufstieg und ihren Fall, der stellvertretend steht für das Schicksal all derjenigen, denen ein Herr Hitler und seine Schergen alles genommen haben, was ein lohnenswertes und erfülltes Leben ausmacht, Wohlstand, gesellschaftliche Stellung, Heimat und eine menschenwürdige Existenz.
Mein Bericht spielt sich zu einem Gutteil in der Hauptstadt Mährens ab, die damals Brünn hieß und heute Brno genannt wird, die vor dem Krieg fast eine halbe Million Einwohner gezählt haben soll – so berichten es jedenfalls die Brünner - und heute nur noch etwas mehr als die Hälfte, wenngleich sie sich, so hört man, als Zentrum moderner Techniken und Industriestandort allmählich erholt. Brünn war zu jener Zeit, allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz, eine deutsche Stadt, die tschechische Bevölkerung befand sich in der Minderheit. Doch hatten sie über Jahrhunderte einigermaßen friedlich zusammengelebt, Deutsche, Tschechen und Juden, wenn auch die Deutschstämmigen gern unter sich blieben. Man pflegte die eigene Kultur und traf sich nur mit seinesgleichen, ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert vor allem im Deutschen Haus, das geradezu symbolisch und als Provokation für den Anspruch stand, einer vermeintlichen gesellschaftlichen Elite anzugehören. Brünn war die Heimat von deutschen Wissenschaftlern und Künstlern, die Weltruhm genossen, Sigmund Freud etwa, Robert Musil und Gustav Mahler. Gregor Mendel dachte dort über die Erbgesetzmäßigkeit nach.
Die mährische Hauptstadt galt auch als „Vorort“ von Wien, das über die bereits im Jahr 1839 eingerichtete Eisenbahnlinie rasch zu erreichen war, und, glaubt man auch hier ehemaligen Brünnern, so bemühte sie sich stets, der großen Schwester in jeder Hinsicht nachzueifern.
In Wien regierte Franz Joseph I., Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Eigentlich hatte er schon immer regiert. Es gab kaum noch jemanden, der sich erinnerte, dass jemals ein anderer regiert hätte. Alt war er, der Kaiser, und einsam. Aber das war er ja schon immer gewesen. Sein Leben war geprägt von Verzicht und Verlust: Die kleine Sophie hatte ihn verlassen, das Töchterl, das ihm während einer Ungarnreise zweijährig gestorben war. Wie lange war das her! Es kam ihm vor wie eine Tragödie aus einer anderen Zeit; den Bruder hatte man ihm genommen, Maximilian, den Kaiser von Mexiko. Rudolph, sein einziger Sohn, hatte sich erschossen, und sogar seine Elisabeth, die geliebte Sisi, war ihm vorausgegangen. Aber sie hatte ja ohnehin nie seine Einsamkeit teilen wollen. Immer war sie herumgehetzt in der ganzen Welt, ausgebrochen aus dem goldenen Käfig, in den man sie schon mit 16 Jahren gesperrt hatte, geflüchtet vor ihren Pflichten als Landesmutter und vor ihm, ihrem Mann und Kaiser. Auf Madeira hatte sie sich monatelang von einer Krankheit erholt, in England Freunde besucht, auf Korfu einen Palast gebaut (für den sie sich, kaum dass er fertig gestellt war, nicht mehr interessierte). Nur den Ungarn hatte sie immer ihre volle Aufmerksamkeit geschenkt, ihnen die Treue gehalten. Eine skandalumwitterte Frau. Und selbst ihr gewaltsames Ende in Genf sorgte noch einmal für weltweite Aufmerksamkeit…
Franz Josephs Bart war über allen Sorgen grau geworden, das dünne Haupthaar ebenso. Bald würde man auch seinen Nachfolger erschießen, Franz Ferdinand, den er zähneknirschend gewählt hatte, es gab ja sonst niemanden mehr. Aber das wusste er damals noch nicht. Noch ging alles seinen gewohnten Gang. Die täglichen Fahrten von der Hofburg, wo er regierte, hinaus nach Schönbrunn, in sein Prachtschloss, wohin ihm die Sorgen folgten, die wöchentlichen Audienzen, bitte sehr! „Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“. Sein Kammerdiener Eugen Ketterl war der Einzige, der ihm geblieben, mit ihm alt geworden war, zwei knöcherne Fossile aus einer Zeit, an die sich außer ihnen kaum noch jemand erinnerte.
„Das Frühstück, bittschön, Majestät! Und wie immer das Mohnkipferl, Majestät.“ Mit einer leichten Verbeugung stellte der alte Mann das silberne Tablett auf dem Schreibpult des Kaisers ab. Franz Joseph pflegte meistens im Stehen zu essen und zu arbeiten. „Dank dir schön, Eugen! Sag, was hört man Neues in der Stadt?“ Der Kaiser tunkte mit zittriger Hand das Gebäckstück in seinen durchsichtigen Morgenkaffee.
„Man munkelt von Krieg, Majestät?“ Der alte Mann verbeugte sich so tief, wie es sein Rheuma noch zuließ. In der weitläufigen Hofburg war es immer kalt und ungemütlich, und auch draußen in Schönbrunn konnte man die großen hohen Räume kaum heizen. Und in Österreich mit seinen schneebedeckten Bergen waren selbst die Sommer mitunter kühl.
„Krieg? Aber nein, wo denken die Leut hin?“, meinte Franz Joseph kopfwackelnd. „Ich hab doch gnug Krieg ghabt in meim Leben. Solferino, die Krim, die 48er Unruhen, der ständige Kampf mit den aufsässigen Ungarn. Erinnerst dich, Ketterl? Krieg? Mit mir jedenfalls nicht. Und auch Franz Ferdinand wird kein Interesse daran haben. Auch er nicht.“ Der Kaiser schüttelte das greise Haupt. Sein Diener schwieg, wer wollte auch einem Kaiser widersprechen. Er verbeugte sich erneut. „Wünschen Majestät noch etwas?“, fragte er. Dann wackelte er, vorsichtig den einen Fuß hinter den anderen setzend, rückwärts zur Tür, wie er es vor Jahrzehnten gelernt hatte. Wenn auch das Spanische Hofzeremoniell nicht mehr so streng beachtet wurde wie zu der Zeit, als Erzherzogin Sophie, die kaiserliche Frau Mutter, - Gott hab den alten Drachen selig!- noch das Kommando hatte, schickte es sich nicht, dem Kaiser sein Hinterteil zu zeigen…
Franz Joseph sah dem Alten nach und nickte. „Ja, ja“, seufzte er. „Wer weiß, wie lang uns der Liebe Gott noch beisamm lässt?“ Dann kramte er umständlich seine Taschenuhr heraus, stellte fest, dass der Morgen schon weit fortgeschritten war, schlug die vor ihm auf dem Pult liegenden Akten auf und begann zu lesen.
Erster Teil
Brünn, ab 1911
Die unbequeme Tochter
„Reli, Reli, du hättest den Ferdinand nehmen sollen, du bleibst uns noch sitzen.“ Der zahnlose Mund der Alten scheint noch mehr eingefallen zu sein und die Falten auf der zerklüfteten Stirn haben sich vertieft. Ihre knochigen Hände beginnen zu zittern. Man sieht sie kaum unter ihrer weißen Nachthaube mit dem Spitzenvolant, der das greise Gesicht umrahmt wie ein Kranz das Haar einer glücklichen Braut. Vor einigen Tagen war Großmutter Veronika über mehrere Stufen gestürzt, und man hatte schon das Schlimmste befürchtet. Aber Dr. Rosenbaum, der Hausarzt, den man sofort hinzugezogen hatte, hatte grünes Licht gegeben. Nein, Gott, der Gerechte, gebrochen hatte sich die alte Dame nichts. Aber der Schreck. Und überall die Hämatome, also die blauen Flecke, korrigierte er sich. Sie möge ein paar Tage das Bett hüten, um sich zu erholen. „Das wird schon wieder, gnä´ Frau!“, hatte er die Schwiegertochter beruhigt. „Das wird schon wieder.“ Dann hatte er nach seinem Lederkoffer gegriffen, der mindestens so alt und abgeschunden war wie er selbst, und war kopfwackelnd verschwunden.
Dr. Rosenbaum war in Brünn und weit darüber hinaus schon zu Lebzeiten eine Legende, ein Arzt, der für alle Krankheiten ein Kräutlein und tröstende Worte kannte. Er entstammte einer alteingesessenen jüdischen Kaufmannsfamilie, die mitten in der Stadt ein florierendes Bekleidungs- und Tuchgeschäft betrieb und in dem palastähnlichen Bau im ersten Obergeschoss auch wohnte. Sein Bruder Josua hatte bereits in jungen Jahren die Verantwortung dafür übernommen, nachdem sich der Vater ins Privatleben zurückgezogen und sich David Rosenbaum, der Ältere, für ein Medizinstudium entschieden hatte. Nein, mit Stoffballen und Kleidungsstücken hatte er nichts am Hut. Gott bewahre! Er musste unter die Menschen, die seine Hilfe so dringend benötigten.
Die Indras, deren Hausarzt er gleich nach dem Erwerb seiner Zulassung geworden war, gehörten zu seinen ältesten Patienten. Sie waren wohlhabend und zahlungskräftig, aber darauf kam es David Rosenbaum nicht an. Er hatte auch immer arme Leute behandelt, sie selbstredend ohne Honorar, und so hatte er sich längst den Ruf erworben, ein jüdischer Wohltäter zu sein. Und er war trotz seiner Erfolge und seiner Beliebtheit bodenständig geblieben. Seine unkonventionelle Art stieß manchen ab, doch wer ihn näher kennenlernen durfte, bemerkte bald, dass sich unter der rauen Schale ein weicher Kern verbarg.
Man war jüdischen Bekenntnisses, gewiss. Aber so wenig die sudetendeutschen und allen voran die Brünner Katholiken ihren Glauben auslebten, so wenig Wert legten die Rosenbaums auf ein bibeltreues Judentum. Man gab sich modern und liberal. Allenfalls an den hohen jüdischen Festtagen wie Jom Kippur suchten sie die Synagoge auf, um zum Gott ihrer Väter zu beten. Die wohlhabende Kaufmannsfamilie verkehrte in den ersten Kreisen der Stadt. Abraham Rosenbaum, der Vater, bekleidete zahlreiche Ehrenämter. Er unterstützte soziale Projekte und förderte unter anderem ein Waisenhaus für jüdische Kinder.
Anna Indra geborene Worel, die neben dem Bett der Greisin über einer Stickarbeit saß, sprang besorgt auf. „Bitte, Maman, echauffierens´ Ihnen doch nicht gar so. Dr. Rosenbaum hat strenge Ruhe verordnet!“ Missmutig verzog sie das Gesicht. Das fehlte noch, dass ihre Schwiegermutter gerade jetzt Schwierigkeiten machte, wo doch die Ehrung ihres Sohnes Theodor bevorstand, die Krönung seiner beruflichen Laufbahn, der Höhepunkt eines arbeits- und entbehrungsreichen Lebens, die sie alle endgültig in den Kreis der besten Gesellschaft Brünns, ja ganz Mährens aufnehmen sollte. Mein Gott, wie lange hatte er dafür gekämpft, welche Opfer auf sich genommen!
„Aurelia!“, fuhr sie ihre älteste Tochter an. „Großmutter darf sich nicht auf-regen, das weißt du. Du wirst sofort auf dein Zimmer gehen und erst wieder herunter kommen, wenn ich dich rufe. Hast du verstanden?“ Die junge Frau, die sich der Vollendung ihres dreißigsten Lebensjahres näherte, aber aussah, als ginge sie noch zur Schule, klein, mager und unscheinbar, stampfte unwillig auf wie ein trotziges Kind. Ihre schwarzen Augen blitzten. „Gewiss, Maman! Aber den Ferdinand nehme ich trotzdem nicht. Den Ferdinand niemals! Lieber gehe ich ins Kloster.“ Damit rauschte sie zur Tür hinaus, die mit einem kräftigen Knall ins Schloss fiel.
Anna Indra schüttelte verständnislos den Kopf und seufzte. Was war das nur für eine Tochter? Was hatte sie sich da groß gezogen? Wenn sie an ihre anderen Kinder dachte, dreizehn hatte sie geboren, und oft hatte man sie bemitleidet ob der Zahl der vielen Geburten. Aber die Leut´ hatten ja keine Ahnung. Sie bekam ihre Kinder leicht, und viel kümmern hatte sie sich auch nie müssen. Hatte ihr Theodor doch immer für ausreichend Personal gesorgt, Dienst- und Kindermädchen, Mali, die beleibte Köchin, die in ihrem Haus vor Jahrzehnten eine Lebensstellung erhalten hatte und jetzt alt war, und ein Diener, Schani, der eigentlich Johann hieß, alle sonstigen anfallenden Hausarbeiten erledigte und gelegentlich sogar Mali auf den Markt begleitete, um ihr die schweren Einkaufskörbe oder das zappelnde Geflügel zu tragen. Einmal in der Woche kam die Waschfrau und nach Bedarf die Büglerin. Nein, eine Dame aus Adelskreisen hätte es nicht besser treffen können. Zufrieden betrachtete Anna ihre gepflegten Hände, die immer noch schlanken Finger, die so gerne Klavier spielten (auch wenn Theodor oft scherzhaft meinte, seine Frau missbrauche wieder einmal das bedauernswerte Instrument, wenn sie in die Tasten griff), und die professionell manikürten Nägel, die nicht zu lang waren und nicht zu kurz. Auch ihre Figur konnte sich noch sehen lassen. Ihre Taille war schlank geblieben, der Bauch flach. Niemand sah ihr die zahlreichen Schwangerschaften an. Noch konnte sie das füllige Haar über der Stirn auftürmen, wie es gerade Mode war, und nur ab und zu hatten sich graue Strähnen in die gezügelte Lockenpracht geschlichen. Und das war gut so, wie sie, ihr Spiegelbild betrachtend, zufrieden feststellte.
Sie betätigte den Klingelzug und nach wenigen Augenblicken erschien ein junges Mädchen, das sein weizenblondes Haar zu einem dicken Zopf geflochten um den Kopf gelegt trug und artig knickste. Katja, das Stubenmädel.
„Gnä´ Frau wünschen?“
„Geh´ in die Küchen und bring der Frau Maman eine Tasse Hühnersuppen. Das wird sie stärken. Und Mali soll mit dem Fleisch nicht sparen“, fügte sie der Davoneilenden noch hinzu.
Hühnersuppe war in der Lage, Tote aufzuwecken. Das wusste in Brünn jedes Kind. Sie würde auch der Greisin gut tun und dafür sorgen, dass Maman durchhielt, zumindest bis …
Aurelia? Anna ließ sich wieder neben dem Bett der Alten nieder, nahm die Stickarbeit auf den Schoß, ergriff Mamans knochige Hand und dachte nach. Es schien ihr, als hätten ihre Sorgen schon mit der Geburt dieser Tochter begonnen, die ihr von allen Kindern den größten Kummer bereitete. Ihre anderen drei Töchter waren längst verheiratet, gut verheiratet. Theodor hatte dafür gesorgt, dass sie standesgemäße Männer bekamen. Maria, die sie Mizzi nannten, etwa den strengen Schulleiter Anton Jelinek, einen nicht nur in Lehrerkreisen angesehenen und gefürchteten Mann; Herma, die eigentlich Hermine hieß, hatte Fritz geheiratet, Fritz Nikodem, der als Magistratsbeamter in den besten Kreisen der Stadt verkehrte und eine besondere Karriere ahnen ließ, und Paula. Sie war Wilhelm Eschler anvertraut worden, der den großen Brünner Bahnhof leitete und immer darauf achten musste, dass der Zug nicht abfuhr, wenn seine Frau eine Reise geplant hatte. Denn Paula bekam jedes Mal, wenn sie sich entschlossen hatte, Brünn für eine Weile oder auch nur für ein paar Stunden den Rücken zu kehren, schlimmste Bauchkrämpfe, die sie auf ein bestimmtes Örtchen zwangen, sodass ihr Gatte stets dafür sorgen musste, dass der Zug erst mit einiger Verspätung abfuhr. Paula war besonders glücklich. Sie erwartete bereits ihr erstes Kind. Nur Aurelia, ihre Älteste, machte keinerlei Anstalten, sich nach einem passenden Mann umzusehen. Es war nachgerade zum Verzweifeln!
Ferdinand, der, wie sie wusste, so sehr an dieser jungen Frau hing, nun, er wäre der Schlechteste nicht gewesen, hatte doch auch er lange studiert und versprach, nicht nur ein guter, sondern auch ein Ehemann zu werden, der für Frau und Kinder durchaus standesgemäß zu sorgen in der Lage wäre. Und dann seine Herkunft! War doch seine Mutter – der Vater war bereits verstorben – eine wohlhabende Gutsbesitzerin, die in einer fruchtbaren Ebene in der Nähe von Olmütz nicht nur weitläufige Ländereien – die Rede war von mehr als 300 Hektar besten Ackerlandes - , sondern auch eine Mühle und sogar eine Bierbrauerei ihr Eigen nannte und ihre Produkte weit über Mährens Grenzen hinaus vertrieb. Gewiss, auch Aurelia hatte ihre Reize. Mit ihren weichen runden Wangen und den blitzenden Augen, den hoch gewölbten Augenbrauen und dem pechschwarzen Haar glich sie einer jener Puppen, die die Rosenbaums in den Schaufenstern ihres Bekleidungsgeschäftes stehen hatten. Sie war klein, fast zierlich, hatte schmale Hände und winzige Füße, und man hätte sie tatsächlich noch für eine Schülerin halten können, wäre da nicht der leicht trotzige Zug gewesen, der die dünnen Lippen umspielte. Es hätte dennoch gepasst. Ferdinand war acht Jahre älter als sie. Es wäre ihm sicherlich gelungen, die widerspenstige junge Frau, die von der Ehe nichts wissen wollte, zu zähmen. Jedes andere Mädchen hätte sich glücklich geschätzt, hätte ihr einer der Lazarus-Brüder mit so viel Aufmerksamkeit und Ausdauer den Hof gemacht. Aber was sollte man machen, wenn man eine Tochter hatte, die an Sturheit einem alten Esel nicht nachstand? Und die Zeiten, in denen Eltern die Ehen ihrer Kinder arrangierten, waren Gott sei Dank vorbei. Für Theodor Indra wäre es ohnehin nie in Frage gekommen, seine Kinder gegen ihren Willen in eine Heirat zu zwingen. Man konnte also nur hoffen und beten…
„Wer wollte schon Lazarus heißen?“, empörte sich Aurelia. „Sind die Lazarus nicht Juden? Heißt dieser Name im Deutschen nicht „Gott hat geholfen“? Ich erinnere mich, dass ich einen Lazarus in einem schwarzen Mantel und mit der Kippa auf dem Kopf in der Brauerei herumlaufen sah, als ich einmal mit Viktor seinen Freund Ferdinand auf dem Gutshof besuchte. Und besonders sympathisch war er mir nicht, der alte Griesgram, glaub mir, Maman. Er hat mich damals kaum beachtet, sondern nur kurz von Kopf bis Fuß taxiert, als wäre ich ein Kalb auf dem Viehmarkt, das er bei Gefallen zu kaufen beabsichtigte. Und wie stellst du dir das vor? Soll ich etwa mit Ferdinand zum Beten in die Synagoge gehen? Oder glaubst du, er begleitete mich in eine unserer Kirchen?“
„Mäßige dich, mein Kind!“, empörte sich die Mutter, „und versündige dich nicht! Die Lazarus mögen vielleicht einmal jüdischen Glaubens gewesen sein, aber sie sind längst Christen wie wir. Und überhaupt: Haben wir dich und deine Geschwister nicht gelehrt, alle Menschen, egal welchen Glaubens, gleichermaßen zu achten? Haben wir euch nicht beigebracht, tolerant gegenüber jedermann zu sein? Was soll dein Einwand? Hat nicht sogar unser Kaiser, die allerchristlichste Majestät, gesagt, die Juden sind ehrliche Leut´, die ihr Leben einsetzen für ihn und ihr Vaterland? Also, ich will davon nichts mehr hören. Du bist fast 30 Jahre alt und kannst froh sein, wenn dich überhaupt noch jemand nimmt. Oder möchtest du als einzige meiner vier Töchter dein Leben alleine verbringen? Papa und ich werden nicht ewig da sein. Wer sollte dann für dich sorgen?“
Aurelia kniff die Lippen zusammen und schwieg. Im Grunde hatte ihre Mutter ja Recht. Vielleicht war Ferdinand doch besser als ein Leben in Abhängigkeit von ihren Eltern oder später gar einem ihrer Brüder.
Ach, war Ferdinand Lazarus eigentlich wieder in Brünn?, überlegte Anna Indra. Um seinem Liebeskummer und der brüsken Abweisung seiner Angebeteten zu entfliehen, war er vor Jahr und Tag traurigen Herzens nach Brasilien aufgebrochen, um dort seine Fähigkeiten als Brückenbauingenieur einzusetzen, Geld zu verdienen und eventuell Karriere zu machen. Die Neue Welt, wie sie immer noch genannt wurde, obwohl sie so neu gar nicht mehr war, galt als Traumziel vieler Studierter und Fachkräfte, die in Europa keine Perspektive und somit keine Zukunft sahen. Nun, sie würde einen ihrer Söhne nach Ferdinand ausfragen, die hatten ja noch sicherlich zu ihrem alten Freund Kontakt. Der Briefverkehr war nie abgerissen, Einladungen aus der Ferne waren nach Brünn gekommen. Es hatte den Anschein, als fühlte sich Ferdinand in dem fremden Land einsam und sehnte sich nach der alten Heimat oder zumindest nach denen, die zu Hause geblieben waren.
Der Tag hatte trüb begonnen. Schwere Wolken hatten sich vor die herbstliche Sonne geschoben und ihr das frühe Licht geraubt. Aber noch am späten Morgen hatte es aufgeklart, der Himmel war aufgebrochen und erwärmte nun die feuchte Erde. Das Strahlen drang bis in das riesige Schlafzimmer, in dem die Greisin in ihren Kissen lag. Sie hatte sich erschöpft zur Seite gedreht und schlummerte. Geräuschvoll floss ihr gleichmäßiger Atem. Anna betrachtete das vertraute Gesicht, in das die Jahre ihre Spuren gegraben hatten, den mageren Kopf in den aufgebauschten Polstern, seufzte, sah von ihrer Stickarbeit auf und eilte ans Fenster. Die Luft schien klar. Regentropfen hatten sich auf den Blättern der Bäume und Sträucher gesammelt, die schon die Farbe des beginnenden Herbstes angenommen hatten, rot, braun, gelb. Der Winter würde bald kommen. Auch in diesem Jahr. Alles ist im Fluss, überlegte sie. Wie wahr, wie wahr! Sie drehte die Zeit zurück. Damals…
Der Winter hatte sich auch im Jahr 1881 früh angekündigt, der November hatte begonnen, und es war bitterkalt. In der Nacht auf Allerheiligen hatte es heftig geschneit, und wie immer hatte sich am frühen Morgen Familie Indra, Vater, Mutter und zwei kleine Buben, zum Friedhof begeben, um ihrer Verstorbenen zu gedenken, Tannengestecke auf den Gräbern niederzulegen und die obligatorischen Kerzen anzuzünden. Der letzte Sterbefall lag zwar viele Jahre zurück, und die Toten, davon war man überzeugt, hatten nichts davon, aber die Leut´! Galt es doch, den Schein zu wahren. Man war immerhin katholisch, wie sich das für einen habsburgischen Untertan seiner allerchristlichsten Majestät gehörte, aber besonders fromm war man nicht. Kirchgänge allenfalls zu den hohen Festtagen wie Weinachten oder Ostern. Sonntags nie. Man hatte zu tun und nutzte die freien Wochenenden, um die Buchhaltung des „Unternehmens“, wie das Geschäft in der Familie genannt wurde, zu erledigen. Das Fest des Gedenkens an jene, die den Weg allen Fleisches voraus gegangen waren, aber war eine der seltenen Gelegenheiten, von vielen Bekannten und Freunden gesehen und bemerkt zu werden, sich in Erinnerung zu bringen. Denn ganz Brünn war zu Allerheiligen auf den Beinen. Oder doch jedenfalls die, auf die es ankam.
Theodor Indra gelang es kaum, seinen Zylinder auf dem Kopf zu behalten, so viele Bekannte traf er, doch Anna, die sich bei ihrem Mann untergehakt hatte, stapfte ungelenk durch den knöcheltiefen Schnee, das Gesicht verzerrt vor Anstrengung und Schmerz. Sie war hochschwanger und rechnete jeden Tag mit der Niederkunft. Sie hoffte, nein, sie war davon überzeugt, dass sie diesmal ein Mädchen gebären würde, zwei Knaben hatte sie schon, ihr Theodor konnte mit ihr zufrieden sein. Die Nachfolge für das „Unternehmen“ war gesichert. Und so es Gott gefiele … Das Gesicht ein wenig wehleidig, hatte sie Mühe, in ihrem engen Rock, der das Ausholen erschwerte, mit ihrem Mann und den ausgelassenen Buben Schritt zu halten. Und es war ihr ein wenig peinlich, sich in ihrem Zustand vor aller Welt zur Schau zu stellen. Sie ging gesenkten Blicks.
Theodor Ignatius Indra grüßte hier, nickte da. Er sah elegant aus in seiner schwarzen Pelerine, unter der das weiße Seidenfutter hervorblitzte. Selbstbewusst holte er aus. Der große Mann mit den breiten Schultern und dem gewaltigen Schnurrbart strahlte Ruhe, Gelassenheit und Würde aus. Stolz sprach aus seinen bedächtigen Bewegungen. Der erst Dreißigjährige hatte es weit gebracht. „Dekorations- und Zimmermaler“ hatte man dem Eintrag in seinem Trauschein hinzugefügt. Pah! Er und Zimmermaler. Das wäre ja noch schöner. Theodor Indra straffte die Schultern und warf den Kopf in den Nacken. Schon früh hatte er die Meisterprüfung abgelegt und sich zum Restaurator fortgebildet. Und Künstler war er auch. Seine Dienste und seine Fähigkeiten waren gefragt. Er beschäftigte bereits zwölf Angestellte, seine Gesellen, und wenn es nach ihm ginge, sollte es nicht dabei bleiben. Kaum eine Kirchengemeinde oder ein Schlossherr in und um Brünn, die ihm nicht schon Aufträge erteilt hätten. Und kürzlich hatte sich sogar ein Auftraggeber aus Linz bei ihm gemeldet. Man schätzte seine Arbeit, sein Können und seine Zuverlässigkeit. Sorgfältig hatte er seine Leute ausgesucht und ausgebildet, sodass er immer weniger selbst Hand anlegen musste und sich aufs Kontrollieren (und Kommandieren, wie seine Gesellen hinter vorgehaltener Hand flüsterten) und gelegentliche Nachbessern beschränken konnte. Aber seine Angestellten liebten ihn, er zahlte nicht nur gut, sondern verlangte von ihnen nicht mehr, als er sich selbst zumutete. Und er war gerecht. Er sparte nie mit Lob, wenn sie es verdienten, und immer stand er hinter ihnen, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten. Auf Theodor Indra war Verlass.
Heute genoss er geradezu die Aufmerksamkeit, die ihm hier, auf dem Friedhof, zuteilwurde. „Der Herr Hofrat, einen wunderschönen guten Morgen wünsch ich!“ Theodor lupfte den Zylinder. „Küss die Hand, gnädige Frau!“ Theodor lupfte den Zylinder. „Wünsche wohl geruht zu haben, werter Herr… Grüßen Sie mir bitte die Frau Gemahlin!“ Theodor lupfte… Das Leben war schön, das Glück gehörte dem Tüchtigen, und tüchtig war er, soviel stand fest. Wäre es nach Theodor gegangen, er hätte den ganzen Tag hier im Freien verbracht und die Gräber all jener aufgesucht, die er einmal gekannt hatte, und gern auch mit dem einen oder anderen Besucher einen kleinen Plausch gehalten, wie er es bisher jedes Jahr getan hatte. Aber Anna fiel das Waten durch die nassen Schneemassen immer schwerer. Ihre Sohlen waren schon durchweicht, sie hatte das Gefühl, nichts anzuhaben, sie fror entsetzlich. Theodor wusste, was ein guter Ehemann seiner Frau schuldig war, überhaupt, wenn sie so kurz vor der Niederkunft stand. Er tätschelte ihre Hand und strebte dem Ausgang zu, um mit seiner Familie die Tram nach Hause zu nehmen. „Wäre nicht schlecht“, meinte er, „wir hätten für heut eine Kalesch gemietet. Aber du warst ja wieder einmal dagegen. Du mit deiner Sparerei.“ „Ja, ja“, meinte Anna kopfschüttelnd und umfasste ihren geschwollenen Leib. „A Kalesch! Am besten auch noch a rote! Bist denn a Baron oder gar a Graf?“
Aurelia Ernestine Gottfriede kam am 8. November im Jahr des Herrn1881 im Haus ihrer Eltern in den frühen Morgenstunden zur Welt. Die Geburt hatte sich als schwieriger erwiesen als die ihrer Brüder, aber Aurelia schien auf den ersten Blick gesund zu sein. Sie war nur ziemlich klein, das Gesichtchen war verschrumpelt wie das einer Greisin, aber Dr. Rosenbaum, der schon damals die Familie betreut und der Gebärenden die ganze Nacht beigestanden hatte, meinte, man solle sich keine Sorgen machen, das gäbe sich schon. „Und sollte sie nach dem Trinken mehr spucken als andere Kinder“, so riet er, „zamkratzen und wieder reinschieben. Speibete, Bleibete! Und denken´ S, gnä´ Frau, bittschön daran: keine Angst vor Blähungen! Wenn der Arsch nicht brummt, ist der Mensch nicht gsund. Ich wünsche Ihnen an scheenen Tag.“ Damit verschwand er und ließ sich wochenlang nicht mehr blicken.
Anna trat vom Fenster zurück. Sie hatte Tränen in den Augen. Wie lange war das her? Und jetzt? Sie dachte einen Augenblick nach und klingelte erneut. Katja erschien und knickste.
„Ruf mir, bittschön, meinen Sohn Viktor. Sag ihm, es eilt! Er möge ins Schlafzimmer der Großmutter kommen.“
„Küss die Hand, Maman! Um Gottes Willen, ist etwas mit Großmama? Weshalb haben Sie mich rufen lassen.“
„Ich brauch deine Hilfe als Advokat, Viktor. Setz einen Ehevertrag auf! Deine Schwester Aurelia wird heiraten.“
Aurelia Indra (1881 – 1974) im Alter von 19 Jahren
Gut Ptaczek, ab 1800
Am Anfang war ein Forsthaus
Gedankenverloren stapfte er durch den dunklen Tannenwald, den Blick zur feuchten Erde gesenkt. Er hatte die Flinte entsichert und sein scharfes Jagdmesser in der ledernen Gürteltasche gut verwahrt. Seine Augen durchdrangen das herbstliche Dickicht. Heute hatte er noch nichts geschossen, und dabei sollte es für diesen Tag bleiben. Ihm war nicht nach Töten. Heute waren alle Bewohner des Waldes vor ihm sicher. Denn der junge Mann strahlte vor Glück.
Antonius Lazarus war der oberste Revierjäger im Dienste des angesehenen Großbauern, Brauerei- und Mühlenbesitzers Florian Ptaczek, und er erledigte seine Aufgaben äußerst gewissenhaft, ja er ging geradezu in ihnen auf. Florian hatte allen Grund, mit ihm zufrieden zu sein, aber vor allem musste er, Antonius, seinem Gönner danken. Seine jahrelange Freundschaft zu seinem Dienstherrn, sein unermüdlicher Einsatz und seine Treue hatten sich ausgezahlt. Unter allen Bewerbern auf das verantwortungsvolle Amt – und es gab einige, wer hätte nicht gern für den wohlhabenden Gutsbesitzer gearbeitet? – hatte Florian ihn ausgewählt und allen anderen vorgezogen. Und ihn so erst in die Lage versetzt, um die Hand Barbaras anzuhalten, der jungen Frau, die er seit früher Jugend so leidenschaftlich verehrte.
Antonius kam aus einfachsten Verhältnissen, ja, man hätte die Familie als arm bezeichnen können. Sie lebte am Rande einer fruchtbaren Ebene in einem kleinen Dorf bei Olmütz, der damals schmucken Hauptstadt Mährens, in einer schimmligen Kate, Vater, Mutter und drei Brüder, alle in einem Raum, den sie noch mit einer mageren Ziege und zwei Schafen teilten. Vater Dominius verdingte sich als Tagelöhner, Mutter Catharina übernahm gelegentliche Putz-arbeiten bei einer wohlhabenden Bauernfamilie. So hielten sich die Lazarus über Wasser.
Catharina: Es gab kaum einen Dorfbewohner, der ihr nicht mit einer gewissen Scheu begegnete – doch nicht wegen ihrer Armut und der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit. Die Kinder fürchteten sich vor ihr, vor ihrem fremden Wesen und dem düsteren, scheinbar alles durchdringenden Blick, und verkrochen sich verängstigt hinter den Röcken ihrer Mütter. Man rief sie, wenn bei einer Kuh das Kalben nicht voran ging, man holte sie zu den Frauen, die in den Wehen lagen und deren Schreie im ganzen Dorf zu hören waren. Sie begleitete die Sterbenden, denen sie in den letzten Sekunden ihres irdischen Daseins ein befreites Lächeln aufzwang. Und sie tröstete diejenigen, die zurückgeblieben waren. Mancher Dorfbewohner verdächtigte sie der Hexerei, aber niemand wagte es, sie bei der Obrigkeit anzuzeigen. Man brauchte sie. Brauchte ihre heilenden Hände, das dunkle, undefinierbare Gebräu, das sie aus tausenderlei Kräutern auf der heimischen Feuerstelle zubereitete und den Kranken einflößte, ihre raue, beruhigende Stimme und die ständige Hilfsbereitschaft und Gegenwart. Wenn sie von einem Kranken oder Sterbenden nach Hause kam, konnte es geschehen, dass sie auf dem Küchentisch wie von Geisterhand abgelegt ein paar Münzen fand, die für einige Tage den Hunger ihrer Kinder stillten.
Nein, eine Hexe war sie nicht. Sie beherrschte weder die Kunst der Zauberei, noch hatte sie je mit dem Teufel einen Pakt geschlossen. Ihr tiefgründiges Wissen um die Heilkräfte der Natur verdankte sie ihrer Beobachtungsgabe und ihrer Mutter, die das ihre wiederum von ihrer Mutter geerbt hatte. Über Generationen hatten die Frauen ihrer Familie weitergegeben, was sie in Jahrzehnten erfahren und erprobt hatten. Sie kannten jede Krankheit und wussten, dass gegen jede ein Kraut gewachsen war. Nur gegen den Tod gab es zu ihrem großen Bedauern nichts.
Vor allem Antonius, ihr Ältester, war stolz auf seine Mutter. Wann immer er hinter der Hütte im hohen Gras lag, träumte er sich in eine ferne Zeit, in der sie eine berühmte Medica war, wallend weiß gewandet wie eine griechische Göttin, von allen geachtet und hoch geehrt, die mit ihrer Familie in einem wunderbaren Haus inmitten eines blühenden Gartens wohnte…
Die Lazarus-Vorfahren waren einst jüdischen Glaubens gewesen, aber das war lange her. Schon der Großvater war zum Christentum übergetreten, mehr schlecht als recht, weil es die Staatsführung so wollte, aber auch in der Hoffnung, in der gesellschaftlichen Hierarchie ein wenig aufzusteigen, eine Hoffnung allerdings, die trog. Geändert hatte sich nichts. Nun war man für die Juden Christ geworden und für die Christen Jude geblieben, vor allem weil man auch gewisse jüdische Bräuche weiterhin übte. So standen vor dem Sabbat nach wie vor der „gefillte Fisch“ auf der Speisekarte und das ungesäuerte Brot, ganz wie es die jüdische Tradition verlangte. Am Freitagvormittag durchzog der Duft frisch gebackenen Striezels das ärmliche Anwesen, und auf dem morschen Fensterbrett der schwarz verrußten Küche fiel die Menora auf, deren Kerzen jeden Freitagabend von Catharina entzündet wurden, obwohl sich das teure Wachs in dieser Familie eigentlich niemand leisten konnte. Nur über dem Sturz der rissigen Küchentür fand sich ein unscheinbares körperloses Kreuz. Früher war die Familie noch zu den Sonntagsmessen in der Dorfkirche erschienen, um sich für jeden sichtbar zur christlichen Religion zu bekennen, gelegentlich auch zur samstäglichen Beichte. Aber den Lazarus war nur die hinterste Kirchenbank reserviert worden, und nach Beendigung der Feier richtete niemand ein Wort an sie. Selbst der Pfarrer ging ihnen aus dem Weg, als brächten sie die Cholera oder die Pest. Sie waren ausgeschlossen wie fahrendes Volk, und nicht selten wurden sie hinter ihrem Rücken als übles Judenpack beschimpft. Und hätte man Catharinas medizinischer Kunst nicht so bedurft, man hätte sie womöglich aus dem Kirchengebäude und vielleicht sogar aus dem Dorf gejagt. So wurden ihre Gottesdienstbesuche immer seltener, beschränkten sich schließlich auf die hohen christlichen Feiertage wie Ostern oder Weihnachten, Feste, die sie in Gedanken mit Chanukka oder Pessach verbanden und die die Juden an die Befreiung von der Fremdherrschaft durch Judas Makkabäus und den Auszug der Kinder Israels aus der ägyptischen Knechtschaft erinnerten.
„Spielt es denn eine Rolle, zu welchem Gott wir beten?“, fragte der Vater kopfschüttelnd. „Ist es nicht gleich, wie wir ihn nennen? Jahwe, Gott oder Christus oder meinetwegen sogar Allah?“
Arm waren sie geblieben, die Lazarus, und so waren die gelegentlichen Zuschüsse, die Antonius, der als Einziger über ein festes Einkommen verfügte, zum Familienunterhalt leistete, eine willkommene Gabe. Ab und zu fielen beim Gutshof sogar ein paar Lebensmittel ab, die die größte Not der Familie linderten.
Einmal hatte die Frau mit den heilenden Händen für Ihre Verdienste sogar eine kleine Goldmünze erhalten, hatte sie sorgsam verwahrt und hütete sie wie ihren Augapfel. Denn es mochten noch schlechtere Zeiten kommen, und man würde vielleicht eines Tages auf den Notgroschen zurückgreifen müssen. Womit hatte sie sich die noble Spende verdient? Und hätte die nicht eher ihrem Sohn Antonius zugestanden? Ihre Gedanken gingen Jahre zurück. Sie erinnerte sich gern und nicht ohne einen gewissen Stolz. Aber noch immer lief ihr ein heftiger Schauder über den Rücken, wenn sie an das dachte, was damals geschehen war.
Über Nacht hatte seinerzeit, wie so oft in diesem Land, der Winter eingesetzt, obwohl der Kalender gerade erst Anfang November zeigte. In den Ästen der Bäume klirrte der Frost, und der Dorfweiher war in drei Tagen zugefroren, sehr zur Freude der Kinder, die gleich ihre Schlittschuhe hervorholten. Niemand hatte die Festigkeit der Eisdecke geprüft. Die vorsichtigen Kleinen begnügten sich damit, am Rand der Eisfläche ihre Runden zu drehen, wie sie es ihren Eltern versprochen hatten. Mutigere und Ungehorsame verengten ihre Kreise immer mehr der Mitte zu. Catharina hatte ihrem Ältesten erlaubt, den lachenden Kindern vom Ufer aus zuzusehen. Schlittschuhe besaß er nicht, aber was sollte ihn daran hindern, an der allgemeinen Fröhlichkeit, die die Dorfjugend so überraschend erfasst hatte, teilzunehmen? Er war ein verständiger Junge, der um die Not der Seinen wusste, und neidisch war er nicht. Nach langen Monaten des Barfußlaufens hatte er zum ersten Mal seine Stiefel angezogen, die einzigen Schuhe, die er besaß. Und die Mutter hatte ihn eindringlich ermahnt, auf das wertvolle Schuhwerk acht zu geben, schließlich sollte es noch an seine Brüder weitergereicht werden. „Und geh net aufs Eis“, rief sie dem davoneilenden Jungen nach. Auf keinen Fall solle er auf der glatten Fläche entlangschlittern, wie das die Kinder so gern taten, das ruiniere das Leder. Und außerdem sei es noch zu gefährlich. „Kaner hat gschaut“, meinte sie, „ob´s scho fest gnuag is.“ Antonius nickte und winkte seiner Mutter zu. Er hatte verstanden.
Er stand also am Ufer und schaute dem bunten Treiben zu. Sehnsüchtig verfolgte er die Reigen, die seine Schul- und Spielkameraden, sich bei den Händen haltend, drehten, und ärgerte sich ein wenig über den Spott, mit dem sie ihn wieder einmal verhöhnten. „He, Lazarus“, riefen sie. „Bist halt a armer Lazarus wie der in der Bibel? Hast kane Schlittschuah net!“
„Was wisst´ s ihr schon?“, gab er selbstbewusst lachend zurück. „Der Lazarus in der Bibel is net arm gwen. Net amol des wisst´ s! Dumm seid´ s halt.“
Er mochte schon eine halbe Stunde gestanden, sich gefreut und Beifall gespendet haben, wenn einem Kind auf dem Eis eine Figur gut gelang, wenn es eine besonders ansprechende Pirouette drehte oder nach einem kühnen Sprung sicher auf den Füßen landete. Der Jubel und die Freudenschreie der ausgelassenen Kinder waren im ganzen Dorf zu hören. Doch plötzlich standen alle still. Wie gebannt starrten die Läufer, die gerade noch das unbeschwerte Leben so lustig gefeiert und ihre Freiheit begrüßt hatten, auf die Mitte des Weihers, wo sich etwas bewegte, etwas, das grün war und rot, etwas, das schrie, das um Hilfe flehte, das heftig, aber offensichtlich vergeblich mit dem eisigen Element rang. Wie von einem unsichtbaren Sturm hinweggefegt, stürzten alle zum Ufer. Einige fuhren fort zu schauen. Andere suchten in großer Eile das Weite, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her. Antonius hatte sofort begriffen. Was dort mitten in dem kleinen See mit dem brüchigen Eis rang, dieses rot-grüne Etwas, das war, das konnte nur ein Kind sein, das sich in seinem Übermut zu weit hinaus gewagt hatte und dafür jetzt mit dem Leben bezahlen sollte. Ohne zu zögern zog der hochgeschossene Junge seinen schäbigen Janker aus, warf ihn auf das Eis und sich selbst hinterher, ohne auf seine wertvollen Stiefel Rücksicht zu nehmen, und begann langsam und bedächtig, jeden Zug abwägend, bäuchlings über die glatte Fläche zu rutschen. Er ignorierte das Krachen, das seinen Weg begleitete, verachtete die Risse in der hauchdünnen gefrorenen Schicht, die sich unter seiner Last bildeten, und konzentrierte sich mit allen Sinnen auf das Ziel, das verzweifelte Kind, dessen schrille Schreie in ein leises Wimmern übergegangen waren, als hätte es sich mit seinem Schicksal, dem nassen, kalten Grab, längst abgefunden.
„Halt durch, Bub“, rief er dem kraftlosen Jungen zu. „Halt durch. Ich komme.“ Und in diesem Augenblick erkannte er, dass es Florian war, der da kämpfte, der kleine Ptaczek, der schon im Begriff war unterzugehen, der Sohn des wohlhabenden Müllers. Florian war ein übermütiges Kind, fröhlich, sympathisch frech und sich seiner besonderen Stellung als Kind des reichsten Mannes des Dorfes stets bewusst. Ein jeder lachte über seine lustigen Streiche, und ein jeder liebte ihn, bewunderte seine fröhlich-freie Art, die Unbefangenheit, mit der er selbst auf Fremde zuging, obwohl er erst sechs Jahre alt war, wie er sich ohne Scheu anderen Kindern anschloss, ohne auf deren Herkunft oder seine eigene zu schauen. Sein Vater Ignaz, selbst fest in der Dorfgemeinschaft verwurzelt und seinen Mitbürgern von Herzen zugetan, hatte seinem Sohn von Kindesbeinen an beigebracht, jeden Menschen gleichermaßen zu achten.
„Ich komme, Florian, ich komme. Einen Augenblick noch.“ Schon war Antonius bei dem Kleinen angelangt und bekam ihn am Kragen der grünen Jacke zu fassen. Mit der gebotenen Vorsicht zog er den Jungen nach oben, Zentimeter um Zentimeter, sprach beruhigend auf ihn ein, zog und zog und legte ihn schließlich auf die brüchige Eisfläche, die die neuerliche Last mit einem weiteren Stöhnen quittierte. Der Junge hatte inzwischen das Bewusstsein verloren. Antonius bettete den vor Kälte zitternden Körper des Kindes auf seine Jacke und machte sich auf den Rückweg, langsam, bedächtig, jeden Zug abwägend, so wie er gekommen war.
Am Ufer angelangt, wurde der Kleine von einer Schar Erwachsener übernommen, die Dankgebete murmelten, sich bekreuzigten und den halb erfrorenen und triefenden Knaben gemeinsam zum Gut des Müllers trugen, um ihn den entsetzten Eltern zu übergeben. Um Antonius kümmerte sich niemand. Der machte sich, zitternd und erschöpft, in seinen nassen Kleidern auf den Heimweg.
Mutter Catharina erschrak. In knappen Worten berichtete ihr Sohn, was geschehen war, streifte das an der Haut klebende Hemd über den Kopf und schälte sich aus der steif gefrorenen Hose. Dann warf er sich auf sein Bett und schluchzte grenzenlos. Catharina Lazarus aber schnappte ihre angerostete Blechflasche, füllte sie mit einer trüben Flüssigkeit, warf sich ihr grobwollenes Schultertuch um und eilte zur Ptaczek-Familie, um nach Florian zu schauen. Das zarte Bübchen würde jetzt all ihre Hilfe und ihre Erfahrung brauchen. Sie kannte den freundlichen Jungen, der ihr auf der Dorfstraße schon so oft begegnet war. Und sie kannte die Familie des reichen Bauern, die ein wenig abseits inmitten ihrer fruchtbaren Felder und weitläufigen, dunklen Wälder lebte. Ihr eigener Sohn? Nun, Antonius war stark, er hatte ihre robuste Natur geerbt. Den konnte so leicht nichts umwerfen. Um den würde sie sich später kümmern, wenn sie sich davon überzeugt hatte, dass mit dem kleinen Florian wieder alles in Ordnung war…
Nachdem sich im Haus der Ptaczeks die Gemüter beruhigt hatten und der Junge auf dem Weg der Genesung und auch abzusehen war, dass das Unglück keine bleibenden Schäden hinterlassen würde, außer vielleicht eine Scheu vor dem düsteren Gewässer, erschien eines Tages der reiche Gutsbesitzer, begleitet von seinem Sohn, der schwieg und den Blick gesenkt hielt, als schäme er sich seines Ungeschicks, erschien also in der ärmlichen Hütte am Dorfrand, um Mutter und Sohn zu danken. „Sag dank schön, Bub!“, mahnte der Vater, „Ohne den Toni wärst leicht nimmer. Und ohne seine Mutter wahrscheinlich a net. Bist a braver Bursch, Anton“, lobte der Bauer, an den Jugendlichen gewandt, „sag, magst in mein Dienst treten, wannst sechzehn bist? Kann ja nimmer lang hin sein. I könnt später an guten und mutigen Jager brauchen. Der Theo tät sich nämlich gern aufs Altenteil zurückziehn.“ Antonius meinte errötend, er habe nur getan, was er auch für seine Brüder oder andere Kinder getan hätte und was die Pflicht eines jeden Christenmenschen sei. Es bestünde kein Anlass, ihm besonders dankbar zu sein. Aber er freue sich über das großzügige Angebot und werde sich, sobald er das sechzehnte Lebensjahr vollendet hätte, bei den Ptaczeks melden. Damit begann die enge Freundschaft zwischen dem reichen Gutsbesitzersohn und dem armen Lazarus, der sich immer mehr in der Rolle des Beschützers des fast zehn Jahre jüngeren Florian sah.
Wenige Wochen nach Antonius´ sechzehntem Geburtstag ratterte ein zweirädriger Karren über die holprige Dorfstraße, gezogen von einem Paar kräftiger Ochsen. Das seltsame Gefährt hielt vor dem Lazarus-Haus an. Vater und Sohn Ptaczek hatten sich selbst auf den Weg gemacht, um Antonius in sein neues Zuhause zu holen. Er sollte ins Forsthaus Zichovec gebracht und dort vom alten Förster in seine späteren Aufgaben eingewiesen werden. Die Freude in der Familie Lazarus war groß. Die Brüder tobten staunend um den Wagen und die prächtigen Tiere herum. Mutter Catharina wischte sich ein paar Tränen aus den müden Augen. Sie hatte diesen Tag ersehnt – und gefürchtet. Und so hätte niemand sagen können, ob es Freudentränen waren, die sie vergoss, oder solche der Rührung oder des Abschieds.
Das Forsthaus Zichovec stand, nicht weit von den Hauptgebäuden des Ptaczekschen Anwesens entfernt, inmitten des Waldes auf einer kleinen Lichtung, die liebevoll in einen Bauerngarten verwandelt worden war. Vor dem Haus blühten üppige Pfingstrosen und alte Fliedersträucher, hinter dem Haus hatten pflegende Hände Gemüsebeete angelegt. Obstbäume, Äpfel, Birnen und Marillen, hatten sich in weiße duftige Wolken gehüllt. Das kleine Grundstück war von einem grün gestrichenen Lattenzaun umgeben. Das Haus selbst, dessen gelb leuchtende Farbe der von Schloss Schönbrunn nachempfunden zu sein schien, war zweistöckig, seine Front wies zahlreiche Fenster mit grün-weiß gestreiften Läden auf. In den blank geputzten Scheiben spielte das frühe Sonnenlicht. Das Haus wirkte freundlich und einladend, und Antonius´ Herz machte einen Sprung. Hier könnte er sich wohlfühlen. Zichovec könnte sein neues Zuhause werden. So schön hatte er es sich nicht vorgestellt.
Der junge Lazarus lernte schnell. Die Arbeit schien ihm große Freude zu machen. Bald konnte sich sein Ausbilder auf das Altenteil zurückziehen, wie er es sich gewünscht hatte. Er wusste, dass die Wälder der Ptaczeks, die dunklen Tannen und die knorrigen Eichen, bei Antonius in den besten Händen waren.
Die Jahre kamen, die Jahre gingen, die Freundschaft der ungleichen Buben blieb. Sie wurde mit der Zeit sogar immer inniger. Von dem schrecklichen Unglück, das die Familie Ptaczek getroffen hatte, als Florian noch ein Kind gewesen war, sprach längst niemand mehr. Auch Antonius´ mutiges Eingreifen hatte man im Dorf vergessen, wenn man es überhaupt je angemessen gewürdigt hatte. Aber darauf kam es dem jungen Mann nicht an. Florian mied den Dorfweiher, machte einen großen Bogen um das ihm jetzt unheimliche Gewässer, über das seitdem die wildesten Geschichten umgingen. Die Wassergeister, die in den unergründlichen Tiefen des Sees lebten, so erzählten sich die Dorfbewohner, seien in Wahrheit die Seelen Ertrunkener, die keine Ruhe fänden, und ab und zu weiterer Opfer bedurften, um sich dort unten die Langeweile zu vertreiben. Besser sei es, die Gegend zu meiden. Die Eltern warnten ihre Kinder, verboten ihnen im Sommer gar, im Weiher zu baden, und in den Wintermonaten, sich die Schlittschuhe überzuziehen oder auch nur am Dorftümpel vorbei-zugehen. „Wenn du nicht brav bist, holt dich der Wassermann“, wurde die übliche Drohung gegen aufmüpfige Jungen und Mädchen, und es gab bald kaum ein Kind, das sich vor dem Unheil kündenden Teich nicht fürchtete. Über Antonius´ heldenhafte Tat wurde auch zwischen den Freunden geschwiegen, es war, als hätte es sie nie gegeben. Nur wenn der Winter anbrach, die Bäume sich mit weißem Raureif überzogen und der Wind in den kahlen Zweigen sang, sahen sich die Freunde bedeutungsvoll an…
Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können, Antonius Lazarus und Florian Ptaczek. Ja, es schien, als hätte die Natur ihre eigenen Regeln verkehrt. Florian war kleiner als sein Freund, fast ein wenig untersetzt. Das dunkle volle Haar fiel ihm unbändig in die niedrige Stirn und verdeckte fast die buschigen Brauen, die sich halbmondförmig über den schwarzen Augen mit den gebogenen Wimpern wölbten. Seine Nase war groß und leicht gebogen, der Mund fleischig und das Kinn sanft gerundet. Die vollen Wangen hätten auch die eines jungen Mädchens sein können. Die breiten Schultern und die muskulösen Arme ließen auf das Tragen schwerer Lasten schließen, und niemand hätte bei seinem Anblick vermutet, dass Florian Ptaczek doch eigentlich ein Herr war, der über eine ganze Anzahl von Knechten und Mägden und anderen dienstbaren Geistern verfügte und sich nie selbst die Hände schmutzig machen musste. Aber er packte gern mit seinen eigenen Händen zu, freute sich wie ein Kind, das eine kostbare Süßigkeit bekommen hatte, wenn er die schweren Getreidesäcke scheinbar mühelos schulterte und den Inhalt in die riesigen Trichter schüttete, unter denen sich das Mahlwerk befand. Er war Müller, er war Bauer, und wenn es seine Zeit zuließ, kümmerte er sich selbst um das Bier, das auf seinem Land, von seiner Gerste und seinem Hopfen gebraut und sogar im fernen Brünn geschätzt wurde.
Antonius Lazarus war das Gegenteil. Aus dem hoch aufgeschossenen Jungen, den Florians Vater einst in seinen Dienst geholt hatte, war ein gestandener Mann geworden. Anders als seine Brüder war er blondgelockt, hatte blaue Augen und glich mit seiner vornehmen Gestalt und seinem stolz aufrechten Gang eher dem Sohn eines Barons oder gar Grafen als dem eines einfachen Tagelöhners. Er gab viel auf sein Äußeres. Seine jägergrüne Kleidung, Janker und Kniehose, war immer tadellos sauber und gepflegt, Wangen und Kinn des ebenmäßigen Gesichts waren stets glatt rasiert, die hohen braunen Stiefel blank geputzt. Über den vollen Lippen wuchs ein geschwungener Schnurrbart, dessen gezwirbelte Enden fast in den Himmel ragten. Das lange Blondhaar, das ihm bis an die Schultern reichte, trug er oft auf dem Hinterkopf zusammengebunden. Der Revierjäger war von Kopf bis Fuß eine Augenweide, was den jungen Frauen in seiner Umgebung nicht entging. Und es gab einige, die vom Dorf öfter zu ihm ins Forsthaus hinauswanderten, um ihm einen Kuchen oder eine Flasche Wein zu bringen oder auch nur, um ihm schöne Augen zu machen. Aber seine Gedanken gehörten einzig seiner Jugendliebe.
Antonius Lazarus und Barbara Klein gaben sich im Juni anno 1810 in der kleinen Dorfkirche im mährischen Bölten das Jawort, er 27, sie 22 Jahre alt. Die Ptaczeks waren selbstredend Ehrengäste, sie hatten die Brautleute großzügig beschenkt. Not würde bei den jungen Leuten jedenfalls nie herrschen. Antonius erinnerte sich später gern an den warmen Junitag, über den eine strahlende Sonne ihr goldenes vorsommerliches Licht goss, als hätte es der Liebe Gott selbst mit seiner Hand über sie ausgeschüttet. Er hörte noch immer die Vögel singen, die sich mit ihm zu freuen schienen, und er hatte noch den Duft der Zentifolien in der Nase, die gerade voll erblüht waren. Günstige Vorzeichen für seine Verbindung, so hatte er schon damals gedacht, und tatsächlich sollte sich die als besonders glücklich erweisen. Im vierten Jahr nach der Hochzeit wurde dem Paar ein Sohn geboren, Anton Thadeus, der in seinem Elternhaus das Licht der Welt erblickte, wie es üblich war. Das Glück war vollkommen.
„Was wird aus dem Buben wohl werden?“, fragte der Vater stolz und beugte sich über die mit Bauernrosen bemalte Krippe, in der das winzige menschliche Bündel lautstark auf sich aufmerksam machte.
„No“, wunderte sich die stolze Mutter. „Was wird er werden, der Bub? Wird er werden a guter Forstmann genau wie sein Papa“, eine wie selbstverständliche Feststellung, die das Vaterherz mit noch größerem Stolz erfüllte.
Antonius schmunzelte zufrieden. Alle Verwandten und Freunde, die gekommen waren, um den Eltern zu gratulieren und den neuen Erdenbürger zu begrüßen, hatten die auffallende Ähnlichkeit von Vater und Sohn bestaunt, und mit jedem Besucher, der das Forsthaus wieder verließ, trug der Vater den Kopf ein wenig höher und seine Augen strahlten noch heller. „No ja“, murmelte er, „a guter Forstmann und Jager, was sonst?“
Der kleine Anton Thadeus wuchs und gedieh. Die junge Familie lebte abgeschieden im „Schlössel“, wie die Lazarus ihre Unterkunft liebevoll nannten, weit weg von anderen Kindern. Viele Freunde hatte der Lazarus-Bub deshalb nicht. Nur ab und zu kam jemand zu ihnen heraus, um ein Stück Wildbret zu kaufen oder die herrliche Waldluft einzuatmen und die Stille fernab des quirligen Dorflebens zu genießen. Dann saßen die Eltern und ihre Gäste auf der großen Holzbank vor dem Haus, und die Kinder spielten im nahen Wald. Gelegentlich war auch der eine oder andere Spielkamerad allein zu Gast, dem der junge Förstersohn dann stolz einen Hochstand zeigte oder das Baumhaus, das ihm sein Vater gezimmert hatte. Anton war ein fröhliches Kind, dessen Silberlachen den dunklen Forst erhellte und das beschauliche Leben im Wald für alle noch freundlicher werden ließ.
Von Kindesbeinen an nahm ihn Vater Antonius auf seine Pirschgänge mit, zeigte ihm Pflanzen und Tiere, erklärte ihm, welches Kraut gegen welche Krankheit half und welche Quelle das beste Wasser spendete. Der Wald wurde Antons Zuhause, wie er vor Zeiten die Heimat seines Vaters geworden war. Bald fand er sich allein zurecht und war in der Lage, Antonius zu unterstützen, der sich immer mehr von seiner Arbeit zurückzog. Das Alter, das bei ihm durch die Entbehrungen in Kindheit und Jugend früher als bei anderen seinen Tribut forderte, zwang ihn immer öfter, das Bett zu hüten. Rheumaanfälle plagten ihn, seine Gelenke schwollen an, und die früher so kraftvoll zupackenden Hände mit den auffallend schlanken Fingern krümmten sich vor Gicht. Seit seine Barbara gestorben war, schien auch er das Interesse am Leben verloren zu haben. Anton fand den Vater meist in tiefe Gedanken versunken, wenn er von seinen Streifzügen nach Hause kam, und wenn er sich nach seinem Befinden erkundigte, wartete er oft vergebens auf Antwort. In das einst so fröhliche Forsthaus zog die Traurigkeit ein, ein ungebetener Gast. Glücklicherweise konnte sich Anton jederzeit an Florian wenden, seinen Taufpaten, den Freund seines Vaters, der oft zum Forsthaus herüberkam, um Antonius zu besuchen und ein Lächeln auf dessen Züge zu zaubern. Die Freundschaft, die die beiden Männer noch immer verband, übertrug sich wie selbstverständlich auch auf den Sohn. Hätte Florian doch auch Antons Vater sein können! Und kaum einem Außenstehenden wäre auf den ersten Blick aufgefallen, dass der Förster jetzt nicht mehr Antonius hieß, sondern Anton Thadeus, der das verjüngte Abbild des alten Waldhüters war.
Aber wir sind der Zeit erneut vorausgeeilt. Noch einmal müssen wir eintauchen in die Tiefen der Vergangenheit. Anton Thadeus war gerade drei geworden. Da warfen bei den Ptaczeks große Ereignisse ihre Schatten voraus.
Ab anno 1815
GeschichteNapoleon Bonaparte
Auf St. Helena, einer kleinen felsigen Vulkaninsel inmitten des Südatlantiks, fernab jeglicher Zivilisation, träumte sich ein vor der Zeit gealterter Mann in ein Leben zurück, in dem er die Welt das Fürchten gelehrt hatte. Auferstanden gleichsam aus dem Nichts, hatte er den gesamten europäischen Kontinent bis in die eisigen Weiten Russlands mit Krieg überzogen. Ein tüchtiger General war er einmal gewesen, dann ein Diktator, und schließlich hatte er sich selbst zum Kaiser aller Franzosen gekrönt. Bewundert und gefürchtet zugleich. Napoleon Bonaparte. Jetzt war er niemand mehr.
Nach fast drei Jahrzehnten des Zitterns und Bangens war Europa endlich zur Ruhe gekommen. Aber der Schrecken saß immer noch tief. Anno 1789 hatten die verhassten Franzosen, getrieben von Hunger und Not, mit dem Sturm auf die Bastille in Paris eine Revolution ausgelöst, die jahrelang nicht nur ihr eigenes Land, sondern die halbe zivilisierte Welt in ihren Grundfesten erschütterte. König und Königin hatten unter dem Jubel des Pöbels auf dem Schafott ihren Kopf verloren, und der gesamte französische Adel war nur wenige Jahre später nahezu ausgeblutet. Wem es nicht rechtzeitig gelungen war, den rettenden Rhein zu überqueren und jenseits der Grenzen Frankreichs bei Verwandten oder Freunden Unterschlupf zu finden, fiel in die Hände der Aufrührer und teilte das Schicksal, das der wütende Mob dem König und seiner Frau zugedacht hatte. Revolutionstruppen waren plündernd und mordend in die Kleinstaaten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation eingedrungen und hatten überall Angst und Schrecken verbreitet. Und dann kam dieser Mann, der sich als Retter aufspielte, unter dem sich aber zuletzt alles womöglich noch schlimmer anlassen sollte, zumindest für die, die keine Franzosen waren. Napoleon.
Klein von Wuchs sei er gewesen, verbreitete England, von untersetzter Körperstatur, und doch war er fast zwei Jahrzehnte lang der Größte, den Europa hervorgebracht hatte, seitdem das Römische Reich von der Bühne des Weltgeschehens verschwunden war. Er überragte alles und alle. Geboren 1769 auf Korsika, gelangte der tüchtige Militär, ein sorgfältig ausgebildeter, von Kindesbeinen an begeisterter Soldat, nach Paris, mitten in die Revolutionswirren, fast ein Jüngling noch, wo er schnell eine Aufgabe fand und Ruhm erlangte. Für Frankreich erfolgreich geführte Feldzüge nach Italien (1796) und Ägypten (1798) machten den ehrgeizigen Korsen in ganz Europa bekannt. In einer prunkvollen Zeremonie setzte er sich am 2. Dezember 1804 in der Kathedrale Notre Dame de Paris in Anwesenheit von Papst Pius VII. selbst die Krone auf und erklärte sich zum Kaiser der Franzosen. Kein halbes Jahr später fand sich im Mailänder Dom auch der Eiserne Reif der Langobarden auf seinem Haupt. Sie erhob den einstigen General zum König von Italien. Er hatte erreicht, worauf einer, der nicht von Geburt adelig war, damals eigentlich nicht hoffen konnte. Napoleon. Nun begann er, Europa nach seinen Vorstellungen neu zu gestalten.
Von der Landkarte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation fegte er die meisten Grenzen hinweg, beendete schlagartig die Kleinstaaterei, die jahrhundertelang Handel und Gewerbe behindert hatte, setzte Franz II. ab, den Kaiser, der ab sofort als Franz I. nur noch Kaiser von Österreich war. Im Süden Deutschlands machte er Bayern zum Königreich, verhalf Maximilian I. Joseph auf den Thron, schuf, gleichsam aus dem Nichts, das Königreich Württemberg und das Großherzogtum Baden und verpflichtete alle, ihm als Dank für seine Großzügigkeit Soldaten zu stellen, die er sich für sein fernes Ziel bereit zu halten gedachte, den großen Feldzug nach Russland, mit dessen erfolgreichem Ausgang er einmal ganz Europa zu beherrschen hoffte. Er bedachte nicht, dass der Zar aller Reußen einen Verbündeten hatte, mit dem es kein noch so erfahrener Feldherr aufnehmen konnte, den Winter.
Nachdem die europäischen Staaten bis hin zu den Preußen und Polen in die Knie gezwungen waren, machte sich Napoleon auf, mit seiner „Grande Armée“ in Russland einzumarschieren. Man schrieb das Jahr 1812. Anfangs war sein Unternehmen noch von Erfolg gekrönt. Die bedrohten Menschen flohen in die Weiten ihres Landes, verbrannte Erde zurücklassend. Der kühne Feldherr gelangte bis Moskau, das er lichterloh brennend vorfand. Hatten die Bewohner ihre Stadt selbst angezündet, um sie nicht unbeschadet in die Hände des Feindes fallen zu lassen? Das vermochte niemand zu sagen. Die Enttäuschung des Angreifers war groß. Schließlich kam der Winter den bedrängten Russen zu Hilfe. Darauf nicht vorbereitet, ordnete der Kaiser der Franzosen zähneknirschend den Rückzug an.
Der entwickelte sich zur Katastrophe. Er, der ausgezogen war, ein Weltreich zu erobern, wurde nun selbst ein Getriebener. In der Eiseskälte, die wie ein Leichentuch das Land überzog, verhungerten und erfroren seine Soldaten. Tausende und Abertausende verloren ihr Leben. Er, der mit einer halben Million Männern aufgebrochen war, kehrte mit wenigen Tausend Überlebenden heim. Doch noch einmal forderte er das Schicksal heraus. Aber sein Stern war längst im Sinken. Nach der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) verlor er Würde und Amt. Vom Wiener Kongress, der nach Auffassung des französischen Außenministers Charles- Maurice de Talleyrand-Périgord nur tanzte und nicht vorwärts kam, wurde er im April 1814 auf die Insel Elba verbannt, zu nahe an Frankreich, als dass er sich so widerstandslos geschlagen gegeben hätte. Am 1. März des folgenden Jahres kehrte er nach Paris zurück, um ein letztes Mal sein Glück zu versuchen. Er war auch in der Verbannung nicht untätig geblieben. Ermutigt von der Unzufriedenheit seiner einstigen Untertanen mit den neuen Verhältnissen, von der ihm berichtet worden war, kehrte er nach Frankreich zurück. Und noch einmal begann Europa zu zittern. Aber seine neuerliche Herrschaft währte nur hundert Tage…
Am 15. Juni 1815 schlug und verlor er beim wallonischen Waterloo seine letzte Schlacht. England hatte sich unter dem Herzog von Wellington mit den Preußen verbündet, dessen Truppen von Generalfeldmarschall Blücher angeführt wurden. Der Überlegenheit der vereinigten Gegner hatte Napoleon nichts entgegenzusetzen. Auf Beschluss Englands wurde er auf die weit entfernte Insel St. Helena verbannt, von der es für den Lebenden keine Wiederkehr gab. „Kein Abschied“, bemerkte damals der bereits erwähnte Talleyrand, „fällt schwerer als der Abschied von der Macht“, eine Erfahrung, die nun auch er machte.
Napoleon.
Doch er wahrte auch in der Fremde den Schein eines französischen Hofstaats mit Dienern und Soldaten. Er begann, seine Memoiren zu schreiben. Sechs Jahre später starb er, 52 Jahre alt, an einem schweren Magengeschwür, wie die Wissenschaft vermutet. Doch bald schon begann die Gerüchteküche zu brodeln. Bei diesem Tod, hieß es, sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Der entthronte Herrscher sei in Wahrheit einer schleichenden Arsenvergiftung zum Opfer gefallen…
anno 1817
… und ein herrschaftliches Gut
Wenn die Wellen der hohen Politik auch nicht bis in Einzelheiten in den böhmischen und mährischen Familien zu spüren waren und ihr Leben weiterhin in den gewohnten Bahnen verlief, so hatte man doch Anteil genommen und mit allen Völkern gezittert und gebangt. Die Bedrohung war immer da. Was wäre gewesen, hätte der verrückte Korse das große Russland tatsächlich eingenommen, wie es ja seine Absicht gewesen war? Hätte er dann nicht bald auch sie unter den Rädern seiner Kanonen zermalmt und unter den Hufen seiner Rösser zertrampelt, unter den Stiefeln der gewaltigen Heerscharen, wie sie die Welt in dieser Größenordnung zuvor noch nie gesehen hatte? In Wien war er gewesen, in Brünn für kurze Zeit ebenso, einen Vorgeschmack der französischen Knechtschaft hatte man ja bekommen.
Noch immer erzählte man sich über den Aufenthalt Napoleons in Brünn vor der Schlacht bei dem nahen Austerlitz eine merkwürdige Geschichte. Er sei dort, so hieß es, anno 1805 mit knapper Not einem Attentat entgangen. Als der Kaiser der Franzosen nämlich auf seinem weißen Ross in die Stadt eingeritten sei, habe ihn schon ein mutiger Schmiedegeselle erwartet. Der junge Mann hatte sich angeblich, das Gewehr im Anschlag, in einer Dachluke verborgen. Er wollte sich an dem ehrgeizigen Korsen für alle Leiden, die dieser dem Kaiser in Wien schon zugefügt hatte, rächen und die Welt von einem Ungeheuer befreien. Doch just in dem Augenblick, als er abdrücken wollte, erschien sein Meister und schlug ihm die Büchse aus der Hand. Niemand sonst hatte von dem Vorfall etwas bemerkt, auch Napoleon nicht, aber noch viele Jahre später rätselte man bis im fernen Olmütz, wie sich denn die Geschichte Europas entwickelt hätte, wäre der Anschlag damals erfolgreich gewesen…