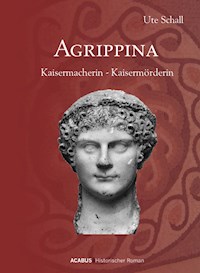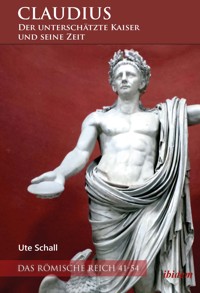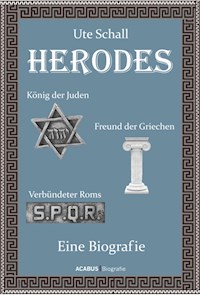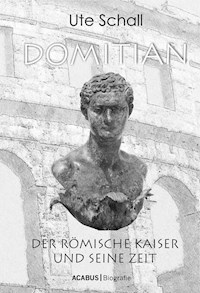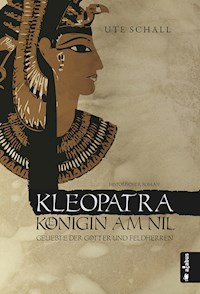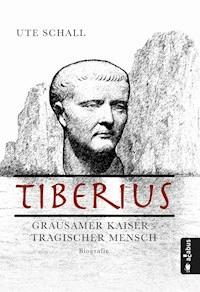
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Er war nach antiken Vorstellungen fast ein Greis, als er 14 n. Chr. als zweiter Kaiser Roms den Thron bestieg: Tiberius Claudius Nero. Seine überaus ehrgeizige Mutter Livia Drusilla hatte ihm den Weg dorthin freigemordet. Nach anfänglich milder Herrschaft zog sich Tiberius, zu Schwermut neigend, misstrauisch und finster, für seine letzten Lebensjahre auf die Insel Capri zurück. Er überließ die Regierungsgeschäfte dem Prätorianerpräfekten Seianus, einem skrupellosen Mann, der in Rom eine beispiellose Schreckensherrschaft errichtete. Gerade noch rechtzeitig wurde er vom Kaiser entmachtet und wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Doch Tiberius' Weigerung, nach Rom zurückzukehren, ließ bald die wildesten Gerüchte über die Grausamkeit und die sexuelle Abartigkeit des alten Mannes aufkommen. "Biberius" nannten ihn die Römer, den Trinker. Und als er gestorben war (37 n. Chr.), forderte das aufgebrachte Volk, seine Leiche im Tiber zu versenken. In den Annalen zeichnet der römische Historiker Tacitus ein düsteres Bild des Kaisers. Doch mancher Nachfolger sah in ihm den gerechten Herrscher schlechthin und erkor ihn zum Vorbild der eigenen Regentschaft. Mit der gebotenen Behutsamkeit des neuzeitlichen Forschers nähert sich Ute Schall der komplexen Persönlichkeit des Menschen und des Kaisers, wobei sie in erster Linie die alten Quellen vergleichend heranzieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ute Schall
Tiberius
Grausamer Kaiser - tragischer Mensch
Biografie
Schall, Ute : Tiberius. Grausamer Kaiser - tragischer Mensch,
Hamburg, acabus Verlag 2018
1. Auflage
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-554-7
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-553-0
Print: ISBN 978-3-86282-552-3
Lektorat: Julia Lemburg, Cira Korfmacher, acabus Verlag
Cover: © Marta Czerwinski, acabus Verlag
Covermotiv: Roman Emperor Tiberius Caesar © Sam Spiro; Capir © giumas
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Meinen „Oberrömern“ Gabriele und Jürgen, Anne und Bernd (†)
Verwünschungen
Als der junge Agrippa Postumus begriff, dass es kein Entrinnen gab, dass die Henkersknechte des verhassten Alten im fernen Rom kein Erbarmen kannten und niemals seinem Zauber erliegen würden, beschwor er mit ermattenden Kräften alle Flüche des Schicksals auf Tiberius’ blutbeflecktes Haupt herab. Er sagte ihm den schrecklichsten aller Tode voraus, weissagte ihm jahrelange Einsamkeit und Menschenangst und schließlich den langsamen Fall von Mörderhand.
„Ich sehe Tiberius“, hauchte er, „er wünscht zu sterben und wird nicht sterben können. Und doch hat er Angst vor dem Tod. Ich sehe ihn, von weither kommend, vor den Toren Roms verharren und auf verschlungenen, menschenleeren Pfaden um die Mauern der Ewigen schleichen, vom Ort seiner gemeinsten Verbrechen angezogen und abgestoßen zugleich. Sehe ihn zitternd vor Furcht auf immerwährender Flucht.
Flüstern höre ich das Volk der entsetzten Quiriten: Biberius nennen sie ihn, den Trinker. Selbst der Tod fürchtet sich vor ihm, sagen sie, selbst der Tod. Unbeweint wird er in das Reich der unterirdischen Schatten eingehen. Und mancher wird fordern, den faulenden Leib in der schlammigen Flut des Tibers zu versenken, Tiberium in Tiberim, auf dass er, im Leben umgetrieben vor Angst, auch im Jenseits keine Ruhe fände.“
Tiberius
Grausamer Kaiser – tragischer Mensch
Eine Begegnung
Capri, Sommer 1987. Er ist nicht allzu steil, der Weg, den ich trotz der hochsommerlichen Temperaturen emporgestürmt bin, führt aber doch stetig bergan. Es war die Neugier, die mich trieb. Wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben. Aber diese alte Weisheit wurde erst viel später in Worte gefasst (oder auch nicht). Da stehe ich nun und schaue mich um. Und die Jahrhunderte gerinnen zum Augenblick.
Langsam beginne ich, ihn zu verstehen. Ihn: Tiberius Claudius Nero, der sich später Tiberius Iulius Caesar Augustus nannte. Nennen musste. Denn Augustus, der Erhabene, hatte ihn mangels anderer Kandidaten an Sohnes statt angenommen und zum Nachfolger bestimmt. Hatte wiederholt zerstörerisch in sein Leben eingegriffen und ihn damit zum „traurigsten Mann der Welt“ gemacht, wie Plinius zu berichten wusste … Doch dann wenigstens das: Von blaugrüner Farbe das Meer weit unter meinen Füßen, das auch er gesehen hat. Zerklüftet die Schroffen, die in die Tiefe stürzen. Überwölkt vom makellosen Azur des campanischen Himmels. Ich kann ihn verstehen. Ruhe, fast gespenstische Stille um mich herum. Nur ab und zu das Kreischen der Möwen. Kaum eines Menschen Fuß verirrt sich hierher. Zu steinig ist der Pfad, zu wenig ergiebig erscheint das Ziel. Reizvoll nur für den, der Augen und Ohren für die Magie dieses Ortes hat. Eine Weile stehe ich stumm, erfüllt von Ehrfurcht für den Palast, der dem Herrn des Himmels geweiht ist: das weitläufige Areal der Villa Jovis.
„Entschuldigen’S!“, werde ich aus meinen rückwärts gerichteten Gedanken gerissen. Ein wenig verstört drehe ich mich um. Nein, es ist nicht Jupiter, der mir an dieser fast magischen Stätte in den Trümmern des nach ihm benannten Landsitzes erscheint, wenngleich die Erscheinung auch graues, bis zu den Schultern wallendes Haar und ein weißer Rauschebart ziert, der immerhin fast bis zur fülligen Brust reicht. „’Tschuldigung!“, wiederholt der Fremde, und ich blicke einem Bayern auf Kulturtour ins Gesicht, der in eine etwas knappe, kurze Lederhose gepresst ist, einen gamsbartbewehrten Hut auf dem mächtigen Haupt trägt und einen prallen Rucksack von offensichtlich beachtlichem Gewicht auf dem Rücken. „Wo find i, bitt schön, dö Villa Jovis?“, will der Mann von mir wissen, und es hat ganz und gar nicht den Anschein, dass er sich über mich lustig macht. Er breitet eine Karte der doppelgipfligen Insel aus, die er ein wenig umständlich einnordet und eifrig zu studieren beginnt.
„Na, Sie stehen doch mitten drin!“, gebe ich bereitwillig Auskunft. Der Blick, der mich durchbohrt, drückt Erstaunen, nein, Misstrauen, ja sogar ein wenig Verachtung aus. Und er scheint sich zu fragen, ob er da einer Ignorantin oder gar einer Verrückten aufgesessen ist. Die Enttäuschung über das, was er nach doch recht mühsamem Aufstieg – er atmet immer noch schwer und der Schweiß steht ihm glänzend auf der Stirn – hier vorfand, ist ihm deutlich anzusehen. Aber er fasst sich schnell wieder. In sicherer Entfernung von mir lässt er sich auf einer Fundamentmauer nieder, schüttelt ungläubig sein schweres Haupt, nimmt seinen Rucksack ab, wischt sich mit einem karierten Taschentuch über die schweißnasse Stirn und beginnt, seine deftigen Schmankerln auszupacken. Mich würdigt er keines Blickes mehr …
Tiberius Claudius, wie er bei seiner Geburt hieß: Wer war er eigentlich, der dem Römerreich immerhin fast 23 Jahre vorstand, über den Zeitgenossen wie Nachgeborene die unterschiedlichsten Urteile fällten, an dem die meisten aber kein gutes Haar ließen und der, wenn wir Historikern und Vitenschreibern vertrauen können, seinen Untertanen verhasst war? So sehr verhasst, dass sie ihm Trunksucht und unvorstellbare sexuelle Ausschweifungen nachsagten, dass sie sogar die Entsorgung seiner Leiche in den Fluten des Tibers forderten: „Biberius“, nannten sie ihn, den Trinker, und der Pöbel auf der Straße skandierte, als er gestorben war: „Tiberium in Tiberim, Tiberium in Tiberim!“
Wer war er, dieser finstere, zu Melancholie und Schwermut neigende Mann, der um eines ungeliebten und von ihm nicht begehrten Thrones willen um sein Leben betrogen wurde? Wer war er, der dem Moloch Rom entfloh und auf der entlegenen Insel in aller Abgeschiedenheit die letzten elf Jahre seines vergeudeten Lebens verbrachte? Und ist es möglich, seiner gewiss zwiespältigen Persönlichkeit einigermaßen gerecht zu werden?
Einen Versuch ist es wert. So will ich mich denn an die Arbeit machen.
Kindheit und Jugend
Fast elf Jahre lebte Kaiser Tiberius schon auf Capri, als er, ein verbitterter Greis, von einem der wenigen Vertrauten, die ihm geblieben waren, angesprochen wurde: „Erinnerst du dich noch, Caesar?“
„Nein“, fuhr ihm der Alte schroff dazwischen. „Ich erinnere mich an nichts, was ich jemals gewesen bin.“
Wie soll sich ein Kind entwickeln, das im zarten Alter von vier Jahren von seiner Mutter im Stich gelassen und im Haus eines mürrischen, zu Depressionen neigenden Vaters in die Obhut von Ammen gegeben wird? Was kann aus einem Menschen werden, der, durch Flucht, Vertreibung und Unglück schon in frühester Kindheit traumatisiert, über Jahrzehnte ausschließlich für fragwürdige politische Zwecke missbraucht wird? Tiberius Claudius Nero, der nachmalige Kaiser, war solch ein Mensch.
Er wurde am 16. November 42 v. Chr. geboren, im Jahr 711 seit Gründung der Stadt, nach der die Römer ihre Jahre zählten. Nach dem Glauben der Alten berechtigte der Geburtsort zu den größten Hoffnungen: Das Kind soll nach herrschender Meinung auf dem Palatin, dem Hügel Roms, der dem Himmel so nahe ist, das Licht der Welt erblickt haben. Dies kann jedoch kaum richtig sein. Denn die alteingesessene Familie der Claudier wohnte auf dem kaum weniger vornehmen Caelius, der dem Palatin gegenüber liegt. Und Tiberius’ Eltern waren zum Zeitpunkt seiner Geburt noch verheiratet. Erst einige Jahre später sollte seine Mutter auf den Palatin umziehen. Es ist möglich, dass der antike Biograf Suetonius Tranquillus, Sekretär im Dienste Kaiser Hadrians (117–138 n. Chr.), der der interessierten Nachwelt die Biografien der ersten zwölf Kaiser Roms von Caesar bis Domitian hinterließ und dem wir auch viele Nachrichten über Tiberius verdanken, durch den Geburtsort „Palatin“ die Herkunft seines Protagonisten aufwerten wollte.
Freilich sahen einige seinen Geburtsort in Fundi, einer Kleinstadt in Latium, die an der Via Appia lag. Sie stützten ihre Behauptung darauf, dass Tiberius’ Großmutter mütterlicherseits aus Fundi stammte. Aber durfte es damals schon sein, dass ein römischer Herrscher seine Wurzeln in einem unbedeutenden Dorf hatte?
Rom oder dieses Städtchen auf dem Land: Wo der nachmalige Kaiser das Licht der Welt erblickte, spielte für seinen Werdegang keine Rolle. Denn alles schien vorherbestimmt in diesem Leben, das wie kaum ein anderes von Verlust und Verzicht und alles andere als selbstbestimmt, aber auch seit früher Jugend von Wunderzeichen und mehr oder weniger günstigen Vorhersagen geprägt war.
Schon unmittelbar nach seiner Geburt wurde Tiberius eine große Zukunft geweissagt. Seine Mutter Livia war sich übrigens ganz sicher gewesen, einen Sohn zu gebären. Denn sie hatte während ihrer Schwangerschaft versucht, das Geschlecht des Kindes, das sie in sich trug, zu erfahren, und dazu unter anderem einer brütenden Henne ein Ei weggenommen, das sie, abwechselnd mit ihren Dienerinnen, in der Hand so lange wärmte, bis ein Hähnchen mit einem besonders großen Kamm schlüpfte. Nach dem Glauben der Alten wies das eindeutig auf die Geburt eines Knaben hin. Dann sagte der Astrologe Scribonius dem Neugeborenen eine große Zukunft voraus: Der Knabe werde einst König sein, allerdings ohne die Abzeichen der königlichen Würde. Eine mutige Vorhersage zu einer Zeit, als die Herrschaft der Caesaren noch völlig im Dunkeln lag.
Von großem Einfluss waren die beiden Familien, in die das Kind hineingeboren wurde. Väterlicher- wie mütterlicherseits die Claudier, ein altes, hoch angesehenes Geschlecht, das seine Wurzeln bis auf die Götter und Heroen zurückführte und der römischen Hocharistokratie angehörte. (Es gab eine gleichnamige plebejische Gens, die den patrizischen Claudiern an Macht und Ansehen kaum nachstand. Schon in der Frühzeit Roms hatten sich die beiden Familien aber getrennt.) Wenn es in Stadt und Reich je überzeugte Verfechter von Macht und Würde des Hochadels gab, gehörten sie zweifellos den Claudiern an, die seit jeher als stolz und unnahbar galten. Sie seien, so sah es zumindest Suetonius Tranquillus, der römische Kaiserbiograf, besonders dem Volk gegenüber „sehr heftig und anmaßend“ gewesen. So habe es beispielsweise keiner von ihnen über sich gebracht, sich öffentlich in Trauerkleidung zu zeigen, oder, sofern einer zum Tode verurteilt worden war, um sein Leben zu bitten. Der spätere Kaiser sollte da keine Ausnahme sein, wie sich noch herausstellen wird.
Im Laufe der Zeit, so Suetonius, erlangten Angehörige der Claudier achtundzwanzig Mal das Konsulat, fünfmal die Diktatur und siebenmal die Censur. Zudem wurden sie mit sechs großen und zwei kleinen Triumphen geehrt. „Sie führten verschiedene Vor- und Beinamen, von denen der Vorname Lucius einstimmig ausgeschlossen wurde, nachdem von zwei Familienmitgliedern, die diesen Namen getragen hatten, der eine der Wegelagerei, der andere des Mordes überführt worden war. Unter die Beinamen wurde der Name Nero aufgenommen, der auf sabinisch ‚stark‘ und ‚tapfer‘ bedeutet.“1 Derart also waren auch Tiberius’ Vorfahren mütterlicherseits. Denn beide, Vater und Mutter waren, wenn auch weitläufig, miteinander verwandt.
Der Stammvater der Claudier soll ein gewisser Clausus gewesen sein. Der Überlieferung nach, die das adelsstolze Geschlecht in Rom nur allzu gern wach hielt, war er der Sohn des Gottes Saturn, von den städtischen Priestern dem vorzeitlichen Kronos gleichgesetzt, dem Titanen, der als Spross des Himmelsbeherrschers Uranos und der Erdmutter Gaia galt. Kronos, so ging die Sage, hatte seinen Vater mit einer scharfen Sichel entmannt und seine eigenen Kinder verschlungen, und nur Zeus war Dank eines Täuschungsmanövers von Uranos’ listiger Gattin diesem Ungeheuer entkommen. Denn Rheia, so hieß die liebende Mutter, hatte ihrem Mann statt des Kindes einen in Windeln gewickelten Stein angeboten. Der heranwachsende Zeus rächte seine Geschwister und stürzte den Vater in den Tartarus. Doch eines Tages sei Kronos die Flucht gelungen, und er sei unter dem Namen Saturn nach Italien gekommen, wo er fortan gemeinsam mit dem doppelgesichtigen Janus über die fruchtbaren Ebenen an den Ufern des Tibers herrschte. Auf dem Hügel Janiculus, so hieß es weiter, habe er bald eine Stadt gegründet, die nach ihm benannt wurde: Saturnia, so viele Jahrhunderte älter als die erhabene Roma. Angeblich verdankte Rom, später die Beherrscherin der Welt, nur diesem Gott ihren Reichtum. Denn er war mit der Göttin Ops vermählt, die für Fülle und Wohlstand sorgte.
Erst nachdem der letzte etruskische König, Tarquinius Superbus, aus Rom verjagt worden war und die Römer einen heiligen Eid geschworen hatten, sich nie mehr einem König unterzuordnen und die Herrschaft nur noch in die Hände der Ersten und Besten zu legen, – nach unserer Zeitrechnung 510 v. Chr. –, siedelten sich dort die Claudier an, um von da an die Geschicke der Stadt und des späteren Reiches verantwortlich mitzugestalten.
Auf diese göttliche Herkunft und das uralte Geschlecht sahen die Claudier zurück und machten aus ihrer Verachtung für die Julier, denen der erste Princeps Octavian Augustus entstammte, keinen Hehl. Um wieviel vornehmer waren sie doch als jene, die ihre Wurzeln auf Troja und auf Aeneas, einen Flüchtling, zurückführten und erst kürzlich die Subura, die schmuddelige Unterstadt, verlassen hatten, um die Hügel des Lichts zu erklimmen!
Zwei Vorväter des nachmaligen Kaisers waren Söhne des Appius Claudius Caecus, auf den nicht nur die älteste Wasserleitung Roms zurückgeht. Auch die frühesten Abschnitte der Via Appia, die ins süditalienische Brundisium (heute Brindisi) führt, tragen seine Handschrift. Der Mann, der wohl blind war – daher sein Cognomen „Caecus“ – und doch mehr als andere sah, wurde zu allen Zeiten in Rom verehrt. Seine beiden Söhne trugen die Namen Tiberius Nero und Appius Pulcher. Der Großvater von Tiberius’ Mutter Livia Drusilla war darüber hinaus durch Adoption in die Familie der Livier aufgenommen worden, einer plebejischen Gens, die dennoch in hohem Ansehen stand und dem Staat mehrere Konsuln und andere wichtige Staatsmänner geschenkt hatte. Der Name von Tiberius’ Mutter leitete sich von diesen Liviern ab, sowie von Drusus, einem Beinamen, der einst einem ihrer Vorfahren verliehen worden war, weil er in mutigem Einsatz einen feindlichen Führer namens Drausus im Nahkampf getötet hatte.
Tiberius Claudius Nero, der Vater, stand einige Jahre vor der Geburt seines ersten Sohnes dem nach der Alleinherrschaft strebenden Gaius Iulius Caesar als Quästor im erfolgreichen Kampf um das ägyptische Alexandria zur Seite – er befehligte die Flotte – und wurde vom dankbaren Diktator in das kürzlich eroberte Gallien geschickt, um dort Kolonien zu gründen. Südfranzösische Städte wie Narbonne und Arles gehen auf seine Initiative zurück.
Es ist nicht bekannt, weshalb sich der willensschwache Tiberius bald von seinem mächtigen Gönner abwandte. Möglicherweise ertrug er, ein eingefleischter Republikaner, Caesars unverhohlenes Machtstreben und, wie das Gerücht verbreitete, dessen Griff nach dem Königsdiadem nicht. Jedenfalls trat er nach Caesars Ermordung an den Iden des März 44 v. Chr. nicht nur für eine Straffreiheit der Attentäter ein wie viele seiner Standesgenossen: Er ging weit darüber hinaus und forderte, alle, die an dem Verbrechen beteiligt gewesen waren, zu belohnen. Seine diesbezügliche Rede vor dem Senat brachte ihm nicht nur den Unmut der eingeschriebenen Väter ein, sondern auch den Hass der Triumvirn, jenes Dreimännerbundes – Octavian, Antonius und Lepidus –, der nach vollendeter Rache für Caesars gewaltsamen Tod die Geschicke des Reiches in seine Hände genommen hatte, sich aber oft uneins war. Tiberius Claudius Nero wurde auf die Proskriptionsliste gesetzt, das heißt, er hatte Leben und Ehre verwirkt. Aus einem Geachteten war ein Geächteter geworden.
Es scheint überhaupt, als habe er immer auf der falschen Seite gestanden, wie sich noch zeigen wird.
Ganz anders entwickelte sich die Lebensgeschichte von Tiberius’ Großvater mütterlicherseits. In unerschütterlicher Treue stand er zur Senatsherrschaft. Doch der Sieg der Caesar-Rächer bei Philippi ließ ihn verzweifeln. Er mochte ahnen, dass die res publica für immer verloren war, und stürzte sich in sein Schwert.
Als die Verfechter der republikanischen Freiheit auf griechischem Boden geschlagen worden waren, schrieb Rom das Jahr 711 a.u.c. (42 v. Chr.), das auch das Geburtsjahr des späteren Kaisers Tiberius war. Sein Vater hatte einige Zeit zuvor Livia Drusilla geheiratet, seine Verwandte, die nicht nur eine stadtbekannte Schönheit, sondern schon als junges Mädchen überaus ehrgeizig war. Es war sicherlich keine Verbindung, die auf gegenseitiger Zuneigung gründete. Derartige Ehen waren in Rom nicht üblich. Die Eltern hatten die Heirat arrangiert. Familiäre Rücksichten mochten dabei ausschlaggebend gewesen sein, und auch Geld spielte wohl eine entscheidende Rolle. Es sollte in der Familie bleiben. Der jungen Livia war es zunächst sicherlich recht. Der ihr verordnete Gatte gehörte der römischen Hocharistokratie an und damit zu den ältesten und angesehensten Sippen der Stadt, was ihrem Ehrgeiz sehr entgegenkam. Denn die stolze Schöne trug schwer daran, dass sie durch die Adoption ihres Großvaters auch in das plebejische Geschlecht der Livier geraten war. Jedenfalls wurde sie nicht müde, immer und überall ihre claudische Abstammung zu betonen und darauf hinzuweisen, dass sich ihr Großvater auf die Livier nur eingelassen habe, um eine drohende Verarmung zu verhindern. Vom Geburtsort ihrer Mutter, der bereits erwähnten Kleinstadt Fundi, war bei ihr überhaupt nicht die Rede.
Die zeitgenössische Geschichtsschreibung schilderte schon die junge Frau als hochfahrendes, zu Herrschsucht neigendes Wesen, was man allerdings, ganz im Einklang mit den Vorstellungen des Römertums, dem unglücklichen Gestirn zuschrieb, unter dem sie geboren war: dem Sternzeichen des Wassermanns. Im Laufe ihres langen Lebens sollte sich diese Einschätzung als allzu richtig erweisen.
Wenn sich ein derartiger Charakterzug tatsächlich schon bei der Heranwachsenden zeigte, so war der düstere und zurückhaltende Ehemann, der zudem um einiges älter war als sie, sicherlich nicht die richtige Partie, und es war abzusehen, dass ein Leben an seiner Seite auf Dauer Livia Drusillas Ansprüchen nicht genügen würde. Dies umso mehr, als der Gatte, unentschlossen, für welche politische Richtung er sich entscheiden sollte, immer wieder die Fronten wechselte und erst kurz vor Ende seines nicht allzu reichlich bemessenen Lebens zwangsläufig ein wenig zur Ruhe kam. Livia machte aus ihrer Verachtung für den schwächlichen Mann, der ihr von ihrer Familie und vom Schicksal aufgezwungen worden war, bald keinen Hehl mehr. War dieser Versager ihrer überhaupt würdig, dieser bereits ältliche, ein wenig untersetzte Mensch, den sie nicht nur körperlich um einiges überragte? Traf es zu, dass sie sich ihm anfangs verweigerte und eine Annäherung erst im Alter von sechzehn Jahren zuließ, ganz ungewöhnlich für eine Römerin der damaligen Zeit, die doch bereits mit zwölf Jahren als geschlechtsreif und damit ehefähig galt? Wir wissen es nicht. Doch hat sich bald nach den ersten Begegnungen im ehelichen Bett eine Schwangerschaft eingestellt, die Livia mit ihrem Schicksal ein wenig versöhnte. Ihre Freude mag umso größer gewesen sein, als sie einen Jungen gebar, der, so hoffte sie, ihr einst ähnlich werden und den Stamm der Claudier weiterführen würde, so es den Göttern gefiele.
Das Neugeborene wurde seinem Vater zu Füßen gelegt. Er musste es aufheben und damit anerkennen. So verlangte es der Brauch. Auch bei der Namensgebung war man der Tradition verpflichtet. Der Erstgeborene wurde Tiberius Claudius genannt wie vor ihm sein Vater und davor wiederum dessen Vater.
Misstrauisch verfolgte Livias unsicherer Ehemann die politische Entwicklung. Er stand noch immer auf der Liste der zum Tode Verurteilten, und es galt, den Häschern der Triumvirn unbeschadet zu entkommen. Beim Heranrücken derer, die ihm nach dem Leben trachteten – er befand sich gerade mit seiner jungen Familie im sicher geglaubten Neapel – bestieg er mit den Seinen heimlich und in aller Eile ein Schiff, das ihn nach Sizilien bringen sollte. Die Aufregung des überstürzten Aufbruchs muss sich auch auf seinen kleinen Sohn übertragen haben. Mit seinem Gewimmer hätte er die Absicht seiner Eltern beinahe verraten. Einmal, so berichtet der antike Biograf, als er von der Brust seiner Amme gerissen wurde, und das zweite Mal, als man ihn seiner Mutter wegnahm. Beides geschah jedoch nicht in böser Absicht. Man wollte den Frauen in der kritischen Lage, in der sich die Fliehenden befanden, ihre Last abnehmen, um schneller vorwärts zu kommen. Zu allem Unglück glitt Livia noch auf dem schmalen, glitschigen Steg aus, der auf das Schiff führte, und wäre ins Wasser gefallen, hätte ihr Mann sie nicht aufgefangen. Dass sie mit ihrem Gatten die Beschwernisse und Gefahren der Flucht teilte, zeugt davon, wie hoch sie die Pflicht der römischen Matrone achtete. Tiberius mochte nicht der Mann sein, den sich eine junge Frau in einsamen Nächten erträumte, aber sie war mit ihm verheiratet und hatte alles mit ihm zu erdulden. Nur darauf kam es an. Wenige Jahre später sollte sie auf ihn und ihre kleine Familie allerdings keine Rücksicht mehr nehmen.
Der eilige Aufbruch brachte die Reisegesellschaft schließlich nach Sizilien, wo Tiberius bei Sextus Pompeius, dem Sohn des Pompeius Magnus, nach anfänglichen Schwierigkeiten Aufnahme, Zuflucht und neue Aufgaben zu finden hoffte. Er glaubte, Pompeius, der sich selbst zum „Seekönig“ ernannt hatte und ein strikter Gegner des in Rom herrschenden Dreimännerbundes war, sei als Einziger in der Lage, die republikanische Freiheit wiederherzustellen. Aber er fand nur einen müßigen Feldherrn vor, der seine Zeit mit üppigen Festgelagen vergeudete und einer verlotterten Flotte vorstand. Anstatt für den in Tiberius’ Augen nötigen Freiheitskrieg zu rüsten, verprasste Sextus Pompeius die Abgaben, die die sizilischen Bauern zu leisten hatten, stellte sich blind, wenn seine Schergen wie gemeine Piraten Handelsschiffe überfielen und ausraubten und verjubelte das ohnehin wenige Geld, das er eigentlich für den Kampf um Rom vorgesehen hatte. Die lauen Nächte hallten wider vom Gegröle der Betrunkenen, und der Seekönig machte überhaupt keine Anstalten, sich ernsthaften Dingen zuzuwenden.
Mit diesem Mann, das erkannte Tiberius sehr bald, war im wahrsten Sinne des Wortes kein Staat zu machen. Dennoch freute sich die Familie über die gastliche Aufnahme, die ihr im Haus des Pompeius bereitet wurde, hatte sich ihr gegenüber doch in letzter Zeit kaum jemand freundlich gezeigt. Besonders Schwester Pompeia, die das Los ihres Bruders, die „Verbannung“ aus Rom, teilte, war von dem kleinen Tiberius so entzückt, dass sie ihn, wo es nur ging, verwöhnte. Das Kind erhielt von ihr wertvolle Geschenke, unter anderem ein Mäntelchen mit einer kostbaren Spange und goldene Amulette. Noch Jahrzehnte später konnte man Suetonius zufolge diese Gaben im noblen Badeort Baiae an der Küste Campaniens bewundern.2
Bei aller Freundschaft und trotz des kaum noch für möglich gehaltenen Wohllebens, das man den Claudiern auf Sizilien bot, war an ein langes Bleiben auf der Insel nicht zu denken. Zum einen war man den feindlichen Häschern zu nahe. Zum anderen waren ihnen die Hände gebunden. Die Claudier mussten sich also erneut den Launen der See überlassen.
Ihr Ziel war Griechenland, wo vor ihnen schon zahlreiche Angehörige der römischen Oberschicht Zuflucht und Schutz vor feindlichen Nachstellungen gesucht und gefunden hatten. Ohnehin bestanden vor allem zu den Spartanern jahrzehntealte Beziehungen. Hatten sich doch diese vor mehreren Generationen, nachdem die Griechen von Rom unterworfen worden waren, ausdrücklich unter den Schutz der Claudier gestellt. Man durfte also annehmen, dort willkommen zu sein.
Derweil hatten die Angehörigen des wieder einmal zerstrittenen Triumvirats erneut zueinander gefunden. Im Grunde teilten sich nun Caesars Adoptivsohn Octavian und Marcus Antonius die Macht, Octavian erhielt den Westen des Imperiums, Antonius die östlichen Reichsteile. Der Dritte im Bunde, Lepidus, wurde mit dem Norden Afrikas abgefunden, durfte aber das Amt des obersten Priesters, des Pontifex Maximus, behalten, da dieses auf Lebenszeit vergeben war. Die Verhältnisse waren also friedlicher geworden. Und vielleicht, überlegte Tiberius Claudius, würde sich ja ein Marcus Antonius daran erinnern, dass er, Tiberius, vor einigen Jahren für Antonius’ Sache vor Perusia gekämpft hatte. Die Gelegenheit schien günstig. So beschloss er, sich Marcus Antonius anzuschließen und die Rückkehr nach Rom zu wagen. Er ahnte nicht, dass andere lebensbedrohende Ereignisse anstanden, die seine Heimkehr verzögern sollten.
Im Schutze der Nacht waren die Flüchtlinge aus dem sicheren lakedämonischen Exil aufgebrochen, als sich die ganze Gesellschaft in einem Wald plötzlich von meterhohen Flammen eingeschlossen fand. Schon waren Livias Kleider angesengt, ihr Gesicht rußgeschwärzt und das Haar von der Hitze gekräuselt. Mit dem Mut der Verzweiflung warf sich die junge Frau auf ihr Kind, um wenigstens dessen Leben zu retten. Und es grenzt fast an ein Wunder, dass die Claudier diesem Inferno ohne größeren Schaden entkamen. Ob es sich um einen jener Waldbrände in südeuropäischen Ländern handelte, von denen wir auch heute noch immer wieder hören oder gezielte Brandstiftung vorlag, der die Claudier zum Opfer fallen sollten, ist nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich aber hat die traumatische Erfahrung entscheidend dazu beigetragen, dass Sohn Tiberius im Herzen seiner Mutter Zeit ihres Lebens einen besonderen Platz einnahm, den ihm nicht einmal Bruder Drusus, mit seinem leutseligen und freundlichen Wesen das krasse Gegenteil des Älteren, streitig machen konnte. Die sicherlich übertriebene Mutterliebe schreckte selbst vor mehrfachem Mord zu Gunsten des Sohnes nicht zurück, wie sich noch zeigen wird. Der Erstgeborene war und blieb ihr Augapfel, auch in Zeiten, in denen zwischen Mutter und Sohn tiefe Spannungen herrschten.
Es ist kaum möglich, dass sich das Kind, bei der Rückkehr der Familie nach Rom gerade zwei Jahre alt, an Flucht, Vertreibung und den lebensbedrohenden Waldbrand erinnerte. Wahrscheinlich hat Livia ihrem Lieblingssohn von den Ereignissen berichtet, nach denen er, wie es Kinderart ist, sicherlich immer wieder fragte, bis sich das Erzählte in seiner Phantasie zu eigenem Erleben verdichtete. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass schon damals der Grundstock zu Tiberius’ Wertschätzung alles Griechischen gelegt wurde. Erst viel später sollte er auch den Zauber von Inseln entdecken. Die als Erwachsener auf Rhodos nicht ganz freiwillig verbrachten Jahre betrachtete er rückblickend als die glücklichsten seines ganzen Lebens …
Als er vier Jahre alt war, gingen im Haus am Caelius-Hügel, zu jener Zeit eine der vornehmsten Wohngegenden Roms, seltsame Dinge vor, die auch dem kleinen Tiberius nicht entgingen. Immer öfter erschien dort ein junger Mann mit blauen Augen unter gelocktem Blondhaar, der von dem kleinen Jungen kaum Notiz nahm. Schön war er nicht, dieser Fremde, der, sooft er lachte, eine lückenhafte Reihe gelber Zähne zeigte und auf das Kind fast ein wenig unheimlich wirkte. Nicht schön und auch nicht so vornehm wie Vater Tiberius. Wohnte er doch auch nicht auf dem Caelius, sondern im eher unscheinbaren, leicht verwahrlosten Haus des unbedeutenden Redners Calvus in der Stiegengasse.
Überhaupt war er von zweifelhafter Herkunft, was der Vater oft betonte. Aber erst, wenn der Fremde wieder gegangen war. Tiberius erfuhr zwar später, der Jüngling sei von seinem Großonkel Gaius Iulius Caesar noch kurz vor dessen Ermordung an Sohnes statt angenommen worden, aber selbst der große Julier konnte sich keiner altehrwürdigen Ahnen rühmen, was er freilich dennoch tat. Vater Tiberius erinnerte sich noch gut, dass dieser Caesar einst in öffentlicher Rede seine Herkunft auf Urvater Aeneas und dessen göttliche Mutter Venus und gleichermaßen auf den Kriegsgott Mars zurückgeführt und damit seiner Gens eine gewaltige Aufwertung beschert hatte. Aber es war allseits bekannt, dass Caesars unmittelbare Vorfahren aus der Subura kamen, der schmuddeligen Unterstadt, in die keiner von Roms Noblen ohne Not je auch nur einen Fuß gesetzt hätte.
Was wollte der eigenartige Gast nur immer in Tiberius’ Haus? Und warum ließ er, sooft er zu Besuch kam, Mutter Livia nicht aus den Augen? Der kleine Junge fand keine Erklärung dafür. Erst allmählich erfuhr das besorgte Kind, dass der Mann Octavian hieß und derjenige war, vor dessen Hass sein armer Vater über Land und Meer hatte fliehen müssen. Und ab und zu war auch zu vernehmen, dass sein Vater nur am Leben geblieben war, weil dieser unsympathische Mensch ein Auge auf die schöne Livia Drusilla geworfen hatte.
Was mag der Junge gefühlt haben, als er langsam begriff, dass Octavians Besuche ausschließlich der Mutter galten, die sich zunehmend, auch das kann dem heranwachsenden Kind kaum verborgen geblieben sein, ihrem Gatten und ihrer Familie und damit auch ihm, dem Sohn, entfremdete? Ohnmächtig musste der Kleine zusehen, wie die ihm gewohnte heile Welt langsam zu bröckeln begann und der Vater von Tag zu Tag trauriger und schweigsamer wurde.
Denn Livia Drusilla zeigte sich keineswegs unempfänglich für die Schmeicheleien des hartnäckigen Besuchers. Mit dem sicheren Instinkt für Einfluss und Macht sah sie in ihm die Zukunft Roms, eine Zukunft, die ihr äußerst verlockend erschien. War er nicht genau der Mann, der, ihr ähnlich, trotz seiner Jugend längst nach den Sternen griff? Dessen Erfolg allenthalben bereits abzusehen war? Waren ihm doch in dem Vertrag, den der Dreimännerbund abgeschlossen hatte, der Westen des Reiches und die Hauptstadt Rom zugefallen, während Caesars Freund und erfahrener General Marcus Antonius nur Herr des Ostens geworden war? Dem jungen Octavian standen damit alle Türen offen, und er machte schon jetzt von seinen Möglichkeiten rücksichtslos Gebrauch.
Wir wissen nicht, was Vater Tiberius zuletzt bewog, dem gnadenlosen Aufsteiger, der bislang hauptsächlich durch unvorstellbare Grausamkeit aufgefallen war – man denke nur an sein Wüten in Perusia, wo er vor wenigen Jahren ohne Erbarmen 300 Patrizier hatte abschlachten lassen –, die Frau abzutreten. Die bis heute andauernde Verwunderung darüber war und ist umso größer, da bekannt wurde, dass Livia mit ihrem zweiten Sohn im sechsten Monat schwanger war. Schon munkelte man in Rom hinter vorgehaltener Hand, dieses Kind, das den Namen Drusus tragen sollte, sei die Frucht eines Seitensprungs der Mutter mit dem um sie werbenden Verehrer, der bald aus seiner Begierde keinen Hehl mehr machte. Welche Druckmittel mögen Tiberius Claudius Nero überzeugt haben, auf seine schöne Ehefrau zu verzichten, auch wenn man ihm versprach, das Kind nach seiner Geburt sogleich dem Vater „zurückzugeben“? Und weshalb versteifte sich Octavian gerade auf diese Frau, wo es doch in Rom an Schönheiten gewiss nicht mangelte?
Es kann kaum nur darum gegangen sein, einen Angehörigen eines der ältesten und vornehmsten Geschlechter der Stadt zu demütigen. Aber Octavian war sich durchaus bewusst, dass er nur durch die Verbindung mit einer Frau, die der Hocharistokratie angehörte, Zugang zum inneren Kreis der römischen Nobilität erlangen würde, die noch immer die höchsten Staatsämter unter sich aufteilte. Scribonia, einige Jahre älter als er, mit der er noch verheiratet war und die zur Gens des Pompeius gehörte – sie war eine entfernt Verwandte des Seekönigs –, genügte dazu nicht. Die Pompeianer, die noch eine Generation zuvor einen Pompeius Magnus hervorgebracht hatten, hatten ihre beste Zeit hinter sich. Es war abzusehen, dass diese Familie in der Geschichte Roms keine große Rolle mehr spielen würde. Da konnte Octavian, wie er glaubte, auch keine Rücksicht darauf nehmen, dass ihm Scribonia gerade eine Tochter geboren hatte. Julia, das einzige legitime Kind, das er je haben würde, sollte ihm aber noch großen Kummer bereiten.
Der vierjährige Tiberius blieb also bei seinem Vater, während Mutter Livia zu Octavian zog, der sich von Scribonia scheiden ließ und die Schwangere zur Frau nahm, freilich nicht ohne zuvor die Priesterschaft Roms (der er selbst angehörte) zu fragen, ob solche Eile nicht unsittlich oder gar unglückbringend war. Nachdem die Götter ihre Zustimmung erteilt hatten, stand der Heirat nichts mehr im Wege. Und die Römer hatten ihren Skandal. „Wer Glück hat, bekommt auch noch ein Dreimonatskind“, spotteten sie auf den Straßen. Aber die Neuvermählten, bei denen möglicherweise auch gegenseitige Zuneigung eine Rolle spielte, störten sich daran nicht. Sie ließen den Römern ihren Spaß und übergaben den kleinen Drusus vereinbarungsgemäß dem Mann, der zumindest nach dem Gesetz sein Vater war. Und doch verstummten die Spekulationen nicht. War das alles ein abgekartetes Spiel? War vielleicht dieser Drusus doch das Produkt eines Ehebruchs seiner keineswegs so sittenstrengen Mutter? Niemand weiß es. Schon die äußere Ähnlichkeit mit Octavian und sein freundliches Wesen – er sollte sich später zum beliebtesten Mitglied des gesamten Kaiserhauses entwickeln – könnten dafür sprechen. Nur die unmittelbar Beteiligten wussten, was wirklich geschehen war, und sie haben dieses Wissen mit ins Grab genommen.
Für den verlassenen Ehemann war die ganze Geschichte wohl doch nicht so leicht zu verkraften, wie es anfangs den Anschein hatte. Die Schande, gegen den skrupellosen jungen Aufsteiger verloren zu haben, lastete schwer auf ihm und setzte seiner Gesundheit heftig zu. Er verfiel in eine tiefe Traurigkeit, aus der ihn auch der kleine Sohn, dem das Leiden des Vaters sicherlich nicht entging, nicht erlösen konnte. Es gelang ihm kaum mehr, sich um Tiberius Junior zu kümmern, der bald der Obhut allzu strenger Pädagogen überlassen wurde, als müsste der Vater den Mangel an eigener Zuwendung kompensieren. Die Mutter sah der Junge kaum noch, allenfalls während gelegentlicher flüchtiger Besuche, die fast im Geheimen abzulaufen hatten. Möglicherweise wollte sie ihrem ersten Ehemann nicht begegnen. Denn sie muss erkannt haben, wie sehr sich dieser grämte und wie rasch er verfiel, nachdem ihn die ganze Stadt zum Hahnrei erklärt hatte und sich darüber hinaus über ihn lustig machte, da er so offensichtlich immer die falsche politische Wahl traf, das heißt, sich im Kampf um Einfluss und Macht stets der falschen Seite angeschlossen hatte. Für die schadenfrohen Römer galt er als Verlierer schlechthin. Und Verlierer schätzte man in einer Gesellschaft nicht, die sich gerade anschickte, die Weltherrschaft zu erringen. Immer misstrauischer und menschenscheuer wurde Tiberius Claudius, immer mehr zog er sich in sich selbst zurück. Bald verließ er sein Haus überhaupt nicht mehr.
Octavian, dem eine erneute Vaterschaft vom Schicksal versagt blieb, ließ nichts unversucht, das heranwachsende Kind für sich einzunehmen. Drusus, der jüngere Bruder, war ein fröhlicher, aufgeschlossener Junge, der keiner besonderen Aufmerksamkeit bedurfte. Ihm flogen die Herzen ohnehin im Sturm zu. Bei den wenigen Besuchen des kleinen Tiberius auf dem Palatin, wo das junge Paar jetzt wohnte, bemühte sich Octavian daher, den störrischen Knaben, der das Geschehen mit stumpfer Miene und geschlossenen Lippen verfolgte, mit kostbaren Geschenken für sich einzunehmen. Aber Livias Sohn fiel auf solch plumpe Annäherungsversuche nicht herein. Er machte deutlich, dass er sich, wenn überhaupt, allenfalls für bestimmte Bücher interessierte, nicht für irgendwelche Waffen, mit denen ihn der neue Mann an der Seite seiner Mutter zu überlisten versuchte. Dies brachte ihm Verachtung und Spott des gesamten stiefväterlichen Haushalts ein. Wer interessierte sich schon für Bücher? Schon damals zeichnete sich ab, dass sich das Verhältnis von Tiberius zu Octavian niemals zu einem herzlichen entwickeln würde.
Die erste wirklich große Herausforderung traf Livias Sohn, als der Vater starb, ein gebrochener, am Leben verzweifelter Mann, den zuletzt eine unbekannte körperliche Krankheit gequält hatte, wohl hervorgerufen durch die vielfache Schmach, die er hatte erfahren müssen. Es war jedoch, wie gesagt, nicht nur der Verlust der Frau, der ihn gekränkt hatte. Ohnehin hatten ihn an sie keine großen Gefühle gebunden. Mehr noch muss ihm bewusst gewesen sein, dass er sein Leben vertan hatte. Leer, grau und verächtlich war es ihm nun selbst erschienen. Was er auch begonnen hatte, immer war es missraten. Stets hatte er auf der falschen Seite gestanden, hatte Ruf und Ehre, hatte alles verloren. Und Hoffnung auf Veränderung zum Guten hin gab es nicht mehr.
Ein Rhetor hatte die Leichenrede gefertigt, die Tiberius’ gleichnamiger neunjähriger Sohn vor dem aufgerichteten Scheiterhaufen hielt. Als die Flammen zusammengefallen und nur noch glühende Holzscheite übrig geblieben waren, führte man die beiden Claudiersöhne vom Marsfeld unmittelbar in das Wohnhaus von Mutter und Stiefvater, wo zumindest für den verschlossenen Älteren ein lebenslanger Leidensweg begann.
1 Tranquillus, Suetonius, künftig Suet. Leben der Caesaren, Tib. 2 f.
2 Suet. Tib. 6.
Mord und Totschlag – die letzten Tage der Republik
Zur Zeit von Tiberius’ Geburt waren die politischen Verhältnisse in Rom äußerst verworren. Stadt und Reich hatten fast ein Jahrhundert blutigster Bürgerkriege hinter sich, und es hatte nicht den Anschein, als wäre deren Ende erreicht. Nie zuvor hatten Angehörige der führenden Schicht erbitterter um die Macht gekämpft und waren in der Wahl der Mittel, diese an sich zu reißen, rücksichtsloser vorgegangen. Mord und Totschlag standen auf der Tagesordnung, und kaum jemand musste befürchten, für begangene Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Mit den revolutionären Ideen der Gebrüder Gracchi hatte es im letzten Drittel des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts begonnen, einer umfassenden, die unteren Stände Roms begünstigenden, letztlich aber fehlgeschlagenen Bodenreform. Sulla hatte als Diktator fast alle verfolgt und umgebracht, die ihm im Wege standen und auf die Proskriptionslisten gesetzt worden waren, und das sinnlose Töten war weitergegangen bis zu Caesars gewaltsamem Tod, ja in den sich daran anschließenden Bürgerkriegen weit darüber hinaus. Schon war die herrschende Klasse Roms nahezu ausgeblutet. Neue Geschlechter hatten mehr oder weniger erfolgreich begonnen, das politische Tagesgeschehen zu beeinflussen. Aber auch sie sahen sich bald an den Grenzen ihrer Möglichkeiten.
In atemberaubender Geschwindigkeit hatte sich Rom in nur wenigen Jahrzehnten nahezu den gesamten Erdkreis unterworfen oder jedenfalls das, was man dort, im Zentrum der Macht, darunter verstand. Vielleicht lag es ja daran, dass man sich nun im Inneren zu zerfleischen begann. Viele mochten ahnen, dass die nun schon fast hundert Jahre dauernde schreckliche Zeit, die vor allem die Metropole am Tiber geschwächt hatte, noch lange nicht zu Ende war. Und doch weigerte sich die Mehrheit zu glauben, dass die so oft beschworene res publica verloren war.
Lange vor der Mitte des letzten vorchristlichen Jahrhunderts nutzten in Rom drei Männer die politischen Verwirrungen aus und beschlossen, die Herrschaft an sich zu reißen und einen Bund, das bereits erwähnte Triumvirat, einen Dreimännerrat, ins Leben zu rufen. Darunter war ein bis vor einigen Jahren noch weitgehend Unbekannter aus der Sippe der Julier, der immer mehr von sich reden machte und dem der Ruf eines großen Schuldners anhaftete. Unter dem Cognomen Caesar sollte er einst als einer der größten Römer in die Geschichte eingehen, ein Namenszusatz, der sich wohl vom punischen aesar, ableitete, was so viel wie „Elefant“ bedeutete. Angeblich hatte einer von Caesars Vorfahren mit der Tötung eines solchen Tieres einen gewissen Ruhm erlangt.
Bei dem zweiten Triumvirn handelte es sich um den allseits bekannten Pompeius, einen wohlhabenden und sehr angesehenen Römer, dem schon zu Lebzeiten der seltene Titel Magnus, „der Große“, verliehen worden war, da er Roms Einfluss in der Welt durch zahlreiche Eroberungen erheblich erweitert hatte.
Und schließlich Crassus, der zu den reichsten Männern nicht nur der Stadt, sondern des gesamten Imperiums gehörte. Sein märchenhaftes Vermögen verdankte er vor allem dem Handel mit menschlicher Ware. Anders als seine beiden Kollegen im Dreimännerbund hatte er sich aber noch keinen militärischen Ruhm verdient, was nicht nur ihm selbst als Mangel erschien. Galt doch in Rom nur derjenige als wahrer Römer und wirklich bedeutend, der andere Völker unter das römische Joch gezwungen und das Imperium territorial erweitert hatte. Hier musste Abhilfe geschaffen werden.
Seit jeher galten die Parther, ein in Vorderasien siedelndes altes Kulturvolk, neben den stets aufmüpfigen Germanen als die Feinde Roms schlechthin. Generationen von Feldherrn und Soldaten hatten sich in den endlosen Schlachten, die die beiden Völker gegeneinander austrugen, aufgerieben, aber allenfalls zeitlich begrenzte Erfolge erzielen können. Nie war einem von ihnen ein diese Bezeichnung verdienender Sieg vergönnt. Die Parther waren – und blieben – eine ständige Bedrohung, die den römischen Frieden, die pax Romana, was immer man im Zentrum der Macht darunter verstand, nachhaltig störte.
Gemeinsam mit seinem Sohn machte sich Crassus auf den Weg, diese Gefahr ein für alle Mal zu bannen. Wahrscheinlich lag es an seiner mangelnden militärischen Erfahrung, dass er in eine Falle stolperte wie der Ochs ins Schlachthaus. Nie zuvor wurde einem römischen Feldherrn übler mitgespielt und die erhabene Roma tiefer gedemütigt. Unter dem Vorwand von Friedensverhandlungen lockte der parthische Anführer den arglosen Römer 53 v. Chr. bei Carrhae in einen Hinterhalt. Sein Sohn fiel bereits im Kampf. Crassus selbst wurde gefangen genommen und vor den parthischen König geschleppt. Dort wurde er auf grausamste Weise gefoltert. Man goss ihm, der dem Reichtum so sehr verfallen war, flüssiges Gold in die Kehle. Dann schlug man ihm den Kopf ab. Während eines großen Festgelages, das der König gerade gab, wanderte die blutige Trophäe als Spielball von Hand zu Hand, ehe sie im Kuriositätenkabinett des Herrschers verschwand.
Empörter noch als über die Behandlung eines ihrer einflussreichsten Männer war die römische Führung über den Verlust der Feldzeichen, die die Parther erbeutet hatten und sich verständlicherweise zurückzugeben weigerten. Es war für die Weltstadt am Tiber geradezu eine Schmach, die neue Feldzüge und weiteres Blutvergießen forderte. Erst Jahrzehnte später sollte es Tiberius unter Kaiser Augustus gelingen, diese für Rom so wichtigen Symbole auf diplomatischem Weg zurückzugewinnen.
Crassus starb, wie gesagt, im Jahr 53 v. Chr. Das Triumvirat war damit beendet. Aber Caesar und Pompeius Magnus hatten ihre Macht bereits derart gefestigt, dass nun ein gnadenloser Kampf der beiden Männer um die Vorherrschaft begann, den zuletzt beide nicht überleben sollten. Er wolle, so ließ Caesar verkünden, lieber in jedem beliebigen Dorf der Erste als in Rom nur der Zweite sein. Daraus lässt sich schießen, dass er wohl auf die Macht ganz verzichtet hätte, wäre er Pompeius unterlegen. Wie feindlich sie sich gegenüber standen, sollte die nahe Zukunft zeigen.
Zu Beginn der gemeinsamen Herrschaft, 60 v. Chr., hatte Caesar seine Tochter Julia, das einzige legitime Kind, das er hatte, Pompeius zur Frau gegeben, freilich keineswegs, weil sich zwischen der jungen Frau und dem alternden Mann eine Liebesbeziehung angebahnt hätte. Es war ein politisches Zweckbündnis zur Absicherung des Triumvirats-Vertrages, wie es in Rom üblich war. War man doch davon überzeugt, dass nichts Partner stärker aneinander zu binden vermochte als familiäre Beziehungen. Als pflichtbewusste Römerin ließ Julia alles klaglos über sich ergehen, ja, es scheint, dass es ihr durch ihr freundliches Wesen sogar gelang, Unstimmigkeiten zwischen den beiden Männern, Vater und Gatten, auszugleichen. Vielleicht hätte sich deren Verhältnis und womöglich sogar die Weltgeschichte anders entwickelt, wäre Julia länger am Leben geblieben. Aber sie starb früh und ließ die beiden Menschen, die ihr am nächsten standen, ratlos zurück.
Was einigermaßen freundschaftlich begonnen hatte, entwickelte sich bald zu erbitterter Rivalität. Diese gipfelte darin, dass es Caesar, bislang mit der Eroberung Galliens beschäftigt, wagte, seine Truppen gegen Rom zu führen, ein unerhörter Vorgang, der in der Geschichte kaum seinesgleichen hatte. Die Aufregung in Rom war groß, als bekannt wurde, dass sich der Julier mit seinen Legionen der Stadt näherte, und niemand wusste, wem er sich in dem sich abzeichnenden Konflikt anschließen sollte. Den meisten Römern schien der gemäßigtere Pompeius das geringere Übel zu sein, versprach er doch, die res publica wenigstens in ihren Grundzügen aufrecht zu erhalten. Zudem verfügte er über eine größere Anzahl von Streitkräften und war überhaupt der Mächtigere von beiden. Allerdings befanden sich seine Truppen in Spanien, und es würde einige Zeit dauern, sie nach Italien zu führen und Caesar und dessen Männern entgegen zu werfen. Und die Gefahr war zu drohend, um im Mutterland selbst neue Soldaten zu rekrutieren.
Also forderte Pompeius Magnus den Senat auf, Italien sofort zu räumen, da er sich zu dessen Verteidigung nicht in der Lage sähe. Er selbst werde sich, so ließ er die eingeschriebenen Väter wissen, nach Griechenland begeben, um sich in Sicherheit zu bringen. Von dort aus werde er im Schutz der Flotte das verlorene Terrain zurückgewinnen. Vieler Worte bedurfte es nicht. Die meisten von Roms Noblen waren nur allzu bereit, ihm zu folgen. Feige ließen sie Frauen und Kinder und das einfache Volk schutzlos zurück.
In nicht einmal zwei Monaten hatte Caesar ganz Italien unter seine Kontrolle gebracht. Er zeigte sich gegenüber jedermann freundlich und leutselig, und machte von seiner inzwischen sprichwörtlichen Milde regen Gebrauch. So fiel es den Soldaten seines Gegners nicht schwer, in Scharen zu ihm überzulaufen, und auch das auf der Iberischen Halbinsel stationierte Heer, durch Pompeius’ Flucht jetzt führerlos, begab sich unter seinen Oberbefehl.
In Rom fürchtete indes jeder, der geblieben war, die fürchterlichen Proskriptionen eines Sulla, die viele noch miterlebt hatten, würden sich nun wiederholen. Aber zum allgemeinen Erstaunen befand Caesar, es sei genug Blut geflossen. Er begnadigte seine Gegner und rief diejenigen, die vor ihm geflohen waren, unter Zusicherung von Straffreiheit nach Rom zurück. Pompeius Magnus sah sich in die Defensive gedrängt. Aber er gab den Kampf noch nicht verloren.
Gegen Ende des Sommers 48 v. Chr. trafen schließlich die beiden feindlichen Heere in Griechenland in der Ebene von Pharsalos aufeinander. Pompeius’ Truppenkontingent und auch seine Reiterei waren Caesars Streitkräften zahlenmäßig weit überlegen. Aber Caesar hatte die geschicktere Taktik. Die kampferprobten Veteranen seiner berühmten X. Legion entschieden letztlich den Ausgang der Kampfhandlungen.
Ursprünglich hatte Pompeius geplant, auszuharren und die Entscheidungsschlacht hinauszuzögern. Aber seine Berater drängten ihn zu handeln. Es sollte sich bald herausstellen, dass gerade das ein verhängnisvoller Fehler war. Aber Pompeius wäre nicht Pompeius gewesen, hätte er sich nicht durch Vorzeichen abgesichert. Es war ein Traum, der für seine Entscheidung, sich dem Gegner jetzt zu stellen, den Ausschlag gab. Er sah sich ruhmbedeckt das in Rom von ihm erbaute Theater betreten, wo ihn eine riesige Menschenmenge mit tosendem Beifall empfing. Auch der Tempel der Venus Victrix, der siegreichen Göttin, tauchte vor ihm auf, mit zahllosen Beutestücken geschmückt. Was konnte dieses günstige Omen anderes bedeuten, als dass die Götter mit ihm waren?
Als er begriff, dass die Schlacht für ihn verloren war, zog er sich am Boden zerstört in sein Lager zurück. Doch Caesars Männer folgten ihm auf den Fersen. Schon kamen sie seiner Unterkunft bedrohlich nahe, da suchte er sein Heil in der Flucht. Um das Schicksal seiner Leute kümmerte er sich nicht. An der Küste fand er ein Handelsschiff, dessen Kapitän bereit war, ihn für ein hohes Bestechungsgeld aufzunehmen. Mit den wenigen Getreuen, die ihm geblieben waren, kam er an Deck. Einem Odysseus gleich durchkreuzte er nun ziellos das Meer.
Auf der Insel Lesbos wurden die Flüchtlinge abgesetzt. Dort raffte er einige Schiffe zusammen und nahm seine Frau Cornelia, die er nach Julias Tod geheiratet und mit der er einen Sohn hatte, an Bord. Weiter ging es nach Pamphylien. Kilikische Flotteneinheiten schlossen sich ihm an. Ebenso 60 Senatoren. Da fasste er neuen Mut. Doch als die Reisegesellschaft im griechischen Dyrrhachium ankam, der Hafenstadt, von der aus die Schiffe nach Brundisium fuhren, sprach sich herum, dass Pompeius feige geflohen war und seine Leute im Stich gelassen hatte. Als er mit den wenigen Anhängern, die jetzt noch an ihn glaubten, vor Rhodos ankern wollte, verweigerten ihm die Inselbewohner die Unterstützung. Nicht einmal seine Gesandten durften den Hafen anlaufen. Da beging Pompeius den wohl entscheidendsten Fehler seines Lebens: Er wandte sich hilfesuchend an den Partherkönig. Der römische Erzfeind aber weigerte sich ebenfalls, einem Römer zu helfen. Warum auch? Seit Menschengedenken bekriegten sich die beiden Völker, waren auch auf Seiten der Parther Ströme von Blut in den jahrhundertelangen Auseinandersetzungen vergossen worden. Dass sich der große Pompeius ausgerechnet an die Rom so verhassten Parther wandte, mag nicht nur diese verwundert haben. Es brachte auch viele seiner Landsleute gegen ihn auf. Spätestens jetzt liefen die meisten, die ihm bis hierher noch die Treue gehalten hatten, zum Feind über.
Aber der große Römer dachte noch immer nicht daran, den Kampf aufzugeben und sich Caesar zu unterwerfen, solange noch ein winziger Funken Hoffnung bestand. War er es nicht seiner Ehre schuldig, sich bis zum letzten Blutstropfen für die Sache Roms einzusetzen? Ägypten kam ihm in den Sinn, eine letzte Zuflucht, von der aus sich die Rückkehr nach Rom und an die Macht noch am ehesten organisieren ließe. Hatte er nicht ohnehin bei den ägyptischen Herrschern etwas gut? Verdankten die Ptolemäer nicht ihm, dass sie wieder auf dem Thron saßen, von dem Ptolemaios XII. vor einigen Jahren verjagt worden war? Er gedachte, in Pelusion an Land zu gehen, im östlichen Teil des alten Reiches am Nil.
Inzwischen hatten sich auch die Berater des ägyptischen Königs Gedanken gemacht. Womöglich, so überlegten sie, beabsichtigte der unberechenbare Römer, das Heer aufzuwiegeln und zu versuchen, Ägypten unter seine Kontrolle zu bringen. Damit aber war Pompeius’ Todesurteil besiegelt.
Draußen auf der ruhigen See ankerte seine kleine Flotte. Seit geraumer Zeit kreuzten bemannte ägyptische Schiffe vor dem Hafen, und am Ufer sammelte sich bewaffnetes Fußvolk. Dies war keineswegs die Art, einen hohen Gast zu empfangen. Er ahnte, was diese verschlagenen Ägypter vorhatten. Und als ihn die Besatzung eines kleinen Bootes nötigte, sein Schiff zu verlassen und in ihr schwankendes Gefährt umzusteigen, schloss er mit dem Leben ab. Stöhnend fügte er sich in sein Schicksal, als ihn das Schwert eines Besatzungsmitglieds traf, und zog sterbend die Toga über sein Haupt. Der Leiche schlugen die Mörder den Kopf ab und warfen sie ins Meer. Ein Freigelassener namens Philippus erbarmte sich seines Herrn. Er zog den kopflosen Toten ans Ufer, wusch den Leichnam und errichtete aus dem Holz gestrandeter Schiffe einen Scheiterhaufen.
Mit Entsetzen hatten Pompeius’ Gattin Cornelia und sein Sohn Sextus das Geschehen verfolgt und erkannt, dass Pompeius Magnus nicht mehr zu helfen und jeder Widerstand wegen der Überzahl der Mörder zwecklos war. Sofort ließen sie die Anker lichten und suchten ihr Heil auf dem offenen Meer. Doch einige von Pompeius’ Schiffen, die sich den Fliehenden angeschlossen hatten, wurden von den ägyptischen Galeeren eingeholt. Besatzung und Passagiere fanden einen unrühmlichen Tod.
Stolz sahen die Ägypter nun der nahen Zukunft entgegen. Caesar, der bereits unterwegs war, wie man hörte, würde sie sicherlich reich belohnen. Doch als man ihm in einem Korb das abgeschlagene Haupt seines großen Widersachers brachte, wandte er sich mit tränenden Augen ab. Man hatte ihm mit der voreiligen Tötung dieses Mannes keinen Gefallen getan. Im Gegenteil. War ihm doch damit die Möglichkeit genommen worden, von seiner längst sprichwörtlichen Milde Gebrauch zu machen. Zudem waren Pompeius und er einst Freunde, Pompeius sogar eine Zeitlang sein Schwiegersohn gewesen. Ein solches Ende hatte niemand, auch er, nicht verdient.
War Caesar bewusst, dass auch seine Tage gezählt waren? Angst lähmte die siebenhügelige Stadt. Menschenleer dehnte sich das Forum selbst in den mittäglichen Stunden. Schon lange verunsicherten vermummte Gestalten und zweifelhaftes Gelichter die Straßen. Ein Ausgeraubter hier, ein Erschlagener dort. Hilferufe, die ungehört in der Dunkelheit verhallten. Grässlich entstellte Leichen, nachts im Tiber treibend, gesichts- oder kopflos, das Gedärm nach außen gekehrt. Köpfe, die tränenlos und unbewimpert von den Gemonien rollten. Schnödes Verbrechen blieb ungesühnt.
Unheimliches Flüstern auch in Caesars Palast. Freilich nur hinter vorgehaltener Hand. „Weißt du es schon? Hast du es auch gehört?“ Unglaubliche Geschichten waren zu vernehmen, die auf die Bürger Roms ein bezeichnendes Licht warfen. Da wurde, so erzählte man, in Etrurien ein Kalb mit drei Köpfen geboren. Hafer wuchs dort aus den Kronen der Bäume. Man sprach von einer Schlange, die sich von Schwanz her selbst verzehrte. Das schlimmste Vorzeichen aber meldete Capua, das südlich von Rom lag. Dort waren Siedler beim Bau ihrer Hütten auf uralte Gräber gestoßen. In einem fand sich eine eherne Tafel. In den gestelzten Lettern einer uralten Schrift stand darauf geschrieben:
„Unbekannter, der du die Gebeine des Capys entdeckest,
melde in Rom, ein Enkel des sagenumwobenen Gründers
werde dort durch verwandte Hand heimtückisch fallen.
Dies aber werde Italien mit großer Heimsuchung büßen.“
Rom wäre nicht Rom gewesen, hätte es auf solche Vorzeichen nichts gegeben. Nur Caesar achtete auf diese Warnungen nicht. „Hüte dich vor den Iden des März!“, hatte ihm erst kürzlich Spurinna, der alte Seher, der blind war und doch mehr als andere sah, im Senat zugerufen. Aber der heimliche König Roms, der zum Diktator auf Lebenszeit ernannt worden war, hatte darüber nur gelacht. Er meinte, es liege im Interesse des Staates, dass er am Leben bleibe. Denn wenn ihm etwas zustieße, würde das Rom in noch heftigere Bürgerkriege stürzen. Schon die nahe Zukunft lehrte, dass er Recht behalten sollte.
Dann kamen jene Iden, vor denen Spurinna gewarnt hatte. Nach anfänglichem Zögern – Caesars Frau Calpurnia hatten in der Nacht schlechte Träume geplagt, und sie hatte den Gatten tränenreich beschworen, heute nicht in den Senat zu gehen – ließ sich dieser von Decimus, einem der Verschwörer, überreden, doch vor die versammelten Väter zu treten, die ihn an diesem Tag ungewöhnlich freundlich empfingen. Sie geleiteten den Ahnungslosen sogar an seinen Platz. Dann aber stürzten sie sich auf den völlig überraschten Mann, und 23 Dolchstöße streckten ihn nieder. Doch nur ein einziger, so sollten die Ärzte später verkünden, sei tödlich gewesen …
Hatten die Verschwörer nicht richtig gehandelt? Hatte sich Caesar nicht erst neulich mit der Hand an die Stirn gegriffen, als trüge er bereits das Königsdiadem? Jedermann wusste, dass dieser Caesar nach der Alleinherrschaft strebte, und erst kürzlich waren Gerüchte gestreut worden, die Parther, Roms hartnäckigste Feinde, könnten nach alter Vorhersage nur von einem König dauerhaft besiegt werden. Doch niemals, so hatte man sich vor fast fünf Jahrhunderten geschworen, dürfe die Verantwortung für Rom und sein Imperium wieder an einen Einzelnen übergehen. Nur die Ältesten und Besten sollten die Macht ausüben. Der Bürgerkrieg, der nun zwischen Befürwortern des Attentats und denen, die die Tat verabscheuten und den Ermordeten zu rächen versprachen, ausbrach, schwächte ganz Rom und fand im griechischen Philippi ein vorläufiges Ende, als die Caesar-Mörder geschlagen und tot waren. „Vor Philippi sehen wir uns wieder“, hatte Caesar kurz vor seinem Fall orakelt und auch die Bürgerkriege hatte er zutreffend vorausgesagt. Doch war das unsinnige Blutvergießen damit noch lange nicht zu Ende. Denn jetzt begann der kaum weniger grausame Kampf zwischen Octavian und Marcus Antonius um die Vorherrschaft im Römischen Reich.
Niemand konnte verstehen, weshalb Gaius Iulius Caesar seinen Großneffen Octavian, einen blassen Jüngling von 18 Jahren, an Sohnes statt angenommen und zum Alleinerben seines Vermögens und Vollender seiner Politik bestimmt hatte. Jedermann hatte erwartet, Marcus Antonius wäre berufen, das schwierige Erbe anzutreten. Er galt als Caesars bester Freund und hatte mit ihm zahlreiche Schlachten geschlagen. Am meisten war wohl Marcus Antonius selbst über die Entscheidung erstaunt. Aber er ließ sich nichts anmerken und versuchte, sich mit dem Erben zu arrangieren. Und doch erkannten beide, dass selbst ein ImperiumRomanum für zwei, die die Macht beanspruchten, nicht groß genug war.
Die Geschichte von Caesar und Pompeius schien sich zu wiederholen. Nur unterschwellig war zunächst die Gegnerschaft. Bündnisse wurden geschlossen, Freundschaftsbekundungen ausgetauscht. Hatte Caesar einst seine Tochter Gnaeus Pompeius zur Frau gegeben, so verpflichtete jetzt Octavian seine Schwester Octavia, Marcus Antonius zu heiraten. Sie war erst vor kurzem Witwe geworden und an einer raschen Wiederverheiratung eigentlich nicht interessiert. Aber der Bruder erinnerte sie an ihre Pflicht als Römerin, und ihr wurde gestattet, die neue Verbindung sogar vor Ablauf des in Rom üblichen Trauerjahres einzugehen. Octavia verkörperte in den Augen der Römer die Tugenden der römischen Matrone schlechthin. Untadelig war ihr Auftreten. Sie galt als sanft, zurückhaltend, gehorsam und von ausgleichendem Wesen. Jedermann bewunderte die zarte, für eine Römerin äußerst gebildete Frau, die alles, was man ihr aufbürdete, schweigend ertrug. Marcus Antonius war neugierig geworden.
Niemand nahm darauf Rücksicht, dass Antonius, dem, wie bereits erwähnt, durch den Triumvirats-Vertrag der Osten des Reiches zugefallen war, schicksalhaft an Kleopatra gebunden war, die Königin Ägyptens. Auch der erwählte Bräutigam sah nicht voraus, dass die Euphorie einer neuen Ehe – seine Gattin Fulvia war gestorben – nicht von Dauer sein würde. Die Ägypterin übte auf ihn eine fast magische Anziehungskraft aus, und es sollte sich bald zeigen, dass er außer Stande war, sich dieser dauerhaft zu entziehen. Die Zuneigung, die er dieser aufregenden Frau entgegenbrachte, gründete nicht nur auf Überlegungen politischer Art, mochte man auch munkeln, er beabsichtige, sich von Rom abzuwenden und mit der Königin Ägyptens ein selbstständiges Ostreich zu errichten. Auch als Mann war er ihr verfallen. Welche Mittel mochte diese Frau anwenden, dass der an sich rechtschaffene Römer ihr hörig war?
Nur zwei Jahre nach der spektakulären Hochzeit mit Octavia, die im Auftrag von deren Bruder wie ein Staatsakt gefeiert worden war, entfremdete sich Antonius seiner Frau und kehrte reumütig in Kleopatras Bett zurück. Es hatte sich gezeigt, dass auch die familiäre Bindung die beiden Rivalen ihre Gegnerschaft nicht überwinden ließ, ja, sich die Beziehung immer mehr zu offener Feindschaft wandelte.
Als Tiberius Claudius Nero in das Haus seines Stiefvaters kam – nach unserer Zeitrechnung im Jahr 34 v. Chr. –, war die Propaganda gegen Antonius bereits voll im Gange. Es war längst offensichtlich, dass Octavian, der im Westen des Reiches und damit in der Hauptstadt selbst das Sagen hatte, die Alleinherrschaft über das gesamte Reich anstrebte. Er ließ nichts unversucht, seinen Gegner in der Öffentlichkeit zu diskreditieren, bezeichnete ihn als unrömisch und entartet, verstrickt in den Fängen einer exotischen Hexe. So überzeugend wirkten seine gegen Marcus Antonius gezielten vergifteten Pfeile, dass das Volk immer mehr von dessen Schuld überzeugt war.
Tiberius, der, weit über sein Alter hinaus, schon als Kind am politischen Geschehen interessiert war, mag die Entwicklung aufmerksam verfolgt haben. Vielleicht war auch ihm bewusst, dass so viel Hass wieder nur da enden konnte, wo Rom bis vor kurzem noch gestanden hatte: in einem neuen Bürgerkrieg.
Möglicherweise waren es die Erfahrungen des Heranwachsenden, die den späteren Herrscher veranlassten, von kriegerischen Unternehmungen abzusehen, wenn es denn möglich war. Er hatte, anders als sein Vorgänger, nicht den Ehrgeiz, Roms Einflussbereich in der Welt noch zu steigern. Von Eroberungszügen und einem Versuch, Rom bis an die Elbe auszudehnen, ist für seine Regierungszeit nichts bekannt.
Jetzt war Tiberius neun Jahre alt und lebte mit der von ihm misstrauisch beäugten Mutter im Haus seines Stiefvaters. Immer wichtiger wurde die dem römischen Hochadel entstammende Frau für den Aufsteiger, dessen Vorfahren noch aus der Unterstadt gekommen waren. Durch ihre vornehme Herkunft öffnete sie ihm die Türen zu den höchsten Kreisen Roms, ohne deren Einfluss dort niemand zu Macht und Ansehen gelangen konnte. Im Gegenzug schätzte sie Octavians Möglichkeiten und Ehrgeiz richtig ein. Nur über ihn, der frischen Wind in die Politik brachte, würde es ihr gelingen, ihren eigenen Machthunger zu stillen.
Allenthalben war nun vom bösen Antonius die Rede – und von Kleopatra, die es beide zu bekämpfen galt. Beleidigungen und Beschimpfungen, die zwischen Rom und Alexandria hin- und hergingen, forderten schließlich die Entscheidung mit Waffen heraus. Und die ließ nicht lange auf sich warten.