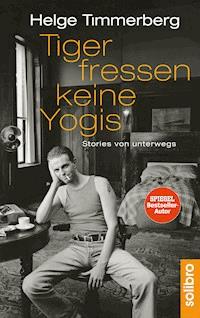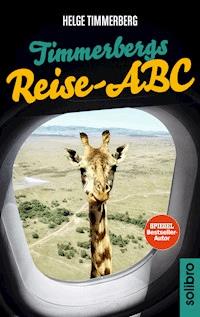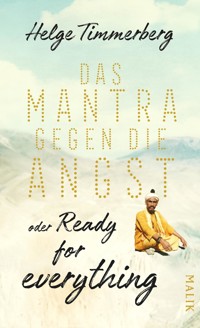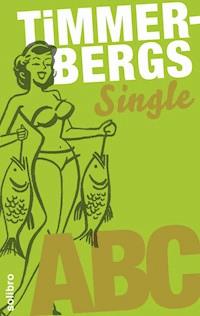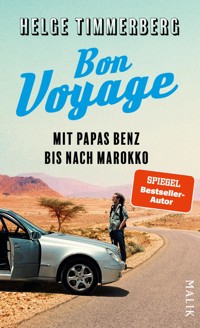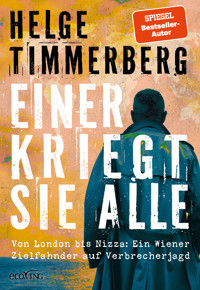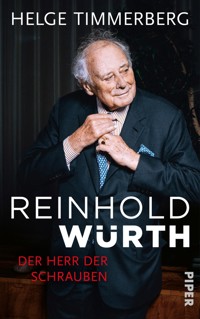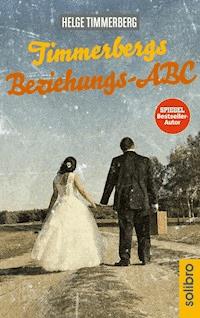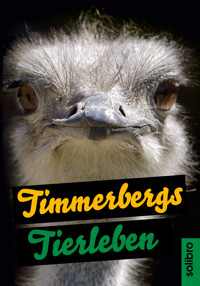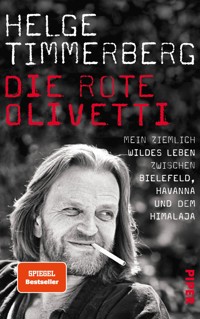
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Helge Timmerberg war nie ein Pauschaltourist: Schon früh bereiste er Länder, von denen andere nur träumen, traf Menschen, denen andere nie begegnen. Und er schrieb darüber: packende Reportagen und Bücher, farbig, voller Humor und ohne Tabus. In seiner Autobiografie schildert er nun seine Anfänge als Journalist in Bielefeld und die Jahre danach, in denen er für »Playboy« und »stern« schrieb, und berichtet ungeschminkt von den Exzessen seiner goldenen Jahre in Havanna. Wir werden Zeuge seines tiefen Drogenabsturzes – und erleben mit, wie er auf einer Reise durch den Himalaja sein Leben wiederfindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür die Frau aus der PorzellanmanufakturISBN 978-3-492-97384-7April 2017© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016 Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Covermotiv: Frank ZauritzDatenkonvertierung: Uhl + Massopust, AalenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Erstes Kapitel
»Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.«
Ich saß im Londoner Stadtteil Notting Hill an einem Küchentisch und machte komische Sachen. Es war Nacht, und ich war allein, aber das härteste Halluzinogen auf Gottes Erden sorgte dafür, dass trotzdem keine Langeweile aufkam. Zunächst zeichnete ich unter dem Einfluss von LSD das Universum auf eine Streichholzschachtel, danach nahm ich mir die Plastikbecher vor. Der Mieter der Wohnung hatte entweder eine Party geplant oder er war ein Plastikbechergroßhändler. In seiner Küche standen oder lagen, zu Bechertürmen gesteckt oder in Kisten verpackt und zu Kistenbergen gestapelt, etwa tausend weiße Plastikbecher. Bei dem ersten war es Zufall. Ich kam aus Unachtsamkeit mit meiner Zigarette dran, und als sich die Glut in das Plastik fraß, war meine Wahrnehmung zu hundert Prozent von einem Transformationsprozess gebannt, der mir wie Zauberei vorkam. Der weiße Becher wurde nicht nur schwarz, er nahm auch eine gänzlich andere Form an. Atome, Moleküle, Elementarteilchen wurden neu gemischt. Alles schmolz, alles floss, alles verwandelte sich. Ergebnis: Statt des weißen Plastikbechers stand da nun eine kleine schwarze Hexe auf dem Tisch. Der nächste Becher wurde zu Gandalf, dem Magier, der nächste zu einem schrecklichen Tier. Zwerge, abscheuliche Kerle, hinterlistige Bäume, das gesamte Personal vom »Herrn der Ringe« versammelte sich vor mir auf dem Küchentisch und wurde immer mehr. Als alle Plastikbecher aufgebraucht waren, brach der Morgen an und ich sah das Malheur. Die Wände der Küche sowie deren Decke waren rabenschwarz, und ich meinte mich zu erinnern, dass sie gestern noch so weiß wie die Plastikbecher gewesen waren. Ich verließ die Wohnung auf der Stelle.
London im September 1970, das heißt: Scheißwetter. Ich war froh, als ich in dem Bus saß, der mich zur Stadtgrenze bringen sollte, von wo ich nach Dover trampen wollte. Hinter dem Ärmelkanal lagen nicht nur Belgien, Deutschland und Osteuropa, sondern auch die Türkei, Persien und Afghanistan. Ich brach an diesem Morgen zu meiner ersten Reise nach Indien auf, und die klimatischen Verhältnisse beim Start bestätigten meinen Entschluss, dies zu tun. Ich saß im oberen Bereich des Doppeldeckerbusses und sah durch das Fenster in den Regen, und sie waren überall. An den Bäumen, an den Hauswänden, an den Bretterzäunen, an den Zeitungskiosken, an den U-Bahn-Eingängen klebten die Extrablätter mit der Aufschrift:
»HENDRIX DIED«
Schock schwerer Rock ’n’ Roll. Hendrix war mehr als ein Jahrhundertmusiker, er war ein Prophet. Er hat Lichtgeschwindigkeit hörbar gemacht. Der schwarze König der psychedelischen Revolution, der Freund und Bruder aller Hippies war in dieser Nacht gestorben, und sollte es noch irgendwelche Restzweifel an meiner Indienreise gegeben haben, selbst Zweifel, von denen ich heute nichts mehr weiß, die Nachricht von Hendrix’ Tod wischte sie vom Tisch. Ohne Hendrix war das Abendland öd und leer, ohne den Beethoven der E-Gitarre rüttelte niemand mehr für mich an den Toren von Himmel und Hölle, ohne Jimi saß ich allein in dem Doppeldeckerbus.
Einen Tag später und bereits in Belgien, stieg ich an einer Autobahnauffahrt in einen dieser bunten VW-Busse ein, deren Schiebetür beim Öffnen herausfiel, und ein Mann begrüßte mich, der mich auf meinem Lebensweg zwar nur bis zum Kamener Kreuz begleiten sollte, aber trotzdem unvergessen blieb. Er war wie ich ein Tramper, ein Hippie, ein Morgenlandfahrer, jedoch viel älter. Graue Haare, langer Bart, Nickelbrille, ein Expsychologieprofessor der Uni Frankfurt in farbenfrohen Klamotten, der gefeuert worden war, weil er LSD-Testreihen nicht mit Meerschweinchen, sondern mit Studenten durchgezogen hatte. Ein deutscher Timothy Leary, ein Wissenschaftler der psychedelischen Fakultäten, ein Politiker der Exstase, und er hatte nicht nur die »Bhagavad Gita« und das »Tibetische Totenbuch« dabei, sondern auch eine aktuelle Tageszeitung, in der Genaueres über den Tod von Jimi Hendrix zu finden war. Die genaue Zeit. Der genaue Ort. Er war in einem Haus im Londoner Stadtteil Notting Hill gestorben, und weil mir der Name der Straße bekannt vorkam, fischte ich in meinen Taschen nach dem Zettel mit der Adresse der Wohnung, die ich zwei Nächte zuvor ein bisschen ruiniert hatte. Und bingo! Es war nicht das unmittelbare und auch nicht das nächste, sondern das übernächste Nachbarhaus. Zwei Häuser standen zwischen mir und Hendrix, als ich LSD nahm und er starb.
Der Hippieprofessor war ganz Ohr, als ich ihm davon erzählte. Er wollte mehr wissen. Alles. Jede Kleinigkeit dieser Nacht, an die ich mich noch erinnern konnte, und als ich das Universum auf der Streichholzschachtel herausholte, flippte er aus. Er bat mich, ihm die Schachtel zu schenken, mehr noch, er bettelte darum. Er wollte sie unbedingt haben. Ich gab sie ihm, und er revanchierte sich mit einer Lesung aus dem »Tibetischen Totenbuch« sowie einer Erläuterung des Vorgetragenen. Er sagte, es gäbe bekanntlich zwei große Spekulationen zum Thema. Die christliche schicke die Seelen nach dem Ableben des Körpers entweder in den Himmel oder in die Hölle, und in der Hölle sei Hendrix sicher nicht gelandet, denn Drogenkonsum zähle im Christentum nicht zu den Todsünden, und darüber hinaus sei er ein guter Mensch gewesen. Für Hindus und Buddhisten sei das natürlich Blödsinn. Sie glaubten nicht an Himmel und Hölle als festen Wohnsitz der Seele, sie glaubten, dass es immer weitergehe, sie glaubten an die Wiedergeburt in einem anderen Körper, an die Chance im nächsten Leben, und ob dieses Leben ein glückliches oder unglückliches, ein leichtes oder schweres, ein reiches oder armes werde, bestimmten unsere Taten im vorherigen. Und da müsse man bei Hendrix schon mal genauer hinsehen. Zwar gälte auch in den fernöstlichen Geistesschulen Drogenkonsum nicht als Sünde. Aber als Schwäche. Als Behinderung. Als Fessel. Als schlechtes Karma. Hendrix sei nicht gut zu sich gewesen. Weil er aber mit seiner Musik unendlich viel Gutes für andere getan habe, sei davon auszugehen, dass sein nächstes Leben ein glückliches und langes werde. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass Hendrix die Drogen nicht aus Jux und Tollerei genommen habe. Er habe es nicht für sich, sondern für die Musik getan.
»Er war ein Märtyrer des Rock ’n’ Roll, und Märtyrer sind nach ihrem Tod nicht nur bei den Christen, sondern auch bei den Hindus und Buddhisten per se auf der richtigen Seite.«
Vielleicht, so fuhr der Expsychologieprofessor aus Frankfurt fort, nähme man Jimi im nächsten Leben nur die Musik weg, und das auch nur zu seinen Gunsten, und dann würde der junge Ex-Hendrix vielleicht in ein paar Jahren wieder mit einem Besen auf einer Holzterrasse in Louisiana stehen, aber dieses Mal nicht glauben, dass der Besenstil eine Gitarre sei. Ob ich das verstände? Ob das klar sei? So in etwa meine es das »Tibetische Totenbuch«. Und bis vor einer Stunde hätte er auch gesagt, genau so sei es vorletzte Nacht gelaufen und genau so werde es mit Hendrix weitergehen. Aber nachdem er gehört habe, wie ich diese Nacht erlebt hätte und wo ich sie erlebt hätte, beginne er eine andere, eine dritte Möglichkeit der Seelenwanderung in Betracht zu ziehen.
Ob ich schon mal was von Soul-Jumping gehört hätte. Das sei die schamanische Spekulation über die Möglichkeiten der Seele nach dem Tod. Die Seele eines gerade Verstorbenen fährt weder zur Hölle, noch schwebt sie gen Himmel, und wiedergeboren wird sie auch nicht. Nein, sie hüpft einfach in einen anderen Körper, in irgendeinen, der gerade in der Nähe ist, und macht da als blinder Passagier weiter. Das könne gezielt geschehen, dann sei es ein Soul-Hijacking, eine Seelenpiraterie, es könne aber auch ein Unfall sein, und ob mir langsam dämmere, worauf er hinauswolle?
Hendrix war ein Acid-Freak. LSD war seine Lieblingsdroge. Er hat sie sogar besungen. »Are you experienced?« heißt: »Hast du schon mal LSD genommen?« Fakt ist: Einer der größten LSD-Konsumenten des anbrechenden Wassermannzeitalters stirbt, und drei Häuser weiter sitzt einer auf LSD am Küchentisch und macht komische Sachen. Das ist wie Nadel und Magnet, und was zur Hölle sollte die LSD-verliebte Seele des Musikers da anderes tun, als mal ruck, zuck durch ein paar Mauern zu zischen und bei mir einzufahren? Zusammen haben wir dann die Plastikbecher abgefackelt, zusammen haben wir das Universum auf die Streichholzschachtel gemalt, und weil der Expsychologieprofessor mir als Gegengabe für die Streichholzschachtel kurz vor dem Kamener Kreuz seine alte Wanderklampfe schenkte, spielten wir ab sofort auch zusammen Gitarre. Jimi und ich. Und das war durchaus ein Problem. Denn was bedeutet es, Jimi Hendrix’ Seele in sich zu tragen? Es bedeutet, man hat sein Feeling. Aber nicht seine Technik.
Hendrix machte in den nächsten Tagen und Wochen einiges durch. Seine Seele glaubte mit Fingern zu spielen, die mit Stacheldraht gefesselt waren. Armer Jimi, arme Gitarre, armes Publikum. Ich spielte, wann immer es eine Gelegenheit dazu gab, und es gab deren viele auf dem Weg nach Indien. Ich spielte auf Autobahnauffahrten, ich spielte in Parks, ich spielte an den Nachtfeuern der Hippies. Ich spielte, aber ich übte nicht. Das hatte ich nicht nötig. Ich machte einfach jedes Mal da weiter, wo Hendrix aufgehört hatte. Vollgas durchs Universum, volle Pulle Intensität, volles Haus. Egal, ob ich vor zwei Leuten spielte oder auch nur vor einem oder maximal vor zehn, irgendetwas in mir glaubte dabei ständig, auf der Woodstockbühne zu stehen. Und es fühlte sich auch genau so an. Ich sagte es schon. Das Feeling stimmte, aber Gitarrespielen konnte ich nicht. Und weil ich das langsam einzusehen begann, verlagerte ich Jimi in meine Stimme. Ich sang nicht, ich entäußerte mich, ich riss mir das Herz heraus. Die Reaktionen darauf warendurchaus nicht einhellig. Die einen sagten, ich sänge wie ein Rockstar, die anderen verglichen mich mit Troubadix, dem furchtbarsten Barden der Comicgeschichte. So ging das bis Südjugoslawien. Und so weit ging es gut.
Bei Dubrovnik übernachtete ich mit anderen Hippies in einer Brandungshöhle am Meer. Ein sagenhafter Platz. Feuer, Sterne und Wellen schrien nach Hendrix in drei Akkorden. Mehr beherrschte ich noch nicht. Drei Akkorde reichten für die Hälfte von »Hey Joe«, der Rest war Interpretation, das Lied dauerte die ganze Nacht. Die Höhle lag am Fuß einer Steilküste, und über uns stand ein Hotel. Und, ach ja, ich habe eine laute Stimme. Die Jugos hörten sich das eine Nacht mit an. Auch eine zweite. In der dritten Nacht entleerten sie Schubkarren voller Steine aus etwa fünfzig Metern Höhe über unserem Feuer, keine Kieselsteine, sondern echte Brocken, und hätte auch nur einer davon jemanden von uns getroffen, wäre derjenige auf der Stelle entweder tot, verkrüppelt oder für immer blöd gewesen. Das nennt man ein ehrliches Publikum. Und darum blieb ich, bis ich aus Jugoslawien heraus war, lieber stumm, auch in Griechenland ließ ich es sein, weil die Griechen damals stramme Faschisten waren, die hassten Hippielieder, erst in der Türkei fing ich damit wieder an.
»Hey Joe, where you going
with that gun in your hand?
I’m going down to shoot my old lady,
you know I caught her messing around with another man.«
Das hat den Türken natürlich gut in den Kram gepasst.
Abgesehen davon sind es 5000 Kilometer vom Bosporus bis zum Ganges, und als ich die hinter mir hatte und in einem Ashram an den Ausläufern des Himalaja weilte, beherrschte ich bereits fünf Akkorde, denn ich hatte mittlerweile »House of the Rising Sun« gelernt. Das Lied ist zwar nicht von Jimi, aber wir beschlossen, es zu covern. Dasselbe machten wir mit den heiligen Liedern der Hindus, trotzdem sagte wenig später an dem großen Shiva-Brunnen des Ashrams eine körperlose Stimme zu mir nicht:
»Bleib bloß hier und werde Tempelgitarrist.«
Nein, sie sagte:
»Geh nach Hause und werde Journalist!«
Und wieder einmal frage ich mich, woher diese Stimme kam. Aus dem Himalaja? Oder aus mir? Was gegen die innere Stimme spricht, war die Lautstärke des Befehls. Es hörte sich an, als hätte der Himmel durch ein Megafon gesprochen, es soll aber durchaus auch innere Stimmen mit Megafon geben, innere Stimmen, die auf Zuhören drängen, innere Stimmen, die schreien. Und falls es also doch nicht die Stimme des lieben Shiva, sondern eine innere Stimme gewesen ist, die mir in der heiligen Stadt Haridwar den Journalismus befahl, dann stellt sich die Frage, welche innere Stimme das genau gewesen ist. Meine? Oder Jimis? Hatte Hendrix’ Seele das Regiment in meiner Brust übernommen, um mir endlich die Gitarre auszureden? Man weiß es nicht.
Zweites Kapitel
»Und sehen wir uns nicht in dieser Welt …«
Als ich aus Indien nach Bielefeld zurückkam, wusste ich also, was ich werden wollte, aber eine Gelbsucht zwang mich, die Sache zu überdenken und schließlich zu vergessen. Einen Monat darauf und inzwischen genesen, ging ich durch die Fußgängerpassage der Innenstadt an der Neuen Westfälischen vorbei, und es fiel mir wieder ein. »Geh nach Hause und werde Journalist«, hatte eine Stimme im Himalaja zu mir gesagt, und das hier war die größte Zeitung meiner Heimat. Ich zögerte keine Sekunde, obwohl meine Kleidung nicht dem Anlass entsprach. Eine weiße Baumwollhose indischen Zuschnitts, ein langes weites Hemd, Sandalen. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte die Dame, nachdem ich drin war.
»Ich möchte Journalist werden.«
»Gute Idee, aber hier ist die Anzeigenabteilung. Die Redaktion ist im ersten Stock.«
Sie zeigte auf eine Treppe. Ich werde diese Treppe nie vergessen. Eine schmale lange Treppe, und ich nahm jede Stufe mit der Gewissheit, das einzig Richtige zu tun. Sie entließ mich in ein Großraumbüro. Ich trat an den nächstbesten Schreibtisch und sagte mein Sprüchlein. Mit einem Lächeln, das einen großen Spaß verhieß, verwies man mich zum Chefredakteur. Der saß mit der Aura eines Kettenhundes am anderen Ende der Etage in einem Glaskasten, und an der Wand hinter ihm zeigte eine große Uhr auf fünf vor sechs. Ich wusste damals noch nicht, was diese Uhrzeit in den Redaktionen einer Tageszeitung bedeutet.
»Was wollen Sie?«, knurrte er.
»Journalist werden«, sagte ich.
Ich sagte es zum dritten Mal innerhalb von zehn Minuten, und es ging bereits flott von den Lippen.
»Warum?«
Fünf vor sechs heißt fünf vor Deadline, Schützengraben, noch ein paar Minuten, und nichts geht mehr. Heute weiß ich es, damals war es Intuition. Du musst schnell sein, sehr schnell, darum berichtete ich ihm, so schnell es mir möglich war, von meiner Erleuchtung am Ganges.
»Eine Stimme hat es mir befohlen. Wer genau da sprach, weiß ich nicht, auf alle Fälle war er körperlos.«
»Eine Stimme?«
»Ja.«
»Körperlos?«
»Ja.«
»Am Ganges?«
»Ja, in Haridwar.«
»Ach so. Und welche Qualifikationen haben Sie für diesen Beruf sonst noch?«
Wir schrieben das Jahr 1971. Damals herrschte in Journalistenkreisen null Toleranz gegenüber so Ballaballa-Moden wie Meditation. Drogensüchtige und Guruhäschen waren zwar hin und wieder der Stoff für Geschichten, aber nie deren Autoren. Deshalb war die Frage aus seiner Sicht durchaus berechtigt. Was hatte ich über meine esoterischen Qualifikationen hinaus sonst noch anzubieten? Schulabschlüsse? Akademische Grade? Nun ja, die mittlere Reife hätte ich, aber nur, weil mein Vater die Rektorin flachgelegt habe. Dass dieser Kettenhundjournalist mich nicht spätestens jetzt hochkant rauswarf, hatte ich ebenfalls meinem Vater zu verdanken. Der Mann betrachtete mein Gesicht mit zunehmendem Interesse und fragte mich noch einmal nach meinem Namen. Dann war die Sache klar. Mein Vater war ein Saufkumpel des Chefredakteurs der Neuen Westfälischen Zeitung. Damit hatte ich zwar noch nicht das Volontariat, aber eine Chance.
»Schreiben Sie vier Probeartikel. Einen Sportbericht, eine Filmkritik, eine Reportage und einen politischen Kommentar. Auf Wiedersehen.«
Ich schrieb den Scheiß und hörte lange nichts von ihnen. Aber irgendwie musste ich Geld verdienen und sprach deshalb bei einem Meinungsforschungsinstitut vor, das eigentlich immer Interviewer suchte. Sie gaben mir Fragebogen und sie gaben mir Straßen. Jeder Fragebogen hatte 32 Seiten. Sie wollten mehr oder minder alles wissen, zu dem der Mensch eine Meinung haben konnte, und auf der Rückseite des Bogens standen die Fragen zur Person, also Name, Alter, Beruf etc. Mit dem Ersten, der mich in seine Wohnung ließ, dauerte das Interview zwei Stunden, weil ich ihm wirklich jede Frage stellte, bei dem Zweiten fragte ich nur mehr die Hälfte und am Ende nur noch ein Viertel der Fragen des Meinungsforschungsinstituts ab und beantwortete die anderen später selbst. Das reduzierte die Zeit, die ich vor Ort für ein Interview brauchte, auf zwanzig Minuten. Aber das ließ sich unterbieten. Ich stellte nur noch die Fragen zur Person und betrat auch nicht mehr die Wohnung, sondern blieb dazu in der Tür stehen. Also fünf Minuten. Am Ende der Woche war es so weit, und ich klingelte nicht einmal mehr. Ich notierte lediglich den Namen, der an der Klingel stand, und wenn der Vorname fehlte, erfand ich den auch.
Die Zeit für das Selbstbeantworten der Fragen des Bielefelder Meinungsforschungsinstituts EMNID ließ sich ebenfalls optimieren, wenn man eine stereotype Vorgangsweise akzeptierte. In Arbeitervierteln wählen fast alle SPD und fahren schlechte Karren, ein paar CDUler gibt es auch, und hier und da einen von der KPD, aber keinen FDPler. Und nicht nur über die Politik, sondern auch über Wirtschaft, Kultur, Sport und das Wetter denken sie alle dasselbe. In bürgerlichen Wohngegenden ließ ich sie eher christlich-demokratisch wählen und gab einen erquicklichen Anteil Liberale hinzu. Dort las man Bücher und den Spiegel und zog für den Urlaub das mediterrane Ausland dem Campingplatz an der Nordsee vor. In den Villenvierteln dagegen schwelgte ich in meinen Träumen, und mit ein bisschen Routine schafft man auf diese Art 32 Seiten in knapp zehn Minuten. Als mir auch das zu lang vorkam, spannte ich Freunde ein. Tom und Howie waren schwere Kiffer, aber verstanden mein System sofort. Sie füllten für mich die Fragebogen im Akkord aus und bekamen von mir pro Interview zwei Mark. Mir zahlte EMNID zwölf. Angeblich beschäftigte das Institut Kontrolleure, die telefonisch bei einigen Interviewten nachfragten, ob sie von einem seiner Mitarbeiter besucht worden seien und wie lange das Gespräch gedauert habe. Aber der Schwindel flog nicht auf, im Gegenteil, man lobte mich für die außergewöhnlich gute Arbeit und bot mir eine Festanstellung an. Nicht als Interviewer, sondern im Organisationsteam, das die Trupps rausschickt, lenkt, leitet … und kontrolliert. Weil ich bis zu diesem Zeitpunkt noch immer nichts von der Neuen Westfälischen gehört hatte, nahm ich das Angebot des Meinungsforschungsinstituts an und stellte mich darauf ein, für den Rest meines Lebens die Menschheit zu verarschen. Trotzdem ließ ich die Hoffnung nicht sausen, im letzten Moment noch vom Journalismus abgegriffen zu werden, und als der Morgen meines ersten Arbeitstags in der Institutszentrale graute, bat ich ein Mädchen aus meiner Wohngemeinschaft, mich unbedingt sofort anzurufen, wenn ein Brief von der Zeitung kommen sollte. Ich ging zu EMNID, und es fühlte sich falsch an. Ich betrat das Büro, und es gefiel mir nicht. Ich wurde den Kollegen vorgestellt und ich hatte nichts mit ihnen gemein. Man zeigte mir meinen Schreibtisch, und ich wusste, dass es nicht meiner war, und kaum hatte ich mich an ihn gesetzt, klingelte das Telefon und meine WG war dran.
»Der Brief ist gekommen, Helge.«
Es war der Volontärsvertrag, und ich kündigte bei dem Meinungsforschungsinstitut noch vor der ersten Mittagspause. Meine Probeartikel hatten dem Chefredakteur also gefallen. Was hatte ich richtig gemacht? Nicht viel, nur das Wesentliche, und der Rest war Glück. Das Wesentliche beim Journalismus ist, dass man nur über Dinge berichtet, die einen interessieren. Ich denke, das ist normal, und weil das Normale automatisch funktioniert, hatte ich keine Sekunde darüber nachgedacht, für den Sportbericht ein Tischtennisturnier zu wählen. Ich war im Jahr 1967 der Tischtennis-Jugendmeister des Kreises Minden gewesen. 1968 hatte ich zu kiffen begonnen und spielte dann nicht mehr Pingpong, sondern nur noch Gitarre, und auch in Indien habe ich nicht ein Mal an der Platte gestanden, trotzdem wusste ich beim Verfassen des Probetextes noch immer ganz gut, was ein scharf gezogener Topspin beim Gegner anrichten kann. Diese Sattelfestigkeit im Thema, kombiniert mit dem Zufall, dass der Chefredakteur ein leidenschaftlicher Tischtennisspieler war, hat es mir beim Sport leicht gemacht. Ob ihm meine Kritik über den »Tanz der Vampire« ebenso gut gefiel, weiß ich nicht, aber ich hatte den Film immerhin dreizehnmal gesehen, und auch auf die Reportage über den Frankfurter Flughafen, in dem ich mir das Geld für die Reise nach Indien als Kofferträger verdient hatte, ging der Chefredakteur der Neuen Westfälischen nicht gesondert ein, als ich zum zweiten Mal vor seinem Schreibtisch stand und mich zum ersten Mal setzen durfte, nein, diesem Prototypen des ungläubigen Journalisten gefiel von den Probeartikeln ausgerechnet mein politischer Kommentar über den Vietnamkrieg am besten, obwohl der nun wirklich reine Esoterik war. Indien pur. Angeklagt sind nicht die Amerikaner, hatte ich geschrieben, und angeklagt ist auch nicht der Vietkong, nein, angeklagt ist der Krieg allein. Und die Zeit wird der Richter sein. Das hört sich gut an, ist aber, wenn man es recht bedenkt, der größte Scheiß, trotzdem hat mir wahrscheinlich dieser Satz die Tür zum Journalismus und damit zum professionellen Schreiben aufgemacht.
Unprofessionell schrieb ich bereits seit meiner Kindheit. Zuerst einen Indianerroman, dann eine Jerry-Cotton-Adaption, und beide Werke illustrierte ich mit eigenen Zeichnungen. Bei den Schulaufsätzen brillierte ich durch schiere Länge. Zu lang für die Deutschlehrerin, die sie nicht mehr korrigierte und wahrscheinlich nicht einmal mehr las, sondern nur noch eine Eins und »sehr fleißig« darunterschrieb. In den Wirren der Pubertät, und leider auch noch danach, verfasste ich zu lange Liebesbriefe, die mir in zwei Fällen in Pornografie abrutschten. Lange Texte hätten deshalb am ersten Tag in der Redaktion der Neuen Westfälischen für mich kein Problem dargestellt, aber sie gaben mir zum Einstand eine Bildunterschrift von insgesamt vier Zeilen à dreißig Schreibmaschinenanschlägen, inklusive Leerzeichen, zu einem Foto, das die Eröffnung eines neuen Kindergartens dokumentierte. Und dazu gaben sie mir die sechs magischen Ws des Journalismus, die sechs Fragen, die jeder Text, egal, wie kurz er ist, unbedingt beantworten muss:
Wer?
Was?
Wo?
Wie?
Wann?
Warum?
Ich brauchte für die Bildunterschrift vier Stunden. Nicht, weil ich sie zu ambitioniert, sondern zu verschüchtert anpackte. Mit welchem der magischen Ws sollte ich beginnen? Mit der Adresse, der Uhrzeit, dem Geschehen? Und wer genau macht den Kindergarten auf? Die Kinder? Der Hausmeister? Und wie macht er das? Mit dem Schlüssel? Muss man denn wirklich alle der sechs Ws in einer Bildunterschrift, kurz BU genannt, unterbringen? Oder reicht hier und da das Vertrauen auf die Intelligenz der Leser? Sie werden schon wissen, warum man einen Kindergarten eröffnet. So doof sind die nicht. Aber ich wurde langsam doof. Ich probierte so lange die großen Ws in verschiedenen Kombinationen aus, bis ich mich nicht nur für keine mehr entscheiden konnte, sondern mir noch dazu das Bauchgefühl für die Grammatik abhandenkam. Ich begann es ernsthaft zu versemmeln.
Der Leiter der Lokalredaktion, unter dessen Fuchtel ich die erste BU meines Lebens schrieb, hasste Hippies mindestens so sehr oder gar noch mehr als der Chefredakteur, aber er trank nicht mit meinem Vater. Er kannte ihn nicht einmal. Ohne die Fesseln der Saufkumpanei konnte er sich ungehemmt in mich verbeißen. Dafür benötigte er keine Zähne, er brauchte mich nur anzusehen, um mein Selbstbewusstsein zu zerreißen.
»Vier Stunden für vier Zeilen, das heißt pro Stunde eine. Gratulation, Herr Kollege.«
Und dann begann er zu schreien.
»Ich habe Sie gestern am Leineweber-Brunnen gesehen! Sie haben Gitarre gespielt!«
Und lauter.
»Und Sie haben GESUNGEN!«
Noch lauter.
»Sie haben mit GESCHLOSSENEN Augen gesungen. Und ich sage Ihnen jetzt mal was.«
Pause. Ruhe vor dem Sturm. Dann:
»EIN JOURNALIST SCHLIESST NIEMALS DIE AUGEN!«
Da irrte er sich aber gewaltig. Hätte er gesagt, dass ein Sänger niemals die Augen schließe, hätte ich ihm recht geben können, denn so zu singen ist ein bisschen feige, aber ein Journalist MUSS die Augen schließen und nach innen blicken. Nur in uns ist das wahre Wissen, und Meditation ist die feinste Klinge des investigativen Journalismus für die breaking news der Seele. Meine Meinung. Seine Meinung: »Gehen Sie zurück nach Indien.« Aber so viel Macht hatte er nicht. Es gab Gewerkschaften, es gab Betriebsräte, und es gab Menschenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Schreibblockaden. Er konnte mich nicht zum Teufel jagen, weil ich für die Bildunterschrift vier Stunden gebraucht hatte. Dafür reichte sein Einfluss nicht aus, aber er reichte, um mich aus der Bielefelder Lokalredaktion zu schmeißen. Die Lokalredaktion in Minden nahm mich auf. Minden ist eine schöne Stadt, doch bevor ich über sie berichten darf, muss ich unbedingt noch einmal auf den Vorfall am Leineweber-Brunnen zu sprechen kommen. Ich hatte dort zwar nicht »Hare Krishna Hare Rama« gesungen, aber etwas Ähnliches.
»Jai Sat Chit Anand.«
Das ist Sanskrit. Jai heißt »ich grüße«. Und was grüße ich? Sat, die Wahrheit, Chit, das Bewusstsein, und Anand, die Glückseligkeit. Sind das die drei Seiten einer Medaille? So eine Medaille gibt es nicht. Oder sind es die drei Säulen der Weisheit? Wieder daneben. Dann sind es drei Namen für ein und dasselbe. Nein, auch das stimmt nicht ganz. Um zu verstehen, was ich am Leineweber-Brunnen einen Tag vor dem Volontariatsbeginn gesungen habe, muss man Füllwörter bemühen. Wahrheit (ist) das Bewusstsein (der) Glückseligkeit. Und weil davor ein Jai kommt, grüßte ich mit diesem gesungen vorgetragenen Sachverhalt jeden, der stehen blieb und mich anlächelte, und jeden, der nicht lächelte und weiterging, einfach jeden. »Jai Sat Chit Ananda«: »Ich grüße die Wahrheit in dir, die das Bewusstsein der Glückseligkeit ist.« Und? Stimmt diese hinduistische Formel? Wahrscheinlich. Denn ihre buddhistische Umkehrung stimmt ja auch. »Alles Leiden ist Unwissenheit.«
Mir ging es also ganz gut zu dieser Zeit. Ich war zwanzig und zu allem bereit, meinetwegen auch Minden. Die Neue Westfälische wird nicht nur in Bielefeld verkauft, sondern in ganz Ostwestfalen, und jede Stadt, die etwas auf sich hielt, hatte ihre eigene Lokalredaktion, die ihre eigenen Seiten produzierte, die als Teil der Gesamtausgabe nur in ihrer Stadt erschienen. Der Größe und Bedeutung ihrer Kreisstadt entsprechend, musste die Mindener Redaktion täglich vier bis sechs Seiten füllen, und dafür gab es einen Choleriker, einen Zyniker und einen normalen Redakteur. Der Choleriker war der Leiter der Redaktion, und der Zyniker sein Stellvertreter. Das ergab Sinn. Letzterer verachtete den Chef, und der Chef hasste ihn. Oder war es umgekehrt? Doch egal, wie man es dreht. Negative Energie war die Grundlage ihrer Zusammenarbeit. Macht gegen Intelligenz. Der eine schrie, der andere trank, und der Dritte war die fleischgewordene Comicfigur des abstinenten, aber rasenden Reporters, mit einem Schuss Nick Knatterton, dem Detektiv. Er entzog sich den beiden durch pure Geschwindigkeit und einen entweder angeborenen oder angenommenen Autismus. So wurden drei Männer und ein Volontär jeden Tag von einer Springflut mitgerissen, auch Posteingang genannt. Und alle Telefone heulten gleichzeitig und immer, den ganzen lieben langen Tag. In Minden gab es gefühlte 10000 Schützenvereine, 5000 Sportvereine und 7000 organisierte Kaninchenzüchter, die uns mit ihren beknackten Terminen die Hölle einheizten, in Minden wollten gefühlte hundert goldene Hochzeiten pro Tag ins Blatt, und in Minden wurde auch Lokalpolitik gemacht. Außerdem liegt die Stadt an der Weser. Es gibt einen kleinen Hafen. Binnenschiffer kamen, Binnenschiffer gingen, nur die Huren blieben. Gauner, Diebe, Verkehrsunfälle, Polizeinachrichten, Amtsmitteilungen, Presseerklärungen sowie Einladungen zu Werkseröffnungen und Tanzdarbietungen brasilianischer Künstlerinnen und Künstler.
»Mit Busen, Beinen und Bananen« war meine erste eigene Überschrift. Reiner Glücksgriff. Keine Sekunde nachgedacht. In Minden lernte ich, zu schreiben, ohne zu denken und ohne gut sein zu wollen, lustig, elegant oder inspirierend. Satzaufbau, Textaufbau, Erzählstruktur, Anfang, Mitte, Ende und dann noch Pointen setzen, für diesen ganzen Egoscheiß fehlte in Minden einfach die Zeit.
Glücklicherweise sagt ein Bild mehr als tausend Worte!
Man erklärte mir deshalb die Funktionsweise einer der drei Redaktionskameras und wie man seine Bilder in der Plumsklo-Dunkelkammer entwickelte, zudem brachten sie mir das Spiegeln bei, also das Layouten. Auf einem Bogen Papier, der exakt so groß wie eine Zeitungsseite und in fünf Spalten unterteilt war, bestimmte man mit einem Bleistift und einem Lineal, wo und wie groß die Artikel, Überschriften, Vorspänne und Fotos stehen sollten. Das machten eigentlich nur die Redakteure, aber weil man in Minden in einem Volontär keinen Auszubildenden sah, sondern ein Häschen, das dringend mal ins kalte Wasser geworfen gehörte, durfte ich es auch, mehr noch, ich bekam meine eigene Seite, die ich nun Tag für Tag selbst gestalten konnte. Zurück zu den Plattitüden. Ein Foto sagt nicht grundsätzlich mehr als tausend Worte, denn das kommt auch immer ein bisschen auf die Worte an, aber weil ich, wie die anderen, für jedes selbst geschossene, selbst entwickelte und selbst eingespiegelte Bild zehn Mark auf mein monatliches Gehalt obendrauf bekam, verinnerlichte ich die Lieblingsplattitüde aller Fotografen und zeichnete sogar zu einem Minitext über ein Altenheim-Event fünf meiner Bilder auf meiner Seite ein. Ich machte praktisch keine Gruppenfotos mehr. Ich brauchte ein Foto pro Greis. Und einen Greis pro Spalte. Dagegen sah die Bild wie eine Bleiwüste aus.