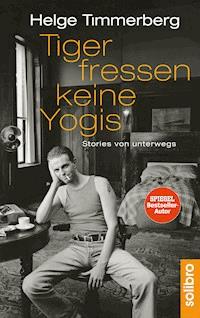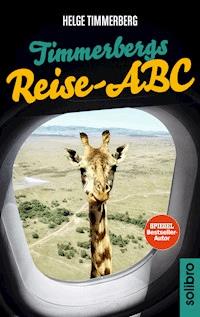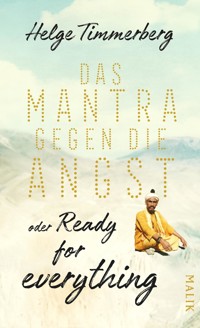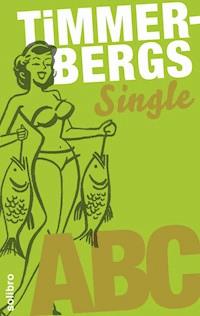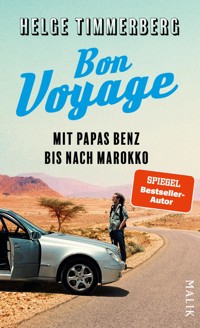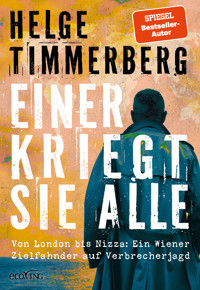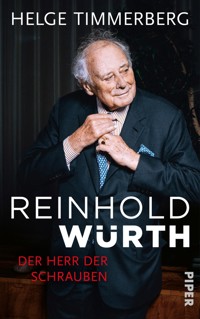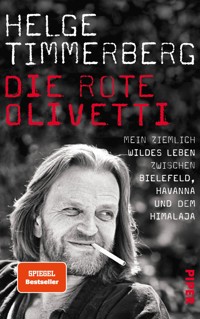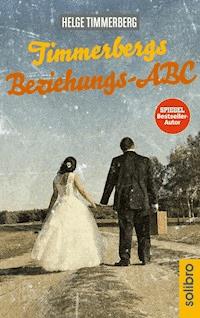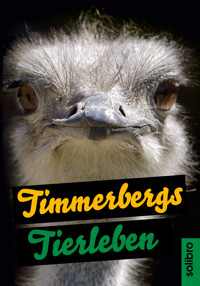9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ist die Tugendhaftigkeit des sinkenden Testosteronspiegels das natürliche Ende aller Laster? Oder geht es danach noch irgendwie weiter mit dem Spaß – am Leben, am Reisen, am Rauchen? Ist die Lebenserfahrung eines Siebzigjährigen Weisheit oder nur die Summe aller Fehler? Will er Respekt oder Mitleid, Ehre oder Shitstorm, Bier oder Marihuana? Wie viele Wracks verrotten am Strand der gestrandeten Träume, wie viel kostet ein Altersheim in Thailand, und was ist mit Bauch, Beine, Po? Auch Schicksalsfragen stellen sich, wenn der einzige Zahnarzt, dem man vertraut, plötzlich im Himmel ordiniert. Tut sich dann auf Erden die Hölle auf? Helge Timmerberg feiert Geburtstag und schenkt sich selbst und uns allen ein Buch zum Thema »Siebzig«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Dr. dent. Konrad Jacobs und Gattin
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Gerhard Kummer
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1. Kapitel
Bauch, Beine, Po
Ich hatte mal einen Bauch in Afrika. Aber auch in Asien, den USA und Lateinamerika schleppte ich ihn wie einen Rucksack mit, nur halt nicht abschnallbar. Obwohl er nicht weniger wog. Zwanzig Kilo zu viel, was ästhetisch noch vertretbar ist, wenn sich das Fett gleichmäßig am ganzen Körper dicke macht. Aber das tat es nicht. Es konzentrierte sich nur auf meine Mitte. Wie ein Wasserball mit Bauchnabel sah es aus. Oder wie schwanger im neunten Monat. Doch nie kam ein Kind heraus, wer hätte das gedacht?
Frauen lügen übrigens wie gedruckt, wenn sie sagen, das Aussehen eines Mannes interessiert sie nicht. Seine Persönlichkeit sei für sie das Ding, seine Intelligenz, sein Humor. Es mag ja sein, dass ihnen ein Dicker, der sie zum Lachen bringt, lieber ist als ein dünner Trauerkloß. Aber nicht im Bett. Denn da lacht man nicht. Und wozu brauchen Orgasmen einen IQ? Auch der stört da nur. Je höher der IQ, desto komplizierter pudert er. Früher hätte ich »fickt er« geschrieben, aber mit siebzig liegt mir die Wiener Mundart mehr. Pudern und Charisma? Nun ja …
Ich hatte mal einen Bauch im Himalaja. Ein Wandermönch, der ihn im Vorbeiwandern sah, riet mir zu einem Fastentag pro Woche. Ich erschrak. Aber so schlimm war es nicht. Ich durfte zwar nichts essen, aber so viel Wasser trinken, wie ich wollte, und das nahm mir das Hungergefühl. Kaffee und Zigaretten waren auch erlaubt, Sex keineswegs. Ich praktizierte das viele Jahre lang, und es half mir mental und spirituell, aber dem Bauch half es eigentlich nicht. Immer schien er mir am nächsten Tag ein bisschen kleiner zu sein und am darauffolgenden wieder ein bisschen größer. War das der Jo-Yogi-Effekt? Trotzdem gewöhnte ich mich an die Diät, wegen der klaren Gedanken und des klaren Urins. Ein Tag der Reinigung, ein Tag der Willensstärke, ein Tag für den Buddha-Bauch. In den restlichen sechs Tagen aß ich, was ich wollte, bis hin zum griechischen Joghurt. Zehn Prozent Fett, fünfzehn Prozent, ich fand sogar mal einen mit zwanzig Prozent. Der Joghurt-Zeitgeist schlug die Hände über dem Kopf zusammen, und ich erklärte ihm mein System. Nur einmal am Tag und nur ein bisschen. Lieber wenig, aber voll im Geschmack, als viel von der vollen Geschmacklosigkeit. Das System hatte zwei Sollbruchstellen. Die erste war die neurologische. Sobald ich einen Löffel Griechenjoghurt intus hatte, wollte irgendeine Fehlschaltung in meinem Gehirn den nächsten, und ab dem dritten Löffel brachen alle Schranken. Auch setzten große Teile des Bewusstseins aus. Und die Erinnerung, was da geschehen war, vom dritten bis zum letzten Löffel, war dann ebenfalls einfach weg. Die zweite Sollbruchstelle meines »Ich kann mit Griechenjoghurt umgehen«-Systems lauerte im Supermarkt. Ich kaufte ihn natürlich in der kostensparenden Großpackung, das sind diese kleinen Eimerchen.
Ich hatte mal einen Bauch in Berlin. Und nahm ihn mit auf die Bühne. Da greift natürlich die Routine. Das superweite Hemd über der Hose machte mich zwar noch nicht zu einem heimlichen Dicken, aber wenn man schnell an den Lesetisch kommt, und das geht fast immer, wird der Bühnenbauch von einem schwarzen Tuch verdeckt, das von der äußeren Tischkante bis zum Boden fallen muss. Das verlangt mein Agent von den Veranstaltern. Aber auch dieses System hatte zwei Sollbruchstellen. Die erste: Schauspieler wären gerne Schriftsteller, und die wären gerne Rockstars. Und weil sich Schriftsteller anscheinend alles erlauben können, singen sie auch manchmal. Außerdem: Der Gürtel ist der Feind des Atems, und die Hosenknöpfe sind die Verbündeten des Gürtels. Meine Lesungen sind eher lang, und irgendwann war da unten alles sperrangelweit offen, aber dem schwarzen Tuch sei Dank blieb das schön im Verborgenen, ich hätte onanieren können, und niemand hätte was gesehen. Erst als ich zur Gitarre greifen wollte, die ein bisschen abseits stand, musste ich aufstehen. Und die offene Hose hatte ich im Leserausch glatt vergessen. Was singt man da? »I’m too sexy for my underwear« oder doch nur »No woman, no cry«?
Ich hatte mal einen Bauch in St. Gallen und schleppte ihn wie einen Bierkasten die Treppen hoch. Die Treppen haben hundertdreiundsechzig Stufen, denn sie führen von der Altstadt zum Rosenberg hinauf, wo ich wohne. Ich hätte auch auf richtigen Straßen mit dem Auto fahren können oder mit dem Bus, aber ich hatte das treppenverseuchte »Dohlengässlein« zu meinem Fitness-Parcours erklärt. Mit zwanzig Kilo im Bauch und zweimal fünf Kilo in Einkaufstüten quälte ich mich täglich über hundertdreiundsechzig Stufen. Ein schöner Leidensweg, gesäumt von den Gärten hundertjähriger Jugendstilvillen und großen Bäumen, die ihr Blattwerk wie ein Dach über den Parcours legen. Vögel zwitschern im Dohlengässlein, Kinder spielen hinter den Büschen, und die Katzen zeigen, wo der Hammer hängt, wenn es um Stufen geht.
Ich war mittlerweile Realist. Ich arbeitete nicht mehr gegen den Bauch, sondern für ihn. Ich brauchte eine bessere Kondition, um ihn zu tragen. Das Dohlengässlein ohne Pausen zu schaffen, darum ging es zuerst. Dann darum, mich nicht mehr beim Treppensteigen am Geländer abzustützen. Und immer ging es um eine malerische Bank vor den letzten dreiunddreißig Stufen. Sie war vom Teufel da hingestellt.
Ein Freund, ein guter Freund, also das Wichtigste auf der Welt, gesellte sich eines Tages zu mir auf die Teufelsbank. Ich hatte ihn seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Vorher war er dick, jetzt nicht mehr. »8/16«, sagte er. »Unheimlich einfach, total effektiv. Acht Stunden darfst du alles essen, sechzehn Stunden nichts. Und die Hälfte von den sechzehn Stunden schläfst du. Nennt sich Intervallfasten, das machen grad alle, von Jennifer Lopez bis Jesus Christus.«
»Bist du sicher?«
»Ja.«
Seitdem verlor der Teufel im Dohlengässlein sein Spiel. Aber auch der Teufel im Kühlschrank, und wenn in den kalten Jahreszeiten der Teufel als Scheißwetter daherkam, verlor er auch. 8/16 nahm mir nicht nur den Bauch, auch meine Routinekrankheiten in den kalten Jahreszeiten mussten abdanken. Zwei, drei fette Erkältungen bis hin zur Bronchitis gehörten zu meinen Wintern wie das Loch zu meinem Hintern, dazu meldete sich ganzjährig der Magen immer mal wieder schwer verstimmt. Auch damit ist es vorbei, weil Wissenschaft und Wille sich paarten. Wie heißt sie gleich? Endokrinologie. Die Lehre von Drüsen und Hormonen hat festgestellt, dass sich der Körper nach sechzehn Stunden Fasten zu ängstigen beginnt. Wird er verhungern? Wie immer und überall besteht auch bei ihm die Lösung darin, Überflüssiges abzubauen. Schlechte Zellen werden eingeschmolzen und aus ihren Bestandteilen neue geschaffen. Recycling ist ein relativ modernes Wort, aber das Prinzip ist so uralt wie die Evolution. Sie kümmert sich um die Ihren. Neue Zellen, das heißt neue Abwehrkräfte, heißt tipptopp Immunsystem, heißt Verlangsamung des Altersprozesses, gesund und länger jung, was will man mehr, ach ja, der Kernauftrag der Diät. Aber der Bauch gehört zu einer anderen Fakultät. Die Ernährungswissenschaft ist hier gefragt, die besagt, dass der Körper zwölf Stunden braucht, um die letzte Kalorienzufuhr vollständig abzubauen. Erst dann beginnt er auf die Fettreserven zurückzugreifen. Bei 8/16 tut er das zwar nur vier Stunden lang, aber das jeden Tag.
So viel zur Wissenschaft, nun muss der Wille ran. Aber weniger als befürchtet. 8/16 hats mir leicht gemacht. Es passte sich perfekt meinem Lebensstil an. Ich lebe gern, wenn das Gute schläft und das Böse wacht, und damit mir die Nacht nicht durch Hunger versaut wird, nahm ich die letzte Mahlzeit erst um 22 Uhr zu mir. Das hielt mich vier bis sechs Stunden satt, und gehungert habe ich dann im Schlaf. Frühstücken durfte ich zwar am nächsten Tag erst wieder um 14 Uhr, aber wo ist das Problem, wenn man nicht vor Mittag aufwacht? Ich sehe keins. Nur eins. Man nennt es den Kiffer-Fresstrip. Er ist nicht hungergesteuert, dem gehts um was anderes. Um Liebe, Lust, und Leidenschaft via Geschmackssinn. Haschisch ist die klassische Einstiegsdroge für Ritter Sport Vollmilch-Trauben-Nuss, aber auch für späte Käsebrote und Studentenfutter. Darauf zu verzichten war der einzige Verdruss in den 8/16-Nächten. Dem zu widerstehen dagegen war ein triumphales Gefühl in kleinen Schritten. Um es kurz zu machen: Ich bin ein Schreiber. Ich arbeite mit Worten, und es gibt durchaus welche, die ich nicht mag – nur ich, andere mögen sie. Und das gilt auch für abgegriffene Sprachbilder, es sei denn, ich kann spielerisch mit ihnen umgehen und sie für andere Themenfelder nutzen als gewohnt. Das »Die Pfunde purzeln«, zum Beispiel, mag ich nicht, wenn es um Diäten geht, aber ginge es um einen plötzlich verarmten Briten, fände ich »Die Pfunde purzeln« richtig witzig. Doch seis drum. Die Pfunde purzelten, die Spiegel verloren ihren Schrecken, schon nach zwei Monaten hatte ich mit 8/16 meinen Bauch fast und nach drei Monaten gänzlich verloren, und das fühlte sich im Dohlengässlein halt wie Treppensteigen ohne einen vollen Bierkasten an.
Ich hatte mal keinen Bauch im Jeansshop und kaufte eine Lewis 501 in den Maßen 32/34. Ich schlüpfte in die Hose wie in ein Roadmovie der guten Jahre, in denen es darum ging, auf fahrende Busse aufzuspringen, auf fahrende Züge, auf fahrende Frauen, aber auch auf Beifahrerinnen, also quasi auf alles, was fährt, damit es weitergeht, aber ich hatte auch mal keinen Arsch im Jeansshop, und damit riss der Film a bisserl. Das ist der Nachteil der Diät. Sie frisst nicht nur den Bauch, auch der Po schmeckt ihr, und was von ihm noch da ist, das hängt in Falten. Und was sagt die Verkäuferin dazu? Abhängen sollst du unter Palmen, aber nicht in der 501. Da wäre die Lewis 511 zu empfehlen. Nur die macht Knackärsche, wenn keine Knackärsche da sind. Das stimmt, aber ich darf mich natürlich auch fragen, welche Signale ich damit aussenden will. Die Botschaft der 511 ist »Fake Arsch«. Und der echt stramme Po macht mich auch nicht wirklich froh, denn was für Signale sind das? Ich war mal eine Zeit lang viel im Zoo. Stichwort: Pavianärsche. Strammer gehts nicht, man könnte schon geschwollen sagen, und je geschwollener sie waren, desto geiler war der Pavian. Der Mensch stammt vom Affen ab. Und die Signale des Knackarsches sind »Fick mich«. Will ich das mit siebzig? Das wollte ich nicht mal mit siebzehn. Außerdem waren die Falten am Arsch noch der geringste aller Kollateralschäden der Diät.
Ich hatte mal keinen Bauch und keinen Arsch am Baggerteich. Das war in Österreich, da sieht es in öffentlichen Badeanstalten folgendermaßen aus: Die Jungen sind körperbewusster und selbstoptimierender als die Deutschen, die Alten sind k. u. k. Hängebauchschweine. Schämt euch, ihr verfressenen Säcke, dachte ich still für mich im Vorbeigehen und genoss den Triumph, aber in der Nähe von Bikini-Mädchen kämpfte ich gegen alte Reflexe, denn wo kein Bauch mehr ist, muss man auch keinen mehr einziehen. Um das Dilemma am Hinterteil kümmerte sich meine knielange Badehose aus Thailand. Flipflops, Ray-Ban-Brille und ein lose übergeworfenes Hawaiihemd vervollständigten das Bild und die Botschaft. Rock ’n’ Roll never dies.
Er starb auf dem Badetuch. Und zwar sogleich. Ich kniete dort auf allen vieren, um irgendeine Kleinigkeit zu suchen, und sah dabei auch unter mir her, und was ich da erblickte, hatte ich noch nie gesehen, seitdem ich wieder schlank war. Nicht im Stehen, nicht im Gehen, nicht im Sitzen, nicht im Liegen, auch nicht in der Seitenlage, nie. Erst als ich mich am Baggerteich in die Hundestellung begab, wurde offenbar, dass zwar der Bauch weg war, aber nicht die Haut, die ihn so lange fest umspannte. Die war noch da, und sie hatte enorm an Spannkraft verloren. Wie ein alter leerer Kartoffelsack hing sie an mir herab. Ich fand das ziemlich ekelhaft. Frauen, die schon mal ein Kind geboren haben, kennen das. Um sich mit mir zu vergleichen, müssten es allerdings Zwillinge gewesen sein. Und der Erkenntnisschock am Baggerteich in Österreich zündete dann die zweite Stufe des Selbstfindungsprogramms.
Dass ich Bauchmuskeln habe, wusste ich vom Hörensagen. Gesehen hatte ich sie nie, nicht mal gefühlt, auch nicht gebraucht. Ich bin kein Reisbauer. Ich bin Reiseschriftsteller, die brauchen Muskeln am Oberarm, und die kriegen sie durchs Kofferschleppen. Früher kamen noch die mechanischen Reiseschreibmaschinen dazu, die waren irre schwer. Mein Laptop ist das nicht mehr, und mittlerweile gibt es auch Rollkoffer, trotzdem weiß ich noch, wie die Muckis am Arm ausgesehen und sich angefühlt haben. Von ihren Kumpels in meinem Bauch weiß ich erst, seitdem mir ein russischer Rentner-Coach eine Alternative zu den Sit-ups aufzeigte. Die mochte ich nie, die konnte ich nie, die habe ich nie durchgehalten. Aber was die alten Russen machen, das kann ich auch.
Rückenlage, Hände unter den Po, das schont die Bandscheibe. Und dann, davai, davai, die Beine hoch und wieder runter. Mit zehnmal fing ich an, mittlerweile bin ich bei zwanzigmal. Danach zwanzig Sekunden lang Luft-Radfahren, abgelöst durch zwanzig Sekunden Luft-Schwimmen und wieder Rückenlage. Jetzt aber nicht mit den Händen unterm Faltenarsch, die Arme liegen weit ausgestreckt hinterm Heldenköpfchen. Und schon schnappt das klassische Rentnerklappmesser zu: Beine hoch, und die Hände holen sich die Fußknöchel. Auch zwanzigmal. Und das Ganze dann noch mal von vorn für den zweiten Durchgang. Anfängerfehler. Man will es schnell hinter sich bringen und dabei möglichst wenig Schmerzen haben. Das Gegenteil ist richtig: Wenn die Beine langsam wieder runterkommen und dabei nicht den Boden berühren, sondern kurz darüber die Spannung halten, erst dann tut es weh, und statt darüber zu jammern und zu klagen, empfiehlt sich ein lustvolles Stöhnen, denn was da wehtut, ist das Neue in meinem Leben. Bauchmuskeln fressen Schmerzen. Sie wachsen an ihnen. Zehn Minuten, mehr nicht, aber das täglich, mit dem Ergebnis, dass ich mittlerweile einen inneren Gürtel trage.
Mittlerweile ist jetzt. Und hier. Und angesichts dieser Zeit- und Raum-Koordinaten sage ich: Scheiß drauf. Ich brauche keine Sixpacks, ich brauche Macht. Und wenn ich keine Macht über was anderes habe, dann brauche ich Macht über mich, und wenn ich keine Macht über mich habe, dann bleibt nur noch die Macht über meine Muskeln, meinen Bauch, meinen Tagesablauf. Disziplin ist Macht. Und sie ist die einzige, die nur ich mir nehmen kann.
2. Kapitel
Alkohol, Drogen, Medikamente
Angelina Alkoholika (kurz: Angel Alk) ist meine Zweitfrau, die ich auch relativ spät kennenlernte. Verheiratet bin ich mit meiner Jugendliebe Maria Marihuana. Sie verstehen sich nicht sonderlich, darum hielt ich sie, so gut es ging, auseinander. Mittlerweile, ich weiß nicht warum, vertragen sie sich besser. Kotzen muss niemand mehr, trotzdem bleibt es ein unflotter Dreier, was an dem gegensätzlichen Temperament der beiden liegt. Unflott bis zum Opiat. Die eine ist intro-, die andere extrovertiert. Maria gräbt sich gern zu Hause ein, Angel macht lieber draußen einen drauf. Gemeinsam blockieren sie sich, und dabei kommt dann nichts heraus. Aber das Nichts ist nicht leer. Es ist randvoll mit einem Lebensgefühl, das der Ursuppe gleicht. Sie blubbert, sie brodelt, sie wirft Bläschen, aber nie braust sie auf, nicht mal aufstehen will man mehr, und das macht den Kombi-Rausch ideal für den Absacker nach einem langen Tag. Und ist nicht das Alter der Absacker nach einem langen Leben?
Wer möglichst unbehelligt bis zum bitteren Ende durchsacken will, ist mit dem unflotten Dreier gut bedient, aber Anti-Aging ist das nicht. Angel Alk macht mich alt. Alles an mir. Die Haare, die Haut, die Augen, die Leber, nichts lässt sie aus, auch nicht die Achselhöhlen und das Gehirn. Die Achselhöhlen stinken wie der Atem des Anus, das Gehirn gerinnt, als müsste es durch einen Abfluss. Doof, aber lustig, kaputt, aber man merkt es nicht, impotent, aber das enthemmt, all das macht Angel Alkoholika zu der Femme fatale in diesem Arrangement. Und Maria Marihuana ist all das nicht. Mehr noch. Sie ist das Gegenteil von alldem. Maria M. ist ein krasser Gesundheitsfreak, sie kümmert sich wie eine Mutter um das Immunsystem, sie füttert Zähne, Nägel und Frisuren, sie lindert Schmerzen, hemmt Entzündungen, entkrampft Magen und Darm, sie ist ein großer Appetitanreger, böse Zungen nennen es Fresstrip, sie ist ein kleines Aphrodisiakum, gute Zungen singen ein Lied davon, sie ist ein Therapeutikum gegen Krebs und Arteriosklerose, sie fördert das Knochenwachstum, entspannt Muskelkrämpfe, und sie ist eine der Schwestern des Sandmännchens. Ach ja, ich vergaß, man kann auch wundervoll mit ihr fernsehen. Egal was. Und warum gebe ich dann der anderen Braut nicht den Laufpass?
Weil Maria auch eine dunkle Seite hat. Die dunkle blaue Blume, oder war es die violette? Ich glaube, Hermann Hesse nannte so die Melancholie. Oder war es Novalis? Sorry, aber Maria vergisst auch viel. Und es ist ja auch egal, wer von den beiden Dichtern davor warnte, zu lange in der Betrachtung dieser Blume zu verweilen, denn Fakt ist, Melancholie macht traurig, schön traurig, klar, aber wenns blöd läuft, wird ne unschöne Traurigkeit daraus, und die nennt man zwar noch nicht Depression, aber depressive Anwandlungen sind das schon.
Maria Marihuana ist übrigens auch ein bisschen ängstlich. Weil sie so sensibel ist. Das hängt mit ihrer Fähigkeit zusammen, Sinneseindrücke zu verstärken. Und zwar alle. Die musikalischen wie die unmusikalischen, die harmonischen wie die unharmonischen, die anmutigen wie die brutalen, und wenn dann irgendwo und irgendwann der Lärm und die Geschmacklosigkeit obsiegen, wird so ein Sensibelchen schnell mal ein bisschen paranoid. Ein bisschen schreckhaft, ein bisschen schissig, was die Zukunft angeht. Hinter jeder Ecke lauert ein Ungeheuer, aus jedem Loch kommt ein Zombie gekrochen, jedes der drei großen Zukunftsthemen Liebe, Geld und Tod ist mit Angst und Schrecken besetzt, und ein alter Hase wie ich weiß zwar, dass am Morgen die Welt wieder in Ordnung sein wird, weil die Schlangen, die Maria in der Nacht gesehen hat, bei Licht betrachtet nur Stöckchen waren, aber ich hätte diesen Erkenntnisstand halt gern auch schon vor dem Einschlafen, vielleicht so ne Stunde lang. Und dafür brauche ich die Schlampe aus der Flasche. Angel Alkoholika besorgts mir dann. Sie entsensibilisiert und macht Mut bis zum Größenwahn.
Maria ab Sonnenuntergang und Angel ab Mitternacht ist meine Formel für ein glückliches Drogenleben mit siebzig, die dicke Berta aus der Familie der Benzos habe ich dagegen bisher nur einmal probiert, und das auch nur versehentlich auf einem Nachtflug nach Kapstadt. Dem ging ein Gespräch mit einem Arzt voraus. Nicht mit meinem Arzt, denn ich hab keinen, weil ich wegen Maria einfach zu gesund bin. Nein, er ist ein guter Freund, der zufällig auch Neurologe, Psychologe, Schmerz- und Angsttherapeut ist. Seine Praxis brummt, denn er hat, wie mir seine Frau gestand, die besten Drogen in town.
Ich unterbreitete ihm folgende Problemfelder: a) dauert der Nachtflug nach Südafrika gute zwölf Stunden, und da würde ich gern mal ne potente Schlaftablette ausprobieren, und b) war ich noch nie dort und kenne mich nicht aus. Es könnte durchaus passieren, dass ich nicht sofort einen Marihuana-Dealer meines Vertrauens erblicke, was verlässlich zu mindestens einer Nacht ohne ausreichenden Schlaf führen würde. Das ist einer der Nachteile von Maria, wenn man sich zu sehr an sie gewöhnt hat. Es braucht zehn bis vierzehn Tage, bis ich auch ohne sie einschlafen kann. Und so viel Zeit hatte ich in Kapstadt nicht. Der Job musste in drei Tagen erledigt sein. »Und warum nimmst du das Gras nicht einfach im Flieger mit«, fragte er. »Dafür bin ich zu vorsichtig«, antwortete ich. »Ach, du bist auch paranoid?« Er gab mir eine Medikamentenpackung aus seiner Vorratskammer. Zwanzig kleine blaue Pillen, nicht rund, sondern stabförmig, von denen jede durch drei Sollbruchstellen in ihrer Wirkung noch mal zu reduzieren war. »Nimm erst mal nur ne Hälfte«, sagte er lächelnd. »Die können was.«
Im Flieger half mir zunächst auch ohne pharmaindustrielle Unterstützung das Video-Bordprogramm, die Economy Class nicht als kontraproduktive Sparsamkeit meines Auftraggebers zu verfluchen. Mit Liam Neeson und Taken verging die Zeit bis zur Nordafrikanischen Küste wie im Flug, mit Taken 2 gings über die Wüste, und mit Taken 3 über den Niger, Nigeria und Kamerun. Erst im Luftraum über den Regenwäldern des Kongo griff ich zu der Pille, teilte sie brav und schluckte die Hälfte. Vielleicht wurde es deshalb auch nur ein Halbschlaf, jedenfalls wollte es mir zwischendurch immer mal so scheinen, als wäre ich noch halb wach, trotzdem landete ich gut fünf Stunden später nicht nur ausgeruht, sondern auch extrem wohlgemut. Ich bin ein Vielflieger. Der Touchdown nach einem interkontinentalen Ritt in beengten Verhältnissen euphorisiert mich nicht mehr automatisch. Normalerweise will ich nur noch raus aus der Kiste, raus aus den Schlangen, raus aus der Gepäckhalle und rein ins Taxi, aber im Cape Town International Airport fühlte sich die Ankunftsprozedur in einer fremden Welt aus mir unerfindlichen Gründen wieder so beglückend neu an wie beim ersten Mal. Die blaue Pille hatte ich als Erklärung dafür nicht auf dem Zettel und auch schon vergessen. Es war ja nur eine Schlaftablette, und davon auch nur die Hälfte. Und für den Verdacht, es könnte mehr als gedacht darin gewesen sein, fehlten vor, während und nach der Landung alle mir bekannten Drogenerlebnisse. Ich war weder high noch breit oder besoffen. Nicht mal beschwipst. Ich hatte nur im Flieger dankbar einen Frühstückskaffee genossen und freute mich nun auf die erste Zigarette, aber das ohne jede Ungeduld, ohne jede Sucht nach Nikotin oder irgendwas anderem, denn ich war vom Augenblick erfüllt und von dem, was er zu bieten hatte. Die Sonne in den Fenstern, die Stewardessen am Laufband, das Lebensgefühl beim Reisen, das ich von früher kannte, so optimistisch wie die Jugend, und so tiefenentspannt wie die Weisheit, ja, man könnte sagen, ich dockte an meinen besten Tagen an, morgens um sieben in Südafrika.
Einen Tag später hatte ich noch immer kein Marihuana, nicht weil ich keins gefunden, sondern weil ich keins gesucht hatte. Auch das war außergewöhnlich. Und ich hatte von dem Rest der blauen Pille nichts nachgeworfen, ich hatte einfach so in der ersten Nacht im Breakwater Hotel, das zur Zeit der Apartheid mal ein berüchtigtes Gefängnis gewesen war, wie ein Baby durchgeschlafen, und wenn ich nicht schlief, war es auch okay, so megaentspannt herumzuliegen und den Atem zu zählen.