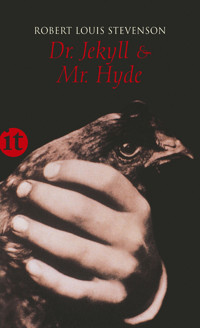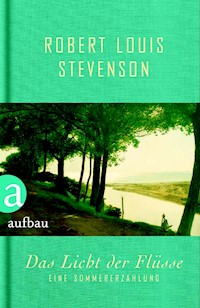Die Schatzinsel / Treasure Island - Zweisprachige illustrierte Ausgabe (Deutsch-Englisch) / Bilingual Illustrated Edition (German-English) E-Book
Robert Louis Stevenson
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Schatzinsel, ein zeitloses Meisterwerk von Robert Louis Stevenson, entfaltet sich als packendes Abenteuer in einer Welt voller Piraten, geheimnisvoller Karten und exotischer Schätze. In lebhaften, detailreichen Prosa beschreibt Stevenson die Reise des jungen Jim Hawkins, der an Bord des Schiffs Hispaniola in ein aufregendes, aber gefährliches Abenteuer aufbricht. Der literarische Stil des Buches, geprägt von einer fesselnden Erzählweise und eindrücklichen Charakterporträts, reflektiert die viktorianische Ära und das Genre des Abenteuerromans, während es gleichzeitig universelle Themen wie Mut, Verrat und Freundschaft untersucht. Robert Louis Stevenson, ein schottischer Schriftsteller des späten 19. Jahrhunderts, war bekannt für seine Fähigkeit, fesselnde Geschichten zu kreieren, die oft von seinen eigenen Reisen und Erfahrungen inspiriert sind. Sein Interesse an Seefahrt und seine Leidenschaft für das Geschichtenerzählen führten ihn zu dieser ikonischen Erzählung, die sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistert. Stevensons eigene Kämpfe mit Gesundheit und Identität finden in den vielschichtigen Charakteren und der Symbolik des Erbes ihren Ausdruck. Die zweisprachige illustrierte Ausgabe von Die Schatzinsel bietet nicht nur einen Zugang zu diesem literarischen Klassiker, sondern fördert auch das Verständnis beider Sprachen. Diese Edition ist perfekt für Leser, die sich für die kulturellen und historischen Kontexte des Buches interessieren und gleichzeitig ihr Sprachverständnis vertiefen möchten. Ein unverzichtbares Werk für jeden Literatur- und Abenteuerliebhaber! In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Schatzinsel / Treasure Island - Zweisprachige illustrierte Ausgabe (Deutsch-Englisch) / Bilingual Illustrated Edition (German-English)
Einführung
Gier und Gewissen teilen den Kompass eines Jungen auf stürmischer See. Diese schlichte, unerbittliche Spannung bildet den inneren Nordstern der Schatzinsel. Robert Louis Stevenson entfaltet daraus kein bloßes Abenteuer, sondern eine Reise der Bewährung: Ein Heranwachsender lernt, die lockende Romantik der Piraterie von der Wirklichkeit der Verantwortung zu unterscheiden. Unter den Salzkrusten der Handlung liegen Fragen nach Mut, Loyalität und dem Preis des Goldes. So verbindet sich das Versprechen der Ferne mit einer genauen Studie menschlicher Motive, die bis heute in jedem Leser die Sehnsucht nach Freiheit und die Sorge um Haltung wecken.
Die Schatzinsel stammt von Robert Louis Stevenson, einem schottischen Autor, geboren 1850, gestorben 1894. Das Werk erschien zunächst 1881 bis 1882 als Fortsetzungsroman in der Kinderzeitschrift Young Folks, und Stevenson verwendete dafür das Pseudonym Captain George North. 1883 folgte die Buchausgabe. Diese Entstehung im Übergang vom feuilletonistischen Abenteuer zur literarischen Form prägt den Ton: klar, zügig, bildkräftig und doch sorgfältig komponiert. Der Roman steht an einem Schnittpunkt der viktorianischen Literatur, an dem Unterhaltungslust, Moraldebatte und Reiseliteratur sich begegnen und ein neues Publikum über Altersgrenzen hinweg gewinnen.
Als Klassiker gilt die Schatzinsel, weil sie das Abenteuer nicht nur erzählt, sondern formt. Stevenson übernimmt maritime Topoi und ordnet sie so, dass Spannung aus Charakterkonflikten erwächst, nicht nur aus äußeren Gefahren. Seine Prosa ist zugänglich, ohne simpel zu werden, und sie vertraut auf die Kraft der Imagination. Die klare episodische Struktur, die genaue Seemannssprache und der Sinn für Rhythmus machen das Buch zu einer Schule des Erzählens. Über Generationen wurde es in Schulen gelesen, in Familien vorgelesen und von Schriftstellern als Muster einer ökonomischen, wirkungsstarken Narration geschätzt.
Die Ausgangssituation ist rasch umrissen, ohne hier Wendungen vorwegzunehmen: Ein Junge lebt an der Küste und gerät durch die Begegnung mit einem rätselhaften Seemann an eine Karte, die eine ferne Insel verspricht. Ein wohlhabender Gutsbesitzer und ein gewissenhafter Arzt helfen, eine Expedition auszurüsten; ein Schiff, die Hispaniola, wird gemietet, und eine gemischte Mannschaft heuert an. Schon vor dem Auslaufen schimmern Misstrauen und verlockende Erzählungen auf. Die Fahrt beginnt, von der Hoffnung auf Reichtum getragen und vom Gefühl, dass nicht alle an Bord dieselben Ziele verfolgen, unmerklich verdunkelt.
Die bleibende Wirkung des Romans beruht auf seinen Themen. Da ist das Erwachsenwerden als Serie von Bewährungsproben, bei denen Klugheit ebenso zählt wie Tapferkeit. Da ist die Versuchung des schnellen Gewinns und die Frage, was Loyalität unter Druck bedeutet. Da ist die Spannung zwischen Gesetz und Gesetzlosigkeit, Autorität und Aufbegehren, Ordnung und Improvisation. Stevenson macht daraus keine Lehrschrift, sondern eine Bewegung: Wir erleben, wie Entscheidungen in Augenblicken fallen und doch lange Schatten werfen. Der Schatz ist dabei weniger Ursache als Prüfstein, an dem Charaktere ihr eigenes Gewicht entdecken.
Zentral für diese Erkundung ist die Figurenzeichnung. Jim Hawkins erzählt überwiegend in der Ich-Form und führt uns mit jugendlicher Klarheit in Gefahren und Selbstzweifel. Ihm gegenüber steht Long John Silver, eine der großen Schöpfungen der Weltliteratur: freundlich, wendig, geschickt im Umgang mit Worten und zugleich undurchschaubar in seinen Zielen. Arzt und Gutsbesitzer bilden Gegenpole von Vernunft und Tatendrang, der Kapitän steht für professionelle Strenge. Dieses Ensemble erlaubt es Stevenson, Moral als Aushandlung zu zeigen, nicht als Dogma, getragen von Charme, Furcht und Gelegenheit.
Auch stilistisch überzeugt das Buch. Die Sprache ist knapp und anschaulich, reich an Bildern, die das Meer, die Küsten und das Leben an Bord plastisch machen. Stevenson beherrscht die Kunst des Szenenwechsels: ruhige Vorbereitung, plötzliche Zuspitzung, konzentrierte Konsequenzen. Gelegentlich wird die Ich-Erzählung durch eine zweite Stimme ergänzt, was den Blick erweitert und das Geschehen ordnet. Die Dialoge treiben die Handlung voran und verraten zugleich Absichten. So entsteht eine dramaturgische Ökonomie, in der kein Detail zufällig wirkt und jedes Stück Seemannsjargon zur Weltbildung beiträgt.
Die Schatzinsel hat das Bild der Piraterie in der populären Kultur nachhaltig geprägt. Der einbeinige Seemann mit Krücke, der sprechende Papagei, die Karte mit dem markierten Fundort, das drohende Zeichen der Verdammung und das Gemisch aus Kameradschaft und Verrat entstammen nicht ausschließlich, aber maßgeblich dieser Erzählkunst. Seit dem späten 19. Jahrhundert hallt der Roman in unzähligen Filmen, Hörspielen, Bühnenstücken, Comics und Spielen nach. Er liefert Archetypen, aber keine Schablonen: Die Figuren bleiben ambivalent genug, um Neuinterpretationen anzuregen und verschiedene Zeiten in ihnen wiederzuerkennen.
Als Klassiker behauptet sich das Werk zudem, weil es beide Lesergruppen ernst nimmt: junge Menschen, die Abenteuer suchen, und Erwachsene, die über Motive und Konsequenzen nachdenken. Es ist ein Buch über Initiative und Grenzen, über Vertrauen in sich selbst und die Notwendigkeit, Hilfe anzunehmen. Seine klare Konstruktion erlaubt spannungsgeladenes Lesen, doch zwischen den Zeilen entstehen Fragen, die über die Lektüre hinausreichen. Diese Balance, verbunden mit stilistischer Präzision, hat der Schatzinsel einen festen Platz im Kanon der Weltliteratur gesichert.
Diese zweisprachige illustrierte Ausgabe bietet eine besondere Leseerfahrung. Der parallele Abdruck von Deutsch und Englisch lädt dazu ein, Stevensons Tonfall unmittelbar zu prüfen, Nuancen von Wortwahl und Rhythmus zu vergleichen und idiomatische Wendungen nachzuvollziehen. Für Lernende eröffnet sich ein natürliches, motivierendes Umfeld; für Literaturfreunde entsteht ein Labor, in dem Übersetzungsentscheidungen sichtbar werden. Die Gegenüberstellung schärft den Blick für stilistische Mittel und schult das Ohr für Klang und Tempo, ohne den Fluss der Erzählung zu stören.
Die Illustrationen unterstützen diese Erfahrung, indem sie Atmosphäre und Topografie des Romans verdichten. Sie veranschaulichen nautische Begriffe, Ausrüstung und Gestik der Figuren, erleichtern das Erinnern von Details und geben Orientierung, wo Karten, Küstenlinien und Deckszenen eine Rolle spielen. Bilder fördern das Verständnis bei jüngeren Lesern und bieten älteren eine neue Perspektive auf vertraute Passagen. In Verbindung mit dem zweisprachigen Text entsteht ein vielschichtiges Erfahrungsfeld, das das Sehen, Hören und innere Mitreisen verbindet und die Welt des Buches lebendig und zugänglich macht.
Warum die Schatzinsel heute noch gilt, liegt auf der Hand: Sie erzählt von Orientierung in unübersichtlichen Zeiten. In einer Welt, in der Verlockungen nahe und Wahrheiten umkämpft sind, fragt der Roman nach Charakter, Urteilskraft und Zivilcourage. Er zeigt, dass Erwachsenwerden kein geradliniger Marsch ist, sondern ein Navigieren zwischen Strömungen. Seine zeitlosen Qualitäten liegen in Klarheit, Tempo und Menschenkenntnis. Wer diese Reise antritt, begegnet nicht nur Piraten und Stürmen, sondern der eigenen Bereitschaft, Stand zu halten, ohne die Neugier auf die weite See zu verlieren.
Synopsis
Robert Louis Stevensons Die Schatzinsel ist eine rasante Abenteuergeschichte, erzählt aus der Rückschau des jungen Jim Hawkins. Zu Beginn arbeitet Jim im Küstengasthaus seiner Eltern, als ein geheimnisvoller, furchterregender Seemann auftaucht. Dessen Vergangenheit zieht ungebetene Besucher an und eskaliert in einem gewaltsamen Zwischenfall, der Jim und seine Vertrauten auf eine Spur setzt: In einer Truhe findet sich eine Karte, die auf eine Insel mit vergrabener Beute verweist. Aus dem Alltag eines Wirtshauses wird unvermittelt eine Reisevorbereitung. Der Fund weckt Hoffnungen, aber auch Begehrlichkeiten, und legt den Grundkonflikt offen zwischen Pflichtgefühl, Abenteuerlust und der verlockenden Macht des Goldes.
Der wohlhabende Landedelmann Squire Trelawney und der besonnene Dr. Livesey organisieren eine Expedition, chartern ein Schiff und stellen eine Mannschaft ein. Der erfahrene Captain Smollett signalisiert früh seine Sorge über das Ziel der Reise und die Zuverlässigkeit der Crew. In der Hafenstadt begegnet Jim dem Schiffskoch Long John Silver, dessen offene Freundlichkeit und Energie Vertrauen erwecken. Zugleich deuten kleine Unstimmigkeiten, verschlüsselte Zeichen und vertrauliche Treffen darauf hin, dass unter der Oberfläche andere Loyalitäten wirken. Stevenson führt hier ein zentrales Spannungsfeld ein: die Verführungskraft charismatischer Führung und die Frage, wem man unterwegs glauben darf.
Auf See verdichtet sich die Atmosphäre. Die Hispaniola nimmt Kurs auf unbekannte Gewässer, die Disziplin wird getestet, und Rivalitäten flammen auf. In einem prägnanten Wendepunkt belauscht Jim zufällig ein Gespräch, das eine geplante Meuterei nahelegt. Diese Entdeckung verändert seine Rolle: Vom passiven Beobachter wird er zum Akteur, der Information abwägen, Vertrauen dosieren und Entscheidungen verschieben muss. Der Captain und die Loyalen stehen einem Gegner gegenüber, der Geduld, List und Überraschung bevorzugt. Die Fahrt wird zur Nervenprobe, in der Timing und Schweigen ebenso wichtig sind wie Mut und Navigationskunst.
Die Ankunft auf der titelgebenden Insel verschärft die Konflikte. Die Gruppe zerfällt in verfeindete Lager; die Küstenlinie, Mangrovensümpfe und Hügel werden zum Schauplatz verdeckter Manöver. Die Loyalen verschanzen sich in einer improvisierten Blockhütte, während Long John Silver seine Gefolgsleute mit Versprechen, Drohungen und Augenmaß zusammenhält. Skirmishes entbrennen, Positionen wechseln, und die Landschaft – mit ihren Pfaden, Sümpfen und Buchten – wird selbst zu einer Figur, die Möglichkeiten bietet und Fallen stellt. Die Jagd nach der Beute ist inzwischen untrennbar mit Fragen der Führung, Ausdauer und Einschätzung des Gegners verwoben.
Im Schatten dieser Auseinandersetzungen löst sich Jim erneut vom Schutz der Gruppe und unternimmt eine eigenständige Erkundung. Dabei trifft er auf einen seit Jahren gestrandeten Mann, dessen Erfahrungen ein anderes Licht auf die Geschichte der Insel werfen. Aus Andeutungen formt sich das Bild früherer Unternehmungen, gescheiterter Erwartungen und der unerbittlichen Logik des Überlebens. Für Jim wird der Gesprächspartner zu einer Quelle praktischer Hinweise und zugleich zu einem Spiegelbild dessen, was Habgier und Isolation aus Menschen machen können. Diese Begegnung erweitert die Perspektive des Romans von der aktuellen Gefahr hin zur langen Vorgeschichte des Schatzes.
Parallel dazu setzt sich das strategische Ringen fort. Dr. Livesey verkörpert rationale Vorsicht und medizinische Verantwortung, während Captain Smollett auf klare Befehlswege und Festigkeit pocht. Squire Trelawney muss seine anfängliche Unerfahrenheit korrigieren. Long John Silver verhandelt, droht und gewinnt Zeit – ein Antagonist, dessen Ambivalenz das moralische Koordinatensystem verschiebt. Symbolische Praktiken der Piraten, etwa die Androhung des schwarzen Symbols der Ächtung, markieren den inneren Zusammenhalt der Gegenseite. Es entstehen Zwischenspiele mit Gefangennahmen, Ultimaten und taktischen Rückzügen, die das Blatt mehrfach zu wenden scheinen, ohne eine endgültige Entscheidung herbeizuführen.
Ein Teil der Spannung verlagert sich zurück aufs Meer. Das Schiff selbst wird zum umkämpften Objekt, denn wer die Hispaniola kontrolliert, hält den Schlüssel zur Heimkehr und zur Beute. Jim gerät in Situationen, die ihn zu raschem, eigenverantwortlichem Handeln zwingen. Die Erzählung verdichtet sich hier zu maritimen Episoden aus Kletterpartien, knappen Ausweichmanövern und Zweikämpfen, in denen Geschick und Zufall nah beieinander liegen. Stevenson balanciert Abenteuerlust mit Gefahrensinn: Die Risiken sind konkret, die Folgen spürbar, doch der Ausgang bleibt bis zuletzt unsicher. Jims Mut gewinnt Kontur, ohne Unverwundbarkeit zu suggerieren.
Im Schlussabschnitt rückt die Karte wieder ins Zentrum. Hinweise müssen präzise gedeutet, Wege neu vermessen und Erwartungen neu justiert werden. Die Suche nach dem eigentlichen Ziel führt durch vertrautes Gelände, das sich unter neuer Perspektive verändert zeigt. Begegnungen zwischen den Lagern bleiben spannungsvoll und von taktischen Gesten geprägt; zeitweilige Übereinkünfte stehen neben heimlichen Manövern. Stevenson hält die Balance zwischen Enthüllung und Verzögerung und lässt zentrale Figuren ihr Verhältnis zueinander neu bestimmen. Der Roman steuert auf eine Entscheidung zu, in der Klugheit und Charakterstärke ebenso zählen wie Glück, ohne die endgültige Auflösung vorwegzunehmen.
Die Schatzinsel ist mehr als eine Piratengeschichte. Der Roman verhandelt Reife, Loyalität und Verführung durch Reichtum, zeigt die Anziehungskraft von Abenteuer und die Zwiespältigkeit charismatischer Führung in der Figur Long John Silver. Jim Hawkins’ Entwicklung eröffnet ein Nachdenken über Verantwortung und Urteilskraft in unsicheren Lagen. Zugleich prägt die klare, anschauliche Erzählweise das Bild von Seefahrt, Kameradschaft und Gier für Generationen. In einer zweisprachigen, illustrierten Ausgabe tritt die sprachliche Gestaltung deutlicher hervor und erleichtert den Zugang. Nachhaltig bleibt die Einsicht, dass wahres Gewinnen selten nur im Finden von Gold besteht.
Historischer Kontext
Die erzählte Welt von Die Schatzinsel ist in einer maritimen Ordnung des frühen bis mittleren 18. Jahrhunderts verankert, als die Seewege des Atlantiks entscheidend für Handel, Krieg und Kommunikation waren. Britische und spanische Imperien, die Royal Navy und koloniale Verwaltungen prägten die Küsten des sogenannten Spanish Main. Hafenstädte, Werften und Navigationsschulen bildeten das institutionelle Rückgrat. In Wirtshäusern, Kontoren und unter Seefahrern zirkulierten Gerüchte über geraubte Edelmetalle und vergrabene Beute. Diese Rahmenbedingungen bilden den Resonanzraum des Romans, dessen Figuren zwischen imperialen Ansprüchen, kommerziellen Interessen und der rauen Selbstorganisation von Schiffsgemeinschaften agieren, ohne dass der Text genaue Jahreszahlen festlegt.
Ein wesentlicher historischer Hintergrund ist die Golden Age of Piracy, etwa von den 1690er bis in die 1730er Jahre. In dieser Zeit entstanden berüchtigte Seeräuberzentren, schwankende Allianzen zwischen Freibeutern und Kronen sowie überlieferte Bräuche der Piratenökonomie. Der Roman greift diese Welt auf, wenn auch mit einer gewissen zeitlichen Distanz, und verwandelt sie in Abenteuererzählung. Die Piraten im Buch, obschon fiktiv, spiegeln real dokumentierte Praktiken: wechselnde Loyalitäten, Gewalt als Mittel der Disziplinierung und die Hoffnung auf einen großen Coup. Die spätere energische Verfolgung durch europäische Mächte verleiht der Erzählung zugleich einen Hauch von Endzeitstimmung.
Die ökonomische Imagination kreist um spanische Silber- und Goldströme aus Amerika. Die Schatzflotten, die über die Karibik nach Europa segelten, schufen seit dem 16. Jahrhundert einen Mythos des leicht zu raubenden Reichtums. Tatsächlich wurde Beute selten vergraben; bekannt ist vor allem die Legende um Captain Kidds angebliche Depots um 1699. Der Roman nutzt diesen Mythos und macht ihn ikonisch, insbesondere durch die Ausdeutung der Schatzkarte, auf der ein X den Ort markiert. Historisch gereift, aber im 19. Jahrhundert literarisch zugespitzt, kommentiert diese Fiktion die Sehnsucht nach plötzlichem Wohlstand in einer Welt regulierter, oft riskanter Fernhandelswege.
Technisch wird eine Segelära beschworen, in der Schiffe wie Schoner und Briggs den Atlantik befuhren. Navigationsverfahren mit Quadrant oder Sextant und, ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, der Marinechronometer erhöhten die Präzision auf See. Feuerwaffen waren zumeist Steinschlossmodelle, und Krankheiten wie Skorbut beeinträchtigten die Tauglichkeit der Mannschaften, bis medizinische Erkenntnisse im späten 18. Jahrhundert Gegenmittel etablierten. Der Roman streift solche Realien, ohne sie zu einem Lehrbuch zu machen, und nutzt sie, um eine glaubhafte Erfahrungswelt zu erzeugen: das Knarren der Planken, die Abhängigkeit vom Wind, die fragile Ordnung an Bord und die allgegenwärtige Gefahr.
Die frühe Handlung an der Küste Englands erinnert an reale Routen von Schmugglern und Küstenschiffern. Im 18. Jahrhundert florierte illegaler Handel entlang der West- und Südküste Britanniens, begünstigt durch Zölle, Kriegslagen und unübersichtliche Buchten. Wirtshäuser dienten als Umschlagpunkte für Nachrichten, Heuerung und verdeckte Geschäfte. Der Roman spiegelt diese Milieus, indem er eine soziale Durchlässigkeit zeigt, in der Matrosen, Gutsbesitzer, Ärzte und Wirtsleute unvermittelt aufeinandertreffen. Das Lokalkolorit verankert die globale Erzählung im Alltag einer Küstenregion, deren Ökonomie von Wind, Wetter und staatlicher Fiskalpolitik gleichermassen abhängt.
Piraten galten historisch nicht nur als Räuber, sondern als Gemeinschaften mit eigenen Regeln. Zeitgenössische Berichte wie A General History of the Pyrates von 1724 schilderten Artikel der Übereinkunft, Wahl von Offizieren, Verteilung der Beute und harte Strafen bei Verstößen. Der Roman greift Elemente dieser Überlieferung auf, etwa die kollektive Entscheidungskultur einer Bande und symbolische Sanktionen. Er dramatisiert dabei eine bekannte Spannung: die Verheißung egalitärer Ordnung gegenüber der brutalen Realität der Gewaltökonomie. Dass solche Strukturen literarisch zugespitzt werden, mindert nicht ihre historische Verwurzelung in dokumentierten Praktiken der Seefahrtsunterwelt.
Die staatliche Antwort auf Seeraub schuf ein eigenes Feld von Recht und Ritual. Admiralty Courts verhandelten Fälle rasch, und Exekutionen – in London etwa am Execution Dock in Wapping – hatten den Charakter öffentlicher Abschreckung. Gesetzesverschärfungen am Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts sowie eine zunehmend professionelle Royal Navy verringerten die Bewegungsfreiheit der Piraten. Der schwarze Flaggenkodex, später als Jolly Roger ikonisiert, sollte ebenso Furcht säen wie Kapitulationsbereitschaft beschleunigen. Diese historische Inszenierung von Macht und Gegenmacht hallt im Roman nach, der die politische Theatralik des Meereskriegens in seine Handlung einbettet.
Der Autor Robert Louis Stevenson wurde 1850 in Edinburgh geboren und entstammt einer Familie renommierter Leuchtturmbauer. Sein Weg führte von technischen und juristischen Studien zur Literatur, begleitet von chronischer Krankheit und Reisen auf der Suche nach milderem Klima. Diese Lebensumstände schärften seinen Blick für Grenzräume und Übergänge – geographisch, sozial, moralisch. Seine Kenntnis der Seefahrtswelt war literarisch und historisch vermittelt, nicht professionell-maritim, doch er verband akribische Lektüre mit anschaulicher Darstellung. Die Distanz des gebildeten Beobachters erlaubt ihm, heroische Klischees zu unterlaufen und zugleich die Suggestivkraft maritimer Abenteuer zu nutzen.
Die Entstehungsgeschichte ist gut dokumentiert. 1881 zeichnete Stevenson für seinen Stiefsohn eine Schatzkarte; daraus erwuchs die Handlung, die er im selben Jahr im schottischen Braemar zu Papier brachte. Die erste Veröffentlichung erfolgte 1881–1882 als Fortsetzungsroman in der Jugendzeitschrift Young Folks unter dem Pseudonym Captain George North. 1883 erschien die Buchausgabe bei Cassell in London. Diese Publikationswege spiegeln die viktorianische Kultur serieller Unterhaltung, in der abschließende Buchausgaben dem erfolgserprobten Stoff rasch folgten. Gleichzeitig zeigen sie, wie Kinder- und Jugendlektüre eine Brücke in den allgemeinen Literaturmarkt bildete.
Die viktorianische Lesekultur bot dem Werk einen fruchtbaren Boden. Bildungsreformen, insbesondere in den 1870er Jahren, erhöhten die Alphabetisierung und schufen eine breite Leserschaft für preiswerte Magazine. Abenteuererzählungen für Jugendliche zirkulierten neben moralisch-erzieherischer Literatur. Stevenson positionierte sich im zeitgenössischen Debattenfeld zwischen Realismus und Romanze und verteidigte die imaginative Erzählung mit ethischem Kern. Die Schatzinsel verband rasches Erzählen, klare Figurenkontraste und ambivalente Motive. Diese Balance bediente die Nachfrage nach Spannung, ohne die moralischen Grauzonen einer global vernetzten, von Risiken geprägten Moderne zu verschweigen.
Die geopolitische Gegenwart der 1880er Jahre war von imperialer Konkurrenz und maritimer Selbstvergewisserung Großbritanniens geprägt. Seemacht galt als Garant für Handelssicherheit und nationale Größe. Obwohl die Handlung historisch zurückgreift, resoniert sie mit dieser Gegenwart: die Sehnsucht nach fernen Küsten, die Sorge vor Meuterei und Verrat, die Frage nach der Legitimität von Gewalt zur Sicherung von Ordnung. Der Roman inszeniert koloniale Räume weniger direkt als andere Zeitgenossen, aber seine Bilder von Inseln, Karten und Transitpunkten fügen sich in die viktorianische Vorstellungswelt, in der die See zugleich Handelsroute, Risiko und moralischer Prüfstein ist.
Ökonomisch rahmt der transatlantische Handel die Imagination von Beute und Wert. Zucker, Tabak, Rum, Metalle und menschliche Arbeitskraft bildeten ein verflochtenes System, dessen Profite und Grausamkeiten weithin bekannt waren. Der Roman erwähnt Sklaverei nicht ausführlich, doch das Bild des Spanish Main ruft eine Kolonialökonomie auf, in der Reichtum aus Zwang und Extraktion gewonnen wurde. Für zeitgenössische Leser war diese Verbindung nicht unsichtbar. Die Erzählung nutzt daher eine historische Atmosphäre, in der die Jagd nach dem Schatz auch als Kommentar zur Herkunft von Vermögen verstanden werden kann – als moralisch zweideutige Verheißung schnellen Gewinns.
Die kulturellen Zeichen der Piratenwelt verdichtet der Roman wirkungsmächtig. Der Ruf Yo-ho-ho and a bottle of rum und das Motiv der Dead Man’s Chest verknüpfen literarische Erfindung mit einem real existierenden Eilandnamen in den Britischen Jungferninseln, der im 19. Jahrhundert in Reiseberichten zirkulierte. Papageien, Augenklappen und die Formel Stücke von acht greifen historische Objekte wie den spanischen Peso auf, zugleich werden sie zu literarischen Emblemen. Der Roman trug wesentlich dazu bei, diese Zeichen im populären Gedächtnis zu fixieren, ohne die Vielfalt realer Flaggen, Dialekte und Lebensläufe der historischen Piratenwelt vollständig abzubilden.
Das Kartenmotiv steht im Zentrum einer weiteren historischen Resonanz. Die britische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war von Kartografie fasziniert: Landesaufnahmen, Seekarten, Schulatlanten und Expeditionsberichte prägten den Blick. Gedruckte Karten wurden durch verbesserte Holzstiche und Dampfdruckpressen massenhaft verbreitet. Stevensons Schatzkarte, die dem Text als visuelles Leitobjekt eingeschrieben ist, knüpft daran an. Spätere illustrierte Ausgaben – besonders prägend wurde die Bildwelt des frühen 20. Jahrhunderts, etwa in den USA – setzten diese Tradition fort. So wird die Verbindung von Text und Bild Teil der Rezeptionsgeschichte, die das Abenteuer anschaulich verortet.
Disziplin und Meuterei bilden ein historisch sensitives Spannungsfeld. Auf Handels- und Kriegsschiffen existierten strikte Hierarchien; Verstöße wurden hart bestraft. Zugleich sind aus dem späten 18. Jahrhundert bedeutende Meutereien überliefert, die Missstände offenlegten. Der Roman projiziert diese Konflikte auf ein kleineres Schiff, wodurch Klassen- und Erfahrungsunterschiede sichtbar werden: der wohlhabende Gutsbesitzer, der aufgeklärte Arzt, die erfahrenen Seeleute. Medizin, Vernunft und Lokalautorität stehen gegen Improvisation, Aberglauben und rohe Gewalt. Diese Konstellation spiegelt zeitgenössische Debatten um Führung, Meritokratie und die Grenzen paternalistischer Ordnung.
Die Rezeptionsgeschichte im deutschsprachigen Raum setzt im späten 19. Jahrhundert ein, als Übersetzungen britischer Abenteuergeschichten verbreitet wurden. Im Kaiserreich trafen maritime Stoffe auf ein wachsendes Interesse an Seehandel und Flotte. Illustrierte Ausgaben erleichterten den Zugang und prägten die Bildwelt der Leser. Bilinguale Editionen, wie die hier genannte, stehen in einer didaktischen Tradition, die Spracherwerb mit Literaturgenuss verbindet. Sie verweisen zugleich darauf, wie international dieses Werk rezipiert wurde: Ein britischer Roman über die Karibik, gelesen und neu bebildert in unterschiedlichen Kulturen, die ihre je eigenen historischen Erfahrungen mit Seefahrt einbringen.
Schließlich kommentiert Die Schatzinsel die eigene Zeit, indem es historische Ferne und gegenwärtige Fragen verschränkt. Es feiert nicht schlicht imperialen Wagemut, sondern zeigt die Ambivalenz von Loyalität, Gier und Gerechtigkeit. Die Verheißung des Goldes wird durch Krankheit, Betrug und moralische Prüfungen relativiert. Der Arzt als Stimme vernünftiger Ordnung, der Squire als Figur sozialer Privilegien und der jugendliche Erzähler als Lernender erzeugen ein Spannungsfeld, in dem Abenteuer nicht als moralischer Freibrief gilt. So wird das Buch zu einer Reflexion über Anziehungskraft und Kosten des Unternehmergeistes – damals wie heute.
Autorenbiografie
Robert Louis Stevenson (1850–1894) war ein schottischer Romancier, Essayist, Reiseautor und Lyriker der späten viktorianischen Epoche. Mit seiner geschmeidigen Prosa, spannungsreichen Stoffen und klarem Sinn für erzählerische Ökonomie prägte er Abenteuer- und Unterhaltungsliteratur nachhaltig. International bekannt wurde er durch erzählerische Werke, die psychologische Fragen, Moral und Identität in zugänglichen Formen verhandeln. Seine Bücher erreichten schon zu Lebzeiten ein großes Publikum und beeinflussten nachfolgende Generationen von Autorinnen und Autoren in verschiedenen Sprachen. Als Grenzgänger zwischen Genres verband er Reiseliteratur, Essayistik, Lyrik und Roman, wodurch sein Werk bis heute im Kanon britischer Literatur präsent bleibt.
Geboren in Edinburgh, studierte Stevenson zunächst Bauingenieurwesen an der University of Edinburgh, wechselte dann zur Rechtswissenschaft und wurde in den frühen 1870er-Jahren als Anwalt zugelassen, ohne den Beruf auszuüben. Wichtige prägende Einflüsse waren die schottische Erzähltradition, insbesondere Sir Walter Scott, sowie englische Prosavorbilder wie Daniel Defoe. Früh engagierte er sich in literarischen Zirkeln und veröffentlichte Essays über Stil und Erzählkunst. Eine bedeutende akademische Bezugsperson war der Ingenieur und Professor Fleeming Jenkin, dem Stevenson später eine biografische Studie widmete. Freundschaften mit Autorinnen und Autoren wie Henry James schärften seinen Blick für Form, Ton und die Kunst des realistischen Erzählens.
In den späten 1870er-Jahren etablierte sich Stevenson zunächst als Reiseautor. An Inland Voyage (1878) schildert eine Bootsfahrt durch Belgien und Nordfrankreich; Travels with a Donkey in the Cévennes (1879) verbindet Landschaftsbeobachtung mit Selbstreflexion. Parallel profilierte er sich als Essayist mit Virginibus Puerisque (1881) und Familiar Studies of Men and Books (1882), die seinen Stilwillen, seine Ironie und sein Interesse an literarischer Tradition zeigen. Diese frühen Texte festigten seinen Ruf als präziser Beobachter und technisch versierter Prosaist, der Erzählrhythmus, Satzmelodie und Perspektive bewusst gestaltet und dadurch alltäglichen Stoffen erzählerische Spannung und intellektuelle Tiefe verlieh.
Den internationalen Durchbruch brachte Treasure Island (1883), ein Musterbeispiel ökonomischer, spannungsgetriebener Erzählkunst, das das Seeabenteuer neu definierte. Kurz darauf veröffentlichte Stevenson den Lyrikband A Child’s Garden of Verses (1885), dessen klare Sprache und musikalischer Ton Kinder- und Erwachsenenpublikum gleichermaßen erreichten. Mit Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) verdichtete er Fragen nach Persönlichkeit, Verantwortung und gesellschaftlicher Fassade in eine prägnante Novelle, die sofort breite Resonanz fand. Im selben Jahr erschien Kidnapped, ein historischer Roman aus Schottland, der Tempo, Landschaftsbeschreibung und Dialogkunst verband und Stevensons Stellung im literarischen Leben festigte.
Die späten 1880er-Jahre brachten eine Reihe weiterer viel gelesener Titel. Unterwoods (1887) und Ballads (1890) erweiterten sein lyrisches Profil. The Black Arrow (1888) bediente das historische Abenteuer, während The Master of Ballantrae (1889) psychologische und historische Elemente kunstvoll verschränkte. In Zusammenarbeit mit seinem Stiefsohn Lloyd Osbourne entstanden The Wrong Box (1889), The Wrecker (1892) und The Ebb-Tide (1894), die humoristische Satire, Kriminal- und Südsee-Stoffe variierten. Die Erzählung The Beach of Falesá (1892) steht für eine zunehmend kritische Darstellung kolonialer Kontaktzonen und zeigt, wie Stevenson seine Stoffwahl und Perspektive an neue geographische Erfahrungsräume anpasste.
Stevensons anhaltende gesundheitliche Probleme beförderten weite Reisen: über den Atlantik in die Vereinigten Staaten und weiter in den Pazifik. Anfang der 1890er-Jahre ließ er sich auf Samoa nieder, arbeitete produktiv und beobachtete aufmerksam die kolonialpolitische Lage. Sein Sachbuch A Footnote to History (1892) kommentierte die politischen Verwicklungen der Region. Literarisch entstanden in dieser Phase unter anderem Island Nights’ Entertainments (1893) und der Fortsetzungsroman Catriona (1893). Reise- und Erfahrungsberichte aus der Südsee wurden teils erst nach seinem Tod ediert, darunter In the South Seas (1896) und die Vailima Letters (1895), die Werkstatt und Alltag dokumentieren.
Stevenson starb 1894 in Vailima auf Samoa und wurde auf dem nahegelegenen Mount Vaea beigesetzt. Sein Ansehen schwankte im 20. Jahrhundert, erfuhr jedoch anhaltende Erneuerung durch Editionsprojekte, biografische Studien und eine wachsende Wertschätzung seiner Prosakunst, Dialogtechnik und Motivökonomie. Seine Erzählweisen prägen bis heute Abenteuer- und Spannungsprosa, und zahlreiche Bühnen-, Film- und Hörspielbearbeitungen halten seine Stoffe im kulturellen Gedächtnis präsent. Auch seine Essays bleiben im Druck und werden breit gelesen. In der schottischen und anglophonen Literaturgeschichte gilt er als stilistisch souveräner Erzähler, dessen Werk zwischen Unterhaltung und formbewusster Kunst vermittelt und so die Entwicklung moderner populärer Erzählformen spürbar mitgestaltet hat.
Die Schatzinsel / Treasure Island - Zweisprachige illustrierte Ausgabe (Deutsch-Englisch) / Bilingual Illustrated Edition (German-English)
Die Schatzinsel
Inhalt
Inhaltsverzeichnis / Table of Contents
Inhaltsverzeichnis
Teil I. Der alte Freibeuter
Kapitel 1 – Der alte Seehund im »Admiral Benbow«
GUTSHERR TRELAWNEY, Dr. Livesey und die übrigen Herren haben mich gebeten, unsere Fahrt nach der Schatzinsel vom Anfang bis zum Ende zu beschreiben, und dabei nichts zu verschweigen als die genaue Lage der Insel, und zwar auch dies nur deshalb, weil noch jetzt ungehobene Schätze dort vorhanden sind. So ergreife ich die Feder in diesem Jahre des Heils 17.. und versetze mich zurück in die Zeit, als mein Vater den Gasthof zum »Admiral Benbow« hielt, und als der braungebrannte alte Seemann mit der Säbelnarbe im Gesicht zuerst unter unserem Dache Wohnung nahm.
Ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre, des Mannes: wie er in die Tür unseres Hauses hereinkam, während seine Schifferkiste ihm auf einem Schiebkarren nachgefahren wurde – ein grosser, starker, schwerer, nussbrauner Mann; sein teeriger Zopf hing ihm im Nacken über seinen fleckigen blauen Rock herunter; seine Hände waren schwielig und rissig mit abgebrochenen, schwarzen Fingernägeln, und der Säbelschmiss, der sich über die eine Wange hinzog, war von schmutzig-weisser Farbe. Er sah sich im Schenkzimmer um und pfiff dabei vor sich hin, und dann stimmte er das alte Schifferlied an, das er später so oft sang:
Fünfzehn Mann bei des Toten Kist’ –[1q] Johoho, und ‘ne Buddel, Buddel Rum!
in der zitterigen, hohen Stimme, die so klang, wie wenn eine Ankerwinde gedreht würde. Dann schlug er mit einem Knüppel, so dick wie eine Handspeiche, gegen die Tür, und als mein Vater erschien, verlangte er barsch ein Glas Rum. Als dieses ihm gebracht worden war, trank er es langsam aus, wie ein Kenner, mit der Zunge den Geschmack nachprüfend, und dabei sah er sich durch das Fenster die Strandklippen und unser Wirtsschild an. Schließlich sagte er:
»Das ist ‘ne nette Bucht und ‘ne angenehm gelegene Grogkneipe. Viel Gesellschaft, Maat?«
Mein Vater sagte ihm, Gesellschaft käme leider nur sehr wenig.
»So? Na, dann ist das die richtige Stelle für mich. Heda, Ihr, mein Mann!« rief er dem Mann zu, der den Handkarren schob: »Ladet mal meine Kiste ab und bringt sie nach oben! Hier will ich ein bisschen bleiben! Ich bin ein einfacher Mann – Rum und Speck und Eier, weiter brauche ich nichts; und außerdem die Klippe da draußen, um die Schiffe zu beobachten. Wie Sie mich nennen könnten? Kaptein können Sie mich nennen. Ach so – ich sehe schon, worauf Sie hinauswollen – da!« und er warf drei oder vier Goldstücke auf den Tisch. »Wenn ich das verzehrt habe, können Sie mir Bescheid sagen!« rief er, und dabei sah er so stolz aus wie ein Admiral.
Und in der Tat – so schlecht seine Kleider waren und so gemein seine Sprechweise, er sah durchaus nicht wie ein Mann aus, der vor dem Mast fuhr, sondern war offenbar ein Steuermann oder ein Schiffer, der gewohnt war, dass man ihm gehorchte, oder sonst gab’s Prügel. Der Mann, der den Schiebkarren gefahren hatte, sagte uns, die Postkutsche hätte ihn am Tag vorher am Royal George[1] abgesetzt; er hätte sich erkundigt, was für Gasthöfe an der Küste wären, und als er gehört hätte, dass man unser Haus lobte, – und besonders, so vermute ich wenigstens, als man es ihm als einsam gelegen beschrieb – hätte er beschlossen, bei uns Aufenthalt zu nehmen. Und das war alles, was wir über unseren Gast erfahren konnten.
Er war ein schweigsamer Mann. Den ganzen Tag lungerte er an der Bucht oder auf den Klippen herum und sah durch sein Messingfernrohr über See und Strand; den ganzen Abend aber saß er in einer Ecke der Schenkstube ganz dicht am Feuer und trank Rum und Wasser, und zwar eine sehr steife Mischung. Wenn jemand ihn anredete, antwortete er für gewöhnlich nicht, sondern sah nur plötzlich mit einem wütenden Blick auf und blies durch seine Nase wie durch ein Nebelhorn; und wir und unsere Besucher merkten bald, dass man ihn dann in Ruhe lassen musste. Jeden Tag, wenn er von seinen Gängen zurückkam, fragte er, ob Seeleute auf der Landstraße vorübergekommen wären. Anfangs dachten wir, er fragte, weil er sich nach Gesellschaft von Kameraden sehnte; schließlich aber merkten wir, dass er im Gegenteil es zu vermeiden wünschte. Wenn ein Seemann im »Admiral Benbow« einkehrte – wie es ab und zu geschah, wenn Leute auf der Küstenstraße nach Bristol gingen – so sah er sich ihn durch das verhängte Fensterchen in der Tür an, bevor er die Schenkstube betrat; und wenn solch ein Seemann anwesend war, verhielt er sich immer mäuschenstille. Vor mir suchte er auch kein Geheimnis aus der Sache zu machen, sondern er beteiligte mich im Gegenteil gewissermaßen an seiner Unruhe. Er hatte mich nämlich eines Tages beiseite genommen und mir versprochen: er wollte mir am Ersten jeden Monats ein silbernes Vier-Penny-Stück geben, wenn ich bloß »mein Wetterauge offen halten wollte nach einem Seemann mit nur einem Bein«, und wenn ich ihm, sobald der auftauchte, augenblicklich Bescheid geben wollte. Wenn nun der Monatserste da war und ich meinen Lohn von ihm verlangte, dann kam es oft genug vor, dass er nur durch die Nase blies und mich mit einem wütenden Blick ansah; aber bevor die Woche zu Ende war, hatte er es sich jedesmal besser überlegt: er brachte mir das Vier-Penny-Stück und wiederholte seinen Befehl, »nach dem Seemann mit dem einen Bein Ausguck zu halten«.
Wie dieser Seemann mich in meinen Träumen verfolgte, brauche ich kaum zu sagen. In stürmischen Nächten, wenn der Wind die vier Ecken unseres Hauses schüttelte und die Brandung in der Bucht gegen die Klippen donnerte, sah ich ihn in tausend Gestalten und mit tausend teuflischen Gesichtern. Bald war das Bein am Knie abgenommen, bald dicht an der Hüfte; dann wieder war er ein ungeheuerliches Geschöpf, das immer nur ein einziges Bein gehabt hatte, und zwar mitten unter dem Rumpf. Ihn zu sehen, wie er sprang und lief und mich über Gräben und Hecken verfolgte, das war für mich der fürchterlichste Nachtmahr. So musste ich eigentlich mein monatliches Vier-Penny-Stück recht teuer bezahlen, denn ich bekam dafür diese grässlichen Traumgesichte in den Kauf.
Wenn ich vor dem einbeinigen Seemann eine schreckliche Angst hatte, so hatte ich dafür vor dem Kaptein selber weniger Furcht als andere, die ihn kannten. An manchen Abenden nahm er mehr Rum und Wasser zu sich, als sein Kopf vertragen konnte; dann saß er zuweilen, ohne sich um irgendeinen Menschen zu bekümmern, und sang seine ruchlosen alten wilden Schifferlieder; zuweilen aber bestellte er Runden und zwang die ganze zitternde Gesellschaft, seine Geschichten anzuhören oder als Chor in seine Lieder einzufallen. Oft zitterte das Haus von dem »Johoho, und ‘ne Buddel, Buddel Rum«; alle Nachbarn stimmten aus voller Kehle ein, mit einer Todesangst im Leibe, und einer sang noch lauter als der andere, damit nur der Kaptein keine Bemerkungen machte. Denn wenn er diese Anfälle hatte, war er der ungemütlichste Gesellschafter von der Welt; dann schlug er mit der Faust auf den Tisch und gebot Ruhe; wenn irgendeine Zwischenfrage gestellt wurde, regte er sich fürchterlich auf – manchmal aber noch mehr, wenn keine Frage gestellt wurde, weil er dann glaubte, die Gesellschaft hörte nicht auf seine Geschichte. An solchen Abenden durfte keiner die Schenkstube verlassen, bis er selber vom Trinken schläfrig geworden war und ins Bett taumelte.
Am meisten Angst machte er den Leuten mit seinen Geschichten. Und fürchterliche Geschichten waren es allerdings: von Hängen, über die Planke gehen lassen, von Stürmen auf hoher See, und von den Schildkröteninseln, und von wilden Gefechten und Taten, und von Häfen in den westindischen Gewässern. Nach seinen eigenen Berichten musste er unter den größten Verbrechern gelebt haben, die Gott jemals zur See gehen ließ; und die Worte, in denen er diese Geschichten erzählte, entsetzten unsere guten Landleute beinahe ebensosehr wie die Verbrechen, von denen sie handelten. Mein Vater sagte fortwährend: unser Gasthof werde zugrunde gerichtet werden, denn die Leute würden bald nicht mehr kommen, um sich anschnauzen und niederducken zu lassen und dann mit zitternden Gebeinen zu Bett zu gehen. Aber ich glaube, dass in Wirklichkeit seine Anwesenheit uns Vorteil brachte. Die Leute grauelten sich allerdings, aber in der Rückerinnerung hatten sie die Geschichten eigentlich gern; es war eine angenehme Aufregung in ihrem stillen Landleben. Unter den jüngeren Leuten gab es sogar eine Partei, die voll Bewunderung von ihm sprach. Sie nannten ihn »einen echten Seehund« und »eine richtige alte Teerjacke« und so ähnlich und sagten, das wären gerade die Leute, die England so gefürchtet zur See machten. In einer Beziehung richtete allerdings der Kaptein uns zugrunde: er blieb eine Woche nach der anderen, so dass die Goldstücke, die er auf den Tisch geworfen hatte, längst verrechnet waren; aber mein Vater konnte sich niemals ein Herz fassen und mehr Geld von ihm verlangen. Sobald er eine leichte Anspielung machte, blies der Kaptein so laut durch die Nase, dass es beinahe ein Brüllen war, und sah meinen Vater so wütend an, dass dieser die Schenkstube verließ. Ich habe ihn nach solcher Abweisung die Hände ringen sehen, und ich bin überzeugt, dass der Verdruss über seinen Gast und die Angst, worin er lebte, seinen allzu frühen unglücklichen Tod sehr beschleunigt haben.
Während der ganzen Zeit, dass der Kaptein bei uns wohnte, trug er immer denselben Anzug; niemals änderte er etwas daran, nur einmal kaufte er Strümpfe von einem Hausierer. Als eine von den Krempen seines Hutes sich losgelöst hatte und herunterhing, ließ er ihn so, wie er war, obwohl diese Krempe ihn bei starkem Wind sehr belästigte. Ich sehe vor meinen Augen noch seinen Rock, auf den er selber oben in seinem Zimmer einen Flicken setzte, sooft er das für nötig hielt; schließlich bestand der ganze Rock nur aus Flicken. Niemals schrieb er einen Brief, niemals empfing er einen; er sprach mit keinem Menschen ein Wort außer mit den Nachbarn, die zu uns in die Wirtschaft kamen, auch mit diesen gewöhnlich nur, wenn er zuviel Rum getrunken hatte. Seine grosse Schifferkiste hatte keiner von uns jemals offen gesehen.
Nur ein einziges Mal wagte ein Mensch, ihm über den Mund zu fahren, und das geschah erst in der letzten Zeit, als mein armer Vater schon sehr krank und dem Tode nahe war. Doktor Livesey kam eines Nachmittags zu später Stunde, um noch nach dem Kranken zu sehen; meine Mutter setzte ihm ein bisschen zu essen vor, und dann ging er in die Schenkstube, um eine Pfeife zu rauchen, bis sein Pferd vom Dorf zurückgebracht würde; denn wir hatten im alten »Admiral Benbow« keine Stallung. Ich ging mit dem Doktor in die Schenkstube, und ich erinnere mich noch, dass mir der Unterschied zwischen dem sauberen, munteren Doktor mit seiner schneeweiss gepuderten Perücke, seinen hellen, schwarzen Augen und seinem liebenswürdigen Benehmen und den plumpen Landleuten auffiel, besonders aber der Gegensatz zu dem schmutzigen, zerlumpten alten Piraten, der stark angetrunken hinter seinem Tische saß und die Ellenbogen aufgestützt hatte. Plötzlich begann er, der Kaptein nämlich, sein ewiges Lied zu brüllen:
Fünfzehn Mann bei des Toten Kist’ – Johoho, und ‘ne Buddel, Buddel Rum! Suff und der Teufel holten den Rest – Johoho, und ‘ne Buddel, Buddel Rum!
Anfangs hatte ich vermutet, »des Toten Kist’« sei die grosse Schifferkiste oben im Vorderzimmer, und ich hatte sie in meinen Träumen mit dem einbeinigen Schiffer in Verbindung gebracht. Inzwischen aber hatten wir alle schon längst aufgehört, auf sein Singen zu achten; an diesem Abend war das Lied nur dem Dr. Livesey neu, und ich bemerkte, dass es auf ihn keinen angenehmen Eindruck machte; denn er sah einen Augenblick ganz ärgerlich aus, bevor er in seinem Gespräch mit dem alten Gärtner Taylor fortfuhr, mit dem er sich über ein neues Mittel gegen das Gliederreissen unterhielt. Der Kapitän wurde bei seinem eigenen Lied lustig und schlug schließlich mit der Faust vor sich auf den Tisch; wir alle wussten, dass er damit den Anwesenden Schweigen befehlen wollte. Alle hörten sofort auf zu sprechen – mit Ausnahme des Dr. Livesey; der sprach ruhig weiter, indem er zwischen jedem zweiten oder dritten Wort einen kurzen Zug aus seiner Pfeife tat. Eine Weile starrte der Kaptein ihn an, schlug wieder mit der flachen Hand auf den Tisch, starrte ihn noch grimmiger an und schrie endlich mit einem gemeinen Fluch: »Stille da unter Deck!«
»Sagten Sie etwas zu mir, Herr?« sagte der Doktor. Und als der Kerl mit einem neuen Fluch ihm sagte, das wäre allerdings der Fall, antwortete der Arzt: »Ich habe Ihnen nur eins zu sagen, Herr: wenn Sie mit dem Rumtrinken so weiter machen, wird die Welt bald von einem sehr dreckigen Schuft befreit sein!«
Die Wut des alten Burschen war schrecklich anzusehen. Er sprang auf, zog ein Matrosen-Klappmesser, öffnete es, schwang es auf der offenen Handfläche und drohte dem Doktor, er werde ihn an die Wand spießen.
Der aber rührte sich nicht einmal. Er sprach wie bisher über die Schulter weg zum Kaptein und sagte mit der gleichen ruhigen Stimme, ziemlich laut, so dass alle im Zimmer ihn hören konnten, aber ganz gelassen: »Wenn Ihr nicht augenblicklich das Messer in die Tasche steckt, so gebe ich Euch mein Wort darauf: nach der nächsten Gerichtssitzung hängt Ihr am Galgen!«
Dann kreuzten ihre Blicke sich; aber der Kaptein gab bald klein bei, steckte seine Waffe ein und setzte sich wieder hin, wobei er wie ein geprügelter Hund knurrte.
»Und nun noch eins, mein Mann!« fuhr der Doktor fort: »Da ich jetzt weiss, dass solch ein Bursche in meinem Bezirk ist, so könnt Ihr Euch darauf verlassen, dass ich Tag und Nacht ein Auge auf Euch haben werde. Ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Beamter; und wenn ich auch nur die leiseste Beschwerde über Euch höre – wär’s auch bloß wegen einer Unhöflichkeit wie heute Abend –, so werde ich dafür zu sorgen wissen, dass man Euch an dem Kragen nimmt und abschiebt. Und damit genug!«
Bald darauf wurde Dr. Liveseys Pferd gebracht, und er ritt ab; der Kaptein aber war an diesem Abend still und tat noch viele Abende hinterher den Mund nicht auf.
Kapitel 2 – Der Schwarze Hund erscheint und verschwindet wieder
NICHT LANGE ZEIT nach diesem Auftritt trat das erste von den geheimnisvollen Ereignissen ein, die uns schließlich den Kaptein vom Halse schafften, wenn auch nicht seine Angelegenheiten, wie der Leser sehen wird.
Es war ein bitterkalter Winter mit langandauernden, harten Frösten und schweren Stürmen, und es war von Anfang an klar, dass mein armer Vater wenig Aussicht hatte, den Frühling noch zu erleben. Er wurde mit jedem Tag schwächer, und meine Mutter und ich hatten den ganzen Betrieb der Wirtschaft zu besorgen; so hatten wir immer viel zu tun und konnten uns um unseren unangenehmen Gast wenig kümmern. Es war an einem Januarmorgen, zu sehr früher Stunde. Das Wetter war beissend kalt; die ganze Bucht war grau vom Rauhreif; die Sonne stand noch niedrig und berührte nur eben die Hügelspitzen und schien weit über das Meer hinaus. Der Kaptein war früher als gewöhnlich aufgestanden und nach dem Strand hinuntergegangen; sein Stutzsäbel[2] schwang unter den breiten Schößen seines blauen Rockes hin und her, sein Messingfernrohr hatte er unter die Achsel geklemmt, den Hut in den Nacken zurückgeschoben. Sein Atem hing wie ein Rauchstreifen hinter ihm, wie er so mit langen Schritten dahinging, und der letzte Ton, den ich von ihm hörte, als er um den grossen Felsen bog, war ein lautes, entrüstetes Schnauben, wie wenn er immer noch an den Dr. Livesey dächte. Mutter war oben bei Vater, und ich war dabei, den Frühstückstisch zu decken, damit er bei der Rückkehr alles fertig fände; da ging die Tür zur Schenkstube auf, und herein trat ein Mann, den ich nie in meinem Leben gesehen hatte. Er war ein Kerl mit blassem, käsigem Gesicht; an der linken Hand fehlten ihm zwei Finger, und obgleich er einen Stutzsäbel trug, sah er nicht gerade nach einem grossen Fechter aus. Ich war immer auf dem Ausguck nach Seeleuten, einerlei ob mit einem Bein oder mit zweien, und ich erinnere mich noch heute, dass der Mann mir sofort verdächtig vorkam. Er sah nicht schiffermäßig aus, und trotzdem hatte er etwas von der See an sich.
Ich fragte ihn, was er wünschte, und er sagte, er wolle ein Glas Rum nehmen. Als ich aber hinausgehen wollte, um das Getränk zu holen, setzte er sich auf einen Tisch und winkte mir; ich möchte näher kommen. Ich blieb aber mit meinem Wischtuch in der Hand stehen, wo ich war. Da sagte er:
»Komm doch her, Jungchen! Komm doch mal näher!«
Ich trat einen Schritt näher an ihn heran.
»Ist der Tisch hier für meinen Maat Bill gedeckt?« fragte er und sah mich dabei lauernd an.
Ich sagte ihm, seinen Maat Bill kenne ich nicht, und der Tisch sei für jemand gedeckt, der in unserem Hause wohne und den wir den Kaptein nannten.
»Na,« sagte er, »mein Maat Bill wird sich wohl Kaptein nennen lassen; das sollte mich gar nicht wundern. Er hat einen Schmiss auf der einen Backe, und ein mächtig netter Kerl ist er, mein Maat Bill, besonders beim Trinken. Wir wollen mal annehmen, euer Kaptein hat einen Schmiss auf der Backe – und, was meinst du? – wir wollen mal annehmen, er hat ihn auf der rechten Backe. Aha, siehst du, ich sagte es dir ja. Na, ist also mein Maat Bill hier im Hause?«
Ich sagte ihm, er sei ausgegangen.
»Wohin denn, Jungchen? Welchen Weg ist er gegangen?«
Ich zeigte ihm den Felsen und sagte ihm, dass der Kaptein jedenfalls bald nach Hause kommen werde, und beantwortete ihm noch ein paar andere Fragen. Schließlich sagte er: »Na, da wird mein Maat Bill sich freuen wie über ein Glas Rum.«
Der Gesichtsausdruck, mit dem er diese Worte sprach, war durchaus nicht angenehm, und ich hatte meine besonderen Gründe anzunehmen, dass der Fremde sich irrte, selbst wenn seine Worte aufrichtig gemeint wären. Aber ich dachte, das ginge ja mich nichts an; außerdem war es schwierig zu entscheiden, was da zu tun sei.
Der Fremde hielt sich fortwährend dicht bei der Haustür auf und guckte alle Augenblicke um die Ecke wie eine Katze, die auf eine Maus lauert. Einmal ging ich selber auf die Straße hinaus, aber er rief mich sofort zurück, und als ich nicht schnell genug folgte, verzerrte sich sein käsiges Gesicht auf eine ganz fürchterliche Weise, und mit einem Fluch, der mir Angst machte, befahl er mir, sofort ins Haus zu gehen. Als ich aber wieder drinnen war, benahm er sich wie vorher: halb spöttisch, halb schmeichlerisch; klopfte mir auf die Schulter und sagte mir, ich sei ein guter Junge und er möchte mich riesig gerne leiden.
»Ich habe selber einen Jungen,« sagte er, »der sieht dir so ähnlich wie ein Ei dem andern und ist so recht mein Stolz. Aber die Hauptsache für Jungens ist Gehorchen – Gehorsam, Jungchen! Na, wenn du mit Bill zusammen auf See gewesen wärest, dann hättest du nicht hier gestanden und dir was zweimal sagen lassen – glaub mir das! Das gab’s bei Bill nicht, und das gibt’s auch bei denen nicht, die mit ihm gefahren sind. Und sieh mal an, da kommt ja mein Maat Bill, mit einem Fernrohr unterm Arm, der gute alte Kerl! Da wollen wir beide mal man in die Schenkstube gehen, Jungchen, und uns hinter die Tür stellen, und wollen Bill ein bisschen überraschen – die gute alte Seele!«
Mit diesen Worten ging der Fremde mit mir in die Schenkstube zurück und ließ mich hinter ihm in die Ecke treten, so dass wir beide hinter der geöffneten Türe verborgen waren. Ich fühlte mich sehr unbehaglich und unruhig, wie man sich wohl denken kann, und meine Angst wurde dadurch noch größer, dass der Fremde offenbar selber Furcht hatte. Er machte den Griff seines Stutzsäbels frei und lockerte die Klinge in der Scheide; und während der ganzen Zeit, dass wir dastanden und warteten, schluckte er fortwährend, als ob er einen Kloß in der Kehle hätte, wie man zu sagen pflegt.
Endlich trat der Kaptein ein, schlug die Tür hinter sich zu, ohne nach rechts oder nach links zu sehen, und ging quer durch das Zimmer an den Tisch, auf dem das Frühstück für ihn bereit stand.
»Bill!« sagte der Fremde mit einer Stimme, der ich deutlich anmerkte, dass er alle Kraft aufgeboten hatte, sie recht laut und kühn zu machen.
Der Kaptein drehte sich auf dem Absatz herum und sah uns an; alle braune Farbe war aus seinem Antlitz gewichen, und sogar seine Nase war blau; er sah aus wie ein Mensch, der ein Gespenst erblickt oder den Teufel oder sogar noch etwas Schlimmeres, wenn es das gibt, und auf mein Wort: es tat mir leid, wie ich ihn plötzlich so alt und krank aussehend fand.
»Nanu, Bill, du kennst mich doch; du kennst doch gewiss einen alten Schiffsmaat, Bill!« sagte der Fremde.
Der Kaptein riss den Mund auf, wie wenn er nach Luft schnappen müsste, und rief:
»Der Schwarze Hund![2q]«
»Wer denn sonst?« antwortete der andere, der sich offenbar etwas behaglicher zu fühlen begann. »Der Schwarze Hund, immer noch der alte, ist nun hier, um seinen allen Schiffskumpan Bill im ›Admiral Benbow[3]‹ zu besuchen. Oh, Bill, Bill! wir haben was durchgemacht, wir zwei, seitdem ich die beiden Greifer verlor!« Und dabei hält er die verstümmelte Hand in die Höhe.
»Na, denn hör mal zu!« sagte der Kaptein: »Du hast mich gestellt; hier bin ich. Also denn man los: was willst du?«
»Das sieht dir ähnlich, Bill!« antwortete der Schwarze Hund. »Bist immer noch der alte Billy. Ich will mir ein Glas Rum geben lassen von dem lieben Jungchen hier, der so nett ist; und dann wollen wir uns hinsetzen, wenn’s dir recht ist, und wollen ein vernünftiges Wort miteinander schnacken, als richtige alte Schiffskameraden.«
Als ich mit dem Rum wieder hereinkam, saßen sie schon an des Kapteins Frühstückstisch einander gegenüber – der Schwarze Hund nach der Tür zu und etwas seitlings auf seinem Stuhl, so dass er, wie mir vorkam, das eine Auge auf seinem alten Schiffskumpan und das andere auf seiner Rückzugslinie hatte.
Er befahl mir hinauszugehen und die Tür weit offen zu lassen.
»Durchs Schlüsselloch gucken gibt’s bei mir nicht, Jungchen!« sagte er.
Ich ließ die beiden miteinander sitzen und zog mich in den Zapfraum zurück.
Obgleich ich mir natürlich alle Mühe gab, etwas zu hören, konnte ich lange Zeit weiter nichts hören als ein leises Gemurmel; schließlich aber begannen die Stimmen lauter zu werden, und ich konnte ab und zu ein paar Worte vom Kaptein verstehen – meistens Flüche.
»Nein, nein, nein, nein! Und damit basta,« schrie er einmal. Und ein anderes Mal: »Wenn’s zum Baumeln kommt, sollen alle baumeln – das sage ich!«
Dann aber gab es ganz plötzlich einen furchtbaren Ausbruch von Flüchen und anderen Geräuschen – Stühle und Tisch fielen um, er folgte ein Klirren von Stahl und dann ein Schmerzensschrei. Und im nächsten Augenblick sah ich den Schwarzen Hund in voller Flucht und den Kaptein scharf hinter ihm her, beide mit gezogenen Stutzsäbeln; dem Schwarzen Hund aber strömte Blut von der linken Schulter herunter. Unmittelbar vor der Tür führte der Kaptein noch einen letzten furchtbaren Streich nach dem Fliehenden; sicherlich hätte der Hieb ihm den Garaus gemacht, wenn er nicht von dem grossen Gasthofsschild des »Admiral Benbow« aufgefangen worden wäre. Man kann die Spur noch bis auf den heutigen Tag an der unteren Leiste des Rahmens sehen.
Mit diesem Hieb war das Gefecht aus. Kaum war der Schwarze Hund auf der Straße, so entwickelte er trotz seiner Wunde eine ungeheure Geschwindigkeit und war in einer halben Minute jenseits der Höhe verschwunden. Der Kaptein aber starrte wie geistesabwesend auf das Schild. Dann fuhr er sich ein paarmal mit der Hand über die Augen, und schließlich ging er in das Haus zurück und sagte zu mir:
»Jim, Rum!«
Und als er diese Worte sprach, taumelte er hin und her und musste sich mit der einen Hand gegen die Wand stützen.
»Sind Sie verwundet?« schrie ich.
»Rum!« sagte er noch einmal. »Ich muss fort von hier. Rum! Rum!«
Ich lief schnell, welchen zu holen; aber ich war von allen diesen Vorgängen ganz verstört und zerbrach ein Glas und konnte den Zapfen nicht richtig aufdrehen. Und während ich mir noch damit zu tun machte, hörte ich im Schenkzimmer einen schweren Fall. Und als ich hineinrannte, sah ich den Kaptein, so lang er war, auf dem Fußboden liegen. In demselben Augenblick kam meine Mutter, die das Geschrei und der Lärm des Kampfes aufgeschreckt hatten, die Treppe heruntergelaufen, um mir zu helfen. Mit vereinten Kräften hoben wir ihm den Kopf hoch. Er atmete sehr schwer und laut; aber seine Augen waren geschlossen und sein Gesicht war so blaurot, dass es schrecklich anzusehen war.
»Herrje, Herrjemine!« schrie meine Mutter: »Was für eine Schande für unser Haus! Und auch dein armer Vater liegt krank zu Bett!«
Wir hatten keine Ahnung, auf welche Weise wir dem Kaptein helfen könnten; wir dachten, er wäre in dem Gefecht mit dem Fremden tödlich verwundet worden. Ich brachte allerdings den Rum und versuchte ihm etwas davon einzuflößen; aber seine Zähne waren dicht geschlossen, und seine Kinnbacken waren so hart wie Eisen. Wir fühlten uns ganz glücklich und erleichtert, als plötzlich die Tür aufging und Dr. Livesey eintrat, der seinen Besuch bei meinem Vater machen wollte.
»O Herr Doktor!« riefen wir: »Was sollen wir tun! Wo ist er verwundet?«
»Verwundet? Papperlapapp!« sagte der Doktor. »Der ist nicht mehr verwundet als ihr oder ich. Der Mann hat einen Schlaganfall gehabt, wie ich es ihm vorhergesagt hatte. Nun, Frau Hawkins, laufen Sie mal schnell nach oben zu Ihrem Mann, aber sagen Sie ihm, wenn irgend möglich, kein Wort von der Geschichte. Ich muss ja leider mein Bestes tun, dieses Kerls in jeder Beziehung wertloses Leben zu retten, und Jim wird so gut sein, mir eine Schüssel zu holen.«
Als ich mit der Schüssel zurückkam, hatte der Doktor schon dem Kaptein den Ärmel hochgestreift und seinen dicken, muskelkräftigen Arm entblößt, der an mehreren Stellen tätowiert war: »Gut Glück!« – »Schöner Wind!« – »Billy Bones sein Liebchen!« Diese Inschriften waren sauber und deutlich auf dem Unterarm angebracht; auf dem Oberarm aber in der Nähe der Schulter war ein Bild von einem Galgen, an dem ein Mensch hing – sehr hübsch und witzig ausgeführt, wie mir dünkte.
»Prophetisch!« sagte der Doktor und tippte auf das Bild. »Und nun, Meister Billy Bones – wenn das Euer Name ist – wollen wir uns mal die Farbe Eures Blutes ansehen. Jim,« sagte er, »hast du Angst vor Blut?«
»Nein, Herr Doktor.«
»Na, dann halte mal die Schüssel!«
Und mit diesen Worten nahm der Doktor seine Lanzette und öffnete eine Ader.
Eine grosse Menge Blut wurde abgezapft, bevor der Kaptein die Augen aufschlug und mit einem blöden Blick um sich sah. Zuerst erkannte er den Doktor und runzelte die Stirn; dann fiel sein Blick auf mich, und er sah erleichtert aus. Plötzlich aber wechselte er die Farbe, versuchte sich aufzurichten und rief:
»Wo ist der Schwarze Hund?«
»Hier ist kein schwarzer Hund,« sagte der Doktor, »außer dem, der Euch im Nacken sitzt. Ihr habt zuviel Rum getrunken; jetzt habt Ihr einen Schlaganfall gehabt, genau wie ich’s Euch vorausgesagt habe; ich habe Euch aber, sehr gegen meinen eigenen Willen, noch einmal mit dem Kopfe voran aus dem Grabe herausgezogen. Nun, Herr Bones –«
»So heisse ich nicht!« unterbrach der Kaptein den Doktor.
»Ist mir Wurscht!« antwortete der. »Ein alter Seeräuber, den ich kenne, heisst so; und ich nenne Euch so der Kürze wegen, und was ich Euch zu sagen habe, ist dies: Ein Glas Rum wird Euch nicht umschmeissen, aber wenn Ihr eins trinkt, so werdet Ihr noch eins nehmen und wieder eins, und ich setze meine Perücke zum Pfande: wenn Ihr das Rumtrinken nicht ganz und gar aufgebt, so sterbt Ihr – versteht Ihr dies? – sterbt und geht dahin, wo Ihr hingehört, wie der Mann in der Bibel. Na, nun versucht mal aufzustehen. Ich will Euch zu Bett bringen.«
Mit grosser Mühe gelang es uns beiden, dem Doktor und mir, den Kaptein die Treppe hinaufzubringen und ihn auf sein Bett zu legen, wo ihm sofort der Kopf auf das Kissen sank, als ob er beinahe ohnmächtig wäre.
»Also denkt daran!« sagte der Doktor; »ich wasche meine Hände in Unschuld – das Wort Rum bedeutet für Euch Tod.«
Und damit ging er hinaus, um nach meinem Vater zu sehen. Er fasste mich am Arm und nahm mich mit hinaus, und sobald er die Tür geschlossen hatte, sagte er zu mir:
»Das hat nichts zu bedeuten; ich habe ihm genug Blut abgezapft, um ihn für eine Weile ruhig zu halten; er sollte eine Woche im Bett liegenbleiben – das ist das beste für ihn und für euch; aber wenn er noch einen Schlaganfall kriegt, so ist’s aus mit ihm.«
Kapitel 3 – Der schwarze Fleck
SO GEGEN DIE Mittagsstunde stand ich vor des Kapteins Türe mit einigen kühlenden Getränken und Medizinflaschen. Er lag noch so ziemlich in derselben Stellung, in der wir ihn verlassen hatten; nur hatte er sich etwas höher hinaufgeschoben. Er schien schwach, zugleich aber auch aufgeregt zu sein.
»Jim,« sagte er zu mir, »du bist hier im Hause der einzige, der was taugt, und du weisst, ich bin immer gut zu dir gewesen. Kein Monat ist vergangen, ohne dass ich dir ein silbernes Vier-Penny-Stück gegeben habe. Und nun sieh mal, Maat, mir geht es verdammt schlecht und ich bin von allen verlassen; und, Jim, du wirst mir ein einziges Nöselchen Rum bringen, nicht wahr, das tust du doch, mein Jungchen?«
»Der Doktor,« fing ich an.
Aber da fluchte er auf den Doktor – mit schwacher Stimme, aber es kam ihm vom Herzen.
»Doktors sind alle Schwätzer,« sagte er;[3q] »und der Doktor da – poh, was versteht der von seebefahrenen Menschen? Ich bin an Stellen gewesen, da war’s so heiss wie in der Hölle, und die Kameraden fielen rund um mich herum wie die Fliegen vom Gelben Hans und das Land da schwankte von Erdbeben wie Meereswogen – was weiss so ein Doktor von solchen Ländern? Und ich blieb am Leben, sag’ ich dir, und das machte der Rum. Der war für mich Essen und Trinken, und wir waren wie Mann und Frau; und wenn ich nicht meinen Rum haben soll, dann bin ich ein armseliges altes Wrack an einer Leeküste – und mein Blut kommt über dich, Jim, und über den Schwätzer da, den Doktor!«
Jetzt kam wieder eine Reihe von Flüchen, und dann fing er noch einmal an zu betteln:
»Sieh doch mal, Jim, wie mir die Finger zittern. Ich kann sie nicht stillhalten – kann’s einfach nicht. Habe an diesem lieben Tag noch keinen Tropfen gehabt. Der Doktor da ist ein Schafskopf, sag’ ich dir. Wenn ich nicht einen Schluck Rum kriege, dann krieg’ ich das graue Elend; hab’s schon ein paarmal gehabt. Ich sah den alten Flint in der Ecke da; da hinter dir; sah ihn klar und deutlich; und wenn ich das graue Elend kriege – na, ich habe ein hartes Leben gehabt, und mir wird schlecht bei dem Gedanken. Der Doktor sagte mir ja selber: ein einziges Glas würde mir nichts schaden. Ich will dir eine goldene Guinee[5] für ein Nöselchen geben!«
Er wurde immer aufgeregter, und das machte mich unruhig meines Vaters wegen, mit dem es an diesem Tage sehr schlecht stand und der Ruhe nötig hatte; außerdem hatte ja der Doktor wirklich die Worte gesagt, die der Kaptein mir anführte. Der Bestechungsversuch ärgerte mich allerdings; aber ich sagte:
»Ich brauche Ihr Geld nicht; bezahlen Sie nur, was Sie meinem Vater schuldig sind. Ich will Ihnen ein Glas holen, aber nicht mehr.«
Als ich ihm das Glas Rum brachte, griff er gierig danach und trank es aus; dann sagte er:
»Ah! ah! das tut wohl! mir ist ganz gewiss schon etwas besser. Und nun höre mal, mein Jungchen: sagte der Doktor, wie lange ich hier in dieser alten Klappe liegen müsse?«
»Wenigstens eine Woche.«
»Alle Donner!« schrie der Kaptein. »Eine Woche! Das geht nicht: inzwischen würden sie mir den schwarzen Fleck bringen. Die Schweinehunde sind schon dabei, mir den Wind abzufangen – die Schweinehunde, die nicht sparsam umgehen konnten mit dem, was sie kriegten, und jetzt klauen wollen, was einem andern gehört! Benimmt ein ordentlicher Seemann sich so? Das möchte ich mal hören! Ich bin ein sparsamer Mensch. Ich habe niemals gutes Geld vergeudet, was ich mir verdient hatte; ich habe auch noch nie welches verloren, und ich will auch jetzt wieder dafür sorgen, dass sie sich den Mund wischen können. Vor denen habe ich keine Angst! Ich werde noch ein Segel aufsetzen, mein Jungchen, und sie können mir nachflöten!«
Während er diese Reden hielt, war er mit grosser Mühe von seinem Bett aufgestanden; er hielt sich mit einem Griff, dass ich beinahe laut herausgeschrien hätte, an meiner Schulter fest, und ich merkte, dass seine Beine so schwer wie Blei sein mussten, denn er konnte sie kaum bewegen. Seine Worte an sich waren zwar sehr mutig, aber die schwache Stimme, in der er sie aussprach, bildete einen traurigen Gegensatz dazu. Als es ihm gelungen war, sich auf den Bettrand zu setzen, schwieg er einen Augenblick. Dann flüsterte er:
»Der Doktor hat mich alle gemacht, es saust mir in den Ohren. Lege mich auf den Rücken.«
Ich konnte ihm nicht viel helfen; denn ehe ich noch zugriff, war er schon wieder in seine frühere Lage zurückgesunken. Eine Weile lag er still da; endlich sagte er:
»Jim, du sahst heute den Seemann?«
»Den Schwarzen Hund?«