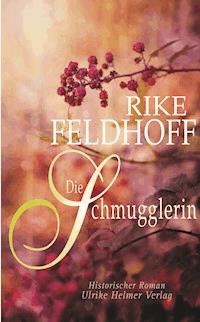
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erste Weltkrieg ist um, doch die Zeiten bleiben hart. An der österreichischen Grenze zu Italien schmuggelt Maria, eine junge Frau, Ware über die Alpen und gewinnt dabei neues Selbstbewusstsein. Als ein Theater-Ensemble im Ort den Tourismus neu ankurbeln soll, freundet sie sich mit einer der Schauspielerinnen an. Bald überschreitet Maria nicht mehr nur als Schmugglerin Grenzen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rike Feldhoff
DIESCHMUGGLERIN
Historischer Roman
ISBN (eBook) 978-3-89741-965-0
ISBN (Print) 978-3-89741-409-9
© 2018 eBook nach der Originalausgabe© 2018 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach/TaunusAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Atelier KatarinaS / NLunter Verwendung des Fotos »Beerentraum«,© Copyright melrose / photocase
Ulrike Helmer VerlagE-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
Inhalt
Auswege
Heimwege
Entscheidungen
Fremde Hilfe
Erste Schritte
Bevormundung
Familienbande
Freunde oder Fremde
Ehrlichkeit und Lüge
Blickwinkel
Aufträge
Was ihr wollt
Bewährungsproben
Verdächtigungen
Aufbegehren
Fortschritte und Rückschläge
Gemeinsame Sache
Richtungsänderungen
Zukunftsgedanken
Hängebrücken
(Selbst)Erkenntnisse
Gratwanderungen
Kein Ende
Hinter eigenen Grenzen
Auswege
Das war nicht der richtige Weg. Hier gab es zu viele Äste. Zu viele Fichten. Nichts war, wie Maria es kannte. Auch wenn sie sich im Wald sonst wie zu Hause fühlte, heute erschien er ihr fremd.
Erneut drückte Maria einen Ast zur Seite. Als sie ihn losließ, schnellte er zurück. Eine Ladung Schnee fiel auf sie herab und nahm ihr für einen Moment die Sicht. »Was denn noch alles!«, knurrte sie, während sie sich über die Augen wischte. Dann atmete sie einmal tief durch. Anstatt zu jammern, sollte sie lieber endlich den Heimweg finden! Sie überlegte. An der Fichte, die der Blitz im letzten Sommer gespalten hatte, war sie noch vorbeigekommen. Das bedeutete, dass sie nicht allzu weit vom Weg abgekommen sein konnte. Suchend verfolgten ihre Augen die Fußstapfen zurück bis zu einem Felsstein, der rechter Hand hätte liegen müssen: die Stelle, an der sie falsch abgebogen war.
Erleichtert wollte sie zu dem Felsen zurückkehren, da sah sie es: ein kurzes Aufflackern aus der Richtung, aus der sie kam. Zwar in weiter Entfernung, dazu behinderten die tiefhängenden Äste und das dichte Schneetreiben die Sicht. Dennoch zweifelte sie nicht eine Sekunde daran, dass jemand hinter ihr her war.
Sie gab sich einen Ruck. Egal wie weh es tat, wie schwer ihr jeder Schritt inzwischen fiel, sie durfte nicht länger hier herumstehen. Entschlossen schob sie die Daumen unter die Riemen ihres Rucksacks und kämpfte sich wieder voran.
Ja, das hier war der falsche Weg, aber es gab kein Zurück. Irgendwo dort vorn warteten die Eltern und der Bruder auf sie und auf das, was sie mitbrachte. Sie sah die kleine Stube vor sich und spürte die Wärme, die der alte Ofen verbreitete. Für wenige Augenblicke hatte sie nicht länger das Gefühl, mitsamt ihren Kleidern durch einen eiskalten, reißenden Fluss zu schwimmen. Nur deshalb schaffte sie es, weiterzugehen.
Mit einem Mal drang dumpfes Kirchengeläut vom Dorf herauf. Es lenkte sie kurz ab. War es tatsächlich schon so spät? Maria lauschte. Der Klang der Glocken erinnerte sie an jenen Tag vor wenigen Wochen – es war am elften November gewesen, als sich die Donaumonarchie hatte ergeben müssen.
Heute bedeutete das Geläut: Silvester. Das Jahr 1918 neigte sich dem Ende zu. Niemand wusste, was das nächste bringen würde. Der schreckliche Krieg war vorüber, doch der andere, der ums Überleben, hatte gerade erst begonnen.
In den letzten Wochen waren unzählige Soldaten über die Tauern geströmt, bei Wind und Wetter, weil sie so schnell wie möglich heim wollten. Dorthin, wo sie sich wärmende Stuben, Ruhe und Frieden erhofften.
Maria straffte die Schultern. Wenn sie nicht erwischt werden wollte, musste sie sich beeilen. Sie würde weitergehen, der Nase nach, mitten durch den Wald, bis nach Hause. Glücklicherweise schneite es stark genug, dass ihre frischen Spuren bald bedeckt waren. Diese Sicherheit machte ihr die Schritte etwas leichter.
Trotzdem hatte sie das Gefühl, vor Erleichterung weinen zu müssen, als sie den Voigt-Hof vor sich sah.
Jetzt nur keinen Fehler machen! Sie öffnete die Haustür gerade so weit, dass sie ins Haus schlüpfen konnte und nicht zu viel Licht nach draußen drang. Die Vorsicht erwies sich als unnötig, denn im Gang war es dunkel. Aus der Küche war nichts zu hören als leises Stühlerücken.
Kurz war sie versucht zu rufen, entschied sich aber dagegen. Dabei hätte sie gut jemanden brauchen können, der ihr half. Ihre Finger waren so klamm, dass sie Mühe hatte, die Haustür zu verriegeln, sich die Schuhe auszuziehen und zu den anderen unter die Treppe zu stellen. Alles, wie sie es jedes Mal machte, wenn sie draußen gewesen war.
Geschafft! Rasch schlüpfte sie in ein Paar Filzschlappen und rannte mitsamt dem Rucksack die Holztreppe hinauf in ihre Kammer. Ihr Atem ging schwer, als sie die Tür hinter sich schloss.
Sie sah sich um, öffnete die Wäschetruhe und verstaute den Rucksack, so wie er war – nass, schwer. Endlich bekam sie wieder Luft und konnte aus dem Schrank ein trockenes Kleid holen. Ihr Schönstes. Dem besonderen Tag des Jahreswechsels angemessen. Der Stoff fühlte sich gut an, als sie es überstreifte.
Draußen vor dem Fenster begannen Schatten zu tanzen. Laternenlicht bewegte sich direkt auf den Hof zu. Sie konnte bereits die Stimmen hören.
Es war höchste Zeit, in die Küche hinunterzugehen. Eilig strich sie sich durchs nasse, erdige Haar. Hoffentlich fiel niemandem auf, dass es dunkler aussah! Und wenn doch, würde ihr etwas einfallen … Die Schürze band sie im Gehen.
Unten wartete die Mutter in der offenen Küchentür. Maria schaute nicht zu ihr hin, als sie die warme Stube betrat und sich an den Ofen stellte. Die Kälte in ihrem Inneren ließ allmählich nach, doch die Angst blieb. Wie alle in dem kleinen Raum starrte sie zur Tür. Niemand bewegte sich. Nur das gleichmäßige Schlagen der Pendeluhr und die Geräusche vor dem Haus zeigten an, dass die Zeit nicht stillstand.
Augenblicke später pochte es kräftig am Eingang. »Andreas! Mach auf!«, forderte eine Männerstimme.
Mutter und Tochter wechselten einen kurzen Blick. Ein Deut mit dem Kinn, Maria setzte sich an den Esstisch. Da standen vier Becher, daneben ein Krug mit Most. Sie griff danach und schenkte ein, Becher für Becher. Bei jedem zitterte ihre Hand weniger.
»Ander! Jetzt komm! Wir woll’n kein’ Ärger!« Der Unterton in der harten Stimme besagte jedoch genau das Gegenteil.
Endlich setzte sich die Mutter in Bewegung. Ihr Brustkorb hob und senkte sich noch einmal, wie um Kraft zu sammeln, dann öffnete sie die Stubentür und trat lautlos wie ein Geist hinaus in den Gang. Dafür war das neuerliche Gepolter an der Tür umso lauter.
Jetzt knarrte der Riegel am Hauseingang. Kalte Luft drang bis in die Stube und mit ihr die kräftige Stimme von Pauline Voigt. »Was ist? Habt ihr Zöllner heut nix Besseres zu tun, als unschuldige Leut’ von der Feier abzuhalten?«
Maria sah die Männer förmlich vor sich. In ihren langen dicken Mänteln, die Krägen hochgeschlagen, mit Fellmützen auf dem Kopf, die unter einer leichten Schneeschicht verschwanden.
»Wir mach’n nur unsere Arbeit, Schwägerin.«
»Und die müsst ihr immerzu bei uns mach’n?«, giftete die Mutter weiter. Aber, das wusste Maria, die Zöllner ließen sich davon nicht aufhalten.
Wortlos trampelten die Eindringlinge den Schnee von den Schuhen, dann kamen sie ins Haus. Ihre genagelten Schuhsohlen schlugen auf die Holzdielen. Maria zählte die Schritte mit … acht, neun, zehn. Mehr brauchte es nicht bis zur Küche.
Sie kehrte sich um zur Tür. Als Erstes erschien der Onkel. Nach ihm sein Kollege, Inspektor Ignaz Stöger. Ihre verschneiten Mützen hielten sie in den Händen. Die Mäntel hatten sie anscheinend draußen abgeklopft, sie schimmerten nur feucht. Auf den Schuhen klebte immer noch Schnee, der zusehends glasiger wurde und blassbraune Lachen auf dem Holzboden hinterließ.
Von der Wärme erfasst, die der alte Herd im Raum verströmte, zogen die Zöllner ihre Handschuhe aus. »Wir haben einen Schmuggler verfolgt. Bis zu euch, Ander«, sagte der Onkel zu Marias Vater.
Der fuhr in die Höhe. »Und was geht uns das an?« Er griff nach seinem Becher und nahm einen kräftigen Schluck daraus. »Ihr wisst, dass mein Bernhard im Krieg für den Kaiser kämpft. Und der Hannes war vorhin nur kurz im Stall, um nach dem Vieh zu schau’n. Aber sonst war er immer da. Stimmt’s, Hannes?«
Marias Bruder prostete dem Vater zu und nickte bestätigend.
Für kurze Zeit war nur das Schlagen der Pendeluhr zu hören.
»Ander … Bruder … Wir wollen ja nicht …« Richard Voigt räusperte sich und sah den Vater wieder an. »Wir haben einen anderen verfolgt. Nicht den Hannes.«
»Und siehst du noch einen anderen hier, Richard?« Der Vater deutete in die Küche. »Aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in die Kammern schauen. Da werdet ihr nichts finden. Kein Zeug und keinen Schmuggler.«
Maria schluckte. So unauffällig wie möglich griff sie sich an den Nacken und schaute dabei zur Decke. Hoffentlich verstand die Mutter die Warnung!
Das tat sie, denn Pauline Voigt stemmte sofort die Hände in die Hüften. »So weit kommt’s noch!«, zeterte sie, »dass irgendwelche Mannsleut’ hier herumschnüffeln.« Entschlossen baute sie sich vor ihrem Schwager auf. Was komisch aussah, weil der sie um fast zwei Köpfe überragte und trotzdem leicht zurückwich. »Wen wollt ihr denn gesehen haben? Bei dem Schneefall?«
Angespannt wartete Maria auf die Reaktion ihres Onkels.
Der hob die Hände. »Beruhig dich, Pauline. Es kann genauso gut sein, dass der Kerl beim Haus vorbei ist.«
»Wir sind halt den Fußspuren nachgegangen. Und die führen zu eurem Hof«, mischte sich zum ersten Mal der Kollege ein. »Und da enden sie, weil bei der Hintertür gibt’s keine mehr.«
Nun kam die Mutter erst richtig in Fahrt. »Und deshalb behandelt ihr uns wie Verbrecher?«, fauchte sie. »Schlagt’s uns fast die Tür ein?« Sie zeigte auf die Füße der Männer. »Und bringt den ganzen Schnee rein. Die Maria und ich dürfen dann auf den Knien herumrutschen, damit wir alles sauber kriegen! Nur weil ihr geglaubt habt, dass irgendein Schmuggler bei uns ein- und ausgeht.«
Bei der Erwähnung von Marias Namen schaute Ignaz Stöger in ihre Richtung. »Ich wollt’ schon beim Reinkommen fragen, wieso deine Haare nass sind, Maria. Warst du draußen?«, fragte er, wie er sie sonst fragte, ob sie viel zu tun hätten auf dem Voigt-Hof.
Gerade deshalb war sie sich nicht sicher, ob er womöglich einen Verdacht hegte. »Ja. Ich hab nach den jungen Obstbäumen geschaut. Nicht dass der Schnee die Äste abbricht. Da hab ich sie halt abgeschüttelt.«
Mit einem Mal lachte Hannes laut auf. »Womöglich habt ihr ab da die Fußspuren von der Maria verfolgt«, überlegte er und schaute grinsend von Ignaz Stöger zum Onkel. »Oder es sind noch ein paar Kriegsheimkehrer in den Bergen, die bei dem Wetter den Weg nicht mehr finden.«
Aus den Augenwinkeln sah Maria, wie ihre Mutter die Arme vor der Brust verschränkte und sich an den Brotbackofen lehnte.
Richard Voigt ließ sich nicht aus der Fassung bringen. »Wenn du draußen warst, muss dir was aufgefallen sein, Maria«, stellte er fest.
Marias Herzschlag beschleunigte sich. Ihr Onkel hatte recht. Dann hätte ihr jemand begegnet sein müssen. Aufs Geratewohl antwortete sie: »Ja, weiter weg. Beim alten Tauernweg. Wie der Hannes schon gesagt hat. Ich hab auch gedacht, dass noch ein paar Soldaten über den Pass sind. Du verstehst bestimmt, dass ich da schnell wieder rein bin. Man weiß ja nie …«
Sofort mischte sich die Mutter ein. »Da hörst es. Wir haben mit deinem Schmuggler nichts zu tun.« Während sie weiter mit den Zöllnern schimpfte, schritt sie zur Tür. »Und jetzt haut ab«, verlangte sie barsch.
Die Männer schauten sich an, unschlüssig, ob sie der Aufforderung folgen sollten. Nach zwei Schlägen der Pendeluhr hoben sie fast gleichzeitig die Schultern und zogen die Handschuhe wieder über. Bevor sie hinausgingen, drehte sich der Onkel noch einmal um. Er deutete mit dem Kopf auf seinen Bruder. »Der Ander braucht Hilfe, Pauline. Das kann so nicht weitergehen.«
Marias Augen folgten dem Wink: Der Vater stand da und starrte auf einen Punkt im Raum, an dem nur er etwas Fesselndes ausmachen konnte. Ander Voigt war wieder in seiner eigenen Welt.
Die Mutter dagegen ignorierte den Blick ihres Schwagers und schob sich zwischen die beiden Brüder. »Ach ja, Richard? Und du wirst uns helfen? So wie du uns geholfen hast, als du unseren Buben, den Bernhard festgenommen hast? Wegen ein paar Sachen, die er über die Grenze gebracht hat, damit wir was zum Leben haben?« Sie riss die Tür auf und wies mit dem Arm hinaus. »Ich sag’s noch einmal! Haut ab!«
Maria sah die Bestürzung und das schlechte Gewissen im Gesicht ihres Onkels. Vielleicht hätte sie Mitleid mit ihm gehabt, wenn nicht klar gewesen wäre, dass bei ihm auch in Zukunft die Arbeit vorging. Darum sah sie ihm auch gleichgültig hinterher, als er schließlich mit Stöger die Stube verließ.
»Wenn ihr wieder mal wen seht, der hier mitten in der Nacht rumschleicht, sag mir Bescheid, Pauline«, sagte er noch, doch die Mutter warf die Tür hinter ihm zu mit den Worten »Die einzigen, die hier rumschleichen, seid ihr Zöllner!«
Dann trat sie zum Fenster, ohne hinauszuschauen.
Maria wusste, warum. Für einen Augenblick wollte die Mutter es wohl nicht sehen. Dieses große schwarze Monster, das sich kaum besiegen ließ. Egal wie sehr sie alle kämpften, die Ruine blieb. Stand starr und reckte ihnen ihr dunkles Gerippe entgegen. Der Stall. Abgebrannt an dem Tag, als der jüngere Bruder, Bernhard, den Zöllnern ins Netz gegangen war. Seit diesem Tag ging es mit dem Voigt-Hof bergab.
Maria betrachtete den Vater. Wie er den Becher mit dem Most von sich schob und nach seiner Pfeife griff. Wie er sie eine Spur zu fest stopfte und den Tabakbeutel auf den Tisch warf. Er allein hatte vergessen, dass es den Stall nicht mehr gab. Wie er auch vergessen hatte, dass der Bernhard im Gefängnis saß. Oder dass der Krieg verloren war. Und morgen, wenn er sich wieder erinnerte, würde er wie immer versuchen, den Schmerz in seinen Augen zu verbergen.
Bedächtig zog die Mutter den Vorhang etwas zur Seite und blickte den davonstapfenden Männern hinterher. »Du musst vorsichtiger sein, Maria«, damit ließ sie den rot-weiß karierten Stoff wieder los, streckte sich und fasste sich an den Rücken. Unter der Bürde der letzten Jahre war er zunehmend krummer geworden. »Zum Glück hat der Hannes vorhin die Bäume abgeschüttelt. Wenn nicht, hätt’ dein Onkel die Ausrede gleich durchschaut.«
Maria nahm einen Schluck vom Most. Er schmeckte sauer. »Beim nächsten Mal pass ich besser auf«, versprach sie, »keine Ahnung, warum die heute unterwegs waren.« Es klang wie der Versuch einer Entschuldigung.
»Weil sie sonst keinen haben, mit dem sie ins neue Jahr reinfeiern können«, behauptete Hannes. Er schaute an sich hinunter, stoppte an dem Bein, dem der Unterschenkel fehlte, und grinste schief. »Nur gut, dass ich nicht mehr der Schmuggler sein kann und sie dich nicht in Verdacht haben, Maria.«
Die Mutter kam zurück zum Tisch, setzte sich neben den Vater und legte ihre Hand auf seine. Faltige Hände. Von den Jahren harter Arbeit in den Bergen ausgemergelt. Und doch kräftig und irgendwie sanft, fand Maria. So viele Jahre waren die Eltern für sie und ihre Brüder da gewesen. Jetzt war sie selbst an der Reihe. Darum ging sie seit Wochen über den Pass. Es brachte Geld, das am Hof nicht mehr zu verdienen war. Es bedeutete ein wenig Licht in ihrem kargen Dasein, auch wenn das, was sie tat, für die Zollwache ein Vergehen darstellte.
»Stoßen wir auf das kommende Jahr an. Und auf den Frieden«, sagte die Mutter in Marias Gedanken hinein.
»Möge er ewig anhalten und uns reich machen«, ergänzte Hannes.
»Satt würd’ mir schon langen«, gab die Mutter zurück. Sie stellte ihren Becher ab. »Was hast du denn für die letzte Rinderhaut bekommen, Maria?«
Der Rucksack! Sie musste ihn dringend ausräumen und die Waren trocknen. Eilig stand sie auf. »Stoff. Polenta. Winterstiefel«, begann sie stolz aufzuzählen.
»Mir reicht der linke«, warf Hannes ein.
Maria fasste sich an den Hals, als schnüre ihn eine Schlinge zu. »Kannst du deine blöden Witze nicht lassen?«, brachte sie mühsam heraus.
»Klar kann ich das, Maria«, meinte der Bruder. »Ich kann euch dafür ja was anderes erzählen. Wie es so war, da am Piave, wie so ein Schwein Dynamit in den Graben geworfen hat«, ätzte er. »Wie ich dann im Dreck lag und gedacht hab, dass ich dort verrecken werd!« Er wurde immer lauter. »Ich kann dir auch sagen, wie es ist, jeden Morgen und Abend auf diesen Stumpen zu schauen, der einmal mein Bein gewesen ist. Soll ich darüber reden?!«, schrie er plötzlich.
Maria senkte den Kopf. Hannes hatte recht. Und trotzdem konnte sie nicht froh darüber sein, dass er Witze machte, anstatt sein Schicksal immer nur laut zu beklagen.
Die Mutter wartete schweigend ab, ob sie eingreifen musste. Aber Hannes schwieg. Er schluckte nur ein paar Mal hart, dass sein Adamsapfel hüpfte.
Und der Vater? Der kratzte sich am Kinn. »Was meinst du, Pauline«, begann er, »wann bekommt der Bernhard wohl Fronturlaub?«
Das war zu viel. Maria ließ sich auf ihren Stuhl sinken. Ein Blick auf Hannes genügte. Stocksteif saß er da, die Hände zu Fäusten geballt. Zur Mutter musste sie gar nicht erst schauen.
»Ein bisschen wird’s noch dauern. Aber dann wird er sicher zu Hause bleiben«, kam es liebevoll von dieser.
»Passt.« Mehr sagte der Vater nicht. Er stand einfach auf und ging zur Schlafkammer.
»Es stimmt, was der Richard sagt«, stellte die Mutter leise fest. »Euer Vater braucht Hilfe.«
»Aber wir haben fast nichts mehr, was ich nach Südtirol bringen kann«, wandte Maria ein. Noch weniger hatten sie Geld, um Waren für den Weiterverkauf zu besorgen.
»Was ist mit dem Kramer-Franz und dem Amperger-Josef?«, überlegte Hannes laut. Er hatte sein Grinsen wiedergefunden. Sie würde nie herausfinden, wie er das schaffte, aber vielleicht war es der Grund, der ihn noch am Leben hielt. »Was soll mit denen sein?«, fragte sie müde. Die Anstrengungen der letzten Stunden machten sich langsam bemerkbar. Dabei musste noch der Rucksack ausgeleert werden. Sie wollte aufstehen, doch die Mutter hielt sie zurück.
»Du kannst genauso für den Kramer und den Amperger Waren über den Pass bringen, wie es der Bernhard gemacht hat«, sprach die Mutter es auch schon aus. »Oder siehst du einen anderen Ausweg?«
Sie wusste selbst nur zu genau, dass es keinen gab.
»Am Samstag ist Versammlung unten im Dorf«, übernahm Hannes. »Da kann die Maria mit den beiden reden.«
»Genau«, stimmte die Mutter zu. »Von uns kann keiner runter und einer muss sich anhören, was der Bürgermeister so Dringendes zu sagen hat.« Sie fuhr über den nassen Ring, den ihr Becher auf der Tischplatte hinterlassen hatte. Maria kam es vor, als wische sie damit auch jeden Einwand beiseite. Hatten die beiden vergessen, dass die beiden Männer auf Bernhard nicht gut zu sprechen waren? Durch ihren Bruder hatten sie jede Menge Petroleum verloren, weil es beim Brand zerstört worden war. Aber sie schwieg und willigte ein, mit Bernhards ehemaligen Hehlern zu reden.
Die Pendeluhr schlug zur Mitternacht.
»Frohes neues Jahr«, flüsterte Maria. Dann ging sie endlich ihren Rucksack holen.
Zwei Tage später hatte Maria immer noch keinen guten Grund gefunden, warum sie nicht nach Krimml gehen konnte. Am Morgen hatte sie erklärt, dass sie sich erst einmal vom anstrengenden Gang über den Pass erholen musste. Die Mutter hatte die Arbeit nur kurz unterbrochen und zu ihr geschaut – dann hatte sie weiter den Polentabrei gerührt. Ab da hatte es Maria aufgegeben, nach weiteren Ausreden zu suchen.
Deshalb war sie jetzt auf dem Weg ins Dorf. In ihrem Kopf drehten sich die Anweisungen im Kreis, die ihr die Mutter und Hannes mitgegeben hatten. Sogar jetzt wurde ihr noch schwindelig, wenn sie daran dachte, wie sie zwischen den beiden gestanden hatte, während ihr die Instruktionen um die Ohren flogen.
Abwechselnd hatten sie auf Maria eingeredet. »Erklär ihnen, dass du dem Bernhard geholfen hast«, hatte die Mutter gesagt. »Du weißt, wem du die Waren verkaufen kannst«, kam es von Hannes. »Sag bloß nicht, dass wir darauf angewiesen sind!«, war die Mutter dazwischengefahren. »Sonst zieh’n sie dich über den Tisch, diese Bauernfänger.« Dann hörte sie wieder Hannes’ mahnende Stimme: »Gib ihnen nicht das Gefühl, dass du zu schwach bist.« Am Ende hatte ihr die Mutter den Janker in die Hand gedrückt und sie mehr oder weniger aus dem Haus geworfen.
Zum Glück war der Weg geräumt, sodass sie nicht durch einen halben Meter Schnee stapfen musste. Sie lächelte – zum ersten Mal an diesem Tag. Das hatte sie Leitner Ferdl zu verdanken. Sie sah den jungen Mann vor sich, wie er gestern mit hochrotem Kopf das Glas mit heißem Most von ihr entgegengenommen hatte. Beinahe wäre es ihm aus der Hand gefallen, weil er nicht stillhalten konnte. Die Pferde, die den Pflug gezogen hatten, waren hingegen geduldig stehen geblieben.
Es erstaunte Maria immer wieder aufs Neue, dass die meisten Lebewesen um Ferdl herum ruhig blieben – egal, wie sehr er auch zappelte. Andere wiederum lachten ihn deshalb aus; und er zappelte dann noch mehr. Dabei gab es so viel Gutes an ihm, was ihn aus der grauen Masse hervorhob. Deshalb mochte sie den Ferdl. Und deshalb behaupteten ein paar Leute in Krimml, er wäre ihr Liebster. Für sie aber war er ein besonders guter Freund.
Vermutlich ihr einziger. Außer ihm wäre jedenfalls keiner auf die Idee gekommen, den Weg zum Voigt-Hof freizuräumen. Dabei wussten alle, dass sie selbst keine Pferde oder Rinder mehr hatten, die sie vor den Pflug spannen konnten. Sie hatten nicht einmal mehr einen Pflug. Alles war beim Stallbrand zerstört worden.
Gerade deshalb war es so wichtig, mit den ehemaligen Geschäftspartnern ihres Bruders zu reden, das wusste Maria inzwischen nur zu gut. Sie beschleunigte ihren Schritt. Wie üblich blieb sie kurz an der Abzweigung zur Hängebrücke stehen, die eine Abkürzung nach Krimml bedeutete. In letzter Zeit ärgerte sie sich immer öfter, dass sie sich dort nicht hinübertraute. Auch wenn ihr klar war, warum. Selbst heute, wo sie in Eile war, wählte sie den längeren Weg. Dabei musste sie in einer halben Stunde im Gemeindesaal sein.
»Maria, warte!«, rief es plötzlich hinter ihr. Sie drehte sich um. In großen Schritten kam die Leitner-Bäuerin auf sie zu. Es wunderte Maria, dass die Frau allein unterwegs war. Sollte bei der Versammlung nicht die ganze Familie mit dabei sein? Doch sie selbst war ja auch alleine.
»Grüß dich, Alwine«, sagte sie artig. »Wo hast du denn deine Buben und die Schwiegertochter gelassen?«, weil sie sich sicher war, dass die Frage erwartet wurde.
»Die Buben sind schon nach dem Essen runter ins Gasthaus. Und die Gerda hat nicht mit wollen«, legte Alwine sofort los. »Sie hat g’meint, dass ich die Bäuerin bin und deshalb zu dieser Versammlung gehen muss.« Alwine hatte aufgeschlossen, Maria streckte ihr auch gleich die Hand zur Begrüßung hin. Der Griff der Leitner-Bäuerin war stark und fest. Trotzdem wirkte sie nicht so kraftvoll wie sonst. Aber das traf im Grunde auf jeden zu. Vier Jahre Krieg hatten bei allen Spuren hinterlassen. Aber da hatte Alwine die Hand auch schon wieder losgelassen und marschierte weiter. Fast mochte man meinen, dass sie vor ihrem eigenen Zuhause floh.
»Es war sehr lieb vom Ferdl, dass er den Weg gestern bis zu uns freigeschoben hat«, begann Maria das Gespräch. Wenn sie nun schon Begleitung hatte, konnte sie sich auch unterhalten. Heute war ihr danach. Dann musste sie nicht länger über später nachdenken.
»So ist er, mein Bub. Immer hilfsbereit. Das nutzen viele aus.« Maria wollte sofort widersprechen, aber Alwine fuhr bereits fort: »Du machst das nicht, ich weiß. Du magst den Ferdl.« Sie klang, als spräche sie mehr mit sich selbst. »Er hat gesagt, dass er dich vielleicht heiraten wird.«
Lächelnd erinnerte sich Maria an den Tag, an dem Ferdl das feierlich verkündet hatte. »Stimmt. Aber nur, wenn ich bis zu meinem Fünfundzwanzigsten niemand anderen find.« Weil die Leut’ behaupten, dass mit einer Frau was nicht stimmt, wenn sie mit fünfundzwanzig noch ledig ist, waren seine Worte gewesen. Keiner soll dumm über dich reden, hatte er hinzugefügt. Weil mit dir stimmt alles, Maria. Davon war Ferdl überzeugt, und Maria hoffte, dass er sich nicht täuschte.
Alwine lachte. »Dann hast ja noch gut drei Jahre.« Plötzlich wurde sie ernst. »Ich glaub, ich hab’s noch nie gesagt, aber das mit deinen Brüdern und dem Vater tut mir leid.«
Maria nickte stumm. Im Grunde hatte bisher niemand Bernhard in sein Bedauern mit eingeschlossen.
»Es muss hart sein für deine Mutter«, stellte Alwine fest. Die Art, wie sie das sagte, brachte Maria die Hängebrücke über dem Wasserfall in Erinnerung. Sobald man aber einen Fuß darauf setzte, begann der Steg zu schwanken. Maria traute der Brücke ebenso wenig wie dem Unterton in Alwines Stimme.
»Vor allem, seit der Bernhard im Gefängnis ist. Der war euch bestimmt eine große Hilfe. Wo doch der Hannes und dein Vater so aus dem Krieg gekommen sind.« Das so betonte Alwine besonders.
»Wir kommen zurecht«, widersprach Maria. »Das mit dem Vater wird wieder. Und der Hannes lernt fleißig, mit Krücken zu gehen. Vielleicht bekommt er bald ein Holzbein.« Sie biss sich auf die Lippen, weil sie zuviel gesagt hatte. Womöglich fragte Alwine sich nun, woher sie das Geld nehmen wollten. Am Ende sorgte das für noch mehr Gerede im Dorf. Maria stöhnte innerlich auf. Wie lange dauerte es noch bis ins Dorf?
»Dein Vater ist wenigstens zurückgekommen. Mein Ferdinand, Gott hab ihn selig …« Alwine hielt inne und Maria schalt sich im Stillen für ihre Ungeduld und die Unterstellungen. Die Leitner-Bäuerin war Witwe. Ihr Mann war einer der ersten gewesen, die gefallen waren. Einer von zwanzig Krimmlern, die den Krieg nicht überlebt hatten.
»Hast du gewusst, dass mir mein Ferdinand den Hof überschrieben hat, bevor er an die Front ist?«
Ja, das wusste sie. Das wusste jeder im Dorf. Deshalb gab es seit dem Kriegsende die Streitereien auf dem Leitner-Hof.
»Ich hab mich um alles gekümmert, als die Mannsleut’ vom Hof unbedingt haben in den Krieg ziehen müssen. Nur der Ferdl ist dageblieben. Freiwillig«, betonte Alwine, »nicht, weil sie ihn nicht dabei haben wollten. Der Ferdl hält nix vom Kämpfen.«
Das klang nach Mutterstolz, aber manchmal fragte sich Maria, ob Alwine Leitner sich in Wahrheit nicht für ihren Ältesten schämte. So wie sie immer betonte, dass der Ferdl von sich aus nicht an die Front wollte. Dabei wusste jeder im Dorf, dass er bei der Musterung für untauglich befunden worden war.
Vielleicht würde sie die Leitner-Bäuerin irgendwann fragen, ob sie mit ihrer Vermutung recht hatte. Gleichzeitig fürchtete sie die Antwort. Sie wünschte ihrem Freund eine Mutter, die stolz auf ihn war. Also schwieg sie und wartete darauf, dass Alwine aussprach, was ebenfalls jeder im Dorf wusste: »Jetzt soll ich mich aufs Altenteil zurückziehen? Nur weil meine Buben meinen, dass es Zeit ist? Ich bin grad mal dreiundvierzig!«
Maria antwortete mit einem langgezogenen »Hm«, mehr wurde von ihr bestimmt nicht erwartet. Die Leitnerin wollte keine Meinung hören; sie wollte sich nur Luft machen. Und heute war eben zufällig sie da. Ihr war das aber nicht unangenehm. Jeder Mensch brauchte ab und zu jemanden zum Reden. Und – dessen war sich Maria sicher – auf dem Leitner-Hof boten sich nicht viele Möglichkeiten dazu.
Alwine schien zufrieden. Sie nickte und redete gleich weiter. »Bei euch hat doch auch die Mutter das Sagen. Das stört niemanden.«
»Sie entscheidet nichts allein«, stellte Maria klar. Die Mutter fragte den Vater – dann jedenfalls, wenn er wusste, wo er war. Auch der Hannes durfte mitreden. Nur ihr, Maria, wurde gesagt, was zu tun war. Weil eine Tochter sich zu fügen hatte. Sie machte sich da nichts vor. Eines Tages würden ihr die Eltern auch einen Heiratskandidaten bringen. Bei der Vorstellung, mit einem der Burschen aus dem Dorf das Bett teilen zu müssen, fröstelte es sie allerdings. Aber wir haben nix, da findet sich vielleicht gar keiner. Und wenn, kann ich immer noch nein sagen. Sie atmete tief durch.
Diesmal war es Alwine, die ein langgezogenes »Hm« hören ließ. Sogar den Schritt hatte sie etwas verlangsamt. Ob sie sich überlegte, ihre Söhne und die Schwiegertochter mehr einzubinden? Maria schaute kurz hinüber. Die Lippen ihrer Begleiterin waren fest aufeinandergepresst. Zudem ging sie jetzt wieder schneller. Das hieß wohl, dass sich auf dem Leitner-Hof in naher Zukunft nichts ändern würde.
»Es passt jetzt einfach nicht«, bestätigte Alwine, was Maria vermutet hatte. »Der Hans und die Gerda werden bald Eltern. Da müssen sie sich erst um das Kind kümmern.« Das Reden munterte die Leitner-Bäuerin immer mehr auf. »Der Sepp wird bald heiraten. Er hat da eine von außerhalb, hat er gesagt.«
Maria musste grinsen, weil der letzte Satz hastig angefügt worden war. Damit ich mir keine Hoffnungen mache, dachte sie bei sich. Dabei waren Sepp Leitner und das, was er in eine Ehe mitbringen mochte, ihr völlig egal.
Überraschend blieb Alwine stehen. »Solange ich die Bäuerin bin, ist auch für den Ferdl alles klar. Es geht einfach nicht, Maria. Wieso kann das keiner verstehen?«
Maria verstand sehr gut. Es ging nicht um den Hans, die Gerda und deren ungeborenes Kind. Es ging nicht um den Sepp. Auch nicht um den Ferdl. Es ging darum, dass Alwine Angst hatte. Davor, dass sie die Witwe vom Ferdinand Leitner war und nun ein Witwenleben zu führen hatte. Bis jetzt aber war sie immer noch die Leitner-Bäuerin, wie seit vier Jahren schon.
Die Versammlung dauerte noch keine halbe Stunde, schon war es mit der Ordnung vorbei. Alle redeten gleichzeitig. Jeder hatte etwas zu sagen, und jeder wollte den anderen übertönen. Manch einer sprang auf, fuchtelte mit den Armen. Andere wiederum blieben wie versteinert sitzen.
So auch Maria. Sie drückte sich immer tiefer in den harten Stuhl hinein. Am liebsten hätte sie sich die Ohren zugehalten. Die Lautstärke und die stickige Luft lähmten sie. Der Saal war viel zu klein für diese Menge an Menschen. Das Atmen fiel ihr schwer, sie wollte raus aus dem Durcheinander an Stimmen, die sie nicht mehr unterscheiden konnte.
»Wir hab’n selbst nix zu essen, da soll’n wir irgendwelche Fremden durchfüttern oder was?«
»Die bringen doch Geld, du Depp!«
»Ich hab noch keine Krone g’sehn!«
»Leut’, wir müssen an morgen denken!«
»Stimmt. Morgen kommen die Schwiegereltern zum Essen.«
Nun mischte sich auch noch lautes Lachen hinein.
Maria knirschte mit den Zähnen. Sie wagte aber nicht, auf ihre Mutter oder auf Hannes zu schimpfen. Obwohl die beiden schuld waren, dass sie das jetzt ertragen musste.
Plötzlich gab es einen lauten Schlag.
Maria zuckte zusammen.
»Ruhe!«, dröhnte ein kräftiger Ruf durch den Saal und alle hielten inne. Niemand bewegte sich. Jeder starrte auf den Bürgermeister. Es war mucksmäuschenstill geworden.
Thomas Bruckner legte den Holzhammer hin, den er auf den Tisch geknallt hatte. Er beugte sich etwas nach vorne. Stützte sich mit den Fingerknöcheln auf der Tischplatte ab. Schaute in die Runde. Und lächelte schließlich.
»Der Mann ist ein Schlitzohr«, hatte der Vater oft gesagt, wenn er vor dem Krieg von seinen Gasthausbesuchen zurückgekommen war. »Der tut, als würd’ ihm das ganze Dorf gehören, und die Leut’, die hier wohnen dazu. Wirst sehen, irgendwann wird das auch so sein.«
Heute fragte sich Maria, ob das nicht wirklich so war. Denn der Bruckner-Thomas, das hatte er zu Beginn der Versammlung klargestellt, wollte aus Krimml eine besondere Gemeinde machen.
Sie war zwar klein und durch den Zusammenbruch der Donaumonarchie zu einem Grenzdorf geworden. Aber es hatte die Tauern und vor allem die Wasserfälle. Dadurch waren schon vor dem Krieg viele Fremde ins Tal gekommen. Und so sollte es wieder werden. Die Einwände der Bürger in seinem Dorf schienen den Bruckner nicht zu interessieren.
Die Maßnahme des Bürgermeisters hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Diejenigen, die aufgesprungen waren, setzten sich hin. Es dauerte aber, bis alle ihre Stühle zurechtgerückt hatten.
Nun konnte Maria wieder nur die Hinterköpfe der Anwesenden sehen. Ein Gemisch aus verschiedensten Haarfarben. Fülliges und schütteres Haar. Glatzen. Zum ersten Mal, seit sie den Saal betreten hatte, wollte Maria lächeln. Aber sie zwang sich, ernst zu bleiben. So lustig war der Gedanke auch wieder nicht, dass die Männer wohl fast alle zum selben Haarschneider gingen, zumal sie doch wusste, dass dafür die Frauen im Haus zuständig waren. Die wiederum kämmten und flochten ihr Haar, wie sie es von ihren Müttern, und diese wiederum von ihren Müttern gelernt hatten.
Maria tastete nach ihrem Kranz. Auch ihr hatte die Mutter vor Jahren gezeigt, wie man ordentliche Zöpfe machte und sie aufsteckte. Die Mütter zeigten es den Töchtern, und die führten es fort. Auf einmal dachte sie, dass sich daran auch in zwanzig Jahren nichts ändern würde.
Langsam ließ sie die Hand sinken. Nichts würde sich hier in zwanzig Jahren ändern. Es wären immer noch dieselben Lodenmäntel, die auf den Haken an der Wand hingen. Dieselbe Aufreihung von Gamsbärten an denselben Hüten. Dieselben Sorgen und Nöte. Die Erkenntnis schnürte ihr die Kehle zu.
»Der Bürgermeister macht es wieder spannend. Nicht wahr, Maria?«, raunte ihr in diesem Moment ihr Nebenmann zu, der Moser-Bauer, und sie kam wieder zu Atem. Maria wandte ihm den Kopf zu und nickte. Sie beugte sich ein wenig vor, um seine Frau sehen zu können, die neben ihm saß und als eine der Wenigen vorhin still geblieben war.
»Wie geht’s dir, Moserin?«, erkundigte sie sich.
»Wie soll es ihr schon gehen?«, erwiderte ihr Mann, bevor sie den Mund aufmachen konnte. »Gut geht es ihr. Jetzt, wo wenigstens ich wieder da bin. Nicht wahr, Mutter?« Robert Moser klopfte seiner Frau auf den Oberschenkel.
Maria sah, wie sich die Hand der Frau verkrampfte. Der Mann hatte keine Ahnung. Er war vielleicht stolz auf seinen gefallenen Buben, aber wie sollte es einer Mutter gehen, die ihren Sohn an den Krieg verloren hatte? Das leise »Ja« der Moserin hörte sich weit eher nach innerer Qual als nach Lächeln an. Aber, fiel es Maria ein, genauso steif und reglos war Elfriede Moser auch schon vor dem Krieg gewesen.
Was machte sie sich darüber eigentlich Gedanken? Hatte sie nicht genug an ihrer eigenen Last zu tragen? Sie setzte sich gerade hin und schaute nach vorne.
In der ersten Reihe bei den Honoratioren sah sie Franz Kramer. Natürlich. Schließlich war der Kaufmann stets an vorderster Front, wenn es darum ging, gesehen zu werden. Mit ihm würde sie nachher zuerst sprechen. Neben dem Kramer saß der Apotheker Amperger, den Rücken wie immer kerzengerade. Bei seinem Anblick musste Maria jedes Mal an den Lehrer Lämpel von Wilhelm Busch denken. Jetzt lächelte sie wirklich und fühlte sich etwas erleichtert.
Als hätte der Bürgermeister ihr Lächeln als Ermutigung aufgefasst, setzte er seine Ansprache fort. »Die Fremden sind unsere einzige Möglichkeit, Leut’. Das, was eure Höfe abwerfen oder ihr mit eurem Handwerk verdient, reicht nicht zum Überleben. Daher müssen wir schau’n, dass wir den Wasserfallweg schnell wieder herrichten.« Bruckner wartete, damit seine Worte bis in den hintersten Winkel des Saales dringen konnten.
Kurz hatte es den Anschein, als wollte der Moser etwas sagen. Schließlich war er derjenige, der vorhin am lautesten geschrien hatte. Aber auch er schwieg nun wie alle anderen.
Zufrieden sprach der Bürgermeister weiter. »Erst einmal gründen wir unseren eigenen Alpenverein.« Er hob die Hand, als es wieder unruhiger wurde. »Eben weil die Sektion Warnsdorf nicht mehr im Deutsch-Österreichischen-Gesamtalpenverein ist, müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann packen wir das.«
»Und woher soll’n wir das Geld nehmen?«, warf der Moser nun doch ein. »Das bissel, was wir haben, wird jeden Tag weniger wert.«
Daraufhin setzte erneut leises Gemurmel ein. »Sobald die ersten Besucher kommen, nehmen wir Maut von denen«, erklärte Thomas Bruckner sein Vorhaben. »Die stecken wir wieder in den Bau. Und so weiter.«
»Und wenn keiner kommt?«, fragte die Leitner-Bäuerin. »Es müssen jetzt schon alle schau’n, wie sie zurechtkommen. Da wird niemand gleich in die Sommerfrische wollen.«
Maria stimmte ihr im Stillen zu. Sie konnte der Idee nichts abgewinnen. Allein die Vorstellung, dass immer mehr Fremde in den Bergen herumstreichen könnten, war ihr zuwider. Irgendwann, so dachte sie, wären alle Wege über den Pass verstopft.
»Sie werden kommen«, behauptete der Bürgermeister. »Die Leut’ brauchen Ablenkung.« Er lächelte erst die Leitner-Bäuerin und dann die ganze Gemeinde an. »Wir müssen’s nur richtig aufziehen.«
»Kommt jetzt die Geschichte mit dem Theater?«, rief Rudi Kramer in den Saal hinein. Sein Vater, der Kaufmann, schaute ihn strafend an.
»Ja«, gab Bruckner ruhig zurück. »Jetzt kommt die Geschichte mit dem Theater.«
Maria sah sich erstaunt um. Alle schienen zu wissen, worum es ging, nur sie nicht. Der Moser rückte näher zu ihr hin. »Er hat wohl gehört, dass irgend so ein Hugo von und zu sonst wie in Salzburg was aufziehen will«, erzählte er ihr in einer Lautstärke, dass jeder ihn hören musste, »um was für den Fremdenverkehr zu tun. Und jetzt bildet er sich ein, dass das auch was für uns ist.«
Maria rückte vom Moser weg. »Ehrlich?«
»Der Bürgermeister behauptet, die werden Sachen spielen, für die man Verstand braucht«, sagte der Moser noch eine Spur lauter. »Aber wenn mich wer fragt, passt das nicht nach Krimml.« Er stieß seine Frau mit dem Ellbogen an. »Vielleicht, wenn’s Geschichten wären mit einem stattlichen Schmuggler und einer feschen Bauerntochter, ja dann …«
Thomas Bruckner runzelte die Stirn und lachte schließlich. Er hatte wohl beschlossen, sich auf keinen Disput mit Moser einzulassen. »Es gibt Schlimmeres, als wegen einem schönen Gesicht und einer netten Figur ins Theater zu gehen. Meinst nicht auch, Robert?«
»Wenn es mich nix kostet, können die Leut’ von mir aus auch wegen dem dummen August reingehen«, gab der Bauer zurück. Das brachte ihm viele Lacher ein. Mit einem breiten Grinsen schaute er sich im Saal um.
»Damit wir das heute noch zu Ende bringen«, rief Bruckner. Diesmal brauchte er keinen Holzhammer, die Krimmler hörten ihm sofort zu. »Ich versteh eure Sorgen wegen dem Geld für’n Wasserfallweg und überhaupt. Aber wer weiß, vielleicht kommt der eine oder andere aus Krimml bald zu Grundbesitz im Achental …« Jetzt hatte er die ungeteilte Aufmerksamkeit aller. Wenn es um Besitz ging, wurde jeder hellhörig.
»Und wie soll das gehen, ohne Geld?«, warf einer der Bauern ein.
»Ich fahr die Tage aufs Grundbuchamt nach Mittersill. Im Achental wird es sicher den einen oder anderen Hektar geben, der jemandem gehört, der nix mehr damit anfangen kann …«
»Und die teilen wir dann wie unter uns auf?«, fragte Robert Moser neben ihr.
Der Bürgermeister, das Schlitzohr, schmunzelte leicht. »Wie Geschäftsleut’, Robert. Wie Geschäftsleut’.«
Maria ballte die Hände zu Fäusten. Es war klar, wen der Bruckner damit meinte; sich selbst und ein paar andere besondere Leute. Ihre Eltern gehörten bestimmt nicht dazu.
Die Gespräche, die folgten, ließ sie an sich vorbeiziehen. Sie wollte nur noch ihren Auftrag erfüllen und dann heim. Bevor sie den Kaufmann erreichte, trat jedoch der Bürgermeister ihr in den Weg.
»Maria, auf ein Wort.« Thomas Bruckner zog sie zur Seite.
Wortlos wartete sie ab, was er von ihr wollte.
»Ich hab’ gehört, dass es bei euch mit dem Geld immer knapper wird«, begann er sofort. »Ohne Vieh und mit dem bissel Wald wird es auch nicht besser.«
Maria spürte die kalte Mauer im Rücken. Ohne es zu merken, war sie immer weiter zurückgewichen.
»Deine Eltern sind heut ja nicht da, darum kannst du daheim ausrichten, dass ich ihnen helfen möchte.« Der Bürgermeister machte eine seiner dramaturgischen Pausen, bevor er fortfuhr. »Ich kauf euch den Voigt-Hof ab. Dann seid ihr alle Sorgen los. Richte das deinen Eltern aus.«
Der Bruckner wollte den Hof! Maria fühlte sich, als falle sie in eine Gletscherspalte. Und wenn dieser Mann etwas wollte, bekam er es! Bruckner, der Saal, alles wich immer weiter zurück. Sie taumelte. Die Wand in ihrem Rücken fing sie auf.
»Aber das pressiert jetzt nicht so«, meinte Thomas Bruckner. »Es reicht, wenn du mir nächste Woche Bescheid gibst.«
Sie wollte auflachen. Nächste Woche? Warum nicht gleich heute? Den Eltern blieben nur wenige Tage Zeit! Mit einem Mal entspannte sie sich. Ihre Eltern bräuchten nicht lange zu überlegen, davon war sie überzeugt. Im Grunde kannte sie die Antwort bereits. Daher konnte sie mit fester Stimme sagen: »Ich werd’ mit den Eltern reden.«
»Tu das«, nickte der Bürgermeister.
Maria nickte kurz und drängte sich an Bruckner vorbei. Als sie zwei Schritte weiter war, sagte er mit einem Lächeln in der Stimme: »Dein Onkel hat übrigens erzählt, dass er an Silvester einen Schmuggler verfolgt hat. Bis zu euch, Maria.«
Langsam drehte sie sich um. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Der Bürgermeister konnte es sicher schlagen sehen.
»Schon komisch, dass danach keine Spuren mehr zu finden waren, meinst nicht auch?«, fragte er freundlich.
»Es hat stark geschneit«, versuchte sie eine Erklärung. Dabei wusste sie, dass es sinnlos war. Der Bruckner ahnte etwas, davon war sie überzeugt.
»Ja. Bestimmt sind die Spuren zugeschneit, derweil die Zöllner bei euch im Haus waren.« Er zog seine Taschenuhr aus der Weste und warf einen Blick darauf. »Weißt, Maria, es ist gut, wenn man Freunde an der richtigen Stelle hat«, sagte er, ohne aufzuschauen. »Als euer Freund helf ich euch natürlich, wenn irgendwas nicht passt.«
Damit wollte er wohl sagen, dass die Voigts ihn lieber nicht als Feind haben sollten. »Grad passt alles«, behauptete Maria und sah zu, wie Bruckner die Uhr mit leisem Lächeln wieder wegsteckte. Dann ließ sie ihn grußlos stehen. Für heute hatte sie genug von den Machenschaften, die da offenbar in Planung waren.
Der Schmerz im Handgelenk wurde immer stärker. Maria wollte sich befreien, aber der Mann hielt sie fest wie in einem Schraubstock. Niemand wusste, dass sie mit dem Kramer-Franz nach draußen in den Garten gegangen war, um mit ihm zu reden. Wenn er ihr jetzt etwas antat, da im Gebüsch, würde es keiner erfahren!
Wie konnte sie nur so dumm sein? Die Mutter, Hannes, beide hatten so getan, als müsste sie dem Kaufmann nur ihr Angebot unterbreiten und dann in Ruhe die Antwort abwarten. Keiner von ihnen war auf die Idee gekommen, dass sie sich damit in Gefahr begab. Und falls sie es wussten, war es ihnen egal.
»Sag schon, Maria!«, zischte Kramer. Sein Gesicht schwebte direkt vor ihrem. »Wer weiß sonst noch Bescheid?«
»Nnn…iemand.« Verdammt. Sie stotterte. Dabei wollte sie stark wirken. Auch wenn sie sich alles andere als stark fühlte.
»Du lügst!« Der Kaufmann stieß sie so heftig weg, dass sie fast hingefallen wäre.
»Ich sag’ die Wahrheit«, beteuerte Maria und wiederholte, was sie ihm schon seit Minuten vorbetete. Dass nur sie, Hannes und die Eltern von Bernhards Geschäften wussten. Sie hielt dem drohenden Blick des Mannes stand.
Nach wenigen Sekunden hob der seinen Hut an und wischte sich über die Glatze. »Rück endlich raus damit, was du von mir willst.«
Sie wollte ihm eben ihr Angebot machen, da kam er schon wieder drohend auf sie zu. »Wenn du mich erpressen willst, Maria, vergiss es! Kein Mensch wird dir glauben. Der Tochter von einem vertrottelten Bauern, der nix hat und nix ist.«
Er will mir nur Angst einjagen, redete sich Maria gut zu, um seine Worte nicht an sich heranzulassen. »Das will ich nicht, Kramer«, widersprach sie einigermaßen gefasst. Dennoch zitterte ihre Stimme leicht, als sie fortfuhr. »Ich will für den Bernhard weitermachen! Mit dem Schmuggel! Ich kann genauso gut die Ware über den Pass bringen.«
Sein Gelächter klang, als sei jeder Ton zu kleinen weißen Kristallen gefroren. In Maria begann es zu brodeln. Ihre Furcht war wie weggeblasen. Kramers Wut konnte sie ertragen, nicht aber, dass er sie auslachte.
»Gut, ich vergess’, dass du von meinen Geschäften mit deinem feinen Herrn Bruder weißt«, sagte der Kaufmann, nachdem er sich beruhigt hatte. »Aber, Maria, ehrlich, wie stellst du dir das vor?« Er musterte sie von oben bis unten. »Du bist eine Frau. Eine sehr adrette junge Frau, wenn ich das so sagen darf. Deine Eltern sollten dir endlich einen Burschen suchen, der dir die Flausen austreibt.«
Die schwere Pranke des Kaufmanns legte sich bleiern auf ihre Schulter. Sie spannte jeden Muskel an, um nicht zu schreien. »Was, wenn wir über zwanzig Liter Petroleum haben?«
Obwohl er nicht einmal zudrückte, schmerzte es mehr als die Umklammerung von vorhin. Maria verkniff es sich, die Hand wegzuschlagen. Stattdessen blieb sie stehen. Stolz und aufrecht. Das schien ihn zu beeindrucken, denn er zog seinen Arm zurück. »Du hast nicht die Kraft, so ein Gewicht über den Pass zu tragen, Mädel.«
Sie rieb sich die Oberarme. Wieso hatte ihre Familie sie dazu mehr oder weniger gezwungen? Nun stand sie hier vor diesem Mann. Sie zitterte, aber mehr innerlich als der Kälte wegen. Erst musste sie sich beschimpfen und bedrohen, dann auslachen und jetzt auch noch bemitleiden lassen. Mit aller Gewalt unterdrückte sie den Drang wegzurennen. Die Blöße würde sie sich nicht geben!
»Dir hat doch das Geld, das du mit dem Bernhard verdient hast, ganz gut zu Gesicht gestanden. Gib’s zu«, sagte sie stattdessen frostig. »Und wer außer mir soll das jetzt für dich übernehmen? Dein Rudi etwa?«
Das entlockte dem Kramer nur ein Schnauben. Er klang wie ein Pferd, das seinen Unmut durch die Nüstern blies. »Der Rudi ist für derlei nicht Manns genug«, erwiderte er. Die Kälte, mit der er sprach, stand der ihren in nichts nach. »Der Franz, der hätte das gepackt. Aber der hat ja für den Kaiser sein Leben gelassen«, tönte jetzt die Stimme des stolzen Vaters. So war es schon vor dem Krieg gewesen, wenn der Kaufmann über seine Söhne gesprochen hatte.
»Du willst also nicht, dass der Rudi das irgendwann macht?«, vergewisserte sich Maria.
»So ist es«, bestätigte der Kramer. »Und ich will auch nicht, dass eine Frau das macht. Das ist mein letztes Wort.«
»Aber –«
Er unterbrach sie mit einer raschen Handbewegung. »Kein aber. Mit dem Bernhard hat es funktioniert. Mit dir funktioniert es nicht.«
»Dem Bernhard hat wer geholfen«, platzte Maria da heraus. Sofort hatte sie die volle Aufmerksamkeit des Mannes.
»Also doch noch jemand, der Bescheid weiß!«, schimpfte er los. »Was hat dein Bruder sich nur dabei gedacht, alle und jeden einzuweihen? Irgendwann wird so ein windiger Mensch in meinen Laden kommen und –«
»Es wird keiner kommen«, warf Maria ein und wollte sagen, dass sie es war, die ihrem Bruder geholfen hatte. Doch da wurde ihr klar, dass sie das keinen Schritt weiterbrachte. Sie war und blieb eine Frau. Und mit Frauen wollte der Kaufmann nicht zusammenarbeiten. »Er heißt Matteo«, setzte sie rasch hinzu. »Einer von den Finanzern aus Südtirol.« Noch während sie das sagte, ahnte sie, dass sie sich damit in neue Schwierigkeiten brachte. Bestimmt würde der Kaufmann sie wieder angreifen. Der einzige Weg, ihre Haut zu retten, war Farbe zu bekennen.
Doch der Kramer wirkte nicht zornig. Stattdessen strich er nachdenklich seinen Schnäuzer glatt. »So, so«, murmelte er, »ein Finanzer. Der wird einen Teufel tun und zu mir in den Laden kommen.« Zum ersten Mal an diesem Nachmittag schaute er sie mit offenem Interesse an. »Ich will den Kerl kennenlernen. Wie kann ich ihn treffen?«
Jetzt gab es kein Zurück. Sie musste dieses Gespräch zu einem brauchbaren Ende bringen. »Ich schau, dass ich ihn finde, dann geb ich dir Bescheid«, schlug sie vor und trat auf den Weg zurück. In ein paar Tagen würde sie immer noch behaupten können, dass dieser Matteo nicht aufzutreiben war oder kein Interesse hatte.
»Ach, da bist du, Franz.« Josef Amperger trat um die Hausecke. »Machst wieder heimlich Geschäfte?«
»Gut, dass du kommst, Josef.« Kramer ließ Maria einfach stehen und ging zu dem Apotheker hinüber. »Ich müsst’ was mit dir klären.«
Maria sah, wie Amperger in ihre Richtung schaute. Der Kaufmann drehte sich noch einmal zu ihr. »Du meldest dich, Maria, wenn du was weißt.« Damit war sie entlassen. Sie nickte und schritt an den beiden Männern vorbei Richtung Rathaus.
»Dem Bernhard seine Familie weiß, dass er für uns geschmuggelt hat«, hörte sie Kramer sagen. Die Worte veranlassten sie, langsamer zu gehen und schnell hinter einen Baum zu schlüpfen. Hinter ihr war ein Zischen und Rascheln zu hören.
»Jetzt bleib da, Josef«, verlangte Kramer. Offenbar hinderte er den Apotheker daran, ihr zu folgen. »Mit der werd’ ich schon fertig. Die Voigt-Maria wird uns keine Schwierigkeiten machen. Dafür sorg ich schon.«
»Bist du dir sicher, Franz?«, fragte der andere.
»Ich hab da meine Möglichkeiten«, tönte der Kaufmann. »Wichtiger ist, dass wir wieder zu Geld kommen. Du musst nur schau’n, dass du Saccharin herbeischaffst.«
»Ich werd mit dem Bürgermeister nach Mittersill fahren«, hörte sie den Amperger sagen. »Weil ich dringend mit meinem Lieferanten reden muss, damit er mir Ware zurücknimmt.«
»Wieso das denn?«, wollte Kramer wissen.
»Die Krimmler kaufen einfach keine Arzneien«, jammerte der Apotheker. »Die brauen sich ihre Tropfen und Salben lieber selbst zusammen wie im Mittelalter! In meiner Kasse ist immer weniger Geld. Und jetzt das noch!«
»Du und deine Gier«, sagte der Kaufmann. »Die Apotheke brauchst du in Wahrheit doch gar nicht, gib’s zu. Dein Vater hat dir genug Geld hinterlassen, Josef. Und ich sag’s noch mal: Um das Mädel brauchst du dir keine Sorgen machen.«
Die Worte lösten in Maria eine Flut von Erinnerungen aus. Daran, wie Bernhard ihr vor vielen Wochen gestanden hatte, dass er mit dem Kaufmann und dem Apotheker Geschäfte machte. Er war so aufgeregt gewesen; so überzeugt. Haarklein hatte er ihr alles erzählt und sie so dazu gebracht, ihm zu helfen.
Letztendlich hatte sich herausgestellt, dass sich seine Geschäftspartner zwar auf ihn verlassen konnten, er sich aber nicht auf sie. Zum Dank für sein Schweigen hatten sie von ihm nicht das Geld für das verbrannte Petroleum verlangt.
Und mit denen sollte sie nun selbst Geschäfte machen?
»Wenn du meinst«, hörte sie Amperger brummen. »Wenn ich in Mittersill bin, kann ich mich auch gleich um das Saccharin kümmern.«
Immerhin hatte sie ihren Auftrag erfüllt. Oder auch nicht. Wirklich sicher war sie sich da keineswegs. Der Apotheker war gierig. Wenn er tatsächlich Waren besorgte, würde er auch auf deren Verkauf bestehen. Maria wusste: Sie war so oder so in riesengroßen Schwierigkeiten. Vielleicht hatte sie Glück und ihre Familie verzieh ihr wenigstens den Fehler mit Matteo. Sie rieb sich das schmerzende Handgelenk. Entschlossen schlang sie ihren Schal zweimal um den Hals. Es wurde Zeit, sich auf den Heimweg zu machen und sich der Wahrheit zu stellen.
Heimwege
Das Dorf versank immer mehr in der Dämmerung. Maria kam sich vor wie ein kleiner Farbklecks in einem Bild, über das sich langsam ein blassgrauer Schleier legte. Ohne es zu wollen, ging sie schneller, bis sie beinahe lief.
Erst als sie die letzten Häuser passiert hatte, jene Stelle, an der der Wasserfall begann oder endete – wie auch immer man es betrachten mochte –, stoppte sie. Das Rauschen war klar und deutlich zu hören. Ein feines Sprühen netzte ihr Gesicht; es kühlte die heißen Wangen. Das Nass vermischte sich mit den Eisskulpturen, die den Wasserfall nach oben hin säumten und wie die Pforte zu einer anderen Welt wirkten. Der Schleier des Dorfes konnte sie nicht mehr verschlucken.
Maria schaute den Weg entlang, der nur wenige Meter vor ihr im Wald verschwand. Ab dort wartete noch über eine Stunde Fußmarsch auf sie. Aber zuerst musste sie zu Atem kommen. Links von ihr stand die Bank, die dort vor Jahren für Wanderer aufgestellt worden war. Herzen, Namen und Daten waren ins Holz geschnitzt, doch nun lag eine dicke Eisschicht über dem Sitz. Darauf konnte sie sich nicht ausruhen. Sie musste weiter, aber sie brachte keinen Schritt zustande. Da war nichts, was sie nach Hause zog. Ein eisiger Wind umwehte sie. Ihre Zähne klapperten, trotzdem blieb sie stehen.
»Jetzt reiß dich zusammen«, hörte sie die Stimme ihrer Mutter, und dazu noch, »du bist kein kleines Kind mehr.«
Das reichte, um weitergehen zu können. Was sollte es auch bringen, noch länger in der Kälte zu stehen? Die Nacht versprach zwar sternenklar zu werden, sodass sie die Dunkelheit nicht fürchten musste. Das tat sie sowieso nie. Dennoch war Maria kein Kind der Nacht. Und ihr war die Wärme der Stube lieb. Zumal ihr seit dem Jahreswechsel die Kälte auch in den Knochen steckte. Ein leichtes Frösteln überkam sie, das schlimmer wurde. Sie hatte Angst vor dem, was sie zu Hause erwartete. Aber es machte es auch nicht besser, wenn sie hier in der Kälte stand.
Entschlossen nahm sie den kürzeren Weg. Sie musste baldmöglichst ihrer Familie gegenübertreten, auch wenn sie nicht wusste, wie sie ihnen von den Gesprächen des Nachmittags erzählen sollte. Aber vielleicht fand sie unterwegs die richtigen Worte; sofern es sie gab, die richtigen Worte.
Unbewusst verlangsamte sie ihren Schritt. Im selben Moment lenkte eine Bewegung im Wald sie ab. Maria hielt inne. Alles, was sie erkennen konnte, war ein kleiner Schatten, der eilig hinter einen Baum huschte. Mehr musste sie auch nicht sehen, um zu wissen, wer sie da beobachtete. Sie sah sein Gesicht deutlich vor sich. Diese Mischung aus Rot und Weiß. Die listigen Augen. Die aufgerichteten Ohren, die sich in alle Windrichtungen drehten, um jedes Geräusch aufzunehmen. Das Lächeln, das nur sie bei Moritz wahrnahm. Alle anderen sahen in ihm die Gefahr, die von einem Rotfuchs ausging.
Natürlich wusste Maria, dass Moritz ein Raubtier blieb, auch wenn sie ihm einen Namen gegeben hatte. Aber seit sie ihn vor einem Jahr aus einer von Bernhards Fallen befreit hatte, war er für sie zu einem stummen Begleiter geworden, von dem sie nichts zu befürchten hatte. Schon damals, als sie die Falle auseinanderdrückte, war ihr das klar geworden.
Moritz hatte sie nicht gebissen, sondern stillgehalten, bis er sein Bein befreien konnte. Er hatte sie kurz angelächelt und war hinkend im Wald verschwunden. Nur wenige Tage später hatte er sie das erste Mal begleitet, und seither kam er immer wieder, vielleicht, um auf sie aufzupassen, redete sie sich ein.
»Reinecke Fuchs«, murmelte Maria. Das war eine der Geschichten, an die sie sich erinnerte. Ihre Großmutter hatte sie früher aus dem großen dicken Buch vorgelesen, das wie ein Schatz in der Kommode aufbewahrt wurde. Wie sie es herausnahm und mit den Handflächen über den Buchdeckel strich, bevor sie das Buch aufschlug … Maria und ihre Brüder saßen vollkommen still um sie herum und lauschten den Märchen und Fabeln. Manchmal waren auch die Eltern anwesend. Sie taten immer unbeteiligt, dabei hatte Maria gehofft, dass sie auch gerne zuhörten und ihre Mutter es nicht ernst meinte, wenn sie sagte, »erzähl den Kindern nicht so viel Unsinn, sondern etwas vom richtigen Leben. Das ist nämlich kein Märchen.«
Die Großmutter hatte darauf immer geantwortet: »Das werden sie noch früh genug lernen müssen, Pauline.«
Wie viele Geschichten hatten sie damals gehört? Wie viele selbst erdacht? Wenn es um Maria herum ruhig war, waren ihr zahlreiche eingefallen. Sie hatte alle für sich behalten. Doch eines Tages waren sie fort gewesen. Wann war das passiert?
»Du bist kein kleines Kind mehr.« Vielleicht hatte sie ihre Geschichten vergessen, als die Mutter diesen Satz zum ersten Mal äußerte. Daran konnte sie sich genau erinnern: Es war an dem Tag gewesen, an dem die Großmutter gestorben war. Das Leben hatte das Märchenbuch für immer geschlossen. Niemand nahm es danach mehr in die Hand. Und irgendwann war es verschwunden.
Die vergangenen Stunden waren ein neuerlicher Beweis, dass man aufhören musste zu träumen. Das Leben hatte der Familie und ihr wieder einen Traum zerstört: den Traum, dass es ihnen einmal wieder besser ginge. Nun war es an Maria, das ihrer Mutter und ihrem Bruder beizubringen. Dem Vater würde sie nichts sagen. Die Mutter wusste besser, was er verstehen konnte und was nicht.
»Vielleicht sollten die Eltern das Angebot vom Bürgermeister annehmen«, überlegte sie laut. Ihre Stimme klang so plötzlich durch den Wald, dass Moritz aufgeschreckt im Unterholz verschwand. Jetzt war sie alleine mit sich und ihren Gedanken.
Wenn die Eltern den Hof verkauften, wären sie tatsächlich viele Sorgen los. Dann stellte sich nicht mehr die Frage, was man noch schmuggeln könnte. Keine eiskalten Nächte mehr. Keine Verfolger. Etwas mehr Leben und weniger Erschöpfung.
Inzwischen hatte Maria den ersten Teil des Weges geschafft. Diesmal stand sie auf der anderen Seite der Hängebrücke. Ging darauf zu. Ein Windhauch strich über das Konstrukt aus Hanf und Holz. Ihr kam es vor, als hörte sie die Brücke seufzen. Sie rief sich zur Ordnung und griff mit beiden Händen nach den Seilen, die rechts und links als Handlauf dienten.
Sogar durch die Handschuhe hindurch waren die groben Rillen zu spüren. Marias Herzschlag beschleunigte sich. Vorsichtig setzte sie einen Fuß auf die verschneite Brücke. Sofort begann der Untergrund sich zu bewegen. Ganz leicht nur, doch genug, um sie den Fuß zurückziehen zu lassen. Verzagt starrte sie die schneebedeckten Bretter entlang. Dort vorne, auf halber Strecke, sah sie sich stehen. Ein fünfjähriges Mädchen, viel zu dünn, viel zu klein, in den ausgelatschten Stiefeln des großen Bruders.
»Jetzt beeil dich, Maria! Zu Hause wartet noch Arbeit auf uns«, rief die Mutter von der anderen Seite, wo der Rest der Familie stand. Der Vater hielt Bernhard an der Hand, und Hannes schlug mit einem Ast in die Luft, als kämpfte er gegen einen Drachen …
Wieso war alles wie immer? Wieso dachte die Mutter an die Arbeit? Und nicht, wie sie, an die Großmutter? Maria konnte es nicht verstehen. Schließlich hatten sie sie gerade alleine zurückgelassen, auf dem Friedhof. Es musste ihr doch kalt sein, und Maria hatte ihr auch nicht den gestrickten Teddybären mitgeben dürfen. »Lass das«, hatte der Vater leise gesagt, als sie ihn in den Sarg legen wollte, bevor sie den Deckel schlossen.
Bestimmt war es für die Großmutter dort zu eng. Wo sie doch Platz brauchte, weil sie sich im Schlaf immer so viel bewegte. Maria wusste das, weil sie oft zur Großmutter ins Bett geschlichen war, um noch mehr Geschichten zu hören über Königinnen und Prinzessinnen. Aber auch über Bauerntöchter, wie sie es selbst eine war.
»Weißt du, Maria«, hatte die Großmutter dann immer gesagt, »auch wir Frauen können Helden sein. Die Männer sehen es nur nicht gerne, und die meisten Frauen verstehen das auch nicht.«





























