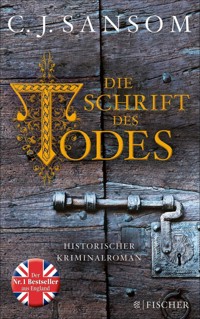
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Matthew Shardlake
- Sprache: Deutsch
*** Platz 1 der englischen Bestsellerlisten *** Matthew Shardlake ermittelt in seinem sechsten Fall Tudor-London, Sommer 1546: Die Ära König Heinrichs VIII neigt sich ihrem Ende zu. Unerbittlich bekämpfen sich Katholiken und Protestanten, die Jagd auf Ketzer wird immer gnadenloser. In dieser aufgeheizten Situation wird Matthew Shardlake in den Palast der Königin gerufen. Er soll ein brisantes Buch wiederfinden, das sie verfasst hat und das aus ihren Gemächern gestohlen wurde. Der Inhalt dieses Werkes könnte sie aufs Schafott bringen. Doch bevor Shardlake und sein Gehilfe Jack Barak die Suche aufnehmen, wird in London ein Drucker tot aufgefunden. Bei ihm findet sich eine Seite des Buches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1088
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Christopher Sansom
Die Schrift des Todes
Historischer Kriminalroman
Über dieses Buch
Tudor-London, Sommer 1546: Die Ära König Heinrichs VIII neigt sich ihrem Ende zu. Unerbittlich bekämpfen sich Katholiken und Protestanten, die Jagd auf Ketzer wird immer gnadenloser. In dieser aufgeheizten Situation wird Matthew Shardlake in den Palast der Königin gerufen. Er soll ein brisantes Buch wiederfinden, das sie verfasst hat und das aus ihren Gemächern gestohlen wurde. Der Inhalt dieses Werkes könnte sie aufs Schafott bringen. Doch bevor Shardlake und sein Gehilfe Jack Barak die Suche aufnehmen, wird in London ein Drucker tot aufgefunden. Bei ihm findet sich eine Seite des Buches.
»Wunderbar unterhaltend. Geschichte war nie so real.« Marilyn Stasio, New York Times Book Review
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel ›Lamentation‹ by Mantle, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited, London
© C.J.Sansom 2014
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Umschlagabbildung: Inger Hogstrom/Getty Images
Umschlaggestaltung: bürosüd, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403482-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Roz Brody, Mike [...]
[Kapitel]
Vorbemerkung des Verfassers
Hauptpersonen
Die Schrift des Todes
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Kapitel Siebenunddreißig
Kapitel Achtunddreißig
Kapitel Neununddreißig
Kapitel Vierzig
Kapitel Einundvierzig
Kapitel Zweiundvierzig
Kapitel Dreiundvierzig
Kapitel Vierundvierzig
Kapitel Fünfundvierzig
Kapitel Sechsundvierzig
Kapitel Siebenundvierzig
Kapitel Achtundvierzig
Kapitel Neunundvierzig
Kapitel Fünfzig
Kapitel Einundfünfzig
Kapitel Zweiundfünfzig
Kapitel Dreiundfünfzig
Epilog
Dank
Historische Anmerkungen
Catherine Parr und die Politik in den letzten Monaten Heinrichs VIII.
Für Roz Brody, Mike Holmes, Jan King und William Shaw, die treue Schreibgruppe, für ihre Kommentare und Vorschläge – in diesem Buch wie in den vergangenen sieben.
Vorbemerkung des Verfassers
Die Details der religiösen Auseinandersetzungen im England des sechzehnten Jahrhunderts mögen heute unwichtig erscheinen, doch in den 1540er Jahren ging es dabei buchstäblich um Leben und Tod. Heinrich VIII. hatte sich 1532–33 zwar vom Papst losgelöst und ihn als Oberhaupt der Kirche von England abgelehnt, doch die übrige Zeit seiner Herrschaft schwankte er zwischen der traditionellen katholischen und der protestantischen Glaubenspraxis. Wer die Tradition beibehalten wollte – nicht wenige von ihnen wären am liebsten zum Bündnis mit Rom zurückgekehrt –, galt als Konservativer, Traditionalist oder gar Papist. Wer sich dagegen dem lutherischen und später calvinistischen Glauben verpflichtet fühlte, war ein Radikaler oder Protestant. Die Begriffe konservativ und radikal hatten damals noch nicht wie in späterer Zeit die Konnotation sozialer Reformen. Es gab viele Menschen, die zwischen 1532 und 1558, sei es aus echter Unangepasstheit oder aus Opportunismus, mehrmals die Seiten wechselten. Einige Radikale, wenn bei weitem auch nicht alle, waren der Ansicht, dass es Aufgabe des Staates sei, die Armut im Volk zu lindern; doch Radikale und Konservative waren gleichermaßen entsetzt von den Ideen der Wiedertäufer. Obwohl ihre Anzahl gering war, galten diese Wiedertäufer als das Schreckgespenst der politischen Elite, da sie die Überzeugung vertraten, wahre Christen müssten alle Güter miteinander teilen.
Der Maßstab des akzeptablen Glaubens war 1546 die Beibehaltung der traditionellen katholischen »Transsubstantiationslehre«, die besagte, dass Brot und Wein in der Heiligen Messe durch die segnenden Worte des Priesters in den Leib und das Blut Christi verwandelt wurden. Es war ein traditioneller Glaube, von dem Heinrich niemals abzurücken bereit war; ihn zu leugnen galt als Hochverrat und war gemäß den Six Articles, dem »blutigen Statut« von 1539, mit dem Scheiterhaufen zu bestrafen. Auch das Supremat des Königs über die Kirche durfte nicht angezweifelt werden: Es war Gottes Wille, dass nicht der Papst, sondern der Monarch über die kirchliche Lehre in seinem Reich bestimmte.
Die politischen Ereignisse im Sommer 1546 waren dramatisch und außergewöhnlich. Anne Askew wurde wirklich der Ketzerei angeklagt, gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, und sie hinterließ auch eine Schilderung ihrer Leiden. Die Feierlichkeiten, mit denen Admiral d’Annebault in London willkommen geheißen wurde, fanden im beschriebenen Maßstab statt. Auch die Geschichte mit Bertano ist wahr. Es gab in der Tat ein Komplott seitens der Traditionalisten, das darauf abzielte, Catherine Parr zu Fall zu bringen; und sie hatte tatsächlich das Buch Lamentation of a Sinner (Klage einer Sünderin) verfasst. Es wurde aber unseres Wissens nie gestohlen.
Der Whitehall Palace, den Heinrich von Kardinal Wolsey übernommen und im großen Stil erweitert hatte, erstreckte sich über ein Gebiet, das heute von Scotland Yard, der Downing Street, der Themse und der modernen Durchgangsstraße Whitehall begrenzt wird, und schloss entlang der westlichen Straßenseite ein Gelände mit ein, welches dem vornehmen Zeitvertreib vorbehalten war. Bei zwei desaströsen Feuersbrünsten in den 1690er Jahren brannte der Palast bis auf die Grundmauern nieder; das einzige Gebäude, das bis heute überlebt hat, ist das Banqueting House, das zu Tudorzeiten noch nicht errichtet worden war.
Einige Begriffe hatten zu Tudorzeiten andere Bedeutungen. Der Begriff Dutch, »niederländisch«, bezog sich auf die Einwohner der heutigen Staaten Niederlande und Belgien. Mit Scotch, heute Scots, wurden die Schotten bezeichnet.
Der Name »Catherine« wurde unterschiedlich geschrieben – Catherine, Katharine, Katryn und Kateryn –, in dieser letzten Form signierte die Königin ihre Schriften. Ich habe mich für die modernere Fassung »Catherine« entschieden.
Hauptpersonen
und ihre Rolle im politisch-religiösen Spektrum
In diesem Roman ist die Anzahl realer Personen ungewöhnlich groß. Die Beschreibung ihrer Charaktere ist freilich frei erfunden.
Die königliche Familie:
König Heinrich VIII.
Prinz Edward, 8 Jahre, Thronfolger
Lady Mary, 30 Jahre, streng katholisch
Lady Elizabeth, 12–13 Jahre
Königin Catherine Parr
Catherine Parrs Familie:
(ausnahmslos Reformer)
Lord William Parr, ihr Onkel
Sir William Parr, ihr Bruder
Lady Anne Herbert, ihre Schwester
Sir William Herbert, ihr Schwager
Mitglieder des Geheimen Kronrats:
John Dudley, Lord Lisle, Reformer
Edward Seymour, Earl of Hertford, Reformer
Thomas Cranmer, Erzbischof von Canterbury, Reformer
Thomas, Lord Wriothesley, Lordkanzler, unentschieden
Sir Richard Rich, unentschieden
Sir William Paget, Obersekretär, unentschieden
Stephen Gardiner, Bischof von Winchester, Traditionalist
Thomas Howard, Herzog von Norfolk, Traditionalist
Andere:
William Somers, Hofnarr Heinrichs VIII.
Jane, Hofnärrin von Königin Catherine und Lady Mary
Mary Odell, Zofe der Königin
William Cecil, später Staatssekretär von Königin Elizabeth I.
Sir Edmund Walsingham
John Bale
Anne Askew (Kyme)
Die Schrift des Todes
Kapitel Eins
Ich wollte sie nicht brennen sehen. Grausame Spektakel hatte ich nie gemocht, noch nicht einmal die Bärenhatz, und in diesem Falle sollten vier Menschen, darunter eine Frau, bei lebendigem Leibe auf dem Scheiterhaufen brennen, und das nur, weil sie nicht glauben mochten, dass in Brot und Wein der Heiligen Wandlung Christi Leib und Blut gegenwärtig seien. Im Jahre 1546 hatte bei uns in England die Jagd auf Häretiker ihren Höhepunkt erreicht.
Ich war von meiner Kanzlei in Lincoln’s Inn zu Master Rowland bestellt worden, unserem Kämmerer. Trotz meines hohen Ranges – ich war mittlerweile zum Serjeanten avanciert – konnte unser oberster Barrister, Master Rowland, mich nicht leiden. Vermutlich hatte sein Stolz es noch immer nicht verwunden, dass ich es drei Jahre zuvor ihm gegenüber – aus gutem Grunde – an Respekt hatte mangeln lassen. Ich überquerte den Hof, dessen rote Backsteinmauern von der Sommersonne milde beschienen waren, und grüßte im Vorübergehen die schwarz gewandeten Amtskollegen. Ich blickte hinauf zu den Räumlichkeiten meines alten Widersachers Stephen Bealknap. Seine Läden waren geschlossen. Er lag seit Anfang des Jahres krank zu Bett und war schon etliche Wochen nicht mehr gesehen worden. Einige munkelten gar, er liege im Sterben.
Ich begab mich zu den Amtsräumen des Kämmerers und klopfte an die Tür. Eine durchdringende Stimme hieß mich eintreten. Rowland saß an seinem Schreibtisch. Die Wände des weitläufigen Saales waren von Regalen gesäumt, in denen wuchtige Gesetzesbände Rowlands Status spiegelten. Er war alt, schon über sechzig, spindeldürr, dabei aber hart wie Eichenholz und besaß ein schmales, zerfurchtes, missmutiges Gesicht. Sein langer weißer Bart, nach gängiger Manier gegabelt, war sorgfältig gekämmt und reichte ihm bis über die Brust seines seidenen Wamses. Als ich ins Zimmer trat, war er damit beschäftigt, die Gänsefeder anzuspitzen. Nun blickte er zu mir auf. Seine Finger wiesen wie die meinen vom jahrelangen Gebrauch der Tinte schwarze Flecken auf.
»Gott zum Gruße, Serjeant Shardlake«, schnarrte er und legte das Messer beiseite.
Ich verneigte mich. »Gott zum Gruße, Master Rowland.«
Er wies mir einen Stuhl zu und maß mich mit strenger Miene.
»Eure Geschäfte gehen gut?«, fragte er. »Habt Ihr viele Fälle ab Michaeli?«
»Durchaus, Sir.«
»Wie ich höre, erhaltet Ihr vom Anwalt der Königin keine Aufträge mehr?« Seine Stimme klang beiläufig. »Schon seit einem Jahr?«
»Ich habe genügend andere Fälle, Sir. Und meine Pflichten für den Court of Common Pleas nehmen doch viel Zeit in Anspruch.«
Er wiegte nachdenklich den Kopf. »Angeblich mussten einige Würdenträger der Königin vor dem Geheimen Kronrat Rede und Antwort stehen. Wegen ketzerischer Ansichten.«
»Es geht das Gerücht, ja. Doch in den vergangenen Monaten sind schon so viele befragt worden.«
»Ich sehe Euch neuerdings wieder öfter hier bei uns im Gottesdienst.« Rowland grinste spöttisch. »Passt Ihr Euch etwa den Umständen an? Eine kluge Haltung in diesen bewegten Zeiten. Man tut gut daran, in die Kirche zu gehen, seine Zunge zu hüten und dem Wunsche des Königs Folge zu leisten.«
»So ist es, Sir.«
Er nahm die zugespitzte Feder, spuckte darauf, um sie weich zu machen, und rieb sie an einem Tuche trocken. Dann blickte er mit ungewohnter Schärfe zu mir auf. »Wisst Ihr, dass am sechzehnten Juli – das ist der Freitag in einer Woche – Mistress Anne Askew und drei weitere Personen auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden sollen?«
»Ganz London spricht darüber. Man munkelt sogar, sie sei noch nach dem Urteilsspruch der Folter unterzogen worden. Schon merkwürdig.«
Rowland zuckte die Schultern. »Klatsch und Tratsch. Das Frauenzimmer hat zur falschen Zeit von sich reden gemacht. Lässt ihren Gemahl im Stich, kommt hierher nach London und verstößt in ihren Predigten offen gegen die Sechs Artikel! Dann weigert sich das Weib zu widerrufen und zankt sich vor aller Welt mit den Richtern.« Er schüttelte den Kopf und beugte sich zu mir vor. »Ihre Hinrichtung soll ein großes Spektakel werden. Etwas Vergleichbares hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Der König wünscht, dass ein jeder sehe, wohin das Ketzertum einen führt. Der halbe Kronrat wird zugegen sein.«
»Seine Majestät nicht?« Es hatte Gerüchte gegeben, dass der König persönlich der Hinrichtung beiwohnen könnte.
»Nein.«
Ich wusste, dass Heinrich im Frühjahr ernsthaft krank gewesen war; seither hatte er sich kaum noch sehen lassen.
»Seine Majestät möchte, dass alle Londoner Zünfte bei der Hinrichtung vertreten sind«, sagte Rowland und fügte nach kurzer Pause hinzu: »Auch die Inns of Court, die Anwaltskammern. Und Ihr sollt Lincoln’s Inn vertreten.«
Ich starrte ihn an. »Ich, Sir?«
»Ihr übernehmt weniger gesellschaftliche und offizielle Pflichten, als es Eurem Stande ziemt, Serjeant Shardlake. Da niemand sich freiwillig erbot, musste ich eine Entscheidung treffen. Und meines Erachtens ist die Reihe nun an Euch.«
Ich seufzte. »Ich bin in der Tat ein wenig nachlässig gewesen, was derlei Pflichten anbelangt. Ich werde mich bessern, wenn Ihr es wünscht.« Ich holte tief Luft. »Nur erspart mir diesen grausigen Anblick, ich bitte Euch. Ich habe noch nie jemanden brennen sehen und auch kein Verlangen danach.«
Rowland winkte verächtlich ab. »Ihr seid viel zu zimperlich. Merkwürdig, da Ihr doch der Sohn eines Bauern seid. Außerdem habt Ihr bereits einer Hinrichtung beigewohnt, ich weiß es. Auf Lord Cromwells Geheiß wart Ihr Zeuge bei der Enthauptung Anne Boleyns.«
»Das war schlimm genug. Doch Feuer ist schlimmer.«
Er tippte auf das Schriftstück, das er vor sich liegen hatte. »Dies hier ist die Aufforderung an mich, jemanden aus unseren Reihen zur Teilnahme zu verpflichten. Unterzeichnet von Paget, dem Sekretär des Königs, persönlich. Ich muss ihm noch heute Abend den Namen nennen. Es tut mir leid, Serjeant, aber meine Wahl fällt auf Euch.« Er erhob sich, womit das Gespräch beendet war. Ich stand ebenfalls auf und verneigte mich wieder.
»Danke, dass Ihr künftig mehr Pflichten innerhalb unserer Innung übernehmen wollt«, sagte Rowland, seine Stimme wieder glatt und geschmeidig. »Ich will sehen« – er stockte kurz – »was demnächst ansteht.«
Am Tag der Hinrichtung erwachte ich schon früh. Sie war erst auf die Mittagsstunde angesetzt, aber ich war viel zu bedrückt, um meine Kanzlei aufzusuchen. Pünktlich wie immer brachte mir mein neuer Steward Martin Brocket um sieben Uhr morgens Leinentücher und einen Krug mit heißem Wasser in mein Schlafgemach, wünschte mir einen guten Morgen und legte mir Hemd, Wams und Sommerrobe zurecht. Wie stets war sein Gebaren ernst, ruhig und ehrerbietig. Seit er mit seiner Frau Agnes im Winter zu mir gekommen war, lief in meinem Haushalt alles wie am Schnürchen. Durch die halboffene Tür konnte ich hören, wie Agnes den Jungen Timothy darum bat, ihr frisches Wasser zu holen, und das Mädchen Josephine aufforderte, sich mit dem Morgenbrot zu beeilen, damit der Tisch für mich bereit sei. Ihr Ton war unbekümmert und freundlich.
»Wieder ein schöner Tag, Sir«, bemerkte Martin schüchtern. Er war in den Vierzigern, hatte schütteres, helles Haar und fade, unscheinbare Züge.
Ich hatte keinem meiner Bediensteten erzählt, dass ich der Hinrichtung beiwohnen würde. »In der Tat«, antwortete ich daher. »Ich bleibe heute Morgen hier, gehe erst zu Mittag aus dem Haus.«
»Sehr wohl, Sir. Der Tisch ist in Kürze gedeckt.« Er verneigte sich und zog sich zurück.
Ich stand auf, und ein Krampf im Rücken ließ mich zusammenzucken. Zum Glück hatte ich diese Zustände jetzt weniger häufig, da ich getreulich die Leibesübungen ausführte, die mir mein Freund Guy, ein Arzt, empfohlen hatte. Wie gern hätte ich Martins Anwesenheit als angenehm empfunden, doch während ich seine Frau durchaus mochte, hatte mir seine kühle, steife Förmlichkeit von Anfang an Unbehagen bereitet. Ich wusch mir das Gesicht, legte ein sauberes, nach Rosmarin duftendes Leinenhemd an und schalt mich töricht, da es doch mir, dem Hausherrn, oblag, einen weniger formellen Ton anzuschlagen.
Ich musterte mein Gesicht im stählernen Spiegel. Noch mehr Runzeln, dachte ich. In diesem Frühjahr war ich vierundvierzig geworden. Das Gesicht faltig, die Haare grau, der Rücken krumm. Da neuerdings Bärte groß in Mode waren – auch das Gesicht meines Gehilfen Barak zierte eine ansehnliche, braune Krause –, hatte auch ich mir vor ein paar Monaten einen kurzen Bart stehen lassen. Er war jedoch wie mein Haupthaar von grauen Strähnen durchzogen gewesen, was ich als unvorteilhaft empfunden hatte.
Ich blickte aus dem unterteilten Fenster hinunter in den Garten, wo ich Agnes erlaubt hatte, einige Bienenstöcke zu platzieren und einen Kräutergarten anzulegen. Die Pflanzen trugen zur Verschönerung bei, dufteten süß und waren zudem sehr nützlich. Die Vögel sangen, und die Bienen umsummten die Blüten. Und ausgerechnet an diesem sonnigen, farbenfrohen Tag sollten eine junge Frau und drei Männer so grausam zu Tode kommen!
Mein Blick fiel auf einen Brief auf meinem Nachttisch. Er kam aus Antwerpen in den spanischen Niederlanden, wo mein neunzehnjähriges Mündel Hugh Curteys lebte und für die englischen Kaufleute dort tätig war. Hugh war jetzt glücklich. Anstatt wie ursprünglich geplant in einer der deutschen Hansestädte sein Studium zu absolvieren, hatte er in Antwerpen Fuß gefasst. Überraschenderweise hatte er sein Interesse am Tuchhandel entdeckt, vornehmlich an der Bewertung seltener Seidenstoffe und neuer Materialien wie der Baumwolle, die aus der Neuen Welt zu uns kam. Hugh schwärmte in seinen Briefen von dieser Tätigkeit und von der geistigen und gesellschaftlichen Freiheit, die die große Stadt ihm bot; auch die Tuchmessen und die Debatten und Vorträge in der Rederijkerskamer, der Redekammer, beschrieb er mir. Obwohl auch Antwerpen dem Heiligen Römischen Reich angehörte, ließ der katholische Kaiser Karl V. die vielen Protestanten, die dort lebten, unbehelligt – freilich um das flandrische Bankenwesen nicht zu gefährden, das seine Kriege finanzierte.
Hugh erwähnte niemals das finstere Geheimnis, das wir seit unserer Begegnung vor einem Jahr teilten, seine Briefe waren ausnahmslos heiter. In diesem jedoch schrieb er von der Ankunft englischer Flüchtlinge in Antwerpen: »Sie sind in einem beklagenswerten Zustand und bitten die Kaufleute um Beistand. Es sind Reformer und Radikale, die befürchten, in das Netz der Verfolgung zu geraten, welches Bischof Gardiner über ganz England geworfen hat.«
Seufzend legte ich meine Robe an und begab mich hinunter zum Frühstück. Ich durfte nicht länger säumen, musste diesen grausigen Tag beginnen.
Die Hatz auf Häretiker hatte im Frühjahr begonnen. Den Winter über schien die wankelmütige Religionspolitik des Königs auf die Seite der Reformer umzuschwenken; er hatte das Parlament überredet, es möge ihm die Macht verleihen, die Chorherrenstifte aufzulösen, in denen Priester gegen Bezahlung für das Seelenheil verstorbener Stifter Messen lasen. Doch wie viele hegte auch ich den Verdacht, dass die Handlungsweise des Königs weniger religiös als finanziell motiviert und der Notwendigkeit geschuldet war, die gewaltigen Geldsummen einzutreiben, die der Krieg gegen Frankreich noch immer verschlang, solange englische Truppen in Boulogne unter Belagerung standen. Die Währung verlor auf sein Betreiben hin immer weiter an Wert, so dass die Preise nach oben schnellten wie noch niemals zuvor. Die neuesten Silberschillinge bestanden in Wahrheit aus Kupfer, welches mit einer hauchdünnen Silberschicht überzogen war. Und diese hatte sich an der erhabensten Stelle bereits abgeschabt. »Alte Kupfernase« lautete deshalb der jüngste Spitzname des Königs. Die Händler verlangten soviel Abzug auf die neuen Münzen, dass diese kaum noch den Wert eines Sixpence-Stückes besaßen, obschon die Löhne noch immer nach dem Nennwert des Geldes gezahlt wurden.
Dann kehrte im März Bischof Stephen Gardiner – in Glaubensdingen der konservativste Berater des Königs – nach England zurück. Er hatte einen neuen Vertrag mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ausgehandelt. Seit April ging nun das Gerücht, dass Personen, ungeachtet ihres Standes, aufgefordert waren, Rechenschaft über ihre Ansichten zur Messe und den Besitz verbotener Bücher abzulegen. Die Befragungen betrafen sowohl den Hofstaat des Königs als auch jenen der Königin; eines der vielen Gerüchte, die in den Straßen kursierten, besagte, dass Anne Askew, die bekannteste der wegen Ketzerei zum Tode verurteilten Personen, über Verbindungen zum Gefolge der Königin verfügt, vor den Hofdamen gepredigt und für ihren Glauben geworben habe. Ich hatte Königin Catherine nicht mehr gesprochen, seit ich sie vor einem Jahr einer potentiellen Gefahr ausgesetzt hatte, und mir war bewusst, sehr zu meinem Bedauern, dass ich diese sanftmütige, edle Dame wohl nicht mehr wiedersehen würde. Doch hatte ich oft an sie gedacht, und seit sich die Jagd auf Radikale verschärft hatte, war mir ernstlich bang um sie; erst vorige Woche war eine lange Liste verbotener Bücher veröffentlicht worden. Außerdem hatte man den Höfling George Blagge, einen Freund des Königs, der Ketzerei überführt und zum Feuertod verurteilt.
Ich selbst hegte inzwischen für keine Seite im Religionsstreit mehr Sympathien und zweifelte bisweilen gar an der Existenz Gottes. Da ich jedoch früher in reformerischen Kreisen verkehrt hatte, hielt ich wie die meisten Menschen in diesem Jahr den Blick tunlichst gesenkt und den Mund geschlossen.
Gegen elf machte ich mich auf den Weg. Timothy hatte mir den braven Genesis gesattelt vor die Tür gebracht und den Aufsitzblock bereitgestellt. Der Junge war jetzt dreizehn Jahre alt und wurde größer, dünn und schlaksig. Peter, meinen früheren Burschen, hatte ich im Frühjahr in die Lehre geschickt, damit er vorankam im Leben. Ähnliche Pläne hegte ich mit Timothy, sobald er vierzehn wäre.
»Guten Morgen, Sir.« Er schenkte mir sein schüchternes, zahnlückiges Lächeln und strich sich dabei eine schwarze Strähne aus der Stirn.
»Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir?«
»Gut, Sir.«
»Bestimmt vermisst du Peter.«
»Ja, Sir.« Er blickte zu Boden und stieß mit der Fußspitze einen Stein beiseite. »Aber ich komme schon zurecht.«
»Du kommst sogar sehr gut zurecht«, versetzte ich aufmunternd. »Aber vielleicht sollten wir allmählich über eine Lehrstelle für dich nachdenken. Hast du dir schon überlegt, was du mit deinem Leben anfangen möchtest?«
Er starrte mich an, jähe Furcht in den braunen Augen. »Nein, Sir, ich, ich wollte eigentlich bei Euch bleiben.« Er blickte um sich, hinaus auf die Straße. Er war immer schon ein stiller Junge gewesen, ohne Peters Selbstvertrauen, und ich erkannte, dass ihm der Gedanke, in die Welt hinauszugehen, eine Heidenangst einjagte.
»Nun ja«, sagte ich besänftigend, »es eilt ja nicht.« Er sah erleichtert drein. »Und jetzt muss ich fort«, – ich seufzte –, »die Pflicht ruft.«
Ich ritt durch das Temple Bar-Tor und bog in die Gifford Street, die nach Smithfield führte, zum Richtplatz. Viele Menschen hatten denselben staubigen Weg eingeschlagen, einige zu Pferde, die meisten zu Fuß, Reiche wie Arme, Männer und Frauen, sogar ein paar Kinder waren darunter. Einige von ihnen, besonders jene in den dunklen Gewändern der Radikalen, machten ernste Mienen, während andere gleichgültig dreinblickten und wieder andere einen Ausdruck freudiger Erwartung zur Schau trugen. Ich hatte unter der schwarzen Kappe die weiße Serjeantenhaube aufgesetzt und in der Hitze zu schwitzen begonnen. Gereizt musste ich daran denken, dass ich am Nachmittag mit meiner schwierigsten Klientin verabredet war, Isabel Slanning, deren Fall – ein Erbschaftsstreit mit ihrem Bruder – zu den dümmsten und kostspieligsten gehörte, die mir je untergekommen waren.
Ich ritt an zwei jungen Lehrburschen in ihren blauen Kitteln und Kappen vorüber. »Warum ausgerechnet zur Mittagsstunde?«, hörte ich den einen murren. »In der prallen Sonne!«
»Was fragst du mich? Irgendeine Vorschrift vermutlich. Damit es der guten Mistress Askew auch hübsch heiß wird unterm Hintern. Die heizen ihr mächtig ein, was?«
Smithfield war bereits dicht bevölkert. Auf dem Platz, wo zweimal wöchentlich der Viehmarkt stattfand, drängten sich die Leute und blickten allesamt auf einen eingezäunten Bereich in der Mitte. Dieser wurde von Soldaten bewacht, die weiße Waffenröcke mit dem Georgskreuz und stählerne Helme trugen. Mit strengen Mienen präsentierten sie ihre Hellebarden. Falls es zu Protesten käme, würden sie mit aller Schärfe durchgreifen. Ich betrachtete sie wehmütig; wann immer ich Soldaten sah, musste ich an meine Freunde denken, die zu Tode gekommen waren wie ich selbst beinahe, als das stattliche Schiff, die Mary Rose, bei dem Versuch, den französischen Invasoren zu trotzen, gesunken war. Ein Jahr lag dies nun zurück, dachte ich, fast bis auf den Tag genau. Im vergangenen Monat hatte uns die Kunde erreicht, dass der Krieg nun fast vorüber sei. Unser König war mit Frankreich und auch Schottland bis auf wenige Punkte handelseins geworden. Ich entsann mich der Soldaten, die ins Wasser gestürzt waren, ihrer frischen, jungen Gesichter, und schloss die Augen. Für sie kam dieser Friede zu spät.
Vom Rücken meines Pferdes aus hatte ich einen besseren Ausblick als die meisten, besser, als mir lieb war, denn die Menge drängte die Reiter nach vorn, auf den abgesperrten Bereich zu. In dessen Mitte waren drei Brandpfähle aus Eichenholz, an die sieben Fuß hoch, in den staubigen Boden getrieben worden. Ein jeder war mit schweren Ringen an den Seiten versehen, durch welche die Londoner Konstabler nun Eisenketten zogen. Sie hängten Schlösser in die Glieder und prüften, ob die Schlüssel passten. Ihre Gesten waren ruhig und sachlich. Etwas abseits standen weitere Konstabler um einen gewaltigen Scheiterhaufen aus dicken Reisigbündeln. Zum Glück hatte es nicht geregnet: Feuchtes Holz, das wusste ich, brannte langsamer, wodurch sich die Qualen der Opfer grausam in die Länge zogen. Vor dem Scheiterhaufen stand, weiß getüncht, ein hohes, hölzernes Rednerpult. Hier würde vor der Verbrennung eine Predigt gehalten werden, ein letzter Aufruf an die Ketzer, ihre Ansichten zu widerrufen. Der Prediger wäre Nicholas Shaxton, der frühere Bischof von Salisbury, ein radikaler Reformer. Er war wie die anderen zum Feuertod verurteilt worden, hatte jedoch widerrufen und damit sein Leben gerettet.
An der Ostseite des Platzes ragte hinter einer Reihe schöner, bunt getünchter Häuser der alte Kirchturm des ehemaligen Klosters St. Bartholomew auf. Als es vor sieben Jahren aufgelöst worden war, waren seine Ländereien an ein Mitglied des Geheimen Kronrates gefallen, Sir Richard Rich, der daraufhin diese neuen Gebäude hatte errichten lassen. In den Fenstern drängten sich Schaulustige. Vor dem Pförtnerhaus des ehemaligen Klosters war unter einem grünweißen Baldachin eine hohe Tribüne errichtet worden. Auf einer langen Bank lagen dicke, farbenprächtige Kissen. Von hier aus würden der Lord Mayor und die Ratsherren der Verbrennung beiwohnen. Unter denen, die wie ich zu Pferde saßen, erkannte ich viele Stadtbeamte und nickte ihnen zu. Ein wenig abseits stand ein Grüppchen Männer mittleren Alters beisammen, ernst und verstört dreinblickend. Ich hörte einige Worte in einer Sprache, die sie als flämische Kaufleute auswies.
Um mich herum nahm ich das vielstimmige Gemurmel und den heftigen Gestank einer Londoner Menschenmenge im Sommer wahr.
»Es heißt, sie sei in die Streckbank gespannt worden, bis Arm- und Beinsehnen rissen –«
»Sie durften sie nach dem Richtspruch nicht mehr der Folter unterziehen –«
»Auch John Lassells wird brennen. Dabei war er es doch, der dem König die Tändeleien Catherine Howards zugetragen hat –«
»Es heißt, auch Catherine Parr sei in Gefahr. Er hat womöglich schon bald eine siebente Gemahlin –«
»Erspart man den Frevlern das Feuer, wenn sie widerrufen?«
»Dafür ist es jetzt zu spät.«
Unweit des Baldachins geriet die Menge in Bewegung, und die Leute reckten die Hälse, als mehrere Männer mit seidenen Roben und Kappen, dicken Goldketten um die Hälse, im Schutze von Soldaten aus dem Pförtnerhaus traten. Sie erstiegen bedächtig die Stufen zur Tribüne, und während die Soldaten vor ihnen Stellung bezogen, nahmen sie auf der langen Bank ihre Plätze ein. Alsdann rückten sie Kappen und Ketten zurecht und starrten mit ernsten, gefassten Mienen in die Menge. Die meisten von ihnen waren mir bekannt: der Bürgermeister von London, Mayor Bowes, in seiner roten Amtsrobe; der Herzog von Norfolk, älter und hagerer als vor sechs Jahren, einen Ausdruck stolzer Verachtung auf dem hochmütigen, strengen Gesicht. An Norfolks Seite saß in einer weißen Seidensoutane unter dem schwarzen Chorhemd ein Geistlicher, den ich nicht kannte. Ich vermutete aber, dass es sich um Bischof Gardiner handeln müsse. Er war um die sechzig, von gedrungener Statur, dunklem Aussehen und besaß eine stolze Adlernase sowie große, dunkle Augen, die er über die Menge schweifen ließ. Er beugte sich zu Norfolk hinüber und raunte ihm etwas zu, woraufhin dieser ein hämisches Grinsen aufsetzte und heftig nickte. Diese beiden, behaupteten viele, würden England lieber heute als morgen wieder der Römischen Kurie zuführen.
Neben ihnen saßen drei Männer, von denen ein jeder unter Thomas Cromwell groß geworden, nach dessen Fall jedoch zur konservativen Fraktion im Kronrat übergelaufen war. Sie pflegten den Mantel nach dem Winde zu kehren und verbargen jeweils zwei Gesichter unter der Haube: William Paget, der Sekretär des Königs, von dem der Brief an Rowland stammte, hatte eine breite, brettflache Stirn und einen buschigen, braunen Bart. Sein dünnlippiger Mund wies an einer Seite scharf nach unten, so dass ein schmaler Schlitz entstand. Paget, hieß es, stehe dem König jetzt näher als jeder andere; sein Spitzname lautete daher »Meister des Taktierens«.
Neben Paget saß hoch aufgeschossen, mager und mit einem abstehenden, rostroten Bärtchen Lordkanzler Thomas Wriothesley, das Oberhaupt der juristischen Zunft. Der Dritte im Bunde war mein Erzfeind Sir Richard Rich, welcher ungeachtet der Korruptionsvorwürfe vor zwei Jahren und trotz der Tatsache, dass sein Name mit den übelsten Machenschaften der vergangenen fünfzehn Jahre im Zusammenhang stand und er ein gemeiner Mörder war, wie ich mit Gewissheit wusste, noch immer im Kronrat saß. Ich war nur deshalb vor ihm sicher, weil ich gewisse Kenntnisse über ihn hatte und nach wie vor unter dem Schutze der Königin stand. Was immer dies noch wert sein mochte, dachte ich mit Unbehagen. Ich sah zu Rich hinüber. Ungeachtet der großen Hitze trug er eine grüne Schaube mit Pelzkragen. Zu meinem Erstaunen las ich bange Sorge in seinem schmalen, gutaussehenden Gesicht. Sein langes Haar unter der edelsteinbesetzten Kappe war inzwischen fast gänzlich ergraut. Er nestelte an seiner Goldkette herum, während er den Blick über die Menge schweifen ließ. Plötzlich trafen sich unsere Blicke. Er lief rot an und starrte eine Zeitlang, die Lippen aufeinandergepresst, zu mir herüber. Erst als Wriothesley das Wort an ihn richtete, wandte er sich schließlich ab. Mich schauderte. Meine Bangigkeit übertrug sich auf Genesis, der sogleich unruhig mit den Hufen scharrte. Ich tätschelte ihm beschwichtigend den Hals.
In der Nähe trug ein Soldat behutsam einen Korb vorüber. »Macht Platz, macht Platz! Es ist Schwarzpulver!«
Ich war erleichtert. Zumindest gäbe es ein wenig Erbarmen. Auf Häresie stand der Scheiterhaufen, doch zuweilen gestattete die Obrigkeit, dass dem Opfer ein Säckchen Schwarzpulver um den Hals gebunden werde, das explodieren würde, sobald die Flammen es erreichten, wodurch ein schneller Tod herbeigeführt war.
»Lasst sie doch brennen bis zum Schluss!«, protestierte einer.
»Genau«, stimmte ein anderer zu. »Der Kuss des Feuers, so licht und voller Pein …« Ein grausiges Kichern.
Ich sah mich um, als ein weiterer Reiter, auch er in der seidenen Sommerrobe und der dunklen Kappe der Anwälte, sich einen Weg durch die Menge bahnte und neben mir zu stehen kam. Er war einige Jahre jünger als ich, mit gutaussehenden, wenn auch etwas strengen Zügen, einem kurzen, dunklen Bart und blauen Augen, die von zwingender Ehrlichkeit und Direktheit zeugten.
»Guten Tag wünsche ich, Serjeant Shardlake.«
»Auch Euch einen guten Tag, Bruder Coleswyn.«
Philip Coleswyn war ein Barrister am Gray’s Inn und mein Gegner bei dem elenden Fall um das Slanning-Vermächtnis. Er vertrat den Bruder meiner Klientin, welcher genauso streitsüchtig und schwierig war wie seine Schwester. Doch obwohl wir, als die Anwälte der beiden, vor Gericht gezwungen waren, die Klingen zu kreuzen, schätzte ich Coleswyn persönlich als einen zuvorkommenden, ehrbaren Menschen. Er gehörte nicht zu denen, die bei entsprechender Entlohnung noch die unangenehmsten Fälle zu übernehmen gewillt sind, und empfand seinen Klienten vermutlich als ebenso irritierend wie ich dessen Schwester. Er galt als Reformer – die Klatschmäuler befassten sich dieser Tage üblicherweise mit der religiösen Überzeugung der Leute, die mir persönlich indes völlig einerlei war.
»Ihr vertretet Lincoln’s Inn?«, fragte Coleswyn.
»So ist es. Und Ihr Gray’s Inn?«
»In der Tat, doch nicht aus freien Stücken.«
»Ich ebenso wenig.«
»Es ist eine grausame Angelegenheit.« Er blickte mich unverwandt an.
»O ja. Grausam und abscheulich.«
»Demnächst wird man uns noch das Beten verbieten.« Er sprach mit leichtem Zittern in der Stimme.
Ich erwiderte leichthin, wenn auch mit hämischem Unterton: »Wir müssen beten, wie König Heinrich es uns befiehlt.«
»Er hat auch dies hier befohlen«, versetzte Coleswyn leise, schüttelte den Kopf und sagte schließlich: »Verzeiht, Bruder, ich sollte meine Zunge hüten.«
»Tja, dieser Tage tut man gut daran.«
Der Soldat hatte den Korb mit dem Schwarzpulver behutsam in einer Ecke des abgetrennten Bereichs abgestellt. Nun stieg er über die Absperrung und stellte sich zu den anderen Soldaten, die nicht weit von uns den Blick in die Menge richteten. Da sah ich, wie Wriothesley sich vorbeugte und den Mann zu sich heranwinkte. Dieser lief auf die überdachte Tribüne zu, und Wriothesley wies auf den Korb mit dem Schwarzpulver. Der Soldat gab ihm Antwort, woraufhin sich Wriothesley, augenscheinlich zufrieden, wieder zurücklehnte. Der Soldat indes kehrte an seinen Platz zurück.
»Was gab es denn?«, wollte sein Nebenmann wissen.
»Er fragte, wie viel Pulver es sei, da er befürchtete, die Explosion könne brennende Reiser auf die Tribüne schleudern. Das Pulver werde den Ketzern um den Hals gebunden, sagte ich ihm, und der befinde sich weit über den Reisern.«
Sein Kamerad lachte. »Die Radikalen hätten vermutlich ihre Freude, wenn am Ende der halbe Kronrat in Flammen stünde. John Bale könnte ein Stück darüber schreiben.«
Ich spürte Blicke auf mir und entdeckte, nicht weit zu meiner Linken, einen Anwalt in schwarzer Robe. Er befand sich in der Gesellschaft zweier junger Herren, deren Wämser in kostbaren Farben leuchteten und deren Kappen mit Perlen besetzt waren. Der Anwalt war noch jung, in den Zwanzigern, klein, schmächtig, mit schmalem, schlauem Gesicht, hervorstehenden Augen und einem dünnen Bärtchen. Er hatte mich eindringlich gemustert. Als unsere Blicke sich trafen, wandte er sich ab.
Ich neigte mich zu Coleswyn hinüber. »Kennt Ihr den Rechtsanwalt dort, bei den zwei jungen Gecken?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn wohl ein-, zweimal bei Gericht gesehen, aber das ist auch schon alles.«
»Nicht so wichtig.«
Ein erregtes Raunen erfasste die Menge, als sich von der Straße her eine Prozession näherte. Wieder waren es Soldaten, in deren Mitte drei Männer in langen, weißen Hemden zum Richtplatz geführt wurden, der eine noch jung, zwei in mittleren Jahren. Sie wirkten gefasst, wäre da nicht die wilde Angst in ihren Augen gewesen. Hinter ihnen, von zwei Soldaten auf einem Stuhle getragen, eine hübsche, hellhaarige Frau in den Zwanzigern. Als der Stuhl leicht schwankte, hielt sie sich an den Seiten fest, wobei sie vor Schmerz das Gesicht verzog. Dies also war Anne Askew, die ihren Gemahl in Lincolnshire verlassen hatte, um in London zu predigen, und die behauptete, die geheiligte Hostie sei nichts weiter als ein Stück Brot, das, in einen Kasten gelegt, schimmelig würde wie jedes andere auch.
»Ich wusste nicht, wie jung sie ist«, flüsterte Coleswyn.
Einige Konstabler eilten zu den Reisigbündeln und schichteten sie rings um die Brandpfähle übereinander, einen Fuß hoch. Dann wurden die drei Männer zu den Scheiterhaufen geführt. Die Zweige knackten unter den Füßen der Konstabler, welche zwei der Männer – Rücken an Rücken – an einen der Brandpfähle banden, den dritten an einen anderen. Die Ketten klirrten, als man sie ihnen um Fußknöchel, Hüften und Hälse legte. Dann wurde Anne Askew auf ihrem Stuhl zum dritten Pfahl getragen. Die Soldaten stellten sie ab, und die Konstabler ketteten sie an Hals und Taille fest.
»Dann ist es also wahr«, stellte Coleswyn fest. »Sie haben sie im Tower der Folter unterzogen. Seht nur, sie kann sich ja nicht einmal mehr auf den Beinen halten.«
»Warum hat man dem armen Geschöpf das angetan, sie war doch schon verurteilt?«
»Das weiß Gott allein.«
Einer der Soldaten nahm vier braune Beutel aus dem Korb, ein jeder gut faustgroß, und legte sie den Verurteilten behutsam um die Hälse. Die vier zuckten instinktiv zusammen. Ein Konstabler trat aus dem alten Pförtnerhaus, eine brennende Fackel in Händen, und begab sich mit unbewegter Miene auf den Richtplatz. Aller Augen waren auf ihn gerichtet. Die Menge verfiel in Schweigen.
Da erstieg ein Mann in geistlicher Soutane die Stufen zum Rednerpult. Er war schon älter, weißhaarig und rotgesichtig, und hatte Mühe, seine angstverzerrten Züge im Zaume zu halten. Nicholas Shaxton. Hätte er nicht widerrufen, stünde auch er jetzt an einen Brandpfahl gekettet. Aus der Menge wurden feindselige Stimmen laut, dann der Ruf: »Schande über dich, der du zulässt, dass Christi Glieder brennen.« Es folgte ein kurzer Aufruhr, und jemand versetzte dem Rufer eine Maulschelle; zwei Soldaten eilten zu den beiden, um sie zu trennen.
Shaxton begann zu predigen und hielt einen langen Diskurs zur Rechtfertigung der alten Messdoktrin. Die drei verurteilten Männer lauschten schweigend, wobei einer von ihnen am ganzen Leib zitterte. Schweiß perlte ihnen von der Stirn und tropfte auf die weißen Hemden. Anne Askew dagegen unterbrach Shaxton in regelmäßigen Abständen: »Er irrt, spricht ohne die Bibel!«, rief sie. Dabei wirkte ihre Miene froh und gefasst, fast so, als genieße sie das Spektakel. Ich fragte mich, ob die Ärmste vielleicht verrückt geworden sei. Jemand in der Menge rief: »Fangt endlich an! Entzündet das Feuer!«
Schließlich hatte Shaxton zu Ende gesprochen. Er stieg langsam die Stufen hinunter und wurde zurück zum Pförtnerhaus geleitet. Als er Anstalten machte hineinzugehen, ergriffen ihn die Soldaten bei den Armen und nötigten ihn, sich umzuwenden. Er musste auf der Schwelle stehen bleiben und zusehen.
Unterdessen schichtete man rings um die Gefangenen weitere Reisigbündel übereinander, bis sie ihnen an die Schenkel reichten. Alsdann trat der Konstabler mit der Fackel hinzu und entzündete einen Haufen nach dem anderen. Man hörte zunächst nur ein Knistern, dann ein Keuchen, das schnell zum Geschrei anschwoll, als die Flammen die Beine der Opfer erreichten. Einer der Männer brüllte ein ums andere Mal: »Herr Jesus, nimm mich zu dir! Nimm mich zu dir!« Anne Askew stieß ein langgezogenes Geheul aus, und ich schloss die Augen. Die Menge ringsum sah schweigend zu.
Die Schreie der Verurteilten und das Knistern des Reisigfeuers schienen kein Ende zu nehmen. Genesis scharrte erneut mit den Hufen, und einen Moment lang befiel mich wieder jenes entsetzliche Gefühl, das mich monatelang gequält hatte, nachdem die Mary Rose gesunken war: Es war, als geriete alles unter mir ins Wanken, und ich musste die Augen öffnen. Coleswyn starrte grimmig vor sich hin, und unwillkürlich folgte ich seinem Blick. Die Flammen, hell und durchscheinend, kletterten schnell an diesem heiteren Julitag. Die drei Männer wanden sich noch immer, brüllend vor Schmerz; die Flammen leckten bereits die Haut an ihren Armen und Unterleibern fort; ihr Blut tropfte in die Flammen. In dem verzweifelten Versuch, das Schwarzpulver zu entzünden, reckten zwei der Männer die Hälse den Flammen entgegen, die aber noch nicht hoch genug züngelten. Anne Askew hatte offenbar die Besinnung verloren und saß zusammengesunken auf ihrem Stuhl. Mir wurde übel. Ich schaute hinüber zu den Gesichtern derer, die in langer Reihe unter dem Baldachin saßen; sie alle beobachteten das Geschehen mit strengen, missbilligenden Mienen. Dann fiel mein Blick erneut auf den schmächtigen, jungen Rechtsanwalt, der mich aus der Menge zu beobachten schien. Wer ist dieser Mensch?, dachte ich unbehaglich. Was will er von mir?
Coleswyn stöhnte auf und sank im Sattel in sich zusammen. Ich streckte die Hand nach ihm aus, damit er nicht herunterfiel. Er holte tief Luft und richtete sich wieder auf. »Nur Mut, Bruder«, sagte ich sanft.
Er sah mich an, sein Gesicht bleich und schweißglänzend. »Ist Euch bewusst, dass jedem von uns ein solches Schicksal zuteilwerden könnte?«, flüsterte er.
Ich sah, dass einige in der Menge sich abgewandt hatten; ein, zwei Kinder weinten, von Grauen übermannt. Einer der holländischen Kaufmänner hatte ein kleines Gebetbuch aus dem Mantel gezogen und hielt es aufgeschlagen in den Händen, leise daraus rezitierend. Andere jedoch lachten und scherzten. Rauch lag in der Luft, aber auch der Gestank der Menge, und noch etwas, das mir aus der Küche vertraut war: der Geruch nach gebratenem Fleisch. Gegen meinen Willen wanderte mein Blick erneut zu den Scheiterhaufen. Die Flammen waren höher geklettert, die Unterleiber der Opfer schwarz von Ruß, und an einigen Stellen zeigten sich die blanken Knochen, während die oberen Bereiche rot waren von Blut, da die Flammen daran leckten. Ich bemerkte entsetzt, dass Anne Askew das Bewusstsein wiedererlangt hatte und gottserbärmlich stöhnte, während das Feuer ihr das Hemd vom Leibe sengte.
Sie rief noch etwas in die Menge, doch da erreichten die Flammen den Pulverbeutel, und ihr Kopf barst, so dass Blut, Schädel- und Hirnmasse flogen und zischend ins Feuer fielen.
Kapitel Zwei
Sobald die Hinrichtung vollzogen war, ritt ich mit Coleswyn davon. Die drei Männer hatten länger gelitten als die Frau; man hatte sie stehend, nicht sitzend, an den Pfahl gekettet, und so hatten die Flammen nach Anne Askews Tod noch eine halbe Stunde gebraucht, bis sie endlich den Pulverbeutel am Halse des letzten Mannes erreicht hatten. Ich hielt die Augen die meiste Zeit geschlossen; hätte ich bloß auch meine Ohren schließen können.
Wir sprachen wenig, während wir die Chick Lane entlangritten, zurück in die Stadt. Schließlich brach Coleswyn das unbehagliche Schweigen: »Ich habe meine Meinung allzu freimütig kundgetan, Bruder Shardlake, obwohl ich weiß, dass man sich hüten muss.«
»Seid unbesorgt«, antwortete ich. »Es ist schwer, angesichts solcher Szenen ruhig Blut zu bewahren.« Ich entsann mich seiner Bemerkung, dass jedem von uns ein solches Schicksal widerfahren könnte, und fragte mich, ob er etwa mit Radikalen in Verbindung stand. »Ich bin heute Nachmittag mit meiner Klientin, Mistress Slanning, verabredet«, sagte ich, um das Thema zu wechseln. »Es gibt noch viel zu tun für uns beide, ehe der Fall im September vor Gericht verhandelt wird.«
Coleswyn entfuhr ein ironisches, bellendes Lachen. »Das will ich meinen.« Sein Blick sagte mir, dass er ähnlich über den Fall dachte wie ich.
Wir hatten Saffron Hill erreicht, wo sich unsere Wege trennen würden. Ich fühlte mich noch nicht imstande, in die Kanzlei zurückzukehren, und fragte deshalb: »Trinkt Ihr einen Krug Bier mit mir, Bruder?«
Coleswyn schüttelte den Kopf. »Ich danke Euch, aber das könnte ich jetzt nicht. Ich reite in die Kanzlei und versuche, mich mit ein wenig Arbeit zu zerstreuen. Gott behüte Euch.«
»Euch ebenso, Bruder.«
Ein wenig eingesunken im Sattel hängend ritt er davon. Da ich es noch nicht über mich brachte, nach Lincoln’s Inn zurückzukehren, zog ich mir Kappe und Haube vom Kopf und ritt weiter nach Holborn.
Unweit der Kirche St Andrew’s fand ich eine ruhige Schenke; sie würde sich vermutlich bald mit Gästen füllen, sobald die Menge vom Richtplatz in Smithfield hereindrängte, doch im Augenblick saßen nur ein paar alte Männer an den Tischen. Ich kaufte mir einen Humpen Bier und suchte mir eine ruhige Ecke. Es war ein erbärmliches, trübes Gesöff, an dessen Oberfläche eine Spelze trieb.
Meine Gedanken wanderten, wie so oft, zur Königin. Ich dachte daran, wie ich ihr zum ersten Mal begegnet war, als sie noch Lady Latimer hieß. Meine Gefühle für sie waren unvermindert stark, und ich schalt mich deshalb einen törichten Schwärmer. Ich sollte mir eine Frau unter meinesgleichen suchen, bevor ich zu alt dafür war. Hoffentlich besaß die Königin keines der verbotenen Bücher auf der Liste. Die war lang – Luther, Tyndale, Coverdale und natürlich John Bale, dessen jüngstes Werk, die Acts of the English Votaries – unflätige Geschichten über die alten Mönche und Nonnen –, sich bei den Londoner Lehrburschen derzeit großer Beliebtheit erfreute. Auch ich besaß alte Schriften von Tyndale und Coverdale; wer sie freiwillig herausgab, sollte ungestraft bleiben, doch diese Amnestie war nur noch drei Wochen gültig. Ich täte vermutlich besser daran, die Bücher in aller Stille im Garten zu verbrennen.
Eine kleine Gruppe Männer kam herein. »Was bin ich froh, endlich diesem Gestank zu entkommen«, sagte einer.
»Immer noch besser als der Gestank der Lutheraner«, knurrte ein anderer.
»Luther ist doch längst tot und begraben, und jetzt ist auch diese Askew erledigt.«
»Da gibt’s noch viel mehr, die im Finstern lauern.«
»Na komm, trink ein Glas. Gibt’s hier auch Pasteten?«
Ich fand es an der Zeit aufzubrechen. Also leerte ich meinen Humpen und ging. Ich hatte das Mittagsmahl versäumt, aber allein der Gedanke an Essen war mir zuwider.
Ich ritt unter dem Großen Pförtnerhaus von Lincoln’s Inn hindurch, wieder mit Robe, Kappe und Haube bekleidet, überließ Genesis einem Stallburschen und begab mich zu meiner Kanzlei. Zu meiner Überraschung herrschte reges Treiben im vorderen Büro. Meine drei Mitarbeiter – mein Gehilfe Jack Barak, mein Schreiber John Skelly und mein neuer Student Nicholas Overton – durchsuchten emsig die Papierstapel auf Schreibtischen und Regalen.
»Pest und Cholera!«, warf Barak Nicholas hin, während er das Band um eine Schriftensammlung löste und durch die Dokumente blätterte. »Weißt du nicht einmal mehr, wann du sie zuletzt gesehen hast?«
Nicholas, der seinerseits einen Stapel Schriften durchsucht hatte, wandte sich zu ihm um. Sein sommersprossiges Gesicht unter dem hellroten Haar wirkte bekümmert. »Das war vor zwei Tagen, vielleicht auch vor drei. Ich musste so viele Übertragungen prüfen.«
Skelly musterte Nicholas durch seine Augengläser hindurch. Sein Blick war milde, aber die Stimme klang gepresst, als er sagte: »Wenn Ihr Euch doch erinnern könntet, Master Overton, es würde uns die Suche ein wenig erleichtern.«
»Was geht hier vor?«, fragte ich von der Tür her. Sie waren so vertieft gewesen in ihr fieberhaftes Tun, dass sie mich nicht bemerkt hatten. Barak wandte sich zu mir um, das Gesicht über dem neuen Bart rot vor Zorn.
»Master Nicholas hat die Carlingford-Urkunde verlegt! Der einzige Beweis, dass Carlingford Eigentümer seiner Ländereien ist. Sie muss am ersten Tag der neuen Sitzungsperiode dem Gericht vorliegen! Lulatsch, verschlafener!«, murmelte er, »nichtsnutziger Trottel!«
Nicholas lief rot an. »Das wollte ich nicht«, beteuerte er, an mich gewandt.
Ich seufzte. Ich hatte Nicholas vor zwei Monaten eingestellt, auf die Bitte eines Freundes hin, dem ich einen Gefallen schuldete, und bereute es fast schon wieder. Nicholas war der Sohn eines Landadeligen aus Lincolnshire, der sich mit seinen einundzwanzig Jahren offensichtlich noch für keine Tätigkeit hatte erwärmen können und nun eingewilligt hatte, ein oder zwei Jahre in Lincoln’s Inn die Gesetze zu studieren, damit er später seinem Vater bei der Verwaltung des Gutes zur Hand gehen konnte. Mein Freund hatte zwar darauf hingewiesen, dass zwischen Nicholas und seiner Familie gewisse Unstimmigkeiten herrschten, aber gleichzeitig betont, dass er ein guter Junge sei. Er war in der Tat gutmütig, aber gänzlich verantwortungslos. Wie die meisten dieser jungen Herren verbrachte auch er einen Großteil seiner Zeit damit, die Lustbarkeiten Londons zu erkunden; er hatte sich bereits Ärger eingehandelt, weil er einer Hure wegen mit einem anderen Studenten die Klinge gekreuzt hatte. Der König hatte die Bordelle in Southwark in diesem Frühjahr geschlossen, mit dem Ergebnis, dass es noch mehr Huren über den Fluss in die Innenstadt verschlug. Die meisten Landjunker wussten mit dem Schwerte umzugehen, und sie durften dank ihres Standes auch in der Stadt ihre Schwerter mit sich führen. Trotzdem war eine Schenke nicht der passende Ort, um mit Fechtkünsten zu prahlen. Und eine scharfe Klinge war, zumal in einer unbedachten Hand, eine tödliche Waffe.
Ich besah mir Nicholas’ hoch aufgeschossene, schlaksige Gestalt und bemerkte, dass er unter seiner kurzen Studentenrobe ein grünes Wams trug, durch dessen geschlitzte Ärmel gelb das feine damastene Innenfutter hervorschimmerte. Damit verstieß er gegen die herrschende Regel der Innung, die den Studenten schlichte Kleidung vorschrieb.
»Suche weiter, Nicholas, aber beruhige dich«, sagte ich. »Du hast diese Urkunde doch nicht etwa aus der Kanzlei getragen?«, fügte ich in schärferem Tone hinzu.
»Nein, Master Shardlake«, beteuerte er. »Ich weiß doch, dass das nicht erlaubt ist.« Er hatte eine gebildete Art zu sprechen, mit leisen Anklängen an seine Heimat Lincolnshire. Sein Gesicht mit der langen Nase und dem runden Kinn sah betrübt aus.
»So wenig wie ein seidenes Wams. Willst du dir Ärger mit unserem Schatzmeister einhandeln? Sobald du die Urkunde gefunden hast, gehst du nach Hause und kleidest dich um.«
»Jawohl, Sir«, antwortete er kleinlaut.
»Und wenn Mistress Slanning heute Nachmittag hierherkommt, möchte ich, dass du dem Gespräch beiwohnst und dir Notizen machst.«
»Jawohl, Sir.«
»Und solltest du die Urkunde nicht finden, dann bleibe hier, bis du sie gefunden hast.«
»Ist die Hinrichtung vorüber?«, fragte Skelly vorsichtig.
»Ja. Aber ich möchte nicht darüber sprechen.«
Barak merkte auf. »Ich habe Neuigkeiten für Euch. Gute Neuigkeiten, aber nur für Eure Ohren bestimmt.«
»Ein wenig Aufmunterung könnte ich durchaus gebrauchen.«
»Das dachte ich mir«, antwortete Barak mitfühlend.
»Gehen wir in mein Büro.«
Er folgte mir in meine private Amtsstube mit dem unterteilten Fenster zum Innenhof. Ich warf Robe und Kappe beiseite und setzte mich an den Schreibtisch, während Barak auf dem Stuhl gegenüber Platz nahm. Ich bemerkte die eine oder andere graue Stelle in seinem dunkelbraunen Bart, wenn auch noch keine in seinem Haar. Barak war jetzt vierunddreißig, zehn Jahre jünger als ich, und seine einst hageren Züge wurden allmählich fülliger.
Er sagte: »Der junge Overton, dieser Trottel, bringt mich noch einmal ins Grab. Als hätte man es mit einem Affen zu tun.«
Ich lächelte. »Pfui! Er ist nicht dumm. Erst vorige Woche hat er mir den Bennett-Fall recht ordentlich zusammengefasst. Er muss lediglich ein wenig Ordnung lernen.«
Barak knurrte. »Zum Glück habt Ihr ihm seiner Kleidung wegen einen Rüffel erteilt. Ich wünschte, ich könnte mir dieser Tage ein Seidenwams leisten.«
»Er ist noch jung und ein wenig übermütig.« Ich lächelte. »So wie du damals, als wir uns kennenlernten. Und Nicholas flucht wenigstens nicht wie ein Bierkutscher.«
Barak winkte unwillig ab und sah mich dann mit ernster Miene an. »Wie war sie, die Hinrichtung?«
»Unbeschreiblich grausam. Aber ein jeder fügte sich in seine Rolle«, setzte ich bitter hinzu, »die Schaulustigen, die Stadtbeamten und die Mitglieder des Kronrats unter ihrem Baldachin. Einmal kam es zu einer kleinen Rangelei, aber die Soldaten schlugen sie rasch nieder. Diese armen Menschen sind grausam, aber tapfer gestorben.«
Barak schüttelte den Kopf. »Warum haben sie nicht widerrufen?«
»Vermutlich glaubten sie, dass ein Widerruf sie der Verdammnis preisgeben würde.« Ich seufzte. »Nun, was sind das für gute Neuigkeiten?«
»Hier die erste, sie ist heute Morgen hier abgegeben worden.« Baraks Hand wanderte zum Beutel an seiner Hüfte. Er zog drei glänzende, buttergelbe Goldstücke heraus und legte sie auf den Tisch, dazu ein gefaltetes Blatt Papier.
Ich sah ihn an. »Ein überfälliges Honorar?«
»So könnte man sagen. Lest den Brief.«
Ich griff nach dem Zettel und schlug ihn auf. Es war eine Nachricht, mit zitternder Hand hingekritzelt: »Hier ist das Geld, das ich Euch für die Pflege schulde, die Mistress Elliard mir in ihrem Hause angedeihen ließ. Ich bin sehr elend und krank und wünschte, Ihr würdet mir einen Besuch abstatten. Euer Amtsbruder Stephen Bealknap.«
»Da bleibt Euch der Mund offen stehen, was?« Barak grinste. »Kein Wunder, mir erging es nicht anders.«
Ich griff nach den Münzen und besah sie genau, einen Scherz argwöhnend. Doch sie waren aus gutem Gold, noch vor der Abwertung geprägt, und zeigten auf der einen Seite den jugendlichen König, die Tudor-Rose auf der anderen. Es war kaum zu glauben. Stephen Bealknap galt nicht nur weithin, privat wie beruflich, als ein gewissenloser Mensch, sondern auch als ein elender Geizkragen. Es hieß, er hüte in seinen Gemächern einen Schatz, den er nachts zu bestaunen pflege. Er hatte sich über die Jahre ein Vermögen zusammengerafft, durch allerlei schmutzige Händel – einige auch gegen mich gerichtet –, und indem er es sich zum stolzen Grundsatz hatte werden lassen, seine Schulden, so es sich irgendwie vermeiden ließ, nicht zu begleichen. Es lag nun schon drei Jahre zurück, dass ich in einem Anflug falscher Großmut eine Freundin dafür bezahlt hatte, ihn zu umsorgen, als er krank war, und er hatte seine Schuld nie beglichen.
»Es ist kaum zu glauben.« Ich überlegte. »Und doch – ich erinnere mich wieder, vorigen Herbst, ehe er krank wurde, hatte er sich eine Zeitlang von einer ungewohnt liebenswürdigen Seite gezeigt. Er kam im Innenhof auf mich zu und erkundigte sich nach meinem Befinden, fragte auch, wie die Geschäfte gingen, als wäre er mein Freund, oder gedenke es zu werden.« Es fiel mir ein, wie Bealknap an einem lauen Herbsttage draußen im Hof an mich herangetreten war. Der schwarze Rock hatte seine dürre Gestalt umschlottert, und um die verkniffenen Lippen spielte ein süßliches, einschmeichelndes Lächeln. Sein drahtiges, helles Haar stand unter der Kappe wie üblich nach allen Seiten hin ab. »Master Shardlake, wie geht es Euch?«, hatte er mich begrüßt. Ich schüttelte versonnen den Kopf. »Ich war kurz angebunden, traute ihm natürlich keinen Zollbreit über den Weg, denn ich war mir sicher, dass er wieder irgendetwas im Schilde führte. Ich glaube, er suchte nach Aufträgen; angeblich hatte ein alter Klient kaum noch Verwendung für ihn. Von dem Geld, das er mir schuldete, war natürlich keine Rede. Nach einer Weile hatte er begriffen, dass mir an einer Freundschaft mit ihm nichts gelegen war, und ignorierte mich fortan wieder.« Ich runzelte nachdenklich die Stirn. »Schon damals kam er mir müde und kränklich vor. Vielleicht kamen ihm die Klienten abhanden, weil es ihm allmählich an Gerissenheit fehlte.«
»Mag sein, dass er wirklich seine Sünden bereut, wenn er so krank ist, wie sie alle sagen.«
»Ein Geschwulst in den Eingeweiden, nicht? Er ist angeblich schon seit Monaten krank. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wer hat die Nachricht überbracht?«
»Eine alte Frau. Sie kümmert sich um ihn.«
»Heilige Maria!«, sagte ich. »Bealknap begleicht eine Schuld und bittet mich um einen Besuch.«
»Geht Ihr zu ihm?«
»Die Barmherzigkeit gebietet es wohl.« Wieder schüttelte ich verwundert den Kopf. »Welche Nachricht hast du noch für mich? Wenn du mir jetzt sagen würdest, dass neuerdings Frösche über London hinwegfliegen, könnte es mich kaum mehr in Erstaunen versetzen.«
Er lächelte wieder, ein glückliches Lächeln, das seine Züge glättete. »Nun ja, eine Überraschung ist es schon, aber ein Wunder wohl nicht. Tamasin ist wieder guter Hoffnung.«
Ich beugte mich zu ihm vor und ergriff seine Hand. »Das nenne ich eine gute Nachricht! Ich weiß ja, wie sehr ihr euch ein zweites Kind gewünscht habt.«
»Ja, ein kleines Geschwister für Georgie. Im Januar ist es so weit.«
»Wie schön, Jack, herzlichen Glückwunsch. Das müssen wir feiern.«
»Wir haben es vorerst noch niemandem erzählt. Kommt Ihr zu dem kleinen Umtrunk am 27., um den ersten Geburtstag unseres Georgie zu feiern? Dann geben wir es bekannt. Sagt es auch dem alten Mohren. Tamasin war bei ihm in guten Händen, als sie Georgie erwartete.«
»Guy speist heute bei mir zu Abend. Ich werde ihn fragen.«
»Gut.« Barak lehnte sich zurück und faltete, sichtlich zufrieden, die Hände über dem Bauch. Das erste Kind der beiden war gestorben, und ich hatte fast schon befürchtet, die Trauer werde sie für immer trennen, doch dann hatte Tamasin im vergangenen Jahr einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Und nun war sie erneut guter Hoffnung. Wie vernünftig Barak geworden war, dachte ich, wie sehr er sich doch von dem ärgerlichen Kerl unterschied, der er gewesen war, als ich ihn vor sechs Jahren kennengelernt hatte. Damals hatte er noch fragwürdige Aufträge für Thomas Cromwell erledigen müssen. »Ich freue mich sehr für euch beide«, sagte ich leise. »Vielleicht kommen doch noch ein paar gute Dinge in diese Welt.«
»Müsst Ihr dem Kämmerer über die Scheiterhaufen Bericht erstatten?«
»O ja. Ich werde ihm versichern, dass meine Anwesenheit als Vertreter der Innung durchaus bemerkt wurde.« Ich zog beredt die Augenbrauen in die Höhe. »Unter anderem von Richard Rich.«
»Dieser Schurke war auch dort?«, erwiderte Barak, sichtlich verdutzt.
»In der Tat. Ich habe ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Aber er hat sich natürlich meiner erinnert. Und mir einen scheelen Blick zugeworfen.«
»Mehr kann er nicht tun. Ihr habt zu viel gegen ihn in der Hand.«
»Er schien besorgt zu sein. Ich frage mich, warum. Ich dachte, auf der Seite Gardiners und der Konservativen müsse er derzeit Morgenluft wittern.« Ich sah Barak an. »Hast du noch Kontakt zu deinen alten Freunden aus Cromwells Tagen? Vielleicht gibt es ja Gerüchte?«
»Ich gehe zwar gelegentlich in die alten Schenken, wenn Tamasin mich lässt. Doch ich erfahre wenig. Und ehe Ihr fragt, nicht ein Wort über die Königin.«
»Was man sich über Anne Askew erzählt, dass sie angeblich im Tower der Folter unterzogen wurde, traf immerhin zu«, sagte ich. »Man musste sie heute auf einem Stuhl zum Scheiterhaufen tragen.«
»Die Ärmste.« Barak strich sich nachdenklich über den Bart. »Ich frage mich nur, wie diese Information nach draußen sickern konnte. Vermutlich arbeitet ein Anhänger der Radikalen im Tower. Meine alten Freunde haben mir lediglich erzählt, dass der König jetzt auf Bischof Gardiner hört – und das ist allgemein bekannt. War etwa auch Erzbischof Cranmer auf dem Richtplatz?«
»Nein. Er hält sicheren Abstand, in Canterbury, nehme ich an.« Ich schüttelte den Kopf. »Ein Wunder, dass er so lange überlebt hat. Ach übrigens, auf dem Richtplatz war ein junger Anwalt, der in Begleitung einiger Edelleute den Verbrennungen beiwohnte und mich unentwegt anstarrte. Klein und schmächtig, braunes Haar, kurzes Bärtchen. Wer mag das sein?«
»Vermutlich einer, der im kommenden Herbst bei einem Fall Euer Gegner ist und Euch in Augenschein nehmen wollte.«
»Mag sein.« Ich befingerte die Münzen auf dem Schreibtisch.
»Ihr dürft nicht immer glauben, ein jeder hätte es auf Euch abgesehen«, sagte Barak ruhig.
»Tja, das ist wohl ein Fehler. Aber ist es ein Wunder nach den vergangenen Jahren?« Ich seufzte. »Ach ja, ich traf übrigens Bruder Coleswyn auf dem Richtplatz, er vertrat seine Innung, Gray’s Inn. Ein anständiger Mensch.«
»Im Gegensatz zu seinem Klienten. Geschieht diesem Lulatsch Nicholas ganz recht, dass er heute Nachmittag die alte Slanning am Halse hat.«
Ich lächelte. »Ja, das finde ich auch. Nun, dann sieh nach, ob er das Schriftstück inzwischen gefunden hat.«
Barak stand auf. »Wenn nicht, setzt es einen Tritt in den Allerwertesten, Gentleman hin oder her …«
Während er ging, spielte ich weiter mit den Münzen. Ich las Bealknaps Nachricht ein zweites Mal und dachte dabei: »Was führt dieser Unglücksmensch jetzt wieder im Schilde?«
Mistress Isabel Slanning kam um Schlag drei. Nicholas, jetzt etwas nüchterner gekleidet, in einem Wams aus leichter, schwarzer Wolle, setzte sich mit Feder und Papier neben mich. Zu seinem Glück hatte er das verloren geglaubte Schriftstück wiedergefunden, während ich mich mit Barak unterhalten hatte.
Skelly führte ein wenig bang Mistress Slanning herein. Sie war eine hoch aufgeschossene, hagere Witwe Mitte der fünfzig, obwohl das faltige Gesicht, die schmalen, verkniffenen Lippen und die aus Gewohnheit gerunzelte Stirn sie älter erscheinen ließen. Ich hatte ihren Bruder, Edward Cotterstoke, bei den Anhörungen während der vergangenen Amtsperiode im Gerichtshof gesehen und erstaunt festgestellt, wie sehr er ihr, von dem grauen Bärtchen abgesehen, in Wuchs und Angesicht glich. Mistress Slanning trug ein violettes Kleid aus feiner Wolle mit einem modischen Stehkragen, der ihren dünnen Hals umschloss, dazu ein von kleinen Perlen gesäumtes Hütchen. Sie war eine wohlhabende Dame; ihr verstorbener Ehemann war ein erfolgreicher Kurzwarenhändler gewesen, und wie viele reiche Kaufmannswitwen hatte sie sich einen Befehlston zugelegt, wie er sich für eine Frau von geringerem Stande nicht geziemen würde. Sie begrüßte mich kühl. Meinen Schüler Nicholas überging sie.
Wie immer kam sie sofort auf den Punkt. »Nun, Master Shardlake, wie sieht es aus? Ich nehme an, dass Edward, der elende Wicht, die Angelegenheit erneut hinauszuzögern sucht?« Ihre großen, braunen Augen maßen mich vorwurfsvoll.
»Nein, Madam, unser Fall soll im September vor dem Court of King’s Bench verhandelt werden.« Ich bat sie, Platz zu nehmen, und fragte mich dabei erneut, warum sie und ihr Bruder einander nur so abgrundtief hassten. Sie waren die Kinder eines Kaufmanns, eines begüterten Getreidehändlers, der ziemlich jung verstorben war. Die Mutter hatte ein zweites Mal geheiratet und dem Stiefvater die Geschäfte übertragen. Doch auch dieser war schon ein Jahr später verstorben, woraufhin die alte Mrs Cotterstoke das Unternehmen veräußert hatte, um für den Rest ihres langen Lebens von ihrem beachtlichen Vermögen zu zehren. Sie hatte nie mehr geheiratet und war im vergangenen Herbst, mit achtzig Jahren, nach einem Schlaganfall verstorben. Ein Priester hatte ihren letzten Willen zu Papier gebracht, als sie auf dem Sterbebett lag. Das meiste davon war unmissverständlich: Ihr Barvermögen sollte zu gleichen Teilen an ihre beiden Kinder gehen; das große Haus, in dem sie wohnte, unweit Chandler’s Hall, sollte verkauft werden und der Erlös wiederum zu gleichen Teilen den Kindern zufallen. Edward verfügte wie Isabel über ein bescheidenes Vermögen – er war ein hoher Beamter in der Guildhall –, das Erbe würde sie beide noch reicher machen. Das Problem war entstanden, weil im Testament festgelegt war, wie mit dem Inventar des Hauses zu verfahren sei. Das gesamte Mobiliar sollte Edward zufallen, wogegen Isabel sämtliche Wandteppiche, Gobelins und Gemälde im Haus bekommen sollte, wie auch immer sie beschaffen oder befestigt sein mochten. Die Wortwahl war ungewöhnlich, doch hatte ich mir die eidesstattliche Aussage des Priesters eingeholt, der das Testament niedergeschrieben hatte, und er hatte mir zweifelsfrei bestätigt, dass die alte Dame, die zwar dem Tode nah, jedoch durchaus bei klarem Verstand gewesen sei, auf exakt diesen Worten bestanden habe.





























