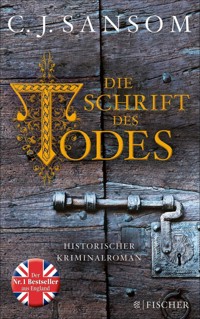8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Matthew Shardlake
- Sprache: Deutsch
England, 1540: Die Suche nach der Wunderwaffe Es ist Mai anno 1540, genau drei Jahre nach den Vorfällen im Kloster Scarnsea. Matthew Shardlake hat sich aus Cromwells Dunstkreis enttäuscht zurückgezogen, nachdem er dessen Intrigen und Machenschaften auf die Schliche gekommen war. Er lebt seitdem unbehelligt in London und soll als Rechtsanwalt eine junge Frau aus gutem Hause vertreten, der vorgeworfen wird, ihren Cousin ermordet zu haben. Die junge Frau schweigt zu alldem. Matthew ist aber von ihrer Unschuld überzeugt und versucht mit allen Mitteln, sie dem Foltertod zu entreissen. In dieser Zeit tritt auch Cromwell wieder in sein Leben: Dessen Stern ist bei Heinrich VIII. im Sinken begriffen, nachdem er diesem die deutsche Prinzession Anne von Kleve als Ehefrau vermittelt hat. Heinrich VIII. ist entsetzt über diese Wahl und hat sich schon wieder in Catherine Howard, ein Teenager und pikanterweise die Nichte des Herzogs von Norfolk, verliebt. Um sich die Gunst des Königs wieder zu sichern, braucht Cromwell etwas Spektakuläres, wobei Matthew Shardlake ihm helfen soll. In London geht das Gerücht um, dass es Leute gibt, die wissen,wie man ein griechisches Feuer entfacht - eine willkommene Waffe im heraufziehenden Krieg gegen Spanien und Frankreich. Shardlake soll die Formel besorgen - koste es, was es wolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
C.J. Sansom
Feuer der Vergeltung
Historischer Kriminalroman
Über dieses Buch
England, 1540: Die Suche nach der Wunderwaffe
Es ist Mai anno 1540, genau drei Jahre nach den Vorfällen im Kloster Scarnsea. Matthew Shardlake hat sich aus Cromwells Dunstkreis enttäuscht zurückgezogen, nachdem er dessen Intrigen und Machenschaften auf die Schliche gekommen war. Er lebt seitdem unbehelligt in London und soll als Rechtsanwalt eine junge Frau aus gutem Hause vertreten, der vorgeworfen wird, ihren Cousin ermordet zu haben. Die junge Frau schweigt zu alldem. Matthew ist aber von ihrer Unschuld überzeugt und versucht mit allen Mitteln, sie dem Foltertod zu entreissen. In dieser Zeit tritt auch Cromwell wieder in sein Leben: Dessen Stern ist bei Heinrich VIII. im Sinken begriffen, nachdem er diesem die deutsche Prinzession Anne von Kleve als Ehefrau vermittelt hat. Heinrich VIII. ist entsetzt über diese Wahl und hat sich schon wieder in Catherine Howard, ein Teenager und pikanterweise die Nichte des Herzogs von Norfolk, verliebt. Um sich die Gunst des Königs wieder zu sichern, braucht Cromwell etwas Spektakuläres, wobei Matthew Shardlake ihm helfen soll. In London geht das Gerücht um, dass es Leute gibt, die wissen,wie man ein griechisches Feuer entfacht – eine willkommene Waffe im heraufziehenden Krieg gegen Spanien und Frankreich. Shardlake soll die Formel besorgen - koste es, was es wolle.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
C.J. Sansom studierte Geisteswissenschaften und promovierte im Fach Geschichte. Nach einem Jura-Studium arbeitete er als niedergelassener Rechtsanwalt in Sussex, bevor er sich hauptberuflich dem Schreiben zuwandte. Bisher sind fünf Bücher in der Matthew-Shardlake-Serie erschienen, die weltweit über zwei Millionen mal verkauft wurden. Der Autor lebt in Brighton.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel ›Dark Fire‹ bei Macmillan, an imprint of Pan Macmillan Ltd. London
© C.J. Sansom 2004
Für diese Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: bürosüd°, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403705-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die Familie Wentworth von Walbrook, London
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Kapitel Siebenunddreißig
Kapitel Achtunddreißig
Kapitel Neununddreißig
Kapitel Vierzig
Kapitel Einundvierzig
Kapitel Zweiundvierzig
Kapitel Dreiundvierzig
Kapitel Vierundvierzig
Kapitel Fünfundvierzig
Kapitel Sechsundvierzig
Kapitel Siebenundvierzig
Epilog
Geschichtliche Anmerkung
Dank
Die Familie Wentworth von Walbrook, London
Kapitel Eins
Ich hatte schon früh mein Haus in der Chancery Lane verlassen, um mich in die Guildhall zu begeben, da ich die Interessen der Stadtväter in einer unleidigen Sache vertrat. Obschon die weitaus ernstere Angelegenheit, die bei meiner Rückkehr auf mich wartete, mir schwer aufs Gemüt drückte, so fand ich doch, als ich durch die stille Fleet Street ritt, ein wenig Freude an der lauen Luft des frühen Morgens. Die Hitze war groß für Ende Mai, die Sonne schon ein feuriger Ball am klaren blauen Himmel, und ich trug nur ein leichtes Hemd unter der schwarzen Anwaltsrobe. Während mein altes Ross Chancery so dahintrottete, befiel mich beim Anblick der üppig belaubten Bäume wieder der Wunsch, mich aus dem Amt zurückzuziehen, Londons lärmenden Menschenmassen zu entfliehen. In zwei Jahren wäre ich vierzig und ein alter Mann; liefen bis dahin die Geschäfte gut, so könnte ich es wagen. Ich ritt über die Fleet Bridge, vorbei an den Standbildern der alten Könige Gog und Magog. Vor mir ragte die Stadtmauer auf, und ich wappnete mich innerlich gegen Londons Lärm und Gestank.
In der Guildhall traf ich mich mit Bürgermeister Hollyes und dem Stadtsyndikus. Der Magistrat hatte eine Belästigungsklage erhoben gegen einen der raubgierigen Landspekulanten, die die leeren Klöster an sich rafften, deren Letztes in diesem Frühling des Jahres 1540 zerschlagen worden war. Besagter Spekulant war zu meiner Beschämung ein Amtsbruder meiner Gilde, Lincoln’s Inn, ein hinterlistiger, habgieriger Schurke mit Namen Bealknap. Er hatte ein kleines Mönchskloster in London an sich gebracht, und, anstatt die Kirche niederreißen zu lassen, hatte er eine Vielzahl elender Behausungen darin eingerichtet. Die Jauchegrube, die er für seine Mieter hatte ausheben lassen, hatte sich bald als ein ganz abscheulicher Pfusch erwiesen, und die Bewohner der angrenzenden Häuser, im Besitz der Stadt, hatten schwer zu leiden, da stinkender Unrat in ihre Keller einsickerte. Das Schwurgericht hatte Bealknap dazu verurteilt, ordnungsgemäß Abhilfe zu schaffen, doch der Schuft hatte eine richterliche Verfügung erwirkt und die Sache vor den Court of King’s Bench gebracht. In der Gründungsurkunde des Klosters sei vermerkt, so sein Argument, dass Selbiges nicht unter die städtische Rechtsprechung falle, er demnach zu gar nichts verpflichtet sei. Die Angelegenheit sollte binnen einer Woche zur Anhörung gebracht werden. Ich gab dem Syndikus zu verstehen, dass Bealknaps Sicht der Dinge wenig Aussicht auf Erfolg habe; unsereiner treffe immer wieder auf dergleichen Schurken, sagte ich; aus diebischer Freude verschwendeten sie Zeit und Geld auf aussichtslose Zwistigkeiten, anstatt sich dem Urteil des Gerichts zu fügen und, wie es recht und billig, die beklagten Missstände zu beheben.
Ich hatte eigentlich auf dem selben Weg nach Hause reiten wollen, den ich gekommen war, über Cheapside, doch als ich die Kreuzung mit der Lad Lane erreichte, blockierte die Wood Street ein umgestürzter Wagen voller Blei und Schindeln vom Abriss des Klosters St. Bartholomew. Ein Haufen bemooster Ziegel lag quer über der Straße. Der Karren war groß, von zwei mächtigen Kaltblütern gezogen; eins der Rösser hatte der Kutscher befreien können, das andere aber lag zwischen den Deichseln hilflos auf der Seite. Es strampelte wild mit den riesigen Hufen, dass Staub aufwirbelte. Dabei wieherte es in panischer Furcht und rollte mit den Augen in die schaulustige Menge. Ich hörte jemanden sagen, dass die Schlange der Fuhrwerke fast bis nach Cripplegate reichte.
Es war nicht die erste Szene dieser Art in der Stadt. Überall hörte man neuerdings Steine krachen, wenn die alten Gebäude einstürzten: So viel Land war frei geworden im übervölkerten London, dass Höflinge und andere Raffhälse, welchen es in die Hände gefallen, es kaum zu verwalten wussten.
Ich wendete Chancery und lenkte ihn durch das Labyrinth schmaler Gassen, die nach Cheapside führten, mancherorts gerade breit genug, dass ein Pferd mit Reiter zwischen den ausladenden Dachgesimsen Platz fand. Obschon noch früh am Morgen, war man in den Werkstätten bereits emsig bei der Arbeit, bevölkerten Menschen die Straßen und behinderten mein Fortkommen, Handwerksgesellen, Straßenhändler und Wasserträger, die unter der Last ihrer riesigen konischen Körbe ächzten. Es hatte einen Monat lang so wenig geregnet, dass die Brunnen trocken waren, und so verdienten sie gutes Geld. Ich dachte wieder an das bevorstehende Gespräch; es graute mir davor, und jetzt käme ich auch noch zu spät.
Ich rümpfte die Nase ob des mächtigen Gestanks, den die Hitze aus der Gosse zog, und stieß einen saftigen Fluch aus, als ein Schwein, die Schnauze vom Wühlen mit namenlosem Unrat verschmiert, quiekend meinem Chancery vor die Hufe lief, sodass er jäh zur Seite sprang. Ein paar Lehrlinge in blauen Wämsern, die Gesichter aufgedunsen von durchzechter Nacht, reckten die Hälse nach mir, und einer von ihnen, ein stämmiger, grobschlächtiger Bursche, verzog den Mund zu einem verächtlichen Grinsen. Ich biss mir auf die Lippe und gab Chancery die Sporen. Ich konnte mir schon denken, wie der Bursche mich sah: als einen käsebleichen buckligen Anwalt mit schwarzer Robe und Kappe, am Gürtel statt des Degens Federkasten und Dolch.
Ich war erleichtert, als ich wieder auf die breite gepflasterte Straße von Cheapside gelangte. Um die Stände des Cheap Market wimmelte es von Menschen; die Marktleute unter den bunten Planen priesen ihre Ware an oder feilschten mit weißbehaubten Matronen. Gelegentlich schlenderte eine wohlhabende Dame zwischen den Ständen herum, bewaffnete Diener an der Seite, das Gesicht hinter einem Schleier verborgen, der die weiße Haut vor der Sonne schützte.
Als ich an der mächtigen St Paul’s Cathedral vorüberritt, hörte ich den lauten Ausruf eines Pamphletenverkäufers. Ein magerer Bursche im fleckigen schwarzen Wams, einen Stoß Blätter unter dem Arm, brüllte in die Menge: »Kindsmörderin von Walbrook im Kerker!« Ich blieb stehen und warf ihm eine Münze hin. Er leckte sich den Daumen, schälte ein Blatt ab, gab es mir und ging plärrend seiner Wege: »Die abscheulichste Mordtat des Jahres!«
Ich blieb stehen, um die Nachricht im Schatten zu lesen, den die Kathedrale warf. Wie üblich war der Kirchplatz voller Bettler – alte und junge lehnten abgemagert und zerlumpt gegen die Mauer und stellten in der Hoffnung auf eine milde Gabe Wunden und Missbildungen zur Schau. Ich vermied ihre flehenden Blicke und wandte mich dem Pamphlet zu:
Grausiger Mord in Walbrook; Knabe von eifersüchtiger Base gemeuchelt
Am Sonntag, dem 16. Mai, ward im schönen Haus von Sir Edwin Wentworth von Walbrook, einem Mitglied der Tuchhändlergilde, dessen einziger Sohn, ein zwölfjähriger Knabe, mit gebrochenem Hals am Grunde des Brunnens gefunden. Sir Edwins Töchter, zwei liebreizende Mädchen von fünfzehn und sechzehn Jahren, sagten aus, der Knabe sei von ihrer Base Elizabeth Wentworth – Sir Edwin hatte die Waise nach dem Tod ihres Vaters aus Barmherzigkeit zu sich genommen – angegriffen und in den tiefen Brunnengestoßen worden. Die Mörderin ward in den Kerker nach Newgate gebracht und soll dort am 29. Mai vor den Richter treten. So sie sich weiterhin verstockt zeigt, wird sie der Folter unterzogen, bis sie die böse Tat gesteht; alsdann wird sie für schuldig befunden und zum nächsten Galgentag in Tyburn am Halse aufgehängt.
Das Pamphlet war auf schlechtem Papier gedruckt, und der Schrieb hinterließ Druckerschwärze auf meinen Fingern, als ich ihn im Weiterreiten in die Tasche schob. Also war der Fall der Öffentlichkeit bereits bekannt, erhitzte schon die Gemüter. Ob sie nun unschuldig war oder schuldig, wie konnte Elizabeth Wentworth jetzt noch von Londoner Geschworenen auf ein gerechtes Urteil hoffen? Die Verbreitung des Buchdrucks hatte uns einerseits die Englische Bibel beschert, welche seit einem Jahr in jeder Kirche ausliegen musste, andererseits auch dergleichen Nachrichtenblätter, von welchen nur Hinterhofdrucker und Henker ihren Nutzen ziehen. Fürwahr, die Alten hatten Recht: Nichts unter dem Mond, und sei es noch so fein, ist frei von Fäulnis.
Es war schon fast Mittag, als ich Chancery vor meinem Hause zügelte. Die Sonne stand im Zenit, und als ich das Band meiner Kappe aufschnürte, hingen mir Schweißperlen unterm Kinn. Joan, meine Haushälterin, öffnete die Tür, als ich abstieg, einen besorgten Ausdruck im plumpen Gesicht.
»Er ist hier«, flüsterte sie mit einem Blick über die Schulter. »Der Onkel jenes Mädchens –«
»Ich weiß.« Joseph war gewiss durch London geritten. Dann hatte er vielleicht auch das Pamphlet gelesen. »Wie steht’s um ihn?«
»Finster, Sir. Er ist in der Wohnstube. Ich habe ihm ein Glas Dünnbier hingestellt.«
»Danke.« Ich überließ Chancery dem jungen Simon, den Joan vor kurzem eingestellt hatte, damit er ihr im Haus zur Hand gehe, ein spindeldürrer, hellhaariger Bursche. Chancery war noch nicht an ihn gewöhnt und scharrte unruhig mit den Hufen im Kies, wäre ihm fast auf die bloßen Füße getrampelt. Simon redete ihm gut zu, verbeugte sich hastig vor mir und führte das Pferd in den Stall.
»Der Junge sollte Schuhe tragen«, sagte ich zu Joan.
Sie schüttelte den Kopf. »Er will keine, Sir. Behauptet, sie würden ihm die Füße wund scheuern. Ich sagte ihm schon, dass er im Haus eines Gentleman nicht barfüßig herumlaufen könne.«
»Versprich ihm Sixpence, wenn er die Schuhe eine Woche lang anbehält«, sagte ich. Dann holte ich tief Luft. »Und jetzt seh ich besser nach Joseph.«
Joseph Wentworth war ein rundlicher rotbackiger Mann Anfang fünfzig, der sich nicht recht wohl zu fühlen schien im braunen Sonntagswams. Es war aus Wolle, viel zu warm für dieses Wetter, und entsprechend schwitzte er. Er sah nach dem aus, was er war: ein schwer arbeitender Landmann, dem unten in Essex ein paar armselige Felder gehörten. Seine zwei jüngeren Brüder hatten in London ihr Glück gemacht, Joseph dagegen war auf dem Hof geblieben. Ich hatte ihn vor zwei Jahren gegen einen Großgrundbesitzer vertreten, der auf seinem Land Schafe weiden lassen wollte. Ich mochte Joseph, doch seit ich vor einigen Tagen seinen Brief erhalten hatte, war mir schwer ums Herz. Ich war schon versucht gewesen, ihm wahrheitsgemäß zu erwidern, dass ich ihm kaum würde helfen können, doch was er mir geschrieben, hatte sich allzu verzweifelt gelesen.
Seine Miene hellte sich auf, als er mich sah; sogleich kam er auf mich zu und schüttelte mir herzlich die Hand. »Master Shardlake! Guten Tag, Sir, guten Tag. Habt Ihr meinen Brief erhalten?«
»O ja. Hast du schon ein Quartier?«
»Unten in Queenhithe«, sagte er. »Mein Bruder hat mir das Haus verboten, weil ich für unsere Nichte eintrete.« Verzweiflung trat in seine haselnussbraunen Augen. »Ihr müsst mir helfen, Sir, ich bitte Euch. Ihr müsst Elizabeth helfen.«
Ich beschloss, nicht lange um den heißen Brei herumzureden. Ich zog also das Pamphlet aus der Tasche und hielt es ihm hin.
»Hast du das gesehen, Joseph?«
»Ja.« Er fuhr sich mit der Hand durch die schwarzen Locken. »Dürfen die so was schreiben? Ist sie nicht unschuldig, bis ihre Schuld erwiesen ist?«
»Theoretisch schon. In der Praxis hilft es nicht viel.«
Er nahm ein fein besticktes Schnupftuch aus der Tasche und wischte sich damit über die Stirn. »Ich hab Elizabeth heute Morgen in Newgate besucht«, sagte er. »Gott sei uns gnädig, was für ein schrecklicher Ort. Aber sie will noch immer nicht reden.« Er fuhr sich mit der Hand über die runden, schlecht rasierten Wangen. »Warum redet sie nicht, Sir? Es ist doch ihre einzige Möglichkeit, sich zu retten.« Er sah mich flehentlich an, als wüsste ich die Antwort. Ich wehrte ab.
»Komm, Joseph, setz dich wieder. Lass uns ganz vorn anfangen. Ich weiß nur, was du mir in deinem Brief geschrieben hast, und der ist nicht viel länger als dieses elende Blatt hier.«
Er nahm sich einen Stuhl und meinte verlegen: »Tut mir Leid, Sir, meine Finger taugen nun mal nicht zum Schreiben.«
»Also, einer deiner beiden Brüder ist der Vater des ermordeten Knaben – richtig? – und der andere war Elizabeths Vater?«
Joseph nickte, sichtlich um Fassung bemüht.
»Mein Bruder Peter war Elizabeths Vater. Er ging schon in jungen Jahren nach London, um das Färberhandwerk zu erlernen. Er verdiente eine Weile gutes Geld, aber mit dem französischen Embargo – nun ja, der Handel ist in den letzten Jahren ziemlich zurückgegangen.«
Ich nickte. Nach Englands Bruch mit Rom hatte Frankreich die Ausfuhr des für die Färberei unentbehrlichen Alauns verboten. Es hieß, sogar der König trage jetzt schwarze Beinkleider.
»Peters Frau ist vor zwei Jahren gestorben«, erzählte Joseph weiter. »Als die verfluchte Überschwemmung letzten Herbst auch noch Peter dahinraffte, war kaum noch genug Geld da, um ihn zu Grabe zu tragen, und Elizabeth ging gänzlich leer aus.«
»War sie das einzige Kind?«
»Ja. Sie wollte bei mir leben, aber ich dachte, bei Edwin wäre sie besser aufgehoben. Ich bin schließlich unverheiratet. Er ist außerdem vermögend und in den Ritterstand erhoben worden.« In seiner Stimme schwang ein bitterer Unterton.
»Ist er Tuchhändler, wie es in diesem Pamphlet heißt?«
Joseph nickte. »Edwin versteht sein Geschäft. Nachdem er Peter nach London gefolgt war, ging er schnurstracks in den Tuchhandel. Er wusste bald, wie sich die besten Gewinne erzielen ließen, und heute besitzt er ein schönes Haus in Walbrook. Freundlicherweise erbot sich Edwin, Elizabeth bei sich aufzunehmen. Er hat schon unsere Mutter zu sich geholt, als sie vor zehn Jahren der Blattern wegen das Augenlicht verlor. Er ist ja auch ihr Lieblingssohn«, sagte er und setzte ein wenig schadenfroh hinzu: »Als dann Edwins Frau vor fünf Jahren starb, übernahm unsere Mutter bei ihm den Haushalt und herrscht seitdem mit eiserner Hand – dabei ist sie schon vierundsiebzig und stockblind.« Er zerrte nervös an seinem Schnupftuch, dass die Stickerei darauf sich verzog.
»Dann ist Edwin auch verwitwet?«
»Ja. Mit drei Kindern. Sabine, Avice und – und Ralph.«
»In jener Hetzschrift heißt es, die Mädchen seien älter als der Junge.«
Joseph nickte. »Ja. Hübsch sind sie, haben das helle Haar und die zarte Haut ihrer Mutter geerbt.« Er lächelte traurig. »Wie Mädchen so sind, reden sie von nichts anderem als von Kleidern, jungen Burschen und den Tanzfesten der Tuchleute. Bis letzte Woche jedenfalls.«
»Und der Knabe? Ralph? Wie war der?«
Joseph zerrte wieder am Taschentuch. »Er war Edwins Augenstern; mein Bruder hatte sich immer einen Sohn gewünscht, einen Nachfolger im Geschäft. Bevor Sabine zur Welt kam, hatte Edwins Frau ihm drei Knaben geboren, die allesamt noch in der Wiege starben. Dann kamen die zwei Mädchen, und schließlich gebar sie diesen Jungen, der am Leben blieb. Umso heftiger seine Trauer. Vielleicht hat er die Rute gar zu sehr geschont …« Er brach ab.
»Warum sagst du das?«
»Ralph war, um ehrlich zu sein, ein arger Schlingel. Immer nur Dummheiten im Kopf. Seine bedauernswerte Mutter wusste ihn nicht zu bändigen.« Joseph biss sich auf die Lippe. »Andererseits war er eine Frohnatur. Letztes Jahr schenkte ich ihm ein Schachspiel, und er hatte viel Freude daran, lernte schnell und setzte mich alsbald schachmatt.« In Josephs traurigem Lächeln erahnte ich die Einsamkeit, die ihn erwartete, wenn er mit der Familie brach. Was er tat, fiel ihm nicht leicht.
»Wie hast du von Ralphs Tod erfahren?«, fragte ich leise.
»Ein Brief von Edwin; ein berittener Bote brachte ihn mir am Tag nach dem Unglück. Edwin bat mich, nach London zu kommen und der Untersuchung zur Feststellung der Todesursache beizuwohnen. Er musste Ralphs Leichnam in Augenschein nehmen und brauchte dabei meinen Beistand.«
»Du hast dich also nach London begeben, wann genau, vor einer Woche?«
»Ja. Ich musste gemeinsam mit Edwin den Leichnam identifizieren. Es war grauenhaft. Der arme Ralph lag auf dem schmutzigen Tisch, das kleine Wams am Leib, ganz bleich im Gesicht. Edwin brach schluchzend zusammen; noch nie zuvor hatte ich ihn weinend erlebt. Er weinte an meiner Schulter und schluchzte ein ums andre Mal: ›Mein Bübchen, mein Bübchen. Diese böse Hexe‹.«
»Damit meinte er Elizabeth.«
Joseph nickte. »Dann traten wir vor den Richter und hörten die Beweisaufnahme des Staatsanwalts. Die Vernehmung dauerte nicht lang, ich war überrascht, dass sie so kurz war.«
Ich nickte. »Ja. Greenway hat es immer eilig. Wer waren die Zeugen?«
»Als Erstes wurden Sabine und Avice befragt. Es war eigenartig, sie beide so still in der Anklagebank stehen zu sehen: Wahrscheinlich waren sie starr vor Angst, die armen Mädchen. Sie sagten aus, sie hätten an dem besagten Tage im Haus gesessen und Gobelins gestickt. Elizabeth habe draußen im Garten unter dem Baum am Brunnen gesessen und gelesen. Sie hätten sie durchs Fenster der Wohnstube aus sehen können. Ralph sei zu ihr gegangen und habe mit ihr gesprochen. Dann hätten sie einen Schrei gehört, ganz schrecklich und hohl. Sie hätten aus dem Fenster geblickt und gesehen, dass Ralph fort war.«
»Fort?«
»Verschwunden. Sie seien hinausgerannt. Elizabeth habe mit zorniger Miene am Brunnen gestanden. Sie hätten sich zuerst nicht zu ihr gewagt, aber Sabine habe sich ein Herz gefasst und sie gefragt, was geschehen sei. Elizabeth habe nicht antworten wollen, und in der Tat hat sie seitdem kein Wort mehr gesprochen, Sir. Sabine erzählte, sie hätten in den Brunnen geblickt, aber weil er so tief sei, hätten sie nicht bis auf den Grund gesehen.«
»Ist der Brunnen in Gebrauch?«
»Nein, das Grundwasser unten in Walbrook ist schon seit Jahren verschmutzt. Edwin hat sich kurz nach dem Kauf des Hauses ein Rohr gießen lassen, durch welches das Wasser unterirdisch vom Kanal zum Haus fließt. Es war im selben Jahr, in dem der König seine Nan Bullen geheiratet hat.«
»Eine kostspielige Angelegenheit.«
»Edwin ist reich. Sie hätten den Brunnen zudecken müssen.« Er schüttelte erneut den Kopf. »Sie hätten ihn zudecken müssen.«
Ich hatte plötzlich ein Bild vor Augen, von einem Sturz ins Dunkel, vernahm einen Schrei, der von den feuchten Ziegelmauern widerhallte. Und trotz der Hitze des Tages überfiel mich ein Schauder.
»Was ist dann passiert?«
»Avice lief zu Needler, dem Hausdiener. Der holte einen Strick und kletterte hinunter. Unten lag Ralph mit gebrochenem Hals, sein armer kleiner Leib noch warm. Needler hat ihn herausgeschafft.«
»Ist der Hausdiener als Zeuge aufgetreten?«
»O ja. David Needler war da.« Joseph runzelte ärgerlich die Stirn. Ich blickte ihn scharf an.
»Du magst ihn nicht?«
»Er ist ein unverfrorener Bursche. Hat mir immer verächtliche Blicke zugeworfen, wenn ich vom Land kam und die Familie besuchte.«
»Also hat keins der Mädchen die Tat wirklich mitangesehen?«
»Nein, erst auf den Schrei hin hätten sie hinausgeblickt, erzählten sie. Elizabeth saß oft allein im Garten. Ihr – nun ja, ihr Umgang mit dem Rest der Familie war – schwierig. Ralph schien ihr besonders verhasst zu sein.«
»Soso.« Ich blickte ihm in die Augen. »Und wie ist Elizabeth?«
Er lehnte sich zurück, legte das zerknüllte Schnupftuch in den Schoß. »Sie und Ralph waren sich in gewisser Weise sehr ähnlich. Sie hatten beide dunkles Haar und dunkle Augen. Und eigensinnig war sie auch. Sie war das einzige Kind ihrer armen Eltern, und diese haben sie nach Kräften verwöhnt. Sie konnte recht aufmüpfig sein, tat auf sehr unmädchenhafte Weise ihre Meinung kund und begeisterte sich mehr für Bücher als für Frauensachen. Aber sie spielte wunderschön auf dem Virginal, und sticken mochte sie auch gern. Sie ist noch sehr jung, Sir, sehr jung. Und sie hat ein gutes Herz – hat stets streunende Hunde und Katzen gerettet.«
»Soso.«
»Allerdings, das muss ich zugeben, hat sie sich verändert, nachdem Peter starb. Doch wen wundert’s, da sie zuerst ihre Mutter, dann ihren Vater und dann auch noch das Haus verlor. Sie zog sich immer mehr zurück, Sir, war nicht mehr das wissbegierige, redselige Mädchen, das ich kannte. Ich weiß noch gut, wie sie mich nach Peters Beerdigung, als ich ihr sagte, bei Edwin wäre sie besser aufgehoben als bei mir, zornig anfunkelte und sich ohne ein Wort von mir abkehrte.« Die Erinnerung trieb ihm Tränen in die Augen. Er blinzelte sie fort.
»Und es ging ihr nicht gut bei Edwin?«
»Nein. Ich habe sie des Öfteren dort besucht. Ich machte mir Sorgen um sie. Sie würde von Tag zu Tag schwieriger, klagten Edwin und meine Mutter, es sei ganz unmöglich mit ihr auszukommen.«
»Inwiefern?«
»Sie weigerte sich, mit der Familie zu reden, blieb in ihrer Kammer, wollte nichts mehr essen. Achtete nicht einmal mehr auf ihre Kleider. Wurde sie darum gescholten, blieb sie entweder stumm oder brüllte, rasend vor Zorn, man möge sie in Ruhe lassen.«
»Und sie kam mit keinem der drei Kinder zurecht?«
»Ich glaube, dass Sabine und Avice nichts mit ihr anzufangen wussten. Sie hätten versucht, sagten sie dem ermittelnden Coroner, sie für Weibersachen zu begeistern, aber Elizabeth habe sie immer nur fortgeschickt. Sie ist achtzehn, ein wenig älter als ihre Basen, aber trotzdem noch ein Mädchen. Und Edwins Kinder verkehren in höheren Kreisen, sie hätten Elizabeth vieles beibringen können.« Er biss sich erneut auf die Lippe. »Ich hatte gehofft, sie würde vorankommen. Und das haben wir nun davon!«
»Und warum, glaubst du, konnte sie Ralph nicht leiden?«
»Das verstand ich am allerwenigsten. Ralph brauchte sich Elizabeth nur zu nähern, erzählte mir Edwin, da habe sie ihn so hasserfüllt angeblitzt, dass er ganz erschrocken sei. Eines Abends im Februar sah ich es mit eigenen Augen. Ich saß mit der Familie zu Tisch, alle waren da. Es war ein unbehagliches Mahl, Sir. Wir aßen Beefsteak, mein Bruder mag es ziemlich blutig, und Elizabeth schien keinen rechten Appetit zu haben, denn sie stocherte nur immerzu in ihrem Essen herum. Meine Mutter schalt sie, aber sie gab nichts drauf. Da fragte Ralph, ganz artig, ob ihr das feine rote Fleisch nicht schmecke. Da wurde sie bleich, legte das Messer hin und blickte ihn so wild an, dass ich mich fragte –«
»Ja?«
Er flüsterte: »Ich fragte mich, ob sie vielleicht geisteskrank sei.«
»Elizabeth hat also keinen Grund, der Familie so gram zu sein?«
»Nein. Edwin ist das Ganze ein Rätsel, von Anfang an.«
Ich fragte mich, was wohl im Hause Sir Edwins vorgefallen war, ob Joseph mir etwas verheimlichte, wie es nicht selten ist bei Familienangelegenheiten, obschon er mir sehr offen zu sein schien. Er redete weiter: Nachdem der tote Ralph geborgen war, sperrte Needler Elizabeth in ihre Kammer und sandte einen Boten zu Edwin in die Mercers’ Hall, die Tuchhändlergilde. Der kam sogleich nach Haus, und als er keine Antwort erhielt auf seine Fragen, da rief er nach dem Konstabler.« Joseph breitete die Hände aus. »Was hätte er tun sollen? Er fürchtete um die Sicherheit seiner Töchter und unserer alten Mutter.«
»Und bei der Untersuchung vor Gericht? Hat Elizabeth da auch nichts gesagt? Gar nichts?«
»Nein. Der Coroner meinte, sie habe jetzt Gelegenheit, sich zu verteidigen, aber sie ist nur still da gesessen und hat ihn aus kalten, leeren Augen angesehen. Das hat ihn erzürnt, und die Geschworenen auch.« Joseph seufzte. »Die Geschworenen befanden Elizabeth Wentworth für schuldig, und der Coroner ließ sie nach Newgate schaffen, wo man sie des Mordes anklagen und vor Gericht stellen würde. Er gab die Anweisung, sie ihrer unerhörten Verstocktheit wegen ins Loch zu stecken. Und da –«
»Ja?«
»Da drehte Elizabeth sich um und sah mich an. Nur eine Sekunde. Da war ein solches Elend in ihrem Blick, Sir, kein Zorn mehr, nur noch Elend.« Joseph biss sich wieder auf die Lippe. »Früher, als sie noch klein war, da hatte sie mich gern, da kam sie mich oft auf der Farm besuchen. Meine beiden Brüder sahen in mir den Bauerntrottel, aber Elizabeth mochte das Landleben, lief immer gleich zu den Tieren, wenn sie kam.« Er lächelte traurig. »Als sie noch klein war, da brachte sie die Schafe und Schweine dazu, mit ihr zu spielen, wie wenn es Schoßhündchen wären, und weinte, wenn sie ihr nicht gehorchen wollten.« Er strich das zerknüllte, fleckige Schnupftuch glatt. »Sie hat ein paar von diesen Tüchern hier für mich gestickt, wisst Ihr, vor zwei Jahren. Dies hier habe ich ganz schön zugerichtet. Doch sooft ich sie an diesem schrecklichen Ort besuche, wo sie jetzt ist, liegt sie teilnahmslos und schmutzig da, als warte sie nur noch auf den Tod. Ich bitte sie inständig, mit mir zu reden, aber sie starrt durch mich hindurch, als wäre ich gar nicht da. Am Samstag wird ihr der Prozess gemacht, in nur fünf Tagen.« Seine Stimme wurde wieder ein Flüstern. »Manchmal fürchte ich, sie ist besessen.«
»Na komm, Joseph, so etwas sollst du nicht denken.«
Er sah mich flehentlich an. »Könnt Ihr dem Mädchen helfen, Master Shardlake? Könnt Ihr es retten? Ihr seid meine letzte Hoffnung.«
Ich schwieg einen Augenblick still, wählte meine Worte mit Bedacht.
»Die Beweislast gegen sie ist schwer, ausreichend für die Geschworenen, außer, Elizabeth hat etwas zu ihrer Verteidigung vorzubringen.« Nach einer Pause fragte ich: »Bist du sicher, dass sie nicht schuldig ist?«
»Ja«, sagte er ohne Zögern. Er schlug sich mit der Faust gegen die Brust. »Ich fühle es hier. Sie hatte stets ein gutes Herz, Sir. Sie ist der einzige Mensch in meiner Verwandtschaft, der ein wirklich gutes Herz hat. Auch wenn sie tatsächlich krank sein sollte im Kopf, was Gott verhüten möge, so mag ich doch nicht glauben, dass sie einen kleinen Jungen umgebracht haben soll.«
Ich holte tief Luft. »Wenn sie dem Gericht vorgeführt wird, muss sie sich für schuldig oder nicht schuldig bekennen. Verweigert sie die Aussage, können die Geschworenen sie nicht verurteilen. Doch was ihr dann blüht, ist noch schlimmer.«
Joseph nickte. »Ich weiß.«
»Peine forte et dure. Harte, heftige Pein. Man wird sie in einer Zelle in Newgate auf den Boden ketten. Sie werden ihr einen großen, spitzen Stein unter den Rücken schieben und ein Brett auf sie legen. Dieses Brett wird dann mit Gewichten beladen.«
»Wenn sie doch nur reden würde!« Joseph stöhnte und schlug die Hände vors Gesicht. Aber ich sprach weiter, hatte keine Wahl; er musste wissen, was seiner Nichte drohte.
»Sie werden ihre Nahrungs- und Wasserrationen möglichst knapp bemessen. Tag für Tag werden mehr Gewichte auf das Brett geladen, bis sie redet oder unter dem Druck der Gewichte erstickt. Sind die Gewichte schwer genug, bricht ihr der Stein unter dem Rücken die Wirbelsäule.« Nach kurzer Pause sagte ich: »Immer wieder gibt es besonders Tapfere, die nicht gestehen wollen und sich lieber zu Tode pressen lassen. Wenn ihnen nämlich keine Schuld nachgewiesen werden kann, fällt ihr Besitz nicht dem Staate anheim. Ist Elizabeth vermögend?«
»Nicht im Geringsten. Der Verkauf des Hauses hat gerade Peters Schulden abgedeckt. Den kläglichen Rest verschlang die Beerdigung.«
»Vielleicht hat sie die abscheuliche Tat ja doch begangen, Joseph, in einem Anflug von Raserei; und jetzt fühlt sie sich so schuldig, dass sie allein im Dunkeln sterben möchte. Hast du schon daran gedacht?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, das glaub ich nicht. Ich kann es nicht glauben.«
»Du weißt doch, dass Verbrecher vor Gericht keinen Anspruch auf Rechtsvertretung haben?«
Er nickte verdrossen.
»Die Begründung lautet, dass die Beweise, die in einem Strafprozess erbracht werden, so klar sein müssen, dass es keines juristischen Beistands bedarf. Blanker Unsinn, wenn man mich fragt; die Fälle werden rasch abgewickelt, und die Geschworenen entscheiden für gewöhnlich nach dem Gefühl. Oft sind sie dem Beschuldigten nur deshalb gewogen, weil sie sich scheuen, jemanden an den Galgen zu bringen, doch in diesem Fall« – ich sah nach dem elenden Hetzblatt auf dem Tisch – »handelt es sich um einen Kindsmord, da ist von ihrer Seite kaum Mitleid zu erwarten. Elizabeth hat nur eine Chance: Sie muss ihre Version der Geschichte erzählen. Und sollte sie tatsächlich in einem Anfall von Raserei gehandelt haben, dann könnte ich sie für schwachsinnig erklären und wenigstens ihr Leben retten. Man würde sie ins Irrenhaus stecken, nach Bedlam, aber wir könnten den König um Gnade ersuchen.« Das würde mehr Geld kosten, als Joseph besaß, dachte ich.
Er blickte auf, und zum ersten Mal sah ich ein Fünkchen Hoffnung in seinen Augen. Mir wurde bewusst, dass ich ohne nachzudenken mich ins Spiel gebracht hatte. Ich hatte mich verpflichtet.
»Wenn sie aber nicht reden will«, warf ich ein, »kann keiner sie mehr retten.«
Er beugte sich vor und umklammerte mit feuchten Händen meine Rechte. »O, danke, Master Shardlake, tausend Dank, ich wusste, Ihr würdet sie retten –«
»Ich bin mir keineswegs sicher, ob ich dazu imstande bin«, fiel ich ihm ins Wort, fügte dann aber hinzu: »Doch ich will es versuchen.«
»Ich bezahle auch dafür, Sir. Ich hab nicht viel, aber ich zahle.«
»Ich sollte mich besser nach Newgate aufmachen und sie besuchen. Fünf Tage – ich muss sie also so bald wie möglich sehen, aber ich habe noch etwas am Lincoln’s Inn zu erledigen und werde den ganzen Nachmittag dort beschäftigt sein. Treffen wir uns doch morgen früh im Pope’s Head. Das ist eine Schenke gleich neben dem Gefängnis. Sagen wir um neun?«
»Ja, ja.« Er stand auf, steckte das Schnupftuch ein und ergriff meine Hand. »Ihr seid ein guter Mensch, Sir, ein gottesfürchtiger Mann.«
Wohl eher ein dummer Tropf, dachte ich. Doch das Kompliment rührte mich. Joseph und seine Verwandten waren eifrige Anhänger der Reform, genau wie ich früher, und sagten dergleichen nicht leichtfertig dahin.
»Meine Mutter und mein Bruder halten Elizabeth für schuldig, sie waren außer sich, als ich sagte, dass ich ihr helfen würde. Doch ich muss die Wahrheit finden. Als wir Ralphs Leiche in Augenschein nahmen, da war etwas, das mich und auch Edwin im höchsten Maße befremdete …«
»Was war das?«
»Ralph war schon zwei Tage tot, als wir ihn sahen. Der Frühling heuer ist heiß, aber im Keller, in dem sie die Leichname lagern, bis der Coroner sie in Augenschein nimmt, um die Todesursache festzustellen, ist es kühl. Und der arme Ralph war angekleidet. Und doch stank die Leiche, Sir, sie stank wie ein Kuhschädel, den man im Sommer draußen auf dem Schlachthof liegen lässt. Mir wurde übel, dem Coroner ebenfalls. Und Edwin schwanden fast die Sinne. Was hat das zu bedeuten, Sir? Ich habe versucht, es mir zu erklären. Was hat das bloß zu bedeuten?«
Ich schüttelte den Kopf. »Wir wissen so vieles nicht, mein Freund. Und manches hat auch gar nichts zu bedeuten.«
Joseph schüttelte den Kopf. »Aber Gott will, dass wir die wahre Bedeutung der Dinge begreifen. Er gibt uns Hinweise. Und wenn diese Angelegenheit nicht geklärt wird, Sir, und Elizabeth stirbt, kommt der wahre Mörder, wer es auch sei, ungeschoren davon.«
Kapitel Zwei
Früh am nächsten Morgen ritt ich wieder hinein in die City. Noch ein heißer Tag; das Sonnenlicht, das sich in den rautenförmigen Fensterscheiben der Gebäude in Cheapside spiegelte, machte mich blinzeln.
Am Pranger neben der Standarte stand ein Mann in mittleren Jahren; er hatte einen Papierhut auf dem Kopf sitzen und einen Laib Brot um den Hals hängen. Ein Schild schmähte ihn als Bäcker, der zu kleine Brote gebacken hatte. Ein paar faule Früchte klebten noch an seinem Kittel, aber die Vorübergehenden zollten ihm wenig Beachtung. Die Schmach wird wohl das Schlimmste sein an seiner Strafe, dachte ich, als ich zu ihm aufblickte, doch da sah ich, wie er das Gesicht im Schmerz verzog, als er das Gewicht auf den anderen Fuß verlagerte. Für jemanden, der nicht mehr jung war, war es mühsam, so dazustehen, Kopf und Arme eingeklemmt, den Hals vorgereckt; ich schauderte beim Gedanken an die Schmerzen, die mein Rücken mir bereiten würde, wäre ich an des Bäckers Stelle; dabei hatte ich in letzter Zeit, seit Guy mich behandelte, wenig Beschwerden.
Guy betrieb eine von mehreren Apotheken, die sich in einer schmalen Gasse gleich hinter der Old Barge befanden. Die Barge war ein riesiges altes Gemäuer, das einst sehr prächtig gewesen sein mochte, jetzt aber schäbige Wohnungen beherbergte. Krähen nisteten zuhauf auf den bröckelnden Zinnen, und auf der Backsteinmauer wucherte wild der Efeu. Ich bog in die Gasse ein, froh über die schattige Kühle.
Als ich vor Guys Apotheke mein Pferd zügelte, war mir plötzlich, als würde ich beobachtet. Die Straße war ruhig, die meisten Läden noch nicht geöffnet. Ich stieg bedächtig aus dem Sattel und band Chancery vor der Tür fest; und während ich einen unbeschwerten Eindruck zu machen suchte, horchte ich auf jedes Geräusch hinter mir. Dann drehte ich mich geschwind um und blickte die Straße hinauf.
In einem der oberen Stockwerke der Barge hatte sich etwas bewegt. Ich sah hinauf, erhaschte aber nur noch einen Schatten an einem der Fenster, bevor die wurmstichigen Läden zuklappten. Ich starrte noch einen Augenblick, von jähem Unbehagen er füllt, ehe ich mich Guys Apotheke zuwandte.
Auf dem Schild über der Tür stand nur sein Name, ›Guy Malton‹. Das Schaufenster enthielt statt ausgestopfter Aligatoren und dergleichen Ungeheuer ordentlich beschriftete Flaschen. Ich klopfte und ging hinein. Wie üblich war der Laden sauber ausgefegt, standen Krüge mit Kräutern und Gewürzen in Reih und Glied in den Regalen. Der moschusartige, würzige Duft brachte mir Guys Arztstube im Kloster Scarnsea in Erinnerung. In der Tat war der lange Apothekermantel, den er trug, von so dunklem Grün, dass er sich im trüben Licht fast schwarz ausnahm und auch als Mönchskutte durchgehen mochte. Er saß an seinem Tisch, einen konzentrierten Ausdruck im hageren dunklen Antlitz, und strich aus einer Schüssel Salbe auf eine hässliche Brandwunde auf dem Arm eines untersetzten jungen Mannes. Lavendelduft wehte mir in die Nase. Guy sah auf und lächelte, dass die weißen Zähne blitzten.
»Nur noch eine Minute, Matthew«, lispelte er.
»Verzeih, ich bin zu früh.«
»Macht nichts, ich bin fast fertig.«
Ich nickte und ließ mich auf einem Stuhl nieder. Ein Schaubild an der Wand zeigte einen nackten Mann im Zentrum mehrerer konzentrischer Kreise: der Mensch, durch die Natur an seinen Schöpfer gekettet. Unwillkürlich kam mir eine Zielscheibe in den Sinn, auf die ein Mensch geheftet war. Darunter war ein Diagramm von den vier Elementen gezeichnet, welche man den vier menschlichen Wesenstypen zuordnete: die Erde dem Melancholiker, das Wasser dem Phlegmatiker, die Luft dem heiteren Sanguiniker und das Feuer dem Choleriker.
Der junge Mann seufzte tief und meinte zu Guy:
»Bei Gott, Sir, das lindert den Schmerz!«
»Gut. Lavendel hat kalte, feuchte Eigenschaften und zieht die trockene Hitze aus dem Arm. Ich gebe Euch noch eine Flasche davon mit nach Hause, denn Ihr müsst die Tinktur viermal am Tag auftragen.«
Der Bursche blickte neugierig in Guys braunes Gesicht. »Ich hab noch nie von einer solchen Arzenei gehört. Stammt sie aus dem Land, aus dem Ihr kommt, Sir? Vielleicht sind dort ja alle Menschen von der Sonne verbrannt.«
»So ist es, Master Pettit«, pflichtete Guy ihm ernsthaft bei. »Würden wir uns dort nicht mit Lavendel bestreichen, wäre unsere Haut bald ganz verbrannt und schrumpelig. Wir reiben sogar die Palmen damit ein.« Sein Patient sah ihn forschend an, ahnte wohl den Spott. Seine großen, eckigen Hände, fiel mir auf, waren voller blasser Narben. Guy stand auf und reichte ihm lächelnd eine Flasche; dabei erhob er mahnend den Zeigefinger. »Viermal am Tag, vergesst es nicht. Und streicht auch etwas auf die Wunde auf Eurem Bein, die jener närrische Quacksalber Euch beigebracht hat.«
»Ja, Sir.« Der Bursche erhob sich. »Es brennt schon nicht mehr gar so arg; vergangene Woche litt ich noch Höllenqualen, wenn nur der Ärmel daran rieb. Habt vielen Dank.« Er zog den Beutel hervor und gab dem Apotheker eine Silbermünze. Als er den Laden verlassen hatte, wandte Guy sich leise lachend zu mir um.
»Anfangs, da pflegte ich die Leute zu verbessern, wenn sie dergleichen Bemerkungen machten, sie zu belehren, es fiele auch Schnee in Granada, was ja auch stimmt. Doch mittlerweile gebe ich ihnen einfach Recht. So sind sie nie ganz sicher, ob ich scherze oder nicht. Auf diese Weise behalten sie mich im Kopf. Vielleicht erzählt er es seinen Freunden in Lothbury.«
»Er ist ein Gießer?«
»Jawohl, Master Pettit hat eben seine Lehre beendet. Ein ernsthafter junger Bursche. Er hat sich heißes Blei über den Arm gegossen, aber dieses alte Heilmittel wird ihm hoffentlich Linderung bringen.«
Ich lächelte. »Du lernst allmählich, wie man Geschäfte betreibt, weißt dein Anderssein zu deinem Vorteil zu nutzen.«
Der Apotheker Guy Malton, einst Bruder Guy von Malton, war nach der Rückeroberung Granadas mit seinen maurischen Eltern aus Spanien geflohen und hatte dann in Louvain Medizin studiert. Bei meiner Mission in Scarnsea vor drei Jahren war er mein Freund geworden und hatte mir durch die grauenvolle Zeit geholfen. Als das Kloster dann aufgelöst worden war, hatte ich gehofft, ihm in London eine Stelle als Physikus verschaffen zu können. Das Collegium aber hatte ihn nicht aufnehmen wollen, wegen seiner braunen Gesichtsfarbe und der papistischen Vergangenheit. Mit ein wenig Bestechung aber hatte ich ihn in die Apothekergilde gebracht, und inzwischen hatte er sich schon recht gut eingerichtet.
»Master Pettit war zunächst bei einem Physikus.« Guy schüttelte den Kopf. »Er hat ihm ins Bein gestochen und ein Klistier angesetzt, um ihm den Schmerz aus dem Arm zu ziehen; als die Wunde sich entzündete, hat er stur behauptet, darin zeige sich nur die Wirksamkeit des Klistiers.« Er zog sich die Apothekerkappe vom Kopf und brachte Locken zum Vorschein, die einmal schwarz gewesen, jetzt aber großenteils weiß waren. Es kam mir noch immer seltsam vor, ihn ohne die Tonsur zu sehen. Er musterte mich eindringlich mit seinen scharfen braunen Augen.
»Und wie ist es dir ergangen im letzten Monat, Matthew?«
»Immer besser. Ich bin dir ein folgsamer Patient und verrichte zweimal täglich meine Leibesübungen. Mein Rücken schmerzt nur noch, wenn ich schwer schleppen muss, zum Beispiel an den dicken Bündeln juristischer Blätter, die sich in meiner Kanzlei am Lincoln’s Inn stapeln.«
»Du hast einen Gehilfen, soll er sie für dich tragen.«
»Er bringt sie mir bloß durcheinander. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Tollpatsch Master Skelly ist.«
Er lächelte. »Nun, ich werde ihn mir einmal ansehen, wenn ich darf.«
Er stand auf, entzündete eine süßduftende Kerze und schloss die Läden, während ich Wams und Hemd ablegte. Guy war der Einzige, der meinen missgestalteten Rücken ansehen durfte. Er hieß mich aufstehen, Schultern und Arme bewegen, trat hinter mich und betastete vorsichtig meine Rückenmuskeln. »Gut«, sagte er. »Kaum noch harte Stellen. Du darfst dich wieder anziehen. Fahr fort mit deinen Übungen. Es ist gut, wenn ein Patient gewissenhaft ist.«
»Ich möchte ungern wieder den alten Zustand erleben, die ständige Angst vor den Schmerzen, die immer schlimmer werden.«
Er sah mich erneut eindringlich an. »Und wie steht’s um deine Schwermut? Du bist sie noch nicht los, ich sehe es in deinen Augen.«
»Ich bin nun einmal von melancholischer Natur, Guy. Sie ist mir angeboren.« Ich deutete auf das Schaubild an der Wand. »Alles auf der Welt setzt sich aus den vier Elementen zusammen, und ich habe eben zu viel Erde in mir. Dieses Ungleichgewicht ist festgelegt.«
Er neigte das dunkle Haupt zur Seite. »Es gibt nichts unter dem Mond, das nicht dem Wandel unterworfen wäre.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich finde immer weniger Gefallen an den Turbulenzen von Politik und Juristerei, die doch einst mein Leben waren. Seit Scarnsea ist alles anders.«
»Eine schlimme Zeit. Wärst du nicht gern wieder dem Mittelpunkt der Macht nah?« Er zögerte. »Bei Lord Cromwell?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich träume vom ruhigen Leben auf dem Lande, vielleicht in der Nähe meines Vaterhauses. Mag sein, dass mir dann wieder nach Malen zumute sein wird.«
»Wäre das wirklich ein Leben für dich, mein Freund? Würdest du dich nicht langweilen ohne juristische Fälle, daran du deinen Verstand schärfen kannst, ohne Probleme, die der Lösung bedürfen?«
»Das war einmal. Doch jetzt,« ich schüttelte den Kopf, »mit jedem Jahr zieht es mehr Eiferer und Halunken nach London. Und in meinem Beruf gibt es von beiden genug.«
Er nickte. »Ja, in der Religion werden die Ansichten immer extremer. Ich behalte meine Vergangenheit für mich, wie du dir denken kannst, bin wie die graue Maus, fein unauffällig und still, nur so bin ich sicher.«
»Ich kann mich weder für die eine noch für die andere Seite erwärmen. Manchmal meine ich, dass nur der Glaube an Christus zählt; alles andere ist nur leeres Wortgeklingel.«
Er lächelte wehmütig. »Das hättest du früher nicht gesagt.«
»Nein. Und sogar diese wesentliche Überzeugung entgleitet mir zuweilen, dann mag ich nur noch glauben, dass der Mensch eine gefallene Kreatur ist.« Ich lachte traurig. »Das zumindest glaube ich gern.« Ich holte das knittrige Pamphlet aus der Tasche und legte es auf den Tisch. »Sieh her, der Onkel dieses Mädchens ist ein früherer Mandant von mir. Er will, dass ich ihr helfe. Ihr Prozess ist am Samstag. Deshalb bin ich so früh gekommen, ich treffe mich mit ihm Schlag neun in Newgate.« Ich erzählte ihm von meiner Unterredung mit Joseph tags zuvor. Streng genommen beging ich einen Vertrauensbruch, aber ich wusste ja, dass Guy nichts weitersagen würde.
»Sie weigert sich zu sprechen?«, fragte er, als ich geendet hatte, und strich sich nachdenklich übers Kinn.
»Nicht ein Wort. Man würde meinen, sie müsse schon aus Angst vor der Folter reden, aber dem ist nicht so. Langsam glaube ich, dass ihr Verstand gelitten hat.« Ich sah ihn ernst an. »Ihr Onkel macht sich Sorgen, meint, sie könne besessen sein.«
Er neigte den Kopf zur Seite. »Es ist leicht, jemanden für besessen zu erklären. Ich habe mich schon manches Mal gefragt, ob der Mann, dem Unser Herr Jesus einen Dämon austrieb, womöglich bloß ein armer Irrer war.«
Ich blickte ihn von der Seite an. »Die Bibel sagt doch aber klipp und klar, er sei vom Teufel besessen gewesen.«
»Und wir heute müssen alles glauben, was in der Bibel steht, und zwar ausschließlich. Besser gesagt, was in der Übersetzung des Master Coverdale steht«, versetzte Guy mit ironischem Lächeln. Dann wurde seine Miene nachdenklich, und er schritt im Zimmer auf und ab, wobei der Saum seines Mantels über die sauberen Binsen auf dem Boden strich.
»Du kannst sie nicht einfach für schwachsinnig erklären«, sagte er. »Noch nicht. Die Menschen haben viele Gründe, warum sie schweigen. Mancherlei lässt sich nicht enthüllen, weil man sich schämt oder fürchtet. Oder weil man jemanden schützen will.«
»Oder weil man sich keinen Deut darum schert, was aus einem wird.«
»Ja. In der Tat ein grauenvoller Zustand, dem Selbstmord sehr nah.«
»Wie auch immer, wenn ich ihr Leben retten will, muss ich sie zum Reden bringen. Die Folterpresse ist ein abscheulicher Tod.« Ich stand auf. »Ach Guy, worauf habe ich mich da nur wieder eingelassen? Die meisten Rechtsanwälte halten sich von Verbrechen fern; schließlich haben die Angeklagten ohnehin kein Anrecht auf ihren Beistand. Ich habe wohl den einen oder anderen beraten, aber gern tat ich es nicht. Mir graut vor dem Gestank des Todes bei Gericht, zumal ich ja weiß, dass die Verurteilten schon wenige Tage später zum Richtplatz nach Tyburn gefahren werden.«
»Aber die Karren fahren so oder so, ob du sie siehst oder nicht. Wenn du in einem dieser Karren nur einen Platz frei machen könntest –«
Ich lächelte ironisch. »Du hältst noch immer an deinem Mönchsglauben fest, dass einer, der Gutes tut, gerettet werde.«
»Sollten wir nicht alle daran glauben, dass es gut und richtig ist, den Nächsten zu lieben?«
»Ja, wenn wir die Kraft dazu haben.« Ich stand auf. »Nun, ich muss nach Newgate.«
»Ich wüsste einen Trank«, sagte er, »der aufheiternd wirkt, weil er die schwarze Galle im Magen vermindert.«
Ich winkte ab. »Nein danke, Guy, solange er mir den Verstand nicht trübt, möchte ich im Zustand verbleiben, den Gott mir zugedacht hat.«
»Wie du willst.« Er reichte mir die Hand. »Ich werde für dich beten.«
»Unter deinem großen alten spanischen Kruzifix? Du hast es noch immer im Schlafzimmer hängen?«
»Es gehörte meiner Familie.«
»Hüte dich vor dem Konstabler. Dass Reformatoren jetzt auch verhaftet werden, heißt noch lange nicht, dass die Regierung mit den Katholiken weniger streng verfährt.«
»Der Konstabler ist ein Freund. Vorigen Monat trank er Wasser, das er von einem Träger gekauft hatte, und eine Stunde später kam er in meinen Laden gestolpert und hielt sich den schmerzenden Leib.«
»Er hat Wasser getrunken? Ungekocht? Jedes Kind weiß doch, dass es voller tödlicher Säfte ist.«
»Er hatte großen Durst; du weißt ja, wie heiß es derzeit ist. Er hat sich eine schlimme Vergiftung zugezogen – ich ließ ihn einen Löffel Mostrich schlucken, damit er sich erbrach.«
Ich schauderte. »Ich dachte, gesalzenes Bier wäre das beste Brechmittel?«
»Mostrich ist noch besser und wirkt sofort. Der Konstabler erholte sich schnell, und jetzt stolziert er im Viertel herum und preist meine Künste.« Sein Gesicht wurde ernst. »Aber wie dem auch sei: Bei dem vielen Gerede derzeit von einem Überfall auf England sind Ausländer nicht sonderlich beliebt. Ich werde draußen immer häufiger beschimpft; wenn Lehrlinge in Gruppen beieinander stehen, wechsle ich wohlweislich die Straßenseite.«
»Das tut mir Leid. Wir gehen schweren Zeiten entgegen.«
»In der Stadt wird gemunkelt, der König sei nicht glücklich mit seiner neuen Gemahlin«, sagte Guy. »Diese Anna von Kleve könnte in Ungnade fallen und Cromwell gleich mit.«
»Gibt es nicht ständig neue Gerüchte, neue Ängste?« Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. »Kopf hoch. Kommst du nächste Woche zu mir zum Dinner?«
»Sehr gern.« Er geleitete mich an die Tür.
»Du wolltest für mich beten, vergiss es nicht«, sagte ich über die Schulter zu ihm.
»Aber nein.«
Ich band Chancery los und machte mich auf den Weg. Als ich an der Old Barge vorbeikam, sah ich zum Fenster empor, hinter dem ich die Gestalt gesehen. Die Läden waren fest geschlossen. Doch in Bucklersbury überkam mich erneut das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich blickte mich um. Die Straßen belebten sich allmählich, und doch stach mir ein Mann im leuchtend roten Wams ins Auge, der mit verschränkten Armen an der Mauer lehnte und mich unverwandt anstarrte. Er war etwa Ende zwanzig, mit kantigen Zügen, gut aussehend, aber hart, und wirrem braunen Haar. Er hatte die Statur eines Kriegers, breite Schultern und schmale Hüften. Als sich unsere Augen trafen, verzog sich sein breiter Mund zu einem höhnischen Grinsen. Dann wandte er sich ab und ging schnellen, leichten Schrittes zurück in Richtung der Barge, war alsbald in der Menge verschwunden.
Kapitel Drei
Auf dem Weg nach Newgate sann ich ängstlich darüber nach, wer mein Beobachter sein mochte. Hatte er etwas mit dem Wentworth-Fall zu tun? Ich hatte am vergangenen Nachmittag am Lincoln’s Inn darüber gesprochen, und Klatsch verbreitet sich unter Anwälten bekanntlich schneller als unter den Waschweibern auf den Feldern von Moorgate. Oder war er ein Spitzel, der herausfinden sollte, welcher Art mein Umgang mit dem dunkelhäutigen ehemaligen Mönch sei? Dabei hatte ich keinerlei Verbindung mehr in die Politik.
Chancery schlug ängstlich mit dem Kopf und wieherte; entweder spürte er meine Unruhe, oder er reagierte auf die scheußlichen Gerüche, die uns vom Schlachthof und dem fauligen Rinnsal aus Blut und anderen Körpersäften entgegenschlugen, das von der Bladder Street in den Kanal geflossen war. Hier herrschte stets ein übler Gestank, bei aller Einschränkung, die die Schlachter durch den Magistrat erfuhren, doch in dieser Hitze war er schier unerträglich. Wenn das Wetter so bliebe, müsste ich mir auch so ein Riechsträußchen besorgen, dachte ich, weil ich gesehen hatte, dass viele der reicher gewandeten Passanten die Nasen in Blumensträußlein tauchten.
Ich ritt auf den Marktplatz von Newgate, den noch immer die großmächtige Klosterkirche der Greyfriars, der Franziskaner, überschattete, hinter deren bunten Glasfenstern jetzt die Beute lagerte, die man auf See den Franzosen abgerungen. Dahinter ragte die Stadtmauer auf mit den wie ein Schachbrett gemusterten Türmen von Newgate. Londons bedeutendster Kerker ist ein schönes, altes Gemäuer; dabei kennt es mehr Elend als irgendein anderer Ort in London, da viele seiner Bewohner der Tod erwartet.
Ich betrat das Pope’s Head. Die Schenke hatte Tag und Nacht geöffnet und verdiente gut an den Besuchern des Kerkers. Joseph saß an einem Tisch, von dem aus man in den verstaubten Hinterhofblickte, vor sich einen Becher leichten Dünnbiers, um den Durst zu löschen. Ein Blumenstrauß lag neben ihm. Er blickte unbehaglich zu einem flott gekleideten jungen Mann auf, der sich mit leutseligem Lächeln über ihn beugte.
»Na kommt, Bruder, ein Spielchen wird Euch aufmuntern. Ich treffe mich gleich mit ein paar Kameraden in einer Schenke ganz in der Nähe. Da wäret Ihr in bester Gesellschaft.« Er war einer von den Falschspielern, die zuhauf die Stadt heimsuchten. Sie erkannten Leute vom Lande, die neu in der Stadt waren, an den unscheinbaren Kleidern, und machten sich nur an sie heran, um sie gehörig zu rupfen.
»Verzeiht«, sagte ich mit gewisser Schärfe und nahm mir einen Stuhl, »doch dieser Gentleman ist mit mir verabredet. Ich bin sein Anwalt.«
»Dann seid Ihr Euer Geld bald los, Sir«, versetzte der Bursche und maß Joseph mit spöttischer Miene. »Gerechtigkeit lässt sich teuer bezahlen.« Als er an mir vorbeikam, zischte er mir noch ein »Buckliger Blutsauger!« zu, und weg war er.
Joseph hatte es nicht gehört. »Ich war wieder im Kerker«, sagte er dumpf. »Ich ließ den Kerkermeister wissen, dass ich einen Rechtsanwalt mitbringen würde. Sixpence hat er mir berechnet, eh er den Besuch erlaubt hat. Noch dazu hat er jenes schmutzige Schreiben gelesen. Für einen Penny lasse er die Leute einen Blick auf Elizabeth werfen, erzählte er mir. Sie würden sie durchs Guckloch beschimpfen. Er lachte darüber. Es ist grausam – das dürfen die doch nicht, oder?«
»Den Kerkermeistern ist alles erlaubt, was Geld einbringt. Für ein erkleckliches Trinkgeld hätte er dir wohl auch versprochen, ihr dergleichen Belästigungen fürderhin zu ersparen.«
Joseph raufte sich die Haare. »Ich musste für ihr Essen bezahlen, ihr Wasser, einfach alles. Noch mehr kann ich mir nicht leisten, Sir.« Er schüttelte den Kopf. »Diese Kerkermeister sind doch gewiss die gemeinsten Schufte auf Erden.«
»O ja. Aber schlau genug, um Geld zu scheffeln.« Ich sah ihn ernsthaft an. »Ich war gestern Nachmittag am Lincoln’s Inn, Joseph. Dort musste ich erfahren, dass kommenden Samstag Forbizer den Vorsitz hat. Das ist keine gute Nachricht. Er ist bibeltreu und unbestechlich –«
»Aber das ist doch gut, wenn er fromm ist –«
Ich schüttelte den Kopf. »Unbestechlich ist er, aber hart wie Stein.«
»Hat er denn kein Mitleid mit einer armen Waisen, die fast den Verstand verloren hat?«
»Mit keiner Kreatur. Ich stand ihm schon in Zivilprozessen gegenüber.« Ich beugte mich zu ihm vor. »Joseph, wir müssen Elizabeth zum Reden bringen, sonst ist sie so gut wie tot.«
Er biss sich in seiner typischen Art auf die Lippe. »Als ich ihr gestern das Essen brachte, lag sie nur teilnahmslos da und starrte es an. Kein Wort des Dankes, nicht einmal ein Nicken. Ich glaube, dass sie schon seit Tagen kaum etwas gegessen hat. Ich habe diese Blumen hier für sie gekauft, aber ich weiß nicht, ob sie überhaupt einen Blick darauf werfen wird.«
»Nun, ich will sehen, was ich tun kann.«
Er nickte dankbar. Als wir aufstanden, sagte ich: »Ach ja, weiß Sir Edwin, dass du mich verpflichtet hast?«
Joseph schüttelte den Kopf. »Ich habe Edwin seit einer Woche nicht mehr gesehen, denn als ich Zweifel äußerte an Elizabeths Schuld, warf er mich hinaus.« Ein Anflug von Ärger huschte über sein Gesicht. »Er meint, ich sei gegen ihn und die Seinen, nur weil ich nicht will, dass Elizabeth stirbt.«
»Trotzdem«, sagte ich nachdenklich, »er könnte es erfahren haben.«
»Wie kommt Ihr darauf, Sir?«
»Ach, nur so.«
Joseph ließ den Kopf hängen, als wir uns dem Kerker näherten. Wir passierten das Bettelgitter in der Mauer, durch das ein paar armselige Gefangene grabschend ihre Hände steckten, um von den Vorübergehenden eine milde Gabe zu erheischen. Wer kein Geld hatte, erhielt nämlich nur wenig oder gar keine Nahrung, und viele Gefangene sollen schon Hungers gestorben sein. Ich legte einen Penny in eine zitternde Hand und klopfte dann laut gegen die massive hölzerne Pforte. Eine Klappe tat sich auf, und ein hartes Gesicht unter einer schmierigen Mütze blickte heraus. Die Augen wanderten über meine schwarze Robe.
»Ich bin Rechtsanwalt und komme zu Elizabeth Wentworth«, sagte ich. »Ihr Onkel hier hat für den Besuch bezahlt.« Die Klappe schlug zu, und die Pforte tat sich auf. Der Kerkermeister, einen schmutzigen Kittel am Leib und am Gürtel einen schweren Stock, musterte mich neugierig, als wir hindurchgingen. Trotz des heißen Tags war es innerhalb der dicken Gefängnismauern kalt, schienen die Steine eine klamme Kühle zu atmen. »Williams!«, schrie der Kerkermeister, und ein fetter Schließer im ledernen Wams tauchte auf, einen großen Schlüsselring in der Hand.
»Der Anwalt für die Kindsmörderin.« Der Kerkermeister grinste mich böse an. »Das Pamphlet gelesen?«
»Ja«, antwortete ich kurz angebunden.
Er schüttelte den Kopf. »Sie will immer noch nicht reden; da muss die Folterpresse her. Kennt Ihr eigentlich die alte Regel, Herr Rechtsanwalt, welche besagt, dass Gefangene nackt sein müssen, wenn sie in Fesseln liegen und Gewichte auf sie drauf gesetzt werden? Was für’n Jammer, endlich mal’n niedliches Paar Möpse, und dann werdense flach gequetscht.«
In Josephs Gesicht begann es nervös zu zucken.
»Ich weiß von keiner solchen Regel«, sagte ich kühl.
Der Kerkermeister spuckte auf den Boden. »Ich kenn die Regeln für meinen Kerker, da könnt ihr Schreibfritzen sagen, was ihr wollt.« Er nickte dem Schließer zu. »Führ sie hinunter zu den Weibern.«
Man führte uns einen breiten Korridor entlang, mit Zellen zu beiden Seiten. Durch die vergitterten Öffnungen in den Türen sah man Männer, die auf Strohpritschen saßen oder lagen, die Beine mit langen Eisenketten an die Wände gefesselt. Stechender Uringestank stieg uns in die Nase. Der Schließer schlurfte mit rasselnden Schlüsseln vor uns her. Er sperrte eine schwere Tür auf, hinter welcher eine Treppe hinunter in die Dunkelheit führte. Am Fuß der Treppe befand sich noch eine Tür. Der Schließer stieß eine Klappe auf und lugte hindurch, bevor er sich zu uns umdrehte.
»Liegt noch immer am selben Fleck wie gestern Nachmittag, als ich die Leute zu ihr runtergebracht hab, damit sie sie beglotzen können. Stocksteif lag sie da, und als sie schrien, sie wär ne Hexe und ne Kindsmörderin, da hat sie sich verkrochen.« Er schüttelte den Kopf.
»Lasst Ihr uns hinein?«
Er zuckte mit den Schultern und schloss uns auf. Sobald wir durch die Tür waren, warf er sie wieder zu, und ich hörte den Schlüssel im Schloss schaben.
Das so genannte Loch, der tiefste und dunkelste Teil des Gefängnisses, bestand aus einem Männer- und einem Frauenverlies. Das der Frauen war eine kleine, rechteckige Kammer, spärlich beleuchtet durch eine vergitterte Öffnung weit oben, unterhalb der Decke, durch die man die Schuhe und Rocksäume der Vorübergehenden sah. Es war genauso kühl wie der restliche Kerker, und der Modergeruch überdeckte fast den Gestank nach Unrat. Der Boden war mit fauligem Stroh bedeckt, voller Flecken und mit allerlei Unflat durchzogen. In einer Ecke lag eingerollt in tiefem Schlaf ein feistes altes Weib in einem Kleid aus grobem Filz. Verwirrt sah ich mich um, konnte zunächst niemanden mehr entdecken, doch dann bemerkte ich, dass in der Ecke gegenüber das Stroh um eine menschliche Gestalt aufgehäuft war, von der nur noch das schmutzstrotzende Gesicht hervorlugte, eingerahmt von dunklen Locken, die denen von Joseph glichen. Große Augen, so braun wie die seinen, starrten uns leer entgegen. Der befremdliche Anblick machte mich schaudern.
Joseph ging zu ihr hinüber. »Lizzy«, sagte er vorwurfsvoll, »warum versteckst du dich im Stroh? Es ist doch dreckig. Frierst du?«
Das Mädchen gab keine Antwort. Seine Augen waren leer; es konnte oder wollte uns nicht direkt ansehen. Das Gesicht unter dem Schmutz war hübsch, fein geschnitten und mit hohen Wangenknochen. Eine schmuddelige Hand schimmerte durch das Stroh. Als Joseph danach griff, zog das Mädchen sie ruckartig weg, ohne den Blick zu ändern. Joseph legte ihr den Strauß hin.
»Ich hab dir Blumen gebracht, Lizzy«, sagte er. Sie sah sie an; dann erwiderte sie seinen Blick, und zu meinem Erstaunen funkelte Zorn in ihren Augen. Auf dem Stroh stand ein Teller mit Brot und Stockfisch, daneben ein Krug Bier. Vermutlich die Mahlzeit, die Joseph ihr gebracht hatte. Sie war unberührt, und schwarze Schaben krochen über den gedörrten Fisch. Elizabeth wandte sich wieder ab.
»Elizabeth,« die Stimme ihres Onkels zitterte, »das hier ist Master Shardlake. Er ist rechtskundig, der klügste Kopf in ganz London. Er kann dir helfen. Aber du musst mit ihm reden.«
Ich ging in die Hocke, sodass ich ihr ins Gesicht sehen konnte, ohne das eklige Stroh zu berühren. »Jungfer Wentworth«, sagte ich sanft, »könnt Ihr mich hören? Warum wollt Ihr nicht reden? Bewahrt Ihr ein Geheimnis – das Eure oder das eines anderen?« Ich wartete. Sie sah durch mich hindurch, ohne zu blinzeln. In der Stille hörte ich Fußgetrappel von der Straße über uns. Ich wurde ärgerlich.
»Ihr wisst, was Euch blüht, wenn Ihr Euch weiterhin weigert zu reden?«, sagte ich. »Ihr müsst unter die Presse. Der Richter, dem Ihr am Samstag vorgeführt werdet, ist ein harter Mann, wie zweifellos sein Urteil. Hat man Euch gesagt, was die Presse bedeutet?« Noch immer keine Antwort. »Euch droht ein schauriger, langsamer Tod, der viele Tage dauern kann.«
Bei diesen Worten erwachten ihre Augen zum Leben und starrten eine Sekunde lang in meine. Mich durchschauerte es kalt, als ich das abgrundtiefe Elend darin sah.
»Wenn Ihr mit mir sprecht, kann ich Euch vielleicht helfen. Es gibt Möglichkeiten, ganz gleich, was an jenem Brunnen geschah.« Ich wartete. »Was ist dort passiert, Elizabeth? Ich bin Euer Anwalt, ich werde es keinem erzählen. Wir könnten Euren Onkel bitten zu gehen, wenn Ihr lieber mit mir allein sprechen wollt.«