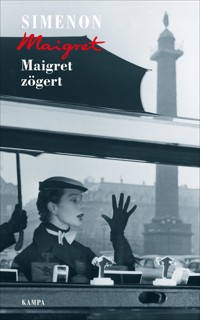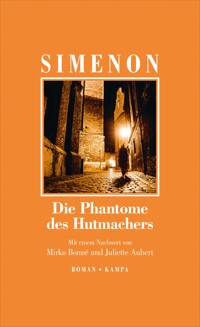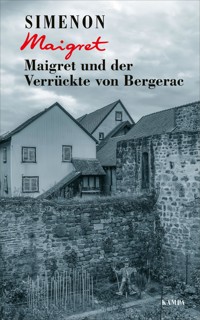9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die großen Romane
- Sprache: Deutsch
ZEIT FÜR MICH – ZEIT FÜR SIMENON »Georges Simenon ist der wichtigste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.« Gabriel García Márquez Joseph Dupuche und Germaine Dupuche reisen nach Panama, wo Joseph für eine französische Firma arbeiten soll. Voller Vorfreude auf das große Abenteuer schmieden sie Zukunftspläne. Umso brutaler ist der Einbruch der Realität. Die Firma ist pleite, und der nackte Kampf ums Überleben treibt das Ehepaar auseinander. Während Germaine mit allen Mitteln den gesellschaftlichen Abstieg zu verhindern sucht, fängt Joseph an zu trinken und zieht, zur Bestürzung der französischen Gemeinschaft, mit einer jungen Schwarzen auf die andere Seite des Kanals, ins Quartier nègre. Bandnummer: 102
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges Simenon
Die Schwarze von Panama
Roman
Aus dem Französischen von Ursula Vogel
Mit einem Nachwort von Michael Kleeberg
Hoffmann und Campe
1
»Da sind ja nur Neger zu sehen«, hatte Germaine geflüstert, während das Schiff in den Hafen einlief. Sie hatten hoch oben auf dem Promenadendeck gestanden und auf den allmählich näher rückenden Kai geblickt, wo zwei Kolonnen von schwarzen Dockarbeitern warteten.
Ein wenig unsicher hatte ihr Mann geflüstert:
»Ja, natürlich!«
Wieso natürlich? Schließlich fuhren sie gerade in den Panamakanal ein, befanden sich also in Mittelamerika. Hätten sie nicht eher Indios sehen müssen?
Das war jetzt zwei Stunden her, und es hatte noch weitere Gelegenheiten zum Staunen gegeben. Sie trugen beide weiße Leinenkleidung und einen Tropenhelm. Dupuche, der besser Englisch sprach als seine Frau, hatte sich mit einem Schwarzen geeinigt, der sich ihres Gepäcks angenommen und ihm einen Zettel mit einer Nummer ausgehändigt hatte.
»Washington Hotel?«, hatte er gemurmelt.
»Yes«, hatte Dupuche verblüfft geantwortet, denn dort wollte er tatsächlich absteigen.
Diejenigen Passagiere der Ville-de-Verdun, deren Reiseziel Tahiti war, hatten es eilig, an Land zu gehen, denn die Zwischenlandung sollte nur drei Stunden dauern, dann würde das Schiff den Panamakanal passieren. Das Ehepaar Dupuche stand ihnen im Weg.
»Bleiben Sie lange in Cristobal?«
»Unser Schiff kommt in zwei Tagen …«
»Viel Glück!«
Alles mutete fremdländisch an, vor allem die Sonne, aber auch die Uniformen der Zollbeamten, der Verkehrspolizisten, der amerikanischen Soldaten, die den Hafen und die anliegenden Straßen bewachten. Neger stellten sich einem in den Weg, um einen in ihre Autos zu locken, doch Germaines Wahl fiel auf einen Einspänner mit einem weißen Verdeck, an dem Vorhangtroddeln baumelten.
»Hast du auch deine Schlüssel nicht vergessen? Der Maître d’hôtel hat sich nicht zu seinem Trinkgeld geäußert? Schau mal, Madame Rocher …«
Sie beugten sich aus dem Wagen, um sich von Madame Rocher zu verabschieden, die zu ihrem Mann auf die Hebriden reiste. Sie blickten neugierig umher, versuchten sich mit der neuen Umgebung vertraut zu machen.
»Zum Washington Hotel?«, hatte der schwarze Kutscher gefragt.
Als Erstes kamen sie durch eine schöne, von Palmen überschattete Allee, die von den prächtigen Gebäuden der Schifffahrtsgesellschaften flankiert wurde.
»Die Post dürfen wir nicht vergessen …«
Eine breite, sonnige Straße, die an den Bahngleisen entlangführte. Warenhäuser, Andenkenläden und an jeder Tür Levantiner, die den Touristen etwas verkaufen wollten.
Endlich erblickten sie inmitten eines mit Kokospalmen bepflanzten Parks das Washington Hotel: eine Freitreppe, Kolonnaden, eine riesige kühle Lobby, weiß gekleidete Boys, ein Angestellter in Smokingjacke, an den Dupuche sich auf Englisch wandte.
Ihr Gepäck war bereits eingetroffen, und zwei Minuten später machten sich die Eheleute in ihrem Zimmer zu schaffen, inspizierten das Bad, öffneten Fenster und Wandschränke.
Dupuche wagte nicht, seiner Frau zu gestehen, dass die Suite zehn Dollar pro Tag kostete. Was machte das schon? Ein paar Dollar mehr oder weniger, darauf kam es doch gar nicht an. In der Hotelhalle hatten sie höhere amerikanische Offiziere wahrgenommen. Der Speisesaal war geräumig, und im Park schimmerte ein marmornes Schwimmbecken.
»Heute Abend gehen wir zum Baden«, entschied Germaine. »Jetzt müssen wir rasch zur Bank …«
Dupuche ließ sein Jackett im Hotel zurück, denn draußen war es dafür zu heiß. Der Boy machte Anstalten, einen Wagen herbeizuwinken.
»Nein, wir gehen zu Fuß …«
Sie wollten die Stadt besichtigen. Es war schon bald Mittag. Sie hatten wohl den falschen Weg eingeschlagen, denn schon nach ganz kurzer Zeit befanden sie sich in einer tristen, schmutzigen Gegend mit Holzhäusern. Auf den Gehsteigen wimmelte es von Schwarzen. Die Sonne stand senkrecht. Frauen dösten auf den Türschwellen vor sich hin. Germaine rümpfte die Nase über den Gestank und blickte verstört um sich.
»Du solltest nach dem Weg fragen …«
Nach einer Viertelstunde hatten sie sich zurechtgefunden, und sie erblickten die von Levantinern geführten Läden, in denen die Passagiere der Ville-de-Verdun um Nippes feilschten.
»Frag nach dem Weg zur Bank, Jo.«
»Ich glaube, das ist der Laden, wo weiße Anzüge besonders preiswert sein sollen …«
»Erst die Bank!«
»Pardon, Monsieur … Die New York Chase Bank, please?«
»Zweiter Häuserblock links …«
»Schau mal«, sagte Dupuche, während er seinen Blick über ein schattiges Café schweifen ließ, »hier haben sie sogar noch Pernod aus der Vorkriegszeit! Wenn wir die Bank hinter uns haben, gehen wir einen trinken …«
Die Bank war nur eine kleine Zweigstelle mit einem einzigen Angestellten. Dupuche reichte ihm einen Kreditbrief über zwanzigtausend Franc. Der andere sah nicht einmal hin.
»Wenden Sie sich an die Agentur in Panama!«
Germaine, die kaum Englisch verstand, begann sich zu beunruhigen.
»Wir sind hier nur eine Wechselstube. Um zwei Uhr fährt ein Zug, mit dem Sie in achtundvierzig Minuten in Panama sind.«
»Komm, Germaine …«
»Was hat er gesagt?«
»Wir fahren nach Panama, am anderen Ende des Kanals. Aber es bleibt uns genug Zeit, um einen Pernod zu trinken und zu Mittag zu essen.«
Schläfrig saßen sie, alle beide von der Sonne getroffen, im mit Korbsesseln ausgestatteten Eisenbahnabteil. Die Mitreisenden lasen in der amerikanischen Zeitung. Die Männer trugen angeknöpfte Kragen und Krawatten, nur Dupuche hatte kein Jackett, er war auch der Einzige mit einem Tropenhelm auf dem Kopf.
Zur Linken zog endloses graues Weideland vorbei, zur Rechten erhaschte man mitunter einen Blick auf den Panamakanal, auf dem die Schiffe langsam dahinglitten.
»Mir waren die Karibik-Inseln lieber«, bemerkte Germaine. Sie hatten zwei Tage in Fort-de-France verbracht.
Hier war alles zu zivilisiert. Es gab zu viele amerikanische Soldaten, zu viele Bungalows mit allen Schikanen, zu viele Autos auf den Straßen.
»Hast du deine Brieftasche auch nicht vergessen?«
In Panama ließen sie sich von einem spanischen Mestizen überreden, in seinem offenen Wagen mitzufahren.
»New York Chase Bank!«
Ihre Eindrücke begannen sich zu überlappen. Sie fuhren durch sehr belebte Straßen, in denen sich ein Laden an den anderen reihte, kamen durch eine ruhigere Wohngegend mit Holzhäusern, schließlich erreichten sie ein Viertel, wo es Straßenbahnen, Steingebäude, Autowerkstätten, Klavier- und Radiogeschäfte gab.
Der Wagen hielt auf einem von schönen Bäumen überschatteten Platz vor einer Kirche im spanischen Stil, und der Chauffeur deutete auf die amerikanische Bank an der Straßenecke.
Dupuche trat an einen Schalter, wurde an einen zweiten geschickt, schließlich folgte er einem Schwarzen in ein Büro, wo ihn der Direktor der Agentur empfing und seinen Kreditbrief entgegennahm.
»Die eine Hälfte möchte ich in Franc, die andere in Dollar ausbezahlt haben …«
Dupuche zeigte seinen Pass vor, um seine Identität zu beglaubigen. Der Yankee blätterte in dem Kreditbrief, griff nach dem Telefonhörer, ließ einen Angestellten kommen. Beide vertieften sich schweigend in das Dokument, hielten es neben ein Überseetelegramm, das auf dem Schreibtisch lag.
»Tut mir leid …«, sagte der Direktor schließlich, reichte Dupuche den Kreditbrief zurück.
»Sie können mir das Geld heute nicht auszahlen?«
»Ich kann Ihnen überhaupt nichts auszahlen. Die Société Anonyme des Mines de l’Équateur ist in Konkurs gegangen. Unsere Pariser Niederlassung hat mir telegraphiert, dass die Firma zahlungsunfähig ist …«
»Sie müssen sich täuschen«, rief Dupuche aus. »Das ist völlig ausgeschlossen. Dieser Kreditbrief ist vor kaum einem Monat ausgestellt worden, und zwar von Monsieur Grenier persönlich, dem Verwaltungsratspräsidenten. Ich bin der leitende Ingenieur der S.A.M.É, und ich bin auf dem Weg dorthin, um die Oberaufsicht über die Arbeiten zu übernehmen …«
»Tut mir leid …«
»So hören Sie doch! … Sie müssen nach Paris telegraphieren … Bestimmt liegt da ein Missverständnis vor …«
Er war in Schweiß gebadet, seine Knie drohten nachzugeben. Germaine fragte:
»Sagt er, dass er nicht zahlen will?«
Dupuche bedeutete ihr zu schweigen.
»Verstehen Sie doch … Die Gesellschaft hat mir zehntausend Franc für die Reisekosten bis hierher ausgehändigt. Übermorgen schiffe ich mich auf der Santa-Clara von der Grace Line nach Guayaquil ein… Ich benötige die zwanzigtausend Franc, sonst …«
»Am sorry …«
»Tut mir leid«, wiederholte der Amerikaner und öffnete die Bürotür.
»Noch einen Augenblick, bitte! Wenn ich gleich eine Depesche nach Paris aufgebe, wann könnte ich ein Antworttelegramm erwarten?«
»In zwei Tagen.«
Da standen sie auch schon wieder auf dem Gehsteig, und ihr Chauffeur bugsierte sie gleich in den Wagen.
»Stadtrundfahrt?«
Dupuche wurde von Schwindel gepackt.
»Was gedenkst du zu tun?«, fragte Germaine mit gerunzelten Brauen.
»Unseren Botschafter oder Gesandten aufsuchen. Es gibt doch bestimmt einen französischen Gesandten in Panama …«
»Ja, Monsieur«, ließ sich der Mestize vernehmen, der zugehört hatte.
Er hielt auf einem menschenleeren Platz, vor einem anmutigen, blumengeschmückten Bauwerk. Germaine blieb im Wagen sitzen. Dupuche klingelte, wurde von einem Mulatten empfangen und in ein Büro geführt, wo sich auf einem Tisch alte Zeitschriften stapelten. Er musste eine Viertelstunde warten, denn der Gesandte hielt eben seinen Mittagsschlaf. Schließlich erschien er, aber in Hemdsärmeln.
»Was hat er gesagt?«
»Ich soll telegraphieren, wenn ich unbedingt will. Aber er behauptet, dass sich die amerikanischen Banken nie irren.«
Der Chauffeur wartete auf eine Adresse.
»Was sollen wir nur tun?«
»Trotz allem ein Telegramm aufgeben!«
Darüber vergaß er, seinen Tropenhelm wieder aufzusetzen, den er abgenommen hatte, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Der Pernod, den er ohne Zucker getrunken hatte, lag ihm schwer im Magen.
S.A.M.É. PARIS UMGEHEND AUSZAHLUNG KREDITBRIEF VERANLASSEN STOPP AUSLÄUFT SCHIFF MORGEN STOPP NÄCHSTES SCHIFF IN EINEM MONAT STOPP DUPUCHE
Das Wort kostete elf Franc, und Dupuche stopfte seine Brieftasche, die nur noch etwa zwölfhundert Franc enthielt, rasch wieder in seine Hosentasche.
Der Fahrer wartete mit gleichmütigem Gesicht, Germaine saß immer noch auf dem Rücksitz.
»Lass uns ein wenig gehen und die Sache besprechen …«
Sie bezahlten die Fahrt und befanden sich nun auf dem Gehsteig einer Geschäftsstraße.
»Was willst du tun?«
»Ich weiß nicht … Die Sache ist mir rätselhaft …«
Es war ihnen nicht einmal mehr bewusst, dass sie in Panama waren, dass es weit und breit nur Holzhäuser gab, dass die Passanten um sie herum Spanisch oder Englisch sprachen. Blicklos, mit leerem, dröhnendem Kopf gingen sie durch die Straßen.
»Wie viel bleibt dir noch?«
»Nicht einmal zwölfhundert Franc … Aber das gibt es doch einfach nicht! Grenier meldet sich bestimmt …«
Er hatte sie beide am Tag nach ihrer Hochzeit in ein Luxusrestaurant an den Champs-Élysées zum Mittagessen eingeladen. Er war ein feiner Kerl. Seine Büros befanden sich in einem neuen Hochhaus an der Rue Berri.
»Freuen Sie sich denn über die Hochzeitsreise, die ich Ihnen spendiere, kleine Madame?«, hatte er Germaine gefragt.
Und er hatte ihr Blumen geschenkt.
»Unser Gepäck ist in Cristobal zurückgeblieben!«, sagte sie.
Ihm aber fiel wieder ein, dass das Zimmer im Washington zehn Dollar pro Tag kostete.
»Wir rufen dort an, sie sollen es uns hierher nachschicken. Es gibt doch sicher billigere Hotels …«
In seiner Verwirrung hatte er nicht auf den Weg geachtet, und plötzlich befanden sie sich in einem Stadtteil, der an das Negerviertel in Cristobal erinnerte, aber größer und düsterer wirkte.
»Wie sind wir hierhergekommen?«, fragte er seine Frau.
»Ich weiß nicht mehr … Hast du nicht aufgepasst?«
Soweit das Auge reichte, sah man nur einstöckige Holzhäuser mit einer Veranda im Obergeschoss. An den Fenstern trocknete Wäsche, die Läden wirkten verfallen, und die Gassen zwischen den Häusern waren kaum einen Meter breit. In den Auslagen häuften sich unbekannte Esswaren, und seltsame Gerüche durchzogen die Luft. Schwarze mit Schaftstiefeln oder Turnschuhen an den Füßen schlenderten an ihnen vorbei, blickten den Fremden in die Augen, vor allem Germaine, die den Kopf senkte.
»Lass uns woandershin gehen!«
»Von Herzen gern … Aber in welche Richtung?«
Immer tiefer gerieten sie in dieses Viertel, das eine Stadt für sich war. Die Straßen wurden noch enger, mehr und mehr Schwarze bevölkerten die Gehsteige.
Sie waren am Ende ihrer Kräfte. Dupuche spürte, dass ihm das Hemd am Rücken klebte. Er hatte nicht einmal sein Jackett dabei. Plötzlich glitt von hinten etwas auf sie zu, sie hörten das Geräusch von Bremsen und erblickten ihren Chauffeur, der seinen Wagen anhielt und sie lächelnd ansah. Er sprach Französisch mit einem leicht spanischen Tonfall.
»Hier dürfen Sie nicht herumlaufen … Soll ich Sie nicht in ein gutes Hotel fahren? Es gibt ein gutes französisches Hotel …«
»Ja! In ein französisches Hotel …«, seufzte Dupuche, dem ein Stein vom Herzen fiel.
Er würde die Sache ins Reine bringen. Alles würde sich aufklären. Ganz unvermittelt befanden sie sich in einer Gegend, die sie nicht weniger überraschte als die anderen Stadtteile, denn hier sah man nur moderne Villen und reiche Gartenanlagen.
»Das Viertel der Gesandtschaften und Konsulate«, erklärte der Fahrer.
Endlich gelangten sie wieder auf den schattigen Platz mit der Kirche, und das Auto hielt vor einer großen weißen Fassade, die eine Aufschrift in goldenen Lettern trug: Hôtel de la Cathédrale.
»Ist kein Gepäck am Bahnhof abzuholen?«
»Nein, danke …«
»Wenn Sie eine Wagenfahrt machen wollen, brauchen Sie nur nach Pedro zu fragen … Hier kennt mich jeder.«
Dupuche dankte mit einem kleinen gezwungenen Lächeln.
Er redete überstürzt. Die kleine alte Frau in Schwarz, die an eine Kassiererin in einem Provinzhotel erinnerte, beeindruckte ihn.
»Verstehen Sie … Übermorgen schiffen wir uns auf der Santa-Clara ein … Unser Gepäck ist im Washington Hotel in Cristobal zurückgeblieben. Wir erwarten ein Telegramm …«
»Soll ich Ihr Gepäck nachkommen lassen?«
Die kleine Alte hob den Telefonhörer ab, rief das Washington an, gab Anweisungen in englischer Sprache.
»Um acht Uhr wird es hier sein …«
Sie rief einen schwarzen Boy herbei, der einen frisch gestärkten Anzug trug.
»Zimmer 67 …«, sagte sie und reichte ihm den Schlüssel.
Dass sie Franzosen waren, hatte sie nicht weiter gewundert. Sie hatte sie nicht einmal angeblickt. Sie waren ihr gleichgültig. Schweigend folgten sie dem Boy, entdeckten einen fremdartigen Baustil, denn er führte sie in eine Art von Innenhof mit mehreren Stockwerken, den eine Glasdecke überdachte. Ringsherum verliefen Galerien, von denen aus man in die Zimmer gelangte.
Sie nahmen den Aufzug. Der Boy geleitete sie in ein geräumiges Zimmer, wo es wegen der heruntergelassenen Rollläden dunkel war, und verschwand.
Das war alles. Sie waren sich selbst überlassen. Sie begutachteten das Zimmer, den Diwan, die Zwillingsbetten mit kupfernen Gestellen, das Bad …
»Wie viel kostet es?«, wollte Germaine wissen.
»Ich weiß nicht.«
Er hatte nicht gewagt, nach dem Preis zu fragen. Um irgendetwas zu tun, zog er die Rollläden hoch. Sonnenlicht überflutete sie. Vor ihren Augen erstreckte sich der Platz. Er war mit hohen Bäumen bestanden, die an Eukalyptus erinnerten. Auf schattigen Bänken saßen Leute mit Strohhüten, lasen Zeitung oder verfolgten schläfrig das träge Spiel des Lichts.
»Er kann doch nicht in so kurzer Zeit bankrottgegangen sein.«
Dupuche dachte an Grenier, der ihm einen Fünfjahresvertrag als leitender Ingenieur der S.A.M.É: unterzeichnet hatte. Eigentlich hätte er ihm fünfzigtausend Franc für die Reise und die ersten Kosten aushändigen sollen, aber im letzten Augenblick hatte er ihm nur zehntausend gegeben. Grenier hatte gesagt:
»In Panama lösen Sie diesen Kreditbrief ein und den anderen in Guayaquil …«
»Und wenn ich nach Guayaquil telefonieren würde«, sagte Dupuche plötzlich. »Vielleicht sind sie dort zahlungsfähig.«
»Von deinen zwölfhundert Franc wird dir dann nicht viel übrig bleiben!«
Das stimmte allerdings. Er sollte lieber warten. Germaine lag auf dem Bett, sie hatte ihre Schuhe abgestreift. Sie so reglos zu sehen, machte ihn nervös.
»Nein! Hier dürfen wir nicht bleiben … Wir sollten uns bewegen, unter Leute gehen.«
»Ich bin müde … Geh doch allein hinunter …«
Sie wirkte fahl im Gesicht, wie in den ersten Tagen der Überfahrt, als sie seekrank wurde und es nicht zugeben wollte. Es war ihre erste Reise gewesen, denn bisher war sie nur zwischen Paris und Amiens hin- und hergefahren.
Dupuche streifte mit den Lippen ihre Stirn, ohne jede Zärtlichkeit, dazu war er zu bedrückt. Er stieg die Treppe hinunter, irrte eine Weile durch die Hotelhalle.
»Suchen Sie die Bar?«, fragte ihn ein Herr von etwa sechzig bis fünfundsechzig Jahren, der am Empfang stand.
Er trug, wie jedermann hier, einen weißen Anzug, dazu einen Zelluloidkragen und einen schwarzen Schlips.
»Möchten Sie das Anmeldeformular ausfüllen?«
Während Dupuche schrieb, blickte er ihm über die Schulter.
»Ich wäre jede Wette eingegangen, dass Sie aus dem Norden kommen. Ich habe Sie eben mit Madame Colombani reden hören und Ihren Akzent erkannt. Tja, Amiens … Ich hatte mal Freunde dort, sie waren in der Wollbranche …«
Der Mann trocknete die Tinte mit einem Löschblatt.
»Möchten Sie etwas trinken?«
Man brauchte nur eine Tür aufzustoßen und gelangte in ein großes leeres Café, wo sich sogleich ein Junge vor Dupuche hinkniete, um ihm die Schuhe zu putzen.
»Was hätten Sie gern?«
»Ich weiß nicht … Einen Pernod …«
Für sich selbst bestellte sein Begleiter ein Bockbier mit Limonade.
»Gedenken Sie, lange in Panama zu bleiben?«
»Übermorgen fahre ich weiter, um meine Stelle anzutreten. Ich bin der neue Direktor der Ecuador-Minen … Der vorige Ingenieur hat Dummheiten gemacht, und Grenier, der Pariser Chef, hat mich damit beauftragt, seine Stelle einzunehmen …«
Sehr rasch stieg ihm der Alkohol zu Kopf, vielleicht wegen der Hitze. Dupuche, der nicht besonders trinkfest war, sah Sonnenstreifen vor seinen Augen flimmern, und das Gesicht seines Begleiters nahm erstaunliche Proportionen an. Es war ein sehr merkwürdiges, schmales und faltiges Gesicht mit winzigen müden Augen, die einen aber mit geradezu peinlicher Eindringlichkeit musterten.
»Nehmen Sie Ihre Frau mit?«
»Ich habe erst drei Tage vor unserer Abreise geheiratet. Wir waren zwei Jahre lang verlobt, eigentlich aber schon seit ich denken kann, denn wir sind in derselben Straße geboren … Kennen Sie Amiens?«
»Früher bin ich einmal dort gewesen …«
»Meine Frau war beim Telefonamt angestellt. Ihre Eltern wollten sie nicht so weit fort lassen … Grenier hat ihnen selbst schreiben müssen – Grenier ist mein Vorgesetzter –, um ihnen zu versichern, dass das Klima in Ecuador sehr gesund ist. Kennen Sie Ecuador?«
»O ja, sehr gut …«
»Guayaquil?«
»Ich habe dort sieben Jahre verbracht.«
Es tat Dupuche wohl, sich auszusprechen, und er bedeutete dem schwarzen Barkeeper, sein Glas nachzufüllen. Mit betonter Lässigkeit warf er dem Jungen, der ihm die Schuhe geputzt hatte, ein paar Münzen zu, doch sein Begleiter rief das Kind zurück, nahm ihm die Hälfte des Geldes ab.
»Man darf sie nicht verwöhnen. Fünfzehn Cent sind mehr als genug.«
Was sollte er noch erzählen?
»Wir sind erst im Washington abgestiegen, in Cristobal …«
»Kenne ich. Es ist zu teuer.«
»Wir sind als Touristen nach Panama gekommen und möchten jetzt lieber hier bleiben. Unser Gepäck kommt nach …«
»Um acht Uhr«, sagte der Mann.
Er war ruhig, unnatürlich ruhig. Er machte keine unnötige Bewegung, er sprach leise, ohne sich zu verausgaben.
»Sie sind mit der Ville-de-Verdun gekommen? Sie wird in einer Stunde hier sein. Sie werden Ihre Reisegefährten wiedersehen, denn sie kommen fast alle hierher.«
Dupuche hatte Kopfschmerzen.
»Gibt es viele Franzosen in Panama?«
»Da sind zuerst einmal der Chef und seine Söhne … Sie kommen aus Korsika. Dann die Brüder Monti, die im Negerviertel ein Café und an der Pferderennbahn einen Ausschank haben … Es gibt noch ein paar in Cristobal, aber die taugen nicht viel.«
»Stimmt es, dass man hier entlaufene Sträflinge antrifft?«
»Hin und wieder schon, aber sie verhalten sich ruhig … Hat Ihre Frau sich hingelegt?«
»Ja … Sie ruht sich ein wenig aus.«
Dupuche konnte sich nicht dazu aufraffen, sich von seinem Stuhl zu erheben, und als ihn sein Begleiter für kurze Zeit allein ließ, um zum Empfangsbüro zu gehen, fühlte er sich entsetzlich allein und erwartete voller Angst seine Rückkehr.
»Leben Sie schon lange in diesem Land?«, vermochte er ihn endlich zu fragen.
»Ich bin jetzt seit vierzig Jahren in Südamerika.«
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«
»Nein, danke. Je mehr man trinkt, desto schlimmer wird die Hitze …«
Das war richtig. Dupuche war schweißgebadet, aber er hatte immer noch Durst, und nach einigem Zögern bestellte er einen weiteren Pernod, fühlte sich bemüßigt, sich zu entschuldigen.
»In Frankreich ist er verboten … Sie verstehen doch? Dann hat man solche Lust darauf …«
Es war ihm noch nicht in den Sinn gekommen, seiner Mutter eine Postkarte zu schicken, wie er ihr versprochen hatte. Seit er mit dem unbekannten Begleiter in diesem Café saß, erschien ihm die Stadt schon weniger abweisend. Es wunderte ihn bereits nicht mehr, dass die Kathedrale gegenüber aus Holz und nicht aus Stein war. Er fand es auch ganz natürlich, dass der Barkeeper ein Schwarzer war und einen weißen Leinenanzug trug.
Geradezu unglaublich aber schien ihm die Tatsache, dass seine Hochzeit in Amiens, in Saint-Jean, nur drei Wochen zurücklag. Am nächsten Tag hatte in der ›Gazette d’Amiens‹ gestanden:
Unser hochverehrter Landsmann Joseph Dupuche, der nach seinem glänzenden Abschlussexamen an der Ingenieurschule eine Amerikareise antritt, um die französische Trikolore zu verteidigen und …
… ihm und seiner tapferen jungen Frau wünschen wir …
Madame Dupuche war mit einer Freundin an die Bahn gekommen, um sich nach seiner Abreise nicht so verlassen zu fühlen. Sie hatte einen Kuchen mitgebracht, doch da sie nicht hungrig waren, hatte ihn Germaine aus der Zugtür geworfen.
Arme Mama …
Germaines Vater aber hatte ihnen ans Herz gelegt:
»Vergesst nicht, jeden Tag euer Chinin zu nehmen …«
Er war Postbeamter und hatte seine Tochter im Telefonamt untergebracht. Mit tragischer Miene hatte er seinen Schwiegersohn beiseite genommen und ihm zugeflüstert:
»Ja keine Kinder dort drüben! Wenn ihr zurück seid, ist noch reichlich Zeit …«
… Das Mittagessen mit Grenier in Paris … Der Zug nach Marseille … Die Ville-de-Verdun … Der Verwalter der Marquesas-Inseln, der sich trotz seines hohen Ranges gleich mit ihnen angefreundet hatte …
»Ich war der Meinung, die S.A.M.É. sei in Schwierigkeiten …«, seufzte Dupuches Begleiter. »Sie sind der vierte Direktor innerhalb von zehn Jahren …«
»Na, so was! Sie kennen die Gesellschaft?«
»Ich weiß über alles Bescheid, was in Südamerika vorgeht. Hören Sie, wir haben hier den Sohn des Besitzers einer großen Kakaoplantage, der jährlich fünf Millionen verdient hat, in Gold, Vorkriegsmillionen … Jetzt bleibt ihm nicht einmal mehr genug Geld, um die Schiffsreise zu bezahlen!«
Dupuche sah, wie sein Chauffeur Pedro mit drei Passagieren der Ville-de-Verdun vorüberfuhr, die die Stadt besichtigten und auf dem Platz anhielten, um die Kathedrale zu fotografieren.
Sie waren dem Ingenieur bereits gleichgültig geworden, da sie ja weiterfuhren und nicht in Panama blieben!
»Ist das Leben hier teuer?«
»Nicht teurer als in Cristobal … Gewiss billiger als im Hotel Washington … Die Vollpension für Sie beide wird Sie nicht mehr als fünfzehn Dollar kosten … Tsé-Tsé wird es Ihnen genau sagen, sobald er zurück ist …«
»Fünfzehn Dollar …«, wiederholte Dupuche, als wäre nichts dabei.
Er hatte noch achtzig Dollar in der Tasche. Zwei Männer betraten das Café.
»Das sind die Brüder Monti, von denen ich Ihnen erzählt habe …«
Sie setzten sich zu ihnen an den Tisch.
»Ein Ingenieur aus Amiens, Monsieur Joseph Dupuche …«
»Angenehm! Sie trinken doch noch etwas mit uns?«
Hier war es ruhig und gemütlich, wie in einem Café tief in der Provinz.
»Ein Picon mit Grenadine …«
»Zwei!«
»Sie sind auf der Ville-de-Verdun gekommen? Der Zahlmeister ist ein Freund von uns …«
Von diesem Moment an verlor Dupuche den Boden unter den Füßen. Er trank noch etwas. Dann redete er wieder. Er erzählte von seinem Essen mit Grenier, zeigte seinen Vertrag vor, der ihm ein Monatsgehalt von achttausend Franc und eine Gewinnbeteiligung zusicherte. Die anderen waren nicht übermäßig interessiert.
»Ist das nicht die Gesellschaft, die dauernd ihren Direktor wechselt?«, fragte einer der Monti.
Diese Leute wussten einfach alles! Sie sprachen von Guayaquil, als wäre es eine kleine Vorstadt, unterhielten sich ebenso seelenruhig über Peru, Chile, Bogotá und andere Städte, die Dupuche nicht einmal dem Namen nach kannte.
Und dann sprachen sie von mysteriösen Dingen.
»Louis hat Nachricht aus Belgien.«
»Nun, was ist?«
»Sie will nicht kommen … Er ist wütend …«
Er blieb bei ihnen sitzen, mit leerem Blick und schwerem Kopf, und man hatte ihm wohl eine Zigarre angeboten, denn als er in sein Zimmer zurückkehrte, steckte eine zwischen seinen Lippen. Germaine schlief mit aufgelöstem Haar, ihr Gesicht glänzte vor Schweiß, ihr Kleid war über ihre Knie hinaufgerutscht, sodass ihre recht schweren Beine mit den kräftigen Fesseln zu sehen waren.
Er ließ sich neben sie aufs Bett fallen. Sie erwachte.
»Hast du Nachricht?«, fragte sie.
»Was für eine Nachricht?«
Sie zog die Brauen zusammen, sagte spitz:
»Du riechst nach Alkohol!«
»Ach was … Lass mich schlafen.«
»Wo bist du gewesen?«
»Nirgends … Unten …«
Er spürte, dass sie nach seiner Brieftasche griff, die Geldscheine zählte.
»Nicht wahr, du hast getrunken?«
»Einen Pernod … mit einem reizenden Menschen, der uns nützlich sein kann …«
Seine Stimme stieß förmlich gegen die Silben. Er vermochte die Lider nicht mehr zu heben.
… Guayaquil … Bogotá … Buenaventura … Grand-Louis …
Er bekam noch mit, dass jemand an die Tür klopfte, dass mit großem Gepolter die Koffer ins Zimmer geschoben wurden.
Germaine flüsterte ihm ins Ohr:
»… Jo … Hör doch … Wach doch für einen Moment auf … Wie viel Trinkgeld soll ich dem Mann geben?«
»Weiß nicht …«
Er schlief noch, seine Zunge war pelzig, doch plötzlich richtete er sich auf, sah das dunkle Zimmer, die Lichter, die durch das Fenster schimmerten, vernahm das Tsching-ta-ra-ta-ta der Militärmusik.
»Germaine!«, rief er, »Germaine …«
Und noch lauter, voller Angst:
»Germaine!«
»Na, was ist denn?«
Sie erhob sich mit einem Satz aus dem Korbsessel, der auf dem Balkon stand.
»Bist du nicht mehr betrunken?«, fragte sie streng.
Er stand auf, machte einige Schritte, stellte fest, dass der Pavillon auf dem Platz erleuchtet war und eine Menschenmenge ringsherum promenierte. Es war kühler geworden. Den Bäumen entströmte ein seltsamer Duft.
»Wie spät ist es?«
»Zehn Uhr …«
»Hast du nicht zu Abend gegessen?«
Er sah die Koffer herumstehen.
»Aha! … Man hat sie also hergebracht …«
Er fühlte sich abgestumpft, wusste nicht mehr, was er sagen oder tun sollte.
»Wir müssen aber etwas essen …«
»Ich habe keinen Hunger …«
Seit Monaten hatte er keinen Rausch mehr gehabt, und er wusste nicht, wie es eigentlich zugegangen war. Er spürte, dass seine Frau böse auf ihn war. Er schämte sich.
»Ich bitte dich um Verzeihung … Ich war nervös … Man hat mir zu trinken angeboten …«
»Lass mich in Ruhe.«
»Germaine, ich beteure dir …«
»Schweig doch! … Wenn du dich schnarchen gehört hättest …«
»Ich schwöre dir, dass ich nichts dafür kann …«
»Wie oft soll ich es dir noch sagen, lass mich endlich in Ruhe! …«