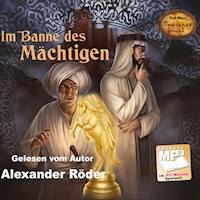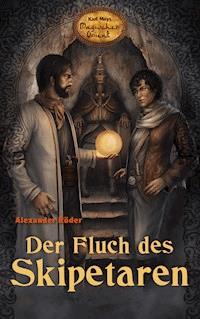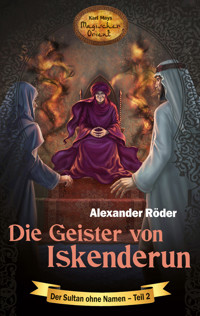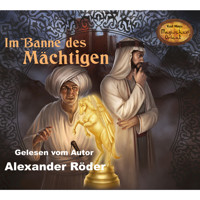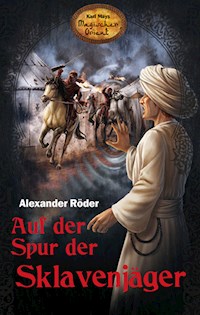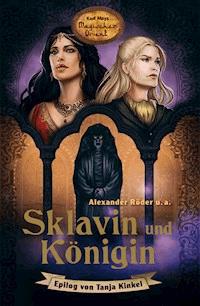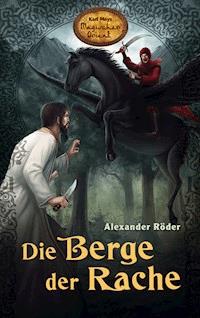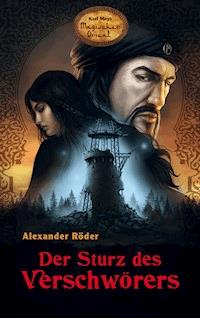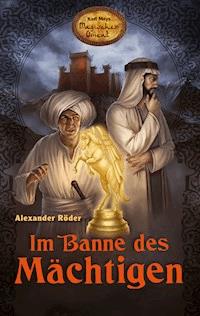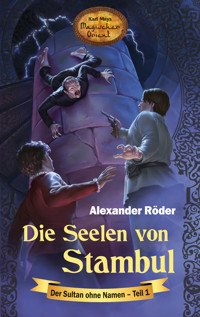
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl-May-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Karl Mays Magischer Orient
- Sprache: Deutsch
Kara Ben Nemsi erhält Besuch von zwei Fremden in Radebeul, die ihm eine Einladung zur Hochzeit von Sir Austen Henry Layard und einer gewissen Constanza Venessia überbringen. Dies kommt ihm merkwürdig vor, und als er auch noch einen verzweifelten Brief von seinem Freund Haschim erhält, macht er sich in geheimer Mission ein weiteres Mal auf nach Stambul. Dort geht Ungeheuerliches vor: Eine namenlose neue Macht greift um sich und übernimmt die Kontrolle über Bürger der Stadt. Gemeinsam mit alten und neuen Freunden bekämpft Kara erneut das Böse – in verschiedenen Welten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 10
Die Seelen von
Stambul
Der Sultan ohne Namen – Teil 1
vonAlexander Röder
Mit einem Prologvon Thomas Le Blanc
KARL - MAY - VERLAGBAMBERG • RADEBEUL
Herausgegeben von Thomas Le Blanc und Bernhard Schmid
In der Reihe „Karl Mays Magischer Orient“ sind bisher erschienen:
Band 1 – Alexander Röder Im Banne des Mächtigen (auch als Hörbuch)
Band 2 – Alexander Röder Der Fluch des Skipetaren
Band 3 – Alexander Röder Der Sturz des Verschwörers
Band 4 – Alexander Röder Die Berge der Rache
Band 5 – Alexander Röder, Tanja Kinkel u. a. Sklavin und Königin
Band 6 – Alexander Röder, Thomas Le Blanc Auf der Spur der Sklavenjäger
Band 7 – Jacqueline Montemurri, Bernhard Hennen Der Herrscher der Tiefe
Band 8 – Friedhelm Schneidewind, Bernhard Hennen Das magische Tor im Kaukasus
Band 9 – Jacqueline Montemurri, Nina Blazon Das Geheimnis des Lamassu
Band 10 – Alexander Röder, Thomas Le Blanc Die Seelen von Stambul
Thomas Le Blanc (Hrsg.) Auf phantastischen Pfaden – Eine Anthologie mit den Figuren Karl Mays
Weitere Informationen zur Reihe „Karl Mays Magischer Orient“ finden im Internet auf
www.magischer-orient.karl-may.de
© 2023 Karl-May-Verlag, Bamberg
Alle Urheber- und Verlagsrechte vorbehalten
Illustration: Elif Siebenpfeiffer
ISBN 978-3-7802-1410-2
www.karl-may.de
Thomas Le Blanc
Prolog
Drei Botschaften nach Radebeul
Meine Leser wissen, dass man mein Leben als unstet, ja als ruhelos bezeichnen könnte. Ich reise gerne und häufig durch aller Herren Länder, aktuell bevorzugt durch den Orient, und habe dabei nicht immer ein festes Ziel, sondern lasse mich auch von den Ereignissen treiben. Wenn ich unterwegs bin, bleibe ich selten länger an einem Ort: Ich erlebe meine Abenteuer beim Reisen und bin dabei meist zu Pferd oder zu Kamel unterwegs, nutze aufgrund der großen Entfernungen aber auch gelegentlich die Eisenbahn, so sie denn schon eine Strecke auf meinem geplanten Weg anbietet, oder das Schiff. Natürlich bleibt es nicht aus, dass ich kürzere oder längere Strecken auch auf den eigenen Füßen zurücklege – bedingt durch das Gelände, die Verfügbarkeit eines Transportmittels oder manchmal schlicht und einfach verursacht von der geringen Menge an Piastern, die sich in meinem chronisch klammen Geldbeutel gegenseitig anöden.
Aus dieser ständigen Bewegung folgt, dass ich mich körperlich recht gesund und kräftig fühle, keinen Bauchansatz habe, selten krank bin und auch die Speisen fremdländischer Küchen im Allgemeinen gut vertrage. Damit ich diese körperliche Stärke in den Zeiten, in denen ich mich zuhause in Radebeul aufhalte und daher tagsüber (und nachts) lange am Schreibtisch sitze, nicht gefährde, habe ich mir selbst einen strengen Plan auferlegt, wie ich mir Bewegung verschaffe. Täglich vor dem Mittagessen und nach dem Abendbrot sehen mich die Radebeuler eine halbe bis eine Stunde durch die ruhigen Straßen der Villenviertel spazieren gehen, und in unregelmäßiger Frequenz wandere ich auch gerne im Lößnitzgrund und in den Weinbergen von Kötzschenbroda und Wahnsdorf. Das alles mag nicht weit und nicht intensiv sein, aber es genügt doch, um meine Gelenke nicht einrosten zu lassen und meine Lungen immer wieder mit frischer sächsischer Luft zu füllen.
Von einem kleinen Weg durch die benachbarten Weinberge kam ich an einem Samstagmittag zurück und freute mich schon auf die deftige Mahlzeit, die meine Haushälterin für mich bereitet hatte.
Als ich in Sichtweite meines Hauses kam, sah ich vor dem Gartentor zwei Männer stehen. Der eine war ein gemütlich wirkender, untersetzter, rothaariger Herr in mittleren Jahren; der andere ein junger Mann unter dreißig, schmal und lang und von derart aufrechter Haltung, als habe er einen Stock verschluckt. Der Erste war geschäftsmäßig in einen dunklen Zweireiher gekleidet und hatte eine Mappe unter dem Arm; der Zweite trug eine makellos sitzende Uniform, die ich beim Näherkommen als den Rotrock eines First Lieutenants der britischen Armee identifizierte. Auf der anderen Straßenseite ein Haus weiter sah ich eine geschlossene Kutsche warten.
Der Zivilist blickte mir mit offenem Gesicht entgegen, als ich auf mein Haus zuging, und sprach mich an, als ich unmittelbar vor ihm stand: „Verzeihen Sie, dass ich Sie auf offener Straße anspreche, aber Ihre Haushälterin wollte uns nicht hineinlassen. Habe ich die Ehre mit dem Reiseschriftsteller, der im Orient den Namen Kara Ben Nemsi führt?“
Da seine Sprache und seine Haltung von ausgesuchter Höflichkeit waren, sah ich keine Veranlassung, die Frage nach meiner zweiten Identität nicht zu beantworten. „In der Tat, das bin ich.“
„Gestatten Sie dann, dass ich mich vorstelle“, fuhr er nach einem Nicken fort. „Mein Name ist Arthur George Drake, ich bin der Büroleiter der britischen Gesandtschaft in Dresden.“
Das britische Empire war nicht nur beim Deutschen Kaiser in Berlin diplomatisch vertreten, sondern aus historischer Tradition zusätzlich bei den deutschen Gliedstaaten Sachsen und Bayern, im Königreich Sachsen vermutlich auch aus handfesten wirtschaftlichen Interessen.
„Dann darf ich Sie natürlich ins Haus bitten“, sagte ich. „Meine Haushälterin, die von mir angehalten wurde, Besuchern höflich zu begegnen, hat sich vermutlich vor der Uniform Ihres Begleiters erschrocken. Ich darf mich dafür entschuldigen, dass Sie auf der Straße warten mussten.“
„Aber nein, aber nein, Sir“, gab Mr. Drake zurück. „Es ist natürlich völlig korrekt, keine Fremden ins Haus zu lassen, wenn der Hausherr nicht zugegen ist.“
Ich öffnete das Gartentor und ging voran zur Haustür, die ich für meine Gäste öffnete. „Ich darf vorausgehen“, sagte ich dann und führte die beiden durch die Diele in mein Arbeitszimmer. Der Raum zeichnete sich durch eine kreative Unordnung aus, ohne aber ungemütlich oder für Gäste abweisend zu sein. Zwei Wände waren mit dicht gefüllten Bücherregalen möbliert, eine öffnete sich mit einer Doppeltür zur Terrasse, und die vierte Wand war meinen Reisen gewidmet: Hier hingen oder lagen auf einer Anrichte ein paar Mitbringsel, die mir wichtig waren, darunter eine Friedenspfeife der Dakota-Sioux, das Kalumet eines Pawnees, der in meinen Armen gestorben war und mir seine ‚Seele‘ anvertraut hatte, einige Speere, Messer und Tomahawks, ein Bumerang, eine Bärenfellmütze, eine Kette aus Löwenzähnen, eine aus Antilopenleder gefertigte Mappe, Zaumzeug und auch eine Nilpferdpeitsche, die ich einem Sklavenjäger abgenommen hatte – aber natürlich kein Löwenkopf und kein Geweih eines Wapitis, denn ich war kein Jäger und zeigte deshalb auch keine Trophäen.
An dieser Wand hingen natürlich meist – wie auch heute – meine beiden Gewehre: der ingeniöse fünfundzwanzigschüssige Henrystutzen und der schwere doppelläufige Bärentöter. Wenn sie dort hingen, zeigte das, dass ich bereits mehr als zwei Wochen wieder zu Hause war. Denn die Gewehre wurden auf meinen Reisen natürlich beansprucht, es wurde nicht nur mit ihnen geschossen, sie dienten in der Not auch als Werkzeug jeglicher Art, und deshalb mussten sie regelmäßig von Sand und anderen Fremdkörpern gereinigt werden, sie mussten gepflegt werden, damit sie keinen Rost ansetzten und damit vor allem ihr Lauf nicht verzogen wurde. Deshalb gab ich sie, sobald ich zu Hause war, sofort zu einem befreundeten Büchsenmacher und ließ es mich etwas kosten, sie immer wieder neu herzurichten, einzufetten und in perfekter Funktion zu halten – denn davon konnte immerhin mein Leben und das meiner Begleiter abhängen.
Wenn man das Zimmer von der Diele aus betrat, stand linker Hand mein großer Schreibtisch, an dem ich meine Romane verfertigte: Er war auch heute wieder überfüllt mit Papierbögen, und am Kopf standen gleich vier Tintenfässer und ein ganzes Dutzend Schreibfedern. Zur Rechten befand sich eine kleine Sitzgruppe, zu der ich meine Gäste geleitete.
Ich sah, dass sie kurz zur Wand mit den Andenken schielten, aber sie ließen sich ihre naturgemäße Neugier nicht anmerken; offenbar hatten sie einen offiziellen Auftrag, und sie waren nicht zum Plaudern gekommen. Auch waren sie – trotz zweimaliger Einladung durch mich – nicht bereit, sich zu setzen.
Mr. Drake hielt seine Mappe vor sich und öffnete sie. Dabei gewahrte ich, dass an ihrer Seite noch ein kleines Paket baumelte, das mittels einer goldfarbenen Tresse an der Mappe befestigt war. Er zog aus der Mappe eine passende Kladde hervor, die er aufschlug, und griff nach einem Papier, das er mir überreichte.
Ich bekam ein grauweißes, feinstes, handgeschöpftes Büttenpapier in die Hand, stark strukturiert und sehr holzhaltig. Auf dem Kopf des Blatts prangte das Wappen der britischen Königin, an den Seiten gehalten von einem Löwen und von einem Einhorn, darunter waren die Worte „Her Britannic Majesty’s Ambassador to the Ottoman Porte“ eingedruckt. Ich blickte zum Fuß des Schriftstücks: Der Brief war handschriftlich unterzeichnet mit „Layard“.
Ich war so überrascht, dass ich mich jetzt in einen der Sessel setzen musste. Die Unterschrift war offenbar von Sir Austen Henry Layard, der gerade Botschafter von Königin Victoria in Stambul geworden war. Layard war für mich eine Legende, weil er bis zur Wiege unserer Zivilisation vorgedrungen war. Er hatte auf den Hügeln von Kujundschik bei Mossul das assyrische Ninive entdeckt und dort Tafeln des Gilgamesch-Epos ausgegraben und nach London verschifft. Seine detailgetreuen Reiseberichte aus Persien, Mesopotamien, Kurdistan und Palästina waren für mich Grundlage all meiner Reisen in den Orient geworden, ja, durch seine Erlebnisse fühlte ich mich ihm ungewöhnlich eng verbunden, obwohl ich ihm bislang noch nicht begegnet war. Nur Lindsay, der mit Layard natürlich persönlich bekannt war, hatte mir gelegentlich von ihm erzählt.
Der Brief zeigte in bester Kalligrafie die Hochzeit von Sir Austen Henry Layard mit einer Constanza Venessia an und lud den Empfänger – also in diesem Fall mich – zur Feier dieser Hochzeit nach Istanbul in die Räume der britischen Botschaft ein.
Das war natürlich eine ungewöhnliche Bevorzugung; bedeutete es doch, dass auch Layard auf mich aufmerksam geworden war und vermutlich seine Hochzeit als Gelegenheit nahm, mich persönlich kennenlernen zu können. Denn was gäbe es sonst für einen Anlass für einen hohen Vertreter der britischen Krone, mich als deutschen bzw. sächsischen Staatsbürger zu seiner Hochzeit einzuladen. Ich war zwar bereits einmal in der Botschaft in Stambul gewesen, doch damals hatte mich Lindsay als Begleitung mitgenommen, und ich war daraufhin sicherlich nicht auf die invitation list für offizielle Empfänge gesetzt worden.
Als ich allerdings auf das Datum der Hochzeitsfeier schaute, stutzte ich, denn ich wurde gewahr, dass der Termin schon in der Vergangenheit lag, wenn auch nur wenige Stunden: Die Trauung war bereits am heutigen Morgen gewesen.
Als ich Mr. Drake, der offenbar auf meine Antwort auf die Einladung wartete, auf diesen Umstand aufmerksam machte, war ihm das erkennbar unangenehm. Seine ohnehin kräftige Gesichtsfarbe wechselte in ein dunkles Rot. Der offizielle Depeschentransport auf dem Diplomatenweg von Istanbul nach Dresden hatte mehr Zeit benötigt, als vom Absender kalkuliert worden war, und das musste Drake natürlich ausgesprochen peinlich sein, auch wenn er nur auf die letzte Etappe hatte Einfluss nehmen können: auf den Weg von der Gesandtschaft in Dresden hier hinaus nach Radebeul, also gerademal auf die andere Seite der Elbe, was eine Entfernung von wenigen Kilometern und mit der Kutsche vielleicht eine halbe Stunde Zeitaufwand bedeutete. Dennoch: Er war in offizieller Mission unterwegs und hatte eine Botschaft überbracht, die dem Empfänger nicht mehr viel nützte; eine Einladung, die keine Einladung mehr war; und ein weniger freundlicher Mensch als ich hätte das sogar als Affront auffassen können.
Einen Affront zu vermuten, davon war ich jedoch weit entfernt, denn zum einen nahm ich die Langsamkeit der Diplomatenpost mit Humor, zum anderen war ich – ohne dass ich das natürlich meinen Gästen gegenüber zugeben durfte – gar nicht mal so unglücklich über die Sache. Die Panne enthob mich nämlich der Verpflichtung, an einem steifen Festakt teilzunehmen, stattdessen erlaubte es mir, Layard meine – unfreiwillig verspätete – Aufwartung privatim zu machen und dabei in zwangloserer Atmosphäre sicherlich mehr von seiner Zeit in Anspruch nehmen zu können.
Ich teilte also Mr. Drake mit, dass ich bei meiner nächsten Orientreise als Erstes in der britischen Botschaft in Istanbul vorsprechen würde, und man möge dazu schon mal meine Glückwünsche voraussenden und meine Ankunft avisieren. Während ich mich also darauf freute, ganz geruhsam mit Layard über seine Reisen und seine Ausgrabungen plaudern zu können, versuchte Mr. Drake die Peinlichkeit zu überspielen, indem er meine Antwort getreulich memorierte und versprach, sie über die diplomatischen Kanäle der Gesandtschaft weiterzugeben – mit diesmal höherer Geschwindigkeit.
Er schickte sich nun an, sich zu verabschieden, löste dabei die Tresse des kleinen Päckchens und überreichte es mir: „Ich habe noch eine zweite Übergabe zu erledigen. Dieses packet darf ich Ihnen im Namen der Braut überreichen.“
Jetzt war ich vollends verwirrt. Was hatte eine mir völlig unbekannte Braut eines Mannes, dem ich auch noch nie persönlich begegnet war, für eine Veranlassung, mir ein kleines würfelförmiges Päckchen von etwa zehn, zwölf Zentimeter Kantenlänge schicken zu lassen – und das auch noch per diplomatischem Kurier? Ich wog es in meiner Hand: Es war recht leicht und mochte gar nicht viel enthalten. Ob das darin befindliche Element etwas mit der Hochzeit zu tun hatte? Vielleicht war es eine Art Schmuck, den die Gäste alle tragen sollten, und gehörte zu einem mit der Zeremonie verbundenen Ritual.
Ich schaute nochmals auf die Einladung, ob ich dort eventuell einen Hinweis fand. Der Name der Braut Constanza Venessia mochte italienischer Herkunft sein, denn Venessia war die venezianische Schreibweise von Venedig. Das half mir jedoch nicht weiter. Aber eine andere Information, die ich erst jetzt auf dem Einladungstext wahrnahm, setzte mich in Erstaunen: Die Zeremonie sollte nicht ein Reverend der Anglikanischen Kirche oder ein Zivilbeamter der Botschaft übernehmen, sondern ein Mudir, ein türkischer Verwaltungsbeamter. Der britische Botschafter ließ sich nach osmanischem Recht trauen? Die Angelegenheit wurde immer merkwürdiger.
Das alles ging mir durch den Kopf, während ich meine Gäste aus dem Haus geleitete und sie, nach einigen Ehrbezeugungen, ihre wartende Kutsche bestiegen.
Ich konnte ihnen jedoch nicht hinterhersehen, denn just in diesem Augenblick erreichte mich Herr Reichenberg, der kaiserliche Postbote, der in unserem Viertel zweimal am Tag die Post austrug, und drückte mir mit freundlichem Gruß einen Brief in die Hand. Er war korrekt an meinen deutschen Namen adressiert, besaß aber keinen Absender. Anstelle von Briefmarken trug er einen arabischen Stempel und einen deutschen Stempel als Freimachungsvermerke, der arabische war stark verschmiert und unleserlich, der deutsche wies nach, dass der Brief über das Postamt in Stambul gelaufen war. Ich erinnerte mich, dass es seit 1871 ein kaiserlich-deutsches Postamt in Istanbul gab, das unter anderem für den Postaustausch der im Osmanischen Reich nach Deutschland aufgegebenen Briefe zuständig war. Ich durfte stolz auf die Dienstleistungen unserer modernen Zeit sein, die für die Kommunikation über Kontinente hinweg sorgten.
Aber jetzt galt es erstmal, dass ich es mir nicht mit meiner Haushälterin verscherzte, die mit dem Essen wartete. Außerdem verspürte ich Hunger, zumal ich am Vormittag schon gesehen hatte, was sie für mich zubereiten wollte. Im kleinen Essraum neben der Küche war bereits gedeckt, und als ich zu ihr in die Küche kam, um mich wegen des unerwarteten Besuchs für die Verzögerung zu entschuldigen, da nickte sie verständnisvoll. Sie hatte ohnehin das Kochen etwas verzögert, weil sie die Gäste zwar vor der Tür hatte stehen lassen, aber doch vermutet hatte, dass ich mich mit ihnen befassen würde, sobald ich da war.
Ich setzte mich an den Esstisch und sie trug auf. Sie brachte einen großen Topf Gemüse-Allerlei, das aus Erbsen, Bohnen, Karotten, Blumenkohl und Kohlrabi bestand; das Gemüse war noch knackig und mit viel Butter gedünstet. Dazu gab es kleine feine Semmelklößchen, wie ich sie mochte. Alles dampfte noch, als es auf den Teller kam, und ich nahm gerne zum Allerlei noch etwas Brot dazu. Fleisch gab es heute keins. Auf meinen Reisen aß ich nämlich reichlich Fleisch, was ich mir ja meist selber schoss, da die Zeit, zusätzlich in der Prärie oder der Savanne wildes Gemüse zu suchen und zuzubereiten, meist nicht vorhanden war. Ein paar in den Satteltaschen mitgeführte getrocknete Kräuter mussten zum Würzen des Fleischs reichen. Deshalb hatte meine Haushälterin beschlossen, die Ernährung zu Hause etwas umzukehren, also in Radebeul das Gewicht eher auf Gemüse zu legen. Ich fügte mich dem gerne, weil ich eh ein Allesesser bin und auch die Abwechslung liebe.
Nach der Essenspause, für die ich mir Zeit genommen hatte, denn Speisen sollte man genießen und sie nicht als reine Nahrungsaufnahme sehen, ging ich wieder hinüber in mein Arbeitszimmer und gönnte mir zunächst einmal ein großes Glas Selters; durch die erfrischende Kohlensäure diente es mir ebenso zur körperlichen Verdauung wie zur geistigen Anregung. Der aus der berühmten Unternehmerfamilie Siemens stammende Friedrich August Siemens, der bei Dresden zwei Glashütten besaß, war nicht nur in die Massenproduktion von Glasflaschen eingestiegen, sondern hatte auch ein Auge auf die weithin gerühmten Seltersbrunnen in den nassauischen Gemarkungen Niederselters und Oberselters geworfen, stattete deren Produktion mit seinen Flaschen aus, um die bisherigen Tonkrüge abzulösen, und sorgte durch seine Geschäftsbeziehungen quasi nebenbei dafür, dass die Marke Selters auch in Dresden zu kaufen war.
Ich ergriff nun den vom Postboten übergebenen Brief, öffnete ihn vorsichtig und entnahm ein in gestochen klarer arabischer Schrift einseitig beschriebenes Blatt. Das Absendersiegel oben rechts zeigte mir sofort, dass der Brief von meinem Freund Haschim stammte, doch als ich den nicht allzu umfangreichen Text rasch durchlas, war ich zunächst etwas ratlos. Haschim sprach mich mit netten, freundlichen Worten an und erzählte mir in einem Plauderton einige belanglose Begebenheiten von seinem Gut in der Nähe von Taif, auf dem ich ihn ja auch einmal besucht hatte. Der Brief war höflich und freundschaftlich gehalten, aber sein Inhalt war es eigentlich nicht wert, in Worte gefasst und dann noch gegen Porto quer durch halb Europa geschickt zu werden. Er besaß keinen höheren Gehalt, als wenn ich von meinem heutigen Mittagessen erzählt hätte.
Ich legte den Brief vor mich auf den Schreibtisch, lehnte mich in meinem Stuhl zurück und dachte nach.
Da kamen am selben Tag aus demselben Land zwei Briefe, von denen der eine überholt und der andere inhaltsleer war. Da ich ohnehin nicht an den Zufall glaubte, ging es jetzt nur darum, die beiden Briefe von ihrer Intention her zusammenzuführen. Was wollten mir ihre Absender mitteilen?
Während ich mit meinen Gedanken auch meine Augen schweifen ließ, fiel mein Blick auf zwei Objekte, die friedlich nebeneinander auf meinem Schreibtisch lagen, obwohl sie sich in ihrer Funktion gravierend unterschieden: Dort lagen eine gewöhnliche Lupe und der Musaddas, der magische Sechseckring, den ich seit meinen Begegnungen mit Al-Kadir bei mir trug.
Ob Haschims Brief vielleicht eine zweite Botschaft in sich trug?, sinnierte ich. Eine Botschaft, die er magisch versteckt hatte, damit ein anderer als ich sie nicht wahrnehmen konnte, sondern nur einen harmlosen Gruß aus Haschims Leben im Hedschas las?
Ich hatte mich ja längst damit abgefunden, dass es Formen der Magie gab, die mit den Gesetzen der Physik konkurrierten, aber das nur als eine magische Eigenschaft des Morgenlands gesehen und das Abendland nicht davon berührt verstanden. Deshalb lag der Musaddas hier auch nur als Dekoration, während die Lupe daneben eine Funktion hatte, die sich mit den Gesetzen der Strahlenoptik erklären ließ.
Heute jedoch schien vieles anders zu sein, deshalb griff ich nun kurzentschlossen zum Musaddas, hielt ihn mir vor das rechte Auge und versuchte durch ihn hindurch auf Haschims Brief zu blicken.
Beim ersten Blick geschah gar nichts. Doch dann begannen die Buchstaben vor meinem Auge zu tanzen. Die arabischen Schriftzeichen bewegten sich plötzlich nicht nur über die Papierfläche, als wären sie winzige lebende Wesen, kleine emsige Käfer, nein, sie verwandelten sich auch noch von arabischen Lettern in die sehr ähnlichen Zeichen des persischen Alphabets, und wenn man dann auch die zugehörigen persischen Lautwerte zuordnete, war zu erkennen, dass Haschim seine eigentliche Mitteilung in persischer Sprache formuliert hatte.
Durch den Musaddas geblickt stand dort etwas ganz anderes zu lesen:
Mein lieber Freund Kara,
die Welt gerät aus den Fugen. Im Orient riecht es überall nach Aufruhr und nach Krieg von Völkern gegen Völker, der Padischah reagiert darauf nur mit Terror und brutaler Niederschlagung und zeigt gleichzeitig Schwäche, die regionalen Fürsten beginnen sich gegenseitig zu misstrauen, und die ausländischen Mächte reißen sich Stücke aus unserem Leib für ihre eigenen Nutzen. Und in diesem Chaos ist eine neue Macht erwachsen, die scheinbar über unbegrenzte Ressourcen an Menschen und Finanzen verfügt, die neue Formen von Magie kennt und alles zu wissen scheint, was zwischen dem Mittelländischen Meer und dem Arabischen Golf geschieht. Diese Macht ist durchweg böse, indem sie die Menschen korrumpiert; sie strebt ein neues Gemeinwesen an, das keine Freiheiten des Einzelnen mehr zulässt und die Würde des Menschen missachtet. Und diese böse Macht geht mit Mitteln vor, von denen wir bislang nicht geglaubt haben, dass Menschen sie gegen Menschen einsetzen würden.Bitte komm uns zu Hilfe. Ich bin bereits auf der Flucht vor Assassinen und wechsle ständig den Ort, aber ich werde es erfahren, sobald du osmanischen Boden betrittst, und dich dann zu mir leiten.Antworte nicht auf diesen Brief, lieber Freund, und kündige deine Reise niemandem an.
Dein verzweifelter Haschim
Beim Lesen war mir irgendwann der Atem stehen geblieben und ich holte nun hektisch Luft. Einen solchen Brandbrief konnte man allerdings nur einer magischen Verschlüsselung anvertrauen.
Ich stand auf und lief im ersten Schock zunächst etwas planlos im Zimmer umher. Dann blieb ich vor der Wand mit meinen Gewehren stehen. Es gab kein Überlegen mehr. Jetzt galt es nur noch zu packen und morgen in aller Frühe die Eisenbahn zu nehmen, die mich zunächst nach Triest bringen musste, von wo aus ich einen Dampfer nach Istanbul nehmen konnte. Das war erfahrungsgemäß der schnellste Weg. Lindsay, von dem ich nicht wusste, auf welchem Kontinent er sich gerade aufhielt, würde ich von der britischen Botschaft aus zu kontaktieren versuchen, und Halef … Mal sehen, ich konnte wohl von Triest aus ein Seekabel nach Istanbul ans Telegrafenamt schicken, um einen vertrauenswürdigen, alten türkischen Soldaten zu erreichen, der einen Kurier zu den Haddedihn organisieren konnte.
Nein … halt …! Kündige deine Reise niemandem an. Haschim hatte diese Warnung offensichtlich bitterernst gemeint. Ich würde also nichts verlauten lassen und auch in Triest den Dampfer keinesfalls unter meinem Namen buchen. Und dann wollte ich in Istanbul auf Haschims Kontaktaufnahme warten; er kalkulierte mit Sicherheit ein, dass ich Halef würde erreichen wollen, und mir einen Weg weisen.
Obwohl … ich musste mich erneut gedanklich korrigieren: Die britische Gesandtschaft in Dresden würde eine Depesche zur britischen Botschaft in Istanbul senden. Ich hatte zwar Mr. Drake nicht mitgeteilt, wann ich kommen würde, aber ich hatte angekündigt, dass ich, wenn ich kam, zuerst die Botschaft aufsuchen würde.
Ob diese Information auch bei der unbekannten gefährlichen Macht, von der Haschim sprach, ankommen würde und ihr bereits einen Vorteil verschaffte? Egal – ich vermochte es nicht mehr zu ändern, und ich konnte nur versuchen, bei meinem Besuch der Botschaft meine Identität irgendwie zu kaschieren.
Ich nahm schon mal meine beiden Gewehre von der Wand und schob sie in ein ledernes Doppelfutteral, auf das ich zur Tarnung das großformatige Emblem eines britischen Angelwettbewerbs geklebt hatte. Solange ich noch in Europa unterwegs war, wollte ich kein Aufsehen erregen und eventuell von pflichteifrigen Beamten als bewaffnetes Sicherheitsrisiko angehalten werden. Für den Fall, dass das doch einmal geschehen sollte, hatte ich am Futteral mittels einer Schlaufe ein flaches Etui hängen, in dem ein amtliches Papier steckte. Ein befreundeter Beamter der königlich-sächsischen Staatskanzlei hatte mir vor ein paar Jahren – nach der begeisterten Lektüre meiner ersten Romane – ein Dokument ausgestellt, das den Inhalt des Doppelfutterals als Diplomatenpost deklarierte und mir einen Kurierstatus zuerkannte. Damit durfte es von keinem Gendarmen und auch keinem Grenzpolizisten oder Zollbeamten geöffnet werden und ersparte mir lange Auseinandersetzungen über die Aus- bzw. Einfuhr von Waffen, was früher schon mal an einer österreichisch-italienischen Grenze zu einigen Tagen Haft und damit zu unangenehmen Verzögerungen meines Reiseplans geführt hatte.
Doch bevor ich mit dem Zusammensuchen meines Gepäcks begann, wartete noch eine weitere Sache auf mich: das kleine Päckchen, das mir Mr. Drake beim Abschied zusätzlich überreicht und das ich zunächst auf dem Schreibtisch abgelegt hatte. Ich hatte es nicht vergessen, aber in meiner Prioritätenliste ein wenig nach hinten geschoben.
Nun nahm ich es auf. Es passte zwischen meine beiden Hände, war von der Geometrie her würfelförmig, mit grünem Papier umhüllt und mit dünnen Fäden mehrfach umwickelt und verknotet. Vorne stand in feinen Buchstaben „Kara Ben Nemsi“ in lateinischer Druckschrift, und auf der Rückseite war in anderer Handschrift und mit schwarzem Kohlestift „Germany – Saxony“ vermerkt; die Destination mochte ein Beamter der Botschaft angemerkt haben. Als ich das Papier entfernte, kam eine Schachtel aus Pappe zutage, und darinnen lag zwischen etwas Stroh als Füllmaterial – ein Stein.
Ich nahm ihn heraus. Er erinnerte mich zumindest von der Farbe und vom Material her an die kleinen schwarzen Steine, die wir auf der Suche nach Hanneh und Djamila aufgesammelt hatten, aber dieser war kein Bruchstück, sondern sichtlich geschliffen, sodass er angenehm in der Hand lag. Er war schwarz marmoriert mit weißen unregelmäßigen Linien, von der Form her oval, lediglich unten etwas abgeplattet, sodass ich ihn hochkant auf den Schreibtisch stellen konnte, ohne dass er umfiel.
An der Spitze bemerkte ich eine kleine Öffnung, eine winzige Höhlung. Ich versuchte hineinzusehen, konnte aber nicht erkennen, ob sie tief ging oder nur eine kurze Einkerbung war. Und sie war zu schmal, um sie selbst mit dem kleinen Finger zu erkunden. So war ich zunächst ratlos, was dieser Stein zu bedeuten hatte und warum er mir geschickt worden war.
Ich konnte nichts anderes tun, als ihn vor mir auf dem Schreibtisch stehenzulassen, ihn eine Weile anzusehen, ihn dann mit beiden Händen ein wenig zu wärmen – und mich aufnahmebereit zu zeigen, falls der Stein mir irgendetwas mitteilen wollte.
So saß ich ein paar Minuten, bis ich plötzlich das Gefühl hatte, dass nicht meine Finger den Stein erwärmten, sondern dass die Temperatur des Steins von selbst zunahm. Als ich deshalb meine Finger wieder wegnahm, gewahrte ich, dass ganz feiner weißer Rauch aus der winzigen Öffnung aufstieg, der sich rasch verdichtete, immer mehr und mehr wurde, aber nicht bis zur Decke stieg oder sich im Raum verteilte, sondern ebenfalls eine schmal-ovale Form von etwa einem Meter Höhe bildete.
Ob hier ein Dschinni aufstieg und mir gleich verkünden würde, dass ich drei Wünsche frei hätte?
Dschinni war es keiner, aber der Rauch verdichtete sich dennoch zu einer menschenähnlichen Gestalt von knapp einem Meter Höhe. Die Gestalt bekam Arme und Beine, Statur und Kleidung, Farbe und Konsistenz, und auch das Gesicht formte sich aus und gewann Züge, die mir von Augenblick zu Augenblick bekannter vorkamen: Vor mir in der Luft über dem Tisch manifestierte sich in halbdurchscheinender Geistform und halber Körpergröße die Simulation einer Frau, die bei mir vor rund drei Jahren eine gewaltige Gefühlsbandbreite von Vertrauen und Zuneigung über Mitleid und Abweisung und zum Schluss Zorn wegen ihres Verrats ausgelöst hatte und die ich aktuell noch am Kaspischen Meer in der sicheren Obhut von Marah Durimeh wähnte:
Vor mir erschien ein Abbild der Hexe Qendressa.
„Ich bin’s wirklich, lieber Kara“, begann die Gestalt aus Rauch nach einigen Augenblicken zu sprechen. „Ich weiß, ich habe unendlich viel Schuld auf mich geladen, ich habe vielen Menschen wehgetan, auch dir und Freunden von dir. Ich habe euch alle an den Schut verraten, und als Dank hat der Schut mich verraten. Es ist geschehen, nichts lässt sich nachträglich ändern, und vieles kann man nicht wieder gutmachen. Aber ich werde in meinem neuen Leben nicht mehr auf der falschen Seite stehen, sondern versuchen, durch mein Handeln Schuld abzutragen.“
Es war unzweifelhaft Qendressas Stimme, ohne große Intonation zwar, und der Blick des Abbilds ging nach vorne ins Leere. Es handelte sich lediglich um eine Projektion, die abgespult wurde wie bei einer Maschine. Qendressa war nicht zugegen, und es gab offenbar auch keine direkte Verbindung zu ihr, die Übermittlung geschah nur in einer Richtung.
„Marah Durimeh hat mich wieder in die Welt entlassen“, fuhr die Gestalt fort. „Ich bin keine Hexe mehr, ich verfüge auch über keine hexerischen Fähigkeiten mehr – außer denen, die mir situationsgebunden zugewiesen werden, um meine neuen Aufgaben erfüllen zu können. Im Orient ist eine neue böse Macht aufgestanden und hat ein Spiel begonnen, an dessen Ende die Welt, wie wir sie kennen, eine neue Gestalt bekommen soll. Diese Macht, deren Namen ich nicht kenne und von deren Mitteln ich auch noch keine Kenntnis habe, nennt ihre unheilvollen Aktivitäten ein großes weltumspannendes Spiel, und Marah Durimeh hat sich nun in dieses Spiel als heimlicher Gegner hineinbegeben und stellt ihre Figuren auf. Sie verfolgt einen Plan, um die bisherige Weltordnung zu bewahren. In diesem Plan spielst du, lieber Kara, eine tragende Rolle. Haschim wurde die Rolle des Vogelfreien zugedacht, der alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll. Und auch ich bin gemeinsam mit dem Britischen Botschafter darin eingebunden und soll die nur scheinbar harmlose Ehefrau spielen, die keiner beachtet. Marah Durimeh hat mit Queen Victoria gesprochen und ihr den Ernst der Situation erläutert, daraufhin hat die Britische Königin bereits im vergangenen Jahr Sir Henry Layard zum Botschafter in Istanbul ernannt und ihn in einige Punkte eingewiesen. Er steht mit all seinen Kontakten auf unserer Seite. Queen Victoria und Marah Durimeh haben auch unsere Hochzeit arrangiert, die dazu dienen soll, dass jeder Spieler an seinem Platz ist. Um mich nach außen zu tarnen, wurde ich mit einem Aliasnamen ausgestattet: Aus dem albanischen Qendressa wurde das italienische Constanza, was ja beides ‚die Standhafte‘ bedeutet, und als Nachnamen bekam ich die venezianische Form meiner Heimatstadt Venedig. Und ich werde die vornehme Dame zu spielen wissen – selbstredend voller Distanz auch dir gegenüber.“
So einfach klärte sich die Einladung zur Hochzeit an mich. Die aufmüpfige Qendressa als Diplomatenfrau, eine Karriere von der Einbrecherin in die Botschaft zu ihrer First Lady – welch ein Aufstieg!
„Die Einladung zur Hochzeit ist deine offizielle Fahrkarte in den Orient. Du wirst hier erwartet, doch sei auf der Hut, wem du trauen kannst. Marah Durimeh ist allerdings zuversichtlich, dass dein Instinkt dich schon leiten wird. Und sie weiß, welche Stärke in dir sitzt. – Kara, lieber Kara, wir sehen uns schon sehr bald wieder.“
Und dann folgten ihre letzten, wie automatisch dahingesagten Worte: „Diese Botschaft wird sich in wenigen Augenblicken selbsttätig vernichten.“ Daraufhin fiel das Phantombild in sich zusammen und der übriggebliebene Rauch verwehte im Raum. Dann schoss unvermittelt noch einmal ein kleiner Puff aus dem winzigen Loch, bildete einen Brandring darum herum, und dann war der Stein nur noch ein Stein.
Nun also zu meinem Reisegepäck. Ich rief meine Haushälterin.
Alexander Röder
Erstes Kapitel
Rückkehr nach Stambul
Die Stadt hatte sich verändert.
Oder war ich es, der sich verändert hatte?
Ich stand an der Reling des Dampfers, als er im Hafen anlegte. Hinter mir stieg dünner grauer Rauch aus dem Schornstein in den matten Himmel, vor mir sah ich den Dunst der Kamine von Stambul. Die Luft war drückend, es mochte bald ein Gewitter geben. Die Hitze des beginnenden Monats August lag schwer über dem Bosporus, ohne Hoffnung auf kühlende Winde vom Schwarzen Meer. Das trübe Wasser des Hafens war brackig und verdreckt, und über den Dunst von fauligen Algen wehte der schwere Odem der Metropole. Die winzigen Wellen zwischen dem eisernen Rumpf des Dampfers und der steinernen Kaimauer tanzten wie die Wogen der Menschen an Land, die hin und her eilten, dabei Packen und Waren trugen und laut durcheinanderriefen. Aus den angelegten Schiffen und Booten traten die Passagiere zum Landgang und die Schauerleute, um die Ladung zu löschen. Über den Fischerboten schwärmten und kreischten die Möwen.
All dies schien mir fahrig und wirr, sogar bedrohlich, nach meinen ruhigen Wochen in der Heimat, in denen ich fleißig geschrieben hatte und eifrig gewandert war, in Gelassenheit und Einsamkeit. Nach der Stille von Stube und Wald und der sächsischen Gemütlichkeit brach die ungestüme Wildheit des Orients auf mich ein, als wäre es das erste Mal, dass ich dergleichen erlebte. Hier in Stambul trafen sich Abendland und Morgenland, und nicht allein, weil die Stadt in zwei Teilen auf zwei Kontinenten lag. Eine Landreise über den Balkan machte den Übergang zwischen diesen beiden Weltteilen allmählich erfahrbar, die Schiffspassage hingegen endete mit plötzlichem Sturz. An Bord ging man im Okzident, dann folgten gleichförmige Tage auf See, und im Orient ging man von Bord. Dies musste jeden Reisenden verblüffen, ja erschrecken.
Ein Ehepaar aus Schweden ging an mir vorüber und grüßte zum Abschied:
„Farväl! En trevlig och lyckad vistelse!“
„Auch Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Leben Sie wohl!“
Ich hatte die beiden flüchtig kennengelernt, da ich nähere Reisebekanntschaften gemieden hatte, doch nicht so strikt, dass ich als Sonderling aufgefallen wäre. Ich hatte einen falschen Namen angegeben und eine falsche Identität vorgespielt, was ich geübt beherrschte. Ich war freundlich, aber unverbindlich. Unauffällig. Ich fürchtete Spione, die mich entlarven könnten. Es rächte sich, dass ich im Abendland als Schriftsteller und im Morgenland als Abenteurer und Kämpfer für Gerechtigkeit weithin bekannt war. Ich musste mich tarnen, als wenig erfahrener, wenig gereister Mann, der die weite Welt kaum kannte. Hier an der Reling ließ ich meinen sachte staunenden Blick schweifen, als sähe ich Stambul oder gar überhaupt einen orientalischen Hafen zum ersten Mal. Das Spiel fiel mir leicht: Tatsächlich drangen die Eindrücke sehr heftig auf mich ein,
Warum fühlte ich derart? Ich, der ich den Orient über Jahre am eigenen Leib erlebt hatte und später im Geist noch einmal, als ich meine Erlebnisse niederschrieb. Ich glaubte mich stets ganz und gar vom Orient durchdrungen und somit gegen alle Verwunderung oder Abscheu gefeit, gewissermaßen fühlte ich mich selbst als Teil des Orients, meines Wesens wegen und meiner Profession.
Wie konnte es also sein, dass ich hier, angesichts der Stadt Stambul, eine ungekannte Unsicherheit spürte, die mich mit weißen Knöcheln die Reling umklammern ließ?
Es musste die dreifache Botschaft sein, die ich erhalten hatte. Die Nachricht von einer Hochzeit, welche keine Freude, sondern Sorge auslöste, war ohnehin bedenklich. Die Kunde von der Bedrohung einer ganzen Weltgegend und der Gefahr, in der ein enger Freund sich befand, musste auch den tapfersten und zuversichtlichsten Mann erschüttern.
Und nun empfand ich auch die Rückkehr nach Stambul nicht als glückliche Wiederkunft, wie sie jenem verheißen wird, der in Rom eine Münze in den Trevibrunnen wirft. Mir schien, dass die Stadt und ihre Menschen mir nichts Gutes wollten.
„Obacht!“ – „Fort da!“ – „Aufpassen!“ – „Schneller!“ – „Aus dem Weg!“
All die Rufe, die von der Kaimauer zu mir heraufdrangen, schienen mir zu gelten. Kein freundliches Willkommen. Dabei war mir all dies vertraut:
Ich war vor Jahren zum ersten Mal nach Stambul gekommen, mit meinen Gefährten Halef und Sir David, auf der Spur von Verbrechern, den Entführern und Mördern Abrahim-Mamur und den Brüdern El Amasat. Im Laufe dieses Abenteuers hatten wir den Schurken namens Schut kennengelernt und zur Strecke bringen können. Vermeintlich aber nur, denn später kehrte ich zurück, um mit den gleichen Freunden den üblen Magier Al-Kadir zu stellen und dessen Bruder, just jenen wiederauferstandenen Schut. Letzteren besiegten wir endgültig, den anderen erst Monate später, als wir in den Bergen des Kaukasus hinüber in die Geisterwelt wechselten und dort mit Hilfe der weisen Marah Durimeh den machtgierigen Zauberer vernichten konnten.
Nun sah ich zum dritten Mal Stambul vor mir. Erneut als Ausgangspunkt eines Kampfes gegen Verbrecher und das Böse. Der Feind war eine unbekannte Macht, die noch unheilvoller und gefährlicher war, als es der Schut und Al-Kadir je gewesen waren. Und diese wiederum ließen die Schurken Abrahim-Mamur und El Amasat wie schäbige Straßenräuber und Messerstecher erscheinen.
Das dritte Mal in Stambul.
Aller guten Dinge sind drei, sagt man im Volksmund, wenn man die deutsche Sprache spricht. The third time is the charm, hätte Sir David gesagt. Und damit nicht den bezaubernden französischen charme gemeint, sondern britischen Pragmatismus. Der englische Ausdruck setzt darauf, dass beim dritten Anlauf eine Unternehmung gelingt. Ende gut, alles gut. Doch der Kampf gegen das Verbrechen und das Böse endet nie, das Böse ist ewig und auf einen Verbrecher folgt der nächste. Aber die Verbrechen zu verhindern, welche das Böse gebiert, ist ein Erfolg. Das war das gute Ding im deutschen Sprichwort. Der charm in der englischen Redewendung ist der französischen charme in seiner alten Bedeutung als Zauberspruch. Wie passend!
Meine Rückkehr nach Stambul war auch meine Rückkehr in den magischen Orient.
Und so löste ich den Klammergriff um die Reling und führte die rechte Hand zu meiner Westentasche mit dem Talisman darin: dem magischen Sechseckring, dem Musaddas, der mich die Dinge in ihrer wahren Gestalt sehen ließ, falls sie von Zauberei verschleiert wurden. Und wieder spürte ich jene Gabe, die ich nach dem magischen Schachduell gegen Al-Kadir errungen hatte: Gefahren zu spüren, die nicht von dieser Welt waren. Und mit meinen wachen Sinnen und meiner Menschenkenntnis war ich gewappnet, allen Dunst von Zweifeln und Ängsten zu durchdringen, auch die Täuschungen und Schliche der Gegner.
„Viel Erfolg bei Ihren Geschäften“, brummte eine Stimme im Vorübergehen.
Es war ein beleibter Tuchhändler aus dem Elsass, mit dem ich kurz ins Gespräch gekommen war. Ich selbst hatte mich als Privatier aus Karlsbad ausgegeben und dabei den böhmischen Akzent passabel nachgeahmt. Schließlich liegt Karlsbad bloß einen Katzensprung auf der anderen Seite meines geliebten Erzgebirges. Und um meine Flunkerei noch näher an die Wahrheit zu bringen, hatte ich erzählt, in Istanbul geschäftliche Kontakte mit örtlichen Tabakhändlern knüpfen zu wollen, da ich aus Liebhaberei eine kleine Tabak-Trafik eröffnen möchte. Der türkische Tabak sei ja so beliebt und gelobt wie die türkischen Teppiche und Seidenstoffe, nach denen es den Tuchhändler gelüstete, und dieser hatte genickt.
Auf meinen Reisen rauche ich jeweils jenen Tabak, der lokal angebaut wird. Es geht mir also im Wilden Westen nichts über eine Zigarre aus Virginia, aber davon schwieg ich. Ich schwärmte dem Mann aus dem Elsass vor, wie sehr ich mich freute, den süßen Orienttabak vor Ort zu genießen, statt importierte Ware zu rauchen. Dass ich zu diesem Zeitpunkt, wie auch jetzt, eine Dresdner Zigarette zwischen den Fingern hielt, unterstrich meine Worte. Insgeheim freute ich mich auf Tschibuk und Nargileh, reinen Tabak ohne Papier drumherum.
„Ihnen ebenso“, gab ich zurück und winkte mit der Zigarettenhand. Dann nahm ich einen letzten Zug und warf die halb in Rauch aufgegangene Erinnerung an die Heimat über die Reling. Ich atmete tief den Geruch des Hafens ein, schmeckte dem letzten Rest von klarer Meeresbrise nach, die ich während der Passage genossen hatte, und dachte an die Waldluft von Sachsen, an meinen Schreibtisch am offenen Fenster, durch das die Gartendüfte drangen.
Dann vergaß ich all dies, und schon spürte ich über dem Odor des Brackwassers und der Algen den Rauch der Kohlenfeuer, über dem Kebab briet, und den Rußgeruch der orientalischen Öllampen – die ätherische Schärfe der Gewürze des Orients und die stechenden Dünste der Maultiere und der Menschen – das Rosenwasser und das Räucherwerk. Ich fühlte von Ferne die elektrischen Kräfte des nahenden Gewitters und die mystischen Energien der Zauberei, das Klirren von Klingenstahl und die donnernden Schüsse von Gewehren. Alles war mir Omen und Erwartung. Der Kampf und das Abenteuer konnten beginnen.
Ich schritt die Reling hinab und ließ den Blick schweifen. Auf den Steinen der Mole angekommen, packte ich mein Gepäck fester, als würde ich darum fürchten. Dann ging ich mit leicht schwankendem Gang weiter, als beträte ich nach meiner ersten längeren Seereise wieder den ungewohnt festen Boden. Ich bemühte mich, dieses Schauspiel dezent aufzuführen, um die vermuteten Spione nicht durch eine Schmierenkomödie auf mich aufmerksam zu machen. Auch hatte ich mich wie ein geschickter Mime kostümiert. Weder trug ich die unbedacht gewählte Kleidung eines Europäers, der die Witterung des Orients falsch einschätzt, noch die übertrieben angepasste Ausstattung, bei der Gesicht und Gestik nicht zur Erscheinung passen. Noch weniger hatte ich meine bewährten und robusten Kämpferkleider am Leib, die waren noch in Koffer und Tasche verpackt.
Ich war glattrasiert, als hätte ich mich für den Landgang fein gemacht. Meinen Schnauzbart, den ich in der Heimat zu tragen pflege, hatte ich bereits vor der Einschiffung in Italien abgenommen. Mein orientalischer Vollbart würde erst wachsen müssen, mit nackten Wangen kannte man mich jenseits von Europa kaum.
Mein weiteres Erkennungsmerkmal, die beiden berühmten Gewehre, mein Henrystutzen und der Bärentöter, waren als schwergewichtige Angelruten gut getarnt. Dennoch mochten solche Futterale in den Augen etwaiger Spione auffallen. So hatte ich an Bord beide Waffen zerlegt und auf mein Gepäck verteilt.
Ich spielte vor, dass meine Taschen und Koffer sehr schwer wären, gab den Reiseneuling, der übervorsichtig für alle Eventualitäten gerüstet sein möchte und auch zu viele lieb gewordene, vertraute Dinge in die Fremde mitnimmt. So schwankte ich den diversen Wagen, Kutschen und Karren entgegen, welche für ankommende Reisende bereitstanden. Laut priesen die Lenker und Fahrer ihre Gefährte als die sichersten und billigsten an. Ich mischte mich in die Menge der weiteren Neuankömmlinge, frisch von Bord des Dampfers und ahmte ihre Unentschiedenheit und Skepsis nach. Schließlich schüttelte ich überdeutlich den Kopf und stapfte von dannen, als habe mich der kluge Gedanke ereilt, dass es etwas abseits des Hafengedränges günstigere Transportgelegenheiten zu mieten gäbe.
„Bier Arabaßie Laßimm – Ain Karrän brauchn!“
In steifem, unbeholfenem Türkisch mit schwerem Akzent sprach ich wahllos einige Kärrner und Eselsführer an, ob sie mich zum Hôtel de Pest in Pera bringen könnten und was dies denn kosten würde. Den jeweiligen Wortschwall und die Handzeichen konterte ich mit angestrengtem Gesichtsausdruck, stumm bewegten Lippen und dem Abzählen an den Fingern, gefolgt von Kopfschütteln und trotzigem Weiterstapfen.
„Tschock Maßrafflieh – Fiel zu toier!“
Diese Scharade begann mir zu gefallen, doch ich zügelte mich, sie nicht zu übertreiben. Stattdessen schaute ich mich unauffällig um, ob ich etwa beobachtet würde oder man mich verfolgte. Nein, da war nur ein stattlicher, schwarz gewandeter Herr, wohl ein orthodoxer Pope der griechischen Kirche, der unter seinem hohen Hut einherwandelte. Er nickte mir freundlich zu, und ich fühlte mich willkommen geheißen und begrüßt. Eine angenehme Empfindung in meiner sonstigen Anspannung.
Aber ich durfte nicht unbedacht werden und musste weiter meine Rolle spielen.
Mir schien die Tarnung zu glücken. Als jemand, der sich oft verkleidet und andere beschattet und beschlichen hatte, wusste ich Menschen zu erkennen, die ein Gleiches versuchten. Ich erinnerte mich an die Gespräche mit jenen beiden Amerikanern Fontenoy und Beecher, ersterer ein Pinkerton-Detektiv, der andere ein Agent des Handelsministeriums, die ich hier in Stambul kennengelernt hatte, bei meiner zweiten Jagd auf den Schut durch den Balkan. Die Herren hatten sich sehr überzeugend als Baumwollhändler aus den Südstaaten und dessen Sekretär ausgegeben.
Ein anderer Mann in Staatsdiensten hingegen, mein heikler Freund Bradenham, scherte sich zusammen mit seinem Kompagnon Terbut kaum um Unauffälligkeit und erzielte dennoch famose Erfolge in ihrer beider Profession.
Jener britische Geheimdienstler Smith, der mir auf Zypern entgegengetreten war, mochte mit seinem gewöhnlichen Namen und seiner grauen Kleidung etwas zu bemüht unauffällig gewesen sein. Was daran liegen mag, dass ich mit graugekleideten Briten meinen Freund Sir David verbinde, der das Grau seiner Kleidung durch Karomuster verschönert und zudem eine farbig schillernde Schrulligkeit an den Tag legt.
All diese Erkenntnisse und Bemerkungen habe ich auch jenem jungen Arzt Doyle mitgeteilt, den ich in England unter tragischen Umständen kennengelernt hatte und der ein Interesse am Schreiben von Geschichten hat. Da sich unserem Kennenlernen ein gemeinsames Abenteuer in Persien anschloss, fragte ich ihn hernach, ob er diese Erfahrungen nützen würde, etwa in einem exotischen Reisebericht für britische Leser. Doyle entgegnete:
„Nein, ich plane eher kriminalistische Geschichten, mit Polizisten oder einem Detektiv, der aber Privatmann ist.“
„Also im Stile jenes amerikanischen Dichter Poe. Hat er diese Art der Erzählung nicht begründet? Allerdings mit einem Franzosen als Hauptfigur.“
„Auf diese Idee käme ich kaum. Es sollte in London spielen. Und nicht in anderen Weltgegenden. Und nicht mit mir als Helden. Ich will Ihnen doch keine Konkurrenz machen.“
Nun, das wird ihm kaum gelingen, denn er wird nie erleben, was ich erlebt habe. Doyle muss für seine literarischen Ergüsse allein aus seiner Phantasie und der Erfahrung anderer schöpfen und beides geschickt konstruieren, mit ein wenig Zufall als Kleister.
Auch erdachte Unterhaltung spiegelt trefflich das wahrhaftige Leben, dort mischen sich alle Sparten der Dramatik, sei es Tragödie oder Komödie, und vielerlei andere Facetten, wie im Varieté und Vaudeville, in wilder Buntheit und mit unerwarteten Wundern.
Und durch eine solche Schatzkammer bewegte ich mich, als ich durch Stambul schritt, das mir gleichermaßen vertraut und fremd erschien, und ich war sowohl derselbe wie stets als auch ein anderer in Aussehen und Benehmen. Noch musste ich meine Tarnung aufrechterhalten.
Die Straßen und Gassen wandelten sich. Der Hafen lag hinter mir, die Gerüche von Meerwasser und Schiffsmaschinen waren dem Parfüm der Metropole gewichen, auch die Menschen ringsum waren keine Reisenden, Fernhändler und Hafenarbeiter, sondern Handwerker, Krämer und Hausfrauen, die Geschäften und Besorgungen nachgingen. Es musste eine Kirche in der Nähe sein, denn ich sah einen weiteren Popen meinen Weg kreuzen, der mir wiederum freundlich zunickte. Es war ein anderer als zuvor.
Niemand, den ich am Hafen bemerkt hatte, war hier zugegen, selbst wenn ich davon ausging, dass etwaige Spione und Späher sich abgewechselt hatten. Niemand beobachtete mich, ich wurde nur als das beschaut, was ich darstellte, nämlich ein unbedarfter Reisender. Ich wusste, dass ich nun ein Gefährt mieten musste, um nicht aufzufallen, denn so tief in das Alltagsleben wagte sich gemeinhin kein Ortsfremder.
Ich hingegen kannte mich prächtig aus, war hinter der Neuen Moschee über die Galata-Brücke marschiert, mit dem vertrauten Turm dieses Stadtteils als Wegzeiger. Hinter diesem zogen dunkle Wolken auf: das Gewitter, das ich gespürt hatte. Bald würde ein Schauer über Stambul niedergehen. Auch über den Stadtteil Sariyer, in dem Tarabiye lag, das Viertel mit der Sommerresidenz der britischen Botschaft, wo mich Henry Layard erwartete, samt Qendressa, seiner frisch und verwunderlich angetraute Ehefrau. Ein weiter Weg bei drohendem Regen. Ich hätte längst einen Wagen nehmen können oder einen Fährkahn entlang des Bosporus. Doch ich spazierte weiter durch Stambul. Die Beinarbeit tat mir wohl nach der langen Zeit mit Decksplanken und Seegang. Zudem musste ich wieder ein Gefühl für den Orient und die Metropole bekommen. All dies am heimatlichen Schreibtisch nachzufühlen, kommt einem wahrhaftigen Erleben kaum nahe, auch wenn man dergleichen gut erinnert.
Kurz beschlich mich der Gedanke, ob ich das Treffen mit dem Botschafter und der einstigen Hexe hinauszögern wollte. Nein, Zaudern und Zögern sind mir fremd. Ich wollte den beiden Menschen und den kommenden Planungen und Taten mit frischem Geist und erholtem Leib entgegentreten. Ich bin niemand, der sich nach einer Reise zum Ruhen niederlegen mag. Wenn das innere Räderwerk funktionieren sollte, musste man auch die innere Feder aufziehen, und das gelang nur mit Bewegung, nicht beim Sitzen in Kutsche oder Kahn, noch weniger auf dem Kanapee.
Auch geistig wollte ich mich erfrischen und so schaute ich im schwindenden Schatten des Turms von Galata nach einem Kahwehane, dem Laden eines Kaffeesieders, um einen belebenden Trank zu mir zu nehmen. Ich befürchtete nicht etwa, in der britischen Botschaft nur Tee mit Milch serviert zu bekommen; mir war schlicht nach einem kräftigen orientalischen Trunk.
Ich betrat die saubere, helle Stube, die dem Kaffeewirt als Ladenlokal diente, und sog erfreut den Duft der just gebrannten Bohnen ein. Ich suchte mir einen der niederen Tische mit Blick zum Eingang, nahm Platz, verstaute mein Gepäck zwischen der Wand und mir und bestellte bei dem heranschlurfenden Burschen Kaffee und Wasser. Der schaute verdutzt, da ich in leisem, aber perfektem Stambuler Türkisch mit ihm sprach, was er angesichts meiner Kleidung und meines Gepäcks nicht erwartet hatte. Er erkannte also, dass er mich nicht übervorteilen oder übers Ohr hauen konnte, weder bei der Qualität des Ausgeschenkten noch bei der Rechnung. Nun, vielleicht wagte er dergleichen auch nicht, weil ein streng gekleideter und streng wirkender griechischer Priester in einer Ecke saß. Griechen und Osmanen mögen einander geringschätzen, doch in der Liebe zum Kaffee sind sie verbunden. Ähnlich wie Franzosen und Deutsche beim Wein. Ich nickte dem Popen freundlich zu. Es war ein anderer als die beiden zuvor. Ja, es gab etliche orthodoxe Kirchen in Stambul.
Während ich auf meine Bestellung wartete, bemerkte ich, dass dies kein schlichtes Kahwehane war, sondern ein Kiraathane, ein Lesekaffeehaus. Es lagen einige türkische und internationale Zeitungen aus. Ich griff zu einem Istanbuler Blatt, um mich über die aktuellen Ereignisse zu informieren. Druckerzeugnisse im Osmanischen Reich sind weniger dafür gemacht, politische Geister zu erhellen oder schriftliche Opposition zur Hohen Pforte zu üben. Vielmehr soll die Bevölkerung zum Lesen angehalten werden, und dies schließt das Lesenlernen mit ein. So finden sich vorrangig unterhaltsame Artikel in einer solchen Zeitung. Jüngst hatte ich erfahren, dass die Pressefreiheit der Verfassung in diesem Jahr durch die Gründung einer Zensurkommission eingeschränkt worden war. Aber mit harten politischen Erkenntnissen würden mich sicher bald Botschafter Layard und der britische Geheimdienst versorgen. Da konnte ich mich zur Einstimmung auf Stambul mit etwas Klatsch und Tratsch begnügen. Ich nippte an meinem höllisch heißen und herrlich süßen Kahwe, der mir zunächst die Zunge erweckte, bevor er Leib und Geist munter machte. Draußen schwand der Sonnenschein, ein ferner Donner rollte und ein leichter Wind drängte durch die Gasse, wirbelte den Staub auf. Bald würde das Pflaster vom Regen reingewaschen werden.
Ich nahm die Zeitung wieder auf und wollte die nächste Zeile lesen, als ich am anderen Ende des Raums einen Mann bemerkte – und dieser war mir wohlbekannt!
Zweites Kapitel
Wundersames Wiedertreffen
Über den Rand der Blätter hinweg musterte ich den stattlichen älteren Herrn. Zweifellos – es war Maflei, der reiche Händler, Vater von Isla Ben Maflei und Bruder von Jacub Afarah. Welch ein Zufall, ihn hier und jetzt zu treffen. Als ich mich am Hafen an frühere Abenteuer erinnerte, hatte ich auch an ihn gedacht, denn die einst von mir gejagten Verbrecher hatten die Braut seines Sohnes entführt. Ich und meine Gefährten vermochten seinerzeit alles zu einem glücklichen Ende zu bringen.
Die jetzige Begegnung mit Maflei schien mir nach erster Verwunderung durchaus schlüssig. Sein Domizil lag jenseits der Galata-Brücke, nahe der Neuen Moschee. Warum sollte er nicht dann und wann hierher spazieren, zu Kaffee und Lektüre?
Maflei wirkte entspannt und zufrieden, wie er da so saß und las und trank. Es schien ihm wohlergangen zu sein in den vier Jahren, seitdem ich ihn zuletzt getroffen und in seinem Gartenhaus hatte zu Gast sein dürfen. Belustigt bemerkte ich, dass er sich den Bart gefärbt hatte, denn die damals deutlichen grauen Strähnen waren verschwunden. Er hatte auch etwas zugenommen, denn ich sah weniger Falten in seinem Gesicht. Die Geschäfte liefen wohl gut, Sorgen schien er keine zu haben. Nein, er lächelte sogar vor sich hin.
Sollte ich zu ihm hinübergehen und einen Gruß entbieten? Wie weit musste, sollte, durfte ich meine Geheimhaltung betreiben?
Während ich noch in meiner Entscheidung wankte, öffnete sich die Tür und mit einem Schwall kühler Luft und Sprühregen kam ein weiterer Gast herein. Draußen ging ein lauter Schauer nieder. Drinnen stand ein junger Mann mit deutlicher Ähnlichkeit zu Maflei, und ich kannte seinen Namen: Es war Isla Ben Maflei, der Sohn Mafleis.
Mit jugendlichem Ungestüm, trotz seiner dreißig Jahre, und unbekümmert darum, dass er nass war wie eine Katze, ließ er sich neben seinem Vater nieder, rief nach Kahwe und strahlte Maflei an, während er auf die Zeitungen tropfte, die auf der Tischplatte lagen.
„Vater“, begann er. „Ich habe einen Ring für meine Liebste gekauft! Jetzt kann ich bei ihrem Vater um ihre Hand anhalten.“
Ich stutzte. Isla war doch bereits verheiratet, und zwar mit eben jener hübschen Senitza, die vor sechs Jahren durch Barud El-Amasat nach Ägypten entführt und im Harem Abrahim-Mamurs gefangen gehalten worden war. Ich war damals Isla begegnet, hatte von seiner Not erfahren und war nach etlichen Abenteuern imstande gewesen, die junge Frau zu befreien, um sie als Braut in die Hände des jungen Kaufmanns zu geben. Und nun wollte Isla eine weitere Dame freien? Was war geschehen? War das gnadenlose Schicksal so um Ausgleich bedacht, dass es wegen der Eheschließung von Henry Layard und Qendressa die Scheidung von Isla Ben Maflei und Senitza erzwungen hatte? Oder war das bedauernswerte Geschöpf, deren Name Augapfel bedeutete und die in Ägypten Güzela, die Schöne, genannt worden war, vom Tod dahingerafft worden? Es musste in den vergangenen vier Jahren geschehen sein, seit ich Maflei das letzte Mal getroffen hatte, was je nachdem einen angemessenen Zeitraum der Trauer ergeben hätte; dennoch befremdete mich das Verhalten des Mannes, der sich wie ein schwärmender Junggeselle benahm.
„Schau, Vater“, sprach Isla Ben Maflei weiter und zog ein Kästchen aus seiner Kleidung, gerade groß genug, um als Schatulle für einen Ring zu dienen, und fein gearbeitet, mit reichen Intarsien, wie ich selbst quer durch den Raum erkannte.
Isla öffnete das Kästchen und hielt es Maflei hin. Der begutachtete nickend das Schmuckstück.
„Nun, Junge, der Ring ist wohl etwas dünn, aber die Perle ist prächtig. Das scheint mir passend für deine Liebste. Gold ist kaltes Metall, aber eine Perle ist ein Wunder der Natur. So wie deine künftige Braut.“
„Du verstehst mich, Vater.“ Isla schaute entrückt und begann zu schwärmen. „Oh, sie ist schön wie die Rose und herrlich wie die Morgenröte; sie duftet wie die Blüte der Reseda, und ihre Stimme klingt wie der Gesang der Houris. Ihr Haar ist wie der Schweif des Pferdes Gilja, und ihr Fuß ist wie der Fuß von Delila, welche Samson verriet. Ihr Mund träufelt von Worten der Güte, und ihre Augen …“
Maflei lächelte. „Ich weiß, mein Sohn, diese Worte hast du schon oft gebraucht, um sie zu beschreiben.“
Allerdings, dachte ich. Mit diesen Worten hatte mir Isla in Ägypten das Aussehen von Senitza geschildert, bis ich ihn bat, mir nüchternere und eindeutigere Erkennungszeichen der Entführten zu beschreiben. Dem heutigen Isla war ich gram, dass er seine neue Braut mit den gleichen blumigen Begriffen bedachte. Und wieder hatte er einen Perlenring gekauft. Ich fühlte das Andenken Senitzas, die ich durchaus liebgewonnen hatte, überaus beschmutzt.
Ich rang mit mir. Vor wenigen Herzschlägen noch hatte ich zu Maflei und seinem Sohn hinübergehen wollen, um sie zu begrüßen und das zufällige Wiedersehen zu feiern. Aber nun war da das Schicksal Senitzas, welches das Treffen vergällte. Ich wollte besser noch einige Augenblicke hinter meiner Zeitung verborgen lauschen.
„Ich kann es kaum erwarten, Vater“, sprach Isla Ben Maflei. „Nächste Woche reise ich wieder nach Skutari, um sie zu sehen. Das werden mir lange sieben Tage werden.“
Nun denn, dachte ich, der Freiersmann bleibt sich treu. Auch Senitza stammte aus Skutari, im Land der Skipetaren. Ihr Vater war der Montenegriner Osko, der sich damals mir und Halef angeschlossen hatte, um Barud El-Amasat zu jagen. Osko hatte den Entführer seiner Tochter schließlich in die Teufelsschlucht stoßen können. Ich hoffte inständig, dass sich Osko und Isla Ben Maflei nicht in Skutari begegneten, wenn der junge Mann seine neue Braut besuchte. Wer wusste, wie der frühere Schwiegervater dies aufnehmen würde?
„Ich hoffe“, seufzte Isla, „dass ihr Vater meinem Wunsch entspricht und mir Senitza zur Frau gibt. Osko ist ein recht strenger Mann.“
Ich atmete scharf ein. Konnte es wahrhaftig einen solchen Zufall geben, dass Isla in Skutari eine weitere Frau mit dem Namen Senitza kennengelernt hatte, deren Vater wiederum ebenfalls Osko hieß? Würde dieser unglaubliche Lauf des Schicksals erklären, warum Isla sich so verhielt, wie ich es soeben erlebt hatte? Und auch sein Aussehen war bemerkenswert. Kein Schmerz von Scheidung oder Witwertum war zu erkennen, er wirkte wie der Bursche von Mitte Zwanzig, den ich in Ägypten kennengelernt hatte, vor sechs Jahren. Damals war er trotz seiner Erfolge als Kaufmann – das Geschick hatte er von seinem Vater geerbt – in Begleitung seines Dieners aufgetreten, eines leichtsinnigen Gesellen namens Hamsad al Dscherbaja, der keinen guten Einfluss auf seinen Herren hatte. Dieser Hamsad hatte Isla später bestohlen, wurde entlassen und verfiel dem Opium. Ich hatte ihn in Stambul wiedergesehen, wo er mir bei der Jagd auf Abrahim-Mamur helfen wollte, sozusagen als Wiedergutmachung. Doch als er den Verbrecher belauschen wollte, wurde er entdeckt und erdolcht. Sein Schicksal dauerte mich, zumal er sich als ein Landsmann herausgestellt hatte: Der Mann, der den Namen Hamsad al Dscherbaja getragen hatte, war ein Barbier aus Jüterbog in der preußischen Provinz Brandenburg gewesen. Ich sah ihn noch vor mir, mit den weiten blauen Pumphosen, der blauen Jacke und dem Fez auf dem Kopf. Und darunter ein Mund, aus dem passables Türkisch wie auch breites Brandenburgisch klingen konnte. Wie hatte er doch gleich seinen Herrn Isla beschrieben? Hat schauderhaftes Jeld, dat Kerlchen.
Ich hoffte, Isla würde nun einen weniger eigentümlichen und wankelmütigen Diener in Diensten haben.
Maflei räusperte sich: „Ja, Osko ist nicht nur streng, sondern auch fromm. War er nicht Christ?“
„Ja, und deshalb habe ich für ihn als Gastgeschenk etwas Passendes besorgt. Eine kleine byzantinische Ikone. Ich habe sie billig erstanden und aufarbeiten lassen. Während ich beim Schmuckhändler war, habe ich Hamsad gesandt, sie abzuholen. Er sollte uns hier treffen – ah, da kommt er schon.“
Ich hatte den genannten Namen kaum verstanden, da öffnete sich erneut die Tür. Draußen regnete es noch stärker, und ein in schlichtes Blau gekleideter Mann kam herein, mit einem flachen, gut verschnürten und tüchtig durchnässten Paket in der Hand. Er hatte es zweifellos als Regenschutz genutzt und erst kurz vor dem Kaffeehaus heruntergenommen.
„Hamsad“, rügte Isla, „wie kannst du die Mutter des himmlischen Gesandten Issa Ibn Maryam als Schutzdach benutzen! Zeige doch etwas Respekt, liederlicher Bursche!“
Der so Gescholtene verzog das Gesicht, wischte halbherzig mit dem Ärmel über das nasse Packpapier und dienerte. „Ja, Herr.“ Dabei rollte er heimlich mit den Augen. Und ich hörte deutlich, wie er murmelte: „Hurrjees, hab dir nich so ...“
Und all dies nicht nur auf Deutsch, sondern mit brandenburgischem Zungenschlag!
Ich sprang auf. Mein Tisch rumpelte, die Kaffeeschale und das Wasserglas klirrten gegeneinander. Maflei, Isla und Hamsad al Dscherbaja aus Jüterbog – denn niemand anderer war es – schauten erschrocken in meine Richtung, während der Kaffeeschenk – es war ein anderer als zuvor – eilig herankam, um zu schauen, was dem Gast denn nicht recht sei.
Die drei Männer, die ich wohl kannte und von denen einer tot sein musste, denn ich hatte ihn mit eigenen Augen an seiner Messerwunde sterben sehen, starrten mich an – ohne jedes Erkennen.
Ich begriff: Es war wohl mein fehlender Bart.
„Ich bin es“, rief ich, in der Hoffnung, dass sie meine Stimme erkannten, doch sie schauten mich weiterhin an, als sei ich ein völlig Fremder.
„Noch einen Kahwe, der Herr?“, dienerte der Kaffeeschenk in gebührendem Abstand, da er mich wohl für verrückt hielt. Auch auf den Gesichtern von Maflei, Isla und Hamsad bildete sich ein ähnlicher Ausdruck.
„Ich bin es“, wiederholte ich. „Kar …“
Dann drang ein Donnerschlag von draußen herein, ich zuckte zusammen und fiel auf meinen Sitz zurück. Die Zeitung, die ich in der Hand gehalten hatte, flatterte in meinen Blick. Die arabische Datumszeile sprang mir ins Auge. Das Jahr lautete in westlicher Zeitrechnung 1872. Das war vor sechs Jahren gewesen. Doch bevor ich zweifeln konnte, ob ich eine alte Zeitung vor mir hatte oder eine Vision der Vergangenheit erlebte, verschwamm die Zahl und wandelte sich: 1871, 1869, 1870, 1868, 1873 – ich konnte die Ziffern nicht mehr fassen. Das Titelblatt der Zeitung verwischte und zeigte andere Schlagzeilen und Artikel. Auch die Kaffeeschenke veränderte sich, verschwamm vor meinen Augen, Menschenschemen glitten einher, das Licht verwandelte sich von Sonnenschein zu Lampenflammen. Ich ächzte und hob die Hand vor die Augen, mir schwindelte.
Es donnerte erneut. Ich fühlte mein Innerstes in einem Krampf zusammengepresst, die Luft aus den Lungen gedrückt. Dann war es vorüber.
Ich saß in dem Kiraathane, vor mir eine halb gefüllte Schale noch immer dampfenden Kaffees. Draußen begann es leise zu regnen. Ich war allein in dem Raum. Auch der Pope war fort. Der Platz, an dem Maflei gesessen hatte, war leer, die Zeitungen unberührt und trocken. Auch Isla und Hamsad waren nicht mehr dort – oder waren es nie gewesen.
Meine Hand zitterte.
Was war geschehen?
Drittes Kapitel
Stadtflucht
„Ist alles recht, der Herr?“, fragte der Kaffeeschenk, der mir den Kahwe gebracht hatte. Es war nicht jener, der neben mir gedienert hatte. Mir war nicht klar, ob die Bedienung erneut gewechselt oder sich – gewandelt hatte.
Ich starrte ihn an und deutete durch den Raum.
„Waren da eben nicht drei Männer?“
„Es waren zwei dort, kurz bevor ihr eingetreten seid“, antwortete der Mann bedächtig.
„Bist du der Einzige hier?“
„In der Küche ist der Kaffeekoch und ein Knabe, der …“
„Sind die Zeitungen neu?“ Ich fuhr mit der Hand durch die Blätter.
„Gewiss, der Herr“, entgegnete der Mann pikiert. „Nur die neuesten Nachrichten, wir sind ein gutes Haus!“
„Ich zweifle nicht daran“, sagte ich eilig und freundlich, während ich an mir selbst zweifelte. „Bring mir noch einen Kahwe, er ist sehr gut.“
„Wie Ihr wünscht.“
„Und Wasser. Und bring mir ein frisches Mundtuch.“ Ich musste allein nachdenken, ohne den Mann neben mir.