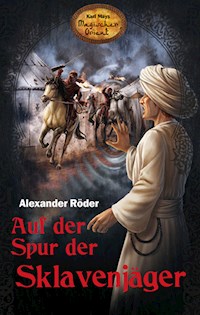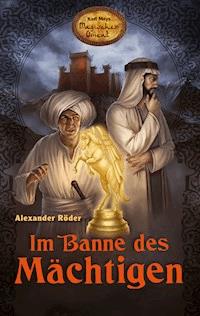Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl-May-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Karl Mays Magischer Orient
- Sprache: Deutsch
Die Jagd nach dem finsteren Magier Al-Kadir führt Kara Ben Nemsi und seine Gefährten ins wilde Kurdistan - und noch darüber hinaus, denn ihr Widersacher verbirgt sich in der Geisterwelt. Von dort bedroht dieser nicht allein seine Verfolger, sondern will weitere schreckliche Pläne in die Tat umsetzen. Kann Kara Ben Nemsi auf Beistand von alten Verbündeten wie Nedschir-Bey hoffen? In den Bergen entdecken die Helden die ersten Zeichen einer Gefahr, die nicht von dieser Welt zu sein scheint - stammt sie von Al-Kadir oder einem neuen Gegner? Und auch die Hexe Qendressa ist noch immer eine Bedrohung. Im Kampf gegen die Feinde benötigt Kara Ben Nemsi das Wissen von Marah Durimeh - doch der Ort, an dem sich die weise Frau aufhält, ist ein Geheimnis ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 4
Alexander Röder
Die Berge derRache
KARL-MAY-VERLAGBAMBERG • RADEBEUL
Herausgegeben vonThomas Le Blanc und Bernhard Schmid
In der Reihe „Karl Mays Magischer Orient“ sind bisher erschienen:
Band 1 – Alexander Röder Im Banne des Mächtigen
Band 2 – Alexander Röder Der Fluch des Skipetaren
Band 3 – Alexander Röder Der Sturz des Verschwörers
Band 4 – Alexander Röder Die Berge der Rache
Thomas Le Blanc (Hrsg.) Auf phantastischen PfadenEine Anthologie mit den Figuren Karl Mays
Weitere Informationen zur Reihe „Karl Mays Magischer Orient“ finden Sie im Internet aufwww.magischer-orient.karl-may.de
© 2017 Karl-May-Verlag, Bamberg
Alle Urheber- und Verlagsrechte vorbehalten
Illustration: Elif Siebenpfeiffer
Umschlaggestaltung: Petry & Schwamb, Freiburg
eISBN 978-3-7802-1404-1
www.karl-may.de
Inhalt
Erstes Kapitel Das schwarze Schiff
Zweites Kapitel Die Teuta
Drittes Kapitel Zwei Leibhaftige
Viertes Kapitel Jenseits von Trapezunt
Fünftes Kapitel Das Gallapfelhaus
Sechstes Kapitel Ein fremder Freund
Siebtes Kapitel Jagdgrauen
Achtes Kapitel Verrat und Verbannung
Neuntes Kapitel Ein Bote
Zehntes Kapitel Drei Gaben
Elftes Kapitel Die Beute des Jägers
Zwölftes Kapitel Im Zagros
Dreizehntes Kapitel Vom Himmel hoch
Vierzehntes Kapitel Ein Zwiegespräch
Fünfzehntes Kapitel Flucht und Flügel
Sechzehntes Kapitel Höhlenrast
Siebzehntes Kapitel Der rote Feind
Achtzehntes Kapitel Unheil und Hoffnung
Neunzehntes Kapitel Die Quellen von Mehabad
Zwanzigstes Kapitel Die Faghragha
Einundzwanzigstes Kapitel Marah Durimeh
Zweiundzwanzigstes Kapitel Geistergespräche
Dreiundzwanzigstes Kapitel Der Weg zum Sangesur
Vierundzwanzigstes Kapitel Trennung und Übergang
Fünfundzwanzigstes Kapitel Durch die Fremde
Sechsundzwanzigstes Kapitel Die Herrin der Schatten
Siebenundzwanzigstes Kapitel Die Berge des Simurgh
Achtundzwanzigstes Kapitel Streiter auf Schwingen
Neunundzwanzigstes Kapitel Der Ring der Drei
Dreißigstes Kapitel Das Ende der Hexe
Erstes Kapitel
Das schwarze Schiff
Über dem Schwarzen Meer tobte ein Sturm und peitschte die finsteren Fluten unter den düsteren Wolken einher. Es ging auf Mitternacht zu und die Blitze sandten ihren irrlichternden Schein auf das Deck des Dampfschiffs, welches durch die Dünung stampfte. Der Sturm war noch um einiges entfernt, doch die Regungen der Elemente wirkten bereits kraftvoll auf den eisernen Rumpf ein, ließen ihn wanken und schwanken, aber die mächtige Maschine hielt das Schiff auf Kurs, und Bug und Kiel schnitten schnell durch das dunkle Wasser.
Ich stand an der Reling und atmete die von Gischt durchsprühte Luft ein, während der Wind an meiner Öljacke zerrte. Es war ein herrliches Gefühl! Nach den staubigen Landstraßen des Balkan, den trockenen Schründen der Berge, den von Sommersonne durchglühten Tagen im Sattel genoss ich diese Überfahrt, die mich und meine Gefährten von Istanbul aus an die östliche Küste jenes Binnenmeers bringen sollte, welches auf Türkisch Karadeniz hieß, was eben Schwarzmeer bedeutet und somit mit jenem Namen korrespondiert, welchen ich auf meinen Reisen im Orient zu tragen pflege.
Mein Gefährte Halef, der sich neben mir an Stangen und Taue klammerte, hatte jedoch gar nichts Schwarzes an sich, zumindest oberhalb des dunkelnass glänzenden Ölzeugs: Sein Gesicht war fahl und bleich im dann und wann aufgrellenden Gewitterlicht, und seine Miene zeigte nichts von dem, was ich empfand, sondern nur Unwohlsein und Ungemach.
Ich selbst und meine Leser hätten nun erwartet, von Halef einen launigen, vielleicht etwas klagenden Satz zu hören, der mit „O Sihdi“ beginnen würde; allein, Halef schwieg, weil er sich nicht getraute, den Mund zu öffnen, und dies lag nicht daran, dass er etwa befürchtete, mit der Gischt einen aus dem Meer geschleuderten Schwarzmeerfisch zu verschlucken. Nein, der gute arme Halef war ein wenig seekrank und schlaflos noch dazu, weswegen er sich um diese späte Stunde zu mir an Deck gesellt hatte. Ich wusste, dass er Haschim beneidete, der in seiner Kabine selig schlief. Ob diese Ruhe im Sturm dem edlen und klugen Mann, der unser Freund war, nun gegeben sein mochte, weil er als Scheik mit seinem Körper und seiner Seele im Einklang war, oder ob es doch daran lag, dass er ein Zauberer, ein Magier war, das mochte ich kaum entscheiden. Es gab schließlich auch sehr irdische Mittel, um sich einen gesunden und tiefen Schlaf sogar bei widrigen Umständen zu ermöglichen. Selbst ich, der ich kein Arzt oder Apotheker war, wenngleich ich auf meinen Reisen oft für einen solchen gehalten worden war, wegen meines kleinen Vorrats an Heilmitteln und weil der Orientale einen Europäer, insbesondere einen Franken, einen Deutschen, gern für einen Arzt hält – aus welchen Gründen auch immer – selbst ich also kannte genug Pülverchen und Tinkturen und Kräuter, die einen erholsamen Schlummer befördern. Manche greifen natürlich zu einem tüchtigen Schluck eines jener starken Getränke, die man auch geistige nennt – doch ist dies dem frommen Moslem, wie mein Freund Halef einer ist, ja durch seinen Glauben verwehrt, was nichts weniger als klug ist. Jene Männer jedoch, die der Religion der Seefahrt anhängen, trinken allzu gerne ihren Rum, vielleicht mit etwas heißem Wasser als Grog, und so schlafen sie stets prächtig, wenn sie es denn dürfen, also auf Freiwache. Was nicht heißt, dass jene, die Dienst versehen müssen, nicht auch einen ordentlichen Trunk zu sich genommen hätten, zumal in einer kühlen Gewitternacht auf dem Schwarzen Meer.
Die Matrosen, die ich als schwarze Schemen zwischen den Schatten der beiden Masten und des Schlotes erkennen konnte, hatten sich allerdings nicht mit karibischem Rum von innen gewärmt, sondern mit russischem Wodka; denn jenes Schiff, die „Knjas Korowjew“, also Fürst Korowjew, war ein Parochod der Russischen Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel, im russischen Faible für Abkürzungen auf Russisch auch ROPiT genannt. Diese Reederei aus Odessa ist erst vor knapp zwanzig Jahren auf Betreiben Zar Alexanders gegründet worden, stellt aber mit ihren über sechzig Schiffen bereits ein äußerst wichtiges Unternehmen im Seehandel zwischen den Reichen Russlands und der Osmanen dar. Die Frachter selbst entstammen englischen und französischen Werften, was davon zeugt, dass selbst ein solch schreckliches Ereignis wie der Krieg auf der Krim rasch vergessen ist, wenn es um internationale Geschäfte geht. Aber ich will nicht moralisieren. Auch wenn ich ein Mann des Sattels bin und einen geschwinden Ritt schätze, so war ich doch zufrieden, die Strecke zwischen Bosporus und Kaukasus nicht auf dem Landweg zurücklegen zu müssen, denn es eilte durchaus. Meine Gefährten und ich hatten zwar unseren alten Feind, den Schut besiegt und sein Reich des Unrechts und der Ausbeutung zerstört, doch nun waren wir auf der Jagd nach jener Frau, die dem Schurken gedient und uns alle getäuscht und betrogen hatte: der Hexe Qendressa. Diese war vor uns geflohen, oder nein, ich will ehrlich sein: Sie hatte uns geschmäht und war ihrem weiteren Plan gefolgt, den Lohn für ihre Dienste und ihren Verrat einzufordern, und zwar bei des Schuts Bruder, dem Schwarzkünstler Al-Kadir, welchen sie aufzusuchen gedachte. Dass dieser tot war und nun in jenen überirdischen Gefilden herrschte, die von Anhängern der Magie das Geisterreich genannt wurden, war eine andere Sache. Mir waren diese Dinge allzu suspekt, zu nahe am Aberglauben und gauklerhaftem Geraune. Dennoch hatte ich in den vergangenen Monaten bei meinen jüngsten Reisen und Abenteuern so manches erlebt und geschaut, das sich nicht mit dem nüchternen Verstand eines modernen, von Wissenschaft und Technik geprägten Menschen erklären ließ. Nun aber, nach den Erlebnissen mit Al-Kadir, vor allem aber dem Schut und seinen Helfershelfern, war ich mir nicht mehr sicher, ob ich damals nicht auf eine gewisse Weise blind gewesen war – und nicht hatte sehen wollen, an was ich nicht glauben mochte. Doch mein kluger kleiner Freund Halef hatte einmal weise gesagt:
„Man muss an das glauben, was man sehen will, Sihdi.“
Ich meinte damals, dass sich dies nur auf den religiösen Glauben beziehe, obwohl man auch sagen könnte, dass es sich mit der Wissenschaft ähnlich verhält. Doch dass es auch auf Magie und Zauberei zuträfe und auf die Wesen und Gestalten der Fabeln und Märchen, das hätte ich kaum für möglich gehalten. Aber haben frühere Generationen nicht auch Blitz und Donner für ein Spektakel der Überirdischen gehalten? Heute wissen wir, um was es sich wirklich handelt: um elektrische Entladungen in den Dunstkreisen des Himmels, also dem, was der Meteorologe eine Atmosphäre nennt. Vielleicht verbarg sich hinter der Magie und Zauberei ja auch etwas anderes, so wie das vormals göttliche Donnergrollen am Ende nur die Elektrizität des Himmels war.
Deshalb stand ich an Deck des Dampfers und spürte mit Genugtuung das Stampfen der Maschinen im Leib des Schiffs und das Bäumen und Gieren des Rumpfes im Kampf mit den Wogen, und den Wind und den Regen. Diese Dinge trogen nicht, sie waren wahr und wahrhaftig und ließen sich weder auslegen noch diskutieren oder hinterfragen. Mochte die von uns Gejagte eine Hexe sein, mochte der, den sie finden wollte, ein Magier in der Geisterwelt sein – am Ende verfolgten wir eine ganz menschliche Verräterin. Und ich will nicht selbstgerecht und grausam klingen. Ich wusste wohl, dass diese Frau mich und uns zwar betrogen hatte, aber von den Verbrechern ihrerseits betrogen worden war und für sich selbst wiederum Rache und Gerechtigkeit forderte – jedoch nicht gegenüber uns. Wir würden mit unseren eigenen Ansprüchen auf Gerechtigkeit und Rache sehr weise umgehen müssen. Und so war ich froh, dass uns Abdi auf dieser Reise nicht begleitete, sondern in Istanbul geblieben war. Er war von der Hexe entführt und verletzt worden – und hatte ihr blutige Rache geschworen. In den Wochen danach war sein Zorn auch durch unsere besänftigende Gegenwart verraucht, doch ich wollte nicht, dass er sich zu unbedachten Taten hinreißen ließ. Mit einem allzu wütenden Gefährten ist schlecht reisen und kämpfen. Deshalb hatte er mein ernstes Versprechen angenommen, dass wir für Sühne sorgen würden. Ich glaubte ohnehin, dass Abstand zu all jenen Geschehnissen für den jungen Koch heilsamer wäre, als wenn er sich die Hände mit Blut und die Seele mit Sünde befleckte.
Warum reisten wir also gen Osten, mit Ziel Kurdistan? Weil Haschim Kunde davon hatte, dass sich in dieser Weltgegend der vom Balkan aus gesehen nächstgelegene Ort befand, an dem ein Portal in die Welt der Geister führte, und dieser somit das Ziel der Hexe sein musste, die Al-Kadir aufsuchen wollte. Doch es hatte sich noch eine andere Sache herausgestellt, die mich, der ich auf meinen Reisen mit glückhaften Begegnungen und Wendungen des Schicksals so meine Erfahrungen gemacht habe, nun wahrlich wenig verwunderte. Haschim hatte von einer weisen, alten Frau gesprochen, die im Lande der Kurden lebte und die wohl wissen müsste, wo genau sich das Portal befinde. Bei dieser Beschreibung hatte ich aufgemerkt und mir war sogleich das Bild jener weisen Greisin vor Augen gestanden, die ich bei meinem ersten Besuch im wilden Kurdistan vor zwei Jahren kennengelernt hatte.
„Ihr meint doch nicht etwa Marah Durimeh?“, hatte ich zu Haschim gesagt.
„Ja, Kara Ben Nemsi …“, hatte dieser zögerlich zurückgeben. „Ihr kennt sie auch …?“
Über diese Verwunderung war ich amüsiert gewesen – angemessen und freundschaftlich.
„O ja“, hatte ich erwidert.
Und dann hatten wir beide gelacht, als Halef meinte:
„Da sagen manche, wie klein doch die Welt ist! Aber ich weiß das längst, weil ich mit meinem Sihdi so viel gereist bin.“
Und nun stand eine weitere Reise an!
Wir fuhren also über das Schwarze Meer, um uns nach Landung an seinen östlichen Gestaden in die Wüsten und Gebirge des Kurdenreichs zu begeben. Dort würden wir den Rais von Schohrd aufsuchen und dessen Tochter Ingdscha, die eine Vertraute Marah Durimehs war und wohl um deren Aufenthaltsort wissen würde. So zumindest hatte ich es damals erlebt, in jener wundersamen Episode um den Ruh-i-Kulyan, den Geist der Höhle. Wer diese noch nicht kennt, kann sie in meinen Gesammelten Werken nachlesen, welche sich wohlfeil und schön gebunden erwerben lassen, meinem Verleger im malerischen Bamberg zur Freude.
Vielleicht las auch mein Freund und Mitstreiter Sir David Lindsay in dieser Stunde eines jener Bücher, in seiner prächtigen Privatkabine an Bord seiner ebenso prächtigen Privatjacht, die ihn gerade über das Mittelmeer hinweg zurück zu den heimatlichen britischen Inseln trug. Denn der Lord wollte endlich seinen Schatz, das goldene und silberne Schachpiel Al-Kadirs, in die Sicherheit seiner eigenen hochherrschaftlichen Wände bringen. Wie gut also, dass Sir David nicht auf Rache gegen Al-Kadir sann, weil dieser ihn in der roten Festung eingekerkert hatte. Als gelassenem Mann englischen Adels war ihm die kunstvolle Trophäe Entschädigung genug.
Ich war somit froh, unter meinen jetzigen Gefährten niemanden zu zählen, der auf heißblütige Rache aus war, sondern nur Halef und Haschim, die mir im gemäßigten Wesen doch ähnelten. Nun ja, der gute Halef schwingt oft laut drohende Reden und rüttelt wütend am Griff seiner Kurbatsch, aber er ist dann doch stets bedacht und ruhig. Genau dies brauchten wir auf unserer Mission.
Leider war es mit der Bedächtigkeit und Ruhe auf dieser Etappe unserer Reise nicht weit her.
Ein Donnerschlag riss mich aus meinen Gedanken an die Vergangenheit zurück in die Gegenwart, die aus gischtiger Nachtluft und schwankendem Plankenboden bestand.
„O Sihdi“, rief Halef nun doch über das Heulen des Windes, umklammerte mit einer Hand die Reling und bewahrte mit der anderen seinen Turban davor, sich in ein flatterndes Band aufzulösen – ganz nach der seemännischen Devise: eine Hand für das Boot, die andere für sich selbst.
„Ja, Halef?“, rief ich zurück und hielt die Krempe meines geborgten Südwesters nach oben, damit sie mir nicht in die Augen schlug.
„Sihdi, warum stehen wir hier an der Seite, wo der Wind weht, und nicht an der anderen?“
„Weil nur hier das Spiel der Elemente so grandios zu spüren ist, wie es sich dem Auge darbietet!“ Ich wies mit dem Kinn auf die wabernden Gewitterwolken, die im grellen Gleißen der Blitze aufglommen. Auf der Leeseite des Schiffs, also der vom Wind abgewandten, hätte man dies nicht beschauen können.
„Aber der Sturm treibt uns sowohl den Regen als auch die Wellen ins Gesicht. Diese Vermischung von süßem und salzigem Wasser ist mir nicht geheuer.“
„Das kann ich dir nachsehen, mein Sohn der Wüste. Belecke also nicht deine Lippen, die vom brackigen Nass benetzt sind.“
„Sihdi, ich glaube, du musst rasch wieder einmal nach Hause, nach Dschermania. Wenn du deine Dichterworte nicht auf Papier schreiben kannst, kommen sie aus deinem Mund. Und ich finde, solche gewählten Ausdrücke passen nicht zu diesem Ort und dieser Gelegenheit. Ich schmecke nur eine Erinnerung daran, wie ich ins Hafenbecken von Stambul gefallen bin.“
„Ach, Halef, so schlimm ist es nun wirklich nicht. Denn dort stand die Luft und war nicht so rein und klar wie jetzt, ganz zu schweigen von dem, was alles so im Hafenwasser einherschwamm.“
„Das waren wir selbst, Sihdi! Und bevor ich auch hier in die Fluten stürze, gehe ich lieber wieder unter Deck, auch wenn da die Wände um mich her schwanken, es dafür aber trocken ist …“
Halef presste die Lippen zusammen.
„Wir können auch die Position wechseln“, schlug ich vor. „Vorn am Bug könntest du dich wahrhaft königlich fühlen …“
„Danke nein, Sihdi. Ich will der Gestalt da vorn nicht zu nahe kommen. Die ist mir unheimlich …“
Halef deutete fahrig zum Bugspriet, ohne hinzusehen. Ich erinnerte mich, dass sich darunter tatsächlich eine Galionsfigur befand, aber die war eine harmlose hölzerne Dame mit ein paar Schnörkeln darum, und ich hatte eher das Gefühl der Wehmut, da sie wohl zu den Letzten ihrer Art gehörte, denn mit dem fortschreitenden Einsatz der Dampfschiffe ohne zusätzliche Segel würden Bugspriet und Galionsfigur bald endgültig verschwinden. Ich wollte nun einen Scherz machen, dass eine Dame ohne Unterleib wirklich kein erbaulicher Anblick sei und besser auf den Jahrmarkt gehöre als zur christlichen Seefahrt – Tradition hin, Tradition her –, als ich am Bug eine Bewegung bemerkte, die nicht vom Stampfen des Schiffs herrührte und auch keine brechende Welle war. Ich sah tatsächlich eine Gestalt geduckt an der Wurzel des Bugspriets stehen – und dann war sie verschwunden!
Ich erschrak – war da jemand über Bord gegangen?
Jetzt aber zuckte Halef neben mir zusammen, denn hinter meinem Rücken war in einem Schwanken des Schiffs plötzlich ein Mann an die Reling getreten, in dem ich beim hastigen Umwenden den Ersten Offizier Bossoi erkannte, der das Schiff führte, während Kapitän Rimski schlief.
„Gaspadin Nemets“, sprach er mich aus seinem durchnässten Bart heraus an. „Sie hier, mitten in der Nacht?“ Im Gewitterleuchten sah ich seine hellen Augen unter dem Mützenschirm blitzen. Er machte sich seit unserem Auslaufen den Spaß, meinen arabischen Reisenamen zu russifizieren und mich somit als „Herr Deutscher“ anzureden. Da wir aber gemeinsam nach den Mahlzeiten in der winzigen Messe dann und wann jeder eine Zigarre geraucht hatten, nahm ich es ihm nicht übel.
„Die Nacht ist voller Wunder, Nikolai Bogdanowitsch“, antwortete ich ihm mit Nennung von Vor- und Vatersnamen, was im Russischen keine plumpe Vertraulichkeit ist, sondern höfliche Anrede. Zudem entsprach ich mit meinen Worten dem gefühligen Wesen jener Nation, welches bei ihren Seefahrern besonders ausgeprägt ist. Bossoi hatte mir bei unseren Rauchrunden so einiges an Seemannsgarn gesponnen, in welchem ich mich jedoch nicht verfangen hatte, da ich ja in beiderlei Sinn stets nüchtern bin – was in Gesellschaft eines russischen Seemanns nicht wenig Stärke und Moral erfordert.
„Wie wahr“, gab Bossoi zurück und spähte auf die wühlenden Wogen und den fahlgrün erscheinenden Schaum hinaus. „Die Meerhexen toben sich aus.“
Er nickte zu Halef hin und rollte mit den Augen. Dieser lächelte schief, da er das Märchenraunen des Offiziers nicht verstanden hatte: wegen des Russischen und des Windheulens gleichermaßen. Beide Männer hatten sich aber über einige Gläser Tee hinweg angefreundet, zumal Bossoi dem verschleckten Halef den speziellen Genuss gezeigt hatte, den Tee nicht direkt mit Zucker zu süßen, sondern nach oder vor jedem Schluck einen Löffel voll Konfitüre, also kleinen Früchten in Sirup, im Mund verschwinden zu lassen. Dieses Ritual hatte Halef begeistert, da es nicht allein seinem Naschdrang, sondern auch seinem Spieltrieb entgegenkam. Ich sah schon, wie sich in Zukunft Gläser mit Eingemachtem an den Zeltwänden der Haddedihn stapelten, oder zumindest jenen von Halefs Familie.
„Beschwören Sie es nicht“, meinte ich zu Bossoi und sprach damit das aus, was wohl Halef gesagt hätte. Ich wunderte mich ein wenig über mich selbst. Aber vielleicht lag es daran, dass das Wort Hexe für mich keinen märchenhaft-abergläubischen Klang mehr hatte, auch kein schlicht abwertendes Wort für eine resolute Dame oder ruppiges Frauenzimmer war, sondern dass dieser Begriff in meinem Leben tatsächlich mit einer konkreten Person und ihren Taten verbunden war und ich es als meine Aufgabe sah, die Hexe Qendressa zu verfolgen, von weiteren Verbrechen abzuhalten und die von ihr begangenen zu sühnen. Und hoffentlich auch diese so kluge und tapfere Skipetarin wieder auf den Pfad des Guten zu führen. Dies hoffte ich, wenn ich auch nicht wusste, ob es gelingen würde, bei einem Menschen, der sich der Zauberei verschrieben und mit finsteren Magiern verbündet hatte. Ich würde noch ergründen müssen, ob eine solche Seele sich überhaupt retten ließe. Vielleicht konnte Haschim mir Aufklärung verschaffen, oder eben Marah Durimeh, wenn wir sie erst gefunden hätten.
„Der Sturm zieht in unsere Richtung“, bemerkte Bossoi und schaute zurück zum Ruderhaus.
„Erwägen Sie, den Kurs zu ändern?“, fragte ich, als ich den ernsten Blick des Mannes bemerkte.
„Keineswegs“, brummte der Erste Offizier. „Wir nähern uns der Küste erst, wenn wir den Hafen in Sicht haben. Die ROPiT war, ist und bleibt pünktlich.“
„Sie sind der Nautiker“, nickte ich.
„Allerdings. Bei Reisen über Land haben Sie Ihre Erfahrungen, und ich die meinen über See.“
„Warten wir ab, ob es auch irgendwann Luftreisen gibt“, sinnierte ich. „Und ich meine nicht das gemächliche Gondeln von Luftschiffen.“
Bossoi lachte. „Diese Kinderballons Schiffe zu nennen ist nachgerade lächerlich. Aber was Wunder, es ist schließlich eine Erfindung der Franzosen …“
Da meinte er wohl die Brüder Montgolfier, Jacques Charles und Henri Giffard gleichermaßen, und es mochte ihm gleichgültig sein, dass die einen mit Heißluft, die anderen mit Leichtgas geflogen oder eben doch gefahren waren. Meinen Landsmann Paul Haenlein wollte ich nicht erwähnen, weil dieser jüngst an der Finanzierung seiner futuristischen Idee des motorisierten Luftschiffs gescheitert war. Noch weniger Franz Leppich, der vor sechs Jahrzehnten die Chuzpe besessen hatte, seine aerostatischen Luftgefährte in Kriegszeiten sowohl Kaiser Napoleon als auch Zar Alexander anzubieten. Das hätte der stolze Russe Bossoi mir wohl übelgenommen, und ich wollte auch nicht gezwungen werden, Partei zu ergreifen, in Dingen des reinen Renommées und des Chauvinismus, welche mir beide zuwider sind. So sagte ich also, Puschkin zitierend, um dem Russen eine Freude mit einem Wort seines Nationaldichters zu machen, und ich hoffte, dass ich den Petersburger Dialekt einigermaßen traf:
„Vom ruhigen Himmel verjagt dich der Wind. – Wie beruhigend, dass wir das vergleichsweise gut tragende Element des Wassers befahren. Und uns in einem stabilen Gefährt befinden. Ein gutes, russisches Schiff.“ Ich bemerkte, dass ich unbedacht die nichtrussischen Werften vergessen hatte. Bossoi ignorierte dies oder ließ sich vom eigenen Stolz und auch ein wenig Wehmut tragen. Er klopfte auf die Reling und deutete den Schiffsrumpf entlang.
„Die Fürst Korowjew trägt ihren Namen auch nicht von ungefähr! Sie müssen wissen, dass dieser edle …“
„Sihdi!“, unterbrach Halef ihn mit einem aufgeregten Ruf, und gleichzeitig spürte ich die Hand meines Gefährten auf meiner Schulter. Ich wandte mich um und sah, wie Halef mit dem freien Arm übers Meer zeigte, hin zum tobenden Gewölk des Gewitters. In der Brise der Sturmausläufer löste sich ein Stoffende des Turbans und peitschte wie eine weiße Schlange vor dem schwarzen Himmel. Dies war jedoch nicht der erstaunlichste Anblick, denn was ich sah, als ich Halefs Finger mit den Augen folgte, raubte mir den Atem, wie es der beißende Wind nicht vermochte: Vor der fernen Wolkenwand, die schwarz in schwarz zwischen finsterem Meer und sternlosem Firmament brodelte und die durch zittrige Blitzfinger mit weißen Fetzen durchsetzt wurde, blähten sich die Segel eines Mehrmasters altertümlicher Bauart. Die Leinwände unter den Rahen leuchteten in düsterem Rot, als die himmlischen Entladungen ihr bleiches Licht hindurchschienen. Das Schiff hielt auf uns zu, flog vom Sturm getrieben uns entgegen, die roten Segel wie der Kropf eines Fregattvogels geschwellt, und unter dem Bugspriet, am Vordersteven, sah ich ein goldenes Blitzen. Dort gab es wohl auch eine Galionsfigur, und vielleicht war es dieser Schimmer, der Halef aufmerksam gemacht hatte.
„Hast du das auch gesehen, Sihdi?“, rief Halef.
„Ein anderes Schiff“, nickte ich. „Welch mutige Mannschaft, sich ohne Dampfkraft dem Sturm zu stellen.“
„Kein Dampf?“, fragte Halef und schüttelte den Kopf, bemerkte seinen sich lösenden Turban und steckte das lose Ende rasch und vehement fest. „Dann habe ich mich wohl verhört, Sihdi. Denn ich meinte, ein Rufen zu hören, das der Sturm zu mir wehte. Es klang wie die scheußliche Pfeife an dem Eisenkamin, nur abgehackt, fast meckernd …“
Er wedelte mit der Hand nach hinten, zur Sirene am Schlot hin. Er hatte dieses ihm verhasste lärmende Etwas schon zuvor ein wenig despektierlich mit einer Kirchenglocke verglichen. ‚Sihdi, warum immer nur dieser Lärm? Ihr Ungläubigen trötet damit die Hafenankunft heraus und kreischt schrill, wenn die eiserne Bahn ihren Hof erreicht. Aber warum der Bimbam aus dem Turm des Gotteshauses? Wir Muslime rufen freundlich zum Gebet, nur Männer mit schönen Stimmen werden Muezzin. Ihr aber lasst rohe Glockengießergesellen bestimmen, wie die Gläubigen an den Gottesdienst erinnert werden …‘
Nun, diese eigensinnige Sicht auf westliche Klänge war es wohl, warum Halef nun auch bei einem Segler ein Dampfsignal zu hören glaubte. Immerhin munkelte er nicht vom Fauchen der Meerhexen. Wie gut also, dass er des Russen Seemannsgarn nicht vernommen hatte, weil ich so vorausschauend gewesen war, es eben nicht zu übersetzen.
Mit gelassener Neugier zog Bossoi das Fernrohr aus dem Lederetui am Gürtel. Seine Geste war geübt, und auch wenn ich selbst über ein gutes Messingperspektiv verfüge und es oftmals zum Fernspähen eingesetzt habe, erinnerten mich die Bewegungen des Ersten Offiziers an einen Mann, der einen Revolver zieht – um ihn mit einem Handgriff zum schimmernden Säbel zu verwandeln. Dieser war natürlich stabrund und stumpf, die Schärfe lag in den geschliffenen Linsen, dennoch schien mir Bossoi nicht immer bei der Handelsmarine gedient zu haben. Es ist nun so, dass ein Kämpfer den anderen an solchen Kleinigkeiten erkennt. Ich fragte mich, ob er in unseren gemeinsamen Stunden wiederum erkannt hatte, dass ich nicht allein mit der Schreibfeder umzugehen weiß.
Jetzt blickte Bossoi durch das Teleskop. Er murmelte einige nautische Begriffe, mit denen er wohl die Art des Seglers bestimmen mochte, und suchte nach Anzeichen, eine Nationalität auszumachen. Dass er davon ausging, jene Entdeckungen in diesem unsteten Licht machen zu können, zeichnete ihn als Seemann mit geübtem, ja kühnem Auge aus. Dann ließ er das Fernrohr sinken, im Blitzeslicht bemerkte ich seine ernste Miene und glaubte, seine wettergebräunten Züge erbleichen zu sehen. So schaute kein Mann drein, der eine Handelsbrigg, einen Kauffahrerschoner oder eine Postbark erblickt hatte.
Bossoi hauchte einen wütenden Seufzer aus und knurrte dann:
„Piraten.“
Zweites Kapitel
Die Teuta
„Piraten im Schwarzen Meer?“, sagte ich ungläubig. Nicht, dass ich mich dem Glauben hingab, das Piratentum sei für alle Zeiten ausgemerzt, nur weil in den vergangenen Jahrzehnten die Freibeuterei der Karibik und das Korsarentum des Mittelmeers niedergegangen waren, bedingt durch die politischen Entwicklungen betreffend der Großmächte und ihrer Kolonialreiche, wie auch der technischen Neuerungen, etwa der windunabhängigen Dampfschiffe. Auch wusste ich, dass die südlichen Küsten am Persischen Golf von den Briten nicht von ungefähr Piratenküste genannt wurden, wegen der Überfälle auf Handelslinien, die Waren aus Indien nach Europa brachten, vom scheußlichen Sklavenhandel unmenschlicher Verbrecher ganz zu schweigen. Dass es nach einigen Verhandlungen zwischen dem Empire und den betreffenden Emiraten zu Vertragsunterzeichnungen gekommen war und offiziell Frieden und Einigkeit herrschen sollten, änderte nur wenig an den grausamen Tatsachen, denn Übeltäter scheren sich nicht um offizielle Dokumente. Ich wusste also sehr wohl, dass es türkische und arabische Piraten gab in den Gewässern des osmanischen Reichs. Und selbst hier, auf dem Schwarzen Meer, hatte es Kosaken zur See gegeben, welche von der Krim und der Mündung des Dnjepr aus Beutezüge unternahmen. Doch dies war vor zweieinhalb Jahrhunderten gewesen. Und so spukhaft die Szenerie auch sein mochte, mit dem finsteren Schiff und dem nächtlichen Sturm, so würde es sich wohl kaum um geisterhafte Piratengestalten handeln. So sehr ich den Dichter Wilhelm Hauff schätze, der in seiner Erzählung vom Gespensterschiffdie Sage vom Fliegenden Holländer ins Morgenland verbracht hat – diese war nun einmal ein Märchen.
Hier aber hielten wahrhaftige Segel auf uns zu, und der Erste Offizier schien besorgt. Ich wollte ihn aber ernst nehmen: „Was haben Sie gesehen?“, fragte ich, wobei ich nicht davon ausging, dass er mir nun von einer Flagge mit Totenschädel und gekreuzten Knochen berichten würde. Damit wären wir bei den übertriebenen Abenteuergeschichten, welche vor allem im angelsächsischen Sprachraum in billigster Heftung an der Hintertreppe vertrieben werden, als sensationelle Lektüre für schlichtere Gemüter. Letztere sind gute Menschen, die eben ihren eigenen Geschmack haben; jene, die aber solcherlei Schund verfassen, empfinde ich als Schande innerhalb der schreibenden Zunft. Wie gut, dass ich selbst nur von meinen Reisen und Erlebnissen berichte und mich nicht dem Flunkern und Fabulieren ergeben muss.
„Es ist die Teuta“, sagte Bossoi und hob erneut das Fernrohr ans Auge, wie um sich zu vergewissern.
Das gab mir Zeit zum verwunderten Nachsinnen. Ich war mit meinen Gefährten ja vom Balkan hergekommen, wo wir den Schut besiegt und sein Reich zerstört hatten. In diesem Land der Skipetaren, weit im Westen an der Küste des Adriatischen Meeres, in Albanien und Dalmatien, hatte in der Antike der Volksstamm der Illyrer geherrscht, und deren Name ging auf jene Gebiete über, bis in die heutige Zeit. Ich will nicht über Ländergrenzen und Gebietsansprüche referieren, über Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich. Der Name Teuta wies auf viel frühere Zeiten hin, denn so hieß eine Königin der Illyrer, im dritten Jahrhundert vor der Zeitrechnung, zwischen den Punischen Kriegen, als Gnaeus Flavius Konsul war. Dieser bekämpfte Teuta in den sogenannten illyrischen Kriegen, die begonnen wurden, weil die kriegerische Dame einige nahe griechische Städte in Überfällen verheert hatte, die nichts anderes waren als – Piratenangriffe. Wenn sich also eine heutige Piratin Teuta nannte, so lag diese Namenswahl nicht allzu fern – obgleich das Schwarze Meer doch einiges von der illyrischen Adria entfernt war, so wie unsere heutige Zeit von der Ära der Römer. Dennoch wollte ich dies nicht so recht glauben. Man mag es mir nachsehen und mich nicht der männlichen Überheblichkeit zeihen, als ich Bossoi fragte:
„Meinen Sie den Namen des Schiffs?“
Der Erste Offizier blickte mich scharf an. „Sie mögen verzeihen, aber dies kann nur ein Mann sagen, der ausschließlich die Landwege dieser Breiten, aber nicht die Seewege kennt. Sonst würde auch Sie der Name Teuta mit Respekt erfüllen, wenn nicht gar Ehrfurcht.“
„Aber wenn sie doch eine Piratin ist, warum spielt die Ehre in die Furcht? Verbrecher sind ohne Ehre, und diese sollte ihnen nicht zugesprochen werden.“
„Teuta ist die letzte Piratin. Oder die erste …“
„Warum dies?“
„Weil sie von ihrem Gemahl das Schiff und die Mannschaft und die Profession ererbte. Sie ist Witwe. Und ihre Seele ist so schwarz wie ihr Schiff.“
„Es gab in China, in den fernöstlichen Gewässern einst eine Witwe Cheng, welche …“
„Teuta ist die letzte Piratin, weil sie sich nicht dem Schicksal ergeben hat, welches die Dampfkraft über die Segler gebracht hat. Ihr Schiff behauptet sich weiter in jedem Manöver. Weil Teuta mit dem Teufel im Bunde ist.“
Ich seufzte. In dieser Erzählung steckte doch wieder nur allzu viel Seemannsgarn, das zudem auf übliche Art gesponnen war. Irgendjemand hatte wohl von der chinesischen Piratenwitwe Cheng reden hören. Diese war mit ihrer ererbten Piratenflotte tatsächlich eine Bedrohung im Reich der Mitte gewesen, aber dies hatte sich zu Beginn des Jahrhunderts ereignet – und auch die Witwe hatte den Niedergang der Piraterie nicht aufhalten können, und seit fünfzig Jahren war auch im Gelben Meer dieser Spuk vorüber. Nun, und dieser Spuk des Schwarzen Meeres und der Adriatischen See? Ich konnte nicht umhin, kopfschüttelnd zu lächeln. Da hatte man dem Fliegenden Holländer wohl nur einen Rock um die Hüften gewunden, ansonsten aber Teufelsbund und Fluch und Zauberschiff beibehalten, alles was es für eine abergläubische Klabauterei nach Seemannsgeschmack benötigte.
Ich wollte Bossoi aber nicht verhöhnen und fragte interessiert: „Woran haben Sie das Schiff der Teuta erkannt?“
„Am goldenen Ziegenkopf unter dem Galion.“
Jetzt begriff ich: das Symbol der Illyrer. Dies war mir im Land der Skipetaren begegnet, es schmückte die Helme der Fürsten Skanderbeg und Dukagjini, zumindest deren sterblicher Überreste. Und die Hexe Qendressa hatte uns mit einem ziegenförmigen Schmuckstück eine Botschaft übersandt. Es lag also nahe, dass sich eine illyrische Piratin mit diesem Signet ausgestattet hatte, oder wer auch immer jenes Schiff führte und sich mit Schauermärchen schmückte oder mit dergleichen belegt wurde. Und nun erinnerte ich mich an die launige Bemerkung jenes österreichischen Beamten in Dalmatien, dass von einer Piratin gemunkelt werde, die vom leibhaftigen Bocksbeinigen begleitet werde. Ja, und selbst mein guter Freund Sir David hatte von einer Schiffsbegegnung erzählt, die er und seine Mannschaft auf der Fahrt von Malta zum Balkan, kurz vor der albanischen Küste gehabt hatten. Ein Schiff mit rötlichen Segeln und einer gehörnten Figur am Vordersteven. Und es hieß, man habe ein Meckern vernommen …
Ich schaute Halef an, der in meiner Unterhaltung mit Bossoi das Wort Pirat zweifellos hatte ausmachen können und der von uns zu dem nahenden Schiff und wieder zurück blickte.
„Halef“, sprach ich ihn an, „was hattest du über jenes Geräusch gesagt …“
In diesem Augenblick heulte der ferne Sturm auf und schien wie eine Windsbraut heranzufegen. Die Wolken quollen in gewaltig sich türmenden Wänden auf uns zu, ihre erzdunkle Schwärze durchgrellt von silberhellen Adern aus Himmelsfeuer. Und der Gewitterfront voran rauschte das Schiff mit den glühenden Segeln und dem goldenen Blitzen am Bug.
„Sie halten auf uns zu“, bemerkte Bossoi. Dies war augenscheinlich, wie ich befand. Seine weitere Einschätzung erstaunte mich jedoch: „Sie wollen entern.“
„Im Sturm?“, fragte ich und setzte nach: „In der Nacht?“
„Das ist die Teuta“, gab Bossoi zurück, als wäre dies hinreichende Antwort, als müsse mir dies alles sagen. Er presste die Lippen aufeinander und schob vehement das Fernrohr erst ineinander, dann in das Etui am Gürtel. Er blickte mich eindringlich an. „Verlassen Sie das Deck. Ich gebe Alarm.“
Letzteres war seine Entscheidung, Ersteres sah ich nur als Empfehlung, der ich nicht folgen musste. Bossoi stieß sich von der Reling ab und lief zum Ruderhaus, wobei er jedes Schwanken des Decks geschickt und erfahren mit seinen eigenen Bewegungen ausglich. Ich blieb neben Halef stehen und blickte dem Schiff entgegen, das vor dem Sturm heranflog.
„Es ist nicht möglich, ein Schiff bei Sturm aufzubringen“, sagte ich. „Dieses Manöver ist nur ein Schreckensakt, um die abergläubischen Seeleute zu verunsichern.“
„Aber Sihdi“, meinte Halef, „warum all das, wenn doch nur wir und die Nachtwache es sehen können?“
„Wie du bemerkt hast, eilt der eifrige Offizier zum Kapitän und scheucht die Besatzung aus den Kojen. Ein schöner Aufruhr und ausreichend Publikum für das Schauspiel.“ Ich musterte den Kurs des schwarzen Seglers. „Es wird kaum möglich sein, dass sie längsseits gehen, wie es für ein Entermanöver nötig ist. Bei diesem Wind können sie gar nicht mehr beidrehen.“ Ich erläuterte Halef mit den Händen, was ich meinte. „Sie werden wohl hinter unserem Heck vorbeifahren.“
„Und wenn sie das nicht schaffen und uns rammen? Oder rammen wollen?“
Halef umklammerte mit beiden Händen die Reling, als bereite er sich auf einen Aufprall vor.
„Das wäre auch für sie äußerst gefährlich. Schließlich ist es ein recht moderner Segler und kein antikes Kriegsschiff mit einem Rammsporn. Das ist ein …“
„Ein großes Ding aus Metall, das vorn am Schiff aus dem Wasser ragt?“
„Ja, richtig.“ Mein kluger Halef ist von rascher Auffassungsgabe.
„Dann hat das Schiff einen Rammsporn“, rief Halef und getraute sich, eine Hand von der Reling zu lösen und fahrig nach vorn zu deuten. Ich folgte seinem Wink und sah tatsächlich, dass sich einiges unter der schimmernden Galionsfigur ein weiteres glänzendes Etwas zeigte, als es sich aus den Fluten vor dem Bug erhob, wann immer das Schiff durch die Wellen stampfte. Es mochte ein solider Balken sein, der in den Kiel eingefügt und mit Kupferblech beschlagen war und so, ähnlich wie die Bocksfigur am Steven, das Licht zurückwarf.
„Das ist nur Blendwerk“, sagte ich grimmig. „Um ein Schiff gezielt zu rammen, braucht es Ruderer, die auch rückwärtig sozusagen für Vortrieb sorgen könnten, damit …“
„Was immer du da meinst, Sihdi“, rief Halef, „es scheint die da drüben nicht zu kümmern!“
Tatsächlich hielt das finstere Gefährt weiter auf uns zu, und wie ich verwundert bemerkte, auf einem Kurs, der exakt senkrecht zu dem unseren angelegt war, dwars oder querab, wie es in der Seefahrt heißt. Doch wir bewegten uns ja ebenfalls, und so hätte ich doch eine Schrägstellung des Rumpfes bei unserem Gegenüber bemerken sollen – denn dieser würde uns doch folgen müssen und hätte niemals andauernd auf unsere Mitte zielen können! Ich konnte jedoch stets von vorn auf den Bug blicken, und der Bockskopf schien mich ebenfalls anzustarren. Das war unmöglich! Ich spürte ein Ziehen in meinem Nacken, als mich diese Erkenntnis überfiel, und für einen Augenblick schien mir, als würde die abergläubische Saat des Seemannsgarns in mir aufgehen, in diesem Klima, das für Schauergeschichten so gedeihlich ist: Mitternacht und Sturmesbrausen.
Dann aber presste ich die Zähne aufeinander und ballte die Fäuste an der Reling. Ich spähte angestrengt zu den Aufbauten hinüber, ob ich nicht doch den Schlot einer verborgenen Dampfkesselbefeuerung erkennen könnte. Ich bin wahrlich kein Ingenieur der Marine, aber vermochte man ein solches Manöver, wie ich es hier beobachtete, vielleicht dadurch zu erreichen, dass es eine seitliche Schiffsschraube gab? Gewiss war dies zweifach absurd: Wer würde solch ein altes Segelschiff mit derartiger Technik ausstatten – und zudem, welchem Kopf entspränge eine solche Idee, wenn nicht einem Romanschriftsteller, der Fabeln über phantastische Fahrten erdachte, wie etwa der Franzose, der den deutschen Lesern als Julius Verne bekannt ist?
Bevor ich aber noch weiter darüber nachsinnen konnte, hörte ich hinter uns das Poltern schwerer Seestiefel. Die russischen Matrosen kamen heran, mit Gewehren und Beilen in den Händen, auch Stangen mit Haken an der Spitze. Das war wohl das Gegenkommando für den befürchteten Enterversuch, und Bossoi befehligte sie, diesmal nicht mit einem säbelähnlichen Teleskop in der Hand, sondern einem tatsächlichen Säbel, der möglicherweise schon bei Borodino gegen Napoleon geschwungen worden war, dann aber gewiss von Bossois Großvater. Der Marinerevolver, den er trug, war jedoch neu. Am Schwung des Hammers erkannte ich, dass es sich um die Kopie eines amerikanischen Modells aus der russischen Waffenfabrik in Tula handelte, eine Stadt, die auch für ihre vorzüglichen Samoware und köstlichen pryaniki, also Lebkuchen, bekannt ist. Den amerikanischen Waffenschmieden wäre es wohl lieber, wenn sich die Russen auf diese beiden Dinge beschränkten und nicht Revolver nach fremdem Vorbild bauten. Nun, sollte es wirklich zum Kampf kommen, war es mir einerlei, woher die Waffe des Offiziers stammte, wenn er nur geschickt damit umgehen könnte. Und jetzt fiel mir auf, dass ich selbst unbewaffnet war. Diesen Umstand mag man mir nachsehen, denn ich trage weder Revolver noch Henrystutzen, schon gar nicht den Bärentöter bei mir, wenn ich auf einer Schiffspassage übers Schwarze Meer kurz zum mitternächtlichen Luftschnappen das Deck betrete.
Bossoi schaute zu mir herüber und deutete mit dem Kolben seines Revolvers erst auf mich und dann auf seinen Gürtel. In dessen Halfter steckte eine zweite Waffe.
„Darf ich anbieten, Sie zu bewaffnen, Gaspadin Nemets? Ein vorzügliches Modell, russische Erfindung. Besser als ‚Kalt‘ oder ‚Smissenwessen‘.“
Ich fragte mich, ob er scherzte und sich absichtlich dieses schweren Akzents bediente.
„Danke, nein“, gab ich zurück. „Ich habe ausreichend Feuerwaffen in meiner Kajüte.“
„Aber nicht hier, wo Sie sie brauchen!“
„Warten wir ab.“ Ich wollte die Entscheidungen des Offiziers nicht in Frage stellen, aber ich glaubte noch immer nicht an einen Angriff.
„Wie Sie meinen“, rief Bossoi über ein Aufheulen des Windes, und als er sich abwandte, um angespannt über die Reling zu spähen, sah ich, wie er etwas gewiss Despektierliches murmelte. Das störte mich nun, obwohl ich es dem Mann nicht verdenken konnte. Ich seufzte und wandte mich an Halef.
„Bist du so gut und gehst ausnahmsweise alten Dienerspflichten nach? Oder eher noch denen eines Schildknappen oder Waffenmeisters …“
Halef legte den Kopf schief. „Ich soll unsere Gewehre holen, Sihdi?“
„Die Revolver sollten reichen“, meinte ich. Dies war keine fahrlässige Verkennung der möglichen Gefahrensituation, sondern hatte auch andere Gründe. Halef schaute an mir vorüber, zu den Aufbauten unseres Schiffes hin.
„Das kann ich nicht, Sihdi.“
„Aber …“
Halef deutete über meine Schulter und ich wandte mich um. Vor dem Deckshaus stand Scheik Haschim mit finsterer Miene, doch wachen Augen. Seine helle Kleidung schien unter dem dunklen Umhang hervor, als sich die Ölhaut im Wind blähte. Und so sah ich auch, dass über Haschims eigenem Waffengurt, an dem er Säbel, Dolch und Revolver trug, locker mein eigener Gürtel um seine Hüften lag, mit meinem eigenen Revolver und dem Bowiemesser. In den Händen trug Haschim meinen Henrystutzen und Halefs Büchse, samt gefülltem Patronengurt.
Stumm trat Haschim an uns heran, reichte uns die Gewehre, und als er meinen Gürtel ablegte und ihn mir übergab, sagte er:
„Ich habe eine Präsenz gespürt, Kara Ben Nemsi. Und sie verheißt Unheil.“
Ich legte mir den Gurt mit Messer und Revolver um, den Henrystutzen hatte ich mir am Riemen über die Schulter gehängt. An seinem Gewicht spürte ich, dass er vollständig geladen war. Es ist meine Gewohnheit, die Waffe nicht nur regelmäßig, vor allem nach Gebrauch, zu reinigen und zu prüfen, auf dass sie stets tadellos ihren Dienst verrichten kann. Sondern ich wechsle auch immer die Patronen, wenn sie längere Zeit im Röhrenmagazin verharrt haben, sowohl in ihrer Position, als auch gegen neue. Der Henrystutzen ist eine verlässliche und robuste Waffe, die aber ihre Eigenheiten hat. Diese kenne nur ich, und so ist dies neben der speziellen Funktionsweise jenes Gewehrs eine weitere Sicherungsmaßnahme gegen fremden Gebrauch. Ich hatte die Passage auf dem Schwarzmeerdampfer für eine grundlegende Wartung des Stutzens genutzt, und so wusste ich, dass er an diesem Abend zur Hälfte auseinandergenommen auf meiner Koje gelegen hatte. Und als ich an Deck gegangen war, hatte ich die Kabinentür verriegelt.
Ich wechselte einen Blick mit Haschim, in dem kein Vorwurf lag, sondern nur Verwunderung, vielleicht auch ein wenig Bewunderung, vor allem aber Respekt. Der Scheik ließ seine Mundwinkel nur kurz zucken, das weise Lächeln, welches sonst bei solchen Gelegenheiten um seine Lippen spielte, zeigte er nicht. Dies ließ mich begreifen, wie ernst die Lage sein mochte. Und dieser militärische Begriff, der mir in den Sinn kam, erinnerte mich daran, dass wir uns noch immer im Krieg mit dem finsteren Magier Al-Kadir befanden, selbst wenn er nicht mehr auf dieser Erde weilte, sondern im Geisterreich darauf harrte, Rache an uns zu nehmen und uns zu vernichten.
Und in eben dem Moment, in dem Haschim von einer Präsenz sprach, die er gespürt zu haben glaubte, empfand ich ebenfalls etwas. Es war jenes leichte Brennen in meinem Innern, das sich bemerkbar machte, seit ich Al-Kadir in dessen roter Festung im Duell mit dem magischen Schachspiel besiegt hatte, wodurch mir ein Preis der Macht zugestanden worden war, den ich jedoch abgelehnt hatte. Doch trotz meines Kampfs dagegen und meines Widerwillens war laut Haschim ein Teil dieser Kraft in mir verblieben. Und diese befähigte mich, Magie und Zauberei zu verspüren, wann immer ich ihr begegnete. Allerdings war es nun so, dass meine Zweifel an dergleichen Dingen und mein nüchterner Verstand sich oftmals dagegenstellten, ich es schlicht nicht wahrhaben wollte, selbst wenn ich es mit eigenen Augen sah. Aber wie ein weiser Mann einmal gesagt hatte, er mochte Wissenschaftler gewesen sein, doch kein Mystiker: Deine Augen können dich täuschen, traue ihnen nicht. – Solange es also keine Thermometer oder Barometer oder Kompassnadeln gab, die eindeutig auf unwiderlegbare Kräfte der Natur oder eben der Übernatur hinwiesen, blieb ich doch skeptisch. Auch und gerade, weil ich durchaus über ein Instrument verfügte, um damit die, wie es hieß, wahre Natur der Dinge zu schauen, namentlich den Musaddas. Dieser goldene Sechseckring aus dem Besitz Al-Kadirs, hatte bei meinem jüngsten Abenteuer zwar durch Halefs Hand seine Form verloren, besaß diese aber nun wieder, dank der Kunst von Schimin dem Schmied – und ein wenig Anleitung von Seiten Haschims. Aber nun, um den Ring zu nutzen, musste man hindurchblicken, mit den so leicht zu täuschenden Augen. Ich trug den Ring in meiner Westentasche, mittlerweile eher aus Gewohnheit als aus dem Grund, ihn rasch bei der Hand zu haben. Aber auch nach Haschims Worten beschloss ich, den Musaddas nicht zu nutzen, um etwa durch seinen goldenen Kreis hindurch auf das sich so seltsam annähernde Schiff zu blicken. Um – ja, was zu sehen? Ich vertraute Haschim, er war ein kluger und ehrlicher Mann, und so wollte ich ihn sich erklären lassen. Zudem hatte ich keine Hand frei für das goldene Spekulum, jetzt wo ich den Henrystutzen von der Schulter nahm. Sollten uns tatsächlich Piraten attackieren, wäre er wohl nützlicher als ein Ringlein, um dadurch – um es der Situation angemessen hanseatisch auszudrücken – Spöken zu kieken.
Ich lud den Stutzen durch. Neben mir repetierte Halef den Bolzen seiner Büchse. Die Revolver würden erst später nötig sein, wenn es zum näheren Kampf käme. Und schließlich müssten die Klingen herhalten.
„Ihr seid bereit zum Kampf“, sagte Haschim.
„Gewiss“, gab ich zurück. Es war offensichtlich.
„Nicht dieser Kampf, Kara Ben Nemsi.“
„Wie soll man Piraten anders begegnen? Oder einer Piratin, wenn man dem Ersten Offizier Glauben schenken mag.“
„Es ist die Teuta“, nickte Haschim.
Ich war kaum verwundert, dass der Scheik diesen Namen kannte. Als Kundiger der magischen Künste wusste er wohl auch um allerlei Sagen und Legenden und abergläubische Dinge, denn all das ging ja, zumindest nach meiner Vorstellung, nahtlos ineinander über und ließ die nötige Trennschärfe vermissen. Ich wusste nicht mehr, woher ich diesen Begriff kannte, vielleicht hatte ich in einem Buch über Optik davon gelesen, mir schien er recht passend. Aber ich war verwundert, dass Haschim jenes klabauterhafte Piratenweib so bezeichnete, als sei Teuta kein Name, sondern ein Titel, gerade wie Bossoi zuvor. Aber nun, Ähnliches war in der Geschichte oft genug vorgekommen: Der familiäre Beiname Caesar wurde zur römischen Würdenbezeichnung, und der Name des Kaisers Karl – man beachte wiederum den Titel – wurde im Slawischen zum Wort für König: kral. Mochte es also eine Namens-Teuta gegeben haben, so war es eben nun eine Titel-Teuta, die mit ihrem Schiff die Seeleute in Schrecken versetzte – oder beides, mir war es einerlei.
„Und wer ist diese nun? Piratin oder Popanz? Eine reale Bedrohung oder eine Spukgestalt?“
„Schaut selbst.“
Ich sandte meinen Blick wieder über die Reling hinaus, nachdem ich mich etliche Herzschläge lang nur Haschim zugewandt hatte. Und ich erschrak! In dieser kurzen Zeit war das schwarze Schiff so nahe gekommen, wie ich es selbst mit Sturmwind in den Segeln kaum für möglich gehalten hätte. Und noch immer ragte uns der Vordersteven mit dem Bockskopf entgegen, darunter der drohende Rammsporn. Was mich jedoch am meisten erstaunte, war der Anblick einer Gestalt, die auf der Wurzel des Bugspriets stand, sich mühelos gegen das Schwanken und Stampfen geradehielt, die Hand nur locker an das Tau des Vorstags gelegt.
Es war eine Frau – es war die Teuta!
Ich konnte die hageren Züge ihres Gesichts erkennen, die Haut von Gischt und Sonnenglut gestrafft und verhärtet. Falten zogen sich als tiefe Linien hindurch, kaum weniger zahlreich als Taue und Stage in der Takelage des Schiffs, doch die Augen blitzten so wach wie der Goldschädel am Galion. Die Teuta mochte das mittlere Alter überschritten haben, ich erkannte ihr langes, graues Haar, das unter einem straff um den Schädel gewundenen Tuch hervorkam und im Wind nach hinten schlug, in verfilzten Strähnen, die mich an die Haartracht von Sufis oder Derwischen erinnerten. Doch ein Vergleich mit jenen heiligen Männern verbot sich wohl. Auch die Kleider waren wie die eines Mannes; an Jacke, Weste, Hemd konnte ich nichts Weibliches entdecken, was immer dies auch heißen mochte, denn Stickerei und Zierrat sind Dinge, die den Männern aller Kulturen keineswegs fremd sind. Ich sah keine Waffen, weder in der freien Hand noch im breiten Gürtel, und auch aus dem Stiefel ragte weder Dolchgriff noch Revolverkolben. Ja – aus dem einen Stiefel! Denn die Teuta stand am Bug ihres Schiffes und schwankte nicht, obgleich aus der einen gekappten Hosenröhre kein menschliches Bein aus Fleisch und Blut ragte, sondern eines, das aus Holz oder Elfenbein geschnitzt sein mochte. Dies war nun kein verwunderlicher Anblick, denn auch ohne die legendenhafte Beschreibung von Freibeutern und Bukanieren zu bemühen, sind hölzerne Beine eine Gehhilfe für Versehrte aller Art, hätten sie ihre Glieder nun durch Krieg, Unfall, Krankheit oder Schicksal verloren.
Doch die Teuta trug ein künstliches Bein, das gestaltet war wie der Lauf eines Bocks, vom Schwung der Linien bis hin zur Ausformung von Hinterklaue und Huf. Wäre die Teuta ein Mann gewesen, hätte man glauben mögen, man würde den bocksbeinigen Leibhaftigen erblicken! Ich aber erkannte, dass sie hiermit wohl ihre illyrische Herkunft und das alte Herrschersymbol würdigen wollte, wenn auch auf seltsam erscheinende Weise.
Ich riss mich von dem eigentümlichen Anblick los, denn die Männer um mich herum begannen zu wanken und zu zaudern. Sie glaubten nicht mehr, ein Kapermanöver verhindern zu können, allein mit einigen Salven aus den Gewehren oder ihrer schlichten Anwesenheit, die Bereitschaft zeigte, ein jedes Prisenkommando zurückzuschlagen.
Denn das geisterhafte schwarze Schiff mit den blutig leuchtenden Segeln und seiner teuflischen Kapitänin zeigte keine Kursänderung. Die Piraten wollten nicht längsseits gehen, für jedes Beidrehen war es wohl zu spät, es blieb allein der Rammstoß aus voller Fahrt!
Der Bocksschädel blitzte auf, ebenso der Metallsporn, welcher sich aus der schimmernden Gischt der Bugwelle erhob, und wir alle sahen den stummen, harten Blick der Teuta. Diese drei Anblicke bannten uns, und wir mussten uns von der Reling, von unseren Positionen regelrecht losreißen, um zu den Seiten zu fliehen, damit wir nicht an jener Stelle verharrten, die in wenigen Herzschlägen vom Aufprall des Sporns und des diesen tragenden Schiffs zerfetzt und zerschmettert würde. Ich warf einen hastigen Blick zurück zum Deckshaus und zum Schlot der Maschine. Würde der Rammsporn lang genug sein, der Aufschlag heftig genug, dass der Kessel zerrissen, gar zersprengt würde? Es wäre unser aller Ende!
Drittes Kapitel
Zwei Leibhaftige
Das schwarze Schiff kam noch immer heran und jedes Detail stach mir in die Augen, grell hervorgehoben während der kurzen Herzschläge des flackernden Lichts. Ich dachte nicht an Flucht, niemand dachte daran, denn an keiner Stelle auf Deck oder innerhalb des Schiffs, noch weniger in den Fluten der See, wäre die Gefahr geringer gewesen. Und so musterte ich ergeben das nahende Unheil. Der Bockskopf am Bug starrte mir aus den leeren Augenhöhlen entgegen, der Blick der Teuta hingegen schien zu brennen – doch nicht in meine Richtung! Ich glaubte zu bemerken, wie sie stattdessen Haschim mit einer Art nüchternem Erkennen bedachte. Und als ich zu Haschim sah, erstaunte mich der gelassene Ausdruck auf seinen Zügen, der mir jedoch nicht davon zeugte, dass er sich seinem Schicksal gefügt hätte – zumindest nicht dem Schicksal des Todes auf See! Wenn Haschim also die Teuta kannte, was wusste er noch?
In diesem Augenblick geschah das Unfassbare! Ich sah mit ungläubigem Staunen, wie das schwarze Schiff von seinem vermeintlichen Rammkurs abschwenkte, beidrehte und dabei auf schier unbegreifliche Art seine Geschwindigkeit minderte! Dies war nach allen Gesetzen der See und der Erde unmöglich! Und ich hörte über den Wind einen meckernden Laut, der alle Naturwissenschaftler von Archimedes bis Newton in Spott und Hohn zu verlachen schien. Das Schiff der Teuta ging längsseits, einen Steinwurf entfernt. Der Wellenberg, den der Rumpf bei diesem Manöver aufgeworfen hatte, schlug mit Macht gegen unsere Bordwand und ließ die Aufbauten erzittern, sandte einen Schlag durch unsere Leiber. Dies warf mich noch vorn, gegen die Reling, und als ich mich abfederte, fiel mein Blick nach unten auf das wühlende Wasser, und der Schaum schien mir auf widernatürliche Art zu schimmern, ähnlich jenem Phänomen, welches man in der südlichen See das Meeresleuchten nennt. Ich bezweifelte aber, nicht nur wegen unserer nördlichen Position, dass hier gütige Geschöpfe der maritimen Kleintierwelt ihr Lichterspiel trieben. Nicht allein wegen des erstaunlichen seefahrerischen und physikalischen Kunststücks, dessen Zeuge ich geworden war; auch nicht allein wegen des Raunens über die Teuta und der Worte Haschims – nein, auch ich hatte in meinen jüngsten Abenteuern mittlerweile zu viel Unglaubliches gesehen, als dass ich nicht sogleich an etwas Übernatürliches gedacht hätte. Oder doch immerhin an etwas, dessen Natur mir noch unbekannt war. Ich riss den Blick hinauf, wobei ich ohnehin gar nicht anders konnte, denn der Widerruck des Wellenschlags ließ mir Kopf und Körper zurückkippen, und als ich die Takelung des schwarzen Schiffs nun von der Seite sah, bemerkte ich etwas Ungewöhnliches: Wenn ich auch kein Seemann war und auch nie einer werden würde oder wollte, so erkannte ich doch, dass die Masten dieses Schiffs durchaus besonders waren. Ich hatte nun als Reisender zwischen den Kontinenten genug Schiffsmasten gesehen, um dies beurteilen zu können, auch ohne Schiffsbaumeister zu sein. Diese Masten erschienen mir nicht nur um einiges mächtiger im Umfang, als es üblich war, nein, um die Rundungen der Hölzer – wenn es denn Holz sein mochte – wand sich jeweils von Fuß bis Topp ein sicher armdickes Etwas, wie eine Schlingpflanze um den Stamm eines Urwaldriesen oder eben doch die sprichwörtliche Schlange um den Baum der Erkenntnis. Mir allerdings blieb die Erkenntnis, um was es sich dabei handeln mochte, verborgen – denn in diesem Moment wurde ich abgelenkt von einem entsetzten Aufstöhnen der Männer, die zu beiden Seiten neben mir an der Reling standen. Ich schaute von den eigentümlichen Masten des schwarzen Schiffs hinab zum Deck. Dort, hinter dem Schanzkleid, erkannte ich, wie eine finstere Spiegelung unser selbst, die Mannschaft der Teuta. Doch trotz des unsteten Lichts, in dem ich alles andere erkennen konnte, blieben diese Männer in Schatten verborgen, als seien sie keine Menschen, sondern Schemen, die mit der Dunkelheit verschmolzen. Mir war das alles unerklärlich, zumal ich noch über die nautischen Wunderkünste des Schiffes selbst rätselte. Wer nun bei solcherlei optischem Gaukelwerk verwundert ausgerufen hätte, dass es hier mit dem Teufel zugehen musste – ich glaubte, dergleichen von den Seeleuten zu vernehmen, wenngleich verhalten und murmelnd –, dem habe ich einzugestehen, dass ich in diesem Zustand der Verwirrung aufs Heftigste erschrak, denn unter den Schattengestalten auf dem gegenüberliegenden Deck erkannte ich eine düster beleuchtete Figur, die mir, als hätte ich sie selbst beschworen, wie der Leibhaftige erschien!
Ich sah die Hörner, die aus seiner Stirn sprossen! Spitze Ohren, die von seinen Schläfen ragten! Einen spitzen Bart, der das spitze Kinn verlängerte! Stechende Augen mit einer geschlitzten Pupille über einer gebogenen und doch zugleich flachen Nase und einem dünnen, grausamen Mund! Der Leib war muskulös, sehnig, halbnackt und haarig und wurde getragen von zwei kräftigen, aber schmalen Beinen, die in – Hufen endeten!
Ich bin nun weder abergläubisch noch von einem Glauben, der von Schreckensgestalten bevölkert ist. Ein anderer Mann wäre vielleicht von diesem Glauben abgefallen und hätte sich einer mittelalterlichen Furcht hingegeben, angesichts dieser Teufelsgestalt! Doch ich hatte ja noch meinen Intellekt und mein Gedächtnis – und so erinnerte ich mich nicht allein an das hölzerne Bein der Teuta in Form eines Bocksschenkels sowie an die Munkeleien und das Fabulieren über deren Gefährten, samt eines verstörenden Meckerlauts. Sondern ich erkannte in dieser gehörnten Gestalt eine veritable Ausformung eines klassischen Satyrs, wenn nicht gar des Gottes Pan selbst. Und wenn diese Erkenntnis nun einen Altvorderen, einen Römer oder Griechen der Antike, in panischen Schrecken versetzt hätte, wenngleich es entgegen des damaligen Glaubens keine Mittagsstunde, sondern eben Mitternacht war, so fiel von mir doch jeglicher Schrecken ab und ich erkannte dies alles als Scharade, als Maskerade und Schabernack der Piraten, um die Mannschaften der angegriffenen Schiffe in lähmendes Entsetzen zu stürzen. Da stand also ein Mann auf Bocksstelzen und im Ziegenfell zwischen den verhüllten Gesellen des Enterkommandos, um das Spektakel nur recht schauerlich zu gestalten, denn eine Flagge mit Schädel und Knochen am Mast war in diesen Zeiten des Niedergangs des Freibeutertums nicht mehr hinreichend schreckerregend!
Ich überlegte rasch: War es für die Moral der russischen Seemänner förderlicher, wenn ich ihnen meine Erkenntnis in markigen Worten zurief – oder sollte ich doch besser Taten sprechen lassen? Ich entschied mich, indem ich meiner Eingebung folgte, die mich in Wüste und Prärie nie getrogen hatte. Ich hob den Henrystutzen an die Schulter, gleichzeitig fand ich sicheren Stand auf dem schwankenden Deck, indem ich mich mit den Stiefeln zwischen die Relingstangen stemmte. Rasch nahm ich mein Ziel ins Visier, federte die Dünung in den Knien ab – es war kaum anders, als aus dem Sattel meines galoppierenden Rih zu schießen. Ich atmete bedächtig aus. Mein Plan war es, dem Kostümierten zunächst die Hörner von der Maske zu schießen und hernach die Hufstelzen. Bei Letzteren war ich mir noch nicht ganz sicher, denn es schien mir, dass ich den Mann damit zu sehr demütigen, gar verletzen könnte, denn mir war die vergleichsweise geringe Größe der Gestalt aufgefallen, was bedeuten musste, dass der Stelzenträger ein Zwerg oder ein Versehrter ohne Beine war. Nun, ich würde mich nach den beiden Kugeln gegen die Hörner entscheiden, je nachdem, was nach meinen Schüssen geschehen würde.
Ich legte den Finger fest um den Abzug und zielte auf das Bockshorn.
„Kara Ben Nemsi!“
Mein Finger sprang vom Abzug fort! Es war nicht der Ruf allein, der mich vom Schuss abhielt – es war ein zweifacher Ruf! Wie ein seltsames Echo, das jedoch gleichzeitig erscholl, über das Rauschen der Wellen und des Windes. Zum einem hatte Haschim meinen Namen gerufen, direkt neben mir. Ich wandte kurz den Blick zu Seite und sah noch, wie der Scheik seine ausgestreckte Hand zurückzog. Hatte er mich greifen wollen, bei der Schulter, gar am Lauf des Gewehrs? Was konnte ihn dazu bewogen haben? Doch er musste mir nicht mehr mit einem Blick oder einem Wink bedeuten, dass ich meine Aufmerksamkeit sogleich von ihm wenden musste, wieder hinüber zum schwarzen Schiff. Ich spähte wieder über den Lauf meiner Waffe, in die Richtung, aus welcher der zweite Ruf erklungen war. Nein, es konnte nicht der Gehörnte, der Vermummte in seinem Bockskostüm gewesen sein, der da gerufen hatte – wie hätte er mich kennen können? Als ich noch mutmaßte, wer sich hinter der Maske verbergen mochte, trat jemand in mein Sichtfeld, aus der Masse der dunklen Gestalten und ebenfalls in Schwarz gekleidet, dennoch besser erkennbar als jene, aus welchem Grund auch immer. Die Gestalt hob eine schlanke, blasse Hand und vollführte eine knappe Geste. Kein Winken, kein Gruß, ich wusste nicht recht, was sie zu bedeuten hatte.
Wer die Gestalt war, erkannte ich jedoch, und es hätte nicht des grellen Himmelsleuchtens bedurft, um mir in Augen und Gemüt gleichermaßen ein Schlaglicht zu setzen:
Es war die Hexe Qendressa!
Sie sah kaum anders aus als damals, vor einigen Wochen im Land der Skipetaren, als ich ihr in der Berghütte des Schut unter dem Gipfel des Lowtschen begegnet war. Ihr Gesicht war fahl, die Augen schwarz in tiefschwarzer Umrandung aus Antimon, umweht von den Rabenschwingen ihres Haares, in dem sich einige helle Strähnen befanden. Kopf und Körper waren von einem Cape aus glänzender Ölhaut verhüllt, kaum anders als der Wetterschutz, den ich selbst trug. Sonst konnten wir unterschiedlicher nicht sein. Ich will nicht auf Gestalt und Geschlecht anspielen, das sei einerlei, da sie doch wie ich ein Mensch war und mir alle Menschen gleich sind. Aber Qendressa war eine Hexe, eine Schwarzkünstlerin. Ohne in inquisitorischen Eifer geraten zu wollen, in den Wahn der Jagd auf Zauberinnen, so verachtete ich sie doch ob ihrer Grausamkeiten gegen die Meinen, den Verrat an mir und den Gefährten, die Entführung, die Verletzung und Weiteres mehr. Und selbst ihre kurzen Anwandlungen von Gnade und Gerechtigkeit konnte ich nur wenig schätzen, denn sie waren stets Teil eines Handels zu ihrem Vorteil gewesen oder aus der Not ihrer Lage geboren.
Nun wollte sie Al-Kadir aufsuchen, vorgeblich, um den Lohn für ihre Dienste einzufordern, um den sie sich geprellt sah. Dies verwunderte mich kaum, denn Schurken haben untereinander eben doch keine Ehre, gleich, was der Volksmund darüber sagen mag. Ich bezweifelte aber, dass diese beiden nur ihre Schuldgeschäfte abschließen würden, wenn sie denn aufeinanderträfen. Sie würden wohl neue schauerliche Pläne schmieden. Ob Al-Kadir die Hexe dazu drängen oder überreden oder locken würde, konnte ich nicht wissen, aber ich ahnte es wohl und befürchtete einiges. Und das, obgleich ich nichts von den Umständen wusste, die das Geisterreich betrafen. Ich glaubte aber der Kenntnis und Weisheit Haschims, und dieser ging von üblen Dingen aus. Diese mussten wir vereiteln, Al-Kadir finden, mit Hilfe Marah Durimehs. Und jetzt zeigte sich an diesem unerwarteten Ort die Hexe, welche eine willige Helferin der Verbrecher war und deren Spur wir gesucht hatten. Das Schicksal hatte uns diese Begegnung geschenkt – wer hätte erwartet, dass wir zur gleichen Zeit die Passage über das Schwarze Meer unternahmen? Ich war nun nicht so töricht anzunehmen, dass die Hexe über die Wasser geflogen wäre, auf ihrem Weg nach Osten. Zwar war mir der Unglaube an das zauberische Fliegen längst abhandengekommen, ich hatte die Hexe ja mit eigenen Augen durch die Lüfte schweben sehen. Doch hing ich andererseits auch nicht dem Aberglauben an, etwa zu denken, Hexen vermöchten kein Gewässer zu queren. Es schien mir schlicht ein zu großer Aufwand der Kräfte – einerlei, ob sich jemand körperlich oder zauberisch verausgabte. Zumal Qendressa unter dem Fluch des Alters litt und ihre jugendliche Gestalt nur mühevoll aufrechterhielt. Sie erschien mittlerweile zwanzig Jahre älter als bei unserem ersten Treffen in Stambul, doch war sie noch nicht die greisenhafte Erscheinung, als die ich sie in der Höhle des Skipetarenfürsten durch den Musaddas erblickt hatte. Ich musterte ihr Gesicht genauer: Waren die Linien in ihren Zügen noch tiefer geworden? Im unsteten Licht konnte ich dies kaum erkennen. Drängte die Zeit auch für die Hexe? Nutzte sie deshalb ein Schiff, um ihre Kraft für sich selbst aufzusparen? Und das Schiff selbst und dessen Herrin …
Jetzt regte sich meine Hand am Henrystutzen, meine Finger krampften – als wollte mir mein Körper raten, nicht nachzusinnen, sondern zur Tat zu schreiten. Ich erschrak. Nie hatte ich geglaubt, dass mein Innerstes mir solch tückischen Rat geben würde, die Gelegenheit zu nutzen, einen Gegner, noch mehr: eine Gegnerin zu stellen. Ich wollte nicht die anderen Begriffe nutzen: zur Strecke bringen, ausschalten. Dies waren unmenschliche Denkweisen! Und doch: War eine Hexe, eine Zauberin, denn ein Mensch wie …