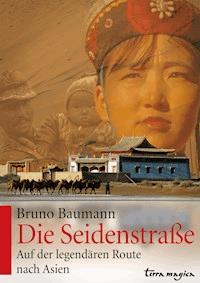
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reich terra magica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wertvolle Waren und kostbares Wissen wurden einst auf den Karawanenwegen der Seidenstraße transportiert. Doch für Bruno Baumann ist die Seidenstraße mehr als eine historische Handelsroute, sie ist ein moderner Verbindungsstrang zwischen Europa und Asien. In diesem Buch verbindet Bruno Baumann auf einzigartige Weise interessante Fakten und Details über die Seidenstraße mit Berichten über seine Abenteuer bei der Ergründung ihres Mythos und Erlebnisse im Rahmen seines aktuellen Projektes Silk Road Experiences. Eine spannende Reise zwischen damals und heute, die unter anderem auf den Spuren Marco Polos durch Venedig, in die Oasenwelt am Rande der Takla Makan und zu den himmlischen Bergen des Tien-Shan-Gebirges führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bruno Baumann
Die Seidenstraße
Auf der legendären Route nach Asien
Bunt bemalte Lastwagen mit hölzernen Kabinenaufbauten befahren den pakistanischen Karakorum-Highway, die uralte Verbindung zwischen dem Tarimbecken und dem indischen Subkontinent. Sie durchqueren dabei das Land der Hunza, eine karge Gebirgswüste mit verstreuten Oasen.
Die Zeit geht nicht,
sie stehet still,
wir ziehen durch sie hin;
sie ist die Karawanserei,
wir sind die Pilger drin.
Gottfried Keller
Besuchen Sie uns im Internet unter www.terramagica.de
© für die Originalausgabe und das eBook: 2013 by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten.
Schutzumschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel unter Verwendung eines Entwurfs von Simon Wendler
Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: Bruno Baumann
Karte: Eckehard Radehose, Schliersee
Die F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH empfiehlt, für ein optimales Leseerlebnis die Schrift Minion Pro zu verwenden
Satz, Layout und Reproduktionen: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-7243-6003-2
Terra magica ist seit 1948 eine international geschützte Handelsmarke des Belser Reich Verlags AG.
Inhalt
Karte
Mythos und Gegenwart
Auf Marco Polos Spuren
Auf dem Wasserweg zur »Serenissima«
Outdoor-Aktion auf den Kanälen Venedigs
Die Anfänge der Lagunenstadt
Handelsreisende und Missionare auf der Seidenstraße
Marco Polos Abenteuer
Venedig – die losgerissene Blüte
Die Kulturkarawane
Das Team
On the Road
Varna – die erste Station der Kulturkarawane
Das historische Erbe Varnas
Stadt der Gegensätze
Mit dem E-Bike in die Türkei
Istanbul – »die Eine«
Die »Intercultural Art Dialogue Days«
Das Konzert der Muezzine
Von Europa nach Asien
Auf der Straße der Reiternomaden
Der Kampf um Wasser
Khiva – Königin der Wüste
Buchara – »die Edle«
Samarkand – »die Goldene Stadt«
Die Passage nach China
Chinghis Aitmatov und seine Vision einer »Neuen Seidenstraße«
Oasen der Takla Makan – Perlen der Seidenstraße
Kashgar
Das alte und das neue Khotan
Bazar Kun – der große Wochenmarkt
Die Jagd nach dem Stein des Himmels
Schätze im Wüstensand
Rawak – Leuchtturm des Glaubens
Auf der Suche nach Dandan Oilik
Das »Pompeji der Wüste«
Mazar Tagh – eine tibetische Festung auf der Seidenstraße
Die himmlischen Berge
Expedition zu den »Himmelspferden«
Vom Sand zum Eis
Die letzte Station – das Höhlenkloster von Kizil
Chronik der Seidenstraße
Literatur
Lesetipps
Mythos und Gegenwart
Die »Karawanen« der neuen Seidenstraße sind die Lastwagenkolonnen, die auf abschüssigem Terrain Gebirge überwinden und auf staubigen Pisten Wüsten durchkreuzen. Mit heulenden und rauchenden Motoren bewegt sich dieser Fahrzeugtross in der dünnen Luft von über 4000 Metern Höhe auf dem Karakorum-Highway in Pakistan.
Die Seidenstraße ist das bedeutendste Band, das es je auf Erden zwischen Völkern und Kontinenten gab.
Sven Hedin
Es ist nirgendwo überliefert, wann und wo sich in China die erste Handelskarawane formierte, um in Richtung Westen aufzubrechen. Genauso wenig wissen wir über die Frequenz von Karawanen entlang der Seidenstraße. Nur die Wege, die sie nahmen, kennen wir, die verschiedenen Routen und Zweige, die sich über Tausende Kilometer erstreckten. Eigentlich müsste man den Begriff in der Mehrzahl gebrauchen – Seidenstraßen –, denn was wir heute als Seidenstraße bezeichnen, war in Wirklichkeit ein komplexes Netzwerk von uralten Karawanen- und Völkerwanderungswegen, die dafür sorgten, die oft gefährdete, doch nie ganz unterbrochene Verbindung zweier unterschiedlicher Kontinente – Europa und Asien – aufrechtzuerhalten. Es gibt auch keinen Erfinder der Seidenstraße. Niemand ist auf die innovative Idee gekommen, einen solchen antiken »Superhighway« zu begründen, sondern es gab bestimmte Voraussetzungen, die zur Entstehung der Seidenstraße führten – und diese Voraussetzungen wurden schon früh in China geschaffen. Bereits der erste große Kaiser Chinas, der legendäre Qin Shihuangdi, der im dritten vorchristlichen Jahrhundert die verschiedenen kleinen Reiche zu einem einzigen großen Reich vereinte, ergriff Maßnahmen, die zur Entwicklung der Seidenstraße führten. Er ließ in seinem Reich Wege mit genormter Spurbreite anlegen und bereits bestehende Befestigungsanlagen im Norden nach und nach zu einem einzigen Wall verbinden.
Seidenhändler in Kashgar. Das Geheimnis der Seidenherstellung gelangte angeblich durch eine kaiserliche chinesische Prinzessin in die Oasenwelt am Rande der Takla Makan.
Noch viel früher hatte man im Osten Chinas das Geheimnis der Seide entdeckt. So, wie viele andere Erfindungen im Reich der Mitte den jeweils regierenden Herrschern zugerechnet wurden, brachte man auch die Technologie der Seidenherstellung mit der damaligen Kaiserin in Verbindung. Die Wirklichkeit dürfte freilich weniger glamourös gewesen sein. Vermutlich war es eine unbekannte Bäuerin, die vielleicht durch Zufall, indem ihr der Kokon eines Seidenspinners in heißes Wasser fiel, erkannte, dass sich daraus ein Faden abhaspeln lässt – eben wenn man ihn in kochendes Wasser taucht, bevor die Raupe darin sich in einen Schmetterling verwandelt und aus dem Kokon entschlüpft.
Chinesische Seide zählte im fernen Rom zu den begehrtesten Luxusgütern und wurde fast mit Gold aufgewogen. Die Nachfrage nach Seide bei den alten Römern war so groß, dass der Senat den Männern sogar das Tragen von Seidenkleidern verbot; vorgeblich aus moralischen Gründen, aber in Wirklichkeit, weil der Import der Seide die Staatskassen leerte und Rom kein auch nur annähernd so wertvolles Exportgut besaß, um dieses Defizit zu kompensieren. China hingegen verdiente sich mit der Seide eine goldene Nase und setzte alles daran, das Geheimnis der Seide zu hüten und damit seine Monopolstellung zu bewahren. Kein Wunder also, dass auf Ausfuhr von Seidenraupeneiern und Maulbeersamen die Todesstrafe stand.
Ausgerechnet eine kaiserliche Prinzessin soll den Frevel des Technologietransfers begangen und dafür gesorgt haben, dass das wertvolle Wissen Khotan erreichte, von wo es später durch Anhänger einer christlichen Sekte weiter nach Westen geschmuggelt wurde. Trotzdem blühte der Handel mit chinesischer Seide weiter, selbst dann noch, als es im Europa des Mittelalters längst eine eigene Produktion gab, weil chinesische Seide trotz des langen Transportwegs billiger war.
Im chinesischen Kernland reisten die Händler im Schutz der militärischen Macht des Reichs der Mitte, die freilich von der Befindlichkeit der jeweils herrschenden Dynastie abhing. In Kriegszeiten und Wirren, die den Untergang von Dynastien einläuteten, brach auch der Handel zusammen; sobald sich eine neue Dynastie etabliert hatte und das Reich zentral beherrschte, florierte der Handel wieder.
Seit der Han-Dynastie (206 v. Chr.–220 n. Chr.) existierte ein geschlossener Wall, der das Reich im Norden vor den Einfällen der Steppennomaden schützen sollte und sich westwärts bis nach Dunhuang erstreckte. Freilich hatte dieser Han-Limes noch wenig mit jenem beeindruckenden Bauwerk aus Steinquadern zu tun, das heute als Große Mauer zum touristischen Standard-Besuchsprogramm gehört – diese stammt aus viel späterer Zeit –, sondern war nur ein einfacher Wall aus Lehm. Dennoch schützte er auch die Seidenstraße und trug dazu bei, den interkontinentalen Fernhandelsweg offen zu halten. Die alten Chinesen setzten die Große Mauer sogar noch weiter nach Westen, bis ins Tarimbecken hinein, fort, allerdings nicht mehr in Form eines geschlossenen Walls, sondern nur noch durch einzelne Wachtürme, antike Feuertelegrafen, die bis heute in regelmäßigen Abständen mehr oder weniger verfallen aus dem Wüstenboden ragen. Diese endeten am Yumenguan, der Festung am Jadetor-Pass. Danach gab es nur noch Wüste, insbesondere die als Todeswüste gefürchtete Takla Makan: weite menschenleere Räume, Irrgärten aus Sanddünen, weglos und trostlos. Die einzigen Wegweiser, so überliefern es die Quellen einhellig, sollen die Überreste früherer Reisender oder die Skelette toter Tiere gewesen sein.
Haben früher aufgestellte Kamelgerippe den Karawanen den Weg gewiesen, so sind die Wegzeichen entlang der neuen Seidenstraße zwar anders, aber nicht weniger abschreckend.
Hier übernahmen die Kamele den Lastentransport. Die Händler taten sich zusammen, um sich gegen die Gefahren der Wüste zu wappnen. Hundert, fünfhundert, ja bis zu tausend Tiere formten einen Karawanenzug. Ohne die einzigartigen Fähigkeiten des Kamels hätte es keine Seidenstraße gegeben, wären derartige Wüstenpassagen für die Menschen unüberwindbar gewesen. In der brütenden Hitze des Sommers, wenn sich die Sandoberfläche bis auf siebzig Grad aufheizt, reisten die Karawanen nachts. Wie die Seefahrer orientierten sich die Führer an den Gestirnen. Sie suchten nie den kürzesten Weg durch die Wüste, sondern folgten stets der sichersten Route. Diese führte an den Rändern entlang, von einer Oase zur anderen, von einem Brunnen zum nächsten. So entstanden Nord- und Südroute der Seidenstraße, die die Takla Makan wie ein Ring umgingen. Aus den Halteplätzen, den Oasen, wurden im Lauf der Zeit Karawansereien mit Märkten und kulturellem Leben. Keine Karawane legte die gesamte Strecke von China bis Europa zurück. Die Waren wurden weitergereicht von Völkern, die zwischen den Chinesen und Römern lebten und als Zwischenhändler fungierten.
Ohne Kamele hätte es keine Seidenstraße gegeben, wären die Wüstenpassagen für den Fernhandel unüberwindbar gewesen. Heute werden die Tiere nur noch wegen der Wolle gezüchtet oder für touristische Zwecke wie hier im Dünen-Disneyland von Dunhuang.
Hatten die Karawanen die Durststrecke der Wüste hinter sich, dann bauten sich vor ihnen die Berge zu schwindelerregender Höhe auf. Über mehrere der höchsten Gebirge der Welt – Karakorum, Tien Shan und Hoher Pamir – führten Routen und Zweige der Seidenstraße. Hier beförderten zottelige Yaks oder balancierten Maultiere die Lasten über schmale Saumpfade. Wurde das Gelände so unwegsam, dass auch die Tiere nicht mehr vorankamen, bürdeten sich die Männer die Lasten selbst auf. So oder so ähnlich dürfte der Handelsverkehr stattgefunden haben vor zweitausend Jahren, auf dem Herzstück der Seidenstraße durch China und Zentralasien.
Mit Vollgas über die Steppe, lautet die Devise der Viehhirten von heute, die in jenen wüstenartigen Gebieten Zentralasiens leben, durch die einst die Karawanen der Seidenstraße zogen.
Im Vergleich zum hehren Alter dieser Karawanenstraßen ist der Begriff »Seidenstraße« sehr jung. Der Geograf Ferdinand von Richthofen (1833–1905) hat ihn erst im vorletzten Jahrhundert in die Wissenschaft eingeführt. Er benannte das Geflecht von uralten Karawanen- und Völkerwanderungswegen nach dem wertvollsten Gut, das man dort austauschte: der chinesischen Seide. Aber Seide war nur eines von vielen Gütern, die auf dem ältesten interkontinentalen Fernhandelsweg der Menschheit gehandelt wurden. Aus China kamen auch Porzellan, Teppiche, Jade, Gewürze und Tee nebst den Erfindungen, die im Reich der Mitte gemacht wurden, wie Kompass, Papier oder Drucktechnik. Der Westen hatte vergleichsweise wenig zu bieten. Von den Römern holten sich die Chinesen lediglich Rüstungstechnik.
Trotzdem war die Seidenstraße keine Einbahnstraße, denn auf ihr wurden nicht nur Waren befördert, sondern auch Religionen, kulturelles Gedankengut und Kunststile verbreitet. Im Gefolge der Kaufleute reisten Künstler, Architekten, Mönche und Priester. Zwei Weltreligionen verbreiteten sich entlang der Seidenstraße: zuerst der Buddhismus, dann der Islam. Hinzu kamen noch Einflüsse der persischen Lichtreligion des Mani und christlicher Nestorianer, die sich der Verfolgung im Oströmischen Reich entzogen und entlang der Seidenstraße bis in die Oasenwelt des Tarimbeckens gelangten, um dort Gemeinden zu gründen.
Mit der Entwicklung des Seewegs, der Seidenstraße der Meere, entstand eine Alternative zum Landweg, der immer wieder durch kriegerische Ereignisse vorübergehend blockiert war. Den Todesstoß versetzte der Seidenstraße als Landverbindung erst die Entdeckung des Seewegs von Europa nach Indien durch Vasco da Gama (1468 oder 1469–1524). Dieser wurde bald bis nach China hin ausgedehnt. Damit wurde Zentralasien als Dreh- und Angelpunkt des Handels bedeutungslos. Die Verlagerung auf den sicheren Seeweg bedeutete das Ende des Karawanenhandels und damit der Seidenstraße und den Niedergang des Reichtums und der Macht der Reiche, die entlang ihrer Routen lagen. Exponierte Oasenorte, einst des Handels wegen gegründet, wurden im Lauf der Zeit von den Menschen verlassen und fielen der Wüste anheim. Dort schlummerten die Überreste jahrhundertelang, wurden allmählich vom Sand verweht und gerieten in Vergessenheit – bis sie Kinder einer anderen Zeit wiederentdeckten.
Es war jener Ferdinand von Richthofen, der Namensgeber der Seidenstraße, bei dem ein junger Schwede studierte, der durch seine spektakulären Expeditionen durch Asiens Wüsten für Furore sorgte – sein Name: Sven Hedin (1865–1952). Er läutete ein »internationales Wettrennen« um die Schätze der Seidenstraße ein, an dem sich Briten, Deutsche, Franzosen und Japaner beteiligten, bis dann zur Mitte des letzten Jahrhunderts die Chinesen die Tür zuschlugen.
Doch die Seidenstraße ist nicht nur »Schnee von gestern«, nicht bloß eine nostalgische Reiseroute oder ein Betätigungsfeld für Archäologen, Kunsthistoriker oder Religionswissenschaftler. Seit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Entstehen unabhängiger Turkstaaten in Zentralasien gibt es die Vision einer neuen Seidenstraße. Vordenker wie der kirgisische Schriftsteller und Politiker Chinghis Aitmatov haben sie formuliert. Die »Neue Seidenstraße« ist seitdem ein Zauberwort, das die Fantasie von Politikern unterschiedlichster Couleur von Beijing bis zum Kaspischen Meer anregt.
In den ariden Zonen Mittel- und Zentralasiens wird zunehmend die Sonne als Energiequelle genutzt. Mithilfe von kleinen Fotovoltaikanlagen können Wüstenbewohner ihren Strombedarf decken.
Dahinter stecken weniger nostalgische Sehnsüchte als vielmehr handfeste wirtschaftliche Interessen. Man plant auf den Spuren der antiken Seidenstraße den Ausbau der Infrastruktur in Form moderner Straßen, Schienenstränge, Ölpipelines und Datenhighways. Damit erhofft man sich jene wirtschaftlich blühenden Landschaften, die die politischen Führer ihren Völkern gebetsmühlenartig versprechen. Doch ein Austausch, der allein auf wirtschaftlichen Interessen beruht, reicht nicht aus, um ein konfliktfreies Miteinander zu gewährleisten. Der Dialog – genau das lehrt uns das Beispiel der historischen Seidenstraße – muss auf einer viel breiteren Basis geführt werden, die alle relevanten Ebenen menschlichen Zusammenlebens einschließt. Dazu gehört die kulturelle Ebene genauso wie die religiöse. Mehr und schnellere Kommunikation sowie unbegrenzter Warenaustausch bedeuten nicht automatisch größere Toleranz und besseres Verstehen.
Stolz präsentieren diese mongolischen Jurtenbewohner ihr neues Statussymbol. Wenn draußen der schönste Sternenhimmel glitzert und funkelt, versammeln sie sich vor dem Fernsehschirm, über den bunte Bilder aus einer anderen Welt flimmern.
Diese Erkenntnis stand am Anfang von »Roads of Dialogue« (www.silkroadexperiences.org), einem Projekt, das ein Zeichen setzen will in Form einer modernen Kultur- und Wertekarawane. Ein multikulturell besetztes Team aus Musikern, Künstlern, Sportlern und Querdenkern begibt sich auf die Reise entlang der Seidenstraße, um an ausgewählten Orten haltzumachen und gemeinsam mit Vertretern der jeweiligen Städte und Länder ein dialogorientiertes Programm durchzuführen. Das Projekt ist langfristig angelegt mit jährlich stattfindenden Aktionen, die das Ziel verfolgen, den interkulturellen Dialog als Chance und Herausforderung der Gegenwart zu fördern und damit den Geist der Seidenstraße wiederzubeleben. Darüber hinaus sollen relevante Themen wie Wasser, zukunftsweisende Mobilität oder Energie in den Fokus gerückt werden. Bisher hat uns die Kulturkarawane bis an den Rand Asiens geführt. Weitere Stationen und Aktionen sind in Planung.
»Roads of Dialogue« ist die Quintessenz meiner Beschäftigung mit der Seidenstraße, die mich schon seit meiner Jugend faszinierte und zu einer Vielzahl von Reisen inspirierte. Am Anfang stand wie so oft die Neugier, die Möglichkeit, im Zeitalter von Google Earth einen Weg zu beschreiten, den man stellenweise erst freilegen muss wie einen vom Dschungel überwucherten Pfad. Auch die Sehnsucht, einem Mythos nachzuspüren, trieb mich an. Später, als ich begann, die großen Wüsten Asiens zu Fuß zu durchmessen, kreuzte ich immer wieder Spuren der Seidenstraße, wenn ich plötzlich vor halb verwehten Ruinen stand, die wie Masten eines Schiffs aus dem Sandmeer ragten. Von diesen Reisen – den Stationen unserer Kulturkarawane und davon unabhängigen Abenteuern – will ich hier erzählen, so als wären sie eine einzige gewesen.
Die meisten Menschen, die den Begriff Seidenstraße hören, denken sofort an Marco Polo, den berühmtesten europäischen Reisenden entlang der Seidenstraße, dessen Reisebericht zu einem Bestseller des Mittelalters wurde. Grund genug, auch unsere Reise dort zu beginnen, wo einst der Kaufmannssohn zu seinem Abenteuer aufbrach: in Venedig.
Auf Marco Polos Spuren
In der Abenddämmerung, wenn die Tagestouristen verschwunden sind und die Lagunenstadt wieder den Venezianern gehört, hat auch der Gondoliere sein Geschäft beendet und steuert sein Gefährt nach Hause.
Die erste und einzige Route, die ich dir empfehlen möchte, hat einen Namen. Sie heißt: Zufall. Untertitel: Ohne Ziel. Sichverirren ist der einzige Ort, den anzusteuern es sich lohnt.
Tiziano Scarpa
Ich bin wieder einmal in Venetien, genauer gesagt in Bassano del Grappa, dort, wo die Brenta in die Ebene tritt – jener Fluss, der einstmals Venedig wie eine Nabelschnur mit dem Hinterland verband. Hier habe ich mich mit zwei Einheimischen – Nicola und Moreno – zum Cappuccino verabredet. Wir sitzen am langen Tresen einer Bar und blicken durch die Fenster nach draußen in ein milchig-weißes Nichts.
»Heute ist wieder einmal ein Tag, an dem der Nebel bis in die Kaffeetassen kriecht«, sagt Nicola. »Absolut«, assistiert Moreno. Die beiden sind Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Nicola ist ein Freigeist, der sich als Querdenker versteht. Er sprüht vor Ideen, führt meist das Wort, während Moreno, ein Zahnarzt, an seinen Lippen hängt und jedem noch so verrückten Einfall begeistert applaudiert. Zwischen den beiden hat sich so etwas wie ein ritualisierter Dialog entwickelt. Das geht so: Nicola verkündet, dass er einen alten verlassenen Leuchtturm auf Sardinien in eine Denkschmiede umwandeln will, also zu einer Art geistigem Leuchtturm für junge innovative Köpfe aus ganz Europa. Moreno sagt darauf: »Warum nicht?« Die Mittel dazu, so ist Nicola überzeugt, würden aus EU-Töpfen sprießen. »Absolut«, versichert Moreno, als wäre das so sicher wie das Amen im Gebet.
Ich lenke das Gespräch auf den eigentlichen Grund unserer Zusammenkunft. Es geht um die Möglichkeiten, wie sich Venedig in mein Projekt »Roads of Dialogue« einbinden ließe. Um diese zu erkunden, will ich mit Nicola und Moreno die Touristenmetropole besuchen.
»Wie wollen wir morgen nach Venedig fahren?«, will ich wissen. »Mit dem Boot«, antwortet Nicola, ohne zu zögern. »Also mit dem Auto bis Tronchetto und dann mit dem Vaporetto bis zur Ponte di Rialto?« »Nein! Mit dem Boot von Treviso«, sagt Nicola in einer Bestimmtheit, als wäre das der einfachste Weg, nach Venedig zu kommen.
Moreno blickt ihn fragend an, und es dauert etwas länger, bis ihm das »Warum nicht« über die Lippen kommt. Man merkt ihm an, dass er vom Vorschlag seines Freundes überrumpelt wurde, denn Nicola besitzt weder Boot noch Führerschein. Die Aktion kann daher nur stattfinden, wenn uns Moreno mit seinem Privatboot fährt. Nach ein paar hektischen Telefonaten hat Moreno die Termine in seiner Praxis umdisponiert, und wir verabreden uns für den nächsten Tag in aller Frühe am Jachthafen von Treviso.
Auf dem Wasserweg zur »Serenissima«
Die Morgendämmerung hat gerade eingesetzt, als wir uns vor dem Bootshaus treffen. Der Nebel ist zwar verschwunden, aber der Himmel ist mit dunklen, regenschweren Wolken behangen. »Der Wetterbericht hat eine Sturmwarnung ausgegeben«, bemerkt Nicola beiläufig, während Moreno jedem von uns eine Schwimmweste und einen Regenschirm in die Hand drückt. »Wenn wir Glück haben, beginnt es erst mittags zu regnen«, sagt Moreno. Mit wenigen Handgriffen ist das Boot startklar. Moreno wirft den PS-starken Außenbordmotor an und steuert das Boot gekonnt aus dem Labyrinth schmaler Kanäle hinaus. Sobald wir offenes Wasser erreicht haben, dreht er mächtig auf. Der Bug des Boots hebt sich aus dem Wasser, einen breiten Schweif aus Gischt und Wellen hinter sich herziehend.
Wir folgen zunächst dem Lauf des Sile-Flusses, der sich in Richtung Lagune schlängelt. Sein natürlicher Verlauf wurde bereits im 17. Jahrhundert durch groß angelegte Wasserregulierungsmaßnahmen der Republik Venedig verändert. Um zu verhindern, dass zu viel Wasser in die Lagune strömte und Hochwasser verursachte, wurde nebst anderen Flüssen auch der Sile umgebettet. Zudem sollte damit eine Verschlammung der Lagune als Folge der natürlichen Schwemmfracht der Flüsse verhindert werden. Den alten Venezianern diente das Gebiet entlang des Sile als Kornkammer. Die gleichmäßige Wasserführung eignete sich besonders zum Betreiben von Wassermühlen, in denen das Mehl für die Lagunenstadt gemahlen wurde. Einige davon sind noch heute erhalten. Darüber hinaus war der Sile einer der wichtigsten Wasserwege für den Warenaustausch zwischen Venedig und dem Festland. Dafür benutzte man früher kiellose Frachtkähne mit plattem Boden, die flussaufwärts zumeist gezogen werden mussten. Heute sind der Sile und seine Kanäle, die in die Lagune einmünden, als Handelsweg bedeutungslos, aber umso beliebter für Ausflüge. Zu den Touristen, die auf Hausbooten umherschippern, kommen die vielen privaten Bootsbesitzer, die in ihrer Freizeit aus den Städten flüchten. Doch an diesem trüben Wochentag, zu dieser frühen Stunde, sind wir ganz allein auf dem Fluss unterwegs.
Der als »Taglio« bekannte Sile-Kanal mäandert nun durch ein Sumpfgebiet aus mannshohem Röhricht. Moreno steuert das Boot im Zickzackkurs durch das idyllische Biotop. Bald darauf gleiten wir durch den schmalen Durchstich in die Lagune hinaus, in eine weite offene Wasserfläche, die der Wind aufgewühlt hat. Wellen trommeln gegen das Schlauchboot, Wasser spritzt über die Bordwand, sodass Moreno nun langsamer fahren muss. Am Festland lassen sich die Industrieanlagen von Porto Marghera erkennen und dahinter der Marco-Polo-Flughafen, auf dem der morgendliche Luftverkehr einsetzt. Vor uns tauchen nun die ersten Inseln Venedigs auf.
Mit Moreno und Nicola auf dem Weg von Treviso in die Lagune von Venedig. Während wir die Inseln Burano und Murano passieren, brauen sich bereits dunkle regenschwere Wolken zusammen.
»Wir müssen bald tanken«, sagt Moreno und steuert auf die nächstgelegene Insel zu. Doch die Tankstelle ist noch geschlossen. »Dann gehen wir inzwischen Cappuccino trinken«, schlägt Nicola vor. Moreno lenkt das Boot in einen schmalen Kanal, an dem sich zu beiden Seiten bunte Häuser wie Farbtupfer auf einem Gemälde aneinanderreihen. Wir sind auf Burano angekommen. So dicht gedrängt, wie die Häuser stehen, liegen die Boote festgebunden. Nirgendwo auch nur eine Lücke. Entnervt lässt uns Moreno an einem Steg aussteigen und fährt wieder zurück zur Tankstelle, um das Boot dort zu parken.
Wir laufen die bunte Häuserfront entlang, und ich frage mich, welche Laune die Bewohner dazu bewogen haben mag, sie so farbenfroh zu bemalen. Es heißt, dass es auf Burano einstmals nur drei oder vier Familiennamen gab. Ein Albtraum für den Postboten. Irgendwann sollen dann die Leute beschlossen haben, ihre Häuser in verschiedenen Farbtönen anzustreichen, sodass es für ihn einfacher wurde, die Post zu den richtigen Empfängern zu bringen. Vielleicht haben die Bewohner diese Geschichte aber auch nur erfunden, weil sie einfach keine Lust mehr hatten, immer wieder dieselbe Frage zu beantworten. Ursprünglich war Burano ein Fischerdorf, und niemand fragte danach, warum die Menschen so farbenfrohe Boote hatten. Warum sollten die Fischer ihre Häuser nicht genauso bunt bemalen? Der Ort wirkt um diese frühe Stunde und außerhalb der Touristensaison wie ausgestorben. Knapp dreitausend Menschen leben nach amtlichen Statistiken noch hier, Tendenz fallend. Die jungen Leute sind längst aufs Festland gezogen. Während die Männer früher zum Fischfang hinausfuhren, stellten die Frauen in Gemeinschaftsarbeit feine Stickereien her. An einzelnen Stücken waren bis zu fünfundzwanzig Frauen jahrelang beschäftigt. Heute finden sich auf Burano fast nur noch Billigprodukte aus China, die das schnelle Geschäft mit den Tagestouristen bedienen.
Das einstige Fischerdorf Burano ist heute wegen seiner bunten Häuser ein beliebtes Ausflugsziel. Ursprünglich fand hier der Karneval statt, ehe Venedig dem Ort den Rang ablief.
Nicola steuert zielstrebig die einzige Bar an, an der das Schild »aperto« – »geöffnet« – prangt. Dort serviert ein tätowierter Barmann seinen Kunden, allesamt Männer vorgerückten Alters, bereits zum Frühstück Prosecco. Immerhin gibt es auch frische Croissants. Nach einer Tasse Kaffee erscheint Moreno. Er hat inzwischen den Tankwart ausfindig gemacht und drängt mit sorgenvollem Blick nach draußen zum Aufbruch. Der Himmel hat sich bedrohlich eingetrübt.
Wir laufen zum Boot, betanken es und fahren los. Es dauert nicht lange, bis uns die ersten Tropfen ins Gesicht peitschen. Das offene Schlauchboot bietet so gut wie keinen Schutz. Moreno deutet auf die Regenschirme. Ein lächerliches Unterfangen. Sie halten dem Fahrtwind nicht lange stand. Ich versuche, wenigstens meine Fotoausrüstung damit zu schützen. Zum Glück bleibt es zunächst nur bei wenigen Tropfen. Wir sind nun auf der Hauptroute nach Venedig, die durch hölzerne Pfähle markiert ist. Taxiboote kommen uns entgegen, aber auch Halbwüchsige, die auf ihren Booten mit 100-PS-Motoren in Höchstgeschwindigkeit hintereinander herjagen. Sie lachen und winken uns freundlich zu, obwohl sie unser Boot fast zum Kentern bringen.
Vor uns zeichnen sich immer deutlicher die Umrisse der »Serenissima« – »Ihrer Durchlaucht« – ab. Trotz des unwirtlichen Wetters finde ich Gefallen an der Idee, dass wir uns Venedig auf dem Wasserweg nähern. Wer am Bahnhof ankommt, der betritt den »Palast« durch die Hintertür. Das Gesicht der Stadt blickt zum Meer. Ihr amphibisches Wesen lässt sich nur vom Wasser aus erspüren. Während andere Städte des Mittelalters sich mit Mauern schützten, stellte Venedig offen seinen Prunk und Reichtum zur Schau – zum Wasser hin. Die Serenissima vertraute auf ihre Macht zur See und auf die natürliche Verteidigungslage ihrer Lagune. Die einzigen Wehrmauern, die es in Venedig gab, sind jene des Arsenals. Dort wurden einst wie am Fließband Galeeren gebaut, die jahrhundertelang Venedigs Vormachtstellung im Mittelmeer sicherten.
In der Glanzzeit im 12. Jahrhundert herrschte die Lagunenrepublik über ein Kolonialreich, das sich bis nach Konstantinopel (das frühere Byzanz und spätere Istanbul) und Kreta erstreckte. Mithilfe eines weitverzweigten Netzes aus Stützpunkten und Niederlassungen kontrollierten venezianische Kaufleute den lukrativen Handel mit dem Orient. Rückgrat der Seemacht war »Il Arsenale«, der erste Industriebetrieb der Neuzeit, mit Montagestraßen und Arbeitsteilung, vierhundert Jahre vor der industriellen Revolution. Heute ist das Arsenal ein Kunstbetrieb, einer der Schauplätze für die zweijährlich stattfindende internationale Kunstausstellung der Biennale.
Indessen ist Moreno in einen schmalen Kanal eingebogen, der nur im Einbahnverkehr zu befahren ist. Bei jeder Brücke, die wir passieren, müssen wir uns ducken. Als wir am anderen Ende des Kanals wieder herauskommen, haben wir den Canal Grande erreicht. Moreno will noch eine Ehrenrunde drehen und steuert das Boot in Richtung Piazzale Roma. Doch wir kommen nicht so weit. Noch vor dem Bahnhof hält uns ein Polizeiboot an. Freundlich, aber bestimmt werden wir von den Beamten zur Umkehr gezwungen. Der Grund: Unser Boot ist nicht für Venedig registriert. Moreno mimt den Ahnungslosen. Die Carabinieri zeigen sich gnädig und belassen es bei einer Ermahnung, diesmal. Sie machen jedoch kein Hehl daraus, dass wir, sollten wir wieder erwischt werden, nicht mehr so glimpflich davonkommen werden. Auf Verstöße gegen die Verordnung zum Bootsverkehr in Venedig gibt es satte Geldbußen.
Blick von San Marco über das maritime Gewässer auf die Insel San Giorgio Maggiore. Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm, doch bald werden sich die Schleusen des Himmels öffnen.
Moreno überlegt, uns nahe dem Palazzo der Stadtverwaltung abzusetzen und dann in den Giudecca-Kanal hinauszufahren. Dieser gilt als maritim, und dort gelten die Verordnungen der Kommune nicht. Es bleibt bei der Absicht, denn Augenblicke später öffnen sich die Schleusen am Himmel. Die Schirme sind zerfetzt, nirgendwo ein Platz, an dem wir anlegen können. Was tun? Wir flüchten unter die Rialto-Brücke. Nach einigen Minuten lässt der wolkenbruchartige Regen etwas nach, und wir versuchen noch einmal unser Glück. Der Canal Grande ist wie leer gefegt, und ich frage mich, wohin all die Boote so schnell verschwunden sind. Allerdings erklärt das, warum wir keinen Anlegeplatz finden. Bug an Bug liegen die Boote dicht gedrängt beiderseits des Kanals, den wir langsam entlanggleiten.
Indessen hat es wieder stärker zu regnen begonnen. Auf einen grün livrierten Diener, der mit seinem Regenschirm am Steg eines Luxushotels steht und uns beobachtet, müssen wir wohl einen so erbarmungswürdigen Eindruck machen, dass sich sein Mitleid regt. Jedenfalls winkt er uns heran. Wir dürfen das Boot an dem hoteleigenen Platz festmachen, aber nur für kurze Zeit, wie der gutherzige Mann betont. Triefend vor Nässe betreten wir die Hotelhalle. Das Personal hinter der Rezeption schaut uns schief an, während eines der Dienstmädchen hinter uns her den Marmorboden trocken wischt. Nicola erkundigt sich scheinheilig nach den Zimmerpreisen. Daraufhin erhellen sich die Gesichter an der Rezeption ein wenig, und man lässt uns in die Bar. Dort können wir zumindest die nassen Jacken ein wenig trocknen. Eine philippinische Barfrau serviert uns Kaffee in edlem Gedeck. Ob wir Italiener wären, möchte sie wissen. »Ist das wichtig?«, fragt Nicola irritiert. »Für Italiener kostet der Cappuccino nur fünf Euro, sonst das Doppelte«, klärt sie uns auf.
Erfrischt und mit einigermaßen trockenen Klamotten laufen wir auf hölzernen Stegen am Canal Grande entlang.
Als wir nach unserer Erkundungsrunde wieder im Boot sitzen, machen uns weder Regen noch Carabineri zu schaffen. Allerdings wählt Moreno den erlaubten Weg über den offenen Giudecca-Kanal. Ich mache keinen Hehl daraus, wie gerne ich Venedig auf dem Wasserweg erkunden würde. Das sei gar kein Problem, versichert Nicola, denn die Beschränkung der Fahrerlaubnis betreffe nur motorisierte Boote. Würde ich ein Paddelboot benutzen, könnte ich mich ungehindert selbst auf den schmalsten Kanälen bewegen. Das war das Stichwort, auf das ich gewartet hatte. Plötzlich war mir klar, wie wir Venedig in die »Roads of Dialogue« einbinden konnten.
Outdoor-Aktion auf den Kanälen Venedigs
Gedacht, getan. Ein paar Wochen später bin ich wieder auf dem Weg nach Venedig. Diesmal mit einem Teil des »Roads of Dialogue«-Teams. Als Auftakt für eventuell später folgende Veranstaltungen möchten wir in Venedig eine Outdoor-Aktion durchführen. Wir haben wildwassertaugliche Schlauchboote im Gepäck und jede Menge Regenbekleidung für den Fall der Fälle. Diese hätten wir getrost zu Hause lassen können, denn als wir in Tronchetto mit unserem Gepäck in ein Vaporetto steigen, taucht die aufgehende Sonne die Lagune in ein unwirkliches Licht, in ein goldenes Glühen, in dem die Wolken verdampfen. Der Höhepunkt des Karnevals in Venedig steht unmittelbar bevor, doch zu dieser frühen Stunde ist es noch ruhig, die Ruhe vor dem Sturm.
Wenngleich das Karnevalsfest in Venedig viel älter sein dürfte, findet sich die erste nachweisbare Erwähnung einer Maske erst im 13. Jahrhundert. Neben den Fantasiemasken finden sich auch Masken mit historischem Bezug wie das Gespann von Pestdoktor und Tod.
Wir steigen an der Rialto-Brücke aus. Es ist sieben Uhr, und um diese Zeit gehört die Stadt noch sich selbst – denken wir jedenfalls. Doch wir haben nicht mit dem Barbesitzer gerechnet, der am einzigen noch freien Fleck, den wir finden, um unsere Boote aufzupumpen, partout seine Tische aufstellen will. Er macht uns lautstark klar, dass er unsere Anwesenheit als geschäftsstörend empfindet. Dabei ist noch kein einziger potenzieller Kunde weit und breit zu sehen. Nur ein Venezianer läuft, ohne einen Blick an uns zu verschwenden, vorbei, und zwei Carabinieri erscheinen, wohl angelockt durch unser seltsames Treiben. Sie schauen uns eine Zeit lang zu, und nachdem es nichts zu beanstanden gibt, ziehen sie wieder ab.
Rosafarben wölbt sich der Himmel über die Palazzi, als wir die Boote ins Wasser setzen. Zunächst drehen wir zum Einfahren eine kleine Runde entlang des Canal Grande, während ich Laura, die vorne sitzt und keinerlei Erfahrung im Umgang mit einem derartigen Boot hat, die wichtigsten Paddelmanöver zeige. Laura hatte im Rahmen ihres Medienanthropologie-Studiums Interesse an dem Projekt und bereits im Vorfeld wichtige Aufgaben übernommen. In Venedig gibt es zwar kein Wildwasser, aber in den engen Kanälen wird es notwendig sein, das Boot exakt zu steuern. Michael, mein Projektpartner und ein Outdoor-Experte, folgt zusammen mit Peter im zweiten Boot. Dann tauchen wir in das Labyrinth winziger Kanäle, »rii« genannt, ein. Wir haben uns ein festes Ziel gesetzt, nämlich das Haus von Marco Polo zu finden, oder besser gesagt den Ort, an dem es einst stand.
Es ist ein besonderes Venedig-Erlebnis, wenn man mit dem eigenen Boot die verästelten Kanäle erkundet. Im Gegensatz zu motorisierten Booten braucht man dafür keine Sondererlaubnis.
Die Anfänge der Lagunenstadt
Wenn man mit dem Boot unterwegs ist, erspürt man die Besonderheiten dieser Stadt, dann lässt sich erkennen, wie sehr Venedig dem Meer, der Lagune, entrissen wurde. Aus den Pfahlbauten eines unbezwingbaren Volkes geboren, das sich im 5. Jahrhundert vom Festland in die Lagune geflüchtet und diese in eine uneinnehmbare Festung verwandelt hatte.
»Rivus Altus«, »hohe Ufer«, wurde der Archipel aus etwa hundertzwanzig morastigen Inseln und Inselchen genannt, den die Naturkräfte aus Flussablagerungen und vom Meer geformten Nehrungen – natürlichen kilometerlangen Dämmen – schufen. Auf den Eilanden wuchs kaum mehr als Röhricht und hartes Sumpfgras. Myriaden von Insekten bevölkerten das Feuchtgebiet, durch das sich brackige Schlammkanäle schlängelten. Außer Regen gab es dort kein Trinkwasser. Niemand betrat die Inselgruppe freiwillig, doch den vor den Invasionsheeren flüchtenden Venetern blieb keine andere Wahl. Denn einen unschätzbaren Vorzug hatte dieser lebensfeindliche Archipel: Für Feinde, die vom Festland kamen, war er praktisch uneinnehmbar. Aus der kollektiven Erfahrung heraus, nur hier vor Übergriffen wirklich sicher zu sein, beschlossen die Veneter, sich dauerhaft niederzulassen. Damit begann der Aufstieg einer tristen Inselgruppe zu einer der bedeutendsten Städte der Geschichte.
Zunächst mussten sich die Menschen ihren Lebensraum buchstäblich erschaffen, durch Trockenlegen von Sümpfen, Aufschüttung von Eilanden und Ausbaggern von Kanälen, um sie schiffbar zu machen. Noch schwieriger war es, die Inselufer zu befestigen und stabile Fundamente für ihre Häuser zu bilden. Letzteres geschah durch zugespitzte Holzpfähle, die dicht nebeneinander in den Boden gerammt wurden. Um dabei nicht im tiefen Wasser stehen zu müssen, wurden vorher mit Brettern Sperren gegen die Lagune errichtet und der entstandene Innenraum trocken geschöpft. Waren die Pfähle in den morastigen Grund eingeschlagen, wurden die Zwischenräume mit Lehm und Schlick gefüllt. Dann konnte die Eindämmung wieder entfernt werden, sodass der Unterbau vollständig geflutet wurde. Wären die Holzpfähle der Luft ausgesetzt worden, wären sie verfault.
Die meisten dieser Konstruktionen sind bis heute intakt und bilden das Fundament des Gesamtkunstwerks Venedig. Nach und nach wurden die Inselchen miteinander verbunden, und die langen Pfähle formten ein riesiges Gebilde, verbunden durch Brücken und Stege, um die herum sich Häuser scharten. Freilich waren es zunächst nur mit Stroh gedeckte Holzhäuser, die die Einwanderer leicht und schnell errichten konnten, denn im Gegensatz zu Stein war das Holz aus den Wäldern am Festland einfach zu beschaffen.
Schon sehr früh bildete sich auch jenes Gemeinwesen heraus, das für Venedig so charakteristisch wurde. Da alle als Flüchtlinge ankamen, gab es keine undurchlässigen Gesellschaftsschranken. Was zählte, war der Erfolg und weniger die Herkunft. Jede Kaufmannsfamilie konnte durch Tüchtigkeit und Fleiß zu einer der führenden Patrizierfamilien aufsteigen. Nichtsdestotrotz war Venedig eine Oligarchie, die von wenigen adligen Familien regiert wurde, aus deren Kreis der Anführer – der Doge – auf Lebenszeit gewählt wurde. Aber wenn ein Fischer und ein Patrizier vor Gericht standen, hatten beide die gleichen Chancen, recht zu bekommen. Und das war ungewöhnlich zu dieser Zeit.
Parkende Gondeln vor San Marco. Im Hintergrund Kirche und Kloster San Giorgio Maggiore auf der gleichnamigen Insel.
Wenngleich auf den Inseln weder Landwirtschaft noch Viehzucht betrieben werden konnte, wuchs und gedieh die Kommune unter der Herrschaft des Dogen dank der reichen Fischgründe und vor allem des »weißen Goldes« – Salz –, das in der Lagune mit einfachen Mitteln gewonnen werden konnte. Flache natürliche Wasserzonen wurden eingedämmt, und dann brauchte man nur noch zu warten, bis das Wasser in der Sonne verdunstet war, um das Salz abzuschöpfen. »Auf Gold kann man verzichten, auf Salz nicht«, vermerkte ein Chronist. Zu dieser Zeit war Salz nahezu das einzige Mittel, um Nahrungsmittel wie Fisch und Fleisch haltbar zu machen. Die Lagunenbewohner von Rivus Altus profitierten davon. Mit ihren Booten fuhren sie die Flüsse hinauf und belieferten die Städte am Festland mit den kostbaren weißen Kristallen und eingesalzenem Fisch. Auf dem Rückweg nahmen die Kähne Lebensmittel und andere Güter mit in die Lagune. Verwundert notierte ein Hafenbeamter einer norditalienischen Stadt über die Menschen von Rivus Altus: »Diese Leute pflügen nicht, säen und ernten nicht, doch sie können in jedem Hafen Getreide und Wein einkaufen.«





























