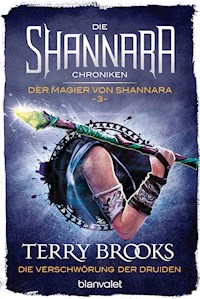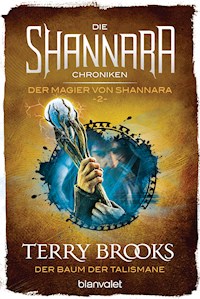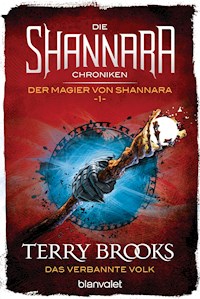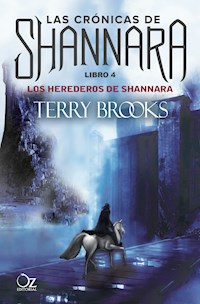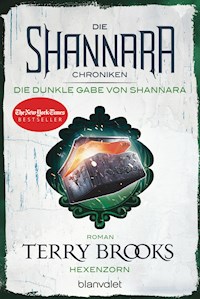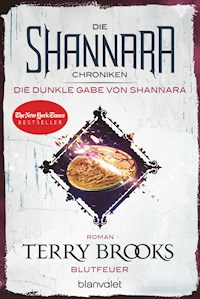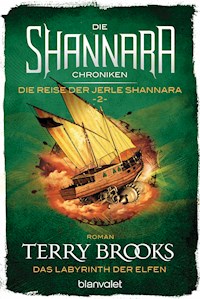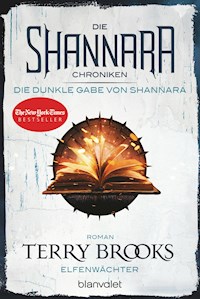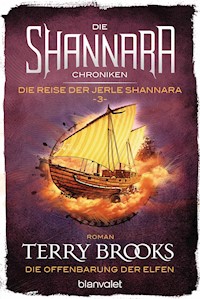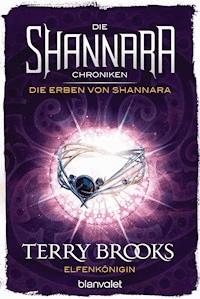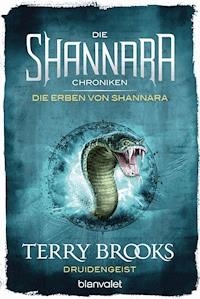5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Shannara-Chroniken
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Vorgeschichte zum Fantasy-Serien-Highlight 2016
Der Elfen-Mensch-Mischling Shea Ohmsford lebt zufrieden in dem kleinen Ort Schattental – bis der mysteriöse Zauberer Allanon auftaucht, und dem jungen Mann das Vermächtnis seiner Familie offenbart. Shea ist der letzte Nachfahre des Elfenhelden Shannara, und nur er kann dessen mystisches Schwert führen. Und damit ist Shea der einzige, der den mächtigen Hexenmeister Brona aufhalten kann. Denn dieser fürchtet nur eine Waffe: das Schwert von Shannara.
Die Shannara-Chroniken – Das Schwert der Elfen ist bereits in geteilter Form erschienen unter den Titeln: »Das Schwert von Shannara«, »Der Sohn von Shannara« und »Der Erbe von Shannara«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1020
Ähnliche
Buch
Die Zivilisation, wie wir sie kennen, ist seit Jahrtausenden untergegangen, Wissenschaft und Technik sind verloren. Elfen, Trolle, Gnome und Zwerge haben sich aus der Menschheit entwickelt. Doch in der mächtigen Felsenfestung Paranor versuchen die Druiden, die Relikte der Vergangenheit zu entschlüsseln und erneut zu entdecken. Das gelang nur teilweise, doch während ihrer Forschungen entdeckten sie eine mysteriöse Energie, die ihnen magiegleiche Kräfte verlieh.
Dann spalteten sich einige der Druiden unter der Führung von Brona vom Orden ab. Sie wollten den Sterblichen nicht länger dienen, sondern sie beherrschen. Doch Brona wurde von dem Elfenfürsten Shannara besiegt.
So glaubte man! Denn jetzt ist Brona zurückgekehrt, mächtiger als je zuvor. Und die einzige Waffe, die ihn aufhalten kann, ist das Schwert von Shannara. Und der Einzige, der die Klinge zu führen vermag, ist der junge Shea Ohmsford. Dies ist seine Geschichte.
Autor
Im Jahr 1977 veränderte sich das Leben des Rechtsanwalts Terry Brooks, geboren 1944 in Illinois, USA, grundlegend: Gleich der erste Roman des begeisterten Tolkien-Fans eroberte die Bestsellerlisten und hielt sich dort monatelang. Doch DasSchwert der Elfen war nur der Beginn einer atemberaubenden Karriere.
Terry Brooks bei Blanvalet:
1. Das Schwert der Elfen
2. Elfensteine
Weitere Titel in Vorbereitung
Terry Brooks
DIE SHANNARA-CHRONIKEN
Das Schwert der Elfen
Roman
Aus dem Englischen von Tony Westermayr
Vollständig durchgesehen und
überarbeitet von Andreas Helweg
1
Die Sonne sank schon ins dunkle Grün der Hügel westlich des Tales. Rot und graurosa legten sich lange Schatten über das Land, als Flick Ohmsford mit dem Abstieg begann. Der Pfad zog sich den unebenen Nordhang hinab, wand sich zwischen den riesigen Felsblöcken hindurch, die in massiven Gruppen das zerklüftete Gelände beherrschten, verschwand in den dichten Wäldern des Tieflands und tauchte in kleinen Lichtungen und zwischen dünnerem Baumbestand vereinzelt wieder auf. Flick folgte dem vertrauten Weg mit dem Blick, während er müde dahinschritt, das leichte Bündel auf einer Schulter. Sein breites, wettergegerbtes Gesicht wirkte ruhig und ausgeglichen, nur die großen grauen Augen verrieten seine rastlose Energie. Mit seinem stämmigen Körperbau, den graubraunen Haaren und den buschigen Brauen sah er deutlich älter aus, als er tatsächlich war. Er trug die weite Arbeitskleidung, wie sie im Tal üblich war, und in seinem Bündel klirrten einige Werkzeuge.
Es war ein kühler Abend, und Flick zog den Kragen seines offenen Wollhemds zu. Sein Weg würde ihn durch Wälder und über sanft geschwungene Hügel führen. Von Letzteren sah er aber noch nichts, als er den ersten Wald erreichte. Die dunklen Wipfel der Eichen und düsteren Hickorybäume verschmolzen mit dem wolkenlosen Nachthimmel. Die Sonne war untergegangen, nun prangten Tausende vertrauter Sterne am tiefen Blau des Himmels. Der Baldachin über ihm verdeckte sogar diese, und Flick war allein in der stillen Dunkelheit, als er langsam auf dem ausgetretenen Pfad weiterschritt. Da er diesen Weg schon hundertmal zurückgelegt hatte, fiel dem jungen Mann sofort die ungewöhnliche Stille auf, die an diesem Abend das ganze Tal erfasst hatte. Das vertraute Summen und Zirpen der Insekten, sonst in der Stille der Nacht allgegenwärtig, die Rufe jener Vögel, die mit der untergehenden Sonne erwachten, um im Flug Nahrung zu suchen – all das fehlte. Flick lauschte angestrengt auf irgendeinen Laut, aber selbst mit seinen guten Ohren nahm er nichts wahr. Besorgt schüttelte er den Kopf. Die tiefe Stille beunruhigte ihn, vor allem in Verbindung mit Gerüchten von einem schrecklichen Wesen mit schwarzen Schwingen, das angeblich vor einigen Tagen nördlich des Tales am Nachthimmel gesichtet worden war.
Er zwang sich zu pfeifen und wandte seine Gedanken wieder seiner Arbeit zu. Nördlich vom Tal betrieben in abgelegenen Gegenden Siedler Viehzucht und Ackerbau, und diese versorgte er mit verschiedenen Dingen des täglichen Gebrauchs und auch mit Nachrichten aus dem Tal und aus fernen Städten des Südlands. Kaum jemand kannte die Gegend so gut wie er, und fast niemand wagte sich gern über die vergleichsweise sicheren Grenzen des heimatlichen Dorfes hinaus. In diesen Zeiten lebten die Menschen zurückgezogen in ihren Orten und überließen den Rest der Welt sich selbst. Flick jedoch war gerne außerhalb des Tales unterwegs, und die abgelegenen Siedlungen brauchten seine Waren und bezahlten gut dafür. Auch Flicks Vater ließ sich keine Gelegenheit entgehen, Geld zu verdienen, und so zahlte es sich für alle Beteiligten aus.
Ein tiefhängender Ast streifte seinen Kopf. Flick zuckte zusammen und sprang zur Seite. Ärgerlich richtete er sich auf und funkelte das belaubte Hindernis böse an, bevor er seinen Weg in etwas schnellerer Gangart fortsetzte. Er war jetzt mitten in den Tieflandwäldern, und nur vereinzelt drangen die Strahlen des Mondes durch das dichte Geäst und erhellten den gewundenen Pfad. Oft konnte Flick den Weg kaum ausmachen, so düster war es, und während er vorsichtig dahinschritt, fiel ihm wieder die lastende Stille auf. Ihm war, als wäre alles Leben plötzlich ausgelöscht, als wäre er allein übrig geblieben und schlüge sich durch die Gruft des Waldes. Wieder erinnerte er sich an die sonderbaren Gerüchte. Unwillkürlich wurde ihm ein wenig unheimlich zumute. Er schaute sich voller Sorgen um, aber auf dem Weg und in den Bäumen regte sich nichts, und er wurde beinahe verlegen, weil er sich so erleichtert fühlte.
Auf einer mondbeschienenen Lichtung blieb er kurz stehen und schaute zum Nachthimmel hinauf, bevor er langsam wieder in den Wald ging. Der gewundene Pfad wurde enger und schien sich in einer Wand aus Bäumen und Gebüsch zu verlieren. Das war nur eine Täuschung, trotzdem schaute sich Flick immer wieder unsicher um. Einige Augenblicke danach war er wieder auf einem breiteren Weg und konnte zwischen den Baumwipfeln hier und dort den Himmel erkennen. Dann hatte er fast schon die Talsohle erreicht und war von seinem Zuhause nur noch ungefähr zwei Meilen entfernt. Lächelnd eilte er weiter und pfiff ein altes Trinklied. Er war ganz mit dem Pfad und der offenen Landschaft jenseits des Waldes beschäftigt, deshalb bemerkte er den hünenhaften schwarzen Schemen nicht, der plötzlich emporwuchs, sich von einer großen Eiche zu seiner Linken löste und unvermittelt auf den Pfad trat, um ihm den Weg zu verstellen. Die schwarze Gestalt war schon zum Anfassen nahe, ehe Flick sie gewahrte, wie einen riesenhaften schwarzen Steinblock, der ihn zu zermalmen drohte. Mit einem Angstschrei sprang er zur Seite, ließ das Bündel fallen und riss mit der Linken den langen, schmalen Dolch, den er an seiner Hüfte trug, aus der Scheide. Während er in Abwehrstellung ging, hob die Gestalt vor ihm beruhigend einen Arm. Eine kraftvolle Stimme sagte: »Warte, mein Freund! Ich bin kein Feind und will dir nichts Böses. Ich brauche nur eine Auskunft und wäre dankbar, wenn du mir den richtigen Weg zeigen könntest.«
Flick atmete auf, starrte in die Nacht und versuchte, an der schwarzen Gestalt vor sich Ähnlichkeiten mit einem menschlichen Wesen auszumachen. Er konnte jedoch nichts erkennen und wich vorsichtig zurück.
»Sei versichert, ich führe nichts Böses im Schilde«, sagte der Fremde, als lese er die Gedanken des Talbewohners. »Ich wollte dich nicht erschrecken, habe dich aber nicht gesehen, bis du ganz nah herangekommen warst, und ich fürchtete, du könntest vorbeigehen, ohne mich zu bemerken.«
Die große schwarze Gestalt schwieg und blieb stehen, allerdings spürte Flick, wie ihr Blick ihn verfolgte, als er sich langsam mit dem Rücken zum Licht stellte. Nach und nach brachte das Mondlicht Zeichnung in die Züge des Fremden und stellte verschwommene Linien und blaue Schatten heraus. Lange Augenblicke standen die beiden einander schweigend gegenüber.
Dann aber griff die riesige Gestalt plötzlich mit erschreckender Behändigkeit zu, die kräftigen Hände packten die Handgelenke Flicks, und er wurde plötzlich vom Boden hoch in die Luft gehoben. Das Messer entglitt gefühllosen Fingern und die tiefe Stimme lachte ihn spöttisch an.
»So, so, mein junger Freund! Und was nun? Ich könnte dir das Herz herausschneiden und dich den Wölfen überlassen, wenn ich wollte, nicht wahr?«
Flick wollte sich befreien und wand sich verzweifelt. Er wusste nicht, was für ein Wesen ihn überwältigt hatte, aber es war auf alle Fälle viel stärker als ein gewöhnlicher Mensch und anscheinend entschlossen, Flick ohne große Umstände das Lebenslicht auszublasen. Dann hielt ihn sein Gegner plötzlich auf Armlänge von sich, und der Spott in der Stimme verwandelte sich in eisige Wut.
»Genug davon, Junge! Wir haben unser kleines Spiel gespielt, und du weißt noch immer nichts von mir. Ich bin müde und hungrig und möchte nicht am kalten Abend im Wald aufgehalten werden, während du darüber nachdenkst, ob ich Mensch oder Tier bin. Ich setze dich ab, und du zeigst mir den Weg. Aber ich warne dich – versuch nicht, mir wegzulaufen, sonst ergeht es dir schlecht.« Die kräftige Stimme wurde leiser, und der verärgerte Ton wurde, angekündigt von einem kurzen Lachen, wieder von Spott abgelöst. »Außerdem«, brummte die Gestalt und stellte Flick auf dem Boden ab, »bin ich vielleicht ein besserer Freund, als du ahnst.«
Sein Gegenüber trat einen Schritt zurück. Flick richtete sich auf und rieb sich die Handgelenke. Am liebsten wäre er davongelaufen, zweifelte aber nicht daran, dass der Fremde ihn dann wieder einfangen und töten würde. Er bückte sich vorsichtig, hob den Dolch auf und steckte ihn ein.
Flick konnte den anderen nun besser erkennen und hegte keinen Zweifel mehr, dass er eindeutig einen Menschen vor sich hatte, wenn auch einen viel größeren, als er je gesehen hatte. Der Hüne maß mindestens sieben Fuß, wirkte dabei aber außerordentlich dürr, obschon es in diesem Punkt keine Gewissheit gab, weil die hochgewachsene Gestalt in einen wehenden schwarzen Mantel mit einer eng anliegenden Kapuze gehüllt war. Das schmale Gesicht war von tiefen Falten durchzogen. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen und waren fast völlig von buschigen Brauen verborgen, die sich über einer langen, flachen Nase wölbten. Ein kurzer schwarzer Bart umgab den breiten Mund, der im Gesicht nur einen Strich bildete – einen Strich, der sich nie zu bewegen schien. Die ganze Erscheinung flößte ihm Angst ein, schwarz und riesenhaft, wie sie vor Flick stand, und er musste den wachsenden Drang unterdrücken, zum Waldrand zu rennen. Er blickte dem Fremden offen, wenn auch nicht ohne Schwierigkeit, in die Augen und rang sich ein Lächeln ab.
»Ich habe Euch für einen Räuber gehalten«, murmelte er zögernd.
»Du hast dich geirrt«, lautete die ruhige Antwort. Dann wurde die Stimme noch milder: »Du musst lernen, Freund von Feind zu unterscheiden. Dein Leben kann einmal davon abhängen. Also, sag mir deinen Namen!«
»Flick Ohmsford.« Flick zögerte und fuhr dann etwas mutiger fort: »Mein Vater ist Curzad Ohmsford. Ein, zwei Meilen von hier in Schattental betreibt er einen Gasthof. Dort findet Ihr Essen und Unterkunft.«
»Ah, Schattental«, rief der Fremde plötzlich. »Ja, da will ich hin!« Er zögerte, als überdenke er seine Worte. Flick beobachtete ihn wachsam, wie er sich das Kinn mit gekrümmten Fingern rieb und auf die sanft geschwungenen Wiesen des Tales jenseits des Waldrands hinaussah, ehe er sagte: »Du … hast einen Bruder …«
Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Sie wurde so ruhig und gleichgültig getroffen, als interessiere sich der hünenhafte Fremde nicht im Mindesten für eine Antwort. Flick überhörte sie deshalb beinahe. Dann begriff er plötzlich die Bedeutung des Satzes, zuckte zusammen und starrte den anderen an.
»Woher …?«
»Ach, nun«, sagte der Mann, »hat nicht fast jeder junge Talbewohner wie du irgendwo einen Bruder?«
Flick nickte stumm und fragte sich nebenbei, wie viel der Unbekannte über Schattental wissen mochte. Der Fremde sah ihn fragend an; offenbar wartete er darauf, zu Essen und Unterkunft geführt zu werden, wie es versprochen war. Flick wandte sich hastig ab, suchte sein Bündel und warf es sich über die Schulter, bevor er sich wieder nach dem Hünen umsah.
»Wir müssen dort entlang.« Er zeigte mit dem Finger in Richtung Westen, und die beiden setzten sich in Bewegung.
Sie verließen den dichten Wald und erreichten die sanften Hügel, die sich bis zum Dorf Schattental am anderen Ende des Tales erstreckten. Als sie den Wald verlassen hatten, stand der Mond als volle weiße Scheibe am Himmel und beleuchtete die Landschaft und den Weg. Der Pfad selbst zog sich als undeutliche Linie über die Wiesenhöhen hin, erkennbar nur an gelegentlichen, vom Regen ausgewaschenen Wagenspuren und flachen, harten Stellen, wo das dichte Gras der kahlen Erde Platz machte. Es war kräftiger Wind aufgekommen, der den beiden Männern mit schnellen Stößen entgegenblies und an ihrer Kleidung zerrte, so dass sie, um die Gesichter zu schützen, die Köpfe senken mussten. Beide schwiegen und schritten dahin, beide achteten nur auf den Weg. Bis auf das Tosen des Windes herrschte Stille. Flick lauschte aufmerksam, und einmal glaubte er weit im Norden einen lauten Schrei zu hören, der aber im nächsten Augenblick wieder verhallt war. Den Fremden schien die Stille nicht zu beunruhigen. Seine Aufmerksamkeit galt offenbar nur einem ständig wandernden Punkt am Boden, etwa zwei Schritte vor ihnen. Er schien genau zu wissen, wohin der andere ging.
Nach einer Weile fiel es Flick schwer, mit dem Hünen Schritt zu halten. Manchmal musste er fast laufen, um nicht abgehängt zu werden. Ein- oder zweimal blickte der Fremde auf seinen kleineren Begleiter herunter, sah, dass dieser Schwierigkeiten hatte, ihm zu folgen, und wurde ein wenig langsamer. Als die Südhänge des Tales endlich näher rückten, ebneten sich die Hügel zu buschbewachsenen Wiesen, die einen weiteren Wald ankündigten. Der Weg führte nun sacht abwärts, und Flick erkannte mehrere vertraute Merkmale am Ortsrand von Schattental. Unwillkürlich verspürte er Erleichterung. Sein Dorf und sein gemütliches Heim lagen vor ihm.
Der Fremde sprach kein Wort, und auch Flick begann kein Gespräch. Stattdessen versuchte er, den Hünen heimlich mit knappen Seitenblicken zu betrachten. Sein Staunen war begreiflich. Das lange, kantige Gesicht, vom schwarzen Bart verdunkelt, erinnerte ihn an die schrecklichen Dämonen aus den Geschichten, die die Alten in seiner Kindheit vor den glühenden Scheiten des Kaminfeuers am späten Abend erzählt hatten. Die Augen des Fremden waren am fürchterlichsten – oder vielmehr die tiefen, dunklen Höhlen unter den zottigen Brauen, wo seine Augen sich befinden mussten. Flick vermochte die schweren Schatten, die diesen ganzen Gesichtsbereich des Fremden verdeckten, nicht zu durchdringen. Das zerfurchte Gesicht war wie aus Stein gemeißelt, starr und ein wenig zum Weg geneigt. Während Flick die undurchdringliche Miene betrachtete, fiel ihm plötzlich ein, dass der Fremde nicht einmal seinen Namen genannt hatte.
Hier am Außenrand des Tales wand sich der jetzt deutlich sichtbare Weg durch hohes, dichtes Gebüsch, das beinahe kein Vorankommen mehr erlauben wollte. Der hünenhafte Fremde blieb plötzlich wie angewurzelt stehen, senkte den Kopf und lauschte angestrengt. Flick hielt neben ihm an, wartete still und lauschte ebenfalls, konnte aber nichts hören. So verharrten sie reglos scheinbar endlose Minuten lang, dann fuhr der Hüne plötzlich zu ihm herum.
»Schnell! Versteck dich im Gebüsch! Los, lauf!« Er selbst rannte auch auf die hohen Büsche zu und schob Flick vor sich her. Flick hastete angstvoll zur Zuflucht des Buschwerks. Auf seinem Rücken klirrten die Metallgeräte in seinem Bündel. Der Fremde riss es ihm von der Schulter und schob es unter seinen langen Mantel.
»Leise!«, zischte er. »Lauf jetzt! Keinen Laut!«
Sie rannten eilig zu der dunklen grünen Wand, die etwa fünfzehn Schritt entfernt war. Der Hüne schob Flick zwischen die belaubten Zweige, die ihnen in die Gesichter peitschten, und weiter bis zur Mitte des großen Gebüschs. Hier blieben sie schnaufend stehen. Flick sah seinen Begleiter an, der sich keineswegs in der Landschaft umschaute, sondern dessen Blick nach oben ging, wo der Nachthimmel durch das Laub in kleinen Ausschnitten sichtbar war. Flick sah nur den klaren Nachthimmel, als er dem durchdringenden Blick des anderen folgte, und die ewigen Sterne funkelten. Minuten verstrichen. Einmal wollte Flick etwas sagen, doch der Fremde packte warnend seine Schultern. Flick blieb stehen, starrte in die Nacht und strengte auch die Ohren an, um die angebliche Gefahr aufzuspüren. Er hörte aber nur ihre schweren Atemzüge und den Wind, der in den schwankenden Zweigen rauschte.
Dann, gerade als Flick seine müden Glieder entspannen und sich setzen wollte, wurde der Himmel plötzlich von etwas Gigantischem, etwas Schwarzem verdunkelt. Es schwebte vorbei und verschwand wieder. Einen Augenblick später tauchte der Schatten erneut auf, kreiste langsam und hing drohend über den beiden versteckten Wanderern, als wolle es sich im nächsten Moment auf sie herabsenken. Flick durchfuhr eine entsetzliche Angst und hielt ihn in eisernem Netz gefangen, als er dem Wahnsinn zu entfliehen versuchte. Etwas schien seine Brust zu umschlingen und langsam die Luft aus seiner Lunge zu quetschen. Er rang nach Luft. Die scharf umrissene Vision einer schwarzen, rot durchschossenen Erscheinung mit Klauenhänden und Riesenschwingen zog an ihm vorbei. Dieses Wesen war so böse, dass sein bloßes Dasein Flicks zerbrechliches Leben zu bedrohen schien. Einen Augenblick lang glaubte der junge Mann, schreien zu müssen, womit er sich verraten hätte, aber die Hand des Fremden hielt seine Schulter fest gepackt und riss ihn vom Abgrund zurück. Der riesige Schatten verschwand so plötzlich, wie er aufgetaucht war, und zurück blieb nur der friedliche Himmel der Nacht.
Die Hand auf Flicks Schulter lockerte den Griff. Der Talbewohner sank schlaff zu Boden; kalter Schweiß bedeckte seine Haut. Der Hüne ließ sich lautlos neben seinem Begleiter nieder. Über sein Gesicht huschte ein schwaches Lächeln. Er legte eine Pranke auf die Hand von Flick und tätschelte sie wie die eines Kindes.
»Komm, komm, junger Freund«, flüsterte er, »du lebst und bist gesund, und das Tal liegt vor dir.«
Flick hatte vor Angst große Augen und blickte auf in das gelassene Gesicht des anderen.
»Dieses Wesen! Was war dieses furchtbare Wesen?«
»Nur ein Schatten«, erwiderte der Mann leichthin. »Aber jetzt ist weder die Zeit noch der Ort, sich mit solchen Dingen zu befassen. Wir sprechen später darüber. Zuerst möchte ich endlich etwas essen und an einem warmen Feuer sitzen, sonst verliere ich bald die Geduld.«
Er half Flick auf die Beine und gab ihm sein Bündel zurück. Dann zeigte er mit einer weiten Armbewegung auf den Weg. Sie verließen die Deckung des Strauchwerks, Flick nicht ohne Bedenken, mit häufigen Blicken zum Nachthimmel. Man hätte auch meinen können, dass alles nur seiner überhitzten Fantasie entsprungen sei. Flick entschied, dass er für einen Abend genug erlebt hatte: zuerst dieser namenlose Hüne, dann der furchterregende Schatten. Er schwor sich im Stillen, es sich zweimal zu überlegen, bevor er sich nachts wieder so weit hinauswagte.
Einige Minuten später öffneten sich Bäume und Dickicht. In der Dunkelheit flackerte gelbes Licht. Als sie näher kamen, nahmen die verschwommenen Umrisse von Gebäuden als quadratische und rechteckige Gebilde Gestalt an. Der Pfad verbreiterte sich zu einer ebeneren Landstraße, die in den Ort führte, und Flick lächelte die Lichter, die durch die Fenster der stillen Häuser freundlich grüßten, dankbar an. Niemand war auf der Straße unterwegs; ohne die Lichter hätte man sich fragen mögen, ob hier überhaupt jemand lebte. Flicks Gedanken waren aber von solchen Fragen weit entfernt. Er überlegte schon, wie viel er seinem Vater und Shea erzählen sollte, um sie nicht unnötig mit düsteren Schatten zu beunruhigen, die vielleicht nur Produkte seiner Fantasie und der düsteren Nacht gewesen waren. Der Fremde neben ihm mochte später einige Aufklärung geben können, aber bis jetzt hatte er sich nicht als sehr gesprächig erwiesen. Flick betrachtete unwillkürlich erneut den Hünen neben sich. Wieder überlief es ihn kalt. Die Schwärze des Mannes schien von seinem Mantel und der Kapuze über den gesenkten Kopf und die schmalen Hände zu fließen und alles in Düsternis zu tauchen. Wer immer er sein mochte, Flick war überzeugt davon, dass er ein gefährlicher Feind wäre.
Sie gingen langsam zwischen den Gebäuden des Dorfes dahin, und Flick sah durch die Holzrahmen der breiten Fenster Fackeln brennen. Die Häuser selbst waren lange, niedrige Bauten mit nur einem Geschoss unter einem flach geneigten Dach, das meist an einer Seite eine kleine Veranda überspannte. Sie bestanden aus Holz, einige verfügten über Steinfundamente und Steinfassaden. Flick blickte durch die verhangenen Fenster und erhaschte hier und dort einen Blick auf die Bewohner. Der Anblick vertrauter Gesichter tröstete ihn in der Dunkelheit. Es war eine furchterregende Nacht, und er war erleichtert, wieder zu Hause unter Leuten zu sein, die er kannte.
Der Fremde blieb für all dies unempfänglich. Er begnügte sich mit einem beiläufigen Blick auf den Ort und hatte, seitdem sie ihn erreicht hatten, noch kein einziges Wort gesprochen. Flick wunderte sich immer noch darüber, wie der andere ihm folgte. Er ging Flick gar nicht hinterher, sondern schien genau zu wissen, wohin der junge Mann sich wenden wollte. Wenn die Straße sich gabelte, fiel es dem Schwarzen nicht schwer, den richtigen Weg selbst zu finden, obwohl er Flick kein einziges Mal ansah und auch nie den Kopf hob, um sich zu orientieren.
Bald erreichten sie den Gasthof. Es war ein großes Gebäude, ein Haupthaus mit Veranda und zwei langen Flügeln, die seitlich sowohl nach vorn als auch nach hinten angebaut waren. Die mächtigen Stämme der Wände ruhten auf einem hohen Steinfundament. Das Dach war mit Holzschindeln gedeckt und deutlich höher als bei den anderen Häusern des Ortes. Das Haupthaus war hell erleuchtet, und von innen hörte man gedämpfte Stimmen, die sich mit Lachen und Rufen mischten. Die Anbauten des Gasthofs lagen im Dunkeln; dort befanden sich die Schlafräume der Gäste. Es roch nach Gebratenem, und Flick eilte über die Holzstufen der langen Veranda zu der breiten Doppeltür in der Mitte des Hauses voraus. Der Fremde folgte wortlos.
Flick schob den schweren Schnappriegel zurück und zog den rechten Türflügel auf. Sie betraten einen großen Schankraum mit Bänken, hochlehnigen Stühlen und mehreren langen, schweren Holztischen an der Seiten- und Rückwand. Hier brannten zahlreiche Kerzen auf den Tischen und in den Wandhaltern und auch ein Feuer im großen offenen Kamin in der Mitte der linken Wand; Flick war kurz geblendet, seine Augen mussten sich erst an die Lichtfülle gewöhnen. Er kniff sie zusammen und blickte an Kamin und Möbeln vorbei zur geschlossenen Doppeltür an der Rückwand und hinüber zur langen Theke, die entlang der rechten Wand verlief. Die dort versammelten Männer hoben die Köpfe, als die beiden hereinkamen, und starrten den Fremden mit unverhohlenem Staunen an. Flicks schweigender Begleiter beachtete die Männer nicht, und diese wandten sich deshalb rasch wieder ihren Gesprächen und Getränken zu. Die beiden Neuankömmlinge blieben einen Augenblick lang an der Tür stehen, während Flick seinen Vater suchte. Der Fremde wies auf die Stühle an der linken Seite und sagte:
»Ich setze mich dort. Hol deinen Vater. Vielleicht können wir gemeinsam essen, wenn du zurückkommst.« Er ging zu einem kleinen Tisch an der Rückseite des Raumes und setzte sich mit dem Rücken zu den Männern an der Theke. Flick sah ihm kurz nach, dann ging er schnell zur Flügeltür an der hinteren Wand und trat in den Korridor. Sein Vater war vermutlich in der Küche und aß mit Shea zu Abend. Flick eilte durch den Flur an mehreren geschlossenen Türen vorbei zur Küche. Als er eintrat, begrüßten die beiden Köche im hinteren Teil des Raumes den jungen Mann fröhlich. Sein Vater saß an einem langen Tresen an der linken Seite. Wie Flick vermutet hatte, aß er, hatte die Mahlzeit jedoch fast beendet. Zur Begrüßung hob er eine seiner kräftigen Hände.
»Du kommst später als sonst, Sohn«, meinte er freundlich. »Komm und iss, solange noch etwas da ist.«
Flick ging müde auf ihn zu, ließ das Bündel klirrend fallen und setzte sich auf einen der großen Hocker. Sein Vater, ein stämmiger, großer Kerl, richtete sich auf, schob den leeren Teller von sich und sah Flick prüfend an.
»Auf dem Weg ins Tal bin ich einem Wanderer begegnet«, erklärte Flick zögernd. »Er sucht ein Zimmer und möchte essen. Wir sollen uns zu ihm setzen.«
»Nun, wenn er ein Zimmer will, ist er am richtigen Ort«, sagte der ältere Ohmsford. »Wüsste nicht, warum wir uns nicht auf einen Bissen zu ihm setzen sollten – ich kann noch gut etwas vertragen.« Er erhob sich schwerfällig und bestellte bei den Köchen drei Portionen. Flick sah sich nach Shea um, konnte ihn aber nirgends entdecken. Sein Vater stapfte zu den Köchen und gab ihnen Anweisungen für das Essen. Flick trat an das Becken neben der Spüle und wusch sich Schmutz und Staub vom langen Marsch ab. Als sein Vater herüberkam, fragte Flick ihn, wo sein Bruder sei.
»Shea erledigt etwas für mich und müsste bald zurück sein«, erwiderte sein Vater. »Wie heißt übrigens der Mann, den du mitgebracht hast?«
»Das weiß ich nicht. Er hat mir seinen Namen nicht gesagt.« Flick zuckte die Achseln.
Sein Vater runzelte die Stirn und murmelte etwas über schweigsame Fremde, fügte aber halblaut hinzu, dass er in seinem Gasthof keine geheimnisvollen Gestalten mehr dulden wolle. Er winkte seinem Sohn, ging voraus und streifte mit den breiten Schultern die Wand, als er zur Gaststube abbog. Flick folgte ihm hastig. Seine Miene drückte Zweifel aus.
Der Fremde saß in aller Seelenruhe mit dem Rücken zu den Männern an der Theke da. Als er die hintere Tür aufgehen hörte, drehte er sich so weit, bis er die zwei Eintretenden sah. Ihm fiel sofort die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn auf. Beide waren mittelgroß und stämmig gebaut, hatten die gleichen breiten, ruhigen Gesichter und graubraunes Haar. Sie blieben vor der Tür stehen. Flick zeigte auf die schwarze Gestalt und sah die Überraschung in seines Vaters Gesicht. Dieser starrte den Fremden eine Weile an, bevor er auf ihn zuging. Der Schwarze stand höflich auf und überragte beide Ohmsfords.
»Willkommen in meinem Gasthof, Fremder«, begrüßte ihn der alte Ohmsford und bemühte sich vergeblich, unter die Kapuze zu blicken, die das dunkle Gesicht des Gastes verbarg. »Mein Name ist Curzad Ohmsford, wie mein Junge Euch wahrscheinlich schon verraten hat.«
Der Fremde drückte die angebotene Hand mit einer Kraft, dass der bullige Wirt eine Grimasse schnitt, und nickte dann Flick zu.
»Euer Sohn war so freundlich, mich zu diesem behaglichen Gasthof zu führen.« Er lächelte spöttisch, wie es Flick schien. »Ich hoffe, Ihr leistet mir beim Essen und einem Glas Bier Gesellschaft.«
»Gewiss«, antwortete der Wirt und ließ sich schwerfällig auf einem freien Stuhl nieder. Flick zog sich ebenfalls einen Stuhl heran und setzte sich, den Blick unablässig auf den Fremden gerichtet, der gerade seinen Vater zu seinem schönen Gasthaus beglückwünschte. Der ältere Ohmsford strahlte vor Freude und nickte Flick befriedigt zu, während er einem der Bediensteten an der Bar winkte, drei Gläser zu bringen. Der Hüne schlug die Kapuze immer noch nicht zurück. Flick hätte zu gerne in die Schatten geblickt, fürchtete aber, der Fremde könnte es bemerken. Ein solcher Versuch hatte ihm bereits einmal schmerzende Handgelenke eingebracht und bei ihm einen gesunden Respekt vor der Kraft und dem Jähzorn des großen Mannes hervorgerufen. Es war sicherer, sich nicht zu weit vorzuwagen.
So saß er stumm dabei, als das Gespräch zwischen seinem Vater und dem Fremden sich von höflichen Bemerkungen über das milde Wetter zu einer eingehenderen Unterhaltung über die Bewohner des Ortes und jüngste Ereignisse wandelte. Flick fiel auf, dass sein Vater, sowieso ein redseliger Mensch, das Gespräch fast ganz allein bestritt und nur von beiläufigen Fragen des anderen unterbrochen wurde. Die Ohmsfords wussten nichts über den Fremden. Er hatte ihnen immer noch nicht seinen Namen genannt. Im Gegenteil, er lockte aus dem Gastwirt unauffällig eine Sache nach der anderen über das Tal heraus. Das störte Flick, aber er wusste nicht recht, was er dagegen tun sollte. Er wünschte sich, Shea möge endlich kommen und sehen, was sich hier abspielte, aber sein Bruder ließ auf sich warten. Das Essen wurde aufgetragen, und erst nachdem dieses verzehrt war, ging eine der breiten Türen auf, und Shea trat aus der Dunkelheit ein.
Zum ersten Mal sah Flick, wie der Fremde für eine andere Person mehr als beiläufiges Interesse zeigte. Mit kraftvollem Griff umklammerte die schwarze Gestalt den Tisch und erhob sich stumm. Der Mann schien die Ohmsfords vergessen zu haben; seine Stimme furchte sich tiefer und verriet eine starke Konzentration. Einen schrecklichen Augenblick lang glaubte Flick, der Fremde wollte Shea angreifen, aber dann wurde die Befürchtung von einer anderen Erkenntnis verdrängt. Der Mann erforschte die Gedanken seines Bruders.
Er musterte Shea scharf. Der Blick aus seinen tiefliegenden, verschatteten Augen glitt über die schlanke, schmale Gestalt des jungen Mannes. Er registrierte die Elfenanzeichen sofort – leicht spitze Ohren unter dem wirren blonden Haar, die bleistiftstrichdünnen Brauen, die im steilen Winkel von der Nasenwurzel schräg hinaufliefen, statt quer über die Augen zu verlaufen, dazu die schmale Nase und der schmale Kiefer. Er sah in dem Gesicht Klugheit und Offenheit, und während er Shea gegenüberstand, bemerkte er auch Entschlossenheit in den durchdringenden blauen Augen – Entschlossenheit, die sich als Gesichtsröte über die jugendlichen Züge breitete, als sich die Blicke der beiden Männer ineinanderbohrten. Shea zögerte einen Augenblick, auf die riesige schwarze Erscheinung zuzugehen. Er kam sich auf unerklärliche Weise vor wie jemand, der in eine Falle getappt ist, fasste sich aber rasch und setzte sich in Bewegung.
Flick und sein Vater sahen Shea herankommen, dessen Blick auf den Fremden gerichtet war, dann standen die beiden auf, als hätten sie urplötzlich begriffen, wer der Mann sei. Es folgte ein Augenblick verlegenen Schweigens, als sie einander gegenüberstanden, ehe sich die Ohmsfords wortreich begrüßten. Die Anspannung löste sich. Shea lächelte Flick an, konnte den Blick jedoch nicht von der eindrucksvollen Gestalt vor ihm wenden. Shea war ein wenig kleiner als sein Bruder und wurde daher noch mehr von dem Fremden überragt als Flick, wirkte aber weniger nervös als dieser. Curzad Ohmsford sprach mit ihm über seine Besorgung, und Shea wurde vorübergehend vom Fremden abgelenkt, als er auf die drängenden Fragen seines Vaters antwortete; aber dann wandte er sich wieder dem Hünen zu.
»Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, trotzdem scheint Ihr mich von irgendwoher zu kennen, und ich habe das merkwürdige Gefühl, dass ich Euch ebenfalls kennen sollte.«
Der Fremde nickte, das spöttische Lächeln huschte wieder über sein Gesicht.
»Du solltest mich kennen, auch wenn es nicht verwunderlich ist, dass du dich nicht erinnerst. Aber ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich sogar gut.«
Shea war verblüfft von dieser Antwort, wusste nichts darauf zu erwidern und starrte den Fremden an. Dieser hob die schlanke Hand ans Kinn und strich sich den schwarzen Bart. Er ließ den Blick über die drei Männer vor sich wandern. Flick öffnete den Mund, um die Frage auszusprechen, die alle drei Ohmsfords beschäftigte, als der Fremde hinaufgriff und die Kapuze zurückstreifte. Endlich wurde das dunkle Gesicht erkennbar. Es war umrahmt von langen schwarzen Haaren, die bis zu den Schultern reichten und die tiefliegenden Augen verdeckten, welche in den Schatten unter den dichten Brauen nur als schwarze Schlitze zu sehen waren.
»Ich bin Allanon«, sagte er leise.
Einen Augenblick herrschte völlige Stille, als die drei Ohmsfords ihn sprachlos und verwundert anstarrten. Allanon – der geheimnisvolle Wanderer durch die vier Länder, Geschichtsschreiber der Rassen, Philosoph und Lehrer und, wie manche behaupteten, Adept der mystischen Künste. Allanon – der Mann, der jeden Ort aufgesucht hatte, angefangen von den dunkelsten Häfen des Anar bis zu den verbotenen Höhen des Charnalgebirges. Sein Name war den Bewohnern selbst der abgelegensten Gemeinden im Südland vertraut. Nun stand er unerwartet vor den Ohmsfords, die in ihrem Leben allenfalls ein paarmal aus ihrem Tal hinausgekommen waren.
Zum ersten Mal lächelte Allanon freundlich, aber innerlich empfand er Mitleid für sie. Mit dem ruhigen Leben, das sie so viele Jahre geführt hatten, war es vorüber, und in gewisser Hinsicht trug er dafür die Verantwortung.
»Was führt Euch hierher?«, fragte Shea endlich.
Der hochgewachsene Mann sah ihn scharf an und ließ ein tiefes, leises Lachen hören, das sie alle überraschte.
»Du, Shea«, murmelte er. »Ich habe dich gesucht.«
2
Am nächsten Morgen erwachte Shea früh und verließ die Wärme seines Bettes, um sich in der feuchten Kälte der Morgenluft hastig anzuziehen. Er war so früh aufgestanden, dass, wie er entdeckte, im ganzen Haus noch niemand wach war, weder ein Gast noch jemand von der Familie. Er ging von seinem kleinen Zimmer an der Rückseite des Hauptgebäudes zum großen Schankraum, wo er mit vor Kälte klammen Fingern im Kamin Feuer machte. In den frühen Morgenstunden, bevor die Sonne über die Hügel heraufkam, war es im Tal kühl, selbst in der warmen Jahreszeit. Gewiss hatte Schattental eine geschützte Lage, nicht nur vor den Augen der Menschen, sondern auch vor der Unbill schlechten Wetters, das vom Nordland herunterzog. Während aber die schweren Stürme des Winters und Frühlings das Tal verschonten, breitete sich das ganze Jahr über frühmorgens bittere Kälte von den hohen Hügeln aus und hielt sich unten bis weit in den Tag hinein. Meist konnte erst die Mittagssonne den kalten Hauch vertreiben.
Das Feuer knackte und prasselte, als Shea in einem der hohen Sessel die Beine ausstreckte und über die Ereignisse des vergangenen Abends nachdachte. Wie hatte Allanon ihn erkannt? Shea hatte das Tal selten verlassen und hätte sich an den anderen gewiss erinnert, wäre er ihm bei einer seiner vereinzelten Wanderungen begegnet. Allanon hatte sich geweigert, seine Geheimnisse zu lüften. Er hatte stumm weitergegessen, das Gespräch bis zum nächsten Morgen vertagt und war wieder zu der bedrohlichen Gestalt geworden, als die ihn Shea beim Eintreten empfunden hatte. Nach der Mahlzeit hatte er gebeten, zu seinem Zimmer gebracht zu werden, weil er schlafen wollte. Weder Shea noch Flick hatten ein weiteres Wort über seine Reise nach Schattental und über sein Interesse an Shea herauslocken können. Die beiden Brüder hatten sich danach noch allein unterhalten, und Flick hatte die Geschichte seiner Begegnung mit Allanon und den Vorfall mit dem angsterregenden Schatten erzählt.
Shea fragte sich erneut, woher Allanon ihn kennen konnte. Er durchforstete sein Leben. Von den frühen Jahren hatte er nur verschwommene Erinnerungen. Er wusste nicht, wo er geboren worden war, wenngleich er einige Zeit, nachdem die Ohmsfords ihn adoptiert hatten, gehört hatte, sein Geburtsort sei eine kleine Gemeinde im Westland gewesen. Sein Vater war gestorben, bevor er, Shea, alt genug gewesen war, einen bleibenden Eindruck von ihm zu gewinnen. Seine Mutter hatte ihn einige Zeit aufgezogen, und er konnte sich an einzelne Bruchstücke seines Lebens mit ihr erinnern, an das Spiel mit Elfenkindern inmitten riesiger Bäume und tiefgrüner Einsamkeit. Er war fünf Jahre alt gewesen, als sie plötzlich krank geworden war und beschlossen hatte, in ihr eigenes Dorf nach Schattental zurückzukehren. Sie musste damals schon gewusst haben, dass sie sterben würde, aber ihre erste Sorge galt dem Sohn. Die Reise nach Süden gab ihr den Rest, und sie starb, kurze Zeit nachdem sie im Tal angekommen waren.
Die Verwandten seiner Mutter waren alle tot, bis auf die Ohmsfords, entfernte Onkel und Vettern. Curzad Ohmsford hatte kaum ein Jahr zuvor seine Frau verloren. Er nahm Shea bei sich auf, und die beiden Jungen wuchsen wie Brüder heran, beide mit dem Namen Ohmsford. Shea hatte seinen wahren Namen nie erfahren und fragte auch nicht danach. Die Ohmsfords waren die einzige Familie, die ihm etwas bedeutete. Manchmal ärgerte es ihn, dass er ein Halbblut war, aber Flick hatte ihm eingeredet, es sei von Vorteil, weil ihm das die Instinkte und den Charakter von zwei Rassen verleihe.
Doch an eine Begegnung mit Allanon konnte sich Shea nicht erinnern. Es war, als habe nie eine solche stattgefunden. Vielleicht war das tatsächlich so. Er drehte sich auf dem Stuhl herum und starrte zerstreut ins Feuer. Der düstere Wanderer hatte etwas an sich, das ihn beunruhigte. Vielleicht war es Einbildung, aber Shea wurde das Gefühl nicht los, dass der Mann seine Gedanken lesen und ihn gänzlich durchschauen konnte, wie es ihm beliebte. Es war lächerlich, aber dieses Gefühl wollte sich nicht unterdrücken lassen, seitdem er dem Mann begegnet war. Auch Flick hatte so etwas gesagt und war sogar noch weiter gegangen: In der Dunkelheit ihres Zimmers hatte er seinem Bruder zugeflüstert, er halte Allanon für gefährlich.
Shea reckte sich und seufzte tief. Draußen wurde es hell. Er stand auf, legte Holz nach und hörte die Stimme seines Vaters im Flur, der sich laut knurrend über die Zustände im Allgemeinen beklagte. Shea seufzte resigniert, schob seine Gedanken beiseite und hastete in die Küche, um bei den morgendlichen Vorbereitungen zu helfen.
Es war fast Mittag, bis Shea wieder etwas von Allanon zu sehen bekam, der offenbar den ganzen Vormittag in seinem Zimmer verbracht hatte. Er tauchte ganz plötzlich hinter dem Haus auf, als Shea sich unter seinem großen Schattenbaum ausruhte und einen Imbiss zu sich nahm. Sein Vater war im Haus beschäftigt, Flick irgendwo unterwegs. Der dunkle Fremde vom vergangenen Abend wirkte in der Mittagssonne nicht weniger unheimlich; er war noch immer eine schattenhafte Gestalt von unglaublicher Größe, auch wenn er nun statt des schwarzen einen grauen Mantel zu tragen schien. Er ging auf Shea zu, setzte sich ins Gras und blickte geistesabwesend auf die Berge im Osten, die über den Bäumen aufragten. Die beiden Männer schwiegen lange, bis Shea es schließlich nicht mehr aushielt und sagte:
»Weshalb seid Ihr ins Tal gekommen, Allanon? Weshalb habt Ihr mich gesucht?«
Das düstere Gesicht wandte sich ihm zu, und ein schwaches Lächeln kräuselte die Lippen.
»Eine Frage, junger Freund, die nicht so leicht zu beantworten ist, wie du das möchtest. Am besten stelle ich dir zunächst eine Gegenfrage. Kennst du die Geschichte des Nordlandes?« Er zögerte. »Und die des Schädelreichs?«
Shea erstarrte bei dem Namen, der für Schrecken stand, für wirklichen und eingebildeten, ein Name, mit dem man kleine Kinder bange machte, wenn sie ungezogen waren, der selbst erwachsenen Männern Schauer über den Rücken jagte, wenn am Abend beim Feuer die Geschichten umgingen. Es war ein Name, der Geister und Kobolde heraufbeschwor, die verschlagenen Waldgnomen des Ostens und die großen Bergtrolle des fernen Nordens. Shea blickte in das düstere Gesicht vor sich und nickte langsam.
»Ich bin Historiker, Shea, unter anderem – vielleicht der am weitesten gereiste lebende Historiker, da außer mir seit über fünfhundert Jahren nur wenige das Nordland betreten haben. Ich weiß vieles über die Menschen, das heute niemand mehr ahnt. Die Vergangenheit ist eine verschwommene Erinnerung geworden, und das ist vielleicht ganz gut, denn in den letzten zweitausend Jahren war die Geschichte des Menschen nicht gerade ruhmreich. Die Menschen haben die Vergangenheit vergessen; sie wissen wenig von der Gegenwart und nichts von der Zukunft. Sie leben fast ausschließlich innerhalb der Grenzen des Südlandes, wissen nichts vom Nordland und seinen Völkern und wenig vom Ostland und Westland. Bedauerlich, dass die Menschen ein so unwissendes Volk geworden sind, denn einstmals waren sie von allen Rassen jene mit der größten Vision. Aber jetzt begnügen sie sich damit, abgesondert von den anderen Rassen zu leben, fernab der Probleme im Rest der Welt. Sie begnügen sich damit, weil diese Probleme sie noch nicht berührt haben, wohlgemerkt, und weil die Angst vor der Vergangenheit sie dazu bewogen hat, die Zukunft nicht zu genau zu betrachten.«
Shea ärgerte sich ein wenig über diese Vorwürfe und erwiderte scharf: »Wenn man Euch hört, ist es tadelnswert, in Ruhe gelassen werden zu wollen. Ich weiß genug über Geschichte – nein, über das Leben –, um zu begreifen, dass die einzige Hoffnung der Menschen darin besteht, sich von den anderen Rassen fernzuhalten, um alles wieder aufzubauen, was sie in den vergangenen zweitausend Jahren verloren haben. Dann sind sie vielleicht klug genug, es nicht ein zweites Mal zu verlieren. Denn gerade, weil sie sich unablässig in die Angelegenheiten anderer eingemischt und jede Absonderung abgelehnt haben, wurden sie in den Großen Kriegen beinahe völlig vernichtet.«
Allanons Miene wurde hart.
»Die katastrophalen Folgen dieser Kriege sind mir bewusst – die Ergebnisse von Macht und Habgier, die der Mensch durch Sorglosigkeit und bemerkenswerte Kurzsichtigkeit selbst mit verursacht hat. Das ist lange her – und was hat sich geändert? Glaubst du, der Mensch könne neu anfangen, Shea? Nun, es dürfte dich nicht wenig überraschen zu erfahren, dass manche Dinge sich niemals ändern und die Gefahren der Macht stets gegenwärtig sind, auch noch für eine Rasse, die sich selbst schon fast völlig ausgelöscht hat. Die Großen Kriege der Vergangenheit mögen vorbei sein – die Kriege der Rassen, sowohl die der politischen Anschauungen und des Nationalismus als auch die endgültigen der reinen Energie, der äußersten Macht. Aber heute stehen wir vor neuen Gefahren, und sie bedrohen die Existenz der Rassen mehr als irgendwelche alten. Wenn du glaubst, der Mensch sei frei, sich ein neues Leben aufzubauen, während der Rest der Welt außen vor bleibt, hast du nichts von der Geschichte begriffen!« Er verstummte zornig. Shea starrte ihn aber trotzig an, obwohl er sich klein und ängstlich fühlte.
»Genug davon!«, fuhr Allanon fort und legte Shea freundlich den Arm um die Schulter. »Die Vergangenheit liegt hinter uns, und es ist die Zukunft, mit der wir uns befassen müssen. Lass mich kurz dein Gedächtnis auffrischen, was die Geschichte des Nordlandes und die Legende des Schädelreichs angeht. Wie du sicher weißt, haben die Großen Kriege dem Zeitalter ein Ende gemacht, in dem der Mensch die beherrschende Rasse darstellte. Der Mensch wurde fast völlig ausgerottet, und selbst die geografischen Gegebenheiten, die er kannte, wurden völlig umgeformt. Länder, Nationen und Regierungen verschwanden, als die letzten Angehörigen der Menschheit nach Süden flohen. Es dauerte fast tausend Jahre, bis sich der Mensch wieder über das Niveau der Tiere, die er zu seiner Ernährung jagte, erhoben hatte und eine fortschrittliche Zivilisation erschuf. Diese war primitiv, gewiss, aber es gab Ordnung und so etwas wie eine Regierung. Dann begann der Mensch zu entdecken, dass es außer ihm auch noch andere Rassen gab, die die Welt bewohnten – Wesen, die die Großen Kriege überlebt und ihre eigenen Rassen entwickelt hatten. In den Gebirgen die riesigen Trolle, von ungeheurer Kraft und Wildheit, aber ganz zufrieden mit dem, was sie hatten. In den Wäldern und auf den Hügeln gab es die kleinen, verschlagenen Kreaturen, die wir jetzt Gnome nennen. Um die Rechte auf das Land wurde in den Jahren nach den Großen Kriegen manche Schlacht ausgetragen, die beiden Rassen schadete. Aber man kämpfte ums Überleben, und im Denken eines Wesens, das um sein Leben kämpft, hat die Vernunft keinen Platz.
Der Mensch entdeckte auch, dass es noch eine Rasse gab – eine Rasse von Menschen, die unter die Erde geflüchtet war, um die Auswirkungen der Großen Kriege zu überleben. Jahrelanges Leben in den riesigen Höhlen unter der Erdkruste, ohne Sonnenlicht, veränderte ihr Aussehen. Sie wurden klein und breit, bekamen mächtige Arme und Brustkörbe, starke, dicke Beine und waren zum Klettern und Laufen unter der Erde wie geschaffen. Im Dunkeln können sie besser sehen als jeder andere, aber im Sonnenlicht sind sie halb blind. Sie lebten viele Hundert Jahre unter der Erde, bis sie endlich wieder heraufkamen, um auf der Oberfläche zu wohnen. Zunächst sahen sie sehr schlecht und hausten deshalb in den dunkelsten Wäldern des Ostlandes. Sie entwickelten eine eigene Sprache, kehrten später aber wieder zur Menschensprache zurück. Als der Mensch Überreste dieser verlorenen Rasse erstmals entdeckte, nannte er sie Zwerge, nach einer Rasse aus den Märchen der alten Zeit.« Allanons Stimme verklang, und er schwieg einige Minuten, während er auf die in der Sonne grellgrün schimmernden Hügel blickte. Shea überdachte die Sätze des Historikers. Einen Troll hatte er nie gesehen; Gnome und Zwerge auch nur einen oder zwei, an die er sich kaum erinnerte.
»Und die Elfen?«, fragte er schließlich.
Allanon sah ihn nachdenklich an und senkte den Kopf.
»Ah, ja, ich hatte sie nicht vergessen. Eine bemerkenswerte Rasse von Wesen, die Elfen. Vielleicht das großartigste Volk überhaupt, wenngleich das noch keinem ganz aufgegangen ist. Die Geschichte des Elfenvolks muss jedoch noch warten; es genügt zu sagen, dass es sie in den großen Wäldern des Westlandes immer gegeben hat, obwohl die anderen Rassen sie in diesem Stadium der Geschichte selten zu Gesicht bekamen.
Nun wollen wir sehen, wie viel du über die Geschichte des Nordlandes weißt, mein junger Freund. Heute ist es ein Land, das fast nur noch von Trollen bewohnt wird, ein unfruchtbarer, düsterer Ort, wo wenige Angehörige anderer Rassen unterwegs sind, geschweige sich niederlassen. Die Trolle haben sich natürlich angepasst. Heute leben die Menschen in der Wärme und Behaglichkeit des milden Südlandklimas. Sie haben vergessen, dass einst auch das Nordland von Wesen aller Rassen besiedelt war, nicht nur von den Trollen in den Gebirgsgegenden, sondern auch von Menschen, Zwergen und Gnomen im Tiefland und in den Wäldern. Das war in den Jahren, als alle Rassen erst anfingen, mit neuen Ideen, neuen Gesetzen und vielen neuen Kulturen eine neue Zivilisation aufzubauen. Die Zukunft sah sehr vielversprechend aus, aber heute haben die Menschen vergessen, dass es diese Zeit überhaupt gegeben hat – vergessen, dass sie mehr als eine geschlagene Rasse sind, die versucht, abgesondert von jenen zu leben, die sie besiegt und erniedrigt haben. Damals gab es keine Aufteilung in Länder. Die Erde wurde wiedergeboren, und jede Rasse erhielt eine zweite Chance, sich eine Welt aufzubauen. Die Bedeutung dieser Gelegenheit wurde natürlich nicht erkannt. Alle wollten vor allem festhalten, was sie als ihren Besitz betrachteten, und kleine, eigene Welten einrichten. Jede Rasse war davon überzeugt, dass sie dazu bestimmt sei, in den künftigen Jahren herrschende Macht zu sein – zusammengedrängt wie ein Rudel zorniger Ratten, das ein vertrocknetes, armseliges Stück Käse bewacht. Und der Mensch, o ja, stürzte sich in all seiner Glorie genau wie die anderen gierig darauf. Hast du das gewusst, Shea?«
Der Junge aus dem Tal schüttelte langsam den Kopf; er konnte nicht glauben, dass das, was er hörte, die Wahrheit war. Man hatte ihm erzählt, der Mensch sei seit den Großen Kriegen verfolgt worden und habe um Würde und Ehre gekämpft und um das kleine Land, das ihm gehörte. Er habe sich stets vor der Wildheit der anderen Rassen schützen müssen. Der Mensch sei bei diesen Kämpfen nie der Unterdrücker gewesen, stets der Unterdrückte.
Allanon lächelte grimmig, als er die Wirkung seiner Worte bemerkte. Er fuhr fort: »Wie ich sehe, hast du nicht geahnt, dass es so steht. Gleichgültig – das ist noch die kleinste Überraschung, die ich für dich habe. Die Menschen sind nie das großartige Volk gewesen, für das sie sich halten. Damals kämpften die Menschen genau wie die anderen, wenngleich ich zugeben will, dass sie vielleicht ein höheres Ehrgefühl und ein deutlicheres Bestreben zum Wiederaufbau hatten als andere und dass sie ein wenig zivilisierter waren.« Aus den letzten Worten troff reiner Sarkasmus. »Aber alle diese Dinge haben wenig mit dem Gegenstand unseres Gesprächs zu tun, den ich dir hoffentlich in Kürze dargelegt habe.
Es geschah ungefähr zur gleichen Zeit, als die Rassen einander entdeckt hatten und um die Oberherrschaft kämpften. Damals öffnete der Druidenrat die Hallen von Paranor im unteren Nordland. Die Geschichte bleibt vage, was die Ursprünge und Absichten der Druiden angeht, wenn man auch glaubt, dass sie eine Gruppe weiser Männer aus allen Rassen waren, die viele verlorene Künste der alten Welt beherrschten. Sie waren Philosophen und Visionäre, studierten Künste und Wissenschaften, alles zugleich, aber darüber hinaus waren sie die Lehrer. Sie verliehen die Macht – die Macht neuen Wissens über das Leben. Angeführt wurden sie von einem Mann namens Galaphile, einem Historiker und Philosophen wie ich, der die größten Männer des Landes um sich scharte und einen Rat bildete, der Frieden und Ordnung schaffen sollte. Er stützte sich auf ihr Wissen, um das Zepter über die Rassen zu führen, auf ihre Fähigkeit, Wissen zu vermitteln, um das Vertrauen der Leute zu gewinnen.
Die Druiden waren in diesen Jahren sehr mächtig, und die Pläne Galaphiles schienen aufzugehen. Aber im Laufe der Zeit zeigte sich, dass manche Mitglieder des Rates Kräfte besaßen, die weit über jene der anderen hinausgingen, Kräfte, die in einigen wenigen phänomenalen, genialen Gehirnen geschlummert hatten und stärker geworden waren. Es würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, dir diese Kräfte zu beschreiben, mehr Zeit, als wir zur Verfügung haben. Für unsere Zwecke ist allein wichtig, dass manche im Rat, die genialsten Köpfe, zu der Überzeugung gelangten, sie seien ausersehen, die Zukunft der Rassen zu gestalten. Zuletzt trennten sie sich vom Rat, um eine eigene Gruppe zu bilden, verschwanden für einige Zeit und wurden vergessen.
Etwa hundertfünfzig Jahre später fand innerhalb der menschlichen Rasse ein schrecklicher Bürgerkrieg statt, der sich schließlich zum Ersten Krieg der Rassen, wie die Historiker ihn nannten, ausweitete. Seine Ursache war selbst damals schon unklar und ist inzwischen beinahe vergessen. Kurz gesagt, lehnte sich ein kleiner Teil der menschlichen Rasse gegen die Lehren des Rates auf und stellte eine mächtige und gut ausgebildete Armee auf. Der vorgebliche Zweck der Erhebung war die Unterwerfung des Rests der Menschheit unter eine zentrale Herrschaft zur Verbesserung der Rasse und der Förderung ihres Stolzes als Volk. Mit der Zeit schlossen sich fast alle Teile der Rasse der neuen Sache an, und man führte Krieg gegen die anderen Rassen, angeblich, um das neue Ziel zu erreichen. Die Hauptfigur war ein Mann namens Brona – ein archaischer Gnomen-Ausdruck für ›Meister‹. Man behauptete, er sei der Führer jener Druiden im ersten Rat gewesen, die sich abgespalten hatten und im Nordland verschwunden waren. Keine verlässliche Quelle hat je bestätigt, ihn gesehen oder mit ihm gesprochen zu haben, und am Ende kam man zu dem Schluss, Brona sei nur ein Name, eine fiktive Gestalt. Die Revolte, wenn du sie so nennen willst, wurde schließlich von der vereinigten Macht der Druiden und der anderen verbündeten Rassen unterdrückt. Hast du das gewusst, Shea?«
»Ich habe vom Druidenrat, seinen Absichten und Leistungen gehört – alles uralte Geschichten, weil es den Rat seit langer Zeit nicht mehr gibt. Ich habe vom Ersten Krieg der Rassen gehört, allerdings nicht so, wie Ihr ihn schildert. Der Krieg war für die Menschen eine bittere Lehre.«
Allanon wartete geduldig, während Shea hinzusetzte: »Ich weiß auch, dass die Überlebenden unserer Rasse nach dem Ende des Krieges in den Süden geflohen und seitdem dort geblieben sind. Man baute die Heimat und die verlorenen Städte wieder auf und versuchte, Leben zu bewahren statt zu zerstören. Ihr scheint das als ängstliche Abschottung zu betrachten. Ich glaube aber, dass es der beste Weg war und ist. Zentrale Regierungen waren stets die größte Gefahr für die Menschheit. Jetzt gibt es keine mehr – kleine Gemeinschaften sind die Regel. Es gibt Dinge, von denen sich am besten alle fernhalten.«
Der Hüne lachte tonlos.
»Du weißt so wenig, wenn auch zutrifft, was du sagst. Binsenweisheiten sind die nutzlosen Kinder verspäteter Einsichten, junger Freund. Nun, ich will mit dir nicht über Einzelheiten gesellschaftlicher Reform streiten, geschweige denn über politisches Handeln. Das müssen wir auf ein andermal verschieben. Sag mir, was du von dem Wesen namens Brona weißt. Vielleicht … nein, warte einen Augenblick. Da kommt jemand …«
Die stämmige Gestalt Flicks näherte sich. Der junge Mann blieb stehen, als er Allanon sah, und zögerte, bis Shea ihm winkte. Er kam langsam heran, den Blick auf das dunkle Gesicht gerichtet. Der große Mann lächelte ihn an.
»Ich wollte nicht stören …«, begann Flick.
»Du störst nicht«, sagte Shea sofort, aber Allanon schien anderer Meinung zu sein.
»Dieses Gespräch war allein für deine Ohren bestimmt«, sagte er zu Shea. »Wenn dein Bruder bleiben will, wird er in den kommenden Tagen über sein eigenes Schicksal entscheiden müssen. Ich möchte eindringlich vorschlagen, dass er sich den Rest unseres Gesprächs nicht anhört, ja sogar vergisst, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Aber die Wahl liegt bei ihm.«
Die Brüder sahen einander verwirrt an, doch Allanons grimmige Miene verriet, dass er nicht scherzte.
»Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet«, sagte Flick schließlich, »aber Shea und ich sind Brüder, und was dem einen widerfährt, widerfährt auch dem anderen. Wenn er Kummer hat, werde ich diesen mit ihm teilen – das ist meine eigene freie Entscheidung.«
Shea blickte ihn erfreut an. Er war stolz auf seinen Bruder und lächelte. Flick zwinkerte ihm zu und setzte sich. Der schwarze Wanderer strich sich den Bart, lächelte ganz unerwartet auch und sagte:
»Die Entscheidung liegt bei dir, und du hast dich durch deine Worte als Bruder erwiesen. Aber es kommt auf Taten an. In den nächsten Tagen wirst du die Entscheidung vielleicht bereuen…« Er verstummte und sah auf Flicks gesenkten Kopf hinunter, bevor er sich wieder Shea zuwandte. »Nun, ich kann meine Ausführungen nicht noch einmal von vorn beginnen. Dein Bruder Flick wird versuchen müssen, uns zu folgen, so gut er kann. Nun sag mir, was du über Brona weißt, Shea.«
Shea dachte einige Zeit nach und zuckte dann die Achseln.
»Eigentlich nicht viel. Er ist eine Legende, wie Ihr sagt, der angebliche Führer der Erhebung im Ersten Krieg der Rassen. Er soll ein Druide gewesen sein, der den Rat verließ und seine Macht dazu missbrauchte, den Willen seiner Anhänger zu beherrschen. Historisch ist er nie gesehen, nie gefangen genommen und in der letzten Schlacht nicht getötet worden. Es hat ihn also nie gegeben.«
»Historisch zutreffend, gewiss«, murmelte Allanon. »Was weißt du im Zusammenhang mit dem Zweiten Krieg der Rassen über ihn?«
Shea lächelte kurz.
»Nun, der Legende nach war er auch hinter diesem Krieg die treibende Kraft, aber das hat sich ebenso als Mythos erwiesen. Er soll dasselbe Wesen gewesen sein, das die Armeen der Menschen im Ersten Krieg aufstellte, nur nannte man ihn diesmal den Hexenmeister – als böser Widerpart zum Druiden Brimen. Ich glaube, Brimen soll ihn jedoch im Zweiten Krieg getötet haben. Aber das ist alles nur erfunden.«
Flick nickte heftig, Allanon schwieg. Shea wartete auf eine Bestätigung.
»Wohin soll uns das Ganze eigentlich führen?«, fragte er.
Allanon sah ihn scharf an und zog eine Braue hoch.
»Dir mangelt es erstaunlich an Geduld, Shea. Schließlich haben wir binnen Minuten die Geschichte von tausend Jahren abgehandelt. Falls du dir jedoch zutraust, dich noch kurze Zeit im Zaum zu halten, verspreche ich dir, dass deine Frage beantwortet wird.«
Shea nickte geknickt. Es waren nicht die Worte selbst, die schmerzten, sondern die Art, wie Allanon sie sagte, dieses spöttische Lächeln und der kaum verhohlene Sarkasmus. Der Talbewohner errang rasch die Fassung wieder und zuckte die Achseln.
»Nun gut«, sagte Allanon. »Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nur über den geschichtlichen Hintergrund gesprochen. Nun kommen wir zu dem Grund, weshalb ich nach dir gesucht habe. Ich rufe dir die Ereignisse des Zweiten Krieges der Rassen ins Gedächtnis – des letzten Krieges in der neuen Geschichte der Menschen, der vor noch nicht fünfhundert Jahren im Nordland geführt wurde. Die Menschen waren an diesem Krieg nicht beteiligt; sie hatten den Ersten verloren und lebten tief im Herzen des Südlandes, ein paar kleine Gemeinden, die sich bemühten, der Bedrohung totaler Auslöschung zu entgehen. Dies war ein Krieg der großen Rassen – Elfen und Zwerge gegen die Macht der wilden Gebirgstrolle und der verschlagenen Gnomen.
Nach dem Ende des Ersten Krieges teilte sich die bekannte Welt in vier Länder auf, und die Rassen lebten lange Zeit im Frieden. In dieser Zeit nahmen Macht und Einfluss des Druidenrates stark ab, da das Bedürfnis nach seiner Hilfe nicht mehr zu bestehen schien. Man muss gerechterweise hinzufügen, dass die Druiden in ihrer Aufmerksamkeit für die Rassen nachgelassen hatten. Über Jahre hinweg verloren die neuen Mitglieder die Ziele des Rates aus den Augen, wandten sich von den Problemen der Völker ab und persönlichen Dingen zu, führten ein abgeschlosseneres Dasein des Studiums und der Meditation. Die Elfen waren die mächtigste Rasse, beschränkten sich aber auf ihr abgeschiedenes Heimatland tief im Westen, wo sie sich damit begnügten, vergleichsweise abgesondert zu leben – ein Fehler, den sie schwer bereuen sollten. Die anderen Völker zerstreuten sich und bildeten kleinere, weniger geeinigte Gesellschaften, vorwiegend im Ostland, wenn sich auch manche Gruppen in Teilen des West- und Nordlandes niederließen, in den Grenzgebieten.
Der Zweite Krieg der Rassen begann, als eine riesige Armee von Trollen aus dem Charnalgebirge herabkam und das ganze Nordland eroberte, einschließlich der Druidenfestung in Paranor. Die Druiden waren von einigen ihrer eigenen Leute verraten worden, die der feindliche Befehlshaber, damals noch unbekannt, mit Versprechungen und Angeboten auf seine Seite gezogen hatte. Die verbliebenen Druiden wurden bis auf ganz wenige, die entkommen oder zu der Zeit unterwegs gewesen waren, gefangen genommen und in die Verliese der Burg geworfen. Man sah sie nie wieder. Die dem Schicksal ihrer Genossen entrannen, verstreuten sich über die vier Länder und versteckten sich. Die Armee der Trolle ging sofort gegen die Zwerge im Ostland vor, in der klaren Absicht, jeden Widerstand so schnell wie möglich zu brechen. Die Zwerge versammelten sich tief in den riesigen Wäldern des Anar, die nur sie gut genug kannten, um dort längere Zeit überleben zu können, und hielten sich gegen die Trolle, obwohl diese von einigen Gnomen unterstützt wurden, die sich ihnen angeschlossen hatten. Der Zwergenkönig Raybur schrieb in der Geschichte seines Volkes nieder, wen er als den wahren Feind ausgemacht hatte – den Rebellendruiden Brona.«
»Wie konnte der Zwergenkönig das glauben?«, warf Shea ein. »Wenn es zuträfe, wäre der Hexenmeister über fünfhundert Jahre alt gewesen! Ich glaube, irgendein ehrgeiziger Mystiker muss dem König das eingeredet haben, um eine alte, überholte Legende wieder zu beleben, vielleicht um sich eine bessere Stellung zu verschaffen.«
»Das ist eine Möglichkeit«, räumte Allanon ein. »Aber lass mich fortfahren. Nach langen Monaten des Kampfes waren die Trolle offenbar im Glauben, die Zwerge seien geschlagen, und so wandten sie sich mit ihren Kriegslegionen nach Westen und marschierten gegen das mächtige Elfenkönigreich auf. Aber in der Zeit, als die Trolle gegen die Zwerge gekämpft hatten, hatte der berühmte Mystiker Brimen, ein alter und hochgeschätzter Ratsältester, die wenigen aus Paranor entkommenen Druiden versammelt. Er führte sie ins Elfenreich im Westland, um die Leute dort vor der neuen Bedrohung zu warnen und sich auf die sicher geglaubte Invasion der Nordländer vorzubereiten. Der Elfenkönig war in diesem Jahr Jerle Shannara – vielleicht der größte aller Elfenkönige, mit Ausnahme Eventines. Brimen warnte den König vor dem bevorstehenden Angriff, und der Elfenherrscher stellte schnell seine Armeen auf, bevor die Trollhorden die Grenzen erreicht hatten. Passt nun gut auf!«
Shea und Flick nickten.
»Brimen gab Jerle Shannara für die Schlacht mit den Trollen ein besonderes Schwert. Wer immer das Schwert auch ergriff, sollte unbesiegbar sein – selbst gegen die unheimliche Macht des Hexenmeisters. Als die Troll-Legionen in das Tal von Rhenn im Grenzgebiet des Elfenreichs eindrangen, wurden sie von den Armeen der Elfen, die aus den Höhen herabkamen, angegriffen, umzingelt und in einer zweitägigen Schlacht schwer geschlagen. Die Elfen wurden angeführt von den Druiden und Jerle Shannara, der das mächtige Schwert schwang, das er von Brimen erhalten hatte. Sie kämpften gemeinsam gegen die Trolle, denen angeblich die zusätzliche Kraft von Wesen aus der Geisterwelt unter der Herrschaft des Hexenmeisters zur Verfügung stand. Aber der Mut des Elfenkönigs und die Macht des sagenhaften Schwertes überwältigten die Geisterwesen und vernichteten sie. Als die Reste der Trollarmeen versuchten, über die Ebene von Streleheim in die Sicherheit des Nordlandes zu fliehen, gerieten sie zwischen die verfolgenden Elfen und eine Armee von Zwergen, die sich aus dem Ostland näherte. Es kam zu einer mörderischen Schlacht, in der die Trollarmee fast bis zum letzten Mann aufgerieben wurde. Während des Kampfes verschwand Brimen von der Seite des Elfenkönigs und trat dem Hexenmeister gegenüber. Es steht geschrieben, dass die beiden sich gegenseitig im Kampf vernichteten und nie mehr gesehen wurden. Man fand nicht einmal die Leichen.
Jerle Shannara trug das berühmte Schwert bis zu seinem Tod einige Jahre später. Sein Sohn übergab die Waffe dem Druidenrat in Paranor, wo die Klinge in einen riesigen Block Tre-Stein gesteckt und in ein Gewölbe in der Druidenburg verbracht wurde. Ich bin sicher, ihr kennt die Legende von diesem Schwert und was es für alle Rassen bedeutet. Das große Schwert ruht in Paranor, seit fünfhundert Jahren. Habe ich mich verständlich genug ausgedrückt?«