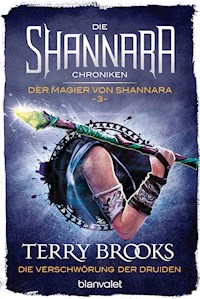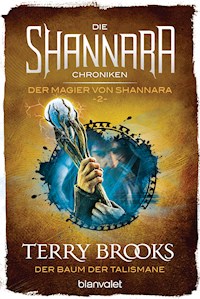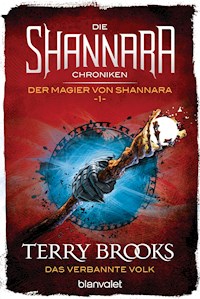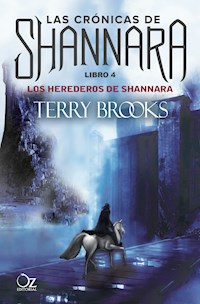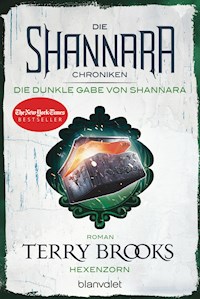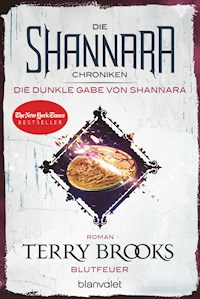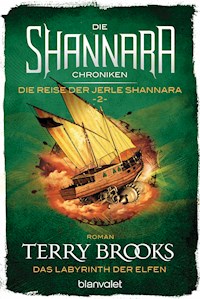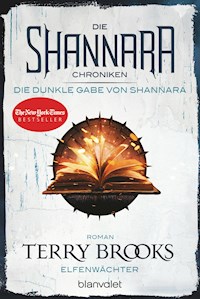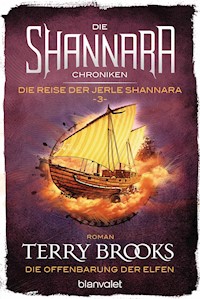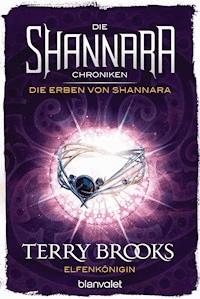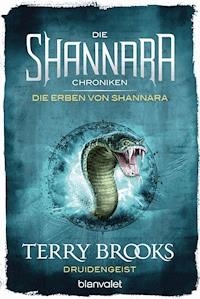
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Shannara-Chroniken: Die Erben von Shannara
- Sprache: Deutsch
»Terry Brooks erschafft große Epen, reich an Magie, Geheimnissen und Charakteren, die man nie vergisst.« Christopher Paolini
Walker Boh, der Onkel von Par Ohmsford, soll im Auftrag von Allanon den Druidenorden neu gründen und so den Sterblichen endlich die Magie zurückgeben. Doch bei der Suche nach der verschollenen Druidenfestung Paranor wurde er in der Halle der Könige mit dem tödlichen Gift der Asphinx infiziert, das ihn nun langsam zu Stein werden lässt. Sein Tod scheint besiegelt, da taucht auf einmal eine wunderschöne Frau an seinem Krankenbett auf …
Dieser Roman ist bereits geteilt in zwei Bänden erschienen unter den Titeln »Die Schatten von Shannara« und »Die Verräter von Shannara«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
In den dreihundert Jahren, die seit dem Tod des Druiden Allanon vergangen sind, haben die Schattenwesen die Vier Länder mit einem Netz der Angst überzogen. Die Suche nach dem schwarzen Elfenstein und der verschollenen Druidenfestung Paranor führt Walker Boh und seine Gefährten in die dunklen Landstriche hinter den Bergen von Charnal. Die Mission scheint aussichtslos, bis ihnen Quickening, die Tochter des Königs vom Silberfluss, zu Hilfe eilt. Die junge Frau hat einen geheimen Auftrag und ist mit ihren Begleitern Morgan Leah und dem Meuchelmörder Pe Ell auf dem Weg in das Reich des Steinkönigs, wo auch der Elfenstein vermutet wird. Walker Boh schließt sich Quickening an, ohne zu ahnen, was ihn im Reich des Steinkönigs Schreckliches erwarten wird …
Autor
Im Jahr 1977 veränderte sich das Leben des Rechtsanwalts Terry Brooks, geboren 1944 in Illinois, USA, grundlegend: Gleich der erste Roman des begeisterten Tolkien-Fans eroberte die Bestsellerlisten und hielt sich dort monatelang. Doch Das Schwert von Shannara war nur der Beginn einer atemberaubenden Karriere, denn bislang sind mehr als zwanzig Bände seiner Shannara-Saga erschienen.
Terry Brooks bei Blanvalet:
Das Schwert der Elfen
Elfensteine
Das Lied der Elfen
Heldensuche
Druidengeist
Weitere Titel in Vorbereitung
Terry Brooks
DIE SHANNARA-CHRONIKEN
Die Erben
von Shannara 2
Druidengeist
Aus dem Englischen
von Angelika Weidmann
Vollständig durchgesehen und überarbeitet
von Andreas Helweg
Für Laurie und Peter,
für ihre Liebe, ihre Unterstützung
und ihre Ermutigung
bei allem
1
Der König vom Silberfluss stand am Rande der Gärten, die seit der Dämmerung des Elfenzeitalters sein Reich waren, und blickte hinaus in die Welt der sterblichen Menschen. Was er sah, erfüllte ihn mit Trauer und raubte ihm den Mut. Überall kränkelte das Land und starb, fruchtbarer schwarzer Humus verfiel zu Staub, grasbewachsene Ebenen welkten dahin, Wälder verwandelten sich in riesige Gebiete toten Holzes, und Seen und Flüsse versandeten und trockneten aus. Und allenthalben wurden auch die Geschöpfe, die das Land bewohnten, krank und starben, denn sie fanden keine Nahrung mehr, weil diese zunehmend giftiger wurde. Selbst die Luft hatte begonnen, faulig zu werden.
Und währenddessen, dachte der König vom Silberfluss, gewinnen die Schattenwesen immer mehr an Macht.
Er streichelte die karmesinroten Blüten der Zyklamen, die üppig zu seinen Füßen wuchsen. Große Forsythienbüsche standen gleich dahinter, Hartriegel und Kirschen ein Stück weiter, Fuchsien und Hibiskus, Rhododendron und Dahlien, Beete mit Iris, Azaleen, Gänseblümchen, Rosen und hundert andere Arten von Blumen und Blütensträuchern, die fortwährend in Blüte standen, eine Pracht an Farben, die sich in die Ferne erstreckte, so weit das Auge reichte. Auch Tiere waren zu sehen, große und kleine, Geschöpfe, deren Evolution zurückverfolgt werden konnte in jene längst vergangenen Zeiten, als alles Leben in Frieden und Harmonie existierte.
In der gegenwärtigen Welt der Vier Länder und der Rassen, die sich aus Chaos und Zerstörung der Großen Kriege entwickelt hatten, war diese Zeit beinahe vergessen. Der König vom Silberfluss als Einziger übrig geblieben. Er hatte schon gelebt, als die Welt noch neu war und ihre ersten Geschöpfe gerade geboren wurden. Damals war er jung gewesen, und es hatte viele gegeben, die so waren wie er. Inzwischen war er alt und der Letzte seiner Art. Alles, was einmal gewesen war, mit Ausnahme der Gärten, in denen er lebte, war verschwunden. Nur die Gärten existierten unverändert, getragen von der Elfenmagie. Das Wort hatte dem König vom Silberfluss die Gärten gegeben, das Wort hatte ihm aufgetragen, sie zu pflegen und zu erhalten, als Erinnerung an das, was einst gewesen war und was eines Tages vielleicht wieder sein würde. Die Welt draußen würde sich entwickeln, so wie sie musste, doch die Gärten würden für immer bleiben, wie sie waren.
Und dennoch schrumpften sie. Dieser Prozess fand indes nicht so sehr materiell, sondern eher spirituell statt. Die Grenzen der Gärten lagen unveränderlich fest, denn ihr Dasein wurde von den Veränderungen der sterblichen Welt nicht beeinflusst. Die Gärten waren eher eine Präsenz als ein Ort. Doch diese Präsenz wurde durch die Krankheit der Welt, an die sie gebunden war, geschwächt, denn die Aufgabe der Gärten und ihres Hüters bestand darin, jene Welt stark zu erhalten. Je vergifteter die Vier Länder wurden, desto schwerer wurde diese Aufgabe, desto schwächer die Auswirkung dieser Arbeit, und damit begann die Kraft menschlichen Glaubens und Vertrauens in ihre Existenz – die immer ein wenig geschwankt hatte – ganz und gar zu versiegen.
Der König vom Silberfluss war bekümmert deswegen. Er trauerte nicht um seiner selbst willen, er stand über solchen Gefühlen. Er trauerte für die Völker der Vier Länder, die sterblichen Männer und Frauen, denn sie liefen Gefahr, die Elfenmagie für immer zu verlieren. Die Gärten im Lande des Silberflusses waren jahrhundertelang ihre Zuflucht gewesen und er ihr spiritueller Freund, der seine Völker beschützte. Er hatte über sie gewacht, hatte ihnen ein Gefühl von Frieden und Wohlergehen vermittelt, das die körperlichen Grenzen überstieg, und hatte das Versprechen gegeben, dass Wohlwollen und guter Wille in manchen Winkeln der Welt noch immer für alle zugänglich wären. Das war nun vorbei. Er konnte niemanden mehr schützen. Das Übel der Schattenwesen, das Gift, das sie über die Vier Länder brachten, hatte seine Kraft untergraben, bis er wahrhaftig innerhalb seiner Gärten eingesperrt war und nicht mehr die Macht besaß, denen zu Hilfe zu kommen, die er so lange beschützt hatte.
Geraume Zeit starrte er auf die Ruinen der Welt hinaus, und Verzweiflung nahm unnachgiebig Besitz von ihm. Erinnerungen spielten Verstecken in seinem Bewusstsein. Einst hatten die Druiden die Vier Länder beschützt. Aber die Druiden waren gegangen. Einige wenige Nachfahren des Elfenhauses von Shannara waren über Generationen die Helden der Rassen gewesen und hatten die verbliebene Elfenmagie ausgeübt. Aber sie waren alle tot.
Er verdrängte die Verzweiflung und ersetzte sie durch Hoffnung. Die Druiden konnten zurückkehren. Und neue Generationen des alten Hauses von Shannara waren herangewachsen. Der König vom Silberfluss wusste fast alles, was sich in den Vier Ländern ereignete, auch wenn er nicht dorthin gehen konnte. Allanons Schatten hatte die Shannara-Kinder ausgesandt, um die verlorene Magie zurückzuerobern, und vielleicht würde es ihnen auch gelingen, falls sie lange genug überlebten und Mittel und Wege fanden, es zu tun. Aber alle waren größten Gefahren ausgesetzt. Alle waren vom Tode bedroht, im Osten, Süden und Westen von den Schattenwesen, im Norden von Uhl Belk, dem Steinkönig.
Er schloss kurz die alten Augen. Gewiss wusste er, wie man die Shannara-Kinder retten könnte – mit einem Akt der Magie, einer so mächtigen und ausgeklügelten Magie, dass nichts den Erfolg vereiteln konnte. Sie würde die Barrieren überwinden, die ihre Feinde erschaffen hatten, und den Schirm aus Täuschung und Lügen durchbrechen, der den vieren, von denen so vieles abhing, alles verbarg.
Ja, vier, nicht drei. Nicht einmal Allanon verstand die Gesamtheit dessen, was im Gange war.
Er wandte sich um und ging zurück ins Herz seines Refugiums. Er ließ sich vom Gesang der Vögel, dem Duft der Blumen und der warmen Luft streicheln, und seine Sinne sogen die Farben und Düfte und Gefühle seiner Umgebung in sich auf. Es gab praktisch nichts, was er innerhalb seiner Gärten nicht vollbringen konnte. Doch seine Magie wurde draußen gebraucht. Ihm war klar, was nottat. Zur Vorbereitung nahm er die Gestalt des alten Mannes an, in der er sich gelegentlich der Welt jenseits seiner Gärten zeigte. Nun wankte er beim Gehen, schnaufte beim Atmen, seine Augen wurden trüb, und sein ganzer Körper schmerzte mit dem Gefühl des schwindenden Lebens. Das Vogelgezwitscher verstummte, und die kleinen Tiere in seiner Nähe hasteten eilig davon. Er löste sich von allem, mit dem er sich entwickelt hatte, und schrumpfte zurück zu dem, was er hätte werden können, weil er für einen Augenblick menschliche Sterblichkeit empfinden musste, damit er wusste, wie er jenen Teil von sich geben konnte, der gebraucht wurde.
Als er in das Herz seines Reiches gelangte, blieb er stehen. Es gab einen Teich mit allerklarstem Wasser, der von einem kleinen Bächlein gespeist wurde. Ein Einhorn trank daraus. Die Erde am Teich war dunkel und fruchtbar. Winzige, zarte Blümchen, die keinen Namen hatten, wuchsen am Wasser; sie besaßen die Farbe von frischem Schnee. Ein kleiner, filigraner Baum wuchs auf einem Flecken von violettem Gras am anderen Ufer des Teichs, seine grünen Blätter waren mit Mustern wie aus roten Spitzen überzogen. In zwei gewaltigen Felsen glitzerten Streifen farbigen Erzes im Sonnenschein.
Der König vom Silberfluss stand reglos inmitten all des Lebens und zwang sich, damit eins zu werden. Als es so weit war, als sich alles mit der menschlichen Gestalt, die er angenommen hatte, verwoben hatte, als sei es aus Teilen unsichtbarer Stickerei zusammengefügt, nahm er es in sich auf. Er hob die Hände, runzlige, menschliche Haut und gebrechliche Knochen, und beschwor seine Magie; verschwunden war das Gefühl von Alter und Zeit, die Erinnerung an das sterbliche Dasein.
Erst zog der kleine Baum seine Wurzeln aus dem Boden und kam zu ihm, das Knochengerüst, auf dem er aufbauen würde. Langsam bog er sich und nahm die Form an, die er wünschte, die Blätter falteten sich eng um die Zweige, wickelten sie ein und umschlossen sie. Dann kam die Erde, unsichtbare Schaufeln stachen sie aus und klopften und formten sie an den Baum. Dann kamen die Erze für Muskeln, das Wasser für Flüssigkeiten und die Blütenblätter der kleinen Blumen als Haut. Er sammelte Seide von der Mähne des Einhorns für das Haar und schwarze Perlen für die Augen. Der Zauber wirkte und verwob sich, und die Schöpfung nahm langsam Gestalt an.
Als der König vom Silberfluss fertig war, stand vor ihm ein Mädchen, das in jeder Hinsicht vollkommen war. Außer in einer: Es lebte noch nicht.
Er ließ den Blick schweifen, dann wählte er die Taube. Er nahm sie aus der Luft und setzte sie lebend in die Brust des Mädchens, und sie wurde das Herz. Nun umarmte er das Mädchen und hauchte ihr sein eigenes Leben ein. Dann trat er zurück und wartete. Ihre Brust hob und senkte sich, ihre Glieder zuckten. Ihre Augenlider flackerten und klappten auf, die kohlschwarzen Augen schauten aus dem zarten Gesicht. Sie war zierlich und feingliedrig, wie kunstvoll aus Papier gefaltet, geglättet und geformt, alle Kanten und Ecken durch Rundungen ersetzt. Ihr Haar war so weiß, dass es wie Silber schimmerte, und hatte einen Glanz, der das Vorhandensein dieses kostbaren Metalls nahelegte.
»Wer bin ich?«, fragte sie mit sanfter, heller Stimme, die von kleinen Bächlein und zarten, nächtlichen Lauten wisperte.
»Du bist meine Tochter«, erwiderte der König vom Silberfluss, und dabei regten sich in ihm Gefühle, die er seit langer Zeit verloren geglaubt hatte.
Er machte sich nicht die Mühe, ihr zu sagen, dass sie ein Elementarwesen, ein Erdkind war, das seine Magie erschaffen hatte. Mit den Instinkten, die er ihr eingegeben hatte, konnte sie fühlen, was sie war. Weitere Erläuterungen waren überflüssig.
Sie tat versuchsweise einen zaghaften Schritt vorwärts, dann noch einen. Als sie sah, dass sie gehen konnte, bewegte sie sich schneller, prüfte ihre Fähigkeiten auf unterschiedliche Weise, indem sie um ihren Vater herumging und den alten Mann scheu und behutsam betrachtete. Neugierig sah sie sich um, nahm den Anblick, die Gerüche, die Geräusche und den Geschmack der Gärten in sich auf und entdeckte in ihnen eine Verwandtschaft, die sie sich nicht sofort erklären konnte.
»Sind diese Gärten meine Mutter?«, fragte sie unvermittelt, und er sagte ihr, so sei es. »Bin ich ein Teil von euch beiden?«, wollte sie wissen, und er bejahte es.
»Komm mit«, lud er sie freundlich ein.
Zusammen wandelten sie durch die Gärten und erforschten sie wie Vater und Kind, betrachteten Blüten, beobachteten die umherhuschenden Vögel und Tiere, studierten die weitläufigen, komplizierten Strukturen des wirren Unterholzes und die verästelten Schichten von Stein und Erde, die Muster, gewoben aus den Fäden der Existenz der Gärten. Sie war von schneller Auffassung und klug, interessierte sich für alles, voller Liebe und Respekt vor dem Leben. Er war zufrieden mit dem, was er sah. Er fand, er hatte sie gut erschaffen.
Nach einer Weile begann er, ihr etwas von der Magie zu zeigen. Zunächst demonstrierte er die seine, nur ein ganz klein wenig, um sie nicht zu überfordern. Dann ließ er sie ihre eigene ausprobieren. Überrascht stellte sie fest, dass sie über solche verfügte, und war noch mehr überrascht über das, was sie bewirkte. Aber sie zögerte nicht, sie zu verwenden. Sie war ganz eifrig.
»Du hast einen Namen«, sagte er zu ihr. »Möchtest du wissen, wie du heißt?«
»Ja«, sagte sie und schaute ihn aufmerksam an.
»Du heißt Quickening. Belebung.« Er machte eine Pause. »Verstehst du, warum?«
Sie überlegte ein Weilchen. »Ja«, antwortete sie dann wieder.
Er führte sie zu einem uralten Hickorybaum, dessen Rinde sich in großen, ausgefransten Streifen vom Stamm löste. Eine kühle Brise wehte hier und duftete nach Jasmin und Begonien, und sie setzten sich auf das weiche Gras. Ein Greif kam zwischen den hohen Halmen herbei und schnupperte an der Hand des Mädchens.
»Quickening«, sagte der König. »Es gibt etwas, das du tun musst.«
Langsam und sorgfältig erklärte er ihr, dass sie die Gärten verlassen und hinaus in die Welt der Menschen gehen müsse. Er nannte ihr das Ziel und was sie zu tun hätte. Er sprach vom Dunklen Onkel, dem Hochländer, und dem namenlosen anderen, von den Schattenwesen, von Uhl Belk und Eldwist und von dem schwarzen Elfenstein. Und während er zu ihr sprach und ihr die Wahrheit enthüllte, wer und was sie war, spürte er einen Schmerz in seiner Brust, der eindeutig menschlich war, ein Teil von ihm, der sich seit vielen Jahrhunderten nicht mehr offenbart hatte. Der Schmerz brachte eine Traurigkeit mit sich, Tränen stiegen ihm in die Augen, und seine Stimme drohte zu brechen. Überrascht hielt er inne und kämpfte dagegen an. Es kostete ihn einige Mühe weiterzusprechen. Das Mädchen schaute ihn still an – aufmerksam, in sich gekehrt, erwartungsvoll. Sie gab keine Widerworte, und sie stellte nicht infrage, was er ihr sagte. Sie lauschte nur und nahm es an.
Als er zu Ende gekommen war, stand sie auf. »Ich weiß, was von mir erwartet wird. Ich bin bereit.«
Doch der König vom Silberfluss schüttelte den Kopf. »Nein, mein Kind, das bist du nicht. Du wirst es feststellen, wenn du von hier fortgegangen bist. Ungeachtet dessen, was du bist und was du kannst, bist du doch verwundbar durch Dinge, vor denen ich dich nicht schützen kann. Sei auf der Hut und passe gut auf dich auf. Sei wachsam gegenüber allem, was du nicht verstehst.«
»Das werde ich«, erwiderte sie.
Er begleitete sie bis zum Rand der Gärten, wo die Welt der Menschen anfing, und gemeinsam betrachteten sie die sich ausbreitende Verheerung. Ohne zu sprechen standen sie lange, lange Zeit einfach da, bis sie sagte: »Ich sehe, dass ich dort gebraucht werde.«
Er nickte bekümmert, fühlte schon ihren Verlust, obgleich sie noch gar nicht fortgegangen war. Sie ist nur ein Elementarwesen, dachte er und wusste gleichzeitig, dass es nicht stimmte. Sie war viel mehr. So, als habe er sie zur Welt gebracht, war sie ein Teil von ihm.
»Auf Wiedersehen, Vater«, sagte sie plötzlich und wich von seiner Seite.
Sie verließ die Gärten und verschwand in der Welt jenseits davon. Sie küsste oder berührte ihn nicht zum Abschied. Sie ging einfach fort, denn das war alles, was sie zu tun wusste.
Der König vom Silberfluss wandte sich ab. Die Anstrengung hatte ihn erschöpft und seine Magie ausgezerrt. Er musste eine Weile ruhen. Schnell schlüpfte er aus seiner menschlichen Gestalt, streifte die falschen Schichten aus Haut und Knochen ab und wusch sich von ihren Erinnerungen und Gefühlen rein, um wieder zu der Elfenkreatur zu werden, die er eigentlich war.
Doch das, was er für Quickening empfand, seine Tochter, das Kind aus seiner Hand, das blieb.
2
Walker Boh erwachte schaudernd.
Dunkler Onkel.
Ein Wispern in seinem Kopf riss ihn aus dem schwarzen Loch zurück, in das er zu gleiten drohte, zerrte ihn aus dem Tintenschwarz in die grauen Randzonen des Lichts, und er schreckte so heftig hoch, dass sich seine Beinmuskeln verkrampften. Sein Kopf schnellte in die Höhe, seine Augen klappten auf, und er starrte blicklos vor sich hin. Sein ganzer Körper tat weh, nicht enden wollende Wellen von Schmerz wogten über ihn hinweg. Es fühlte sich an, als würde er mit glühendem Eisen malträtiert, und in einem hilflosen Versuch, die Pein zu lindern, rollte er sich ganz fest zusammen. Nur den rechten Arm ließ er ausgestreckt, ein schweres, hinderliches Ding, das nicht mehr zu ihm gehörte, für immer auf den Boden der Höhle gebannt, auf dem er lag, vom Ellenbogen an in Stein verwandelt.
Dort lag die Quelle des Schmerzes.
Er schloss die Augen und wollte den Schmerz zum Aufhören bringen, zum Verschwinden. Aber ihm fehlte die Kraft, es zu befehlen, seine Magie war fast erschöpft, verschwendet, als er gegen das Vordringen des Giftes der Asphinx ankämpfte. Vor sieben Tagen war er auf der Suche nach dem schwarzen Elfenstein in die Halle der Könige gekommen, sieben Tage, seit er stattdessen die tödliche Kreatur gefunden hatte, die dort hingebracht worden war, um ihm eine Falle zu stellen.
Oh, ja, dachte er fiebernd. Eindeutig eine Falle.
Aber von wem? Von den Schattenwesen oder von jemand anderem? Von demjenigen, der jetzt im Besitz des schwarzen Elfensteins war?
Verzweifelt rief er sich die Ereignisse in Erinnerung, die ihn hierhergeführt hatten. Da war der Aufruf von Allanon, der schon seit dreihundert Jahren tot war, an die Erben der Shannara-Magie gewesen, seinen Neffen Par Ohmsford, seine Kusine Wren Ohmsford und ihn selbst. Zuerst hatten man ihnen Träume geschickt und dann den früheren Druiden Cogline, der sie drängte, den Träumen Folge zu leisten. Das hatten die drei getan. Sie hatten sich am Hadeshorn getroffen, wo Allanons Schatten ihnen erschienen war und jeden mit einer anderen Aufgabe betraut hatte. Sie alle waren dazu ausersehen, das zerstörerische Werk der Schattenwesen zu bekämpfen, die ihre Magie einsetzten, um das Leben aus den Vier Ländern zu stehlen. Walker hatte den Auftrag, Paranor zurückzugewinnen, die untergegangene Festung der Druiden, und gleichzeitig den Druiden wiederzubeleben. Er hatte sich dieser Aufgabe widersetzt, bis Cogline ihn abermals aufsuchte und ihm diesmal eine Chronik der Druiden mitbrachte, in der von einem schwarzen Elfenstein die Rede war. Dieser sollte die Kraft besitzen, Paranor wiederzufinden. Das hatte ihn zum Finsterweiher geführt, einem sehenden Geist, der Geheimnisse der Welt und der sterblichen Menschen kannte.
Er ließ den Blick durch das Dämmerlicht der Höhle schweifen, über die Türen zu den Grüften der Könige der Vier Länder, die seit Jahrhunderten tot waren, über die Schätze, die vor den Sarkophagen, in denen sie lagen, aufgestapelt waren, und über die steinernen Wächter, die ihre Überreste bewachten. Steinaugen starrten aus reglosen Gesichtern, blicklos, erbarmungslos. Er war mit ihren Geistern allein.
Und er würde sterben.
Obwohl er sie unterdrücken wollte, traten ihm Tränen in die Augen und machten ihn blind. Was war er doch für ein Narr!
Dunkler Onkel. Die Worte hallten still in seinem Kopf wider, eine Erinnerung, die ihn heimsuchte und quälte. Sie erklangen mit der Stimme des Finsterweihers, dieses üblen, heimtückischen Geistes, der verantwortlich war für das, was ihm widerfahren war. Die Rätsel des Finsterweihers hatten ihn auf der Suche nach dem schwarzen Elfenstein in die Halle der Könige geführt. Der Finsterweiher musste gewusst haben, was ihn dort erwartete – nicht der Elfenstein, sondern stattdessen die Asphinx, eine tödliche Falle, die ihn vernichten würde.
Und warum hatte er angenommen, dass es anders kommen sollte, fragte sich Walker kleinmütig. Hasste ihn der Finsterweiher mehr als jeden anderen? Hatte er sich nicht vor Walker gerühmt, dass er ihn ins Verhängnis schickte, indem er ihm gab, was er wünschte? Walker war dem Geist einfach ausgewichen, um ihm gefällig zu sein, und so war er übereifrig davongehastet, geradewegs in den Tod, der ihm verheißen war, in dem naiven Glauben, er könne sich gegen jedwedes Übel, das ihm begegnen mochte, selbst schützen. Erinnerst du dich, schalt er sich selbst, erinnerst du dich, wie zuversichtlich du warst?
Er wand sich, während das Gift in ihm brannte. Gut und schön. Und wo war seine Zuversicht jetzt?
Er zwang sich auf die Knie und beugte sich hinunter über die Öffnung im Höhlenboden, wo seine Hand im Stein festgehalten wurde. Er konnte die Überreste der Asphinx sehen. Der steinerne Leib der Schlange ringelte sich um seinen versteinerten Arm, beide auf ewig fest mit dem Felsen des Gebirges verbunden und verwachsen. Er kniff den Mund zusammen und zog den Ärmel seines Mantels zurück. Sein Arm war hart und bewegte sich nicht, grau bis an den Ellenbogen. Graue Adern arbeiteten sich gemächlich zu seiner Schulter hinauf. Der Prozess war langsam, aber stetig. Sein ganzer Körper würde zu Stein werden.
Nicht dass es einen Unterschied machte, wenn das geschah, dachte er, denn er würde ohnehin verhungern, bevor es so weit war. Oder verdursten. Oder dem Gift erliegen.
Er ließ den Ärmel wieder hinunterrutschten, über den grausamen Anblick seines Armes. Sieben Tage schon. Das bisschen Nahrung, das er mitgenommen hatte, war bald aufgezehrt gewesen, und das letzte Wasser hatte er vor zwei Tagen getrunken. Die Kräfte verließen ihn jetzt rasch. Die meiste Zeit lag er im Fieberrausch, seine klaren Momente wurden immer kürzer. Zu Anfang hatte er gekämpft und versucht, mithilfe seiner Magie das Gift aus seinem Körper zu verbannen und seine Hand und seinen Arm wieder zu Fleisch und Blut zu machen. Doch seine Zauberkraft hatte vollständig versagt. Er hatte sich abgemüht, seinen Arm vom Steinboden zu lösen und sich irgendwie zu befreien. Doch er wurde festgehalten, ein Verurteilter ohne jegliche Hoffnung auf Freiheit. Irgendwann war er vor Erschöpfung eingeschlafen, und im Laufe der Tage hatte er immer mehr geschlafen, der Wunsch, wieder aufzuwachen, war in die Ferne gerückt.
Und nun, während er da kniete, ein Häufchen Elend und Schmerz, nur zeitweilig von der Stimme des Finsterweihers vor dem Sterben bewahrt, erkannte er mit erschreckender Gewissheit, dass er beim nächsten Mal wohl endgültig einschlafen würde. Er atmete hastig und schluckte die Angst. Das durfte er nicht zulassen. Er durfte nicht aufgeben.
Er zwang sich zum Nachdenken. Solange er denken konnte, sagte er sich, würde er nicht einschlafen. Im Geiste ging er noch einmal die Unterhaltung mit dem Finsterweiher durch, hörte die Worte des Geistes und versuchte, ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Der Finsterweiher hatte nicht ausdrücklich die Halle der Könige als Ort genannt, wo der schwarze Elfenstein zu finden sei. Hatte Walker einfach den falschen Schluss gezogen? War er absichtlich fehlgeleitet worden? Stimmte überhaupt irgendetwas an dem, was man ihm gesagt hatte?
Walkers Gedanken fielen verwirrt auseinander, und sein Verstand weigerte sich, der gestellten Anforderung nachzukommen. Verzweifelt schloss er die Augen, und es kostete ihn ungeheure Mühe, sie wieder zu öffnen. Seine Kleidung war kalt und feucht vom eigenen Schweiß. Er zitterte, keuchte beim Atmen, konnte kaum klar sehen, und zunehmend fiel es ihm schwer zu schlucken. So viele Ablenkungen – wie sollte er da nachdenken? Er wollte nur daliegen und …
Er geriet in Panik, als er spürte, dass ihn Bewusstlosigkeit zu verschlingen drohte. Er bewegte sich hin und her und scharrte mit den Knien über den Stein, bis sie bluteten. Ein bisschen zusätzliche Schmerzen halten mich vielleicht wach, dachte er. Aber er spürte kaum etwas.
Er zwang sich, wieder an den Finsterweiher zu denken, stellte sich den Geist vor, wie er über sein Missgeschick lachte und sich daran erfreute. Er hörte die spöttische Stimme nach ihm rufen. Wut verlieh ihm ein Quäntchen Kraft. Da war etwas, an das er sich erinnern musste, dachte er verzweifelt. Da war etwas, das der Finsterweiher ihm gesagt hatte, an das er sich erinnern musste.
Bitte, nur nicht einschlafen!
Die Halle der Könige reagierte nicht auf sein Flehen. Die Statuen blieben still, gleichgültig, blind. Der Berg wartete.
Ich muss mich befreien!, brüllte er stumm.
Und dann erinnerte er sich an die Visionen, genauer gesagt an die erste der drei, die der Finsterweiher ihm enthüllt hatte. In dieser Vision hatte er auf einer Wolke über der kleinen Gruppe gestanden, die sich nach Aufforderung von Allanons Schatten am Hadeshorn versammelt hatte, und er hatte gesagt, dass er sich eher die Hand abhacken würde als die Druiden zurückbringen. Dann hatte er den Arm in die Höhe gehoben, um zu zeigen, dass er genau das getan hatte.
Er erinnerte sich an die Vision und sah die Wahrheit darin.
Ungläubig und entsetzt ließ er den Kopf sinken, bis dieser auf dem Steinboden der Höhle ruhte. Er weinte, Tränen traten ihm in die Augen und brannten, als sie sich mit dem Schweiß vermischten. Sein Körper wand sich unter der Qual seines Wissens um den nächsten Schritt.
Nein! Nein, er würde es nicht tun.
Aber er wusste, dass er es tun musste.
Sein Weinen verwandelte sich in Gelächter, eiskalt wallte es in seinem Wahnsinn aus ihm heraus in die leere Gruft. Er wartete, bis es sich von allein erschöpfte und das Echo verstummte. Dann sah er wieder auf. Seine Möglichkeiten hatten sich erschöpft, sein Schicksal war besiegelt. Wenn er jetzt nicht freikam, das wusste er, würde er es nie mehr schaffen.
Und es gab nur einen einzigen Weg.
Er wappnete sich gegen seine Gefühle und zog aus einer letzten Reserve seine allerletzte Kraft. Er ließ seinen Blick über den Höhlenboden wandern, bis er fand, was er brauchte. Es war ein Felsbrocken von etwa der Größe und der Form einer Beilklinge, auf einer Seite ausgezackt und hart genug, den Sturz von der Höhlendecke überstanden zu haben, wo er vier Jahrhunderte zuvor beim Kampf zwischen Allanon und der Schlange Valg losgeschlagen worden war. Der Stein lag fast sieben Meter entfernt, für einen gewöhnlichen Menschen unerreichbar. Doch nicht für ihn. Er sammelte einen Rest der Magie, die ihm geblieben war, und zwang sich durchzuhalten, solange er sie einsetzte. Der Stein ruckte scharrend vorwärts, ein langsames Kratzen in der stillen Höhle. Walker schwindelte von der Anstrengung, das Fieber brannte in ihm, verursachte ihm Übelkeit. Doch er ließ den Stein stetig näher rücken.
Endlich war der Felsbrocken in Reichweite seiner freien Hand. Er setzte die Magie ein und brauchte eine Weile, um sich zu erholen. Dann streckte er die Hand aus und fasste nach dem Stein. Langsam zog er ihn heran, fand ihn ungeheuer schwer, so schwer, dass er nicht sicher war, ob er ihn hochheben konnte, geschweige denn …
Er brachte den Gedanken nicht zu Ende. Er durfte nicht länger zögern. Also holte er den Stein heran, bis er neben ihm lag, stützte sich auf seine Knie, holte tief Luft, hob den Stein über den Kopf, verharrte kurz und schlug dann in einem Drang aus Furcht und Eile zu. Der Brocken krachte zwischen Handgelenk und Ellenbogen auf den versteinerten Arm und traf mit solcher Wucht auf, dass sein ganzer Körper erschüttert wurde. Der qualvolle Schmerz drohte ihn in die Bewusstlosigkeit zu zerren. Er schrie, als die Pein in Wellen über ihn hinwegpreschte; er hatte das Gefühl, zerrissen zu werden, von innen nach außen. Dann kippte er vornüber, schnappte nach Luft, und der wie eine Axtklinge geformte Stein fiel ihm aus den verkrampften Fingern.
Etwas war anders.
Er richtete sich auf und betrachtete seinen Arm. Der Schlag hatte sein steinernes Glied zerschmettert. Unterarm und Hand blieben im Dämmerlicht des verborgenen Lochs im Höhlenboden an die Asphinx geheftet. Doch sein übriger Körper war frei.
Benommen staunend kniete er längere Zeit da, starrte auf die Überreste seines Arms, auf das grau durchzogene Fleisch oberhalb des Ellenbogens und die zersplitterten Reste am Boden. Sein Arm war bleischwer und steif. Das Gift, das sich darin befand, wirkte weiter. Schmerz durchzuckte seinen ganzen Leib.
Aber er war frei! Himmel noch mal, er war frei!
Plötzlich rührte sich etwas in der hinteren Kammer, ein schwaches, entferntes Rascheln, als ob etwas erwacht sei. Walker Boh wurde es eiskalt in der Magengrube, als er begriff, was geschehen war. Sein Schrei hatte ihn verraten. Die hintere Kammer war der Versammlungssaal, und im Versammlungssaal hatte einst die Schlange Valg, Wächter der Toten, gelebt.
Und lebte vielleicht noch immer.
Walker stand auf, und ihn überfiel ein plötzlicher Schwindelanfall. Er beachtete ihn nicht, auch nicht den Schmerz und die Erschöpfung, und taumelte zum schweren, eisenbeschlagenen Eingangstor, durch das er hereingekommen war. Alle Geräusche, ob nun von außen oder aus seinem Innern, sperrte er aus und konzentrierte sich ganz darauf, zu dem Gang dahinter zu gelangen. Falls die Schlange lebte und ihn jetzt aufspürte, war er am Ende, so viel wusste er.
Das Glück war ihm hold. Die Schlange kam nicht zum Vorschein. Nichts kam zum Vorschein. Walker erreichte die Tür, die aus der Gruft führte, und trat hinaus in die Finsternis dahinter.
Von dem, was danach geschah, sollte er nie eine klare Vorstellung bekommen. Irgendwie gelangte er in die Halle der Könige, vorbei an den Todesfeen, deren Geheul einen wahnsinnig machen konnte, vorbei an den Sphinxen, deren Blick ihn in Stein hätte verwandeln können. Er hörte die Todesfeen brüllen, fühlte den Blick der Sphinxen auf sich brennen und spürte das Grauen der uralten Magie des Bergs, der versuchte, ihm eine Falle zu stellen und ihn zu seinem nächsten Opfer zu machen. Doch er entkam. Ein letzter Schild aus Entschlossenheit schützte ihn, obwohl dem Wahnsinn nahe, auf dem Weg. Eiserner Wille, gepaart mit Erschöpfung und Schmerz, umgab und bewahrte ihn. Vielleicht kam ihm auch seine Magie zu Hilfe, das hielt er für möglich. Die Magie war schließlich ein unvorhersehbares, ein ewiges Mysterium. Er trottete durch die nahezu vollständige Dunkelheit, vorbei an phantasmagorischen Bildern und steinernen Wänden, die sich um ihn zu schließen drohten, durch Tunnel voller Anblicke und Geräusche, in denen er weder sehen noch hören konnte. Und schließlich war er frei.
Als er hinaustrat, brach gerade der Tag an. Die Sonne schien blass und kühl durch die graue, tiefhängende Wolkendecke, die von einem Gewitter der vergangenen Nacht geblieben war. Den Arm unter dem Umhang verborgen wie ein verwundetes Kind, folgte er dem Bergpfad hinunter nach Süden. Er blickte nicht zurück. Er konnte kaum nach vorn sehen. Auf den Beinen hielt er sich nur, weil er sich weigerte, klein beizugeben. Er konnte sich selbst kaum noch spüren, nicht einmal die Schmerzen der Vergiftung. Er ging, als würde er an Fäden gezogen, die an seinen Gliedmaßen festgebunden waren. Sein schwarzes Haar wehte wild im Wind, peitschte ihm ins blasse Gesicht, bis die Augen tränten. Wie eine wahnsinnige Vogelscheuche verließ er den grauen Dunst.
Dunkler Onkel, wisperte die Stimme des Finsterweihers in seinem Kopf und lachte schadenfroh.
Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Der schwachen Sonne gelang es nicht, die Gewitterwolken aufzulösen, und der Tag blieb farblos und unfreundlich. Wege kamen und blieben zurück, eine endlose Prozession von Felsen, Schluchten, Hohlwegen und Abgründen. Walker nahm das alles nicht wahr. Er wusste nur, dass er abwärts ging, dass er sich aus dem Felsengebiet nach unten schleppte, zurück in die Welt, die er so töricht verlassen hatte, und alles nur in dem Versuch, sein eigenes Leben zu retten.
Es war Mittag, als er endlich die hohen Gipfel hinter sich ließ und das Schiefertal erreichte. Er war ein zerlumptes, zielloses Etwas von einem menschlichen Wrack, so fieberkrank und schwach, dass er halbwegs über den zersplitterten, schwarz glänzenden Fels des Talbodens stolperte, ehe er begriff, wo er war. Als er es schließlich erkannte, verließen ihn seine Kräfte. Er verwickelte sich in seinen Mantel und stürzte, die scharfen Kanten des Gesteins rissen ihm die Haut an Hand und im Gesicht auf, doch er beachtete es nicht und blieb erschöpft auf dem Bauch liegen. Nach einer Weile kroch er in Richtung des stillen Sees los, mühsam schob er sich, mit seinem versteinerten Armstumpf unter sich, stückchenweise vor. In seinem Delirium erschien es ihm logisch, dass das todbringende Wasser dem Gift, das ihn langsam umbrachte, entgegenwirken würde wenn er den Rand des Hadeshorns erreichte und seinen abgebrochenen Arm hineintauchte. Es ergab keinen Sinn, doch für Walker Boh war Wahnsinn das Maß des Lebens geworden.
Dennoch versagte er selbst in diesem kleinen Bestreben. Nach einigen Metern verlor er vor Schwäche das Bewusstsein. Als Letztes nahm er noch wahr, wie finster es mitten am Tag war: die Welt ein Ort der Schatten.
Er schlief, und im Schlaf träumte er, dass Allanons Schatten zu ihm kam. Der Schatten tauchte auf aus dem brennenden, brodelnden Wasser des Hadeshorns, dunkel und mysteriös, und materialisierte sich aus der Unterwelt des Lebens nach dem Tode, zu dem er verbannt war. Er streckte Walker die Hand entgegen, hob ihn auf die Füße, erfüllte ihn mit neuer Kraft und schenkte seinem Denken und Sehen wieder Klarheit. Geisterhaft und durchsichtig schwebte er über dem dunklen grünlichen See – doch seine Berührung fühlte sich seltsam menschlich an.
– Dunkler Onkel –
Als der Schatten die Worte sprach, waren sie nicht spöttisch und hasserfüllt, wie die des Finsterweihers. Sie waren ganz einfach die Bezeichnung dessen, wer und was Walker war.
– Warum willst du den Auftrag, mit dem ich dich betraut habe, nicht erfüllen –
Walker mühte sich aufgebracht um Antwort, doch er fand die Worte nicht.
– Du wirst dringend gebraucht, Walker. Nicht von mir, doch von den Vier Ländern und ihren Völkern, den Rassen der neuen Welt. Wenn du meinen Auftrag nicht annimmst, gibt es für sie keine Hoffnung mehr –
Walker packte grenzenloser Zorn. Die Druiden, die es nicht mehr gab, und das verschwundene Paranor zurückholen? Gewiss doch, dachte Walker zur Antwort. Gewiss doch, Schatten von Allanon. Ich werde meinen ruinierten Leib, meinen vergifteten Arm auf die Suche nach dem, was du haben willst, schleppen, auch wenn ich am Sterben bin und keine Hoffnung hegen kann, irgendwem zu helfen, doch ich …
– Nimm es an, Walker. Du nimmst es nicht an. Gesteh dir die Wahrheit über dich und dein Schicksal ein –
Walker verstand ihn nicht.
– Verwandtschaft mit jenen, die dir vorausgegangen sind, mit jenen, die verstanden haben, was es bedeutet, anzunehmen. Das ist es, was dir fehlt –
Walker schauderte, und die Vision seines Traums wurde unterbrochen. Seine Kräfte verließen ihn. Er sackte am Ufer des Hadeshorns zusammen, fassungslos vor Angst und Verwirrung, und fühlte sich so verloren, dass es ihm unmöglich schien, je wiedergefunden werden zu können.
Hilf mir, Allanon, flehte er verzweifelt.
Der Schatten hing reglos vor ihm in der Luft, ätherisch vor dem Hintergrund grauen Himmels und kahler Gipfel, und ragte auf wie das Gespenst des Todes, das gekommen war, sich ein neues Opfer zu holen. Plötzlich kam es Walker so vor, als ob Sterben das Einzige war, das ihm noch bliebe.
Willst du, dass ich sterbe?, fragte er ungläubig.
Der Schatten sagte nichts.
Wusstest du, dass mir das zustoßen würde? Er streckte den Arm vor, den abgesplitterten Steinstumpf und die vom Gift gestreifte Haut.
Der Schatten blieb stumm.
Warum willst du mir nicht helfen?, heulte Walker.
– Warum willst du mir nicht helfen –
Die Worte hallten scharf durch sein Bewusstsein, drängend und voll finsterer Entschlossenheit. Aber nicht er hatte sie gesprochen. Sondern Allanon.
Dann flimmerte der Schatten plötzlich in der Luft vor ihm und verblasste. Das Wasser des Hadeshorns dampfte, zischte, brodelte zornig und beruhigte sich wieder. Die Luft rundum war dunkel und dunstig, voller Gespenster und wilder Einbildungen, ein Ort, wo Leben und Tod sich an einem Kreuzweg unbeantworteter Fragen und ungelöster Rätsel begegneten.
Walker Boh nahm sie nur einen Moment lang wahr, wusste, dass er sie nicht im Traum, sondern wachend sah, und erkannte plötzlich, dass seine Vision vielleicht gar kein Traum gewesen war.
Dann verschwand alles, und er fiel in tiefe Schwärze.
Als er wieder erwachte, beugte sich jemand über ihn. Walker sah den anderen durch einen Nebel aus Fieber und Schmerzen, seine dünne, lange Gestalt in grauen Gewändern, mit einem schmalen Gesicht, schütterem Bart und Haar und einer Hakennase, dicht über ihn gebeugt, als habe er im Sinn, ihm das letzte bisschen Leben auszusaugen.
»Walker?«, flüsterte die Gestalt freundlich.
Cogline. Walker schluckte, weil seine Kehle trocken war, und wollte aufstehen. Das Gewicht seines Armes zerrte an ihm, zog ihn zurück, zwang ihn nieder. Die Hand des alten Mannes wühlte unter dem Mantel und fand den bleischweren Stumpf. Walker hörte, wie er scharf Luft holte.
»Wie … wie hast du mich gefunden?«, brachte er hervor.
»Allanon«, erwiderte Cogline. Seine Stimme war rau und gebrochen vor Zorn.
Walker seufzte. »Wie lange habe ich …?«
»Drei Tage. Ich weiß nicht, wieso du noch lebst. Dem Rechte nach solltest du tot sein.«
»Ja«, gab Walker zu und umarmte den alten Mann impulsiv. Der vertraute Geruch des alten Mannes trieb ihm Tränen in die Augen. »Ich glaube, ich soll noch nicht sterben – jetzt noch nicht.«
Cogline erwiderte Walkers Umarmung. »Nein, Walker«, sagte er, »jetzt noch nicht.«
Dann half ihm der alte Mann auf die Füße, zog ihn mit einer Kraft hoch, die Walker ihm nicht zugetraut hatte, und während er ihn aufrechthielt, zeigte er zum südlichen Ende des Tals. Wieder dämmerte der Morgen, die Sonne ging auf und leuchtete golden am wolkenlosen östlichen Horizont. Die Luft war still und voller Erwartung.
»Halte dich an mir fest«, drängte Cogline, während er ihn über den zersplitterten schwarzen Fels führte. »Pferde warten auf uns und hilfreiche Hände. Halte dich fest, Walker.«
Walker klammerte sich an ihn wie an sein Leben.
3
Cogline brachte Walker nach Storlock. Selbst zu Pferd, mit Walker auf dem Sattel festgebunden, brauchten sie bis zum Einbruch der Nacht. Aus den Drachenzähnen kamen sie in einen sonnigen, warmen Tag, wandten sich ostwärts über die Rabb-Ebene in die Ostlandwälder des zentralen Anars zu dem legendären Dorf der Stors. Von Schmerzen gepeinigt und von Gedanken an den Tod aufgezehrt, blieb Walker fast die ganze Zeit wach. Aber er war nie sicher, wo er sich eigentlich befand oder was um ihn herum geschah, war sich nur des Schwankens seines Pferdes und Coglines ständiger Versicherungen bewusst, dass alles gut werden würde.
Er glaubte nicht, dass Cogline ihm die Wahrheit sagte.
Storlock lag still, kühl und trocken im Schatten der Bäume, eine Zuflucht vor der drückenden Hitze und dem Staub der Ebene. Hände hoben Walker aus dem Sattel, und damit endeten der Schweißgeruch und das Schwanken und das Gefühl, dass er jeden Augenblick dem Tod nachgeben müsse, der auf ihn wartete. Er wusste nicht, warum er noch lebte. Er konnte keinen Grund dafür nennen. Weiß gewandete Gestalten umgaben ihn, stützten ihn, hielten ihn – Stors, Gnome aus dem Heilerdorf. Jeder kannte die Stors. Sie waren die fortschrittlichsten Heilkundigen in den Vier Ländern. Wil Ohmsford hatte einst bei ihnen studiert und war als einziger Südländer je Heiler geworden. Shea Ohmsford war hier nach einem Angriff im Wolfsktaag geheilt worden. Zuvor hatte man auch Par bei ihnen gegen das Gift der Werbestien aus dem Altmoor behandelt. Walker hatte ihn hergebracht. Jetzt war er selbst an der Reihe, gerettet zu werden. Doch Walker glaubte nicht, dass es dazu kommen würde.
Man hielt ihm eine Tasse an die Lippen, und eine unbekannte Flüssigkeit rann seine Kehle hinunter. Fast augenblicklich ließen die Schmerzen nach, und er wurde schläfrig. Schlaf würde ihm guttun, dachte er plötzlich zu seiner eigenen Überraschung. Schlaf war ihm willkommen. Er wurde ins Haupthaus getragen, das zentrale Pflegequartier, und in einem der hinteren Zimmer in ein Bett gelegt, von dem aus man durch das Gewebe der Vorhänge den Wald sehen konnte, eine Wand dunkler Stämme, die dort Wache hielten. Man zog ihm die Kleidung aus, wickelte ihn in Decken, gab ihm erneut etwas zu trinken, eine bittere, heiße Flüssigkeit, und dann wurde er zum Schlafen allein gelassen.
Er nickte fast augenblicklich ein.
Während er schlief, sank das Fieber, und er erholte sich von der Erschöpfung. Der Schmerz blieb, doch irgendwie fern und nicht Teil von ihm. Er tauchte in die Wärme und Behaglichkeit seines Betts ein, und selbst Träume konnten den Schild nicht durchbrechen, den die Ruhe bildete. Ihn peinigten keine Visionen, keine finsteren Gedanken weckten ihn. Allanon und Cogline waren vergessen. Seine Verzweiflung über den Verlust seines Arms, die Anstrengung, der Asphinx und der Halle der Könige zu entkommen, und das grauenvolle Gefühl, nicht länger Herr seines eigenen Schicksals zu sein – alles war vergessen. Er hatte Frieden gefunden.
Er hatte keine Ahnung, wie lange er schlief, denn ihm wurde nicht bewusst, wie die Zeit verstrich, wie die Sonne über den Himmel wanderte, wie es Nacht und Tag und wieder Nacht wurde. Als er langsam wieder zu sich kam und aus der Dunkelheit seiner Rast durch eine Welt des Halbschlafs schwebte, rührten sich unerwartet Erinnerungsfetzen an seine Kindheit, an die Tage, in denen er gelernt hatte, Enttäuschung und Verwunderung über die Entdeckung dessen zu bewältigen, wer und was er war.
Die Erinnerungen waren klar und deutlich.
Er war noch ein Kind, als er zum ersten Mal erkannte, dass er Magie besaß. Er nannte es damals nicht Magie, er hatte überhaupt keinen Namen dafür. Er hielt damals solche Fähigkeiten für alltäglich und dachte, er sei wie jedermann. Mit seinem Vater Kennar und seiner Mutter Rissa lebte er am Kamin im Dunkelstreif, wo es keine anderen Kinder gab, mit denen er sich hätte vergleichen können. Das sollte erst später stattfinden. Seine Mutter war es, die ihm sagte, dass seine Fähigkeiten ungewöhnlich seien und ihn von anderen Kindern unterschieden. Er sah ihr Gesicht immer noch vor sich, als sie es ihm erklärte, ihre ernsten zarten Züge, ihre weiße Haut und ihr kohlschwarzes Haar, das sie immer zu Zöpfen geflochten trug und mit Blüten schmückte. Er hörte ihre leise, dringliche Stimme. Rissa. Er hatte seine Mutter innig geliebt. Sie selbst hatte keine Magie geerbt; sie war eine Boh, und die Magie kam von der Seite seines Vaters, von den Ohmsfords. An einem strahlenden Herbsttag, an dem die Luft von den Düften welkender Blätter und brennenden Holzes erfüllt war, hatte sie ihn vor sich hingesetzt und es ihm lächelnd und behutsam mitgeteilt, hatte erfolglos versucht, das Unbehagen, das sie deswegen empfand, vor ihm zu verbergen.
Das war eins der Dinge, zu denen ihn die Magie befähigte. Manchmal ließ sie ihn sehen, was andere fühlten – nicht bei jedem, aber fast immer bei seiner Mutter.
»Walker«, sagte sie, »die Magie macht dich zu etwas Besonderem. Sie ist eine Gabe, die du pflegen und hegen und ehren musst. Ich weiß, dass du eines Tages etwas Wunderbares damit vollbringen wirst.«
Ein Jahr später starb sie an einem Fieber, gegen das selbst sie mit ihren außerordentlichen Heilkräften kein Mittel hatte finden können.
Dann lebte er mit seinem Vater allein, und die »Gabe«, mit der sie ihn gesegnet geglaubt hatte, entwickelte sich schnell. Die Magie schenkte ihm Fähigkeiten und Einsichten. Er entdeckte, dass er oft etwas in Leuten spürte, das niemand ausgesprochen hatte – Veränderungen ihrer Stimmung und ihres Charakters, Gefühle, von denen sie glaubten, sie könnten sie geheim halten, Meinungen und Ideen, Nöte und Hoffnungen, sogar die Gründe für ihre Taten. Es gab immer Besuch am Kamin – Durchreisende, Krämer, Händler, Holzfäller, Jäger, Fallensteller, sogar Fährtensucher –, und Walker wusste genau über sie Bescheid, selbst wenn sie kein Wort sagten. Er offenbarte ihnen, was er wusste, ein Spiel, das er schrecklich gern spielte. Manche unter ihnen verängstigte es, und sein Vater befahl ihm, damit aufzuhören. Walker gehorchte, denn er hatte eine neue, interessantere Fähigkeit entdeckt. Er konnte mit den Tieren des Waldes kommunizieren, mit den Vögeln und den Fischen und sogar mit den Pflanzen. Er spürte, was sie dachten und fühlten, genauso wie bei den Menschen, auch wenn ihre Gedanken und Gefühle begrenzter und rudimentärer waren. Für lange Stunden verschwand er zu Ausflügen, bei denen er lernte, zu vorgegaukelten Abenteuern und zu Reisen, auf denen er sich erprobte und erkundete. Schon in sehr jungen Jahren betrachtete er sich als Erforscher des Lebens.
Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass Walkers besondere Einsicht ihm auch beim Lernen zugutekommen würde. Er las in der Bibliothek seines Vaters, sobald er verstanden hatte, wie die Buchstaben des Alphabets auf den abgewetzten Seiten der Bücher seines Vaters Wörter bildeten. Mühelos meisterte er die Mathematik. Die Naturwissenschaften verstand er intuitiv. Kaum irgendetwas musste man ihm erklären. Irgendwie schien er einfach zu begreifen, wie alles zusammenhing. Geschichte wurde seine besondere Leidenschaft, seine Erinnerungsfähigkeit an Orte und Ereignisse und Leute war erstaunlich. Er begann mit eigenen Aufzeichnungen über alles, was er lernte, und schrieb Lehren auf, die er eines Tages anderen weitergeben wollte.
Je älter er wurde, desto mehr schien sich die Haltung seines Vaters ihm gegenüber zu verändern. Zunächst leugnete er diesen Verdacht, überzeugt, dass er sich irrte. Doch das Gefühl blieb. Schließlich fragte er seinen Vater danach. Kennar – ein großer, schlanker Mann mit flinken Bewegungen und großen, intelligenten Augen, der sein Stottern mit harter Anstrengung überwunden hatte und über große handwerkliche Begabung verfügte – gab zu, dass es stimmte. Kennar verfügte selbst nicht über Magie. In seiner Jugend hatte er Spuren davon gehabt, doch kurz nachdem er dem Knabenalter entwachsen war, waren sie verschwunden. So war es auch seinem Vater und dem Vater seines Vaters und allen Ohmsfords, von denen er Kenntnis hatte, ergangen, bis zurück zu Brin. Doch bei Walker war dies offensichtlich nicht der Fall. Walkers Magie schien sogar immer stärker zu werden. Kennar befürchtete, die Fähigkeiten würden seinen Sohn irgendwann überwältigen und sich zu einem Punkt entwickeln, wo er ihre Wirkung nicht mehr vorhersehen und beherrschen könne. Doch gleichzeitig sagte er, dass die Magie nicht unterdrückt werden dürfe und eine Gabe sei, deren Auftreten immer einen bestimmten Sinn habe.
Wenig später erzählte er Walker die Geschichte der Hintergründe der Ohmsford’schen Magie, von dem Druiden Allanon und der Talbewohnerin Brin und von dem mysteriösen Vermächtnis, das er ihr im Sterben überantwortet hatte. Walker war zwölf Jahre alt, als er die Legende hörte. Er hatte wissen wollen, worin denn das Vermächtnis bestanden habe. Sein Vater hatte es ihm nicht sagen können. Er konnte ihm nur die Geschichte berichten, wie es in der Blutlinie der Ohmsfords weitergegeben wurde.
»Das Vermächtnis manifestiert sich in dir, Walker«, sagte er. »Du deinerseits wirst es deinen Kindern weitergeben und sie den ihren, bis es eines Tages gebraucht wird. Das ist das Vermächtnis, das du geerbt hast.«
»Aber wozu taugt denn ein Vermächtnis, das keinem Zweck dient?«, hatte Walker gefragt
Und Kennar hatte wiederholt: »Die Magie hat immer einen Sinn – selbst wenn wir nicht erkennen, worin er liegt.«
Knapp ein Jahr später, als Walker in die Jugendjahre kam und seine Kindheit hinter sich ließ, offenbarte die Magie eine andere, dunkle Seite. Walker fand heraus, dass sie zerstörerisch sein konnte. Manchmal, vor allem, wenn er wütend war, verwandelten sich seine Gefühle in Energie. Wenn das geschah, konnte er Dinge bewegen und zerbrechen, ohne sie zu berühren. Manchmal konnte er eine Art Feuer entfachen. Es war kein gewöhnliches Feuer, es brannte nicht wie gewöhnliches Feuer, und es hatte eine andere Farbe, ein Blau wie Kobalt. Es konnte es nicht dazu bewegen, sich so zu verhalten, wie er wollte, sondern machte so ziemlich das, was es selbst wollte. Er brauchte Wochen, um zu lernen, es zu beherrschen. Er versuchte, seine Entdeckung vor seinem Vater zu verbergen, doch sein Vater erfuhr trotzdem davon, so, wie er irgendwann stets alles über seinen Sohn herausfand. Auch wenn er sich dazu kaum äußerte, spürte Walker, wie sich die Distanz zwischen ihnen vergrößerte.
Walker war auf der Schwelle zum Mannesalter, als sich sein Vater entschloss, ihn vom Kamin fortzubringen. Kennar Ohmsfords Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Jahren immer mehr verschlechtert, seinen einst kräftigen Körper hatte eine zermürbende Krankheit befallen. Er schloss die Hütte ab, die von Geburt an Walkers Heim gewesen war, und brachte den Jungen nach Schattental, wo er bei einer anderen Ohmsford-Familie leben sollte, bei Jaralan und Mirianna mit ihren Söhnen Par und Coll.
Der Umzug wurde zu Walkers schrecklichstem Erlebnis. Schattental war lediglich ein kleiner Weiler, doch nach dem Leben am Kamin musste sich Walker mit großen Einschränkungen abfinden. Vorher hatte er grenzenlose Freiheit genossen, hier gab es Grenzen, denen er nicht zu entkommen vermochte. Walker war nicht an die Gegenwart so vieler Menschen gewöhnt und konnte sich nicht einfügen. Er sollte zur Schule gehen, doch dort gab es nichts für ihn zu lernen. Der Lehrer und die Mitschüler mochten ihn nicht und misstrauten ihm; er war ein Außenseiter und benahm sich anders als sie, er verfügte über bei weitem zu großes Wissen. Sehr bald entschieden sie, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollten. Seine Magie wurde zu einer Falle, aus der er nicht entkommen konnte. Sie manifestierte sich in allem, was er tat, und als er schließlich erkannte, dass er sie hätte geheim halten sollen, war es längst zu spät. Er wurde mehrfach verprügelt, denn er setzte sich nicht zur Wehr, weil er sich vor dem fürchtete, was geschehen würde, wenn er das Feuer ausbrechen ließ.
Er lebte noch kein ganzes Jahr in dem Ort, als sein Vater starb. Walker hatte sich damals gewünscht, er möge auch sterben.
Er wohnte weiterhin bei Jaralan und Mirianna Ohmsford, die gut zu ihm waren und Verständnis für die Schwierigkeiten zeigten, mit denen er zu kämpfen hatte, denn bei ihrem eigenen Sohn Par machten sich gerade die ersten Zeichen bemerkbar, dass er ebenfalls Magie besaß. Par war ein Nachkomme von Jair Ohmsford, Brins Bruder. Auf beiden Seiten der Familie war in den Jahren seit Allanons Tod die Magie ihrer Ahnen weitervererbt worden, sodass Pars Magie nicht völlig unerwartet auftrat. Bei Par war sie jedoch vorhersehbarer und weniger kompliziert und manifestierte sich hauptsächlich in der Fähigkeit des Jungen, mit seiner Stimme naturgetreue Bilder bei den Zuhörern zu erzeugen. Par war damals noch klein, gerade fünf oder sechs Jahre alt, und er verstand kaum, wie ihm geschah. Coll war noch nicht stark genug, um seinen Bruder zu beschützen, also nahm schließlich Walker den Knaben unter seine Fittiche. Das erschien völlig natürlich. Letztendlich verstand nur Walker wirklich, was Par durchlebte.
Die Beziehung zu Par änderte alles. Sie gab Walker eine Richtung und einen Sinn jenseits der Sorge um sein eigenes Überleben. Er verbrachte viel Zeit mit Par und half ihm, mit der Anwesenheit von Magie in seinem Körper zurechtzukommen. Er beriet ihn in ihrer Anwendung und lehrte ihn die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Er versuchte, ihm beizubringen, wie er mit der Angst und der Abneigung der Menschen umgehen konnte, die es nicht verstehen wollten. Er wurde zu Pars Mentor.
Die Leute von Schattental begannen ihn »Dunkler Onkel« zu nennen. Es fing bei den Kindern an. Natürlich war er nicht Pars Onkel, er war niemandes Onkel. Aber in den Augen der Talbewohner bestand keine klare Blutsverwandtschaft, und niemand kannte wirklich die Beziehung, die er zu Jaralan und Mirianna hatte, deshalb konnten sie ihn nicht zuordnen. »Dunkler Onkel« blieb hängen. Der inzwischen hochgewachsene Walker war blasshäutig und hatte schwarzes Haar wie seine Mutter, und offenbar war er auch immun gegen die bräunende Wirkung der Sonne. Er sah aus wie ein Gespenst. Den Talkindern erschien er wie ein Nachtgeschöpf, das nie ans Tageslicht kommt, und seine Beziehung zum jungen Par erschien ihnen geheimnisvoll. So wurde er zum »Dunklen Onkel«, dem Berater in Sachen Magie, ein seltsamer, verlegener, in sich gekehrter junger Mann, dessen Einblicke und Verstand ihn von jedermann abhoben.
Ungeachtet des Namens »Dunkler Onkel« verbesserte sich Walkers Einstellung. Er lernte, mit Ablehnung und Misstrauen umzugehen. Er wurde nicht mehr angegriffen. Er merkte, dass er solche Attacken durch einen Blick oder auch nur eine bestimmte Körperhaltung abwehren konnte. Er benutzte die Magie dazu, sich abzuschirmen. Er merkte, dass er andere zu Vorsicht und Zurückhaltung veranlassen und sie so daran hindern konnte, gewalttätige Absichten auszuführen. Er wurde sogar recht geschickt darin, Streit zwischen anderen zu schlichten. Unglücklicherweise isolierte ihn das alles noch weiter. Die Erwachsenen und älteren Jugendlichen zogen sich ganz von ihm zurück, nur die kleineren Kinder wurden zaghaft freundlicher.
Walker war in Schattental nie glücklich. Misstrauen und Furcht blieben bestehen, nur ungenügend versteckt hinter gezwungenem Lächeln, beiläufigem Kopfnicken und Höflichkeiten der Talbewohner, die es ihm ermöglichten, unter ihnen zu leben, ohne jemals als einer der ihren angenommen zu werden. Walker wusste, dass die Magie Ursache seines Problems war. Sein Vater und seine Mutter mochten sie als Gabe betrachtet haben, er nicht. Und das würde er auch nie können. Für ihn war sie ein Fluch, der ihn bis ins Grab verfolgen würde, dessen war er sicher.
Als Walker das Mannesalter erreichte, entschloss er sich, zum Kamin zurückzukehren, in sein Heim, an das er sich so gern zurückerinnerte, fort von den Leuten in Schattental, fort von Misstrauen und Verdacht, von dem Gefühl, ein Fremder zu sein. Der junge Par hatte sich gut genug angepasst, sodass Walker sich um ihn keine Sorgen mehr machte. Zunächst war Par im Tal geboren und wurde schon deshalb akzeptiert, was jedoch für Walker ausgeschlossen war. Darüber hinaus hatte Par eine andere Einstellung zur Magie als Walker. Par zögerte nie, er wollte alles erfahren, wozu die Magie fähig war. Was andere dachten, kümmerte ihn nicht. Die beiden hatten sich einander entfremdet, je älter sie wurden. Walker wusste, dass das unvermeidlich war. Es war Zeit für den Abschied. Jaralan und Mirianna drängten ihn zu bleiben, doch sie verstanden gleichzeitig, dass er das nicht konnte.
Sieben Jahre nach seiner Ankunft verließ Walker Boh Schattental. Er hatte inzwischen den Namen seiner Mutter angenommen, weil er den Namen Ohmsford, der ihn mit dem inzwischen verhassten Vermächtnis verband, nicht leiden konnte. Er ging zurück in den Dunkelstreif, zurück zum Kamin, und er kam sich vor, wie ein in einen Käfig gesperrtes, wildes Tier, das freigelassen worden war. Sein bisheriges Leben ließ er hinter sich. Er beschloss, nie wieder Magie einzusetzen, und gab sich das Versprechen, für den Rest seines Lebens den Menschen und ihrer Welt fernzubleiben.
Fast ein Jahr lang tat er genau das, was er sich vorgenommen hatte. Und dann tauchte Cogline auf, und alles veränderte sich …
Abrupt erwachte Walker aus dem Dämmerschlaf, und die Erinnerungen verblassten. Er bewegte sich in seinem warmen Bett und blinzelte. Für einen Augenblick konnte er sich nicht erinnern, wo er sich befand. Das Zimmer, in dem er lag, war taghell, trotz der riesigen Waldbäume vor dem Fenster. Der Raum war klein und sauber und enthielt fast keine Möbel. Neben dem Bett standen ein kleiner Tisch und ein Stuhl, sonst nichts. Auf dem Tisch sah er eine Vase mit Blumen, eine Waschschüssel und ein paar Kleidungsstücke. Die einzige Tür war geschlossen.
Storlock. Da war er. Dorthin hatte Cogline ihn gebracht.
Dann erinnerte er sich, was geschehen war.
Er zog seinen ruinierten Arm unter der Bettdecke hervor. Die Schmerzen waren abgeklungen, doch der Stein wog noch immer schwer, und Walker hatte kein Gefühl im Arm. Vor Wut und Enttäuschung biss er sich auf die Lippe. Außer dem Nachlassen der Schmerzen hatte sich nichts geändert. Der steinerne Stumpf, wo sein Unterarm zerschmettert worden war, war noch immer da. Die grauen Streifen dort, wo das Gift sich zu seiner Schulter hocharbeitete, waren ebenfalls noch vorhanden.
Er bewegte den Arm so, dass er ihn nicht sehen musste. Die Stors hatten ihn nicht heilen können. Womit auch immer die Asphinx ihn vergiftet hatte, die Stors konnten nichts dagegen tun. Und wenn die Stors es nicht konnten – die Stors, die besten Heilkundigen in den Vier Ländern …
Er mochte den Gedanken nicht zu Ende denken. Er verdrängte ihn, schloss die Augen und versuchte, wieder einzuschlafen, doch es ging nicht. Die ganze Zeit hatte er vor Augen, wie sein Arm unter der Wucht der Steinaxt zersplitterte.
Verzweiflung überfiel ihn, und er weinte.
Eine Stunde war verstrichen, als die Tür aufging und Cogline ins Zimmer trat, ein Eindringling, dessen Anwesenheit die Stille noch unbehaglicher machte.
»Walker«, grüßte er leise.
»Sie können mich nicht retten, nicht wahr?«, fragte Walker ohne Umschweife. Seine Verzweiflung verdrängte alles andere.
Der alte Mann wurde zu einer Statue neben seinem Bett. »Du lebst, oder?«, erwiderte er.
»Lass die Wortklauberei. Was immer getan worden ist, es hat das Gift nicht ausgetrieben. Ich kann es spüren. Vielleicht lebe ich noch, aber nur für den Augenblick. Sag ruhig, wenn ich mich irre.«
Cogline zögerte. »Du irrst dich nicht. Das Gift ist noch immer in dir. Selbst die Stors haben kein Mittel, es zu entfernen oder seine Ausbreitung aufzuhalten. Doch sie haben den Prozess verlangsamt, den Schmerz gelindert und dir Zeit verschafft. Das ist mehr, als ich erwartet hätte, in Anbetracht der Art und des Umfangs der Verletzung. Wie fühlst du dich?«
Walker lächelte bitter. »So, wie man sich fühlt, wenn man im Sterben liegt natürlich. Aber auf angenehme Weise.« Sie blickten einander wortlos an. Dann ging Cogline zu dem Stuhl und ließ sich darauf nieder, ein Bündel aus alten Knochen, schmerzenden Gelenken und runzliger, brauner Haut. »Erzähl mir, was dir geschehen ist, Walker«, sagte er.
Walker erzählte. Er berichtete ihm, wie er die alte, ledergebundene Druidenchronik gelesen hatte, die Cogline ihm gegeben hatte; wie er von dem schwarzen Elfenstein erfahren und den Entschluss gefasst hatte, den Rat des Finsterweihers einzuholen; wie er dessen Rätsel angehört und die Visionen angeschaut, wie er daraus geschlossen hatte, dass er zur Halle der Könige gehen müsse, wo er das geheime, mit Runen markierte Fach auf dem Boden der Gruft gefunden hatte und schließlich von der Asphinx gebissen und vergiftet worden war, die dort hingebracht worden war, um ihm aufzulauern.
»Um jemandem aufzulauern jedenfalls, vielleicht irgendwem«, bemerkte Cogline.
Walker sah ihn scharf an, Misstrauen und Zorn blitzten in seinen Augen auf. »Was weißt du darüber, Cogline? Spielst du jetzt die gleichen Spiele wie die Druiden? Und was ist mit Allanon? Wusste Allanon …?«
»Allanon wusste gar nichts«, unterbrach ihn Cogline und wischte den Vorwurf beiseite, ehe er ausgesprochen werden konnte. Seine alten Augen funkelten unter den zusammengezogenen Brauen. »Du hast es unternommen, die Rätsel des Finsterweihers allein zu lösen – eine törichte Entscheidung. Ich habe dich wiederholt gewarnt, dass der Geist einen Weg finden würde, dich zu vernichten. Wie sollte Allanon von deiner misslichen Lage wissen? Du unterstellst einem Mann, der seit dreihundert Jahren tot ist, zu viel. Selbst wenn er noch lebte, könnte seine Magie niemals jenen Zauber, der die Halle der Könige abschirmt, durchdringen. Sobald du im Inneren warst, warst du für ihn unsichtbar. Und für mich auch. Erst als du wieder herausgekommen und am Hadeshorn zusammengebrochen bist, war er wieder in der Lage zu erkennen, was geschehen war. Er hat mich gerufen, um dir zu helfen. Ich kam so schnell ich konnte, und auch das dauerte drei Tage.«
Er hob den knochigen Zeigefinger. »Hast du dir mal die Mühe gemacht, dich zu fragen, warum du nicht tot bist? Du bist nicht tot, weil Allanon einen Weg gefunden hat, dich am Leben zu erhalten, zuerst, bis ich ankam, und dann, bis die Stors dich behandeln konnten! Das solltest du vielleicht einmal bedenken, ehe du anfängst, so leichthin Vorwürfe zu machen!«
Er funkelte ihn an, und Walker funkelte zurück. Es war Walker, der als Erster den Blick abwandte, zu krank im Herzen, um die Auseinandersetzung fortzusetzen. »Mir fällt es gerade schwer, irgendwem zu glauben«, entschuldigte er sich halbherzig.
»Dir fällt es immer schwer, irgendwem zu glauben«, erwiderte Cogline schnippisch und unversöhnlich. »Du hast dein Herz vor langer Zeit mit Eisen gepanzert, Walker. Du hast aufgehört, an irgendwas zu glauben. Ich erinnere mich an Zeiten, als das nicht der Fall war.«
Er versank in Gedanken, und im Zimmer kehrte Stille ein. Walker musste unwillkürlich an die Zeit denken, die der alte Mann meinte, damals, als er zum ersten Mal bei Walker erschienen war und ihm angeboten hatte, ihm Möglichkeiten zu zeigen, wie er die Magie nutzen konnte. Cogline hatte recht. Damals war er voller Hoffnung gewesen.
Er musste beinahe lachen. Das lag schon so lange zurück.