
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Stress in der Schule und ein anstehender Umzug: Miris Leben ist ziemlich aus den Fugen geraten. In den Sommerferien ziehen sie und ihre Eltern von der bunten und aufregenden Großstadt in ein kleines Dorf ans Ende der Welt. Ein altes, unscheinbares Haus, als Erbe von Miris Großmutter, soll nun ihr neues Heim werden. Das Gefühl, völlig allein zu sein, droht die Vierzehnjährige immer weiter hinunterzuziehen. Bis sie auf Maria trifft. Das quirlige Mädchen vom Nachbarhof mit den vielen Shettys nimmt Miri mit in ihr Leben und zeigt ihr, wieviel Freude das Ponyhofleben bereiten kann. Doch dann kommt Marias beste Freundin Kathi aus dem Urlaub zurück und erneut muss Miri sich fragen, wo ihr Platz in diesem neuen Leben eigentlich ist ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Janet.
Danke, dass du für mich da warst und mir nicht nur Dinge über Pferde beigebracht hast, sondern vor allem ganz viel über das Leben. Ich hoffe, dir geht es gut, wo auch immer du bist – und verbringst die Zeit damit, mit deiner geliebten Tossi über die Wolken zu galoppieren und frei und unbeschwert zu sein.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Ein großes Geheimnis
Kapitel 2: Ein ziemlicher Schock
Kapitel 3: Videochat
Kapitel 4: Der Umzugstag
Kapitel 5: Das alte Haus
Kapitel 6: Erste Stunden
Kapitel 7: Die Möbelpacker
Kapitel 8: Eine kurze Begegnung
Kapitel 9: Die traurige Wahrheit
Kapitel 10: Die Nachbarswiese
Kapitel 11: Das Mädchen im Gras
Kapitel 12: Maria
Kapitel 13: Der Bauernhof
Kapitel 14: Einfach mal raus
Kapitel 15: Große Pferde, kleine Ponys
Kapitel 16: Der Ort am Fluss
Kapitel 17: Alte Freundin
Kapitel 18: Spontane Pläne
Kapitel 19: Altes Leben
Kapitel 20: Ablenkung
Kapitel 21: Ein Blick zurück
Kapitel 22: Ein Morgen im Stall
Kapitel 23: Spot
Kapitel 24: Die Geschichte hinter den Ponys
Kapitel 25: Routine
Kapitel 26: Ein guter Zuhörer
Kapitel 27: Große Unsicherheit
Kapitel 28: Freibad oder Ponys?
Kapitel 29: Das fremde Mädchen
Kapitel 30: Vorsichtige Annäherung
Kapitel 31: Aussprache
Kapitel 32: Überlegungen
Kapitel 33: Entspannter Spaziergang
Kapitel 34: Planschen
Kapitel 35: Zurück in die Realität
Kapitel 36: Eine traurige Erkenntnis
Kapitel 37: Eingeständnis
Kapitel 38: Geburtstag
Kapitel 39: Die Shettytruppe
Kapitel 1 Ein großes Geheimnis
Irgendwie ist mein Leben mächtig aus den Fugen geraten. Alles begann mit dem komischen Verhalten meiner Eltern – nach dem Abendessen setzten sie sich an den kleinen Tisch in der Küche statt wie gewöhnlich auf die Couch. Sie tuschelten, beugten sich über Papiere oder den Laptop. Abend für Abend ging das so. Und immer dann, wenn ich den Raum betrat, schwiegen sie.
Mittlerweile geht das schon ein paar Wochen so. Sie haben ein Geheimnis. Vor mir! Das ist ganz klar. Dabei gibt es in der nächsten Zeit keinen besonderen Tag, der ansteht. Das zweite Schulhalbjahr ist beinahe vorbei. Es ist weder Urlaub geplant, noch steht Weihnachten vor der Tür.
Also, was ist da los? So eine Ungewissheit kann eine Vierzehnjährige ordentlich auf die Palme bringen. Ich habe es wirklich versucht. Wollte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie beschäftigt.
Aber das ist leichter gesagt als getan. Immer gab es eine andere Sache, die besprochen werden musste. Womit sie von sich ablenken konnten. Und bevor sie dann wieder ein Gespräch über mich und die Schule anfingen, habe ich lieber aufgegeben.
Schließlich ist es so weit. Meine Mama ruft mich am Nachmittag zu sich. Es ist ein sonniger Freitag, die letzte Klassenarbeit in Deutsch liegt hinter mir und am liebsten würde ich mich auf mein Bett werfen und ein Buch lesen. Natürlich folge ich dem Ruf meiner Mutter dennoch. Besser ist das, denn: sie hat meinen vollen Namen benutzt: »Miriam« - das macht sie nie. Außer, wenn sie wütend ist oder es etwas absolut Wichtiges zu besprechen gibt.
»Hab ich was verbrochen?«, frage ich zunächst, als ich ins Wohnzimmer trete. Mit ernsten Gesichtern sitzen dort meine Eltern und deuten mit einem Wink auf den freien Stuhl vor sich. Langsam lasse ich mich darauf sinken.
»Also, Miri«, beginnt Papa (wenigstens hat er meinen Kosenamen benutzt) und beugt sich leicht nach vorn über den Tisch, »du hast ja schon mitbekommen, dass wir seit einiger Zeit ein paar Dinge… planen.«
Mama verschränkt die Arme vor der Brust, während ich unruhig auf meinem Stuhl hin und her rutsche. Dieses Theater kann nichts Gutes bedeuten. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Gab es einen Anruf von der Schule? Hoffentlich nicht das…!
»Ich glaube, wir sind im Moment alle nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. Ich bin mit meiner Stelle in der Firma nicht so richtig zufrieden, Mama gehen auf ihrer Arbeit immer mehr die Kunden aus… wir haben also gemeinsam überlegt, was wir da machen können. Und nach langem Hin und Her sind wir zu einem Entschluss gekommen.«
Papa atmet einmal tief durch, die Luft zwischen uns dreien ist angespannt. Obwohl ich keinen Schimmer habe, worauf genau er hinaus will, schwant mir Böses. »Wir werden in den nächsten Wochen umziehen. Nachdem du dein Zeugnis bekommen hast, geht’s los.«
Meine Augen werden weit. Ich glaube, tellergroß trifft es ganz gut.
»Umziehen?«, stoße ich hervor und blicke meine Eltern erschrocken an. »Wohin? Und … und … wieso?«
Nun ergreift meine Mama das Wort: »Papa hat ja gerade schon erklärt, dass wir uns beruflich nicht mehr wohl fühlen. So was kann man eine Weile ertragen, aber wir sind beide an einem Punkt, der … weißt du, wir bringen alles mit nach Hause. Das ist nicht gut. Für mich persönlich nicht, für Papa nicht und auch das Klima innerhalb unserer Familie leidet darunter. Das geht so einfach nicht weiter. Und dann ist da noch der Punkt mit deiner Schule. Du bist auch nicht glücklich, oder?«
Also gab es doch einen Anruf aus der Schule. Na toll. Ich spüre, wie mir die Hitze in die Wangen steigt.
»Was meinst du?«, frage ich und wende meinen Blick wieder ab. Erst einmal herausfinden, was genau sie wissen.
»Deine Klassenlehrerin und ich haben in den letzten Monaten oft geredet. Sie hat uns viel berichtet, auf jeden Fall mehr, als du uns erzählt hast. Und das kann so nicht weitergehen. Wir denken, es ist das Beste, an einem neuen Ort noch einmal von vorne zu beginnen.«
»Und meine Freunde?«, presse ich hervor. Eigentlich ist da nur eine Freundin, Stella. Denn mehr Menschen in der Schule gibt es für mich im Moment nicht. Das auszusprechen wage ich allerdings nicht.
»Du kannst Stella doch am Wochenende besuchen. Und ihr schreibt sowieso jeden Tag miteinander. Das wird sich nicht ändern«, wirft Papa ein und streicht sich dabei über die kurzen, schwarzen Haare. Eine Sorgenfalte erscheint zwischen seinen Augenbrauen.
»Na toll«, flüstere ich. Verliere ich Stella, bin ich endgültig allein. Wie soll das werden? Wie soll das funktionieren? Eine lange Pause entsteht, die Luft in unserem Wohnzimmer ist zum Zerreißen gespannt.
Draußen braut sich ein Sommergewitter zusammen und spiegelt dabei mein Innerstes wider. Grau-schwarze Wolken türmen sich nicht nur draußen am Himmel auf, sondern sind auch in meinem Kopf und bringen Chaos und Unsicherheit mit sich.
»Wo ziehen wir hin? Ich will mitentscheiden, das könnt ihr nicht einfach alleine machen«, sage ich schließlich mit zitternder Stimme und hebe den Blick.
»Nun …«, setzt Papa an, bricht jedoch ab und wendet sich hilfesuchend an meine Mama. Ja, das zeigt wieder, dass Konfrontation nicht so sein Ding ist.
»Also, Miri …, es ist alles schon beschlossene Sache. Wir ziehen nach Braitling. In das alte Haus deiner Oma.«
Na toll.
Kapitel 2 Ein ziemlicher Schock
Wütend und durcheinander verlasse ich das Wohnzimmer. Durch den Flur und, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, hoch über die Treppe, direkt in mein
Zimmer. Dort lasse ich die Tür hinter mir laut zufallen. Die können ruhig merken, dass ich echt sauer bin!
Dann stehe ich einfach nur so da, halte die Luft an und sehe mich um.
Mein Zimmer. Mein geliebtes Zimmer.
Erst im letzten Sommer haben wir es renoviert, Mama, Papa und ich. Dem kindlichen Hochbett ist ein schickes, weißes Bett mit edlen Verzierungen gefolgt, der hellbraune, alte Schreibtisch meiner Eltern wurde durch einen ebenfalls weißen, modernen Tisch ersetzt. Poster an der Wand zeigen meine Lieblingsbands und Fotos von meiner Freundin Stella und mir.
Ach man. Stella. Ich habe nicht viele Freundinnen in meiner Klasse. Denn Schule … das ist ein schweres Thema. Und das Einzige, was mich hier absolut nicht hält. Ich spreche nicht darüber – denn es bringt nichts. Doch was in meiner Klasse so alles abgeht, ist echt grenzwertig.
Ich schätze, meine Eltern wissen, dass ich gemobbt werde. Aber ich will das hier zu Hause einfach nicht thematisieren. Hin und wieder spreche ich mit Stella darüber und manchmal zwingt mich meine Klassenlehrerin zum Reden. Doch es ist egal, es bleibt alles beim Alten. Beim Schlechten.
Und eins ist sicher: An einer anderen Schule wird es nicht besser. Ich werde vom Regen in die Traufe kommen. Hier habe ich immerhin noch Stella, die mich tröstet, wenn ich mich mit Tränen in den Augen wegdrehen muss.
Erst heute wieder … Doch bevor ich weiter über die Peinlichkeit nachdenke, wie Stephan mich gegen seinen Kumpel gestoßen und dabei wie ein Frettchen gelacht hat, schüttele ich den Kopf und werfe mich aufs Bett. Dort, auf meinem Kopfkissen, liegt mein Handy. Das brauche ich jetzt.
Stella hat mir bereits eine Nachricht geschickt. Sie will wissen, ob sie ihre Eltern wegen der pinken Turnschuhe in dem Laden fragen soll, an denen wir auf dem Heimweg immer vorbeigehen. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich wähle ihre Nummer und versuche, sie anzurufen. Leider nimmt sie nicht ab.
Stöhnend rolle ich mich auf den Rücken und starre die weiße Decke meines Zimmers an. Sie ist eigentlich glatt, doch wenn man genau hinsieht, sind überall winzig kleine Löcher und Striemen von der Farbe. Manchmal liege ich einfach nur da und schaue mir das an. Irgendwie beruhigend. Es ist etwas, was immer bleibt.
Na ja. Zumindest, bis ich in ein neues Zuhause umziehen muss. Bei dem Gedanken daran muss ich schwer schlucken.
Da vibriert mein Handy. Innerhalb einer Sekunde liegt es wieder in meiner Hand und ich öffne die eingetroffene Nachricht. Es ist tatsächlich Stella.
Kann grad nicht, meine Eltern und ich sind unterwegs. Was ist los? Rufst doch sonst nie an.
Ich überlege, ob ich mit der Verkündung meines Umzuges warten soll. Es ihr persönlich sage. Oder zumindest in einem Telefonat. Doch dann denke ich: Nein, so lange halte ich das nicht aus. Ich muss es ihr erzählen.
Meine Eltern wollen in ein paar Wochen umziehen. In den Sommerferien, nach Braitling. Dort, wo meine Oma früher gewohnt hat. Komme grad nicht klar.
Ich schicke die Nachricht ab. Stella liest sie sofort, das kann ich daran erkennen, dass über ihrem Namen ›online‹ steht und ein zweiter blauer Haken hinter meiner Nachricht erscheint. Ein weiteres Zeichen erscheint neben ihrem Profilbild, mehrere Punkte, die auf und ab hüpfen und die mir sagen, dass Stella bereits eine Nachricht eintippt.
Und da ist sie auch schon.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Meine Augen füllen sich mit Tränen.
Doch.
Kapitel 3 Videochat
»Ich schnalle das nicht. Warum machen die das? Voll unfair, dich einfach so an einen anderen Ort zu schleifen!«
Es ist kurz vor zehn Uhr am Abend. Stella und ich unterhalten uns über einen Videochat. Ich kann kaum mehr als ihr Gesicht sehen, nur schemenhaft erkenne ich hinter meiner Freundin Teile ihres Zimmers. Es scheint, als würde sie auf ihrem Bett sitzen, so, wie ich auch.
»Keine Ahnung«, schniefe ich und rolle mit den Augen. Ja, gute Frage – warum machen die das?
»Also gut, wir müssen uns was überlegen. Hast du eine Idee, wie man das Ganze noch verhindern kann?« Zum hundertsten Mal an diesem Tag schüttele ich den Kopf. Nein, ich glaube, es ist aussichtslos.
»Da gibt es nichts. Es ist alles schon entschieden. Meine Mutter hat vorhin noch einmal mit mir geredet. Die haben beide schon gekündigt. Ihre Jobs und auch den Mietvertrag vom Haus. Echt, es ist alles geregelt. Also außer, die Sache ihrer eigenen Tochter zu erzählen und sie zu fragen, zu wieviel Prozent sie das ›zum kotzen‹ findet!«
Stella verschränkt die Arme vor der Brust.
»Das ist voll verrückt. Was sollst du denn dort machen? In so einem Dorf am Ende der Welt! Da ist doch nichts – außer Natur. Käfer, Brennnesseln und Kühe oder so. Miri, das kannst du nicht machen!«
Meine Augen füllen sich mit Tränen. Aber ich will nicht wieder heulen. Das habe ich schon den ganzen Nachmittag getan.
»Habe ich meinen Eltern auch gesagt. Die meinen natürlich, es gibt da super viele Sachen, die ich machen kann. Haha, wer es glaubt! Stella, ich habe keine Ahnung wie das werden soll. Was soll ich denn ohne dich dort?«
Jetzt schweigt sogar meine beste Freundin. Es ist, als würde nun auch zu ihr durchsickern, dass es keinen Ausweg aus dieser Misere gibt. Sie streicht sich durch die kurzen, blonden Haare und atmet tief durch.
»Wir könnten uns jedes Wochenende sehen. Einmal komme ich zu dir, einmal du zu mir. Obwohl … Besser, wir treffen uns immer hier in der Stadt. Ich habe keine Lust auf Traktoren und Dorfklatsch.«
Ich schüttele traurig den Kopf. Das kann nichts werden, da bin ich sicher.
»Wer weiß, ob da überhaupt regelmäßig ein Bus oder Zug fährt. Hast du nicht einmal von deiner Tante erzählt, die in so einem kleinen Kaff wohnt und wo die Busse nur dreimal am Tag fahren?«
Ich stöhne auf, wenn ich nur an dieses Hinterwälder-Leben denke.
»Ja, Tante Hannah ist immer ziemlich eingeschränkt, aber das heißt ja nicht, dass das bei dir auch so sein wird.«
Ein kläglicher Versuch, mich zu trösten. Ich setze mich auf, ziehe die Knie an meine Brust und lasse mein Kinn darauf sinken.
Wie ein kleines Häuflein Elend fühle ich mich. Und nicht einmal Stella, die sonst immer weiß, wie sie andere aufheitern kann, bekommt es hin, mich zu beruhigen. Sie ist genau so überfordert mit dieser Situation, wie ich.
»Das wird schon«, versucht sie mich zu trösten.
»Glaube nicht. Das wird einfach alles super ätzend.
Und es dauert noch so lange, bis ich ausziehen kann!«
Das entlockt Stella ein kleines Grinsen.
»Volljährig sein, um zurück in die Stadt zu kommen, kann ja schon mal nicht des Rätsels Lösung sein.«
»Nein«, antworte ich trocken.
Wir sehen uns durch unsere Handys an. Wahrscheinlich muss ich mich an diesen Anblick gewöhnen. Stella auf einem digitalen Bildschirm ist immerhin besser, als gar nichts. Dennoch – ein schwacher Trost.
»Wir werden das schon hinkriegen. Glaub mir.«
So gern würde ich Stella abkaufen, was sie gerade gesagt hat. Aber die Angst ist groß. Angst, dass dies der Anfang vom Ende unserer Freundschaft ist.
Meiner einzigen Freundschaft.
Kapitel 4 Der Umzugstag
Wenige Wochen später sitze ich mit meinen Eltern im Auto, auf dem Weg ins neue Heim. Bisher habe ich das Haus meiner verstorbenen Oma nur auf Fotos gesehen.
Ich kann mich an Großmutter kaum erinnern. Nur eines ist greifbar in meinem Kopf: die rote, quietschende Schaukel in dem verwilderten Garten hinter dem Haus. Ob es die noch gibt? Als Baby hat meine Oma mich darin immer gehalten und ist vor und zurück geschaukelt. Das hat mir meine Mutter erzählt. In ihren Augen kann ich sehen, wie sehr sie ihr fehlt. Dennoch kann ich nicht anders, als diesem Ausflug mit Argwohn und Wut entgegenzusehen. Für mich gibt es dort nichts. Da bin ich mir ganz sicher.
»Gleich sind wir da«, ertönt die Stimme meiner Mutter von vorn. Ich rutsche mit zerknirschter Miene tiefer in den Sitz. Kurz treffen sich unsere Blicke im Rückspiegel.
Ich drehe mich wieder weg und schaue aus dem Fenster. Seit ein paar Minuten befinden wir uns nicht mehr auf der Autobahn, sondern fahren auf einer Überlandstraße durch Wälder und Felder. Es ist wie eine andere Welt.
In meinem Zuhause – meinem alten, dem richtigen Zuhause – gibt es überall Häuser. Straßen. Autos. Und Menschen. Es ist niemals dunkel, denn die Straßenbeleuchtung ist an, kaum dass es zu dämmern beginnt. Die größten Grünflächen sind die Parks, die innerhalb der Stadt angelegt sind. Ich war mit Stella oft im Winzerpark, gleich bei uns um die Ecke. Das hat mir an Natur definitiv gereicht. Überall Käfer und Ameisen, Flecken vom Gras auf der Hose und mit etwas Pech Sand oder Dreck, der direkt in das Kuchenstück geweht wurde, was man gerade essen wollte. Schrecklich.
Bei dem Gedanken daran muss ich wieder einmal tief durchatmen. Dass ich aufs Land ziehe, grenzt schon fast an Hohn. Ich bin mir sicher, dass ich ein richtiger Stadtmensch bin. Was soll ich denn hier? Beim Blick aus dem Fenster kommt mir zu dieser Frage nur ein Gedanke: Nichts.
Hier ist nichts.
Kein Haus.
Keine Straßenbeleuchtung.
Kein Mensch.
Doch irgendwann kommen wir tatsächlich in so etwas wie eine ›Zivilisation‹ – Gebäude tauchen vor uns auf.
Kleine Einfamilienhäuser, die meisten mit grauer oder brauner Fassade, irgendwie alt. Viele haben einen Hof.
Die Straße, auf der wir fahren, ist aus Kopfsteinpflaster gefertigt. Es scheppert und rumpelt in dem ganzen Auto, während wir langsam durch den Ort fahren. Hoffentlich gehen meine Schneekugeln im Kofferraum nicht kaputt.
»Jetzt nur noch der Straße bis zum Ende folgen, dann links und wir sind da«, höre ich meine Mutter, weiß aber nicht, mit wem sie eigentlich spricht. Langsam und unauffällig schiebe ich meinen Körper von der lümmelnden Fenster-Position nach vorn. Jetzt bin ich doch ein wenig gespannt – immerhin wird das mein neues Zuhause.
Das Kopfsteinpflaster weicht einem Schotterweg.
Papa fährt auch hier langsam rüber, vielleicht macht er sich wegen des Gepäcks ebenfalls Sorgen. Dann setzt er den Blinker (Wozu? Hier sind weit und breit weder Autos noch Menschen!) und biegt links ab.
Jetzt halte sogar ich den Atem an. Bäume und Sträucher versperren die Sicht. Doch dann lichtet sich das Grün, gibt den Blick frei auf …
»Das ist es?«, rutscht es mir fassungslos heraus. Mama dreht sich um, runzelt die Stirn und sieht mich fragend an.
»Ja, wieso?«
Vor uns erheben sich mehrere Gebäude. Wir leben also nicht ganz allein am Rande der Welt, sondern haben noch Nachbarn.
Das Haus meiner Oma ist aber das mit Abstand heruntergekommenste. Die Fassade ist grau und bröckelt, die weiße Fensterfarbe blättert vom Holzrahmen ab. Auch die dunkelbraune Haustür mit ihren Elementen aus Milchglas hat schon bessere Zeiten gesehen. Unruhig winde ich mich auf meinem Autositz.
»Sieht ziemlich alt und baufällig aus«, ist das Einzige, was ich mich traue zu sagen. Meine Mutter straft mich mit einem strengen Blick.
»Vielleicht steigen wir erst einmal aus dem Auto und sehen es uns aus der Nähe an. Bevor wir urteilen, oder?«
Ich nicke folgsam. Mit knirschenden Reifen hält unser Auto vor dem kleinen Vorgarten des Hauses.
Das ist es also.
Home sweet Home.
Kapitel 5 Das alte Haus
Meine Mama hatte Unrecht mit ihrer Aussage. Denn dieses Haus sieht aus der Nähe noch älter und kaputter aus als von weiter weg.
Ich schlage hinter mir die Autotür zu. Ein scharfer Wind weht mir ins Gesicht und lässt meine braunen, langen Haare flattern. Ich hebe die Hand und schirme meine Augen vor der Sonne ab. Papa tritt neben mich und legt mir einen Arm um die Schulter.
»Eigenheimbesitzer«, sagt er und Stolz schwingt in seiner Stimme mit. Ja, für ihn ist das die Erfüllung eines richtig großen Traumes, das weiß ich. Er spricht schon seit Jahren davon, dass er irgendwann raus aus unserer Mietwohnung will und dann endlich selbst bestimmen kann, wie alles läuft. Für ihn freue ich mich sogar ein bisschen. Dennoch … Ich habe das Gefühl, dass das alles auf meine Kosten geht.
»Wollen wir?«, fragt Mama, die sich nun zu uns gesellt. In ihrer Hand liegt ein großer Schlüsselbund.
Ich zucke mit den Schultern und mache einen Schritt nach vorn.
»Halt, wartet. Das muss man doch festhalten!«, ruft Papa und zieht mich zurück. Dann kramt er in seiner Jeanstasche herum und zückt sein Telefon. Lachend hält er es mit der einen Hand von sich weg und zieht Mama und mich mit der anderen an sich ran. Toll, ein Selfie.
»Los, lachen!«, ruft er und drückt dann drei- oder viermal auf den Auslöser. Erst im letzten Moment kann ich mir so was wie ein Lächeln abringen. Aber fröhlich sieht es bestimmt nicht aus.
»Also dann. Jetzt geht’s los!«, sagt Mama und geht vor.
Das alte, hölzerne Gartentor quietscht. Irgendwie ist das alles wie im Film. Ich bin in ein Klischee hinein gestolpert.



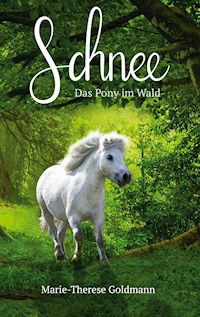
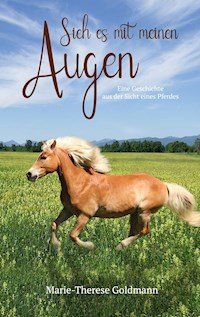
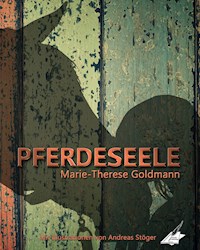













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









