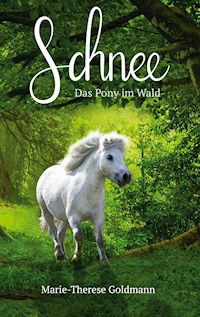
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Claire steht kurz vor ihren Abschlussprüfungen, als sie durch einen Zufall im Wald auf ein kleines Shetlandpony stößt. Es scheint verwahrlost und alleingelassen. Das junge Mädchen fackelt nicht lange und macht sich auf die Suche nach dem Besitzer - obwohl sie vor Jahren geschworen hat, sich nach dem Verlust ihres ersten Ponys nie wieder auf Pferde einzulassen. Wem gehört das schneeweiße Pony und kann Claire ihm ein besseres Leben ermöglichen? Und was hat Tim, der unscheinbare Streber aus ihrer Klasse, damit zu tun?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchbeschreibung:
Claire steht kurz vor ihren Abschlussprüfungen, als sie durch einen Zufall im Wald auf ein kleines Shetlandpony stößt. Es sieht verwahrlost aus, scheut und ist offenbar sich selbst überlassen. Das junge Mädchen fackelt nicht lange und macht sich auf die Suche nach dem Besitzer - obwohl sie vor Jahren geschworen hat, sich nach dem Verlust ihres ersten Ponys nie wieder auf Pferde einzulassen.
Wem gehört das schneeweiße Pony und kann Claire ihm ein besseres Leben ermöglichen? Und was hat Tim, der unscheinbare Streber aus ihrer Klasse, damit zu tun?
Für Phinie.
Schwesterherz, ich hab dich lieb!
Inhaltsverzeichnis
Buchbeschreibung
Widmung
Image
Kapitel 1 - Erinnerung
Kapitel 2 - Begegnung
Kapitel 3 - Wiedersehen
Kapitel 4 - Besitzerin
Kapitel 5 - Schnee
Kapitel 6 - Vertrauen
Kapitel 7 - Pläne
Kapitel 8 - Umbauten
Kapitel 9 - Garten
Kapitel 10 - Verwirrung
Kapitel 11 - Angst
Kapitel 12 - Geständnisse
Kapitel 13 - Veränderungen
Kapitel 14 - Alles wird gut
Danksagung
Über die Autorin
Sieh es mit meinen Augen
Contenthinweis
Impressum
Kapitel 1 - Erinnerung
Laut piepend riss mich mein Wecker aus dem Schlaf. Völlig übermüdet drückte ich auf die Snooze-Taste und drehte mich noch einmal um. Ich hasste es, zeitig aufzustehen. Im Abstand von fünf Minuten klingelte mein Wecker - doch immer wieder drehte ich mich ein weiteres Mal zur Seite. Erst als mir nur noch eine halbe Stunde Zeit blieb, um mich fertig zu machen, stand ich auf. Flüchtig fiel mein Blick auf den Kalender, der über meinem Schreibtisch hing. Dieses Datum … Es war der 4. April – Der Todestag meines geliebten Ponys Jim.
Ich kämpfte plötzlich mit den Tränen, wollte aber nicht weinen. Stattdessen gab ich mir einen Ruck, stand auf und wischte mir mit dem Handrücken über das Gesicht. »Das ist Geschichte. Ich sehe nach vorn«, flüsterte ich.
Nach Jims Tod hatte ich mir geschworen, nie wieder einen Fuß in einen Pferdestall zu setzen. Mein Herz durfte ich nicht noch einmal an ein Pferd verlieren. Denn früher oder später würde es wieder so weit kommen. Nein, einen solchen Verlust wollte ich nie mehr durchleben.
Ich blickte in den kleinen Spiegel, der über meinem Schreibtisch hing. Die Hautpartie um meine Augen war gerötet und leicht angeschwollen. Schnell schnappte ich mir eine Make-up-Tube, und tupfte ein wenig davon unter die Augen, um das Rot zu kaschieren. Dann trug ich noch eine dicke Schicht Mascara auf. Zum Schluss kämmte ich mir die schulterlangen, blonden Haare und machte mir einen Zopf. Ein letzter Kontrollblick in den Spiegel. Ja, so ging es. So würde niemand sehen, dass ich geweint hatte. Mit etwas Glück waren meine Eltern schon auf dem Weg zur Arbeit und ich würde ihnen ohnehin nicht begegnen.
Meine Mutter und mein Vater betitelten sich selbst als Workaholics und liebten ihre Arbeit über alles. Oft gaben sie mir das Gefühl, nicht wichtig zu sein, zumindest nicht so sehr wie ihre Karrieren. Doch jedes Mal, wenn ich versuchte, mit ihnen darüber zu reden, wurde das Thema schnell verworfen. Lange Zeit hatte mich das belastet.
Als ich dann erstmals einen Pferdestall betrat, war es, als würde ich die Tür zu einer anderen Welt öffnen. Eine Freundin hatte mich zum Reitunterricht mitgenommen und sofort war es um mich geschehen. Diese majestätischen Tiere hatten es mir angetan; besonders ihre Augen, die vor Güte und Freundlichkeit strahlten, wenn man ihnen ebenso begegnete. Dort, an diesem wundervollen Ort, hatte ich eine zweite Familie gefunden. Jede freie Minute war ich im Stall. Ich wurde von allen akzeptiert und respektiert, so wie ich war. Sowohl von den Menschen, als auch von den Pferden.
Nachdem ich ein paar Jahre Reitunterricht genommen hatte, erfüllten meine sehr beschäftigten Eltern mir den Herzenswunsch vom eigenen Pferd. Wie glücklich ich gewesen war!
Jim, dieses quirlige Deutsche Reitpony, war der Anker in meinem Leben. Er hatte mich nie im Stich gelassen.
»Verdammt noch mal!«, entfuhr es mir, als ich mich wieder dabei ertappte, wie ich in Gedanken der Vergangenheit hinterher hing. Ich war jetzt ein anderer Mensch, mein Leben hatte mit Pferden nichts mehr zu tun. Den Großteil meiner Freizeit verbrachte ich mit meinen Freundinnen. Wir gingen shoppen oder in ein Café, verabredeten uns zu Mädelsabenden und lernten gemeinsam für die Schule. So hatte ich jeden Tag in der Woche etwas zu tun. Für den Reitsport blieb also ohnehin keine Zeit.
Als ich die schmale Treppe von meinem Zimmer aus hinunterging und im Flur um die Ecke bog, atmete ich erleichtert auf. Niemand war im Wohnzimmer zu sehen, meine Eltern schienen schon außer Haus. So musste ich keinem etwas vormachen. Einen Moment zögerte ich und sah zur Haustür, an der meine Jacke hing. Ich hatte einen dicken Kloß im Hals und eigentlich keinen großen Hunger. So entschied ich, ohne Frühstück das Haus zu verlassen. In der Kantine würde ich sicher etwas finden, sollte mich der Hunger in ein paar Stunden überwältigen.
Draußen schwang ich mich auf mein Fahrrad und fuhr in halsbrecherischem Tempo dem alten Schulgebäude entgegen. Mir war bewusst, dass ich viel zu früh dran war, doch das machte mir an diesem Tag kaum etwas aus.
An der Schule angekommen, schloss ich mein Rad am schuleigenen Fahrradschuppen an und setzte mich auf die kalten Stufen vor den Eingang. Zwar wäre es mir lieber gewesen, ich hätte drinnen in einem warmen Zimmer auf den Unterrichtsbeginn warten können, doch es war so früh, dass noch nicht einmal die Sekretärin da war, um die Tür für die Schüler aufzuschließen.
Langsam durchdrang die kühle Morgenluft meine Kleidung und ich zog zitternd die Knie an meine Brust. Sicher war das ein bemitleidenswerter Anblick, frierend und allein vor der Schule zu sitzen. Aber genau das war es, was ich jetzt wollte. Bloß keine Gesellschaft.
Nach einiger Zeit hörte ich schnelle Schritte. Noch bevor ich den Kopf erhob, ertönte die helle Stimme von Frau Berser, der freundlichen Sekretärin unserer Schule.
»Claire!«, rief sie. »Du bist aber früh dran. Vor mir hier zu sein, ist schon ein starkes Stück!«
Ich lächelte, mehr aus Höflichkeit, und erhob mich. Einen Augenblick später waren wir beide auf gleicher Höhe. »Guten Morgen. Ich habe mich heute etwas in der Zeit vertan.«
»Na, dann aber schnell rein in die warme Schule. Du musst ja frieren.«
Ich bedankte mich und folgte der jungen Sekretärin in das Schulgebäude. Auf der großen Uhr im Vorraum las ich im Vorbeigehen die Zeit ab. Es war kurz nach sieben, der Unterricht begann jedoch erst in einer Stunde. Frau Berser ging in ihr Büro und lächelte mir kurz zu, ehe sie das Sekretariat betrat. Ich hingegen trottete langsam die vielen Stufen bis in den dritten Stock hinauf und öffnete die Tür zum Zimmer Nummer 303, meinem Klassenzimmer.
Still setzte ich mich auf meinen Platz in der letzten Reihe, holte die dicken Schulbücher aus der Tasche und legte sie akkurat auf den Tisch. Dann hielt ich einen Moment inne und starrte gedankenverloren an die Tafel. Obwohl ich gerade noch der Meinung gewesen war, Alleinsein sei für mich das Beste, überkam mich nun ein Gefühl gähnender Leere.
Ich seufzte und zog mein Handy aus der Hosentasche, um mich abzulenken. Mit klammen Fingern tippte ich darauf herum und sah, dass ich eine Nachricht erhalten hatte. ›Treff wie immer?‹, stand in der SMS, die von meiner besten Freundin Tanja kam. Rasch antwortete ich: ›Bin schon in der Schule. Musst alleine fahren. Treffen uns im Klassenraum. Sorry!‹
Normalerweise trafen wir uns immer an Tanjas Elternhaus und fuhren von dort gemeinsam mit dem Rad zur Schule. Tanja war ein lauter und lustiger Mensch - leider merkte sie es aber nie, wenn ihre Fröhlichkeit unpassend war.
Die Tür zum Klassenzimmer öffnete sich und ich wurde aus meinen Gedanken gerissen. Tim betrat den Raum.
»Morgen«, murmelte er und setzte sich auf seinen Platz ganz vorn auf der Fensterseite des Zimmers. »Morgen«, antwortete ich und schaute dann wieder auf mein Handy.
Tim zählte zu den Strebern unserer Klasse. Super Noten, immer aufmerksam, meldete sich ständig und hatte nur wenige Freunde. Während der Hofpause blieb er oft am Platz sitzen und las ein Buch nach dem anderen. Er sah auch nicht sonderlich gut aus. Seine Kleidung war ihm stets eine oder zwei Nummern zu groß. Kaum ein Mensch achtete auf ihn. Manchmal tat er mir leid, denn im Grunde hatte er niemandem etwas getan und wurde trotzdem ausgegrenzt. Doch ich hatte mich dennoch nie bemüht, ihn näher kennenzulernen. Da wir nun in der zehnten Klasse waren und die Prüfungen bevorstanden, machte es zudem keinen Sinn mehr, das noch zu ändern.
Wieder zuckte ich zusammen, als die Tür aufgerissen wurde. Sogleich kam eine ganze Schar von Mitschülern herein, allen voran Tanja. Sie sah erledigt aus, als hätte sie gerade einen Marathon hinter sich gebracht. Geradewegs kam sie auf mich zu und wir begrüßten uns mit einem flüchtigen Kuss auf die Wange.
»Na, alles gut?«, fragte meine beste Freundin und ließ sich auf den Platz neben mir fallen.
»Klar doch«, antwortete ich kurz angebunden. Erstaunt setzte sich Tanja etwas auf und warf mir einen fragenden Blick zu. »Sag mal, ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Du verbreitest echt schlechte Laune und bist heute einfach ohne mich hergefahren. Hab ich dir was getan?«
Ich seufzte und sagte schnell: »Nein, keine Sorge. Heute ist nur nicht mein Tag. Du hast damit aber nichts zu tun.«
»Na, dann bin ich ja beruhigt. Gegen deine Miesepetrigkeit habe ich auch auch gleich was«, rief Tanja, etwas zu fröhlich, aus und hielt mir ihr Handy unter die Nase. Darauf war ein Video zu sehen, in dem sich Katzen in viel zu kleine Kartons und andere Gefäße quetschten. »Das ist total niedlich, oder?«, kicherte Tanja, doch mehr als ein müdes Lächeln wollte nicht über meine Lippen kommen. Sie bemerkte meine Traurigkeit einfach nicht.
Den ganzen Schultag versuchte Tanja, mich mit Witzen und übertrieben guter Laune aus der Reserve zu locken. Meine gedrückte Stimmung blieb jedoch. Immer wieder hatte ich Bilder von Jim vor meinem geistigen Auge, die sich nur schwer abschütteln ließen. Als die Schulklingel schließlich mit ihrem Läuten das Ende des Unterrichtstages ankündigte, atmete ich erleichtert auf.
»Endlich geschafft!«, sprudelte es aus Tanja heraus. Ich nickte zustimmend und packte meine Schulsachen in die Tasche. »Wollen wir noch ins Café runtergehen und ein Stück Kuchen essen? Ich muss dir unbedingt was erzählen«, sagte Tanja. Zu ihrer Enttäuschung schüttelte ich den Kopf. »Tut mir leid, ich werde gleich nach Hause fahren. Da gibt es noch so viel zu tun«, redete ich mich heraus.
»Na gut. Dann ein anderes Mal.«
Wir verließen gemeinsam das Klassenzimmer, liefen schnellen Schrittes die Treppen bis ins Erdgeschoss hinunter und gingen zum Fahrradunterstand. Während ich noch am Fahrradschloss hantierte, schwang sich Tanja bereits aufs Rad.
»Also dann, bis morgen. Gib mir bitte eher Bescheid, wenn du wieder allein zur Schule fahren willst.« Ich sah auf und unsere Blicke trafen sich. Tanja wirkte beleidigt. Um dem drohenden Streit aus dem Weg zu gehen, antwortete ich schnell: »Nein, morgen fahren wir wieder zusammen. Das war heute nur mal eine Ausnahme. Kurz vor halb acht bin ich bei dir. Versprochen.«
»Gut«, sagte sie lächelnd, trat dann in die Pedale und verschwand. Nachdem ich endlich das störrische Fahrradschloss geöffnet hatte, schwang ich mich ebenfalls in den Sattel und rollte gemächlich vom Schulhof.
Kapitel 2 - Begegnung
Als ich Tanja gegenüber behauptete, dringend nach Hause zu müssen, hatte ich natürlich gelogen. Außer leeren Zimmern und viel Langeweile wartete nichts auf mich. Das klang trostlos, war aber besser, als Tanja den ganzen Tag gute Laune vorzuspielen. Ja, ich hätte ihr auch von meinem Kummer erzählen können. Doch Tanja hatte keine Ahnung von Pferden, verstand einfach nicht, wie es sich anfühlt, ein hunderte Kilogramm schweres Tier so in sein Herz zu schließen wie einen geliebten Menschen.
Ich ließ mir viel Zeit beim Fahren und entschloss, noch eine kleine Extrarunde zu drehen. Ich fuhr nicht heimwärts, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung. Mein Ziel waren die Wiesen- und Waldwege außerhalb unserer Ortschaft.
Ich steuerte am Marktplatz vorbei, an der Kirche, der Einkaufspassage - und atmete erleichtert auf, als ich die grauen Straßen hinter mir ließ, die einem schmaler werdenden Kiesweg wichen, den ich mit größter Vorsicht befuhr. Mein Fahrrad hatte recht dünne Reifen und ich war schon des Öfteren damit auf Schotter weggerutscht. Dennoch war es meine liebste Strecke, denn wenn man erst einmal den unsicheren Kies hinter sich ließ, wartete ein wunderschöner Blick ins Tal.
In aller Ruhe radelte ich dahin und hing meinen Gedanken nach. Würde dieses Gefühl jemals verschwinden? Würde ich je mit Jim abzuschließen können? Im Moment war das unvorstellbar. Durch meinen Kopf schossen immer mehr Erinnerungen an mein geliebtes Pferd. Wie ich das erste Mal auf ihm saß, unser erster Turniersieg, das erste Mal ohne Sattel im Gelände.
Nun kullerten erneut Tränen über mein Gesicht. Der Fahrtwind sorgte dafür, dass sie sich eiskalt anfühlten. Ich schluchzte und hob eine Hand, um sie mit dem Handrücken wegzuwischen. Obwohl ich den Kiesweg schon lange hinter mir gelassen hatte, war das ein dummer Fehler.
Sogleich verlor ich das Gleichgewicht und kippte mitsamt dem Rad zur Seite. Der Weg, den ich befahren hatte, lag höher als die umliegenden Wiesen, darum rutschte ich einen steilen Abhang hinunter. Es waren nur ein paar Meter, doch mein Fuß hatte sich in einem Pedal des Fahrrads verhakt und es schlitterte mit mir zusammen hinab. Durch den entstandenen Schwung gelang es mir nicht, mich abzubremsen.
Das übernahm schließlich ein Baum für mich. Ich touchierte den Stamm und blieb dann, einen Moment nach Luft ringend, daneben liegen.
»So ein verdammter Mist!«, keuchte ich und löste mein eingeklemmtes Bein vom Fahrrad. Wütend stieß ich es weg, setzte mich langsam und gequält auf und lehnte mich an den Unglücksbaumstamm. Mein Rücken schmerzte und ich versuchte, die aufsteigenden Tränen zurückhalten, doch der Schock und der Schmerz waren mächtiger als der bloße Wille, nicht zu weinen.
Immer noch flach atmend hob ich meinen linken Arm, auf dem ich den Hang hinuntergerutscht war. Da ich eine Jacke trug, waren keine Schürfwunden zu erkennen, aber mein Handgelenk pochte vor Schmerz. Vermutlich war es überdehnt. Sonst hatte ich wohl Glück im Unglück gehabt.
Ich warf einen Blick auf das verdammte Fahrrad. Es schien unbeschadet zu sein. Ein lautes Seufzen entfuhr mir und nun war ich doch wütend - und zwar auf mich selbst. Wer heulte denn auch beim Fahrradfahren und ließ sich davon ablenken? Das musste ja nach hinten losgehen! Überhaupt … es war eine dumme Idee gewesen, in dieser Gemütslage noch eine Runde zu fahren. Jim hatte schon den ganzen Tag in meinem Kopf herumgespukt. Was hatte ich erwartet? Dass die Fahrradtour die Gedanken verschwinden lassen könnte?
Ich schüttelte den Kopf. Und dann, ganz plötzlich, musste ich lauthals lachen. Mir wurde bewusst, dass mein erster Sturz von Jim auch hier gewesen war. Nicht direkt an diesem Abhang, aber auf derselben Strecke. Ich war gern mit Jim hier entlang geritten, besonders wenn die Sonne gerade unterging. Der Ausblick vom Weg ins Tal war um diese Zeit immer so schön. Jim war damals in Panik geraten und losgerannt. Ich verlor das Gleichgewicht und war, wie am heutigen Tag, den Hang am Wegesrand hinuntergerutscht. Nachdem Jim ein ganzes Stück weiter galoppiert war, hatte er sich beruhigt und war dann den Weg wieder zurückgekommen. Erst später ging mir ein Licht auf: Er hatte nach mir gesucht, um zu sehen, ob es mir gutging. Wie gerührt ich damals gewesen war!
Deshalb musste ich auch so lachen. Die Situation war so absurd. Genau an Jims Todestag hatte ich mich erneut am Abhang dieses Weges wiedergefunden. Irgendwie hinterließ diese Tatsache bei mir das Gefühl, ihm nah zu sein.
Aus meinem lauten Lachen wurde langsam wieder ein trockenes Schluchzen. Ein solches Hin und Her an Emotionen kannte ich nicht von mir.
Doch plötzlich hielt ich inne.
Hatte ich eben ein Wiehern gehört?
Angestrengt lauschte ich, aber außer dem Geräusch des Windes, der durch die Bäume streifte, war nichts auszumachen. Wieder schüttelte ich den Kopf. Jetzt war ich also schon so weit, dass ich Jim hörte, obwohl er tot war. Gerade als ich mich, von Schmerzen gebeutelt, erhob, hörte ich es erneut und diesmal war ich mir sicher: Es konnte nichts anderes als das Wiehern eines Pferdes sein.
Doch woher kam es?
Nirgendwo in der Nähe gab es einen Pferdestall. Womöglich ritt jemand unweit von hier aus? Ein weiteres Mal spitzte ich die Ohren. Ob ich die Quelle ausmachen konnte, wenn das Wiehern noch einmal ertönte?
Eine ganze Weile saß ich da, lauschte angestrengt, doch da war nichts mehr. Vielleicht hatte ich mir das alles ja nur eingebildet, oder es war lediglich ein Pferd gewesen, das hier in der Nähe mit seinem Reiter einen Ausritt unternahm. Also entschloss ich mich dazu, den Heimweg anzutreten. Mein Rücken schmerzte höllisch und ich ging mit kurzen, steifen Schritten zu meinem Fahrrad. Vorsichtig bückte ich mich und stellte es auf, als mir ein lauter Schmerzenslaut entfuhr.
Und plötzlich war es wieder da: das Wiehern. Diesmal hatte ich ungefähr ausmachen können, woher es kam; nämlich aus dem kleinen Wäldchen auf der anderen Seite des Weges. Dort kannte ich mich nicht aus. Doch das Pferd, von dem die Rufe ausgingen, musste sich irgendwo in dem Teil des Waldes befinden. Neugier regte sich in mir. Dennoch zögerte ich. Hatte ich mir nicht geschworen, nie wieder etwas mit Pferden zu tun haben zu wollen? Und jetzt plante ich die Suche nach einem mysteriösen Geisterpferd?
Offenbar nicht ganz bei Sinnen ließ ich mein Fahrrad ins Gras fallen und bahnte mir langsam einen Weg durch die Bäume. »Hoffentlich finde ich den Weg zurück«, murmelte ich und versuchte, auf gerader Strecke zu gehen, um mich nicht zu verirren.
Nach einigen Metern blieb ich stehen. »Das ist doch verrückt«, flüsterte ich. Dann erhob ich meine Stimme und rief in den Wald hinein: »Hallo? Ist hier jemand?«
Statt einer menschlichen Antwort hörte ich erneut ein Wiehern. Es klang irgendwie … traurig. Das spornte mich an. Nachdem ich ein weiteres Stück zurückgelegt hatte, wurde es allmählich heller und ich war sicher, dass ich das Waldstück fast durchquert hatte.
Schließlich passierte ich die letzten Bäume und fand mich auf einer kleinen Lichtung wieder. Sie war komplett eingezäunt, weshalb ich nicht weitergehen konnte. Es war ein Stromzaun und durch das rhythmische Klicken, das ich hörte, konnte ich darauf schließen, dass er in Betrieb war.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung war ein spärlicher Holzverschlag, der aussah, als ob er jeden Moment zusammenfiel. In der Mitte dieser Waldwiese plätscherte ein Bächlein. War das Wiehern von hier gekommen? Der Boden hinter dem Zaun war matschig und ich konnte Hufabdrücke erkennen. Sie waren klein, wie von einem Fohlen oder einem Pony.
Noch einmal erhob ich meine Stimme und rief: »Hallo? Ist hier jemand?«
Da hörte ich ganz in der Nähe ein leises Schnauben. Es raschelte und ich erblickte einen Schatten hinter dem Holzverschlag. Die Bewegung, war kaum auszumachen, doch ich war sicher, sie gesehen zu haben. Darum lief ich am Zaun entlang, bis ich hinter das Häuschen blicken konnte.
»Ach, du meine Güte!«, entfuhr es mir. Genau zwischen dem Elektrozaun und dem Holzverschlag stand ein kleines Shetlandpony. Vermutlich war sein Fell weiß, wenn es nicht gerade schlammverschmiert gewesen wäre. Am Kopf trug es ein verkrustetes, viel zu enges Halfter. Unterernährt schien es jedoch nicht. Ob es sich um eine Stute oder einen Hengst handelte, konnte ich nicht ausmachen.
Den größten Eindruck hinterließen bei mir jedoch die Augen des Ponys: Sie erwiderten meinen Blick mit einer Mischung aus Angst und Traurigkeit. Einen Moment lang dachte ich, dass es sich genau so fühlte wie ich. Freudlos. Leer.
Ganz langsam ging ich an dem Zaun entlang und näherte mich dem kleinen Geschöpf. Als ich noch fünf Meter entfernt war, konnte ich sehen, dass die Unsicherheit und Angst in seinen Augen größer wurde. Trotzdem bewegte ich mich weiter vorwärts. Erst als das Pony verängstigt einen Schritt nach hinten machte, hielt ich inne. Lediglich ein paar Meter trennten uns noch.
Die Schmerzen in meinem Rücken und im Handgelenk waren wie weggeblasen, ich hatte nur Augen für dieses arme kleine Ding, das mich angsterfüllt anstarrte.
»Na«, flüsterte ich. »Was machst du denn hier? Wieso bist du ganz alleine in diesem trostlosen Wald?«
Es rührte sich nicht. Also versuchte ich erneut, mich ihm zu nähern. Ein paar kleine Schritte konnte ich tun, dann scheute es wieder und ich musste innehalten.
Rasch überlegte ich, wie ich weiter vorgehen sollte und entschloss, mich einfach an Ort und Stelle hinzusetzen. Langsam sank ich auf die Knie und eine lange Zeit beobachteten wir uns gegenseitig.
Ich war schockiert.
Dieses Pony, eine Stute, wie ich nun erkannte, schien schon seit geraumer Zeit hier zu sein. Vermutlich kümmerte man sich unzureichend um sie.
Die Hufe waren lang und zum Teil ausgebrochen, die Mähne und der Schweif sahen verfilzt aus. Aber am Holzverschlag war eine Raufe, in der, offenbar frisches, Heu lag. Demnach wurde sie gefüttert.
Wer stellt eine Shetlandpony-Stute auf einer Lichtung im Wald ab und ließ sie ganz allein? Sie tat mir unendlich leid und am liebsten wäre ich auf ewig bei ihr geblieben. Doch nach einer Weile begann ich zu frieren. Die Sonne war schon fast untergegangen und da der Weg bis zurück in die Stadt nicht beleuchtet war, sollte ich mich wohl schnellstens auf den Weg machen. Langsam erhob ich mich, klopfte mir etwas nasses Gras von meiner Jeans und warf einen letzten Blick auf das Häufchen Elend. Es fiel mir nicht leicht, sie zurückzulassen.
»Keine Sorge. Ich komme morgen zurück. Du bist nicht allein, Kleines«, flüsterte ich, drehte mich um und bahnte mir dann einen Weg durch den Wald. Immer wieder wollte ich mich umdrehen, zwang mich aber weiterhin, nach vorn zu sehen.
Schließlich kam ich wieder am Unfallort an und richtete mein Fahrrad auf. Als ich es den Abhang hochschob, glaubte ich, erneut ein Wiehern zu hören. Ich zuckte zusammen, wusste aber, dass ich nicht umkehren konnte. Es wurde bereits dunkel.
Die Rückenschmerzen waren jetzt so stark, dass ich mich nicht traute zu fahren. Darum schob ich das Rad und legte den Weg bis zu meinem Elternhaus zu Fuß zurück. Zu meiner Überraschung parkten die Autos meiner Eltern vor dem Haus. Ich stellte das Fahrrad an der Hauswand ab und ging dann langsam zur Haustür.
Kaum war die Wohnungstür hinter mir ins Schloss gefallen, kam mir meine Mutter entgegen. Sie trug ihren Hosenanzug, ganz die Chefin ihrer Bankfiliale. Auch mein Vater, der ihr auf dem Fuß folgte, hatte sein Büro-Outfit noch an.
»Claire, wo warst du denn? Du bist doch sonst nie so spät zu Hause. Und wie siehst du denn aus? Hattest du einen Unfall? Was ist passiert?«
Ich konnte gerade so einen bissigen Spruch unterdrücken. Meine Eltern hatten nie Zeit für mich, sie lebten ausschließlich für ihre Arbeit. Und kam ich einmal etwas später nach Hause, drehten sie schon durch?
»Bleibt mal ganz ruhig. Ich bin nur mit dem Rad gestürzt, mehr nicht«, sagte ich trocken und drückte mich an den beiden vorbei, um meine Jacke aufzuhängen.
»Oh Gott, ist dir etwas passiert? Tut dir was weh? Deine Sachen sind ja total dreckig«, rief meine Mutter wieder aus.
»Mir tut nur der Rücken ein bisschen weh. Sonst ist alles in Ordnung, wirklich. Ich hab jetzt vor allem echt Hunger.«




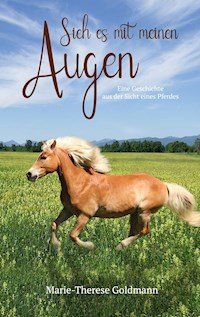
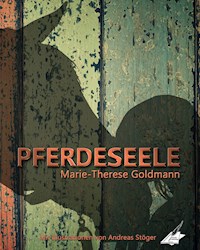













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









