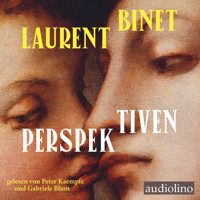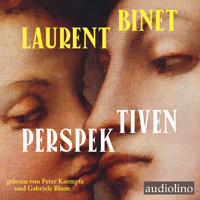9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Binets erster Roman «HHhH» gewann 2010 den Prix Goncourt du Premier Roman, und sein neuer Roman «Die siebte Sprachfunktion» gewann 2015 den Prix Interallié und den Prix du Roman Fnac. Es ist ein Krimi mit Poststrukturalisten. Paris, Frühjahr 1980: Roland Barthes wird von einem bulgarischen Wäschelieferanten überfahren. Barthes kommt von einem Essen mit dem Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, François Mitterrand, und trägt ein Manuskript unter dem Arm. Ein Passant, Michel Foucault, wird Zeuge des Unfalls und behauptet, es war Mord. Der Tod des Autors ist für Kommissar Bayard ein Rätsel. Er mischt sich unter die Poststrukturalisten, besucht Vorlesungen von Foucault und hört Vorträge von Julia Kristeva, Philippe Sollers, Jacques Derrida und anderen. Da er nichts versteht, macht er den jungen Sprachwissenschaftler Simon Herzog zu seinem Assistenten. Der Roman ist auch ein Gesellschaftsporträt des Frankreichs der achtziger Jahre. Bayard ermittelt unter den Nach-Achtundsechzigern, die er nicht ausstehen kann, diesen linken Nichtsnutzen, die mit Joints und langen Haaren vor der Uni herumlungern und mit lüsternen Professoren, die von sexueller Freiheit labern und sich unzüchtig benehmen, Frankreichs Kultur gefährden. Das Manuskript, das Barthes bei sich hatte, bleibt spurlos verschwunden. Auch der bulgarische Geheimdienst interessiert sich dafür. Ein bulgarischer Mörder greift Simon Herzog mit einer vergifteten Regenschirmspitze an. Aber im letzten Moment wird Herzog von zwei Japanern gerettet. Sie sind ebenfalls hinter dem Manuskript her. Eine heiße Spur führt zu dem italienischen Semiotiker Umberto Eco. Also bewegt sich der Tross – Kommissar und Assistent, Bulgaren und Japaner, nach Italien. Die Reise geht noch lange weiter, sie führt sogar auf einen amerikanischen Campus, wo Foucault über die Sexualität der Elefanten philosophiert. Das Manuskript, das alle haben wollen, beschreibt die siebte Sprachfunktion (in Anlehnung an Roman Jakobsons Standardwerk der Linguistik über die sechs Sprachfunktionen). Die siebte Funktion, die Binet Roland Barthes erfinden lässt, gibt Politikern die rhetorischen Mittel an die Hand, öffentliche Rededuelle und damit auch die Wahlen zu gewinnen. Könnte Mitterrand damit an die Macht gelangen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Laurent Binet
Die siebte Sprachfunktion
Roman
Über dieses Buch
Binets erster Roman «HHhH» gewann 2010 den Prix Goncourt du Premier Roman, und sein neuer Roman «Die siebte Sprachfunktion» gewann 2015 den Prix Interallié und den Prix du Roman Fnac.
Es ist ein Krimi mit Poststrukturalisten.
Paris, Frühjahr 1980: Roland Barthes wird von einem bulgarischen Wäschelieferanten überfahren. Barthes kommt von einem Essen mit dem Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, François Mitterrand, und trägt ein Manuskript unter dem Arm. Ein Passant, Michel Foucault, wird Zeuge des Unfalls und behauptet, es war Mord.
Der Tod des Autors ist für Kommissar Bayard ein Rätsel. Er mischt sich unter die Poststrukturalisten, besucht Vorlesungen von Foucault und hört Vorträge von Julia Kristeva, Philippe Sollers, Jacques Derrida und anderen. Da er nichts versteht, macht er den jungen Sprachwissenschaftler Simon Herzog zu seinem Assistenten.
Der Roman ist auch ein Gesellschaftsporträt des Frankreichs der achtziger Jahre. Bayard ermittelt unter den Nach-Achtundsechzigern, die er nicht ausstehen kann, diesen linken Nichtsnutzen, die mit Joints und langen Haaren vor der Uni herumlungern und mit lüsternen Professoren, die von sexueller Freiheit labern und sich unzüchtig benehmen, Frankreichs Kultur gefährden.
Das Manuskript, das Barthes bei sich hatte, bleibt spurlos verschwunden. Auch der bulgarische Geheimdienst interessiert sich dafür. Ein bulgarischer Mörder greift Simon Herzog mit einer vergifteten Regenschirmspitze an. Aber im letzten Moment wird Herzog von zwei Japanern gerettet. Sie sind ebenfalls hinter dem Manuskript her. Eine heiße Spur führt zu dem italienischen Semiotiker Umberto Eco. Also bewegt sich der Tross – Kommissar und Assistent, Bulgaren und Japaner, nach Italien. Die Reise geht noch lange weiter, sie führt sogar auf einen amerikanischen Campus, wo Foucault über die Sexualität der Elefanten philosophiert.
Das Manuskript, das alle haben wollen, beschreibt die siebte Sprachfunktion (in Anlehnung an Roman Jakobsons Standardwerk der Linguistik über die sechs Sprachfunktionen). Die siebte Funktion, die Binet Roland Barthes erfinden lässt, gibt Politikern die rhetorischen Mittel an die Hand, öffentliche Rededuelle und damit auch die Wahlen zu gewinnen. Könnte Mitterrand damit an die Macht gelangen?
Vita
Laurent Binet wurde 1972 in Paris geboren und hat in Prag Geschichte studiert. Jetzt lebt er in Paris. Sein erster Roman «HHhH» gewann 2010 den Prix Goncourt du Premier Roman und wurde von der New York Times zu den 100 besten Büchern des Jahres 2012 gewählt. «Die siebte Sprachfunktion» war in Frankreich ein großer Bestseller und wurde mit dem Prix Interallié und dem Prix du Roman Fnac ausgezeichnet. Der Roman wird in über 20 Sprachen übersetzt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel «La septième fonction du langage» bei Éditions Grasset & Fasquelle in Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«La septième fonction du langage» Copyright © 2015 by Laurent Binet
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN Taschenbuchausgabe 978-3-499-27221-9 (1. Auflage 2018)
ISBN 978-3-644-05501-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dolmetscher, Interpreten gibt es überall. Jeder spricht seine eigene Sprache, selbst wenn er eine Ahnung von der Sprache des anderen hat. Weit öffnet sich der Raum für seine Taschenspielertricks, und nie sieht er ganz von sich selber ab.
Derrida
Erster TeilParis
1
Das Leben ist kein Roman. Möchte man jedenfalls meinen. Roland Barthes kommt die Rue de la Bièvre herauf. Der bedeutendste Homme de lettres des zwanzigsten Jahrhunderts hat allen Grund, zutiefst beklommen zu sein. Seine Mutter ist gestorben, seine Mutter, zu der er ein sehr proustisches Verhältnis hatte. Und sein Seminar am Collège de France über «Die Vorbereitung des Romans» ist danebengegangen, er muss sich sein Versagen eingestehen: Die ganze Zeit hat er seinen Studenten von japanischen Haikus erzählt, von Fotografie, vom Unterschied zwischen Signifikant und Signifikat in der Semiotik, von der Pascal’schen Zerstreuung, von Kellnern, von Morgenmänteln und Hörsaalplätzen – nur nicht vom Roman. Und so geht das nun schon seit drei Jahren. Er weiß natürlich, dass das Seminar eigentlich ein Ausweichmanöver ist, dass er damit nur den Augenblick hinauszögert, wo er endlich ein literarisches Werk beginnen und dem hochsensiblen Schriftsteller Gerechtigkeit widerfahren lassen wird, der in ihm schlummert und der, nach allgemeiner Meinung, schon erste Knospen getrieben hat in den Fragmenten einer Sprache der Liebe, inzwischen ein Kultbuch der unter Fünfundzwanzigjährigen. Von Sainte-Beuve zu Proust – nun ist es an der Zeit, erwachsen zu werden und sich seinen Platz im Pantheon der Schriftsteller zu erobern. Maman ist tot: Seit Am Nullpunkt der Literatur ist sein Bündel geschnürt. Jetzt muss es losgehen.
Die Politik, okay, das kommt auch noch. Er ist nicht gerade Maoist geworden nach seiner Chinareise. Und ehrlich gesagt, das erwartet auch niemand von ihm.
Chateaubriand, La Rochefoucauld, Brecht, Racine, Robbe-Grillet, Michelet, Maman – wie ein Heranwachsender eben so liebt.
Ich frage mich, ob sie im Quartier Latin damals auch schon alle in diesen Outdoorklamotten rumliefen.
Noch eine Viertelstunde, und er ist des Todes.
Ich zweifle nicht daran, dass das Essen in der Rue des Blancs-Manteaux geschmeckt hat, man isst gut in diesen Kreisen. In den Mythen des Alltags dechiffriert Roland Barthes die heutigen Mythen, die die Bourgeoisie zum eigenen Glorienschein errichtet hat, und mit diesem Buch ist er berühmt geworden; in gewisser Weise verdankt er sein Vermögen also dem Bürgertum. Allerdings dem Kleinbürgertum. Der Großbürger, der dem Volk dienen will, ist ein sehr spezieller Fall und verdient genauere Betrachtung; man sollte einen Aufsatz darüber schreiben. Heute Abend? Warum nicht gleich? Ach nein, doch lieber vorher noch die Dias sortieren.
Roland Barthes beschleunigt den Schritt und nimmt nichts von seiner Umgebung wahr, er, der doch eigentlich der geborene Beobachter ist, er, dessen Beruf das genaue Hinsehen und das Dechiffrieren ist, er, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, den Zeichen auf die Spur zu kommen. Tatsächlich sieht er weder die Bäume noch das Trottoir, weder die Schaufenster noch die Autos am Boulevard Saint-Germain, den er wie seine Westentasche kennt. Er ist nicht mehr in Japan. Er spürt nichts von der beißenden Kälte. Den Straßenlärm hört er kaum. Es ist sozusagen das Gegenteil des Höhlengleichnisses: Die Welt der Ideen, in der er sich eingeschlossen hat, verdunkelt ihm die wahrnehmbare Welt. Um sich herum sieht er nur Schatten.
Was ich hier herangezogen habe, um die sorgenvolle Haltung von Roland Barthes zu erklären, ist alles historisch belegt, aber ich möchte Ihnen erzählen, was sich tatsächlich zugetragen hat. Dass er an diesem Tag mit seinem Kopf woanders ist, liegt nicht allein am Tod seiner Mutter, auch nicht daran, dass er außerstande ist, einen Roman zu schreiben, und nicht einmal am – wie er erkennt: unrettbar – schwindenden Interesse der jungen Männer für ihn. Ich will nicht behaupten, dass er daran nicht dächte, mit Sicherheit hat er solche Zwangsneurosen. Aber heute ist da noch etwas anderes. Im abwesenden Blick des gedankenverlorenen Mannes könnte der aufmerksame Beobachter den Gemütszustand erkennen, von dem Barthes glaubte, er sei ihm fremd: Aufregung. Da sind nicht nur die Mutter, die Jungs und das Trugbild des Romans. Da ist auch sie wieder, die libido sciendi, der Wissensdurst, und im Gefolge davon der stolze Anspruch, das menschliche Wissen zu revolutionieren, ja vielleicht die Welt zu verändern. Fühlt sich Barthes, als er die Rue des Écoles überquert, wie Einstein beim Nachdenken über die Relativitätstheorie? Sicher ist nur, dass er nicht besonders aufmerksam ist. Keine hundert Meter sind es noch bis zu seinem Büro, da läuft er in einen Lieferwagen. Sein Leib erzeugt den typischen schrecklich dumpfen Laut von Fleisch gegen Karosserieblech und kugelt wie ein Bündel Lumpen über die Fahrbahn. Die Passanten erschrecken. An diesem Nachmittag des 25. Februar 1980 können sie nicht ahnen, was da gerade vor ihren Augen geschehen ist – logisch, denn die Welt weiß es bis heute nicht.
2
Die Semiotik ist ein Taschenspielertrick. Ferdinand de Saussure, der Begründer der Linguistik, hatte als Erster diese Eingebung. In seinen Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft regt er an, sich eine Wissenschaft vorzustellen, «welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht». Nichts weiter. Und die, die sich dieser Aufgabe unterziehen wollen, setzt er auf die Fährte: «Diese würde einen Teil der Sozialpsychologie bilden und infolgedessen einen Teil der allgemeinen Psychologie; wir werden sie Semiotik (von griechisch sēmeîon, ‹Zeichen›) nennen. Sie würde uns lehren, worin die Zeichen bestehen und welche Gesetze sie regieren. Da sie noch nicht existiert, kann man nicht sagen, was sie sein wird. Aber sie hat Anspruch darauf, zu bestehen; ihre Stellung ist von vornherein bestimmt. Die Sprachwissenschaft ist nur ein Teil dieser allgemeinen Wissenschaft, die Gesetze, welche die Semiotik entdecken wird, werden auf die Sprachwissenschaft anwendbar sein, und diese Letztere wird auf diese Weise zu einem ganz bestimmten Gebiet in der Gesamtheit der menschlichen Verhältnisse gehören.» Ich hätte gern, dass Fabrice Luchini uns diese Passage einmal vorliest, mit Betonung, wie er das so gut kann, damit jedermann ihren Sinn oder doch wenigstens ihre Schönheit erfasst. Diese geniale Eingebung, die seinen Zeitgenossen nahezu unverständlich war (das Seminar fand 1906 statt), hat ein Jahrhundert später nichts von ihrer Wucht, aber auch nichts von ihrer Dunkelheit eingebüßt. Zahlreiche Semiotiker haben seither versucht, klarere und differenziertere Definitionen zu liefern, aber sie haben sich gegenseitig widersprochen (teils ohne es selber zu bemerken), Verwirrung gestiftet und letztlich nur (und auch das nicht wirklich) die Liste der Zeichensysteme verlängert, die von der Sprache nicht erfasst werden: die Verkehrsschilder, die internationalen Schifffahrtszeichen, die Nummerierung der Buslinien und der Hotelzimmer, sie haben sich darangemacht, die militärischen Ränge und die Gebärdensprache zu vervollständigen … und das ist schon fast alles.
Etwas dürftig angesichts der ursprünglichen Zielsetzung.
So gesehen ist die Semiotik keineswegs eine Erweiterung der Linguistik, sondern scheint sich eher auf die Erforschung grober Modelle von Ursprachen zu beschränken, die weit weniger komplex und insofern sehr viel beschränkter sind als jede beliebige Sprache.
Aber das kann es ja nicht sein.
Es ist kein Zufall, dass Umberto Eco, der Gelehrte aus Bologna, einer der letzten Semiotiker, sich so häufig auf die bahnbrechenden Erfindungen der Menschheitsgeschichte beruft: auf das Rad, den Löffel, das Buch …, seiner Auffassung nach vollendete Werkzeuge von unübertrefflichem Wirkungsgrad. Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass die Semiotik eine der zentralen Erfindungen der Menschheitsgeschichte ist, eines der schärfsten Instrumente, die der Mensch je geschmiedet hat. Aber wie beim Feuer und bei der Atomkernspaltung weiß man anfangs nicht, wozu das gut ist und wie man sich seiner bedient.
3
Keineswegs ist er in der nächsten Viertelstunde gestorben. Roland Barthes liegt im Rinnstein, regungslos, nur ein heiseres Röcheln kommt aus seinem Leib, und während er bewusstlos wird, wobei seinen Geist vielleicht wirbelnde Haikus, Racine’sche Alexandriner und Pascal’sche Pensées durchzucken, hört er – das ist wohl das Letzte, was er hört, sagt er sich (sagt er sich, ganz sicher) – hört er die Schreie eines Mannes, der völlig außer sich ist: «Err hat sich mirr vorr die Räder geworrfen! Err hat sich mirr vorr die Räder geworrfen.» Woher kommt dieser Akzent? Um ihn herum haben sich, nach dem ersten Schreck, Passanten versammelt, beugen sich über das, was bald sein Leichnam sein wird, und geben ihre Meinungen und Einschätzungen ab:
«Wir müssen den Notarzt rufen.»
«Lohnt nicht, er hat’s hinter sich.»
«Err hat sich mirr vorr die Räder geworrfen, Sie sind Zeuge!»
«Der ist übel zugerichtet.»
«Der arme Mann …»
«Wo gibt’s hier eine Telefonzelle? Hat jemand Münzen?»
«Ich hatte keine Chance zu brremsen!»
«Rührt ihn nicht an, wir müssen auf den Notarzt warten.»
«Auf keinen Fall ihn umdrehen.»
«Ich bin Arzt. Er lebt noch.»
«Wir müssen seine Familie verständigen.»
«Der arme Mann.»
«Ich kenne ihn!»
«War es Selbstmord?»
«Wir müssten seine Blutgruppe feststellen.»
«Ein Stammgast. Jeden Morgen trinkt er sein Glas Wein bei mir.»
«Er wird nicht mehr kommen.»
«Ist er betrunken?»
«Er riecht nach Alkohol.»
«Einen kleinen Weißwein am Tresen, jeden Morgen, seit Jahren.»
«So kriegen wir seine Blutgruppe nicht raus.»
«Err hat die Straße überquerrt und nicht aufgepasst.»
«Der Fahrer hat sein Fahrzeug jederzeit unter Kontrolle zu haben, so steht es im Gesetz.»
«Ganz ruhig, Alter, Sie sind doch gut versichert.»
«Das geht auf den Schadenfreiheitsrabatt.»
«Rührt ihn nicht an!»
«Ich bin Arzt!»
«Ich auch.»
«Dann kümmern Sie sich um ihn. Ich gehe Hilfe holen.»
«Ich muss die Warre auslieferrn …»
Die Mehrzahl der Weltsprachen verwenden das apico-alveolare R, auch Zungen-R genannt, im Gegensatz zum Französischen, das seit ungefähr dreihundert Jahren das dorso-velare R angenommen hat. Weder im Deutschen noch im Englischen wird das R gerollt. Italienisch und spanisch klingt es auch nicht. Portugiesisch vielleicht? Ein bisschen guttural klingt es wohl, aber die Aussprache ist nicht nasal und singend genug, im Gegenteil, es klingt ziemlich monoton, sodass sich die Modulationen der Panik nur schwer erkennen lassen.
Vielleicht ist es Russisch.
4
Wie konnte die Semiotik, die beinahe nur ein kümmerlicher Seitentrieb der Linguistik zur Analyse der ärmlichsten und simpelsten Sprachen geblieben wäre, die Sprengkraft einer Neutronenbombe entwickeln?
Durch einen Eingriff, an dem Barthes nicht ganz unbeteiligt ist.
In ihren Anfängen widmete sich die Semiotik der Erforschung von nichtsprachlichen Kommunikationssystemen. Saussure selbst sagte seinen Studenten: «Die Sprache ist ein System von Zeichen, die Ideen ausdrücken, und insofern der Schrift, dem Taubstummenalphabet, symbolischen Riten, Höflichkeitsformen, militärischen Signalen und so weiter vergleichbar. Nur ist sie das wichtigste dieser Systeme.» Das stimmt natürlich, aber nur insoweit, wie es die Beschreibung von Zeichensystemen auf solche beschränkt, die ausdrücklich und absichtsvoll auf Kommunikation ausgerichtet sind. Der belgische Semiotiker Eric Buyssens definiert die Semiotik als «das Studium der Kommunikationsvorgänge, das heißt der Mittel, die eingesetzt werden, um den anderen zu beeinflussen, und die der, den man beeinflussen möchte, als solche anerkennt».
Barthes’ Geniestreich nun ist es, sich nicht auf die Kommunikationssysteme zu beschränken, sondern sein Arbeitsfeld auf die Bedeutungssysteme auszuweiten. Hat man einmal von der Sprache gekostet, so wird einem jedes andere Zeichensystem rasch langweilig: Verkehrsschilder oder Militärsignale zu studieren, ist für einen Linguisten ungefähr so inspirierend wie Tarock oder Rommé für einen Schach- oder Pokerspieler. Umberto Eco würde sagen: Zum Kommunizieren ist Sprache einfach perfekt – besser geht’s nicht. Und doch: Die Sprache sagt nicht alles. Der Körper spricht, die Dinge sprechen, die Geschichte spricht, Einzel- und Kollektivschicksale sprechen, Leben und Tod sprechen zu uns auf tausenderlei Weise. Der Mensch ist eine Übersetzungsmaschine, und wenn er auch nur ein Fünkchen Einbildungskraft hat, sieht er überall Zeichen: in der Farbe des Mantels seiner Frau, in den Kratzern an seiner Autotür, in den Kochgewohnheiten der Wohnungsnachbarn, in Frankreichs monatlichen Arbeitslosenzahlen, in der bananigen Note des neuen Beaujolais (es ist immer Banane, seltener Himbeere; keiner weiß, warum, aber es gibt sicher eine Erklärung, und die ist semiotisch), im stolzen und geschwungenen Schritt einer Schwarzen vor ihm im Metro-Gang, in der Angewohnheit seines Kollegen im Büro, die beiden oberen Hemdknöpfe offen zu lassen, im Gehabe des Torschützen, seinen Erfolg zu feiern, in der Art und Weise seiner Partnerin, mit einem Schrei den Orgasmus zu signalisieren, im skandinavischen Möbeldesign, im Logo des Hauptsponsors eines Tennisturniers, in der Musik zum Vor- oder Abspann eines Films, in der Architektur, in der Malerei, in der Kochkunst, in der Mode, in der Werbung, in der Inneneinrichtung, in den abendländischen Vorstellungen von Mann und Frau, Liebe und Tod, Himmel und Erde und so weiter. Nach Barthes bedürfen diese Zeichen gar keiner Signalfunktion mehr: Sie sind Indizien geworden. Eine entscheidende Wandlung. Sie sind überall. Von nun an hat die Semiotik das Zeug, die große weite Welt zu erobern.
5
Kommissar Bayard wird in der Notaufnahme der Pitié-Salpêtrière vorstellig und lässt sich die Zimmernummer von Roland Barthes nennen. Folgende Informationen umfasst seine Akte: Am Montagnachmittag wurde ein vierundsechzigjähriger Mann beim Überqueren der Rue des Écoles am Fußgängerübergang vom Lieferwagen einer Wäscherei überfahren. Der Fahrer des Lieferwagens, ein gewisser Yvan Delahov, Nationalität: Bulgare, war leicht alkoholisiert, 0,6 Promille bei zulässigen 0,8. Räumte ein, dass er mit seiner Liefertour verspätet war, erklärte aber, höchstens 60 km/h gefahren zu sein. Der Verunfallte war bewusstlos, hatte keine Papiere bei sich, als die Sanitäter kamen, aber ein Kollege, ein gewisser Michel Foucault, Professor am Collège de France und Schriftsteller, identifizierte ihn. Die Überprüfung ergab, dass es sich tatsächlich um Roland Barthes handelt, auch er Professor am Collège de France und Schriftsteller.
Nichts in der Akte rechtfertigte zunächst die Entsendung eines Ermittlers und erst recht nicht eines Kriminalkommissars. Dass Jacques Bayard trotzdem gekommen ist, verdankt sich einem Zufall: Als Roland Barthes am 25. Februar 1980 überfahren wurde, kam er gerade von einem Mittagessen mit François Mitterrand in der Rue des Blancs-Manteaux.
Auf den ersten Blick gibt es keine Verbindung zwischen dem Mittagessen und dem Unfall, so wenig wie zwischen dem sozialistischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, die im Jahr darauf stattfinden soll, und dem bulgarischen Wäschereiangestellten, aber es liegt im Wesen des polizeilichen Nachrichtendienstes, sich aller Nachrichten zu bedienen, und am Vorabend des Wahlkampfes natürlich vor allem solcher, die François Mitterrand betreffen. Dabei hat Michel Rocard viel bessere Werte (Sofres-Umfrage im Januar 1980: «Wer ist der bessere Kandidat für die Sozialisten?» Mitterrand 20 %, Rocard 55 %), aber man vermutet da oben wohl, dass er es nicht wagen wird, den Rubikon zu überschreiten: Die Sozialisten glauben an Erbhöfe und haben Mitterrand erneut an die Spitze ihrer Partei gewählt. Sechs Jahre liegt es nun schon zurück, dass er mit 49,19 % gegen 50,81 % beinahe Giscard d’Estaing überholt hätte – so klein war der Vorsprung seit der Einführung der Direktwahl des Präsidenten noch nie gewesen. Nun ist es nicht mehr auszuschließen, dass erstmals in der Geschichte der Fünften Republik ein linker Präsident gewählt wird, und deshalb hat der Polizeiliche Nachrichtendienst eilends einen Ermittler geschickt. Die Aufgabe von Jacques Bayard besteht zunächst darin, zu überprüfen, ob Barthes vielleicht bei Mitterrand zu viel getrunken oder ob er etwa an einer Sadomaso-Orgie mit Hunden teilgenommen hat. Es gab in den vergangenen Jahren kaum Skandale um den Sozialistenführer, er scheint sich anständig zu benehmen. Vergessen ist die vorgetäuschte Entführung im Jardin de l’Observatoire. Über den Francisque-Orden und sein Überlaufen zum Vichy-Regime wird geschwiegen. Etwas Neues muss her. Offiziell wird Jacques Bayard beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren, aber was man von ihm erwartet, bedarf in Wahrheit keiner näheren Erläuterung: Er soll herausfinden, ob es irgendetwas gibt, das die Glaubwürdigkeit des sozialistischen Kandidaten in Frage stellt, indem er ihn genau observiert und ihm gegebenenfalls etwas Schmutziges anhängt.
Als Jacques Bayard zum Krankenzimmer kommt, ist da eine lange Schlange auf dem Flur. Alle warten darauf, dem Unfallopfer einen Besuch abstatten zu dürfen. Gut gekleidete Alte und schlecht gekleidete Junge und umgekehrt, sehr verschieden im Stil, lange Haare, kurze Haare, Maghreb-Gestalten, mehr Männer als Frauen. Während sie warten, bis sie an der Reihe sind, reden sie laut miteinander, beschimpfen sich, lesen, rauchen. Bayard, der noch nicht begriffen hat, wie berühmt Barthes ist, wird sich gefragt haben, was das denn für ein Sauhaufen ist. Er nutzt sein Privileg, zieht an der Schlange vorbei, sagt «Polizei» und betritt das Zimmer.
Jacques Bayard konstatiert: ungewöhnlich weit hochgefahrenes Bett, Patient intubiert, Blutergüsse im Gesicht, trauriger Blick. Vier weitere Personen sind im Raum: der kleine Bruder, der Verleger, der Schüler und eine Art arabischer Prinz, sehr schick. Dieser arabische Prinz ist Youssef, ein gemeinsamer Freund vom Meister und vom Schüler, Jean-Louis, den der Meister für den herausragendsten unter seinen Studenten hält, jedenfalls hat er zu ihm auch die größte Zuneigung. Jean-Louis und Youssef bewohnen gemeinsam eine Wohnung im 13. Arrondissement, in der sie Abendgeselligkeiten veranstalten, die das Leben von Barthes bereichern. Er trifft dort eine Menge Leute, Studenten, Schauspielerinnen, bekannte Persönlichkeiten, oft André Téchiné, manchmal Isabelle Adjani und immer einen Schwarm junger Intellektueller. Doch jetzt gerade interessiert sich Kommissar Bayard nicht für solche Details; seine Aufgabe ist ja nur, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Als er in die Klinik eingeliefert wurde, hatte Barthes wieder das Bewusstsein erlangt. Zu den Herbeigeeilten sagte er nur: «Was für eine Dummheit! Was für eine Dummheit!» Trotz vielfacher Prellungen und mehrerer Rippenbrüche wirkte sein Zustand nicht allzu beunruhigend. Doch Barthes hat, wie sein kleiner Bruder mitteilt, «eine Achillesferse: seine Lunge». In seiner Jugend hatte er Tuberkulose, und er ist ein starker Zigarrenraucher. Daraus folgt eine chronische Atemschwäche, die ihn diese Nacht einholt. Er hat Erstickungsanfälle, man muss ihn intubieren. Als Bayard hereinkommt, ist Barthes bei Bewusstsein, kann aber nicht sprechen.
Vorsichtig spricht Bayard ihn an. Er werde ihm nun ein paar Fragen stellen, als Antwort genüge ein Nicken oder leichtes Kopfschütteln. Barthes blickt ihn mit seinen traurigen Hundeaugen an. Er nickt schwach.
«Sie waren auf dem Weg zu Ihrer Arbeitsstätte, als Sie in das Fahrzeug liefen, nicht wahr?» Barthes nickt. «War das Fahrzeug schnell?» Barthes dreht den Kopf zur einen Seite, dann zur anderen, und Bayard versteht, dass er sagen will, er habe keine Ahnung. «Waren Sie abgelenkt?» Ja. «Hing Ihre Unaufmerksamkeit mit dem Mittagessen zusammen?» Nein. «Mit der Vorbereitung Ihrer Vorlesung?» Nach einer Pause: ja. «Sie trafen beim Mittagessen François Mitterrand?» Ja. «Ereignete sich bei diesem Essen etwas Besonderes oder etwas Ungewöhnliches?» Nach einer Pause: nein. «Hatten Sie Alkohol getrunken?» Ja. «Viel?» Nein. «Ein Glas?» Ja. «Zwei Gläser?» Ja. «Drei Gläser?» Nach einer Pause: ja. «Vier Gläser?» Nein. «Hatten Sie Ihren Ausweis bei sich, als der Unfall geschah?» Ja. Pause. «Sind Sie sicher?» Ja. «Sie hatten keinen Ausweis dabei, als man Sie fand. Kann es sein, dass Sie ihn irgendwo liegengelassen haben, zu Hause oder woanders?» Längere Pause. Barthes’ Blick scheint sich mit neuer Intensität zu beleben. Er schüttelt den Kopf. «Erinnern Sie sich, ob jemand Sie angefasst hat, als Sie am Boden lagen und bevor der Sanitätsdienst kam?» Barthes wirkt, als höre oder verstehe er die Frage nicht. Er schüttelt den Kopf. «Nein, Sie erinnern sich nicht?» Noch eine Pause, doch diesmal glaubt Bayard den Gesichtsausdruck zu verstehen: Er wirkt ungläubig. Barthes schüttelt den Kopf. «War Geld in Ihrer Brieftasche?» Barthes’ Augen fixieren seinen Gesprächspartner. «Monsieur Barthes, hören Sie mich? Hatten Sie Geld bei sich?» Nein. «Hatten Sie irgendwelche Wertgegenstände bei sich?» Keine Antwort. Der Blick ist so starr, dass man, wäre da in den Tiefen der Augen nicht eine seltsame Glut, meinen möchte, Barthes sei tot. «Monsieur Barthes? Trugen Sie irgendetwas Wertvolles bei sich? Glauben Sie, man hätte Ihnen etwas stehlen können?» Die Stille im Raum wird nur durch Barthes’ Atem unterbrochen, der durch den Schlauch des Beatmungsgerätes rasselt. Lange ziehen sich die Sekunden. Langsam schüttelt Barthes den Kopf, dann dreht er sich weg.
6
Beim Verlassen der Klinik stellt Kommissar Bayard fest, dass es da ein Problem gibt. Dass das, was als reine Routineermittlung begonnen hat, am Ende vielleicht alles andere als überflüssig wäre. Dass das Verschwinden der Ausweispapiere ein merkwürdig dunkler Punkt ist in einem Kontext, der zunächst wie ein banaler Unfall aussieht. Dass er das ans Licht bringen muss, indem er mehr Leute befragt, als er ursprünglich vorhatte. Dass er die Fährte seiner Recherchen in der Rue des Écoles aufnehmen muss, vor dem Collège de France (einer Einrichtung, die ihm bis dahin kein Begriff gewesen ist und von deren Bedeutung er keine Ahnung hat). Dass er damit beginnen wird, diesen Herrn Foucault zu treffen, einen «Professor für Geschichte von Denksystemen» (sic). Dass er danach eine ganze Reihe von langhaarigen Studenten auszufragen hat plus die Unfallzeugen plus die Freunde des Unfallopfers. Dieses Arbeitspensum erschreckt ihn, nervt ihn auch. Aber er weiß, was er in dem Krankenzimmer gesehen hat. In Barthes’ Augen war – Angst.
Kommissar Bayard, ganz in seine Gedanken versunken, achtet nicht auf den schwarzen Citroën, der gegenüber geparkt ist. Er steigt in seinen Dienst-Peugeot 504 und fährt zum Collège de France.
7
Im Foyer hält er Ausschau nach den Unterrichtsplänen: «Nuklearmagnetismus», «Entwicklungs-Neuropsychologie», «Soziographie Südostasiens», «Christentum und Gnosis im präislamischen Orient» … Ratlos begibt er sich zum Lehrerzimmer und fragt nach Michel Foucault. Der ist gerade beim Unterricht, heißt es.
Der Hörsaal ist zum Bersten voll. Bayard kommt gar nicht rein. Eine geschlossene Phalanx von Hörern drängt ihn zurück, sie sind empört, als er sich einen Weg zu bahnen versucht. Ein nachsichtiger Student erklärt ihm flüsternd, wie das geht: Wenn man einen Sitzplatz haben will, muss man zwei Stunden vorher da sein. Wenn der Hörsaal voll ist, kann man auf den Hörsaal gegenüber ausweichen, wohin die Vorlesung per Lautsprecher übertragen wird. Da sieht man Foucault zwar nicht, aber man hört ihn wenigstens. Bayard geht also in Hörsaal B, auch der ist ziemlich voll, aber es gibt noch freie Plätze. Ein gemischtes Auditorium: Junge, Alte, Hippies, Yuppies, Punks, Gruftis, Engländer in Tweedjacke, Italienerinnen mit tiefem Ausschnitt, Iranerinnen im Tschador, Großmütterchen mit Hündchen. Er nimmt Platz neben einem jungen Zwillingspärchen in Astronautenkluft (immerhin ohne Helm). Es herrscht Arbeitsatmosphäre, die Leute schreiben mit oder hören konzentriert zu. Manchmal wird gehustet, wie im Theater, aber es ist niemand auf der Bühne. Aus den Lautsprechern kommt eine näselnde Stimme, etwas vierzigerjahrehaft, nicht gerade Chaban-Delmas, eher eine Mischung aus Jean Marais und Jean Poiret, nur schärfer.
«Die Aufgabe, die ich stellen möchte», sagt die Stimme, «lautet: Welche Bedeutung hat innerhalb der Heilsvorstellung – das heißt innerhalb der Vorstellung von der Erleuchtung, der Vorstellung von der Vergebung, welche die Menschen mit ihrer ersten Taufe erlangt haben –, welche Bedeutung kann die Wiederholung der Buße oder sogar die Wiederholung der Sünde haben?»
Sehr professoral klingt das, das spürt Bayard. Er will begreifen, wovon die Rede ist, aber kaum ist er so weit, da fährt Foucault schon fort: «Sodass das Subjekt, indem es sich zur Wahrheit aufmacht und sich durch die Liebe an sie bindet, in seinen eigenen Worten eine Wahrheit offenbart, die nichts anderes ist als die Manifestation des wahren Vorhandenseins eines Gottes in ihm, der selbst nur die Wahrheit sagen kann, denn er lügt nie, er ist wahrhaftig.»
Hätte Foucault an diesem Tag von Gefängnis gesprochen, von Kontrolle, von Archäologie, von Bio-Macht, von Abstammungslehre, wer weiß? … Aber die Stimme geht unerbittlich ihren Weg: «Selbst wenn sich die Welt für einige Philosophien oder Kosmologien tatsächlich in die eine oder andere Richtung dreht, so hat doch die Zeit im Leben der Individuen nur eine Richtung.» Bayard hört zu, ohne zu verstehen, lässt sich einlullen von dem zugleich belehrenden und getragenen Ton, der auf seine Weise melodisch wirkt, gestützt von einem Gefühl für Rhythmus und Pausen und einer sehr streng eingehaltenen Interpunktion.
Der Typ verdient doch hoffentlich nicht mehr als er?
«Zwischen diesem System des Gesetzes, das sich auf die Handlungen erstreckt und sich auf ein Willenssubjekt bezieht und folglich von der unbegrenzten Wiederholbarkeit der Verfehlung ausgeht, und dem Schema des Heils und der Vollkommenheit, das sich auf das Leben und die Zeit der Individuen erstreckt und eine Unwiderruflichkeit beinhaltet, ist, glaube ich, keine Integration möglich.»
Ja, klar. Bayard gelingt es nicht, seinen unterschwelligen Groll zu unterdrücken, diese Stimme war ihm von Anfang an unangenehm. So reden die Leute, mit denen die Polizei sich herumschlagen muss, weil sie ihre Steuern nicht zahlen wollen. Beamte wie er, mit dem Unterschied, dass ihm der Lohn der Gesellschaft für seine Arbeit auch wirklich zusteht. Aber dieses Collège de France, was ist das? Immerhin gegründet von Franz I., das hat er am Eingang gelesen. Und sonst? Öffentliche Vorlesungen, die nur linksradikale Arbeitslose, Rentner, Illuminaten und pfeiferauchende Profs interessieren; spekulative Themen, von denen er noch nie etwas gehört hat; keine Zeugnisse, keine Prüfungen. Leute wie Barthes oder Foucault, die noch dafür bezahlt werden, Nebelkerzen aufsteigen zu lassen. Eines weiß Bayard ganz gewiss: Dies ist nicht der Ort, wo man ein Handwerk erlernt. Ihre Episteme können sie sich sonstwohin stecken.
Als die Stimme die Veranstaltung der kommenden Woche ankündigt, geht Bayard wieder zum Hörsaal A, pflügt sich durch die Hörer, die durch die Flügeltüren herausströmen, und gelangt schließlich in den Saal. Ganz unten sieht er einen Glatzkopf mit Rollkragenpulli und Jackett. Er wirkt zugleich stämmig und feingliedrig, ein energisches Kinn, leichten Überbiss, die hochmütige Attitüde von einem, der weiß, dass die Welt seinen Wert erkannt hat – und sein Kopf ist makellos glatt rasiert. Bayard erwischt ihn noch am Podium: «Monsieur Foucault?» Der große Kahle ist dabei, seine Blätter einzusammeln, in der typischen entspannten Haltung eines Dozenten, der die Vorlesung hinter sich hat. Freundlich wendet er sich Bayard zu; er weiß, welche Schüchternheit seine Bewunderer manchmal überwinden müssen, ehe sie es wagen, ihn anzusprechen. Bayard zückt seinen Dienstausweis. Auch er kennt dessen Wirkung. Foucault hält einen Augenblick inne, betrachtet den Ausweis, mustert den Polizisten und vertieft sich wieder in seine Papiere. Pathetisch, wie an das sich zerstreuende Auditorium gerichtet, sagt er: «Ich weigere mich, von der Staatsgewalt erkennungsdienstlich behandelt zu werden.» Bayard hat das überhört: «Es geht um den Unfall.»
Der große Kahle stopft seine Notizen in die Aktentasche und verlässt das Podium ohne ein Wort. Bayard läuft ihm nach: «Monsieur Foucault, wohin gehen Sie? Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen!» Foucault nimmt die Stufen des Hörsaals mit großen Sätzen. Ohne sich umzudrehen, ruft er in den Raum, sodass es alle noch anwesenden Hörer mitbekommen: «Ich weigere mich, von der Staatsgewalt ausfindig gemacht zu werden!» Lachen im Saal. Bayard fasst ihn am Arm: «Ich möchte nur, dass Sie mir den Vorfall aus Ihrer Sicht schildern.» Foucault bleibt stehen und redet nicht weiter, er ist am ganzen Körper erstarrt. Er blickt auf die Hand, die seinen Arm festhält, als ginge es um die schwerste Menschenrechtsverletzung seit dem Genozid in Kambodscha. Bayard lässt nicht locker. Gemurmel um sie herum. Nach einer langen Minute des Schweigens ist Foucault schließlich bereit zu sprechen: «Meiner Meinung nach hat man ihn umgebracht.» Bayard glaubt, nicht richtig verstanden zu haben:
«Umgebracht? Wen?»
«Meinen Freund Roland.»
«Aber er ist nicht tot!»
«Doch, er ist schon tot.»
Durch seine Brillengläser fixiert Foucault seinen Gesprächspartner mit dem durchdringenden Blick der Kurzsichtigen, und dann skandiert er, Silbe für Silbe, wie die Conclusio aus einer langen Herleitung, deren geheime Logik nur er selber kennt:
«Roland Barthes ist tot.»
«Aber wer hat ihn getötet?»
«Das System natürlich!»
Das Wort «System» bestätigt dem Polizisten, was er schon befürchtet hatte: Er ist unter die Linken geraten. Aus Erfahrung weiß er, dass sie immer nur davon reden: die verfaulte Gesellschaft, der Klassenkampf, das «System» … Ungeduldig wartet er, was jetzt noch kommt. Foucault lässt sich großmütig herab, es ihm zu erläutern:
«Roland wurde in den letzten Jahren heftig verspottet. Weil er die paradoxale Gabe hatte, die Dinge so zu verstehen, wie sie sind, und sie zugleich in einer nie gekannten Frische neu erstehen zu lassen, hat man ihm seinen Jargon zum Vorwurf gemacht, hat ihn nachgemacht, parodiert, karikiert, durch den Kakao gezogen.»
«Hatte er Feinde?»
«Natürlich! Seit er am Collège de France ist – ich habe ihn damals geholt –, sind die Eifersüchteleien immer schlimmer geworden. Feinde hatte er zur Genüge: die Reaktionäre, die Bourgeois, die Faschisten, die Stalinisten und vor allem, vor allem die ranzige Alt-Linke, die ihm nie verziehen hat!»
«Was denn verziehen?»
«Dass er es wagte, zu denken! Dass er es wagte, ihre bourgeoisen Schemata in Frage zu stellen, auf ihre scheußliche Normsetzung hinzuweisen, vor Augen zu führen, was sie in Wahrheit war: eine alte Hure, besudelt von Dummheit und Zugeständnissen.»
«Aber wen meinen Sie konkret?»
«Wollen Sie Namen? Für wen halten Sie mich? Die ganzen Picards, Pommiers, Rambauds, Burniers! Sie hätten ihn eigenhändig füsiliert, wenn sie gekonnt hätten, zwölf Kugeln im Hof der Sorbonne unter dem Victor-Hugo-Standbild!»
Plötzlich strebt Foucault weiter, und weil Bayard nicht damit gerechnet hatte, entkommt er ihm für ein paar Meter. Er verlässt den Hörsaal, huscht über die Treppen, Bayard läuft ihm nach, ist ihm auf den Fersen, ihre Schritte hallen auf dem Steinboden, er winkt ihn heran: «Monsieur Foucault, von welchen Herrschaften sprechen Sie?» Foucault erwidert, ohne sich umzudrehen: «Hunde, Schakale, gesattelte Esel, Deppen, Schwachköpfe, aber vor allem, vor allem, vor allem! Die willigen Erfüllungsgehilfen der bestehenden Ordnung, die Sachwalter der alten Welt, die Zuhälter eines schon lange toten Denkens, die uns mit obszönem Hohn noch dessen Leichengeruch nahebringen wollen.» Bayard hält sich am Treppengeländer fest: «Welche Leiche?» Foucault nimmt vier Stufen auf einmal: «Die Leiche des toten Denkens!» Dann bricht er in ein hämisches Lachen aus. Bayard sucht in den Taschen seines Regenmantels nach Schreibzeug und ist gleichzeitig bemüht, Schritt zu halten: «Können Sie mir bitte Rambaud buchstabieren?»
8
Der Kommissar betritt eine Buchhandlung. Er will Bücher kaufen, aber da er das nicht gewohnt ist, findet er sich schlecht in den Regalen zurecht. Er kann die Werke von Raymond Picard nicht finden. Der Buchhändler, der einen gut informierten Eindruck macht, lässt durchblicken, dass Raymond Picard tot ist – Foucault hatte es nicht für ratsam gehalten, das durchblicken zu lassen –, dass er aber Picards Neue Kritik oder neuer Betrug gern besorgen kann. Vorrätig hat er aber nur Ziemlich bestens entschlüsselt von René Pommier, einem Picard-Schüler, der den Strukturalismus angreift (jedenfalls verkauft ihm der Buchhändler das Buch mit diesem Argument, was ihn auch nicht viel weiter bringt), und natürlich das Buch Rolandbarthisch leicht gemacht von Rambaud und Burnier, ein grünes Bändchen, ziemlich dünn, außen drauf in einem orangefarbenen Oval ein Foto von Barthes mit strenger Miene. Aus dem Rahmen steigt ein Strichmännchen heraus, macht «hahaha» und zeigt breit lachend die Zähne, spöttisch, eine Hand vor dem Mund – wie von Robert Crumb gezeichnet. Nach Überprüfung: Es ist tatsächlich von Crumb. Aber Bayard hat nie etwas von Fritz the Cat gehört, dem achtundsechziger Animationsfilm, wo die Schwarzen saxophonspielende Raben sind und wo der Held ein Kater mit Rollkragenpulli ist, der Joints raucht und in einem Cadillac wie in Kerouacs On the Road alles Lebendige vögelt vor dem Hintergrund von Straßenunruhen und brennenden Mülltonnen. Crumb ist bekannt für seine Art, Frauen zu zeichnen, mit dicken, mächtigen Schenkeln, mit Schultern wie Holzfäller, mit berstenden Brüsten und Pferdehintern. Bayard, der mit der Ästhetik des Comic wenig vertraut ist, stellt keine Verbindung her. Aber er kauft das Buch, und den Pommier gleich mit. Den Picard bestellt er nicht, denn für tote Autoren interessiert er sich in diesem Stadium der Ermittlungen nicht.
Der Kommissar setzt sich in ein Café, bestellt ein Bier, zündet sich eine Gitane an und schlägt Rolandbarthisch leicht gemacht auf. (Welches Café? Details sind wichtig, um die Atmosphäre wiederzugeben, nicht wahr? Ich denke, er ist im Sorbon, der Bar gegenüber des Champo, dem kleinen Filmkunstkino am Ende der Rue des Écoles, aber um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung – setzen Sie ihn, wohin Sie wollen.) Er liest:
Das R.B. (Abkürzung für Roland Barthes und das Rolandbarthische) erscheint in seiner Urform vor einem Vierteljahrhundert, mit dem Buch Am Nullpunkt der Literatur. Seither hat es sich Stück für Stück vom Französischen entfernt, aus dem es partiell hervorgegangen war, und als selbständige Sprache etabliert, mit eigener Grammatik und eigenem Wortschatz.
Bayard zieht an seiner Gitane, trinkt einen Schluck und blättert. An der Bar hört er den Kellner einem Gast erklären, warum Frankreich im Bürgerkrieg versinken wird, falls Mitterrand gewählt wird.
Lektion 1: Einige Gesprächsbausteine.
1 – Wie bringst du dich zum Ausdruck?
Hochsprachlich: Wie heißen Sie?
2 – Ich drücke mich aus als L.
Hochsprachlich: Ich heiße William.
Bayard versteht die satirische Absicht einigermaßen und auch, dass er eigentlich auf einer Wellenlänge mit den Autoren der Parodie sein müsste, aber er bleibt wachsam. Warum heißt «William» auf Rolandbarthisch «L.»? Höchst undurchsichtig. Leckt mich am Arsch, ihr Klugscheißer.
Der Kellner zum Gast: «Wenn die Kommunisten erst an der Macht sind, gehen alle, die Kohle haben, außer Landes, in die Steueroasen, wo sie sicher sein können, dass man ihnen nichts abknöpft!»
Rambaud und Burnier:
3 – Welche «Regelung» verriegelt, umschließt, organisiert, ordnet die Ökonomie deines Pragmas als Bedeckung und/oder Ausbeutung deiner Ek-sistenz?
Hochsprachlich: Was machen Sie beruflich?
4 – (Ich) bringe Codierungsteilchen hervor.
Hochsprachlich: Ich bin Stenotypistin.
Da muss Bayard doch ein bisschen lachen, aber er kann das Zeug nicht leiden, weil er es spontan als einen gegen ihn gerichteten verbalen Einschüchterungsversuch auffasst. Natürlich weiß er, dass sich diese Art Bücher nicht an ihn richten, dass es ein Buch für die Klugscheißer ist, damit diese Brotfresser von Intellektuellen untereinander was zu lachen haben. Sich über sich selber lustig machen: das Höchste des Elitären. Bayard, der kein Dummkopf ist, macht schon ein wenig auf Bourdieu, ohne es selber zu ahnen.
Am Tresen geht die Belehrung weiter: «Wenn das ganze Geld erst mal in der Schweiz ist, fehlen hier die Mittel, um die Löhne zu zahlen, und dann haben wir Bürgerkrieg. Und die Sozialisten-Kommunisten haben gewonnen!» Der Kellner bricht ab, um zu bedienen. Bayard liest weiter:
5 – Mein Diskurs findet/vollendet die ihm eigene Textualität durchs Rolandbarthische in meinem Spie(ge)lbild.
Hochsprachlich: Ich spreche fließend Rolandbarthisch.
Bayard begreift die Grundidee: Roland Barthes’ Sprache ist unverständlich. Warum aber vertut man seine Zeit damit, ihn zu lesen? Und erst recht damit, ein Buch über ihn zu schreiben?
6 – Dessen «Sublimierung» (Integrierung) als (mein) Code stellt den «dritten Schnitt» einer Verdoppelung meiner Cupido, meines Begehrens dar.
Hochsprachlich: Ich würde diese Sprache auch gerne lernen.
7 – Kommt das Rolandbarthische, als Wortschwall betrachtet, nicht allzu sehr wie eine «Verstacheldrahtlichung» daher, jenseits des Gelände(r)s hochsprachlicher Durchdringung?
Hochsprachlich: Ist Rolandbarthisch nicht zu schwer für einen Franzosen?
8 – Die Schlinge des barthischen Stils «legt» sich um den Code insofern, als man innerhalb ihrer Wiederholung/Wiederholtheit agiert.
Hochsprachlich: Nein, es ist ganz leicht. Man muss nur dranbleiben.
Die Ratlosigkeit des Kommissars wird größer. Er weiß nicht, wen er mehr verachtet: Barthes oder die zwei Witzbolde, die ihren Spaß daran hatten, ihn zu parodieren. Er legt das Buch zur Seite, drückt seine Zigarette aus. Der Kellner geht wieder hinter den Tresen. Der Gast, ein Glas Rotwein in der Hand, gibt nun zu bedenken: «Ja, aber Mitterrand macht an der Grenze halt. Und dann wird das Geld eingezogen.» Der Kellner runzelt die Stirn und weist seinen Gast zurecht: «Halten Sie die reichen Leute nicht für Dummköpfe! Die engagieren berufsmäßige Gepäckträger. Die organisieren Kanäle, um ihr Geld wegzuschaffen. Die überwinden die Alpen und die Pyrenäen, wie Hannibal! Wie im Krieg! Wenn man Juden rüberschaffen konnte, kann man auch Talibane rüberschaffen – oder?» Da ist sich der Gast nicht so sicher, aber weil ihm offenkundig keine Antwort einfällt, zuckt er nur die Achseln, trinkt aus und bestellt noch ein Glas. Der Kellner greift zu einer offenen Flasche Rotwein und holt tief Luft: «Ja, natürlich, mir kann es egal sein, wenn die Roten die Macht übernehmen, dann hau ich ab und maloche in Genf. Die kriegen nichts von meiner Kohle, nie und nimmer, ich arbeite nicht für die Roten, verstehen Sie, für niemanden arbeite ich! Ich bin frei! Frei wie de Gaulle!»
Bayard versucht sich in Erinnerung zu rufen, wer schnell noch mal Hannibal war, und registriert unbewusst, dass dem Kellner am linken kleinen Finger ein Glied fehlt. Er unterbricht den Schwadroneur, um noch ein Bier zu ordern, schlägt das Buch von René Pommier auf, zählt auf vier Seiten siebzehnmal das Wort «Nichtigkeiten» und klappt das Buch wieder zu. Der Kellner hat inzwischen ein neues Thema angeschnitten: «Keine zivilisierte Gesellschaft kommt ohne die Todesstrafe aus!» Bayard zahlt und lässt das Wechselgeld liegen.
Er kommt am Montaigne-Denkmal vorbei und würdigt es keines Blickes, überquert die Rue des Écoles und betritt das Rektorat der Sorbonne. Kommissar Bayard begreift, dass er nichts – oder jedenfalls nicht viel – von all diesem Quatsch begreift. Er bräuchte jemanden, der ihn ins Bild setzt, einen Spezialisten, einen Übersetzer, einen Übertrager, einen Ausbilder. Na ja, einen Professor eben. Er fragt nach der Fakultät für Semiotik. Pikiert erwidert die Dame am Empfang, dass es das nicht gibt. Im Hof spricht er Studenten in blauen Trenchcoats und Segelschuhen an, ob sie ihm sagen können, wo er hier eine Semiotik-Vorlesung hören kann. Die meisten wissen gar nicht, was das ist, oder haben nur eine ungefähre Ahnung. Schließlich sagt ihm ein junger Wuschelkopf, der unter der Louis-Pasteur-Statue einen Joint raucht, dass man für die «Semio» nach Vincennes muss. Bayard ist kein Kenner der universitären Interna, aber so viel weiß er doch, dass Vincennes eine Fakultät von Linken ist, wo es nur so wimmelt von eingefleischten Agitatoren, die nichts arbeiten wollen. Aus Neugier fragt er den Jungen, warum er nicht dort eingeschrieben ist. Der Junge trägt einen weiten Rollkragenpulli, die schwarze Hose hochgekrempelt, als wäre er auf dem Weg zur Muschelernte, und hohe violette Doc Martens. Er nimmt einen Zug von seinem Joint und erwidert: «Da hab ich zweimal das Grundstudium gemacht. Aber in einer trotzkistischen Gruppe.» Dies hält er für eine hinreichende Erklärung, und erst als er an Bayards fragendem Blick sieht, dass es das nicht ist, schiebt er noch nach: «Und, äh, es gab Probleme.»
Bayard fragt nicht weiter. Er geht zu seinem Peugeot und fährt Richtung Vincennes. An einer Ampel sieht er einen schwarzen Citroën DS und denkt: Déesse, die Göttin – das war noch ein richtiges Auto!
10
«Heute wollen wir uns mit den Ziffern und Schriftzeichen bei James Bond beschäftigen. Wenn Sie an James Bond denken, welcher Buchstabe kommt Ihnen da in den Sinn?» Schweigen im Hörsaal, die Studenten überlegen. Bayard, der in der letzten Reihe sitzt, kennt wenigstens seinen James Bond. «Wie heißt der Chef von James Bond?» Bayard weiß es! Er ertappt sich dabei, es laut zu sagen, aber es kommen ihm ein paar Studenten zuvor, die gleichzeitig antworten: «M.» – «Wer ist M, und warum M? Was bedeutet dieses M?» Wieder erst mal keine Antwort. «M ist alt, meistens eine weibliche Figur, es ist das M von mother, der treusorgenden Mutter, die ernährt und beschützt, die sich ärgert, wenn Bond Dummheiten macht, die ihm gegenüber aber immer größte Nachsicht an den Tag legt – und die Frau, der er gefallen möchte, indem er seine Aufträge gut ausführt. James Bond ist ein Mann der Tat, aber er ist kein Freischärler, kein Einzelkämpfer. Er ist kein Waisenknabe (biographisch schon, aber nicht im übertragenen Sinn: Seine Mutter ist England; er ist nicht mit seinem Vaterland verheiratet, sondern dessen geliebter Sohn). Unterstützt wird er durch eine Hierarchie, eine Logistik, ein ganzes Land, das ihn vor unlösbare Aufgaben stellt, die er zu dessen großem Stolz bewältigt (M, metonymisch für England, Vertreter der Königin, erinnert immer wieder daran, dass Bond ihr bester Agent ist: der Lieblingssohn), aber sein Land stellt ihm auch alle Hilfsmittel bereit, um diese Aufgaben zu bewältigen. James Bond ist zugleich das Brötchen und der Groschen dafür, und deswegen ist er so ein populäres Fantasma, ein so mächtiger Volksmythos: James Bond – Abenteurer und Beamter, action und Absicherung. Er begeht Regelverletzungen, Delikte, sogar Verbrechen – aber er ist gedeckt, autorisiert, er bekommt keine Schelte, es ist die berühmte license to kill, die Erlaubnis zum Töten, eingeschrieben in seine Matrikelnummer, die drei magischen Ziffern: 007.
Zweimal die Null, das ist der Code für das Recht zum Mord, und hier haben wir ein geniales Beispiel für Zahlensymbolik. Wie könnte man das Recht zu töten durch eine Ziffer wiedergeben? 10? 20? 100? Eine Million? Der Tod ist nicht quantifizierbar. Der Tod ist das Nichts, und das Nichts ist Null. Aber der Mord ist mehr als der einfache Tod, er ist der Tod, der dem Anderen zugefügt wird. Er ist zweimal Tod, der eigene, unvermeidliche Tod, dessen Wahrscheinlichkeit mit der Gefährlichkeit des Berufs zunimmt (die Lebenserwartung von Doppelnullagenten ist sehr niedrig, darauf wird oft hingewiesen), und der Tod des Anderen. Die Doppelnull ist das Recht, zu töten und getötet zu werden. Und die 7? Sie wurde zweifellos gewählt, weil sie, wohl die eleganteste von allen Ziffern, eine magische Zahl ist, mit Geschichte und Symbolik beladen, aber auch weil sie offensichtlich zwei Kriterien erfüllt: Sie ist eine ungerade Zahl, wie die Anzahl Rosen, die man einer Frau schenkt, und sie ist eine Primzahl (teilbar nur durch eins und durch sich selbst), was die Einzigartigkeit, die Einmaligkeit, die Individualität ausdrückt, die den Eindruck vom Austauschbaren und Unpersönlichen durchkreuzen, die die Reduktion auf eine Matrikelnummer nahelegt. Erinnern Sie sich an die Serie Nummer 6, wo der Held verzweifelt und empört ausruft: ‹Ich bin keine Nummer!›? James Bond aber passt sich seiner Nummer perfekt an, und das umso leichter, als diese Nummer ihm unerhörte Privilegien verschafft und ihn damit zum Aristokraten macht (im Dienst der Queen, wie es sich gehört). 007 ist das Gegenteil von Nummer 6: Zufrieden mit dem höchst privilegierten Platz, den ihm die Gesellschaft zubilligt, setzt er sich mit Hingabe für den Erhalt der bestehenden Ordnung ein, ohne sich für die Motive des Feindes zu interessieren. Sosehr Nummer 6 ein Revolutionär ist, sosehr ist 007 ein Konservativer. Die reaktionäre 7 steht der revolutionären 6 gegenüber, und so wie das Wort ‹reaktionär› eine Nachfolgegeneration impliziert (die Konservativen ‹reagieren› auf die Revolution, indem sie auf eine Restauration des Ancien Régime, also der bestehenden Ordnung hinarbeiten), ist es nur folgerichtig, dass die Zahl der Reaktion auf die Zahl der Revolution folgt (und nicht umgekehrt: James Bond wäre niemals 005). Die Funktion der 007 ist also, die Rückkehr zur bestehenden Ordnung zu gewährleisten, die gestört ist durch eine Bedrohung, die die Weltordnung destabilisiert. Übrigens fällt das Ende jeder Epoche zusammen mit einer Rückkehr zum ‹Normalen›, will sagen: zur ‹vormaligen Ordnung›. Umberto Eco behauptet, James Bond sei ein Faschist. Aber wir werden sehen, dass er eher ein Reaktionär ist …»
Ein Student meldet sich zu Wort: «Aber es gibt doch auch Q, der für die Waffen verantwortlich ist. Sehen Sie auch in diesem Buchstaben eine Bedeutung?»
Wie aus der Pistole geschossen antwortet der Dozent, Bayard ist beeindruckt:
«Q ist eine väterliche Figur, denn er versorgt James Bond mit Waffen und erklärt ihm, wie man sie benutzt. Er übermittelt ihm Knowhow. So betrachtet, hätte er F heißen müssen, F wie father … Aber wenn Sie die Szenen mit Q aufmerksam ansehen – was fällt Ihnen auf? Ein geistesabwesender, hochfahrender James Bond, der nicht zuhört (oder so tut, als ob er nicht zuhöre). Und am Ende kommt Q mit seiner Floskel «Noch Fragen?» (oder Varianten im Sinne von «Haben Sie verstanden?»). Doch James Bond hat nie irgendwelche Fragen. Hinter der Maske des Desinteressierten hat er vollständig begriffen, was man ihm erklärt hat, denn seine Auffassungsgabe ist außergewöhnlich. Q ist also der Q der questions, der Fragen, die Q heraufbeschwört und die Bond nie stellt, oder allenfalls als Scherze, jedenfalls nie die, die Q erwartet hätte.»
Jetzt ergreift ein anderer Student das Wort: «Auf Englisch spricht sich Q als ‹kju› aus, das heißt queue, Schlange. Wie beim Einkaufen: Man steht im Waffengeschäft Schlange, und bis man an der Reihe ist, gibt es einen toten Zeitspielraum zwischen zwei action-Szenen.»
Der junge Prof macht eine begeisterte Geste: «Ganz genau! Sehr gut beobachtet! Sehr gute Idee. Denken Sie immer daran, dass keine Interpretation je ein Zeichen erschöpfend deutet, Polysemie ist ein unendlich tiefer Brunnen, aus dem uns unendliche Echos entgegenhallen: Ein Wort ist unerschöpflich, sogar ein Buchstabe, nicht wahr?»
Der Prof schaut auf die Uhr: «Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächsten Dienstag behandeln wir die Kleidung von James Bond. Meine Herren, ich erwarte Sie natürlich im Smoking (Gelächter im Hörsaal). Und meine Damen, im Bikini wie Ursula Andress (Pfiffe und Protest der Mädchen). Bis nächste Woche!»
Während die Studenten den Hörsaal verlassen, geht Bayard auf den jungen Dozenten zu, mit einem verhaltenen Lächeln, das dieser nicht ganz versteht, das aber in etwa bedeutet: «Das hast du dem Kahlkopf zu verdanken.»
11
«Um das klarzustellen, Herr Kommissar, ich bin kein Barthes-Spezialist und auch nicht Semiotiker im engeren Sinn. Ich habe einen Hochschulabschluss in Literaturwissenschaft, habe über den historischen Roman gearbeitet, promoviere in Linguistik über Sprechakte und halte hier Übungen. Dieses Semester habe ich ein Seminar über die Semiotik des Bildes gehalten, voriges Jahr eine Einführungsveranstaltung in die Semiotik für Erstsemester. Ich habe ihnen die Grundlagen der Linguistik beigebracht, denn die ist die Basis der Semiotik, ich habe ihnen von Saussure und Jakobson erzählt, ein bisschen von Austin, ein bisschen von Searle, und dann haben wir vor allem über Barthes gearbeitet, weil das am leichtesten zugänglich ist und weil er oft Lehrbeispiele aus der Massenkultur nimmt, womit die Neugier der jungen Leute eher geweckt wird als mit, sagen wir, seinen Äußerungen über Racine oder Chateaubriand – denn es sind Studenten der Kommunikations-, nicht der Literaturwissenschaften. Mit Barthes konnte man lange über Beefsteak mit Pommes frites reden, über den neuesten Citroën, über James Bond – ein viel spielerischerer Zugang zur Analyse, und übrigens ist das ja die Definition der Semiotik: Sie ist ein Fach, das die Methoden der Literaturwissenschaft auf nichtliterarische Gegenstände anwendet.»
«Er ist nicht tot.»
«Wie meinen Sie?»
«Sie sagten ‹man konnte›, Sie sprechen von ihm in der Vergangenheit, als könnte man das heute nicht mehr.»
«Äh, nein, ich wollte damit etwas anderes sagen …»
Simon Herzog und Jacques Bayard gehen nebeneinander durch die Flure des Instituts. Der junge Dozent hält in der einen Hand seine Aktentasche, und mit der anderen umfasst er mühsam einen Papierstapel. Er schüttelt den Kopf, als ein Student ihm ein Flugblatt geben will, der Student behandelt ihn gleich als Faschisten, er antwortet mit einem schuldbewussten Lächeln und stellt gleich darauf gegenüber Bayard richtig:
«Selbst wenn er stirbt, kann man seine kritischen Methoden doch weiterhin anwenden, nicht wahr …»
«Wie kommen Sie auf die Idee, dass er sterben könnte? Ich habe Ihnen doch gar nichts von der Schwere der Verletzungen berichtet.»
«Nun, hm, ich vermute, man wird nicht für jeden Verkehrsunfall einen Kriminalbeamten schicken, daraus schließe ich, dass es ernst ist und dass die Umstände des Unfalls unklar sind.»
«Der Unfallhergang ist ziemlich klar, und der Zustand des Unfallopfers gibt keinen Anlass zur Beunruhigung.»
«Ach so? Da sehen Sie mich, äh, hocherfreut, Herr Kommissar …»
«Ich hatte Ihnen gar nicht gesagt, dass ich Kommissar bin.»
«Nicht? Ich dachte mir schon, dass Barthes berühmt genug ist, dass man ihm einen Kommissar schickt.»
«Von dem Typen hab ich gestern zum ersten Mal gehört.»
Der junge Doktorand schweigt, er wirkt verunsichert, Bayard ist zufrieden. Eine Studentin in Sandalen und Söckchen hält ihm ein Flugblatt entgegen, auf dem er liest: Warten auf Godard, Stück in einem Akt. Er steckt das Flugblatt in die Tasche und fragt Simon Herzog:
«Was wissen Sie von der Semiotik?»
«Äh, sagen wir, die Beschäftigung mit dem Leben der Zeichen innerhalb des sozialen Lebens?»
Bayard muss wieder an sein Rolandbarthisch leicht gemacht denken. Er beißt sich auf die Lippen.
«Und hochsprachlich?»
«Aber … so ist die Definition von Saussure …»
«Kennt dieser Sodürr Barthes?»
«Äh, nein, der ist schon lange tot. Er ist der Erfinder der Semiotik.»
«Ah, ich verstehe.»
Aber Bayard versteht nur Bahnhof. Die beiden gehen durch die Cafeteria. Das ist eine Art Schuppen, ziemlich heruntergekommen, die Luft gesättigt mit den Dünsten von Würstchen, Crêpes und Hasch. Ein schlaksiger Typ in lila Krokostiefeln steht auf dem Tisch. Die Fluppe im Mundwinkel, in der Hand ein Bier, hält er den jungen Leuten einen feierlichen Vortrag, und sie hören ihm mit leuchtenden Augen zu. Da Simon Herzog kein eigenes Arbeitszimmer hat, bittet er Bayard, hier Platz zu nehmen, und bietet ihm reflexartig eine Zigarette an. Bayard lehnt ab, holt eine Gitane aus der Tasche und knüpft neu an:
«Also ganz konkret: Wozu ist das gut, diese … Wissenschaft?»
«Also, äh … um die Realität zu begreifen.»
Bayard verzieht das Gesicht, fast unmerklich.
«Und das heißt?»
Der junge Doktorand denkt ein paar Sekunden nach. Er taxiert die Abstraktionsfähigkeit seines Gesprächspartners – offensichtlich ist sie eingeschränkt –, um seine Antwort daran anzupassen, sonst würden sie sich stundenlang im Kreis drehen.
«Eigentlich ganz einfach: In unserem Umfeld gibt es ganz viele Dinge, die, äh, eine Gebrauchsfunktion haben. Verstehen Sie?»
Abwehrendes Schweigen seines Gegenübers. Am anderen Ende des Raums erzählt der Typ mit den lila Stiefeln seinen Jüngern das Heldenepos von Achtundsechzig, das sich bei ihm wie eine Mischung aus Mad Max und Woodstock anhört. Simon Herzog versucht es mit noch mehr Vereinfachung: «Ein Stuhl ist zum drauf Sitzen, ein Tisch zum dran Essen, ein Schreibtisch zum Arbeiten, ein Kleidungsstück gegen das Frieren und so weiter. So weit klar?»
Eisiges Schweigen. Er fährt fort:
«Aber außer ihrer Gebrauchsfunk…, außer ihrem Nutzwert tragen diese Gegenstände auch noch einen Symbolwert in sich – sozusagen als könnten sie sprechen: Sie haben uns etwas zu erzählen. Der Stuhl da zum Beispiel, auf dem Sie sitzen, sein Nulldesign, der Lack vom Holz abgeplatzt, das Gestell verrostet, erzählt uns, dass wir hier in einer Umgebung sind, die sich nicht um Komfort und Ästhetik schert und wo kein Geld ist. Nimmt man die Vielzahl der Gerüche von schlechter Küche und Cannabis dazu, bestätigt uns das in der Annahme, dass wir an einer Universität sind. So ähnlich signalisiert die Art und Weise, wie Sie gekleidet sind, Ihren Beruf: Sie tragen einen Anzug, das verrät den leitenden Angestellten, aber Sie tragen keine Markenkleidung, das deutet auf ein bescheidenes Gehalt und/oder das Fehlen jeglichen Interesses für Ihre äußere Erscheinung – Sie üben demnach einen Beruf aus, bei dem es nicht oder kaum auf Repräsentation ankommt. Ihre Schuhe sind ziemlich mitgenommen, und da Sie mit dem Auto gekommen sind, bedeutet das, dass Sie nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern im Gelände arbeiten. Bei einem leitenden Angestellten, der aus jedem sich bietenden Anlass seinen Schreibtisch verlässt, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Inspektor.»
«Hm, ich verstehe», sagt Bayard. Es folgt ein langes Schweigen, während dessen Simon Herzog dem Lila-Krokostiefelmann zuhört, der seinem begeisterten Publikum erzählt, wie er damals als Anführer der Antispinoza-Fraktion die Anhänger der Junghegelianer fertiggemacht hat. «Jetzt weiß ich endlich, wo ich bin, wo ja schon am Eingang ein Schild ‹Université de Vincennes – Paris 8› steht. Und auf dem Kärtchen in den französischen Farben, das ich Ihnen zeigte, als ich Sie nach Ihrem Seminar ansprach, war groß und deutlich ‹Polizei› zu lesen. Ich verstehe immer noch nicht, worauf Sie hinauswollen.»
Simon Herzog kommt ins Schwitzen. Dieses Gespräch erinnert ihn an unangenehme Prüfungssituationen. Jetzt Ruhe bewahren, Konzentration, nicht darauf achten, wie die Sekunden des Schweigens vergehen, die verlogen-gutwillige Art des sadistischen Prüfers ignorieren, der seine institutionelle Überlegenheit auskostet und es genießt, das Opfer leiden zu lassen, weil er das in der Vergangenheit selber durchmachen musste. Der junge Doktorand überlegt rasch, beobachtet sein Gegenüber genau, geht methodisch vor, Schritt für Schritt, wie er es gelernt hat, und als er sich gerüstet fühlt, lässt er noch ein paar Sekunden verstreichen, bevor er antwortet:
«Sie haben am Algerienkrieg teilgenommen, Sie waren zweimal verheiratet, Sie haben sich von Ihrer zweiten Frau getrennt, Sie haben eine Tochter, die noch nicht zwanzig ist und zu der Sie ein schwieriges Verhältnis haben, Sie haben bei der vorigen Präsidentschaftswahl in beiden Wahlgängen für Giscard gestimmt, und Sie werden bei der nächsten wieder konservativ wählen, Sie haben einen Kollegen in Ausübung seines Dienstes verloren, vielleicht durch Ihr Verschulden, jedenfalls machen Sie sich Vorwürfe deshalb und sind darüber nicht mit sich im Reinen, aber Ihre Vorgesetzten sind zu der Einschätzung gelangt, dass es nicht im Bereich Ihrer Verantwortung lag. Und Sie haben den neusten James Bond im Kino gesehen, obwohl Sie eigentlich einen guten Maigret im Fernsehen oder die Filme mit Lino Ventura vorziehen.»
Langes, sehr langes Schweigen. Am anderen Ende des Raumes erzählt der Spinoza-Wiedergänger unter den Beifallrufen der Menge, wie er und seine Leute die Fourier Rose abserviert haben. Bayard murmelt tonlos:
«Woher wissen Sie das alles?»
«Nun, ganz einfach!» Wieder Schweigen, aber diesmal vonseiten des jungen Dozenten. Bayard rührt sich nicht, außer einem leichten Zittern in den Fingern der rechten Hand. Der Mann mit den lila Krokostiefeln stimmt a cappella ein Lied der Rolling Stones an. «Als Sie vorhin in meinem Hörsaal nach Ende der Veranstaltung zu mir kamen, drehten Sie sich sofort so, dass Sie weder die Tür noch das Fenster im Rücken hatten. Das lernt man nicht auf der Polizeischule, sondern beim Militär. Dass Ihnen dieser Reflex geblieben ist, ist ein Zeichen dafür, dass sich Ihre Militärerfahrung nicht auf den Wehrdienst beschränkt, sondern Sie hinreichend gezeichnet hat, dass Ihnen davon unbewusste Verhaltensweisen geblieben sind. Wahrscheinlich waren Sie also im Feld, und für den Indochinakrieg sind Sie nicht alt genug, deshalb vermute ich, dass Sie nach Algerien geschickt wurden. Sie sind bei der Polizei, also zweifellos ein Rechter, was auch Ihre