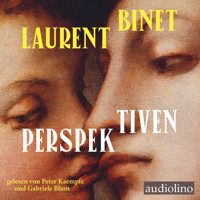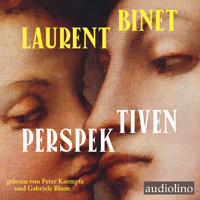19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der große Erfolgsroman aus Frankreich: Top-Ten-Bestseller, preisgekrönt, begeisterte Kritik. Ein toter Maler, ein gestohlenes Gemälde, Liebe, Intrigen und die ewige Suche nach der Wahrheit. Florenz im 16. Jahrhundert. Der Maler Jacopo da Pontormo wird tot aufgefunden, mit einem Meißel erstochen liegt er zu Füßen seines unvollendeten Freskos in der Kapelle von San Lorenzo. Anscheinend wurden Teile des Werks übermalt – warum und von wem? Kurz danach verschwindet ein Gemälde. Auch in ihm schienen gefährliche Botschaften verborgen. Vasari, Handlanger des Herzogs von Florenz und Kunstkenner, wird mit den Ermittlungen beauftragt.Die Situation erfordert Diskretion, künstlerisches Feingefühl und politisches Gespür. Denn Florenz ist ein Ort voller Intrigen und Geheimnisse. Ununterbrochen schwirren Briefe umher, jeder schreibt jedem über den sensationellen Fall. Ordensschwestern, Handwerker, die Medici und die großen Künstler der Renaissance: Jeder hat eine andere Perspektive auf das Geschehene. Aber was ist die Wahrheit? Wo ist das skandalöse Bild geblieben? Und vor allem: Wer hat Pontormo getötet? «Die Perspektive erlaubt es, die Unendlichkeit zu sehen, zu verstehen, zu empfinden, sagt Michelangelo bei Laurent Binet. Der Satz gilt auch für seinen virtuosen Roman, in dem die literarische Form zu Metaphysik wird.»L'Obs «Die große Stärke dieses Buches liegt darin, dass es eine comédie humaine ist. Eine mitreißende und sehr bereichernde Lektüre.» Libération «Ein ausgezeichnetes Buch!» Le Monde «In einer klassischen, lebendigen Sprache geschrieben, hochaktuell, ohne anbiedernd zu sein. Das kommt in diesem Jahr nicht häufig vor.» Figaro
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Laurent Binet
Perspektiven
Roman
Über dieses Buch
Ein toter Maler, ein gestohlenes Gemälde, Liebe, Intrigen und die ewige Suche nach der Wahrheit
Florenz im 16. Jahrhundert. Der Maler Jacopo da Pontormo wird tot aufgefunden, mit einem Meißel erstochen liegt er zu Füßen seines unvollendeten Freskos in der Kapelle von San Lorenzo. Anscheinend wurden Teile des Werks übermalt – warum und von wem? Kurz danach verschwindet ein Gemälde. Auch in ihm schienen gefährliche Botschaften verborgen. Vasari, Handlanger des Herzogs von Florenz und Kunstkenner, wird mit den Ermittlungen beauftragt.
Die Situation erfordert Diskretion, künstlerisches Feingefühl und politisches Gespür. Denn Florenz ist ein Ort voller Intrigen und Geheimnisse. Ununterbrochen schwirren Briefe umher, jeder schreibt jedem über den sensationellen Fall. Ordensschwestern, Handwerker, die Medici und die großen Künstler der Renaissance: Jeder hat eine andere Perspektive auf das Geschehene.
Aber was ist die Wahrheit? Wo ist das skandalöse Bild geblieben? Und vor allem: Wer hat Pontormo getötet?
«Die Perspektive erlaubt es, die Unendlichkeit zu sehen, zu verstehen, zu empfinden, sagt Michelangelo bei Laurent Binet. Der Satz gilt auch für seinen virtuosen Roman, in dem die literarische Form zu Metaphysik wird.»
L’OBS
Vita
Laurent Binet wurde 1972 in Paris geboren und hat in Prag Geschichte studiert. Sein erster Roman HHhH gewann den Prix Goncourt du Premier Roman und wurde von der New York Times zu den besten Büchern des Jahres 2012 gewählt. Die siebte Sprachfunktion wurde mit dem Prix Interallié und dem Prix du Roman Fnac ausgezeichnet. Für Eroberung erhielt Binet den Grand Prix de l’Académie française. Perspektiven gewann den Prix Naissance d’une œuvre und den Prix du roman historique. Seine Bücher werden in über 20 Sprachen übersetzt.
Kristian Wachinger studierte Germanistik und Romanistik in München, Nantes und Hamburg und war dreißig Jahre Verlagslektor. Er hat u.a. Giacomo Casanova, Prosper Mérimée, Émile Zola, Georges Simenon und die beiden vorherigen Romane von Laurent Binet übersetzt. Er lebt in Berlin.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel «Perspective(s)» bei Éditions Grasset & Fasquelle, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Perspective(s)» Copyright © 2019 by Les Editions Grasset & Fasquelle, Paris
Orhan Pamuk, Rot ist mein Name, Hanser Verlag, München/Wien 2001, übersetzt von Ingrid Iren
Karten auf den Vorsätzen © Peter Palm, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Rabatti & Domingie/akg-images
ISBN 978-3-644-01974-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Man möge aus meinen Worten und meinen Farben entdecken, wer ich bin.
Orhan Pamuk, Rot ist mein Name
Schwer sind die Zeiten für die Kunst.
Michelangelo, Brief an seinen Vater
Vorwort
Wenigstens wird man nicht von mir sagen können, ich sei verblendet.
Ich hatte feste Ansichten über Florenz und die Florentiner: vernünftige Leute, gute Manieren, höflich, sogar freundlich, jedoch bar jeden Gefühls, unfähig zum Tragischen und Verrückten. Ganz anders als Bologna, Rom oder Neapel! Warum wohl (dachte ich) ist Michelangelo aus seiner Heimat geflohen und nie mehr dorthin zurückgekehrt? Rom war, obwohl er es sein Leben lang geschmäht hat, die richtige Umgebung für ihn. Und die anderen? Dante, Petrarca, Leonardo da Vinci, Galilei! Alles Ausreißer und Exilanten. Florenz brachte Genies hervor und verjagte sie anschließend, es gelang nicht, sie zu halten, und so hatte die Stadt nach ihrem ruhmreichen Mittelalter ihren Glanz verloren. Ich wollte in die Zeiten der Guelfen und Ghibellinen eintauchen, doch wenig darüber hinaus, denn ich dachte, dass dort nach, sagen wir, 1492 mit dem Tod von Lorenzo il Magnifico alles vorbei war. Der Bußprediger Savonarola hatte nicht nur die Schönheit vernichtet, indem er Botticelli nötigte, seine Gemälde zu verbrennen. Er hatte auch jeglichen Sinn für das Ideal im Keim erstickt, indem er den Idealismus seinem bornierten Fanatismus unterwarf.
Nachdem Leonardo weg war und dann auch Michelangelo – was blieb? Oder besser: Wer blieb? Ich machte mir wenig aus Pontormo, Salviati, Cigoli, und Bronzino schien mir zu trocken und zu kühl, mit all der porzellanenen Haut und seinem harten Strich. Meiner Meinung nach hielt keiner dieser Manieristen dem Vergleich mit irgendwem aus der Bologneser Schule stand, und ich spottete über Vasari, der uns seine Florentiner Maler schmackhaft machen wollte. Hingegen verehrte ich Guido Reni, von dem ich fand, dass er es mit der Schönheit von allen am weitesten gebracht hatte. Den Florentinern gestand ich zu, dass sie zu zeichnen verstanden, aber ich warf ihnen ihren Mangel an Ausdruck vor. Alles war zu brav, zu glatt. Letztlich war mir jeder Niederländer lieber!
Na ja, ich gebe zu, ich lag falsch, und damit sich mir die Augen öffneten, mussten Umstände eintreten, von denen ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Denn sehen heißt denken. Der Betrachter muss sich auch als seines Bildes würdig erweisen. Ich war ein Dummkopf, und wenn ich das gewiss auch heute noch bin, so neige ich doch inzwischen dazu, Gerechtigkeit wenigstens derjenigen widerfahren zu lassen, die es wert ist: der Stadt Florenz. Sie war Mitte des 16. Jahrhunderts ein Tiegel, in dem die Leidenschaften brodelten, und zugleich ein Mutterboden, auf dem die Genies gediehen – und das eine erklärt natürlich das andere. Es geht allein um das Wie!
Nun machte ich vor ein paar Jahren eine Toskanareise, und als ich in Arezzo in einem Laden nach einem Mitbringsel für meine Freunde in Frankreich stöberte – und es sollte nicht gerade eine etruskische Kleinplastik sein –, bot mir ein einarmiger Antiquar ein Konvolut von alten vergilbten Briefen zum Kauf an. Ich beschnupperte das Bündel voller Misstrauen und verlangte, es durchblättern zu dürfen, um sicherzugehen, dass sie echt sind – er willigte ein. Nach dem dritten Brief zog ich mein Portemonnaie und kaufte das Paket zu einem stolzen Preis. Ich kenne mich in der Geschichte des 16. Jahrhunderts aus, und ich glaube, dass, so erstaunlich es einem vorkommen mag, alles, was in den Briefen steht, wahr ist. Ich ging wieder ins Hotel und las in einem Zug die Geschichte, die hier folgt.
Ja, es handelt sich wirklich um eine Geschichte, und wer auch immer es war, der mit viel Sorgfalt die Briefe geordnet hat, hat das richtig erkannt, als er diese archivarische Herkulesaufgabe bewältigte: Die Briefe bilden eine lesbare Einheit; bis zum Morgengrauen habe ich sie schier verschlungen, und am nächsten Morgen begann ich gleich nochmal von vorn. Erst dachte ich, eine Geschichte daraus zu machen, am Ende hatte ich verstanden, warum sie besser für sich stehen. Denn was darin zum Vorschein kommt, ist in so hohem Maße unerhört und vielschichtig, dass es den Historikern überlassen bleiben soll, es ganz zu ermessen. Nur das noch: Die Vorstellung, jeder durchlebe beim Lesen dieser Korrespondenz dieselben Gefühle wie ich, verlängert bei mir den Zustand von Erstaunen und Verstörung, in dem ich mich nach meiner ersten Lektüre befand. Ich glaube, allein daher rührte das zwingende Bedürfnis in mir, sie aus dem Toskanischen zu übersetzen.
Diese Übersetzung, die viel Sorgfalt erforderte, hat ganze drei Jahre meines Lebens in Anspruch genommen. Am Ziel angekommen, neige ich zu der Auffassung, dass meine Kenntnisse der italienischen Sprache und Geschichte mir wohl erlaubt haben, den Geist, ja auch den Stil jener Schreibenden getreulich wiederzugeben. Gleichwohl mögen die Leser, wenn sie Fehler finden oder sich an einer banalen Formulierung stoßen, die Güte haben zu bedenken, dass sie möglicherweise nicht mir zuzurechnen oder gar beabsichtigt sind, denn es ging ja auch darum, heute einen Briefwechsel aus dem 16. Jahrhundert zugänglich zu machen, einer fernen, leider kaum noch vertrauten Epoche. Aus Gründen der Bequemlichkeit habe ich die Jahreszahlen geändert und unserem, dem gregorianischen Kalender angepasst: So habe ich bei einem Brief, der mit Januar oder Februar 1556 datiert ist, die Jahreszahl berichtigt auf 1557, denn in Florenz begann damals das neue Jahr am 25. März. Dagegen habe ich weitgehend auf Fußnoten verzichtet, die zwar den Vorteil haben, die umfangreichen Kenntnisse des Herausgebers zur Geltung zu bringen, aber den Nachteil, die Leser in ihre Gegenwart zurückzuholen. Es genügt zu wissen, dass die Geschichte in Florenz spielt, zur Zeit des elften und letzten Italienkrieges.
Allerdings erkläre ich mich – aus tief empfundener Großherzigkeit und obwohl die Versuchung groß ist, Sie ins kalte Wasser springen zu lassen, ohne Sie zuvor schwimmen gelehrt zu haben – bereit, Ihnen eine Liste der Briefschreiber, fast hätte ich gesagt, der dramatis personae, zu erstellen, um Ihnen die Lektüre zu erleichtern, die sich Ihnen, wie ich hoffe, als ein großes Gemälde darstellt, oder genauer, als das Fresko an der Wand einer Kirche in Italien.
B.
Liste der Briefschreiber
Herzog von Florenz, aus der jüngeren Linie der Medici, 1537 durch Zufall an die Macht gekommen, nachdem Alessandro de’ Medici von seinem entfernten Verwandten Lorenzino, genannt Lorenzaccio, ermordet worden war.
Eleonora di Toledo:Herzogin von Florenz, Nichte von Fernando Álvarez de Toledo, Herzog von Alba, Vizekönig von Neapel im Krieg gegen Frankreich und Rom, in Diensten von Kaiser Karl V. und dessen Sohn Philipp II., König von Spanien.
Maria de’ Medici:Die älteste Tochter des Herzogs und der Herzogin.
Catherine de Médicis:Königin von Frankreich, Gattin von Heinrich II., legitime Erbin des Herzogtums Florenz.
Piero Strozzi:Marschall von Frankreich, Cousin von Catherine, Sohn des Republikaners Filippo Strozzi, den Cosimo umgebracht hatte, Anführer der fuorusciti (so bezeichnete man die Exilflorentiner), Cosimos Feind und Rivale um die Herrschaft über die Toskana.
Giorgio Vasari:Maler und Architekt, Autor der Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten (Viten), enger Berater Cosimos, von dem er immer mehr Aufträge erhält, darunter die gewaltige Aufgabe der Renovierung des Palazzo Vecchio.
Vincenzo Borghini:Historiker, Humanist, Vorsteher des Waisenhauses Ospedale degli Innocenti, eng befreundet mit Vasari, dem er bei der Abfassung des zweiten Bandes der Viten hilft.
Michelangelo Buonarroti:Bildhauer, Maler, Architekt und Dichter, beauftragt mit der Vollendung des Petersdoms in Rom.
Agnolo Bronzino:Maler, Schüler und enger Freund von Pontormo, offizieller Porträtist der Familie Medici.
Sandro Allori:Maler, Schüler und Gehilfe von Bronzino.
Giovanni Battista Naldini:Maler, Schüler und Gehilfe von Pontormo.
Schwester Plautilla Nelli:Vorsteherin des Dominikanerklosters Santa Caterina di Siena in Florenz, Malerin, beeinflusst von den Lehren des Geistlichen Girolamo Savonarola.
Schwester Caterina de’ Ricci:Vorsteherin des Klosters in Prato, überzeugte Savonarola-Anhängerin, saß ihrer Freundin Plautilla Modell.
Schwester Petronilla Nelli:Plautillas Schwester.
Benvenuto Cellini:Goldschmied, Bildhauer und Abenteurer, schuf die Bronzestatue Perseus, die neben Michelangelos David auf dem Vorplatz des Palazzo Vecchio in Florenz steht.
Malatesta de Malatesti:Ein Page des Herzogs von Florenz.
Marco Moro:Handwerker, Farbmischer in Pontormos Diensten.
Ercole d’Este:Herzog von Ferrara, Vater des finsteren Alfonso d’Este, der später Robert Browning zu seinem berühmten Gedicht My Last Duchess inspirieren wird.
Giovanni Battista Schizzi:Regent des Herzogtums Mailand.
Paul IV.:Papst seit 1555, aus der großen neapolitanischen Familie der Carafa, die vormals an der Spitze der römischen Inquisition standen. Erbitterter Feind von Protestanten, Juden, Künstlern und Büchern (schuf den Index librorum prohibitorum). Mit Frankreich verbündet gegen Spanien. Seine auf die Spitze getriebene Vetternwirtschaft begünstigte den Aufstieg seiner Neffen, des Herzogs von Paliano und von dessen Bruder, dem Kardinal Carlo Carafa, zwei Widerlingen, deren Geschichte ich vielleicht ein andermal erzähle.
Jacopo da Pontormo:Maler.
Ich wurde noch darauf hingewiesen, dass ich auch all jene erwähnen sollte, die zwar keinen Brief geschrieben oder empfangen haben, aber in den folgenden Briefen auftreten. Meiner Meinung nach hieße das die Intelligenz der Leserinnen und Leser beleidigen; schließlich sind sie keine Kinder mehr, die man an die Hand nehmen muss. Hatte ich etwa ein Personenverzeichnis zur Hand, als ich die Briefe las? Sei’s drum. Erwähnen wir hier noch Bacchiacca, den alten Maler, der sich auf das Verzieren von Mobiliar und die Innenausstattung von Zimmern spezialisierte; Pier Francesco Riccio, erst Cosimos Lehrer, dann sein Sekretär und Majordomus, zuletzt von seinen Aufgaben entbunden und wegen mentaler Störungen seit 1553 im Irrenhaus untergebracht; Benedetto Varchi, vormaliger Republikaner, der zum Hofberichterstatter wurde, die berühmte Paragone über den Wettstreit der Künste verfasste und in gewisser Hinsicht für Cosimo das war, was Angelo Poliziano für Lorenzo il Magnifico[1] war. Doch nun genug. Vorhang auf, Bühne frei: Florenz 1557.
1. Maria de’ Medici an Catherine de Médicis, Königin von Frankreich
Mein Vater würde mich umbringen, wenn er erführe, dass ich Euch schreibe. Aber wie käme ich dazu, Eurer Hoheit einen dermaßen unschuldigen Gefallen zu verweigern? Er ist mein Vater, aber seid Ihr nicht meine Tante? Was habe ich mit Euern Streitereien zu tun, mit Euerm Strozzi, mit Eurer Politik? Um die Wahrheit zu sagen: Euer Brief hat mir eine Freude gemacht, das könnt Ihr Euch gar nicht vorstellen. Wie bitte? Die Königin von Frankreich bettelt, ich möge ihr Unterhaltsames aus ihrer Heimatstadt berichten, und bietet mir als Gegengabe ihre Freundschaft? Welch schöneres Geschenk könnte der Himmel einer vereinsamten Seele wie der armen Maria machen, die nur von Kindern und Bediensteten umgeben ist? Meine kleinen Brüder sind zu sehr damit beschäftigt, die Prinzen zu geben, meine kleinen Schwestern schwören, sie werden niemals irgendwen heiraten, denn es gebe keine Partie, die sich ihrer würdig erweisen könne – und sei es der Sohn des Kaisers! –, und hier im kalten Gemäuer dieses alten Palazzo bekomme ich sehr wohl mit, wie meine Mutter mit meinem Vater Pläne schmiedet, ohne ein Wort zu mir, so dass die einzige Gewissheit, zu der ich gelange, darin besteht, dass man über meine Verheiratung nachdenkt. Mit wem wohl? Niemand hat es bis jetzt für nötig gehalten, mich darüber aufzuklären. Doch schon missbrauche ich Eure Freundschaft – also genug von mir!
Stellt Euch vor, liebe Tante, in Florenz hat sich ein entsetzliches Drama abgespielt. Vielleicht erinnert Ihr Euch noch an den Maler Pontormo, denn unter all den Künstlern, an denen unser Vaterland so reich ist, war er wohl einer der berühmtesten zu der Zeit, als Ihr Italien noch nicht in Richtung Frankreich verlassen hattet auf dem Weg zu Eurer königlichen Bestimmung. Stellt Euch vor, er wurde in der großen Kapelle von San Lorenzo tot aufgefunden, genau dort, wo er seit undenklichen Zeiten – seit elf Jahren! – gearbeitet hatte. Es heißt, er habe sich das Leben genommen, weil er mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Ich war ihm ein paarmal im Haus seines Freundes Bronzino begegnet: Da wirkte er wie einer dieser alten Narren, die nur noch in ihren Bart murmeln. Gleichviel, es ist sehr traurig.
Zum Glück habe ich nicht nur derlei Tragisches zu berichten, allerdings sonst wohl kaum etwas, das Euch überraschen wird: Wie Ihr wisst, beginnen die Vorbereitungen für Karneval von Jahr zu Jahr früher, so dass schon jetzt die Plätze der Stadt voll von Handwerkern sind, die Bühnen errichten, während in den Häusern die Schneiderinnen ihrer Arbeit nachgehen. Ihr werdet mich frivol finden, wenn ich Euch gestehe, dass es mir gefällt, wie Florenz sich in Festgewänder kleidet, aber was kann ich dafür? Diese Geschäftigkeit stimmt mich fröhlich, und sonst habe ich ja nicht viel Zerstreuung, außer Modell sitzen für eines der unzähligen Porträts, die mein Vater bei Bronzino von all seinen Angehörigen, tot oder lebend, in Auftrag gegeben hat. Stundenlang stillsitzen: Das macht so richtig Spaß, aber wem sag ich das.
Der Sohn des Herzogs von Ferrara, Alfonso d’Este, den Ihr vielleicht in Frankreich kennengelernt habt, denn er hat mir erzählt, er habe in Flandern an der Seite Eures Gatten gekämpft, ist diese Woche gekommen, um meinem Vater seine Aufwartung zu machen, und der möchte unbedingt, dass ich ihn treffe. Es heißt, er sei ein finsterer Geselle, oh Schreck! Jetzt ruft Mama nach mir. Ich küsse Euch die Hände mit der Inbrunst einer neu gewonnenen Freundin. Wie es Euer Wunsch war, habe ich Euern Brief verbrannt, und ich werde Eure Anweisungen befolgen, um Euch den meinen unbemerkt zukommen zu lassen. Wie schade, dass Ihr Euch über meinen Vater ärgern musstet! Aber ich bin zuversichtlich, dass dieser Zwist vorübergeht und Ihr bald Eure Familie besuchen kommt und Euer geliebtes Florenz wiederseht. Wer weiß, ob Bronzino nicht auch Euch porträtieren soll?
2. Giorgio Vasari an Michelangelo Buonarroti
Diesmal, verehrter Meister, schreibe ich Euch nicht auf Bitten des Herzogs, um Euch anzuflehen, Ihr möget nach Florenz zurückkehren. Ach, etwas ganz anderes nötigt mich, Eure Tage in Rom zu trüben, von denen ich doch weiß, wie sehr sie mit Euern bewunderungswürdigen Arbeiten ausgefüllt sind und mit den zahllosen Widrigkeiten, denen sich Eure Kunst tagtäglich gegenübersieht, vor allem seit der Wahl unseres neuen päpstlichen Herrschers, der – im Gegensatz zu seinen Vorgängern – so wenig geneigt scheint, die Schönheiten des Altertums oder der Gegenwart zu schätzen.
Erinnert Ihr Euch noch daran, wie ich Euch vor fünfzehn Jahren über all das zu Rate zog? Ihr hattet damals die Güte, mir Euern Rat zuteilwerden zu lassen, und daraufhin widmete ich mich erneut, planvoller und mit mehr Erfolg als zuvor, dem Studium der Architektur, was ich ohne Euch wahrscheinlich nie getan hätte. Auch heute noch muss ich nach Plan vorgehen, wenn auch auf ganz anderem Gebiet. Hat mir doch der Herzog die Ehre erwiesen und sein Vertrauen geschenkt, indem er mir einen gleichermaßen heiklen und ungewöhnlichen Auftrag erteilt hat.
Jacopo da Pontormo, dessen Begabung Ihr ja schon erkannt habt, als er noch ein Kind war, lebt nicht mehr. Er wurde tot aufgefunden in der Kapelle von San Lorenzo, zu Füßen seiner berühmten Fresken, die er mit einem Bretterverschlag vor neugierigen Blicken verbarg. Allein schon diese Nachricht hätte mich dazu bewogen, Euch zu schreiben, denn einer musste Euch ja von dem schrecklichen Unglück erzählen. Aber die Umstände seines Todes verlangen erst recht, dass ich mich an Euch wende.
Denn da seiner Leiche ein Meißel im Herzen steckte, direkt unter dem Brustbein, war die Hypothese eines Unfalls schwer aufrechtzuerhalten. So hat mir der Herzog den Auftrag gegeben, Licht in die unselige Geschichte zu bringen, bei der es erhebliche dunkle Stellen gibt, wie Ihr selber erkennen werdet, wenn ich Euch sage, dass Jacopos Leiche außer dem todbringenden Meißel Male von stumpfer Gewalt am Kopf zeigte, zugefügt mit einem Hammer, der am Fußboden der Kirche zwischen seinem übrigen Werkzeug gefunden wurde. Der arme Jacopo lag auf dem Rücken, vor seinem Sintflut-Fresko, an dem er, wie aus den Spuren frischer Farbe zu schließen war, kurz vor seinem Tod einen Teil übermalt und dabei einen sichtbaren Übergang in Kauf genommen hatte: Ihr wisst so gut wie ich, dass Jacopo gleichermaßen bedächtig und anspruchsvoll in seiner Arbeit vorging und dass er laufend nachbesserte, doch diese Retusche an einem kleinen Stück Wand, die unvermeidlich den Übergang erkennbar ließ an einer Stelle, wo er mitten durch eine Figur ging, hat mich denn doch überrascht. So wie ich ihn kannte, hätte ich angenommen, dass er das ganze Wandfeld neu malt, wenn er auch nur mit einem winzigen Abschnitt nicht zufrieden ist.
Damit aber nicht genug der Ungereimtheiten in der ganzen Geschichte. Nachdem die Leiche entdeckt worden war, begab man sich in Jacopos Wohnung in der Via Laura, eine Art Scheune, die über eine Leiter zu erreichen ist. Und dort fand sich zwischen unzähligen Zeichnungen, Skizzen und Modellen, die in seinem Atelier lagerten, ein Gemälde, das Ihr nur zu gut kennt, denn Ihr habt seinerzeit das Vorbild dafür gezeichnet: Ihr werdet Euch wohl an Venus und Cupido erinnern, das mit seiner Beliebtheit ganz Europa zu Nachahmungen angeregt hat – vielleicht wisst Ihr, dass auch ich das Glück hatte, einige davon ins Werk zu setzen, die zwar in keiner Weise an die von Pontormo heranreichen, aber doch Gefallen fanden, denn alles, was sich von Euern Zeichnungen herleitet, wird unweigerlich die Spur Eures göttlichen Ingeniums tragen. Wie weit liegt doch die Zeit zurück, bevor die Inquisition wieder da war, als Kardinal Carafa noch nicht Paul IV. geworden war und wo Aktgemälde noch nicht in Ungnade gefallen, sondern im Gegenteil besonders gefragt waren. Natürlich käme heute niemand auf die Idee, solch ein Bild zu malen, aber Ihr kennt ja die verschrobene Art, die unser treuer Jacopo manchmal an den Tag legte. Dabei ist es keineswegs das, was unsere Aufmerksamkeit am meisten auf sich zog, denn lässt man einmal die vier Jahre beiseite, in denen der Mönch Girolamo Savonarola die Herzen der einfachen Leute aufwiegelte, dann vermögen wir Florentiner durchaus noch die Schönheiten des menschlichen Leibes zu erkennen, ohne sie als teuflisch und obszön abzutun. Übrigens fehlt auf der Kopie, die sich unseren Augen darbot, das Stück Stoff, das Pontormo seinerzeit hinzugefügt hatte, um die gespreizten Schenkel der Göttin zu bedecken. Was uns jedoch viel mehr verwunderte – ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, denn es liegt mir daran, niemanden zu beleidigen, vor allem nicht die Familie Seiner Exzellenz –, war, dass Jacopo anstelle des Gesichts der Venus jenes der ältesten Tochter des Herzogs eingesetzt hatte, der Signorina Maria de’ Medici.
Ihr seht, welch unangenehme Aspekte die ganze Geschichte hat und warum der Herzog ihre Aufklärung in die Hände eines Mannes seines Vertrauens legen wollte, wobei er gleichzeitig das Gerücht in Umlauf brachte, der arme Jacopo könnte aus immer tiefer gewordener Unzufriedenheit mit sich selbst seinem Leben ein Ende gesetzt haben. Letztlich lässt mich das alles in einem dichten Nebel allein, weshalb ich mir erlaube, mit dem Ziel, die verworrenen Fäden dieser undurchsichtigen Geschichte zu entknoten, Eure große Klugheit anzurufen – von der ich weiß, dass sie fast an Euer Talent heranreicht und es vollständig aufnehmen kann mit Euerm Ingenium.
3. Michelangelo Buonarroti an Giorgio Vasari
Signor Giorgio, mein Freund, ich kann Euch nicht sagen, wie sehr mir das zusetzt – seit einer gefühlten Ewigkeit habe ich das Bett nicht mehr verlassen. Schon unter all den Sorgen, die mir die Petersdom-Baustelle bereitet, brach ich schier zusammen, doch Jacopos Tod hat mir sozusagen den Rest gegeben, und ich vergoss Tränen, als ich Euern Brief las. Jacopo war ein sehr begabter Maler, meiner Meinung nach einer der besten nicht nur seiner Generation (die zwischen Euch und mir geboren wurde, denn ich bin an der Schwelle zum Grab und Ihr seid noch in den besten Jahren), sondern einer ganzen Epoche. Ich weiß nicht, ob Ihr mit Eurer Bitte um Hilfe bei der Aufklärung dieses vor Gott und der Welt unerklärlichen Verbrechens bei mir an der richtigen Adresse seid; ich befürchte, Ihr überschätzt meine Klugheit, denn schon seit Längerem sagt man in Rom, ich sei ein vertrottelter alter Mann. Trotzdem, denn ich will Euch den Gefallen nicht verwehren, zumal ich Pontormos Andenken ehren möchte, bin ich bereit, Euch im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Vielleicht wäre Euch ja ein sozusagen schräger Blickwinkel, also von außerhalb Florenz’, bei den Ermittlungen hilfreich. Jedenfalls muss man, wenn man sich der Aufgabe mit der Strenge und Logik eines Brunelleschi oder eines Alberti nähern will, um den Schuldigen zu finden, erst einmal den Anlass feststellen und dann die Ursache – oder auch zuerst die Ursache, und dann den Anlass. Wer könnte Interesse gehabt haben am Tod des armen Jacopo? Und wer war an jenem Abend bei ihm und könnte ihm den tödlichen Stoß versetzt haben? Während ich diese Zeilen schreibe, füllen sich meine Augen mit Tränen, und ich sehe ihn in seinem Blut liegen, das Herz durchbohrt mit einem Werkzeug, das der Lebensunterhalt von uns Künstlern ist, seinem eigenen Meißel, erschlagen mit dem eigenen Hammer – und das ist so, als wäre er von seinen treuesten Gefährten verraten worden. Doch Schluss mit derlei fruchtlosen Ergießungen. Meine Tränen zollen dem Andenken an unseren Freund Tribut, aber sie helfen uns nicht, den Mörder zu ermitteln. Also, erste Erkenntnis: Der Schuldige ist in Florenz, er ist mitten unter Euch.
Ich befürchte, mein lieber Giorgio, dass ich Euch nicht mehr helfen kann, weil mir weitere Details fehlen. Schließlich bin ich nur ein gewöhnlicher Bildhauer, und der Blick von Rom aus reicht nicht bis San Lorenzo. Inständig bitte ich Euch um Jacopos willen, mich auf dem Laufenden zu halten über alles, was Eure Augen sehen und was Eure Ermittlungen zutage fördern.
Ihr habt gar nichts über seine Fresken gesagt. Wie fandet Ihr sie? Man hört, der Herzog habe ihn beauftragt, ein Gegenstück zur Sixtinischen Kapelle zu malen. Sagt mir doch, lieber Giorgio, was Ihr davon haltet; Ihr wisst ja, dass ich stets viel auf Euer Urteil gebe.
4. Giorgio Vasari an Michelangelo Buonarroti
Verehrter Meister, vorneweg zu Eurer Beruhigung: Pontormos Kirchenmalerei reicht nicht an Eure Sixtinische Kapelle heran. Wie Ihr es von mir erbeten habt, will ich Euch beschreiben, was ich gesehen habe: Zuerst, in mehreren Wandfeldern im oberen Bereich des Chors, die Erschaffung von Adam und Eva, der Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies, ihre Buße auf Erden, Abels Opferung, Kains Tod, die Segnung der Kinder Noahs, die Erbauung der Arche. Dann folgt auf einer der Seitenwände, die je fünfzehn Klafter breit und hoch ist, die Darstellung der Sintflut, mit einer Unzahl Leichen und Noah im Gespräch mit Gott. Zu Füßen dieser Sintflut wurde der arme Pontormo gefunden, und an dieser Wand hatte er einen Teil des Ganzen übermalt, während der Rest seit langem getrocknet war. An der anderen Seitenwand hat er eine Auferstehungsszene dargestellt, wo ein ebenso wildes Durcheinander herrscht wie, soweit man das sagen kann, am Jüngsten Tag. Dem Altar gegenüber sind auf beiden Seiten nackte Figuren angebracht, die aus dem Erdreich heraustreten und gen Himmel fahren. Über den Fenstern Engel, die Jesus umgeben, der in seiner ganzen Herrlichkeit die Toten auferstehen lässt, um über sie zu richten. Offen gesagt verstehe ich nicht, warum Jacopo unter Jesu Füßen Gott abbildet, wie er Adam und Eva erschafft. Auch wundere ich mich darüber, dass er weder die Gesichter noch die Farbe variiert, und außerdem muss ich kritisieren, dass er keinerlei Rücksicht auf die Perspektive nimmt. Mit einem Wort: Zeichnung, Farbgebung und Figurenführung sind so kläglich, dass ich, obwohl selber vom Fach, zugebe, nichts damit anfangen zu können. Ihr müsstet es mit eigenen Augen sehen, vielleicht könntet Ihr es mir dann erklären, aber ich glaube kaum, dass Euer Urteil allzu sehr von meinem abwiche. Diese Malerei birgt natürlich einige wunderbar ausgearbeitete Torsi, Schenkel und Fesseln, denn Jacopo legte Wert darauf, Kreideskizzen von außerordentlicher Vollkommenheit anzufertigen, doch es fügt sich nicht zu einem Ganzen zusammen. Die meisten Torsi sind viel zu groß, während die Arme und Beine viel zu klein sind. Den Gesichtern fehlt jegliche Anmut und die einzigartige Schönheit, die wir von seinen anderen Gemälden kennen. Hier scheint er nur auf Einzelheiten besondere Sorgfalt gelegt und die wichtigsten dabei vernachlässigt zu haben. Mit anderen Worten: Weit davon entfernt, sich mit diesem Werk dem göttlichen Michelangelo überlegen zu erweisen, ist er hinter sich selbst zurückgeblieben – ein Beweis dafür, dass man, wenn man die Natur bezwingen möchte, sich am Ende der Vorzüge begibt, die man ihrer Freigebigkeit verdankte. Doch hat Jacopo nicht ein Anrecht auf unsere Nachsicht? Sind Künstler nicht wie jeder andere Mensch der Gefahr ausgesetzt, zu irren? Die Frage mag fortan unbeantwortet bleiben, da Jacopo sie mit ins Grab genommen hat: Warum hatte er so kurz vor seinem Tod den Wunsch, einen Teil seiner Sintflut zu übermalen? Wer wüsste zu sagen, aus welchem Stoff die verborgensten Träume dieses Mannes waren?
Wie dem auch sei, in seiner großen Weisheit hat der Herzog die Vollendung der Fresken in die Hände von Bronzino gelegt.
5. Michelangelo Buonarroti an Agnolo Bronzino
Signor Agnolo, von Vasari habe ich gehört, was für ein schrecklicher Schicksalsschlag Florenz getroffen hat und uns alle, die wir die Künste und das Schöne lieben, indem Euer Meister und Freund niedergestreckt wurde am Schauplatz seiner größten Hoffnungen und – ich weiß das nur zu gut aus eigener leidvollster Erfahrung – seiner größten Qualen. Was gibt es denn Schrecklicheres als Freskenmalen? Den ganzen Tag verrenkt man sich den Hals, arbeitet kopfüber, zehn oder fünfzehn Fuß über dem Boden, und pinselt aus Leibeskräften, bevor der Kalkputz abbindet, denn sonst muss man wieder von vorn anfangen. Hätte Signor Vasari mir nicht die genauen Umstände des Todes berichtet, die wohl kaum Raum für Zweifel lassen, hätte es mich nicht überrascht zu erfahren, dass der arme Pontormo seinem Leben ein Ende gesetzt hätte, denn das ist ein Gedanke, der auch mich an so manchem verzweifelten Abend beschlichen hat, wenn mir von der Arbeit Nacken und Kopf ächzten und vom vielen Kopfüber ein Kropf wuchs, ganz zu schweigen von den missgünstigen und aufdringlichen Schwätzern, die einen unausgesetzt verleumden und gegen einen intrigieren. Ihr wisst, dass mein Jüngstes Gericht seit fast zwanzig Jahren regelmäßig angefeindet und verunglimpft wird, wobei Aretino, dieser Hurensohn, Gott sei seiner Seele gnädig, es sogar ein Sündenbabel nannte, das sich in der größten Kirche der Christenheit eingenistet habe. Diese kritischen Stimmen haben nicht nur nicht aufgehört, sondern werden ständig mehr und lauter. Inzwischen ist es so weit, dass Papst Paul IV., als er sogar erwogen hatte, mein Werk schlicht und einfach zu zerstören, meinen guten Freund Signor Daniele da Volterra damit beauftragt hat, meine entblößten Gestalten wieder einzukleiden, so dass der arme Daniele, nachdem er zu diesem würdelosen Tun gezwungen worden war, nun in ganz Rom als «Hosenmaler» verhöhnt wird. So weit sind wir also schon. Lange ist es her, dass die Päpste mich üppig beschenkten. Sogar Paul III., dem die Welt immerhin die Wiederkehr der römischen Inquisition verdankt, hatte mir einen herrlichen Vollblutaraber geschenkt, von dem er behauptete, er sei der hurtigste Botschafter zwischen Morgen- und Abendland. Nichts war ihm damals zu schade, um sich meiner Dienste zu versichern. Und nun verschmachtet das arme Tier in seinem Stall wie ich in meinem Bau.
Ich bin mir sicher, dass Jacopo die gleichen Kränkungen hinnehmen musste, denn ich erinnere mich an boshafte und eifersüchtige Gestalten und Verleumder, die zur Zeit meines Weggangs Florenz bevölkerten, und warum sollten sie keine Nachahmer gefunden haben? Deshalb wüsste ich gern von Euch, wie man Pontormos Fresken aufgenommen hat, und vor allem, was Ihr von seiner Arbeit haltet; denn selbst wenn es keinen Grund gibt, an Vasaris Vorbehalten zu zweifeln, werde ich doch immer daran festhalten, dass zwei Urteile, sofern sie von besonnenen und anständigen Menschen kommen, besser sind als eines.
6. Agnolo Bronzino an Michelangelo Buonarroti
Ist es nicht so, verehrter Meister, dass Ihr seit dreiundzwanzig Jahren nicht mehr in Florenz wart, trotz der wiederholten Aufforderungen Seiner Exzellenz des Großherzogs, der Eure Freunde mit Bitten Nachdruck verliehen? Vielleicht bricht ja dieses weitere Argument Euern Widerstand, und es gelingt unserem armen Pontormo, woran alle anderen gescheitert waren: Ich schwöre Euch, seine Fresken sind von einem exquisiten Glanz, wie ihn seit Eurer Sixtinischen Kapelle die Welt nicht mehr gesehen hat. Ein Ereignis, das sich der große Michelangelo mit eigenen Augen ansehen muss, denn Worte reichen nicht aus, es zu beschreiben.
Glaubt nicht den Worten Signor Giorgios, der, obwohl ein Mann von Geschmack und unbestreitbarer Redlichkeit, doch auch ein Höfling ist, der sich den Forderungen seines Meisters beugt. Ihr wisst nur allzu gut, davon zeugt Euer Brief, wie sehr die Aktmalerei in Verruf geraten ist, seit die römische Kurie es für richtig befunden hat, dem Oberinquisitor Carafa die Tiara aufzusetzen, einem Mann, der keinerlei Sinn für das Schöne in der Kunst hat und der jegliche Darstellung des menschlichen Körpers als Gotteslästerung ansieht. Die großartige Sintflut, dem Geist und den Händen des unvergleichlichen Jacopo entsprungen, hatte nicht das Glück, der Herzogin zu gefallen, deren spanischer Geschmack sich schlecht mit einer so außergewöhnlichen Vision verträgt: nackte Leiber übereinandergestapelt, manche aufgebläht von der langen Zeit unter Wasser. So viel Naturtreue liegt in diesem Bild, dass das Gerücht aufkam, Jacopo habe Leichen von Ertrunkenen als Vorbild genommen, die er eigenhändig aus den Spitälern entwendete. Derlei Gerede ist offenkundig reines Gespinst, doch Pontormos sagenhaftes Gemälde bestätigt nur die ganze Aufregung: Noch nie hat die Welt lebendigere Ertrunkene gesehen als auf diesen Wänden.
Seine Exzellenz Cosimo billigt zwar nicht die Maßnahmen der Herzogin gegen die Darstellung von nackter Haut – er ist ja kein Carafa, keine Frau und kein Spanier –, doch er strebt schon zu lange nach dem Titel des Königs von Toskana, um nicht Zugeständnisse an den Papst zu machen, denn der ist der Einzige, der ihm eine solche Würde verleihen könnte. Deshalb hat Seine Exzellenz sich gehütet, irgendein Zeichen des Beifalls zu geben, als die Fresken einer kleinen Zahl von Auserwählten gezeigt wurden, nachdem er die Bretterwände hatte öffnen lassen, hinter denen Jacopo sie versteckt hielt. Doch ich bin mir sicher, dass die Malereien dem Herzog trotz allem gefallen, und als Beweis dafür sehe ich an, dass er mir die ehrenvolle Aufgabe übertrug, sie zu vollenden; schließlich weiß er, dass ich als der treueste Schüler Pontormos nicht zum Verräter an seinem Erbe werde. So mich Gott als dessen würdig erachtet, werde ich daher, wenn das große Werk von Jacopo da Pontormo von meiner Hand vollendet sein wird, voller Stolz meinen Namen neben den seinen setzen. Das wird seine und unsere Rache sein, denn zweifellos hat man ihn wegen seiner Fresken umgebracht, wegen dieses neuen Zeitgeists – wahrlich düstere Zeiten sind es, und es geht ganz besonders gegen Leute wie uns.
7. Schwester Caterina de’ Ricci an Schwester Plautilla Nelli
Mir fehlen die Worte, Schwester, Dir zu sagen, mit was für Freudenbekundungen hier im Kloster die Nachricht vom Tod dieses Sodomiters aufgenommen wurde. Außer Rand und Band schrien die Mädchen im Refektorium, warfen ihre Hauben in die Luft und dankten dem Herrn Jesus. (Dabei wussten sie noch gar nichts von den obszönen Fresken in San Lorenzo.) Als Vorsteherin muss ich mich unter jeglichen Umständen der größten Zurückhaltung befleißigen, und so habe ich mich natürlich dagegen verwahrt, in ihren Jubel einzustimmen, aber sie zu tadeln, habe ich nicht übers Herz gebracht, auch wenn man sich nie über den Tod eines Menschen freuen darf. Vergangene Nacht wurde mir eine Vision zuteil: Ein Bock mit gespaltenem Schwanz wurde von einem blondgelockten Engel niedergestreckt, sein Kadaver zerteilt und in den Arno geworfen; der Engel hatte das Gesicht von Katharina von Siena, Deiner Heiligen und der meinigen. Gott straft die Bösen und belohnt seine Getreuen, indem er sie zum Werkzeug seiner Bestrafung macht. Florenz kann Gottes Zorn nur entgehen, wenn es sich von seinen Lastern reinigt, sonst erfüllen sich die Prophezeiungen von Girolamo Savonarola, und die Franzosen kommen wieder, oder die Lutheraner aus dem Deutschen Reich fluten uns, oder die Kaiserlichen plündern die Stadt wie damals Rom, oder die Pest flammt wieder auf, tausend Plagen suchen uns heim, und diesmal wäre Bruder Girolamo, Friede seiner Seele, nicht mehr da, um uns zu retten. Im Traum erschien mir ein Heer, das über die Ebene heranzog und von einem Prinzen mit Wolfskopf angeführt wurde. Man munkelt, Pontormo sei Protestant gewesen. Wenn er seinem Schöpfer nicht durch die Gnade einer von Gott gut geführten Hand anheimgefallen wäre, hätte ihn die Heilige Inquisition früher oder später entlarvt und verbrannt. Mag die Stadt Rom auch immer noch der Brandherd von Laster und Irrlehre sein, so steht doch an ihrer Spitze nun ein päpstlicher Herrscher, der nicht zulässt, dass die Ketzerei um sich greift, und wenigstens das ist gut, selbst wenn Paul IV. ansonsten kaum besser ist als Paul III. und alle anderen Vorgänger seit hundert Jahren (nicht zu reden von dem Dreckskerl Borgia, der schlimmer war als alle anderen). Allein deshalb ist es kein Verbrechen, einen reformierten sodomitischen Maler, dessen Bestrafung hienieden oder im Jenseits unausweichlich war, zu Gott zu rufen. Im Gegenteil, es ist eine heilige Tat, die ihrem Urheber beim Jüngsten Gericht zugutegehalten werden wird. Gott konnte diese Angriffe einfach nicht mehr gewähren lassen, und er hat Dich auserwählt, so wie er auch mich auserwählt hat und vor uns Bruder Girolamo, die Stadt Florenz zu retten.
Wir erwarten Dich in San Vincenzo, mit Deinen Leinwänden und Pinseln, wie jeden Monat. Ich werde Dir Modell sitzen, und Du wirst mir alles haarklein erzählen. Bis dahin, Gott sei mir gnädig, werde ich meine Ungeduld zügeln. Gelobt sei der Herr, Schwester, und Kopf hoch.
8. Schwester Plautilla Nelli an Schwester Caterina de’ Ricci
Schwester, Du weißt, dass meine Liebe zu Dir nur von meiner Liebe zu unserem Herrn Jesus übertroffen wird, mit dem Du Dich so jung vermählt hast. Aber bei allem Respekt und aller Bewunderung, die ich für Dich hege, möchte ich Dich doch bitten, solche Herzensergießungen in Deinen Briefen zu unterlassen, denn sollten diese in falsche Hände gelangen, könnten sie uns sehr von Schaden sein.
Auch ich kann es kaum erwarten, dass Du mir wieder Modell sitzt, und ich hoffe, dieses neue Porträt im Laufe des Winters fertigzustellen. Was allerdings die Sache betrifft, von der Du sprichst, so möchte ich nicht, dass Du Dir davon falsche Vorstellungen machst. Anders als Du zu glauben scheinst, habe ich mit dem Tod des Sodomiters nichts zu tun. Ich will damit nicht sagen, dass er seine Strafe nicht verdient hätte. Diese Fresken sind wohl wirklich eine weitere gottlose Ausprägung der Verrohung, die in Florenz herrscht, aber es war Teil von Gottes Plan, sie mich sehen zu lassen. Ich verspreche Dir, dass Du alles erfahren sollst, wenn wir uns sehen. Bis dahin flehe ich Dich an, Deine Begeisterung zu mäßigen. Im Gegensatz zu Dir, die Du stigmatisiert bist wie Er, bin ich von unserem Herrn nicht auserwählt. Ich bin nur eine arme Sünderin, die Dir und Ihm die Füße küsst.
9. Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini
Ich weiß, wie hoch Ihr Pontormo achtet und dass Ihr befreundet wart, aber Euch kann ich es ja sagen: Etwas Erbärmlicheres als seine Fresken habe ich noch nie gesehen, und es ist ein Jammer, dass ein solcher Künstler (denn er verdient ja wirklich, dass man Dantes Begriff auf ihn anwendet) seine grenzenlose Begabung mit solchen Schmierereien vergeudet hat. Ihr kennt meine Meinung zu dieser Frage: Der wahre Schuldige ist Dürer. Die Deutschen sind an allem schuld. Es ist Pontormo nicht vorzuwerfen, dass er diesen altfränkischen Stil nachahmen wollte, der wohl die Seele aller unserer glänzenden Künstler verdorben hat, aber ihm ist vorzuwerfen, dass er das Kleinkarierte der deutschen Manier auf den Gesichtsausdruck und die Körperhaltung der Figuren übertragen hat. Ich will nicht schlecht über einen Toten reden, schon gar nicht einen Freund von Euch, vor allem nicht, nachdem er brutal ermordet wurde, und ich will mich nicht weiter über diese arme verirrte Seele äußern. Jacopo war ein gequälter Mann, der an seiner Liebe zur Veränderung zugrunde gegangen ist, von dem aber, bei allen Fehlern, die er hatte, doch immer Erzeugnisse eines beachtlichen Talents bleiben werden. Gibt es nicht sogar beim guten alten Homer manchmal ermüdende Längen? Aber schaut Euch die Fresken an, ich schwöre, Ihr werdet mir beipflichten: Sie sind grauenhaft.
Doch das kann ja nicht ausreichen, seinen Mord zu rechtfertigen oder zu erklären, es sei denn, ein verrückt gewordener Maler oder Kunstfreund hätte sich heimlich hinter die Bretterwand in der Kapelle geschlichen und, entsetzt über den Irrsinn des schrecklichen Schauspiels, das sich ihm darbot, die Nacht abgewartet, um sich auf sein Opfer zu stürzen. Gewiss reagieren unsere Landsleute manchmal etwas heftig oder beckmesserisch auf Kunst, aber ich bin noch nicht so weit, diese Hypothese ernsthaft in Betracht zu ziehen.
Ich habe zunächst, wie von unserem Meister Signor Michelangelo angeregt, versucht, Anlass und Motiv bei all denen unter einen Hut zu bringen, die den Tod Eures Freundes hätten wünschen können, wenn sie denn die Möglichkeit gehabt hätten, ihren Plan ins Werk zu setzen. Im Ergebnis bleiben gegenwärtig nur sein Gehilfe Battista Naldini, der seit mehreren Jahren bei ihm lebt, und sein Farbmischer Marco Moro, der insbesondere auch für die Bretterwand verantwortlich war. Es ist bekannt, dass beide an den Tagen vor seinem Tod Streit mit ihm hatten, doch es gab ja öfter Streit mit Jacopo, er war kein einfacher Charakter. Um also meine Zeit nicht mit sinnlosen Mutmaßungen zu vertun, machte ich mich daran, den Abend des Mordes zu rekonstruieren. Jacopo hatte mit den Signori Bronzino und Varchi getafelt, die berichteten, er habe Niere gegessen und eine Flasche Wein getrunken, dann über Bauchschmerzen geklagt und sei vor Ende der Mahlzeit aufgebrochen, um sich schlafen zu legen. Ich schließe daraus, dass er sich unmittelbar nach San Lorenzo begab, um an seiner Sintflut weiterzuarbeiten, denn man hatte ihn schon öfter nach Einbruch der Dunkelheit in die Kirche gehen sehen, wo er weiterarbeitete. Warum aber hat er an diesem Abend nur einen Teil des Wandfeldes übermalt und nicht das ganze, so dass eine erkennbare