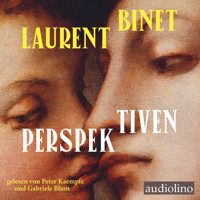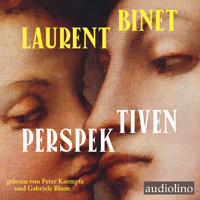9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beim Spaziergang durch Prag entdeckt der Autor an der Krypta eine Gedenktafel für tschechische Widerstandskämpfer. Sie versteckten sich dort nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich – bis deutsche Soldaten, nachdem sie auf der Suche nach ihnen schon ganz Prag auf den Kopf gestellt hatten, die Krypta fluten ließen. Der Ich-Erzähler Binet ist so elektrisiert von dieser Geschichte, dass er beschließt, von Paris nach Prag zu ziehen und ihr nachzugehen. Er verfolgt die sich kreuzenden Spuren der Nationalsozialisten und Widerstandskämpfer im Frühsommer 1942 in Prag. Der Chef der Gestapo Reinhard Heydrich soll von dem Tschechen Josef Gabčik, der an den braven Soldaten Schwejk erinnert, auf offener Straße erschossen werden. Doch als der Mercedes mit Heydrich naht, klemmt der Abzug ... Ein freches und mutiges Buch, das man lachend und weinend zugleich liest. «Ein stilistisches Feuerwerk über den gefährlichsten Mann des Dritten Reichs.» PAGE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Laurent Binet
HHhH
Himmlers Hirn heißt Heydrich
Roman
Über dieses Buch
Beim Spaziergang durch Prag entdeckt der Autor an der Krypta eine Gedenktafel für tschechische Widerstandskämpfer. Sie versteckten sich dort nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich – bis deutsche Soldaten, nachdem sie auf der Suche nach ihnen schon ganz Prag auf den Kopf gestellt hatten, die Krypta fluten ließen.
Der Ich-Erzähler Binet ist so elektrisiert von dieser Geschichte, dass er beschließt, von Paris nach Prag zu ziehen und ihr nachzugehen.
Er verfolgt die sich kreuzenden Spuren der Nationalsozialisten und Widerstandskämpfer im Frühsommer 1942 in Prag. Der Chef der Gestapo Reinhard Heydrich soll von dem Tschechen Josef Gabčik, der an den braven Soldaten Schwejk erinnert, auf offener Straße erschossen werden. Doch als der Mercedes mit Heydrich naht, klemmt der Abzug ...
Ein freches und mutiges Buch, das man lachend und weinend zugleich liest.
«Ein stilistisches Feuerwerk über den gefährlichsten Mann des Dritten Reichs.» PAGE
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel «HHhH. Himmlers Hirn heißt Heydrich» bei Éditions Grasset, Paris.
Die Arbeit an der Übersetzung wurde freundlicherweise unterstützt vom Deutschen Übersetzerfonds.
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«HHhH» Copyright © 2009 by Éditions Grasset
Umschlaggestaltung: Anzinger | Wüschner | Rasp, München
(Umschlagabbildungen: ullsteinbild – Peters)
ISBN Buchausgabe 978-3-498-00668-6 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-01421-3
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
127. Kapitel
128. Kapitel
129. Kapitel
130. Kapitel
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
134. Kapitel
135. Kapitel
136. Kapitel
137. Kapitel
138. Kapitel
139. Kapitel
140. Kapitel
141. Kapitel
142. Kapitel
143. Kapitel
144. Kapitel
145. Kapitel
146. Kapitel
147. Kapitel
148. Kapitel
149. Kapitel
150. Kapitel
151. Kapitel
152. Kapitel
153. Kapitel
154. Kapitel
155. Kapitel
156. Kapitel
157. Kapitel
158. Kapitel
159. Kapitel
160. Kapitel
161. Kapitel
162. Kapitel
163. Kapitel
164. Kapitel
165. Kapitel
166. Kapitel
167. Kapitel
168. Kapitel
169. Kapitel
170. Kapitel
171. Kapitel
172. Kapitel
173. Kapitel
174. Kapitel
175. Kapitel
176. Kapitel
177. Kapitel
178. Kapitel
179. Kapitel
180. Kapitel
181. Kapitel
182. Kapitel
183. Kapitel
184. Kapitel
185. Kapitel
186. Kapitel
187. Kapitel
188. Kapitel
189. Kapitel
190. Kapitel
191. Kapitel
192. Kapitel
193. Kapitel
194. Kapitel
195. Kapitel
196. Kapitel
197. Kapitel
198. Kapitel
199. Kapitel
200. Kapitel
201. Kapitel
202. Kapitel
203. Kapitel
204. Kapitel
205. Kapitel
206. Kapitel
207. Kapitel
208. Kapitel
209. Kapitel
210. Kapitel
211. Kapitel
212. Kapitel
213. Kapitel
214. Kapitel
215. Kapitel
216. Kapitel
217. Kapitel
218. Kapitel
219. Kapitel
220. Kapitel
221. Kapitel
Zweiter Teil
222. Kapitel
223. Kapitel
224. Kapitel
225. Kapitel
226. Kapitel
227. Kapitel
228. Kapitel
229. Kapitel
230. Kapitel
231. Kapitel
232. Kapitel
233. Kapitel
234. Kapitel
235. Kapitel
236. Kapitel
237. Kapitel
238. Kapitel
239. Kapitel
240. Kapitel
241. Kapitel
242. Kapitel
243. Kapitel
244. Kapitel
245. Kapitel
246. Kapitel
247. Kapitel
248. Kapitel
249. Kapitel
250. Kapitel
251. Kapitel
252. Kapitel
253. Kapitel
254. Kapitel
255. Kapitel
256. Kapitel
257. Kapitel
Erster Teil
«Wieder einmal befleckt die Gedankenwelt des
Prosaschriftstellers den Baum der Geschichte,
doch es obliegt nicht uns, die List zu finden,
mit der das Tier in seinen tragbaren Käfig zurück-
gelockt werden kann.»
OSSIP MANDELSTAM, «Das Ende des Romans»
1
Sein Name war Gabčik. Es hat ihn wirklich gegeben. Ob er hinter den geschlossenen Fensterläden seiner in Dunkelheit getauchten Wohnung das charakteristische Quietschen der Prager Tram vernahm? Ob er ihm sogar lauschte, während er alleine auf seinem kleinen Eisenbett lag? Ich möchte es gerne glauben. Da ich Prag gut kenne, kann ich mir vorstellen, welche Straßenbahnlinie dort entlangfuhr (vielleicht hat sich die Nummer auch geändert), ihren Streckenverlauf und den Ort, an dem Gabčik hinter den geschlossenen Fensterläden liegt und abwartet, nachdenkt und lauscht. Wir sind in Prag, an der Ecke Vyšehradská und Trojička. Die Tram Nummer 18 (oder 22) hat vor dem Botanischen Garten angehalten. Den Großteil der Zeit befinden wir uns im Jahr 1942. Kundera lässt in seinem Buch vom Lachen und Vergessen durchklingen, dass er sich ein wenig dafür schämt, seinen Figuren Namen geben zu müssen, und auch wenn in seinen Romanen, in denen sich Tomas, Tamina, Teresa und andere tummeln, davon kaum etwas zu spüren ist, schwingt zwischen den Zeilen folgende Frage mit: Gibt es etwas Gewöhnlicheres, als in der albernen Bemühung um Realismus oder im besten Fall aus schlichter Bequemlichkeit einer ausgedachten Figur einen ausgedachten Namen zu verleihen? Kundera hätte meiner Meinung nach noch einen Schritt weiter gehen sollen: Gibt es denn etwas Gewöhnlicheres als eine ausgedachte Figur?
Gabčik also gab es wirklich, und er hörte tatsächlich auf diesen Namen (wenn auch nicht immer). Seine Geschichte ist ebenso wahr wie außergewöhnlich. Er und seine Kameraden sind meiner Ansicht nach die Schöpfer eines der größten Widerstandsakte der Geschichte und fraglos der Inbegriff des Widerstandskampfes im Zweiten Weltkrieg. Schon seit langem wollte ich seine Verdienste würdigen. Schon seit langem sehe ich ihn vor mir, wie er in dem kleinen Zimmer bei geschlossenen Fensterläden und geöffnetem Fenster ausgestreckt daliegt und dem Quietschen der Tram lauscht, die vor dem Botanischen Garten anhält (in welche Richtung sie fährt? Ich weiß es nicht). Doch wenn ich diese Vorstellung auf Papier banne, wie ich es mir soeben anmaße, bin ich nicht sicher, ob ich ihm damit wirklich einen Dienst erweise. Ich setze diesen Mann zu einer gewöhnlichen Figur herab und seine Taten zu Literatur: infame Alchemie – aber was soll ich machen? Ich möchte diese Vision nicht mein gesamtes Leben mit mir herumschleppen, ohne zumindest den Versuch unternommen zu haben, sie freizusetzen. Dabei hoffe ich nur, dass hinter der dicken Spiegelschicht meiner Idealisierung, die ich auf diese sagenhafte Geschichte auftragen werde, das unverfälschte Bild der historischen Wirklichkeit noch sichtbar bleibt.
2
Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann mein Vater mir zum ersten Mal von dieser Geschichte erzählte, aber ich sehe ihn noch vor mir, wie er in meinem Zimmer unserer Sozialwohnung die Worte «Partisanen», «Tschechoslowaken», vielleicht auch «Attentat», ganz sicher «liquidieren» fallenlässt und schließlich diese Jahreszahl: «1942». In seiner Büchersammlung hatte ich die Geschichte der Gestapo von Jacques Delarue gefunden und gerade in die ersten Seiten reingelesen. Mein Vater sah mich mit dem Buch in der Hand und warf mir im Vorübergehen ein paar Bemerkungen zu: Er erwähnte Himmler, den Reichsführer SS, und dessen rechte Hand, Heydrich, den Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. Und er erzählte mir von einem tschechoslowakischen Kommando, das von London ausgesandt worden war, und eben von dem Attentat. Die Einzelheiten waren ihm nicht bekannt (und ich hatte auch keinen Grund, ihn danach zu fragen, da dieses geschichtliche Ereignis in meinem Kopf damals noch nicht den Stellenwert einnahm wie heute). Aber ich spürte diese gewisse Aufregung bei ihm, die er an den Tag legt, wenn er etwas, das ihn auf irgendeine Weise beeindruckt hat, erzählt (meist zum hundertsten Mal, weil er sich – Berufskrankheit oder schlicht Veranlagung – gern wiederholt). Ich glaube nicht, dass ihm selbst jemals bewusst wurde, welche Bedeutung er dieser Anekdote beimaß, denn als ich ihm vor kurzem von meiner Absicht erzählte, ein Buch darüber zu schreiben, nahm ich bei ihm lediglich höfliche Neugier wahr, ohne besondere Gefühlsregung. Doch ich weiß, dass ihn diese Geschichte immer fasziniert hat, auch wenn sie bei ihm keinen so starken Eindruck hinterließ wie bei mir. Also schreibe ich dieses Buch auch, um ihm etwas zurückzugeben: die Früchte der wenigen Worte, die mir als Jugendlichem von meinem Vater zugeworfen wurden, der damals noch kein Lehrer für Geschichte war, sich aber gut darauf verstand, sie in wenigen schlichten Sätzen zu vermitteln.
Die Weltgeschichte.
3
Schon im Kindesalter, lange vor der Trennung der beiden Länder, konnte ich – dem Tennis sei Dank – zwischen Tschechen und Slowaken unterscheiden. Ich wusste zum Beispiel, dass Ivan Lendl Tscheche war und Miroslav Mecir Slowake. Und während der Slowake Mecir ein phantasievoller, talentierter und sympathischer Spieler war, war der Tscheche Lendl strebsam, kühl und unsympathisch (aber trotzdem über 270 Wochen die weltweite Nummer eins; dieser Rekord wurde nur von Pete Sampras mit 286 Wochen an der Spitze übertroffen). Doch von meinem Vater hatte ich auch gelernt, dass die Slowaken während des Krieges kollaboriert, die Tschechen hingegen Widerstand geleistet hatten. In meinem Vermögen, die erstaunliche Komplexität der Welt zu begreifen (das damals noch sehr begrenzt war), bedeutete dies, dass alle Tschechen Widerstandskämpfer gewesen waren und alle Slowaken Kollaborateure, als sei es von Natur aus so vorgegeben. Dabei hatte ich keine Sekunde über die Rolle Frankreichs nachgedacht, die einen derartigen Schematismus eigentlich in Frage stellt: Haben wir Franzosen nicht zugleich Widerstand geleistet und kollaboriert? Um ehrlich zu sein, bekam ich erst, nachdem ich erfahren hatte, dass Tito Kroate war (alle Kroaten hatten also nicht kollaboriert, und demnach hatten wahrscheinlich auch nicht alle Serben Widerstand geleistet), allmählich eine deutlichere Vorstellung von der Situation der Tschechoslowakei zu Kriegszeiten: Einerseits gab es dort Böhmen-Mähren (anders gesagt: die heutige tschechische Republik), das von den Deutschen okkupiert und dem Reich einverleibt wurde (und damit den nicht gerade beneidenswerten Status eines Protektorats erhielt, das als Bestandteil des Deutschen Reiches betrachtet wurde); auf der anderen Seite gab es den slowakischen Staat, theoretisch unabhängig, von den Nazis aber zu einem Satellitenstaat degradiert. Das alles sagt natürlich nicht das Geringste über das Verhalten der einzelnen Personen aus.
4
1996 reiste ich nach Bratislava, um in einer Militärakademie der westlichen Slowakei als Französischlehrer zu arbeiten. Eine meiner ersten Fragen an den Sekretär des Verteidigungsattachés der französischen Botschaft galt der Geschichte des Attentats (zuvor erkundigte ich mich allerdings nach meinen Koffern, die eine Irrfahrt Richtung Istanbul angetreten hatten). Dieser anständige Mann, ein Hauptfeldwebel, war in der ehemaligen Tschechoslowakei auf das Abhören von Telefongesprächen spezialisiert gewesen und nach Ende des Kalten Krieges zum Botschaftssekretär umgeschult worden. Er verriet mir die ersten Details über die Affäre. So erfuhr ich, dass zwei Männer die Aktion durchgeführt hatten: ein Tscheche und ein Slowake. Ich war beglückt über die Mitteilung, dass ein Staatsangehöriger meines Gastlandes an der Operation beteiligt gewesen war (es hatte also doch slowakische Widerstandskämpfer gegeben). Über den Ablauf der Aktion an sich verriet er nicht viel, außer, dass eine der Waffen in dem Moment, in dem auf Heydrichs Wagen gezielt wurde, eine Ladehemmung hatte (bei dieser Gelegenheit habe ich auch erfahren, dass Heydrich während des Tathergangs tatsächlich im Auto saß). Doch besonders die nachfolgenden Ereignisse weckten meine Neugier: Die beiden Partisanen hielten sich mit ihren Freunden in einer Kirche versteckt, und die Deutschen versuchten, sie darin zu ertränken … komische Geschichte. Ich hätte gern Einzelheiten erfahren. Aber der Hauptfeldwebel wusste nicht mehr.
5
Kurz nach meiner Ankunft in der Slowakei lernte ich eine sehr hübsche junge Slowakin kennen, in die ich mich hoffnungslos verliebte und mit der ich eine leidenschaftliche Liebesgeschichte durchlebte, die beinahe fünf Jahre andauerte. Von ihr erhielt ich zusätzliche Informationen. Zunächst die Namen der Hauptakteure: Jozef Gabčik und Jan Kubiš. Gabčik war der Slowake und Kubiš der Tscheche – der Klang ihrer jeweiligen Nachnamen ließ keinen Zweifel zu. Auf jeden Fall schienen die beiden Männer Bestandteil der historischen Landschaft gewesen zu sein: Aurélia, besagte junge Frau, hatte ihre Namen in der Schule gelernt, so wie alle kleinen Tschechen und Slowaken ihrer Generation, nehme ich an. Ansonsten kannte sie den groben Handlungsverlauf der Geschichte, wusste aber auch nicht viel mehr als mein Hauptfeldwebel. Ich musste mich noch zwei oder drei Jahre gedulden, bis ich bestätigt bekam, was ich immer geahnt hatte: dass diese Geschichte die wahnwitzigsten Phantasiegebilde an Intensität und Glaubwürdigkeit um Längen übertrifft.
Ich hatte für Aurélia eine Wohnung im Zentrum von Prag gemietet, zwischen dem Schloss Vyšehrad und Karlovo náměstí, dem Karlsplatz. Von diesem Platz zweigt eine Straße ab, die Resslova ulice. Sie trifft dort auf den Fluss, wo jenes eigenartige Glasgebäude steht, das sich durch die Lüfte zu schlängeln scheint und von den Tschechen «Tančicí Dům» genannt wird, tanzendes Haus. Auf der rechten Seite der abschüssigen Straße Resslova befindet sich eine Kirche. Die Kirche hat an der Seitenfront ein Kellerfenster. In dem das Fenster umgebenden Stein sind zahlreiche Einschusslöcher zu sehen, neben einem Schild, auf dem unter anderem die Namen Gabčik und Kubiš erwähnt werden – und Heydrich, mit dem ihr Schicksal für immer verbunden ist. Zigmal bin ich an diesem Kellerfenster vorbeigegangen, ohne die Einschusslöcher oder das Schild zu bemerken. Doch eines Tages blieb ich davor stehen: Ich hatte die Kirche gefunden, in der sich die Fallschirmspringer nach dem Attentat versteckt hielten.
Gemeinsam mit Aurélia kehrte ich zu einer Zeit zurück, zu der die Kirche geöffnet war, und wir konnten die Krypta besichtigen.
Wir betraten eine wahre Goldgrube.
6
Die Spuren des Dramas, das sich vor über sechzig Jahren in diesem kleinen Raum abgespielt hatte, waren noch erschreckend frisch: Ich sah die Innenseite des Kellerfensters, das ich von außen betrachtet hatte, einen Tunnel von wenigen Metern Länge, die Abdrücke der Kugeleinschläge an den Wänden und in der gewölbten Decke sowie zwei kleine Holztüren. Außerdem gab es dort Fotos, auf denen die Gesichter der Fallschirmspringer zu sehen waren. In einem zweisprachigen Text auf Tschechisch und Englisch las ich den Namen eines Verräters, ein Plakat zeigte einen herrenlosen Regenmantel, eine Umhängetasche und ein Fahrrad, außerdem gab es dort eine Sten, eine Maschinenpistole, die im denkbar ungünstigsten Moment eine Ladehemmung hatte; es war von Frauen die Rede, von Unvorsichtigkeiten, von London, von Frankreich, von Legionären, einer Exilregierung, einem Dorf namens Lidice, einem jungen Späher namens Valčík, von einer Tram, die vorbeifuhr – ebenfalls im denkbar ungünstigsten Moment –, von einer Totenmaske, einer Belohnung von zehn Millionen Kronen für einen potenziellen Denunzianten, von Zyankali-Kapseln, von Granaten und den Menschen, die die Granaten warfen, von Rundfunksendern und verschlüsselten Nachrichten, von einem verstauchten Knöchel, von Penicillin, das ausschließlich in England zu bekommen war, von einer Stadt, die vollständig unter der Fuchtel des sogenannten Henkers stand; es gab Hakenkreuz-Fahnen, Totenkopfabzeichen, deutsche Spione, die für England arbeiteten, einen schwarzen Mercedes mit einem Platten, einen Schlächter, Parteivorsitzende, die sich um einen Sarg scharten, über Leichen gebeugte Polizisten, fürchterliche Repressalien, menschliche Größe und Wahnsinn, Schwäche und Verrat, Mut und Angst, Hoffnung und Schmerz – alle Gefühle auf wenigen Quadratmetern vereint. Es gab Krieg und Tod, deportierte Juden, ganze Familien, die ausgelöscht wurden, es gab gefallene Soldaten, Vergeltung und politisches Kalkül, es gab einen Mann, der unter anderem Geige spielte und Fechten übte, es gab einen Schlosser, der seinen Beruf nie ausüben konnte, es gab den Geist des Widerstandes, der diese Mauern auf ewig durchdrungen hat, es gab Spuren des Kampfes zwischen den Kräften des Lebens und des Todes, es gab Böhmen, Mähren und die Slowakei – die ganze Weltgeschichte innerhalb weniger Mauersteine.
Und draußen standen siebenhundert SS-Soldaten.
7
Beim Stöbern im Internet entdeckte ich einen Film mit dem Titel Die Wannseekonferenz, in dem Kenneth Branagh Heydrich verkörpert. Bei dem Preis von fünf Euro, inklusive Versandgebühren, schlug ich sofort zu und erhielt drei Tage später die DVD.
Der Film stellt die Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 nach, während der Heydrich mit Unterstützung von Eichmann innerhalb weniger Stunden festlegte, wie die Endlösung umgesetzt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Massenerschießungen in Polen und der UDSSR bereits begonnen. Sie wurden von SS-Einsatzgruppen, speziellen Vernichtungskommandos, ausgeführt, die ihre Opfer zu Hunderten oder sogar Tausenden zusammenscharten, häufig auf einem Feld oder im Wald, und sie mit Maschinengewehren niedermetzelten. Das Problem dieser Methode bestand jedoch darin, dass sie die Nerven der Henker auf eine derbe Zerreißprobe stellte und sich negativ auf die Moral der Truppen auswirkte. Das betraf selbst die hartgesottensten unter ihnen, wie die Truppen vom Sicherheitsdienst oder der Gestapo – Himmler höchstpersönlich soll bei einer dieser Massenerschießungen in Ohnmacht gefallen sein. Später ging die SS dazu über, ihre Opfer in Lastwagen zu pferchen und darin zu vergasen, nachdem man den Auspuff umgedreht und die Abgase ins Wageninnere geleitet hatte, doch diese Technik blieb ziemlich behelfsmäßig. Nach der Wannseekonferenz wurde die Auslöschung der Juden, die Heydrich seinem treuen Eichmann anvertraut hatte, wie ein gigantisches logistisches, soziales und ökonomisches Projekt behandelt.
Kenneth Branaghs Interpretation ist äußerst gelungen: Gekonnt verbindet er ausgesprochene Liebenswürdigkeit mit harscher Autorität und verleiht seiner Figur dadurch einen hochgradig beunruhigenden Anstrich. Zwar habe ich nirgendwo gelesen, dass der wahre Heydrich, ganz gleich, in welcher Situation, jemals so etwas wie Liebenswürdigkeit ausgestrahlt hätte, sei sie nun authentisch oder vorgespielt, dennoch wird in einer sehr kurzen Filmszene die psychologische und historische Dimension der Persönlichkeit Heydrichs treffend dargestellt: Zwei der Konferenzteilnehmer führen etwas abseits ein vertrauliches Gespräch. Der eine vertraut dem anderen an, er habe gehört, dass Heydrich jüdische Wurzeln haben soll. Er möchte wissen, ob sein Gesprächspartner es für möglich halte, dass an diesem Gerücht etwas dran sei. Dieser zischt zurück: «Warum stellen Sie ihm die Frage nicht selbst?» Beim bloßen Gedanken daran wird der andere aschfahl. Tatsächlich hatte Heydrich während seiner Jugend das hartnäckige Gerücht verfolgt, sein Vater sei Jude, und ihm das Leben schwergemacht. Das Gerücht war anscheinend unbegründet, aber selbst, wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, wäre es für Heydrich als Chef des Geheimdienstes der NSDAP und der SS zweifellos ein Leichtes gewesen, seinen Stammbaum von jedem Verdacht reinzuwaschen.
Wie dem auch sei, es ist nicht das erste Mal, dass Heydrichs Figur auf die Leinwand gebracht wurde. Fritz Lang begann 1943, ein knappes Jahr nach dem Attentat, mit den Dreharbeiten zu dem Film Auch Henker sterben, nach einem Drehbuch von Bertolt Brecht. Der Handlungsverlauf dieses Films ist völlig an den Haaren herbeigezogen (Fritz Lang wusste sicherlich nicht, wie sich die Ereignisse tatsächlich zugetragen hatten, und hätte er es gewusst, wäre ihm das Risiko, sie zu enthüllen, sicherlich zu groß gewesen), dabei aber ausgesprochen einfallsreich: Heydrich wird von einem tschechischen Arzt ermordet, der Mitglied der inneren Widerstandsbewegung ist und bei einem jungen Mädchen Unterschlupf findet. Der Vater des Mädchens, ein Akademiker, wird bei einer Razzia der Besatzungskräfte gemeinsam mit anderen lokalen Persönlichkeiten verhaftet. Man droht ihnen mit Repressalien, sollte sich der Mörder nicht stellen. Die Krise wird äußerst dramatisch dargestellt (Brecht verpflichtet eben) und entspannt sich erst, als es der Widerstandsbewegung gelingt, einem Verräter und Kollaborateur den Schwarzen Peter zuzuschieben. Mit dessen Tod enden die Affäre und der Film. In Wahrheit konnten weder die Partisanen noch die tschechische Bevölkerung ihren Kopf so elegant aus der Schlinge ziehen.
Fritz Lang entschied sich dafür, Heydrich ziemlich unflätig darzustellen, als verweiblichten Luststrolch, einen durch und durch Geistesgestörten, der eine Reitgerte schwingt und damit zugleich seine Grausamkeit und seinen Sittenverfall demonstriert. Es stimmt, dass der echte Heydrich als Sittenstrolch galt und mit einer Fistelstimme gestraft war, die im Widerspruch zu seinem sonstigen Auftreten stand, doch mit seiner Überheblichkeit, Steifheit und seinem arischen Aussehen hat Heydrich so gar nichts mit der Figur gemein, die durch diesen Film watschelt. Wer nach einer etwas treffenderen Darstellung sucht, wird offen gesagt mehr davon haben, sich noch einmal Charlie Chaplins Film Der große Diktator anzusehen: Darin sieht man den Diktator Hynkel, flankiert von seinen zwei Schergen, einem grobschlächtigen blasierten Fettwanst, der ganz offensichtlich Göring zum Vorbild hatte, und einem großen Schlanken, der wesentlich listiger, kühler und steifer wirkt – er stellt nicht Himmler dar, den kleinen hinterhältigen schnauzbärtigen Grobian, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit seine gemeingefährliche rechte Hand: Heydrich.
8
Wieder einmal war ich nach Prag zurückgekehrt. Diesmal in Begleitung einer anderen jungen Frau, der strahlend schönen Natacha (sie ist Französin, auch wenn ihr Name anderes verheißt, ein Kommunistenkind wie fast alle Franzosen). Mit ihr zusammen stattete ich der Krypta erneut einen Besuch ab. Beim ersten Mal war sie wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Gegenüber entdeckten wir eine Bar namens «Zu den Fallschirmspringern», die mir nie zuvor aufgefallen war. Die Wände im Innern der Bar sind gespickt mit Fotos, Dokumenten, Bildern und Anschlagzetteln, die sich auf das Attentat beziehen. Am Ende des Raums hängt ein Wandgemälde von Großbritannien. Darauf sind die unterschiedlichen Militärstationen markiert, in denen sich die Kommandos der tschechischen Exilregierung auf ihre Missionen vorbereiteten. Natacha und ich genehmigten uns in der Bar ein Bier.
Am nächsten Tag kehrten wir während der Öffnungszeiten zurück, und ich zeigte Natacha die Krypta. Auf meine Bitte hin machte sie einige Fotos. In der Eingangshalle wurde ein Kurzfilm gezeigt, der das Attentat nachstellt. Ich versuchte, die Schauplätze des Dramas zu lokalisieren, um mich dorthin begeben zu können, doch sie befinden sich ziemlich außerhalb des Stadtzentrums in einem Vorort. Außerdem haben sich die Straßennamen geändert, sodass ich den Ort des Geschehens immer noch nicht zweifelsfrei zuordnen konnte. Am Ausgang der Krypta nahm ich einen zweisprachigen Prospekt mit, in dem auf eine Ausstellung hingewiesen wurde – sie trug den Titel «Atentát» auf Tschechisch, «Assassination» auf Englisch. Zwischen den Überschriften prangte ein Foto von Heydrich, umgeben von deutschen Staatsdienern, neben ihm der Sudete Karl Hermann Frank, seine rechte Hand vor Ort. In Galauniform steigen die Herren eine Treppe mit reichverziertem Geländer hinauf. Heydrich hatte man eine rote Zielscheibe aufs Gesicht gedruckt. Die Ausstellung sollte im Armeemuseum sein, in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Florenc, ein Datum wurde allerdings nirgendwo genannt (nur die Öffnungszeiten des Museums wurden erwähnt). Wir gingen noch am selben Tag hin.
Am Eingang des Museums nahm uns eine zierliche Dame in ziemlich fortgeschrittenem Alter fürsorglich in Empfang: Sie schien beglückt über unseren Besuch und bot uns an, die unterschiedlichen Ausstellungsräume des Gebäudes zu besichtigen. Mich interessierte allerdings nur einer, und ich wies sie darauf hin: Ein riesiger Pappaufsteller stand vor dem Raum und bewarb in bester Hollywood-Horrorfilm-Manier eine Ausstellung über Heydrich. Ich fragte mich, ob es sich wohl um eine Dauerausstellung handelte. Auf jeden Fall war der Eintritt frei, was für den Rest des Museums ebenfalls galt. Die kleine Dame erkundigte sich nach unserer Nationalität und drückte uns ein Begleitheft auf Englisch in die Hand (sie beteuerte, es täte ihr leid, uns nur die englische oder deutsche Version anbieten zu können).
Die Ausstellung übertraf meine kühnsten Erwartungen. Dort gab es wirklich alles: jede Menge Fotos, Briefe, Aushänge und Dokumente; außerdem bekam ich die Waffen und persönlichen Gegenstände der Fallschirmspringer zu sehen, die Akten, die die englischen Geheimdienste über sie geführt und mit Bemerkungen, Beurteilungen und Bewertungen ihrer Kompetenzen versehen hatten, ich sah Heydrichs Mercedes mit dem platten Reifen und dem Loch in der rechten Hintertür, den folgenschweren Brief, den ein Mann an seine Geliebte geschrieben und damit indirekt das Massaker in Lidice ausgelöst hatte, die Reisepässe der Beteiligten mit Fotos sowie jede Menge weitere authentische und bestürzende Geschichtszeugnisse. Eifrig machte ich mir Notizen, obwohl ich mir darüber im Klaren war, dass es einfach zu viele Namen, Daten und Details gab. Beim Gehen fragte ich die zierliche Dame, ob es möglich sei, das Begleitheft zu kaufen, das sie mir für den Besuch mitgegeben hatte und in dem alle Bildunterschriften und Kommentare zur Ausstellung wiederzufinden waren. Sie blickte betrübt drein und verneinte. Das sehr gut gemachte, von Hand geheftete Büchlein war offensichtlich nicht zum Verkauf bestimmt. Lag es nun an meinem perplexen Gesichtsausdruck oder an meinem Bemühen um ein halbwegs verständliches Tschechisch, jedenfalls nahm mir die ältere Dame die Broschüre schließlich entschlossen aus der Hand und ließ sie in Natachas Handtasche verschwinden. Sie bedeutete uns, Stillschweigen zu bewahren und zu gehen. Wir verabschiedeten uns überschwänglich. In Anbetracht der Besucherzahlen des Museums würde das Begleitheft sicherlich niemandem fehlen. Trotzdem war es eine sehr nette Geste. Zwei Tage später ging ich, eine Stunde bevor unser Bus nach Paris abfuhr, noch einmal zum Museum zurück und überreichte der liebenswürdigen Dame eine Schachtel Pralinen. Sie war völlig überrumpelt und wollte sie zuerst nicht annehmen. Ohne die Informationsfülle der Broschüre, und somit ohne die kleine Dame, hätte dieses Buch nicht die Form bekommen, die es von nun an annehmen wird. Ich wollte, ich hätte sie nach ihrem Namen gefragt, um mich an dieser Stelle etwas feierlicher bei ihr bedanken zu können.
9
Auf dem Gymnasium nahm Natacha zwei Jahre in Folge am Concours de la Résistance, einem Schülerwettbewerb zum Thema Widerstand und Deportation, teil und gewann beide Male, was meines Wissens nie zuvor geschehen war und auch danach nie wieder passierte. Dieser doppelte Sieg ermöglichte es ihr unter anderem, bei einer Gedenkveranstaltung die Fahne zu tragen und ein Konzentrationslager im Elsass zu besichtigen. Während der Busfahrt dorthin saß sie neben einem ehemaligen Widerstandskämpfer, der sie ins Herz schloss. Er lieh ihr mehrere Bücher und Dokumente, doch später verloren sie sich aus den Augen. Als sie mir zehn Jahre später von dieser Geschichte erzählte (mit leichten Gewissensbissen, wie man sich unschwer vorstellen kann, weil sie immer noch im Besitz seiner geliehenen Schriftstücke war und nicht einmal wusste, ob ihr Widerstandskämpfer noch lebte), ermutigte ich sie, den Kontakt wiederherzustellen, und obwohl der Mann mittlerweile ans andere Ende Frankreichs gezogen war, fanden wir seine Spur wieder.
So kam es, dass wir ihm einen Besuch in seinem schönen schneeweißen Haus bei Perpignan abstatteten, wo er sich mit seiner Frau niedergelassen hatte.
Während wir am Muskatwein nippten, lauschten wir seinen Erzählungen – wie er sich der Widerstandsgruppe angeschlossen und an welchen Aktivitäten er sich beteiligt hatte. 1943 war er neunzehn Jahre alt und arbeitete in der Milchfabrik seines Onkels, der schweizerische Wurzeln hatte und so gut Deutsch sprach, dass die Soldaten, die sich in der Milchfabrik mit Lebensmitteln eindeckten, immer noch gerne ein Weilchen blieben und sich in ihrer Muttersprache mit seinem Onkel unterhielten. Zunächst wurde er gefragt, ob er aus den Gesprächen zwischen den Soldaten und seinem Onkel interessante Informationen herausfiltern könne, beispielsweise über die Bewegung der Truppen. Danach ließ man ihn an Fallschirm-Aktionen teilnehmen, genauer gesagt half er dabei, die Materialkisten aufzusammeln, die nachts aus den Flugzeugen der Alliierten abgeworfen wurden. Als er schließlich das Alter erreichte, in dem er Gefahr lief, im Rahmen des Service du Travail obligatoire (STO) als französischer Zwangsarbeiter verpflichtet und nach Deutschland geschickt zu werden, schloss er sich der Widerstandsbewegung an. Er diente in der Kampfeinheit und nahm an der Befreiung der Bourgogne teil, offenbar sehr aktiv, wenn man die Anzahl der Deutschen bedenkt, die er getötet haben soll.
An seiner Geschichte war ich aufrichtig interessiert, aber ich hoffte auch, etwas zu erfahren, was mir für mein Buch über Heydrich nützlich sein könnte. Was genau das sein sollte, wusste ich allerdings selbst nicht.
Ich fragte ihn, ob er nach seinem Anschluss an die Widerstandsbewegung eine militärische Ausbildung erhalten habe. Nichts dergleichen, gab er zur Antwort. Man hatte ihm beigebracht, ein schweres Maschinengewehr zu handhaben, und er nahm an einigen Trainingseinheiten teil: Zusammen- und Auseinanderbauen der Waffe mit verbundenen Augen und Schießübungen. Bei seinem Eintritt wurde ihm einfach eine Maschinenpistole in die Hand gedrückt, und das war’s. Eine englische Maschinenpistole, eine Sten. Eine Waffe, die anscheinend alles andere als verlässlich war: Ein Schlag mit dem Kolben auf den Boden genügte, um den gesamten Magazininhalt querbeet zu entleeren. Absoluter Schund. «Die Sten war ein Haufen Scheiße, anders kann man es nicht ausdrücken!»
Ein Haufen Scheiße also, soso.
10
Ich habe geschrieben, dass die graue Eminenz an der Seite von Hynkel-Hitler in Chaplins Der große Diktator Heydrich zum Vorbild hatte, aber das stimmt nicht. Ich hatte nicht bedacht, dass Heydrich 1940 eine Art Schattenmann war, den die wenigsten kannten, was umso mehr für die Amerikaner galt. Das Problem liegt natürlich nicht dort: Chaplin könnte seine Existenz erahnt und damit richtiggelegen haben. Tatsache ist auf jeden Fall, dass der Scherge des Diktators in dem Film als listige Schlange dargestellt wird und seine Intelligenz in starkem Kontrast zum lächerlichen Auftreten des Schauspielers steht, der den grobschlächtigen Göring parodiert. Doch die Figur des Heydrich hat auch einen drolligen, verweichlichten Zug an sich, der nicht zum künftigen Schlächter von Prag passt.
Und wo wir schon bei filmischen Darstellungen Heydrichs sind: Ich habe gerade erst einen alten Film mit dem Titel Hitlers Madman von Douglas Sirk (der tschechische Wurzeln hat) im Fernsehen gesehen. Es handelt sich um einen amerikanischen Propagandafilm, der innerhalb einer Woche abgedreht wurde und 1943 kurz vor Fritz Langs Auch Henker sterben herauskam. Die Handlung ist völlig frei erfunden (wie bei Lang auch) und im Herzen des Widerstands angesiedelt – in dem Märtyrerdorf Lidice, dem das gleiche Schicksal blühte wie der französischen Stadt Oradour-sur-Glane. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Dorfbewohner gegenüber einem der von London ausgesandten Fallschirmspringer verhalten werden: Werden sie ihm helfen, werden sie sich heraushalten, oder werden sie ihn gar verraten? Leider verharmlost der Film die Organisation des Attentats, indem er sie einer kleinen lokalen Initiative zuschreibt, die durch eine Aufeinanderfolge von Zufällen und glücklichen Fügungen zusammenfand (Heydrich durchquert zufällig das Dorf Lidice, in dem zufällig ein Fallschirmspringer Unterschlupf gefunden hat, und die Dorfbewohner erfahren auch nur zufällig, zu welcher Zeit der Wagen des Protektors vorbeikommen soll). Die Intensität des Handlungsverlaufs ist dadurch deutlich abgeschwächter als in Langs Film, in dem sich die Dramaturgie – gemäß Brechts Drehbuch – wie in einem wahren Nationalepos entwickelt.
Dafür ist der Schauspieler, der Heydrich in Douglas Sirks Film verkörpert, große Klasse. Zunächst ähnelt er ihm äußerlich. Weiterhin gelingt es ihm, die Brutalität seiner Figur darzustellen, ohne sie mit zu versponnenen Ticks auszustatten, während Lang dieser Versuchung – unter dem Vorwand, damit die seelischen Abgründe Heydrichs zu unterstreichen – erlag. Sicher, Heydrich war ein unheilbringender, unbarmherziger Saukerl, aber er war nicht Richard III. Bei besagtem Schauspieler handelt es sich um John Carradine, den Vater von David Carradine alias Bill in Tarantinos Kill Bill. Die gelungenste Szene des Films ist Heydrichs Todeskampf: Dem Tode geweiht, liegt er im Bett und wird von Fieberkrämpfen geschüttelt. Dabei hält er Himmler eine Predigt, bei der durchaus etwas Shakespeare mitschwingt, die mir aber dennoch einleuchtend erscheint: Der Schlächter von Prag scheidet weder feige noch heroisch aus dem Leben, ohne Reue, ohne Fanatismus. Er bedauert lediglich, das einzige Leben hinter sich zu lassen, das ihm tatsächlich etwas bedeutet hat – sein eigenes.
Wie gesagt: einleuchtend.
11
Die Monate ziehen vorüber, schließlich werden daraus Jahre, und in all dieser Zeit wächst die Geschichte in mir unaufhörlich. Und während mein Leben weiterläuft, wie bei jedem von uns angefüllt mit Freude, persönlichen Dramen, Enttäuschungen und Hoffnungen, füllen sich die Regale meiner Wohnung mit Büchern über den Zweiten Weltkrieg. Ich verschlinge alles, was mir in die Hände fällt, in allen möglichen Sprachen, ich werde mir alle Filme ansehen, die demnächst herauskommen – Der Pianist, Der Untergang, Die Fälscher, Black Book usw. –, im Fernsehen schaue ich nur noch den Geschichtskanal, den ich über Kabel empfange. Ich lerne haufenweise Dinge, von denen manche nur entfernt mit Heydrich zu tun haben, doch ich sage mir, dass alles nützlich sein kann und dass man sich mit einer Epoche richtiggehend vollsaugen muss, um ihren Zeitgeist zu verstehen. Und wenn man die Spur des Wissens erst einmal aufgenommen hat, folgt man ihr von ganz alleine. Das schiere Ausmaß meines angehäuften Wissens schüchtert mich schließlich ein. Ich schreibe zwei Seiten, während ich Tausende lese. Bei diesem Rhythmus werde ich sterben, bevor ich auch nur die Vorbereitungen des Attentats zu Papier gebracht habe. Mir ist sehr wohl bewusst, dass mein von Grund auf gesunder Wissensdurst allmählich pathologische Züge annimmt: Letztlich dient er als Vorwand, um das Schreiben aufzuschieben.
Während ich mich in Wartestellung befinde, habe ich den Eindruck, dass einfach alle Ereignisse meines täglichen Lebens auf diese Geschichte hindeuten. Natacha bezieht ein Studio in Montmartre, der Sicherheitscode der Eingangstür lautet 4206 – augenblicklich schießt mir durch den Kopf: Juni 42. Natacha teilt mir den Hochzeitstermin ihrer Schwester mit, und ich rufe fröhlich: «27. Mai? Unglaublich! Der Tag des Attentats!» (Natacha ist gekränkt.) Voriges Jahr im Sommer machten wir auf der Rückkehr von Budapest in München Station: auf dem großen Platz in der Altstadt ein schwindelerregender Aufmarsch von Neonazis. Beschämt erzählten mir die Münchner, so etwas hätten sie noch nie gesehen (ich weiß nicht, ob ich ihnen glauben kann). Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich mir einen Rohmer auf DVD an: Der Film spielt in den dreißiger Jahren, und der Hauptcharakter ist ein Doppelagent, der Heydrich persönlich trifft. In einem Rohmer! Amüsiert stelle ich fest, wie einen alles auf ein bestimmtes Thema hinzuweisen scheint, wenn man sich so sehr dafür interessiert.
Außerdem lese ich jede Menge historische Romane, um zu sehen, wie andere mit den Einschränkungen dieses Genres umgehen. Einige nehmen alles ganz genau, anderen scheint es mehr oder weniger egal zu sein, und wieder anderen gelingt es, sich elegant um die Begrenzungen der historischen Wirklichkeit herumzuschlängeln, ohne zu viel hinzuzudichten. Erstaunt stelle ich fest, dass in jedem einzelnen Fall die Fiktion über die historischen Ereignisse triumphiert. Eigentlich logisch, aber es fällt mir schwer, mich zu entscheiden.
Ein Erfolgsbeispiel ist meiner Meinung nach der Roman Le Mors aux dents von Vladimir Pozner. Er erzählt die Geschichte des Barons von Ungern-Sternberg; besagter Baron läuft übrigens dem Comic-Helden Corto Maltese in Corto Maltese in Sibirien über den Weg. Pozner unterteilt seinen Roman in zwei Abschnitte: Der erste spielt in Paris und beleuchtet die Recherchearbeit des Autors, der Zeugenberichte über seine Romanfigur zusammenträgt. Im zweiten Teil findet sich der Leser plötzlich mitten in der Mongolei wieder – man stolpert sozusagen unversehens in die eigentliche Romanhandlung hinein. Das Ergebnis ist eine ergreifende und äußerst gelungene Geschichte. Von Zeit zu Zeit lese ich diese Passagen. Genau genommen sind die beiden Romanabschnitte durch ein Übergangskapitel miteinander verbunden, das folgenden Titel trägt: «Drei Seiten Geschichte». Es endet mit dem Satz: «1920 hatte gerade begonnen.»
Genial, finde ich.
12
Seit etwa einer Stunde klimpert Maria unbeholfen auf dem Klavier herum, da hört sie, wie ihre Eltern das Haus betreten. Ihr Vater Bruno hält seiner Frau Elisabeth, die ein Baby auf dem Arm trägt, die Tür auf. Sie rufen nach dem kleinen Mädchen: «Komm her und schau mal, Maria! Siehst du, das ist dein Brüderchen. Er ist noch ganz klein, und du musst sehr liebevoll mit ihm umgehen. Er heißt Reinhardt.» Maria murmelt etwas Zustimmendes. Vorsichtig beugt sich Bruno über seinen neugeborenen Sohn. «Wie hübsch er ist!», sagt er. «Und so blond!», sagt Elisabeth. «Er wird einmal Musiker.»
13
Natürlich könnte (oder sollte ich sogar?) mit einer als Einleitung getarnten ausufernden Beschreibung der schönen Stadt Halle beginnen und mich in bester Victor-Hugo-Manier auf zehn Seiten über den Ort auslassen, in dem Heydrich 1904 das Licht der Welt erblickte. Ich könnte über die Straßen schreiben, die Geschäfte, die Sehenswürdigkeiten, über alle lokalen Besonderheiten, die Stadtverwaltung, die diversen Infrastrukturen, die gastronomischen Spezialitäten, die Einwohner und ihre geistige Verfassung, über ihre Sitten und Bräuche, ihre politischen Strömungen, ihre Vorlieben, ihre Hobbys. Im Anschluss böte ich eine Nahaufnahme vom Haus der Familie Heydrich: Welche Farbe haben die Fensterläden und die Vorhänge, wie ist die Zimmeraufteilung, wie die Beschaffenheit des Holzes, aus dem der Tisch in der Mitte des Wohnzimmers gefertigt wurde. In der Folge eine minuziöse Beschreibung des Klaviers, begleitet von einer ausgedehnten Abhandlung über die deutsche Musik zu Beginn des Jahrhunderts, ihren Platz in der Gesellschaft, über die Komponisten, die Rezeption ihrer Werke und die Bedeutung Wagners … Und erst dann begänne meine eigentliche Erzählung. Ich erinnere mich noch an einen nicht enden wollenden Exkurs von mindestens achtzig Seiten über die Funktionsweise der Rechtsinstitutionen im Mittelalter in Der Glöckner von Notre-Dame. Ich fand das sagenhaft. Trotzdem habe ich diese Passage übersprungen.
Also spreche ich mich dafür aus, meine Geschichte ein wenig zu stilisieren. Das trifft sich ganz gut, denn im Gegensatz zu einigen vorangehenden Episoden, bei denen ich der Versuchung widerstehen musste, mein Wissen zu sehr zur Schau zu stellen und diese oder jene Begebenheit bis ins kleinste Detail zu beschreiben, weil ich eine Überfülle an Informationen darüber besitze, muss ich im Gegenzug zugeben, dass meine Kenntnisse über Heydrichs Geburtsstadt noch äußerst mager sind. Es gibt in Deutschland zwei Städte namens Halle, und ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal, von welcher der beiden ich überhaupt spreche. Doch ich komme zu dem (vorläufigen) Schluss, dass es nicht so wichtig ist. Wir werden sehen.
14
Der Lehrer ruft die Schüler nacheinander auf: «Reinhardt Heydrich!» Als Reinhardt näher tritt, hebt ein Kind die Hand: «Herr Lehrer! Warum rufen Sie ihn nicht bei seinem richtigen Namen?» Ein freudiges Raunen geht durch das Klassenzimmer. «Er heißt Süss, das weiß doch jeder hier!» Da können sich die Schüler nicht mehr halten, sie fangen laut an zu johlen. Reinhardt sagt nichts und ballt die Fäuste. Er sagt nie etwas. Er ist der Klassenbeste. Gleich in der Turnstunde wird er wieder der Beste sein. Und er ist kein Jude. Hofft er zumindest. Anscheinend war seine Großmutter in zweiter Ehe mit einem Juden verheiratet, aber das hat nichts mit seiner eigenen Familie zu tun. So viel meint er aus den offiziellen Gerüchten und den empörten Reaktionen seines Vaters, der alles abstreitet, herausgehört zu haben, aber er ist sich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. In der Zwischenzeit wird er dafür sorgen, dass es den anderen beim Turnunterricht die Sprache verschlägt. Und wenn sein Vater ihm heute Abend Geigenunterricht erteilt, wird er ihm erzählen können, dass er wieder Erster geworden ist, und sein Vater wird stolz auf ihn sein und ihn beglückwünschen.
Doch an diesem Abend wird seine Geigenstunde ausfallen, und Reinhardt wird seinem Vater nicht einmal von der Schule erzählen können. Wenn er zurückkommt, wird er erfahren, dass Krieg ist.
«Warum ist Krieg, Papa?»
«Weil Frankreich und England auf Deutschland eifersüchtig sind, mein Sohn.»
«Warum sind sie eifersüchtig?»
«Weil die Deutschen stärker sind als sie.»
15
Nichts ist künstlicher als ein historischer Bericht mit Dialogen, die anhand von Zeugenberichten aus mehr oder weniger erster Hand rekonstruiert wurden, unter dem Vorwand, der toten Vergangenheit auf dem Papier Leben einhauchen zu wollen. Stilistisch nähert sich dieses Verfahren der Hypotypose an. Bei dieser Stilfigur wird ein Bild so lebensecht dargestellt, dass der Leser den Eindruck erhält, es direkt vor Augen zu haben. Geht es darum, ein Gespräch wiederzubeleben, wirkt das Ergebnis oft erzwungen, und der erwünschte Effekt wird ins Gegenteil verkehrt: Überdeutlich erkenne ich die grobgesponnenen Fäden, überdeutlich höre ich die Stimme des Autors heraus, der sich bemüht, die historischen Figuren nachzuahmen, sich ihren Tonfall zu eigen zu machen.
Es gibt nur drei Voraussetzungen, unter denen man einen Dialog tatsachengetreu nachbilden kann: wenn es eine Tonaufnahme, eine Videoaufzeichnung oder eine Steno-Mitschrift gibt. Wobei letztere Methode keine exakte, auf Punkt und Komma genaue Wiedergabe des Inhalts sein muss. Es kommt vor, dass der Stenograph kürzt, zusammenfasst, hier und da etwas strafft; aber gehen wir einmal davon aus, dass die Stimmung und der Ton des Gespräches trotzdem auf zufriedenstellende Weise erfasst werden.
Wie dem auch sei, meine Dialoge sind erfunden, sofern sie sich nicht auf präzise, verlässliche und wortgenaue Quellen stützen können. Meinem vorangehenden Beispiel weise ich auch nicht die Funktion einer Hypotypose zu, sondern eher die gegenteilige – die einer Parabel. Wenn schon nicht äußerst genau, dann zumindest äußerst beispielhaft. Und damit keine Verwirrung entsteht: Alle Dialoge, die ich erfinde (es wird aber nicht viele davon geben), werden wie Szenen eines Theaterstücks behandelt. Stilisierte Tropfen im Ozean der Wirklichkeit.
16
Der kleine Heydrich ist zwar niedlich, blond, ein guter Schüler, lernwillig, er spielt Geige und Klavier, mag Chemie und wird von seinen Eltern geliebt, aber er besitzt eine Krächzstimme, die ihm einen seiner vielen Spitznamen beschert hat: In der Schule nennt man ihn «die Ziege».
Zu dieser Zeit kann man sich noch über ihn lustig machen, ohne sein Leben zu riskieren. Doch es ist auch jene entscheidende Phase der Kindheit, in der man Rachegelüste entwickelt.
17
In seinem Roman Der Tod ist mein Beruf rekonstruiert Robert Merle den Lebensweg von Rudolf Höß (im Buch Rudolf Lang genannt), dem Lagerkommandanten von Auschwitz. Dabei stützt er sich auf Zeugenaussagen und Notizen, die Höß im Gefängnis zurückließ, bevor er 1947 hingerichtet wurde. Der gesamte erste Teil ist Höß’ Kindheit gewidmet, seiner fatalen Erziehung durch den ultrakonservativen, vollkommen starrsinnigen Vater. Die Intention des Autors ist offenkundig: Er möchte die Gründe oder zumindest Erklärungen für Höß’ Werdegang finden. Robert Merle versucht zu erahnen – ich sage absichtlich erahnen, nicht verstehen –, wie jemand dazu kommt, Kommandant in Auschwitz zu werden.
Meine Intention – ich sage absichtlich Intention, nicht Ambition – bei Heydrich liegt woanders. Ich werde nicht behaupten, dass Heydrich verantwortlich für die Endlösung wurde, weil seine Schulkameraden ihn «die Ziege» nannten, als er zehn Jahre alt war. Ich glaube auch nicht, dass die Hänseleien, denen er ausgesetzt war, weil man ihn für einen Juden hielt, zwangsläufig als Erklärung wofür auch immer herhalten sollten. Ich erwähne diese Tatsachen nur, um seinem späteren Ruf einen ironischen Anstrich zu verleihen: «Die Ziege» wird zu dem Mann, den man angesichts seiner Machtbefugnisse als den «gefährlichsten Mann des Dritten Reiches» bezeichnet. Und der Jude Süss verwandelt sich in den Planmeister des Holocaust. Wer hätte so etwas ahnen können?
18
Ich stelle mir die Szene vor.
Reinhardt und sein Vater beugen sich über eine Europakarte, die sie auf dem großen Tisch im Wohnzimmer ausgebreitet haben, und stecken Fähnchen um. Sie sind konzentriert bei der Sache, es sind unruhige Zeiten, die Lage ist äußerst ernst. Die glorreiche Armee von Wilhelm II. ist durch Meutereien geschwächt, aber auch die französische Armee leidet unter massenhafter Befehlsverweigerung. Und Russland wurde von der bolschewistischen Revolution quasi überrollt. Glücklicherweise ist Deutschland nicht das rückständige Russland. Die germanische Zivilisation ruht auf so soliden Pfeilern, dass die Kommunisten sie nie umstürzen könnten. Weder die Kommunisten noch die Franzosen. Und die Juden schon gar nicht. In Kiel, München, Hamburg, Bremen und Berlin wird man mit deutscher Disziplin die Zügel der Vernunft, der Macht und des Kriegsgeschehens wieder in die Hand nehmen.
Doch da geht die Tür auf. Elisabeth, die Mutter, unterbricht das Geschehen im Zimmer. Sie ist völlig außer sich. Der Kaiser hat abgedankt. Die Republik wurde ausgerufen. Ein Sozialist wurde zum Reichskanzler ernannt. Man will den Waffenstillstand unterzeichnen.
Sprachlos vor Entsetzen und mit weit aufgerissenen Augen blickt Reinhardt seinen Vater fragend an. Der bringt nach schier endlosen Sekunden einen einzigen genuschelten Satz hervor: «Das ist nicht möglich.» Es ist der 9. November 1918.
19
Ich weiß nicht, warum Heydrichs Vater Bruno Antisemit war. Dafür weiß ich, dass man ihn für einen sehr witzigen Mann hielt. Er war offenbar ein lustiger Kerl, eine echte Stimmungskanone. Es hieß, seine Witze seien viel zu lustig für einen, der kein Jude war. Zumindest dieses Argument hätte man nicht gegen seinen Sohn verwenden können, der sich nie durch einen besonders großen Sinn für Humor auszeichnete.
20
Deutschland hat verloren, und seitdem herrscht Chaos im Land. Immer mehr Menschen sind der Überzeugung, dass die Juden und Kommunisten das Land in den Ruin treiben. Der junge Heydrich wagt einen halbherzigen Vorstoß, so wie viele andere auch. Er tritt dem Freikorps bei, jener Miliz, die sich als Ersatz für die Armee betrachtet und alles bekämpft, was links von der extremen Rechten steht.
Die paramilitärischen Organisationen des Freikorps haben sich dem Kampf gegen den Bolschewismus verschrieben und wähnen ihre Existenz durch die sozialdemokratische Regierung legitimiert. Mein Vater würde sagen, dass ihn das nicht im mindesten überrascht, weil die Sozialisten seiner Ansicht nach von jeher Betrüger gewesen sind. Es läge in ihrer Natur, sich mit dem Feind zu verbünden. Er hat immer haufenweise Beispiele parat. In diesem Fall würde er sich darauf berufen, dass ein Sozialist die Spartakusrevolution niederschlug und Rosa Luxemburg ermorden ließ – von Freikorpsoffizieren.
Ich könnte mehr Einzelheiten zu Heydrichs Engagement in diesen Freikorpstruppen preisgeben, aber das erscheint mir unnötig. Es reicht zu wissen, dass er während seiner Zeit dort den «Truppen der technischen Nothilfe» angehörte. Ihre Aufgabe bestand darin, die Besetzung von Fabriken zu verhindern und das reibungslose Funktionieren der öffentlichen Betriebe im Falle eines Generalstreiks zu garantieren. Schon damals diese ausgeprägte Staatstreue!
Das Schöne an wahren historischen Ereignissen ist, dass man sich keine Gedanken über eine realistische Darstellungsweise zu machen braucht. Ich muss diese Lebensphase des jungen Heydrich gar nicht groß ausschmücken. Zwischen 1919 und 1922 wohnt er immer noch bei seinen Eltern in Halle (Halle an der Saale, ich habe mich schlaugemacht). Während dieser Zeit erhalten die Freikorps immer mehr Zuwachs. Eines dieser Freikorps ist aus den ehemaligen «weißen Truppen» des Korvettenkapitäns Ehrhardt hervorgegangen. Erkennungszeichen der Marinebrigade Ehrhardt sind die Stahlhelme mit Hakenkreuz, ihr Kampflied lautet entsprechend Hakenkreuz am Stahlhelm. Damit ist auch schon ein Bühnenbild erschaffen, das jede noch so ausführliche Beschreibung um Längen übertrifft, finde ich.
21
Es herrscht Krisenstimmung, Deutschland wird von einer Welle der Arbeitslosigkeit überschwemmt, die Zeiten sind hart. Der kleine Heydrich träumte davon, Chemiker zu werden, seine Eltern hofften, einen Musiker aus ihm zu machen. Doch in Krisenzeiten stellt die Armee die sicherste Option dar. Heydrich ist fasziniert von den Entdeckungsfahrten des legendären Admirals von Luckner. Besagter Admiral ist ein Freund der Familie, der sich selbst den Beinamen «Seeteufel» verliehen hat – in dem gleichnamigen Bestseller über seine Heldentaten. Heydrich tritt in die Marine ein. An einem Morgen im Jahr 1922 stellt sich der großgewachsene junge blonde Mann bei einer Offiziersschule in Kiel vor. In der Hand hält er einen schwarzen Geigenkasten, den ihm sein Vater geschenkt hat.
22
Auf dem deutschen Marinekreuzer Berlin ist Admiralstabsoffizier Wilhelm Canaris Erster Offizier. Canaris ist ein Held des Ersten Weltkriegs, ehemaliger Geheimagent und zukünftiger Chef der Spionageabwehr der Wehrmacht. Seine Frau spielt Violine und veranstaltet jeden Sonntag einen Musikabend in ihrem Haus. Im Streichquartett ist ein Platz frei geworden. Der junge Heydrich, der auf der Berlin angeheuert hat, erhält das Angebot, das Orchester zu vervollständigen. Er spielt offenbar gut, und seine Gastgeber schätzen – im Gegensatz zu seinen Kameraden – seine Gesellschaft. Er wird Stammgast bei Frau Canaris’ Musikabenden und lauscht dort den Erzählungen seines Vorgesetzten, die ihn schwer beeindrucken. «Spionage!», denkt er und träumt vor sich hin.
23
Heydrich ist ein schneidiger Offizier der Kriegsmarine und ein furchterregender Fechter. Sein Ruf als Draufgänger bei sportlichen Wettkämpfen hat ihm den Respekt seiner Kameraden verschafft, wenn auch nicht deren Freundschaft.
In Dresden findet in jenem Jahr ein Wettkampf für deutsche Offiziere statt. Heydrich tritt am Säbel an, der brutalsten Waffe überhaupt, seiner Spezialität. Im Gegensatz zum Florett, bei dem nur die Spitze zum Stoß eingesetzt wird, geht man beim Säbel mit der Schneide auf Hieb und Stoß, und die wie Peitschenschläge ausgeführten Hiebe sind unvergleichlich gewalttätiger. Der Körpereinsatz der Säbelkämpfer ist ebenfalls spektakulärer. All das kommt dem jungen Heydrich sehr zupass. An jenem Tag gerät er jedoch schon in der ersten Runde in arge Bedrängnis. Wer ist sein Gegner? Meine Recherchen haben diesbezüglich nichts ergeben. Ich stelle mir einen Linkshänder in Quart-Position vor; er ist wendig, gewieft und dunkelhaarig, wahrscheinlich kein Jude, das wäre wohl zu viel des Guten. Ein Spieler, der sich nicht beeindrucken lässt; er weicht aus, entzieht sich dem Kampf und reiht eine Körperfinte an die nächste, wobei jede für sich eine kleine Provokation darstellt. Trotzdem gilt Heydrich weithin als Favorit. Doch er wird immer gereizter, seine Hiebe verfehlen den Gegner und verlieren sich in der Luft, immerhin gelingt es ihm, in der Wertung wieder aufzuholen. Doch beim letzten Hieb tappt er in die offene Falle, er macht einen zu gewagten Vorstoß, sein Gegner pariert und startet einen Gegenangriff, bei dem er Heydrich am Kopf touchiert. Heydrich spürt, wie die Klinge des Gegners auf seinen Helm knallt. Er ist erledigt – in der ersten Runde. Vor lauter Wut zertrümmert er seinen Säbel auf dem Boden. Die Kampfrichter erteilen ihm eine Verwarnung.
24
Der 1. Mai ist in Frankreich ebenso wie in Deutschland der Tag der Arbeit. Sein Ursprung geht auf den lange zurückliegenden Beschluss der Zweiten Internationale zurück, an diesem Tag des großen Arbeiterstreiks vom 1. Mai 1886 in Chicago zu gedenken. Doch an diesem Datum jährt sich auch ein Ereignis, dessen Bedeutung nicht auf der Stelle erkannt werden konnte und dessen Konsequenzen nicht absehbar waren. Es steht selbstverständlich nicht zur Debatte, diesen Jahrestag in irgendeinem Land zu feiern: Am 1. Mai 1925 schuf Hitler ein Elitekorps, das ursprünglich seinem eigenen Schutz dienen sollte. Diese Garde setzte sich aus übertrainierten Fanatikern zusammen, die äußerst strikten Rassekriterien entsprachen. Es handelte sich um die Schutzstaffel, die SS.
1929 verwandelte sich die Spezialgarde in eine richtige Miliz, eine paramilitärische Organisation, die Himmler unterstand. Nach der Machtübernahme 1933 erklärte er bei einer Ansprache in München, jeder Staat brauche eine Elite. Die Elite des nationalsozialistischen Staates sei die SS. In ihr würden sich auf der Grundlage rassischer Auslese – entsprechend den Anforderungen der Gegenwart – die deutsche Militärtradition, die deutsche Würde und Erhabenheit sowie die industrielle Leistungsfähigkeit der Deutschen verewigen.
25
Ich habe mir immer noch nicht das Buch besorgt, das Heydrichs Frau nach dem Krieg geschrieben hat: Leben mit einem Kriegsverbrecher. Das Werk wurde noch nie übersetzt, weder ins Französische noch ins Englische. Ich schätze, dieses Buch könnte eine ergiebige Informationsquelle für mich sein, aber es gelingt mir einfach nicht, es mir zu beschaffen. Anscheinend ist das Buch äußerst selten, sein Preis liegt im Internet zwischen 350 und 700 Euro. Ich nehme an, dass die deutschen Neonazis aufgrund ihrer Faszination für Heydrich, einen Nazi, wie sie ihn sich selbst nicht perfekter hätten ausmalen können, für diesen exorbitanten Preis verantwortlich sind. Einmal habe ich ein Exemplar für 250 Euro gefunden und wollte die Verrücktheit begehen, es mir zu bestellen. Die deutsche Buchhandlung, die das Buch zum Verkauf anbot, akzeptierte allerdings keine Kartenzahlung, was sich schließlich als Segen für meinen Geldbeutel erwies. Um dieses kostspielige Exemplar zu bekommen, hätte ich meiner Bank den Auftrag für eine Überweisung auf ein deutsches Konto erteilen müssen. Zu diesem Zweck nannte man mir eine endlose Folge aus Zahlen und Buchstaben; die Transaktion konnte aber nicht direkt übers Internet stattfinden, ich hätte mich persönlich zu meiner Bank begeben müssen. Diese komplizierte Methode hätte wohl jeden normalen Menschen abgeschreckt, jedenfalls brachte sie mich letztlich davon ab, das Vorhaben weiterzuverfolgen. Abgesehen davon entsprechen meine Deutschkenntnisse dem Niveau eines Fünftklässlers (obwohl ich in der Schule acht Jahre lang Deutsch hatte), sodass die Investition sowieso von fragwürdigem Nutzen gewesen wäre.
Ich muss also ohne dieses wichtige Werk auskommen. Jedenfalls bin ich jetzt an dem Stadium der Geschichte angelangt, an dem ich von der Begegnung zwischen Heydrich und seiner Frau erzählen sollte. Zweifellos wäre mir das seltene und kostspielige Buch an keiner Stelle so hilfreich gewesen wie an dieser.
Wenn ich sage: «erzählen sollte», will ich damit natürlich nicht sagen, dass es absolut notwendig ist, von ihrer ersten Begegnung zu berichten. Ich könnte die gesamte Operation «Anthropoid» sehr gut erzählen, ohne ein einziges Mal den Namen Lina Heydrich zu erwähnen. Doch wenn ich die Figur des Heydrich lebendig darstellen will, und ich scheine ganz versessen darauf zu sein, finde ich es schwierig, die Rolle seiner Ehefrau während seines rasanten Aufstiegs in Nazideutschland einfach unter den Teppich zu kehren.
Zugleich bin ich dankbar dafür, um die romantische Version ihrer Zweisamkeit herumzukommen, die Frau Heydrich in ihren Memoiren sicherlich zum Besten gibt. So laufe ich nicht Gefahr, eine Szene wie aus einem Kitschroman einzufügen. Nicht, dass ich mich weigern würde, auch die menschlichen Aspekte eines Wesens wie Heydrich zu betrachten. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die über den Film Der Untergang empört waren, weil dort (unter anderem) ein Hitler zu sehen ist, der seinen Sekretärinnen gegenüber freundlich ist und seinen Hund liebevoll behandelt. Ich nehme einfach an, dass Hitler von Zeit zu Zeit liebenswürdig sein konnte. Ich bezweifle auch nicht, dass Heydrich sich aufrichtig in seine zukünftige Frau verliebte, als er sie kennenlernte, zumindest schließe ich das aus den Faksimiles seiner Briefe an sie. Sie war damals eine junge Frau mit strahlendem Lächeln, die man durchaus als hübsch bezeichnen konnte, und noch weit entfernt von der Rabenmutter mit gestrengem Gesicht, die sie einmal werden sollte.
Ein Biograph schildert ihre erste Begegnung mit Heydrich und verlässt sich dabei ganz auf Linas Erinnerungen – was dabei herauskommt, ist purer Kitsch: Lina ist auf einer Tanzveranstaltung und langweilt sich, weil zu wenig junge Herren anwesend sind. Sie befürchtet schon, dass der ganze Abend ein Reinfall wird, da werden sie und ihre Freundin von einem schwarzhaarigen Offizier angesprochen. Der Offizier ist in Begleitung eines schüchternen blonden jungen Mannes, der sich Hals über Kopf in Lina verliebt. Zwei Tage später folgt ein Rendezvous im Kieler Hohenzollernpark (sehr hübsch, ich habe Fotos davon gesehen) mit romantischem Spaziergang am See entlang. Am nächsten Tag ein Theaterbesuch, gefolgt von einem Schäferstündchen in einem gemieteten Zimmer, zumindest nehme ich an, dass sie dort miteinander geschlafen haben, auch wenn der Biograph diesbezüglich äußerst diskret bleibt: Die offizielle Version besagt, dass Heydrich in seiner schönsten Uniform aufkreuzt und sich beide nach dem Theaterbesuch noch ein Gläschen genehmigen. Schweigsam sitzen sie bei einem Glas Wein beisammen, als Heydrich Lina aus heiterem Himmel fragt: «Fräulein von Osten, wollen Sie meine Frau werden?» Verblüfft antwortet Lina: «Mein Gott, Herr Heydrich, Sie kennen ja überhaupt nicht meine Eltern, wissen nichts vom Beruf meines Vaters. Sie sind Seeoffizier und haben Ihr Reglement, Ihre Heiratsvorschriften.» An einer anderen Stelle habe ich gelesen, dass Lina zuvor den Schlüssel für ein Zimmer abgeholt hatte, und daraus geschlossen, dass sie an diesem Abend – entweder vor oder nach Heydrichs Heiratsantrag – den Liebesakt vollzogen. Wie sich später herausstellt, entstammt Lina von Osten einer (ein wenig deklassierten) Aristokratenfamilie und ist somit eine sehr gute Partie. Also wird geheiratet.
Diese Geschichte bringt mich auf eine andere. Ich hatte schon keine Lust, die Szene auf der Tanzveranstaltung genauer zu beschreiben, das gilt erst recht für den Spaziergang durch den Park. Es wäre besser, keine weiteren Details zu kennen, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme, sie zu erzählen. Wenn ich über Einzelheiten stolpere, mit deren Hilfe ich eine ganze Szene aus Heydrichs Leben minuziös nachbilden kann, fällt es mir oft schwer, dieser Versuchung zu widerstehen, selbst wenn die Szene an sich keine besondere Bedeutung hat. Ich nehme an, dass Linas Memoiren mit Geschichten dieser Art gespickt sind.
Letzten Endes werde ich wohl auf das völlig überteuerte Buch verzichten können.
Trotzdem hat etwas an der Geschichte des Kennenlernens der beiden Turteltäubchen mein Interesse geweckt: Der dunkelhaarige Offizier, der Heydrich begleitete, hieß von Manstein. Zunächst habe ich mich gefragt, ob es sich um den Manstein handelt, der während des Frankreich-Feldzugs die Ardennenoffensive ausklügelte und später Generalfeldmarschall an der russischen Front war – in Leningrad, Stalingrad und Kursk. Selbiger Manstein leitete 1943 das «Unternehmen Zitadelle», mit dem die Wehrmacht einem bevorstehenden Großangriff der Roten Armee zuvorkommen wollte. 1941 gab Manstein eine Erklärung ab, mit der er die Arbeit von Heydrichs Einsatzgruppen an der russischen Front rechtfertigte: «Für die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum, dem geistigen Träger des bolschewistischen Terrors, muss der Soldat Verständnis aufbringen. Sie ist auch notwendig, um alle Erhebungen, die meist von Juden angezettelt werden, im Keime zu ersticken.»
Manstein starb 1973, was bedeutet, dass ich ein Jahr lang auf demselben Planeten gelebt habe wie er. Um ehrlich zu sein, ist die Übereinstimmung unwahrscheinlich; der dunkelhaarige Offizier wird als junger Mann beschrieben, während Manstein 1930 schon dreiundvierzig Jahre alt war. Vielleicht handelte es sich um jemanden aus seiner Familie, einen Neffen oder Cousin zweiten Grades.
Die junge Lina war, soweit man weiß, bereits mit achtzehn überzeugte Nationalsozialistin. Sie behauptet, Heydrich bekehrt zu haben. Einige Indizien deuten darauf hin, dass sie die Wahrheit sagt, allerdings stand Heydrich schon vor 1930 politisch deutlich weiter rechts als der durchschnittliche Soldat und fühlte sich vom Nationalsozialismus stark angezogen. Aber natürlich hat die Version von der «Frau hinter den Kulissen» etwas Verführerischeres …
26
Zweifellos ist es gewagt, den Moment bestimmen zu wollen, an dem der Lebensweg eines Menschen ins Wanken gerät. Ich weiß nicht einmal, ob solche Momente überhaupt existieren. In seinem Buch Adolf H. Zwei Leben