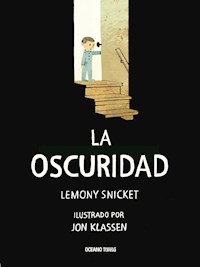9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Meine rätselhaften Lehrjahre
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein junger Detektiv, eine Stadt in Gefahr – und endlich die langersehnten Antworten!
Das kleine Städtchen Schwarz-aus-dem-Meer wird von einem finsteren Schurken bedroht. Brandhorst tut alles dafür, eine hier versteckte geheimnisvolle Statue in seinen Besitz zu bringen. In der Hoffnung, seine Pläne vereiteln und die Stadt retten zu können, folgt der Detektivanwärter Lemony Snicket seiner Mentorin Theodora zu einer geheimen Mission an Bord eines Zuges. Hier trifft er nicht nur auf nahezu all seine Verbündeten, sondern auch auf die von Brandhorst. Und kaum liegt Schwarz-aus-dem-Meer hinter ihnen, geschehen äußerst hässliche Dinge. Snicket weiß: Nur die Statue kann die Stadt noch retten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Ähnliche
Buch
Die Stadt Schwarz-aus-dem-Meer ist in Auflösung begriffen. Die Schule ist abgebrannt, und die Schulkinder sind Gefangene des Schurken Brandhorst, der alles daransetzt, die Statue eines Fabelwesens namens Bordunbestie in seinen Besitz zu bringen. In der Hoffnung, Brandhorsts Pläne vereiteln und die Stadt retten zu können, folgt der Detektivanwärter Lemony Snicket seiner Mentorin Theodora, als diese sich zu einer Geheimmission aus dem gemeinsamen Hotelzimmer davonschleicht. Nach beträchtlichen Mühen und Gefahren findet sich Snicket in einem Zug namens Seedistel wieder. Wie er allerdings schon bald feststellt, sind nicht nur nahezu all seine Freunde mit an Bord, sondern auch die Verbündeten von Brandhorst. Und Schwarz-aus-dem-Meer liegt gerade erst hinter ihnen, da geschieht ein hinterhältiger Mord. Die Wachtmeister Mitchum verhaften kurzerhand Theodora und erklären den Fall für abgeschlossen, und so muss sich Lemony Snicket auf eigene Faust daranmachen, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen.
Weitere Informationen zu Lemony Snicket sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Roman
Illustrationen von Seth
Ins Deutsche übertragen
von Sabine Roth
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»Why Is This Night Different from All Other Nights?
All The Wrong Questions 4«
bei Little, Brown and Company, a division of
Hachette Book Group Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Lemony Snicket
Copyright © der Illustrationen 2015 by Seth
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Jacket art © 2015 Seth;
Jacket design by Gail Doobinin;
Jacket © 2015 Hachette Book Group, Inc.
Redaktion: Heiko Arntz
Satz: Buch-Werkstatt, Bad Aibling GmbH
ISBN: 978-3-641-13682-6V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
An: B. und P. Bellerophon
Von: LS
Schlagworte: Schwarz-aus-dem-Meer, Einzelheiten über; Mord, Ermittlungen zu; Brandhorst; Bordunbestie.
4/4
Cc: FF-HQ
Eine Stadt war im Spiel, und ein Zug war im Spiel, und ein Mord. Ich fuhr mit dem Zug mit, und ich dachte, wenn ich den Mord aufklären würde, könnte ich dadurch die Stadt retten. Ich war fast dreizehn, und ich lag falsch. Ich lag auf der ganzen Linie falsch. Die richtige Frage wäre gewesen: »Was ist schändlicher, einen Mörder zu decken oder selbst zu einem zu werden?« Stattdessen stellte ich die falsche Frage – vier falsche Fragen, um genau zu sein. Hier ist der Bericht über die letzte.
Ich lag in einem kleinen Zimmer, schlaflos und argwöhnisch. Das Zimmer, in dem ich lag, trug den Namen Fernostsuite und lag seinerseits im Weißen Torso, dem einzigen Hotel der Stadt. Die Fernostsuite war mit einer Kommode und einem Tischchen mit Kochplatte möbliert, auf der schon etliche bemerkenswert schlechte Mahlzeiten erhitzt worden waren. Ein absonderliches Gebilde an der Decke diente als Leuchte, und ein Bild von einem Mädchen mit einem verletzten Hund auf dem Arm musste als Wandschmuck herhalten. Es gab ein einzelnes Fenster mit einem einzelnen Fensterladen davor, weshalb es im Zimmer unangenehm dämmrig war, außer frühmorgens. Frühmorgens war es unangenehm hell.
Den Hauptteil der Fernostsuite nahmen jedoch zwei Betten ein, und die Hauptursache für meinen Argwohn lag in dem größeren der beiden. Sie hieß S. Theodora Markson. Ich war ihr Praktikant, und sie war meine Mentorin und der Grund, warum ich überhaupt in Schwarz-aus-dem-Meer gelandet war. Ihre Haare waren zottlig und ihr Auto grün, und das war das Positivste, was mir zu ihr einfiel. Wir hatten Streit wegen unseres letzten großen Falls gehabt, den jeder nachlesen kann, der Spaß daran hat, etwas über die Streitereien anderer Leute zu lesen. Seitdem war sie wütend auf mich, hatte mir aber verboten, wütend auf sie zu sein. Deshalb wechselten wir in letzter Zeit kaum ein Wort miteinander, nur gelegentlich fragte ich sie, wofür das S in ihrem Namen stand, und bekam zur Antwort: »Sei nicht so neugierig.« An diesem Abend hatte sie verkündet, wir zwei würden heute mit den Hühnern zu Bett gehen. Früh zu Bett gehen ist schön und gut, solange man nicht seine ganze Umgebung mit reinzieht. Jetzt plusterte sich ihre Strubbelmähne auf dem Kissen wie ein Mopp, der sich vom Dach gestürzt hat, und sie schnarchte auf eine Art, wie ich es von ihr sonst nicht gewohnt war. Es ist eine einsame Angelegenheit, hellwach im Bett zu liegen, während im Nachbarbett geschnarcht wird.
Ich sagte mir, dass es eigentlich keinen Grund gab, sich einsam zu fühlen. Schließlich hatte ich eine Anzahl von Gefährten in Schwarz-aus-dem-Meer, Leute etwa in meinem Alter, die ähnliche Interessen hatten wie ich. Unser dringendstes Interesse war es, einem Schurken namens Brandhorst das Handwerk zu legen. Meine Verbündeten und ich hatten dafür einen Ad-hoc-Ableger der Organisation gegründet, in deren Auftrag ich hier war. »Ad hoc« hieß in diesem Fall, dass wir auf uns gestellt waren und versuchten, das Beste draus zu machen. Brandhorst zog verdeckt die Fäden, um die Statue eines Fabelwesens namens Bordunbestie an sich zu bringen, darum hielten meine Freunde und ich unsere Aktivitäten nun ebenfalls geheim, damit Brandhorst uns nicht auf die Spur kam. Wir trafen uns nicht mehr so oft wie früher, sondern arbeiteten jeder solo, in der Hoffnung, so Brandhorsts Pläne vereiteln und Schwarz-aus-dem-Meer retten zu können.
Der ferne Pfiff einer Lokomotive erinnerte mich daran, dass meine Verbündeten und ich bislang nicht sonderlich viel erreicht hatten. Die Stadt Schwarz-aus-dem-Meer war in Auflösung begriffen. Der Meer war abgelassen worden, um die Tintenindustrie über Wasser zu halten, aber nun ging die Tintenindustrie den Bach runter und die ganze übrige Stadt mit ihr. Die Zeitung gab es nicht mehr. Die einzige reguläre Schule war abgebrannt, und die Schulkinder der Stadt waren Gefangene. Brandhorst und seine Komplizen von der Antihumanen Sozietät hatten sie in die Offshore-Akademie verschleppt, ein ehemaliges Internat auf einer ehemaligen Insel, zu Zwecken, die nur perfide sein konnten, ein Wort, das hier so viel bedeutet wie »böse und unter Zuhilfenahme von gestohlenen Honigmelonen und ausrangiertem Aquariumszubehör«. Der einzige Bibliothekar der Stadt, Dashiell Qwertz, war als Brandstifter verhaftet worden, weswegen ihn die einzigen zwei Wachtmeister der Stadt nun aus seiner Zelle holen und in den einzigen Zug der Stadt setzen würden, damit er in der Hauptstadt vor Gericht kam.
Du weißt, wer dort noch vor Gericht gestellt wird, sagte ich mir, aber der Gedanke an meine Schwester war nicht gerade schlaffördernd. Kit war erwischt worden, als sie versucht hatte, allein ein Ding zu drehen, bei dem ich ihr hätte helfen sollen. Ich hatte große Schuldgefühle deswegen und schrieb ihr im Geist einen Brief nach dem anderen. Sie begannen alle mit »Liebe Kit«, aber danach wurde es schwierig. Manchmal versprach ich ihr, sie da rauszuholen, aber das war ein Versprechen, das ich möglicherweise nicht halten konnte. Manchmal versicherte ich ihr, dass sie bald freikommen würde, aber ich wusste nicht, ob das stimmte. Also sagte ich ihr, dass ich an sie dachte, aber das erschien mir so dürftig, dass ich meine Phantasiebriefe einen nach dem anderen zusammenknüllte und in einen sehr dekorativen Phantasiepapierkorb warf.
Und dann ist da die eine, dachte ich, die dich mehr Schlaf gekostet hat als alle anderen zusammen. Wie ich stammte auch Ellington Feint nicht aus Schwarz-aus-dem-Meer. Sie war hergekommen, um ihren Vater aus Brandhorsts Fängen zu befreien. Sie sei zu allem bereit, um ihm zu helfen, hatte sie mir gesagt, und dieses »alles« hatte sich als eine Reihe handfester Straftaten entpuppt. Die Straftaten hatten sie zum Schluss eingeholt, und jetzt war sie in dem winzigen Gefängnis von Schwarz-aus-dem-Meer eingesperrt. Der Zug holt auch sie ab, sagte ich mir. Er fährt mit ihr durch die Außenbezirke der Stadt und hinab ins Tal, das einmal der Meeresgrund war. Er trägt sie vorbei am Klausterwald, diesem riesigen gesetzlosen Dschungel aus Seetang, der sich ohne Wasser am Leben erhält, und du siehst sie vielleicht nie wieder.
So viele Menschen, die dich beschäftigen, Snicket, und trotzdem bist du allein.
Wieder pfiff der Zug, lauter diesmal, aber vielleicht wirkte es auch nur lauter, weil Theodoras seltsames Schnarchen verstummt war. Es war deshalb verstummt, weil es kein Schnarchen war. Sie hatte sich nur schlafend gestellt. Ich schloss die Augen und lag ganz still, um herauszufinden, warum.
»Snicket?«, flüsterte sie in dem dunklen Zimmer. »Lemony Snicket?«
Ich gab keinen Laut von mir. Wer sich schlafend stellt, sollte nie vor Leuten schnarchen, die wissen könnten, wie sein richtiges Schnarchen sich anhört. Er sollte einfach atmen und stillhalten. Es gibt haufenweise Situationen, in denen diese Strategie sich bewährt.
»Snicket?«
Ich hielt still und atmete.
»Snicket, ich weiß, dass du wach bist.«
Auf diesen Uralt-Trick fiel ich nicht herein. Ich lauschte, während Theodora seufzte und gleich darauf unter großem Geknarze aus dem Bett stieg und ins Bad tappte. Es klickte, und über mein Gesicht fiel ein schmaler Lichtstreif. Ich reagierte nicht. Theodora raschelte im Bad herum, und dann verlosch das Licht, und als sie am Bett vorbeikam, klangen ihre Schritte anders als vorher. Sie musste ihre Stiefel angezogen haben. Sie ging aus! Sie stand wieder auf und ging aus, während gleichzeitig auf dem Bahnhof der Zug einfuhr!
Der Türknauf drehte sich, dann Stille. Wahrscheinlich sah sie noch einmal zu mir zurück. Ich hätte die Augen aufschlagen oder einfach aus dem Dunkeln heraus »Viel Glück« sagen sollen. Das hätte sie schön erschreckt. Aber ich ließ sie hinausschlüpfen und die Tür schließen.
Ich beschloss, bis zehn zu zählen, um sicherzugehen, dass sie wirklich weg war. Als ich bei vierzehn angelangt war, öffnete sie die Tür noch einmal und sah zu mir herein. Dann verschwand sie erneut und zog die Tür erneut zu, und ich zählte erneut und dann noch mal von vorn, und dann stand ich auf und knipste das Licht an und sputete mich. Ich war im Nachteil, weil ich im Schlafanzug war und ein bisschen brauchte, um meine Kleider zusammenzusuchen. Ich zog ein langärmliges Hemd mit steifem Kragen an, das noch halbwegs sauber war, und meine besten Schuhe und eine Jacke, die zu einer warmen Hose mit sehr robustem Gürtel passte. Den Gürtel erwähne ich aus einem bestimmten Grund. Ich eilte zur Tür und spähte vorsichtig den Gang entlang, ob sie noch irgendwo lauerte, aber so schlau war S. Theodora Markson dann doch nicht.
Ich schaute zurück in das Zimmer. Die sternförmige Deckenleuchte schien auf alles herab. Das Mädchen mit dem Hund mit der verbundenen Pfote betrachtete mich mit seiner üblichen Leidensmiene, als hätte es Langeweile und hoffte, ich würde ihm eine Zeitschrift bringen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich die Fernostsuite für immer verließ, hätte ich mir vielleicht etwas mehr Zeit genommen. So aber begnügte ich mich mit einem raschen Blick. Das Zimmer sah einfach wie ein Zimmer aus. Ich löschte das Licht.
In der Hotelhalle erwarteten mich zwei bekannte Gestalten, aber keine davon war meine Mentorin. Die eine war die Gipsstatue einer Frau ohne Kleider und ohne Arme, die wie stets in der Mitte der Halle stand, und die andere war Prosper Weiss, der Geschäftsführer, der mir von der Rezeption mit seinem üblichen Lächeln entgegenblickte. Ich tue alles für dich, hieß dieses Lächeln, absolut alles, vorausgesetzt, es macht keine Umstände.
»Einen schönen guten Abend, Lemony Snicket.«
»Guten Abend«, erwiderte ich. »Wie geht es Ihrer Tochter?«
»Wenn du dich nicht so früh schlafen gelegt hättest, wärst du ihr begegnet«, sagte Prosper. »Sie hat vorbeigeschaut, um mich zu besuchen, und für dich hat sie auch etwas abgegeben.«
»Tatsächlich?«, sagte ich. Ornette Weiss war eine meiner Verbündeten und wohnte aus Gründen, die ich nicht ganz durchschaute, nicht bei ihrem Vater, sondern bei ihren Onkeln, den einzig verbliebenen Feuerwehrmännern der Stadt.
»Ja, tatsächlich«, sagte ihr Vater und zog hinter seinem Tresen einen kleinen, aus Papier gefalteten Gegenstand hervor. Ich nahm ihn, und im selben Moment pfiff wieder die Lokomotive.
Es war ein Eisenbahnwaggon.
»Ornette hatte schon immer ein Händchen dafür, aus ganz gewöhnlichen Materialien ungewöhnliche Dinge herzustellen«, sagte Weiss. »Es muss in der Familie liegen. Ihre Mutter interessierte sich sehr für Bildhauerei.«
»Tatsächlich?«, sagte ich wieder, ohne recht hinzuhören. Wenn man einen gefalteten Papierzug zugespielt bekommt, darf man sich ein Momentchen fragen, warum.
»O ja«, sagte Weiss. »Alice besaß eine gewaltige Skulpturensammlung und hat auch selbst etliche Statuen geschaffen. Sie hat sie im Fernwestflügel unseres Hotels ausgestellt. Meine Frau hatte gehofft, die Glyptothek würde Touristen anlocken, aber es lief nicht so wie geplant.«
»Das tut es fast nie«, sagte ich. »Glyptothek« ist ein Wort, das hier so viel bedeutet wie »Ort, an dem Skulpturen ausgestellt sind«, aber ich war zu beschäftigt damit, den Zug auseinanderzufalten. Er bestand aus einer einzelnen Visitenkarte. Alle meine Verbündeten hatten neuerdings Visitenkarten, auf denen ihr Name und ihr Spezialgebiet abgedruckt standen. »Bildhauerin« stand auf dieser hier.
»Die meisten Statuen sind leider ein Raub der Flammen geworden«, sagte Weiss. »Ornette roch den Rauch als Erste – auch so etwas, das bei uns in der Familie liegt. Bis ihre Onkel eintrafen, um den Brand zu löschen, hatte meine Tochter schon das ganze Hotel geweckt und Gästen und Personal geholfen, sich in Sicherheit zu bringen. Alle konnten gerettet werden – alle außer Alice.«
Ich riss den Blick von dem Stück Papier in meiner Hand los und sah in die traurigen Augen von Prosper Weiss. Ich hatte das Hotel, in dem ich wohnte, und den Mann, der es führte, immer heruntergekommen und deprimierend gefunden. Jetzt sah ich beide zum ersten Mal als vom Schicksal gestraft. »Das tut mir leid«, sagte ich. »Ich hatte keine Ahnung.«
»Ich habe es dir ja auch nicht erzählt«, sagte Weiss mit seinem matten Lächeln. »Jeder hat so seine Sorgen, nicht wahr, Snicket?«
»Aber nicht jeder so schlimme wie Sie, Weiss.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, sagte Weiss leise. »Mir scheint, du und ich sitzen im selben Boot – beide allein hier in der Halle.«
»Dann haben Sie meine Mentorin weggehen sehen?«
»Ja, gerade eben.«
»Hat sie Ihnen gesagt, wo sie hingeht?«
»Leider nein.«
»Hat sie sonst irgendetwas gesagt?«
Prosper Weiss verlagerte sein Gewicht auf das andere Bein. Es musste anstrengend sein, immerzu hinter der Rezeption zu stehen, aber ich konnte mich nicht erinnern, ihn je sitzend angetroffen zu haben. »Allerdings«, sagte er, »sie sagte, falls sie bis morgen nicht zurück ist, soll ich mich darum kümmern, dass du versorgt bist.«
»Wie bitte?«
»Sie hat gesagt, falls sie bis morgen …«
»Ich hab Sie gehört, Weiss. Sie hat gesagt, sie kommt nicht wieder zurück.« Meine Mentorin hatte schon einmal damit gedroht abzureisen, aber nach den Regeln unserer Organisation durften Praktikanten nicht unbetreut zurückbleiben. Ich sah wieder auf den Papierzug hinab. Er war aus einer Karte gefaltet, die für Mitteilungen gedacht war. Aber was will mir Ornette mitteilen, fragte ich mich – reichlich sinnlos, da ich die Antwort nicht wusste, also stellte ich die nächste Frage wieder Weiss. »Wie lange hält der Zug am Bahnhof?«, fragte ich ihn.
»Oh, eine ganze Weile«, sagte er mit einem Blick auf seine Uhr. »In Schwarz-aus-dem-Meer wird die Lokomotive gewechselt, und es dauert endlos, all die Fahrgäste einzuladen. Es scheint immer mehr Menschen zu geben, die die Stadt verlassen wollen.«
»Hören Sie zu, Weiss«, sagte ich. »Sollte ich bis morgen nicht zurück sein, tun Sie mir dann einen Gefallen?«
»Was denn?«
»Neben meinem Bett liegt ein Buch«, sagte ich. »Wenn ich nicht zurückkomme, geben Sie es bitte den Bellerophon-Brüdern.«
»Den Taxifahrern?«, fragte er. »In Ordnung, Snicket. Wenn du es so möchtest. Obwohl ich erstaunt bin, dass du es nicht mitnimmst. Ich hatte den Eindruck, dass du nie ohne Buch weggehst.«
»Das stimmt«, sagte ich, »aber es ist ein Bibliotheksbuch.«
»Die Bibliothek ist von der Berieselungsanlage zerstört worden, Snicket. Hast du das vergessen?«
»Natürlich nicht«, sagte ich, »aber ich sollte es trotzdem nicht einfach mitnehmen. Obwohl es schade ist. Ich bin erst bei der Hälfte.«
»So geht’s im Leben«, sagte Prosper Weiss in bekümmertem Ton. »Es gibt Geschichten, deren Ende man nie erfährt.«
Ich nickte zustimmend, und ich sah ihn nie wieder. Draußen war die Luft kälter, als ich gedacht hatte, aber nicht kälter, als ich es mag. Ich wandte mich in Richtung Bahnhof, in Gedanken noch bei dem Buch. Es handelte von einem Mann, der eines Abends ins Bett geht, und als er aufwacht, ist er in einen Käfer verwandelt. Daraus entstehen ihm jede Menge Unannehmlichkeiten. Die Straßen waren leer, und ich musste mehrere Blocks gehen, bis zu dem letzten verbleibenden Kaufhaus der Stadt, ehe ich auch nur einer Menschenseele begegnete.
Madigs Modehaus sah aus wie ein Turm aus sauber ineinandergesteckten quadratischen Fenstern, die alle das Sternenlicht einfingen und genauso funkelten wie der Himmel oben. Und in jedem Fenster posierte eine Schaufensterpuppe mit Madig-Kleidern oder einem der vielen sonstigen Madig-Artikel. Um diese Zeit hatte der Laden natürlich geschlossen, aber ein paar Lichter brannten im Innern noch, und die Schaufensterpuppen blickten alle mit unheimlicher Konzentration zum Eingang hin, einer hohen, verschnörkelten Doppeltür, die durch ein Vorhängeschloss von der Größe eines Handkoffers gesichert war. Im Clinch mit diesem Schloss lag S. Theodora Markson. Ihre Bemühungen, sich Zutritt zu Madigs Modehaus zu verschaffen, waren verbissen und erforderten den Einsatz beider Hände und gelegentlich auch eines Fußes, und ihre Zottelmähne schwang hin und her, während sie an dem Schloss herumturnte. Von der anderen Straßenseite aus gesehen, hätte sie beinahe ein Käfer sein können, so verzweifelt und panisch wie der Mann in dem Buch. Wie das wohl ausgeht?, dachte ich.
Schließlich aber hatte Theodora die Tür so weit, dass sie nachgab, und huschte hinein. Ich wartete kurz, dann folgte ich ihr. Übertrieben vorsichtig ging ich dabei nicht vor. Ein Mensch, der auf offener Straße minutenlang mit einem Schloss kämpft, sorgt sich nicht groß um Verfolger. In dem Schloss steckte ein großes, spitzes Gerät aus Eisen. Es war ein Dietrich, aber kein sehr guter. Ein guter Dietrich öffnet jedes Schloss in Sekunden. Ein schlechter Dietrich öffnet mit viel Glück ab und zu eins, und das nur nach zähem Ringen. Ich betrachtete ihn, aber recht flüchtig, denn ich kannte ihn schon. Es war im Zweifelsfall der einzige in der ganzen Stadt. Ich ließ ihn stecken. Ich hatte keinen Dietrich bei mir, als ich Madigs Modehaus betrat. Ich hatte nur die Kleider, die ich am Leib trug, und einen kleinen Eisenbahnwaggon aus Papier. Meine Mentorin hatte etwas Besseres. Sie hatte ein Geheimnis.
Madigs Modehaus lag im Dunkeln. Gleich hinter dem Eingang kam die Parfümabteilung, Regale über Regale voll wartender Glasflaschen wie in dem verlassenen Labor eines verrückten Wissenschaftlers. Ich schaute mich in dem großen Raum um. Nichts regte sich – bis auf ein Lichtpünktchen drüben an der Wand. Ich suchte mir meinen Weg dorthin. Die Flaschen beobachteten mich. Ich war noch nie ein großer Parfümfreund. Für mich riecht es immer, als wäre jemand von einem Blumenlaster überfahren worden.
Das Licht an der Wand befand sich über den Aufzugtüren und zeigte an, dass der Aufzug in Benutzung war. Das Lämpchen mit der 4 leuchtete auf, dann das mit der 5. Theodora fuhr nach oben. Es gab einen zweiten Aufzug, aber ihn zu nehmen wäre zu riskant gewesen. Ich würde abwarten, wo ihrer zum Halten kam. Dann würde ich die Treppe nehmen. Ich hoffte, er würde bald halten. Er hielt bei 10.
Die Treppe war breit und sehr prächtig, mit einem Geländer, das bei Licht vermutlich aus Messing war, und einem Läufer, der bei Licht vermutlich rot war. Ohne Licht war das Geländer einfach nur verschmiert und der Läufer getupft mit hellen Flusen und dunklen Flecken. Auf jedem Treppenabsatz verkündete ein Schild, was es in der nächsten Etage zu kaufen gab. Im ersten Stock gab es Herrenschuhe. Im zweiten Stock gab es Damenschuhe. Im dritten gab es noch mehr Damenschuhe. Im vierten gab es Haushaltswaren – Radios und Rührschüsseln warfen anmutige Schatten an die Wände. Im fünften Stock gab es Spielzeug zu kaufen, und während ich stehen blieb, um zu verschnaufen, musste ich an ein Bilderbuch denken. Ein Bär spaziert darin bei Nacht durch ein Kaufhaus und sucht nach einem Knopf, den er verloren hat. Der Nachtwächter erwischt ihn. Madigs Modehaus hat wahrscheinlich gar keinen Nachtwächter, überlegte ich. Wenn sie es sich nicht leisten können, das Geländer zu polieren, können sie sich erst recht niemanden leisten, der nachts die Runde macht. Sie schließen einfach die Tür ab und gehen. Egal, du bist ja nicht eingebrochen. Die Einbrecherin ist Theodora. Du bist ihr nur gefolgt. Also lass das Geländer los und geh weiter.
Im sechsten Stock gab es Abendkleidung. Im siebten Stock gab es Alltagskleidung. Im achten gab es Kinderkleidung, und ich dachte daran, wie Theodora mich vor ein paar Wochen hierhergeschleppt hatte, um mir neue Hosen anmessen zu lassen. Hosen angemessen zu bekommen ist immer peinlich. Im neunten Stock gab es die bunt glänzenden Klamotten, in denen einige Leute offensichtlich gern Sport treiben.
Im zehnten Stock gab es Uniformen. Ein Vorteil der Organisation, der Theodora und ich angehörten, war, dass wir keine Uniform hatten, außer man rechnete die kleine Tätowierung über dem Fußknöchel dazu. Leise lief ich an den Kleiderständern vorbei, an denen Dienstuniformen hingen wie geplättete Frauen und Männer, und fragte mich, was Theodora hier wollte. Aber sie schien überhaupt nicht da zu sein. Gang um Gang lag leer vor mir. Ich schaute hierhin und dorthin. Die Uniformen schauten achselzuckend zurück. Schließlich erreichte ich das hintere Ende der Etage, wo sich die Schaufenster zur Straßenseite befanden. In einem Fenster stand eine Puppe in Polizeiuniform, im nächsten eine, die wie ein Feuerwehrmann angezogen war. Dann kamen eine Krankenschwester, eine Köchin, ein Matrose und ganz hinten in einem Fenster eine Puppe mit gar nichts am Leib. Zu ihren Füßen lag ein Stoß Kleider, die ich als die von Theodora erkannte. Sie hatte dort gestanden und sich umgezogen, ihre Sachen gegen die Kleider der Puppe vertauscht. Ich mochte mir die Szene nicht näher vorstellen. Zu meiner Erleichterung lag Theodoras Unterwäsche nicht mit auf dem Haufen, sie hatte also zumindest nicht splitterfasernackt im Schaufenster gestanden.
Aus dem Augenwinkel sah ich hinten an der Wand ein bekanntes Lichtpünktchen. Der Aufzug fuhr wieder nach unten. »Na dann«, sagte ich zu der nackten Puppe. »Sie hat alles, was sie braucht.«
Die Puppe schwieg dazu. Ich hätte nicht mit ihr tauschen mögen, aber sie mit mir im Zweifel auch nicht.
Treppab lief es sich leichter, wie eigentlich immer. Im Nu hatte ich die Parfümabteilung durchquert und eilte zur Eingangstür hinaus. Das Absperren hatte meine Mentorin sich geschenkt, aber wenigstens war der Dietrich weg. Ich hörte ihre Schritte klacken und sah ihre Silhouette gerade noch um die Ecke verschwinden, konnte aber nicht erkennen, was sie trug. Sie drehte sich nicht um. Wozu auch? Sie war verkleidet, und ich lag schlafend in der Fernostsuite.
Theodoras Weg führte an einem Lokal namens Schmeck’s vorbei, wo mein Verbündeter Jake Schmecks mir ab und zu eine Gratismahlzeit zuschanzte, und an Weniger Delikatessen, einem Lebensmittelgeschäft, wo Brandhorst erst neulich einen seiner finsteren Pläne ins Werk gesetzt hatte. Theodora sah nicht nach rechts und nicht nach links. Wir kamen zu einem turmhohen Bauwerk, das wie ein Füller geformt war. Inzwischen war es verwaist, aber früher hatte dort meine Verbündete Cleo Knight gewohnt, die an einer Formel für unsichtbare Tinte arbeitete – der einzigen Hoffnung für Schwarz-aus-dem-Meer. Ich wünschte Cleo stumm Glück dafür, da erreichten wir schon Ellington Feints Lieblingsladen, das Gatto Nero Caffè. Wie oft hatte ich hier am Tresen gesessen und den blitzenden Apparaturen zugesehen, wie sie kleine Tässchen mit starkem Kaffee und Laibe frisches, warmes Brot auswarfen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich nie wieder herkommen würde, hätte ich vielleicht bewusster hingesehen. So streifte mein Blick es nur. Ich wusste ja, dass Ellington Feint nicht im Gatto Nero Caffè war. Das Wachtmeister-Ehepaar Mitchum verlud sie gerade in den Zug. Schon bald würde sie in einer Zelle in der Hauptstadt sitzen, genau wie meine Schwester. Wir gingen noch ein Stück weiter, Theodora voraus und ich hinterher, bis wir beide da anlangten, wo sie hinwollte.
So viel Trubel wie hier am Bahnhof hatte ich in meiner ganzen Zeit in Schwarz-aus-dem-Meer nicht erlebt. Die große Bahnhofshalle quoll über von Menschen, und das Stimmengewirr hallte von der Decke wider, unter der sich geschwungene Eisenträger spannten, als hinge ein schwarzer Regenbogen dort oben in der lärmerfüllten Luft. An den Wänden brannten Fackeln, und in ihrem flackernden Schein sah ich auf einem der vielen Gleise den Zug stehen, zwanzig oder dreißig Waggons. Die meisten waren Güterwaggons, alle mit dem Namenszug der Tinten-AG versehen und oben offen, um die Tinte aufnehmen zu können, die monströse maschinengetriebene Nadeln den Tintenfischen entzogen. Aber die Tinten-AG war kein florierendes Unternehmen mehr, und die Tintenfische wurden immer weniger, so dass die Güterwaggons leer darauf warteten, auf den kaum noch genutzten Schienen durch die zerfallende Stadt zu rollen. Hinter den Güterwaggons kamen ein paar bunt verzierte Personenwaggons mit schnörkeligen Schnitzereien am oberen Fensterrand und altmodischen Geländern am unteren, und ganz vorn war eine riesige, müde Lokomotive, um die schwarzbeschürzte Männer mit Schaufeln und Schubkarren herumwimmelten und Kohle in den Tender füllten. Gepäckträger in hellblauen Jacken bahnten den Passagieren einen Weg durch das Getümmel, und graulivrierte Schaffner knipsten ihre Fahrscheine mit silbernen Lochzangen, die ihnen am Gürtel hingen. Etwas war an die Revers all der Jacken und Livreen geheftet. Ich konnte nicht sehen, was es war, aber umso deutlicher hörte ich das unermüdliche Klicken der Lochzangen vom Deckengewölbe zurückschallen. Offenbar konnten all die Leute gar nicht rasch genug aus der Stadt wegkommen.