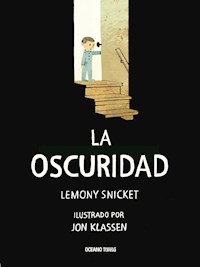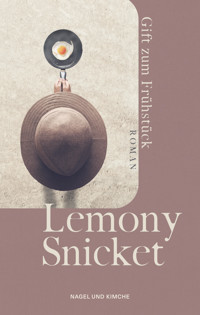
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einzigartig humorvolles und herrlich verwirrendes Leseerlebnis!
Seit mehr als zwanzig Jahren führt Lemony Snicket seine Leserinnen und Leser durch eine geheimnisvolle Welt voller verwirrender Fragen und »betrüblicher Ereignisse«. Sein neues, von der Reihe unabhängiges Buch »Gift zum Frühstück« ist ein Liebesbrief an die Leserinnen und Leser und an das Lesen. Und es ist eine Reflexion über die Unwägbarkeiten des Lebens.
Diese wahre Geschichte – so wahr wie Lemony Snicket selbst – beginnt mit einer rätselhaften Notiz unter seiner Tür: »Sie hatten Gift zum Frühstück«. Um das Rätsel rund um seinen bevorstehenden Tod zu lösen, nimmt Snicket die Leserinnen und Leser mit auf eine Tour durch seine Vorlieben: die richtige Art, ein Ei zuzubereiten, eine verwirrende Idee namens »Tzimtzum«, das erhabene Vergnügen, in offenem Wasser zu schwimmen – und noch vieles mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Poison for Breakfast bei Liveright Publishing Corporation, a Division of W.W. Norton & Company
Textauszug aus: Paul Valery,
Zur Theorie der Dichtkunst und vermischte Gedanken,
hrsg. von Jürgen Schmidt-Radefeldt, © der deutschen Ausgabe
Insel Verlag, Frankfurt a. M. 1991. Alle Rechte bei uns
und vorbehalten durch Insel Verlag Berlin.
© 2021 Lemony Snicket
Illustration copyright © 2021 by Margaux Kent
Deutsche Erstausgabe
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe
NAGELUNDKIMCHE
in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Coverabbildung von fran_kie / Shutterstock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783312013081
www.nagel-kimche.ch
Widmung
In Erinnerung an die Schuhmacherin
Kapitel eins
Heute Morgen hatte ich Gift zum Frühstück.
In diesem Buch geht es um Fassungslosigkeit, ein Wort, das hier so viel bedeutet wie »fassungslos sein«, und »fassungslos« ist ein Wort, das hier bedeutet, dass »man keine Ahnung hat, was passiert«, und »man« ist ein Wort, das nicht nur »man selbst« bedeutet. Es sind alle gemeint. Man selbst hat keine Ahnung, was passiert, aber auch niemand sonst, den man kennt, hat eine Ahnung, was passiert, und natürlich gibt es auch noch Leute, die man nicht kennt, und das sind die meisten auf der Welt, und auch die wissen nicht, was passiert, und natürlich weiß auch ich nicht, was passiert, denn sonst hätte ich ja kein Gift zum Frühstück gegessen.
Alles, was in diesem Buch passiert, ist wahr, und damit meine ich, dass alles wirklich passiert ist – das Gift und die Gedichte, der tödliche Kaktus und der hypnotische Musiker, das Huhn und das Ei und das fatale Finale, ein Ausdruck, der hier bedeutet, dass die Geschichte mit dem Tod endet. Aber die Geschichte beginnt beim Frühstück, das ich mir selbst hergerichtet hatte, weil ich das gern mache. Sie brauchen sich nicht zu merken, was es bei mir zum Frühstück gab, weil ich es immer wieder erwähnen werde, aber es gab
Tee
mit Honig,
eine Scheibe Toast
mit Käse,
eine aufgeschnittene Birne
und ein perfekt zubereitetes Ei,
und ich hatte alles, wie schon gesagt, selbst zubereitet und aß es auf, während ich las, worauf ich Lust hatte.
Das Frühstück mache ich mir seit vielen Jahren selbst, seit einem Sommer, als ich noch ziemlich klein war und mit meiner Familie in einem Haus wohnte, das wir gemietet hatten. Das Haus lag am Ufer eines Sees, der ziemlich groß und ziemlich kalt war, und dort versammelte sich eine kleine Schar von Gänsen im Sand, die sich laut unterhielten und Dreck machten. »Die Gänse werden verschwinden«, erklärte uns der Hausbesitzer, »solange ihr sie nicht füttert«, aber die Gänse verschwanden nicht, den ganzen Sommer nicht. Am Morgen wachte ich auf und ging allein in die Küche. Die Sonne stand noch tief über dem See, und die Wellenkämme glänzten so scharf, dass sie wie Messer aussahen.
Ich habe einmal etwas gelesen, wo das Meer als »reine Messerangelegenheit« beschrieben ist und habe das nie vergessen. Ich bewundere diese Beschreibung sehr, weil es so verblüffend ist, wenn man weiß, dass vor der Person, die das geschrieben hat, niemand daran gedacht hat, und gleichzeitig ist sie so eindeutig, dass man sich fragt, warum einem das nicht selbst eingefallen ist. Das macht gutes Schreiben aus. Deshalb ist einem ein Lieblingsbuch guter Freund und neue Bekanntschaft zugleich, und ein Lieblingsautor kann Vertrauter und rätselhafter Fremder zugleich sein.
Das mit der »Messerangelegenheit« hatte ich damals am See noch nicht gelesen, aber ich saß trotzdem da und beobachtete all die scharfen, funkelnden Wasserzacken draußen vor dem Fenster, während ich wartete, bis der Toaster seine Arbeit getan hatte. Damals mochte ich zum Frühstück immer nur ein Glas Saft und eine einzelne Scheibe Toast mit Marmelade, und deshalb goss ich mir den Saft ein und steckte zwei Scheiben in den Toaster. Wenn sie fertig waren, strich ich Marmelade auf die eine, ging hinaus an den See und verfütterte die andere an die Gänse. Sie liebten das Toastbrot und blieben den ganzen Sommer, und keiner wusste, warum. Ich fütterte sie aus zweierlei Gründen: A, weil ich sie gern fütterte und ich es nicht fair fand, sie dazu zu zwingen, sich woanders nach einem Frühstück umzusehen, nur weil sie laut waren und keine eigene Toilette hatten, und B, weil es mir gefiel, ein Geheimnis zu haben, und während ich diese beiden Gründe A und B aufschreibe, kommt es mir vor, als wäre B der wichtigere, und deshalb ist B in Wirklichkeit A, das Geheimnis, das ich haben wollte.
Morgens hinauszuschlüpfen war ein so interessantes Geheimnis, dass ich bald auch nachts hinausschlüpfte, und das war noch interessanter. Die Gänse waren fort, wenn es dunkel war, und da war beim Spazieren nichts als das Rauschen des Wassers, und der See stellte im Mondschein seine Messer zur Schau. Alles war leise und lärmend zugleich, und ruhig und gruselig dazu. Bücher schrieb ich noch nicht, jedenfalls nicht wirklich, aber ich stand gern im Dunkeln und dachte nach und schrieb Dinge auf. Manchmal schrieb ich sie auf Papier, und manchmal schrieb ich sie einfach in meine Gedanken.
Mir gefiel das so sehr, dass ich auch nach diesem Sommer, als ich in einem Haus in einer Stadt wohnte, nachts hinausschlüpfte. Wahrscheinlich brauche ich nicht das Gefühl zu beschreiben, wenn man nachts eine Straße hinuntereilt, weil Sie wahrscheinlich wissen, wie köstlich das ist. Es ist natürlich auch ein bisschen beängstigend, aber so ein bisschen Angst ist nichts verglichen mit dem dunkelblauen Himmel und dem einäugigen Mond und der Nachtkälte, die einem dabei sofort unter den Schlafanzug fährt. Es stimmt, dass einem etwas Schreckliches zustoßen kann, wenn man nachts alleine herumgeht, und deshalb rannte ich immer, anstatt zu gehen, obwohl das die Chance wahrscheinlich gar nicht verringerte, dass mir etwas Schreckliches zustieß. Etwas Schreckliches kann einem jederzeit zustoßen – beim Frühstück zum Beispiel.
Beim Rennen gab es einen zusätzlichen Nervenkitzel, weil ich damals ein Gedicht namens »Der Straßenräuber« sehr mochte, in dem der geheimnisvolle Held
kam geritten –
Geritten – geritten –
und das einfach so, mit Gedankenstrichen zwischen den Wörtern, damit das Gedicht dringlicher klingt und lustiger zu lesen ist. Wenn ich in meinem Stadtteil unterwegs war, kam ich
gerannt –
Gerannt – gerannt –
und kam mir genauso geheimnisvoll und heldenhaft vor wie der Straßenräuber, der im Übrigen am Ende tot ist.
Und noch eine andere Zeile aus dem Gedicht flatterte mir im Kopf herum, während ich rannte: »Der Mond war eine Geister-Galeone, gebeutelt im wolkigen Meer.« Eine Galeone ist ein altmodisches Schiff, aber das wusste ich damals nicht, und weil das Wort »Galeone« wie »Gallone« aussieht, dachte ich, es wäre eine Art Flasche, die vom Sturm gebeutelt auf dem Meer tanzt, und zwar mit einer Botschaft darin. Mir gefiel die Vorstellung, der Mond hätte eine Botschaft, und ich könnte die Person sein, die sie bekommt, wenn ich nur genügend herumrenne.
Wenn ich mir mein Herumrennen vorzustellen versuche, sehe ich den Stadtteil nie so, wie er wirklich war, sondern nur die Welt des Straßenräubers mit einem Mond wie eine geisterhafte Flasche am Himmel. Zu den Rätseln der Welt zählt, dass man in Gedanken die Landschaft verändern kann, und dann bewegt und verändert sich alles so, wie man es sich vorstellt. Denkt man etwa an ein Buch, sieht man möglicherweise die Welt des Buchs um sich herum, auch wenn man gerade gar nicht liest. Das gehört zu den vielen aufregenden Tricks der Literatur, aber eine Schuhmacherin, die ich kenne, hat mich kürzlich daran erinnert, dass das jederzeit und unter allen möglichen Umständen passieren kann. Als Jugendliche wanderte sie durch eine entsetzliche Landschaft, kein Buch weit und breit, und stellte sich dabei nur wunderbare Dinge vor. Genau wie der Straßenräuber ist sie jetzt tot.
Wenn ich mich nachts zum Herumrennen hinausstahl, ging ich durch die Hintertür, die auf eine dunkle Gasse führte. Oft hört man den Spruch, »dem möchte ich nicht in einer dunklen Gasse begegnen«, wenn von jemandem die Rede ist, der verdächtig aussieht oder sich verdächtig benimmt, aber natürlich will man in einer dunklen Gasse am liebsten überhaupt niemandem begegnen. Die Gasse, in der ich mich wiederfand, war wie die meisten Gassen voller unheimlicher Schatten und flüchtiger Geräusche. Ich hätte hier meinem besten Freund auf der ganzen Welt begegnen können, und er wäre mir wie ein bedrohlicher Fremder vorgekommen. So alleine in dieser Gasse kam ich mir selbst wie ein Fremder vor, ein Kind, das eigentlich im Bett sein sollte, aber trotzdem blieb ich einen Moment stehen, bevor ich auf den Gehweg hinauseilte, um ganz sicher zu sein, dass ich nicht irgendwas verloren hatte.
Ich war noch sehr jung, als mir jemand die Geschichte einer Entführung erzählte, die ich sehr interessant fand. Die Entführer hatten ein kleines Mädchen aus seinem Schlafzimmer geholt und in eine Gasse hinausgezerrt, wo der Wagen wartete. Die Eltern hörten das Auto und liefen hinaus in die Gasse, wo man den Kissenbezug des kleinen Mädchens fand. »Stell dir das vor«, sagte die Frau, die mir die Geschichte erzählte. Sie gehörte zu der Sorte, die beim Erzählen entsetzlicher Geschichten in freudige Erregung gerät. »Wie verzweifelt muss man sein, wenn man den Kissenbezug des eigenen Kindes in einer dunklen Gasse findet?« Ich konnte mir das vorstellen, und deshalb blieb ich immer kurz stehen, bis ich sicher war, dass ich in der Gasse nichts hatte fallen lassen, das jemanden zur Verzweiflung bringen konnte, wenn er es fand. Manchmal lag ich auch hinter meinem Zimmerfenster auf der Lauer und hielt Ausschau nach dem Auto eines Entführers oder irgendwelchen anderen Anzeichen dafür, dass etwas Schreckliches geschehen könnte. Ein Mörder, dachte ich, ein Werwolf. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, wie ich mich fühlte, als ich über solche Dinge nachdachte. Jedenfalls musste ich beinahe die Luft anhalten, denn es war wunderbar und schrecklich zugleich. Zwei unter Kapuzen verborgene Gestalten, eine große Schlange, ein Paar maskierter Zwillinge oder ein Dämon mit Umhang. Ich wartete nur, beobachtete und dachte nach, und das für lange Zeit, und obwohl ich nie auch nur eine einzige Hexe sah, hielt ich weiter Ausschau.
Sie haben inzwischen wahrscheinlich erkannt, dass dieses Buch anders ist als diejenigen, die Sie vielleicht gelesen haben. Es unterscheidet sich auch von anderen Büchern, die ich geschrieben habe. Es findet sich eine Geschichte darin – eine wahre Geschichte darüber, dass ich Gift zum Frühstück gegessen habe – aber es ist auch ein Buch über Philosophie, ein Wort, das bedeutet, über Dinge nachzudenken und zu versuchen, sie zu verstehen. Es ist auch ein Buch darüber, wie ich die Bücher schreibe, die ich offenbar geschrieben habe, und über andere Dinge, wie zum Beispiel ein langes Lied oder einen langen Film, den ich vor vielen Jahren gesehen habe, was mir zufällig wichtig vorkommt. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass das Buch von Fassungslosigkeit handelt und vom Tod, der jetzt schon zweimal vorgekommen ist – der Straßenräuber und die Schuhmacherin, die ich kenne – und dass es, wie schon gesagt, mit einem fatalen Finale enden wird.
In allen Büchern über Philosophie wird irgendwann der Tod erwähnt, und das ist einer der Gründe, weshalb viele Leute Bücher über Philosophie nicht gerne lesen, genauso wie viele Menschen nachts nicht gern ihre Betten verlassen und sich aus dem Haus schleichen. Ich habe dieses Buch einer Schriftstellerin gegenüber erwähnt, die ich nicht nennen will, und sie sagte: »Oh, Mr. Snicket, wer will denn so etwas lesen?« Ich weiß genau, was sie meint. Wenn man in einer Bibliothek nach einem ganz besonders ruhigen Platz zum Lesen sucht, dann geht man am besten geradewegs in die Abteilung für Philosophie. Da niemand gerne Philosophisches liest, wird niemand dort sein, und man kann ungestört lesen, schreiben oder einfach nur nachdenken und beobachten, was ich bis heute tue. Das gehört dazu, wenn man Schriftsteller ist – es ist sehr wichtig, vielleicht sogar wichtiger, als Dinge aufzuschreiben. Aber es kann sehr schwierig sein, das zu beschreiben.
Als ich klein war, sagte man mir zum Beispiel nach dem Frühstück: »Geh bitte deine Zähne putzen und zieh dir deine Schuhe an«, und ich ging aus dem Zimmer und dann, zuerst sehr leise und dann viel zu laut, rief man meinen Namen, und ich ging mit ungeputzten Zähnen und ohne Schuhe zurück ins Frühstückszimmer. »Mr. Snicket«, fragte man mich dann – mir ist es lieber, wenn mich die Leute »Mr. Snicket« nennen, damit ich, falls wir irgendwann Freunde werden, sagen kann: »Ach, jetzt kennen wir uns schon so lange, Sie brauchen mich nicht mehr ›Mr. Snicket‹ zu nennen«, – »Mr. Snicket, was haben Sie denn so lange gemacht?«, und ich konnte keine Antwort darauf geben.
Am Frühstückstisch gab es damals einem Holzstuhl, den man auf verschiedene Arten zusammenbauen konnte. War man ein Baby, dann war er ein Hochstuhl; war man ein Kleinkind, konnte man ihn ebenfalls passend einstellen und auch, wenn man schließlich erwachsen war, und ich dachte immer, vielleicht könnte man ihn noch einmal umbauen, wenn man starb, und zwar zu einem Sarg – einem »Holzpyjama«, – wie das einmal jemand genannt hat – und damit bräuchte man für das ganze Leben nur einen einzigen Stuhl. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich einmal in meinem Holzpyjama liege, werde ich Ihnen immer noch nicht genau sagen können, was ich eigentlich getan habe, als man mir sagte, ich solle meine Zähne putzen und meine Schuhe anziehen. Lesen war es jedenfalls nicht, denn ich hatte kein Buch vor der Nase. Schreiben war es auch nicht, denn ich hatte keinen Füller oder Bleistift in der Hand. Ich dachte nach. Ich beobachtete. Der Versuch, das zu erklären, macht mich fassungslos, so als würde mich plötzlich eine alarmierende Botschaft erreichen, angespült in einer Flasche, oder vielleicht unter meiner Tür hindurchgeschoben wie heute Morgen, als ich gerade mein Frühstück beendete und an andere Dinge dachte. Es war nur ein Schnipsel Papier, der da neben dem winzigen Stückchen Nichts zwischen Tür und Boden lag. Als ich ihn aufhob und las, konnte ich an nichts anderes mehr denken, aus zweierlei Gründen: A, weil es beängstigend war, und B, weil es mich fassungslos machte, und dabei kommt es mir, während ich diese beiden Gründe aufschreibe, tatsächlich so vor, als wäre B der wichtigere, und deshalb ist B in Wirklichkeit A, weil es mich fassungslos machte. Sie haben wahrscheinlich schon erraten, was darauf stand, denn Sie haben es schon ganz am Anfang dieses Buches gelesen.
Sie hatten Gift zum Frühstück.
Kapitel zwei
Ich starrte den Papierschnipsel in meinen Händen einige Augenblicke lang an und versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Ich versuchte sogar, sie zu nummerieren für den Fall, dass das hilft.
Grundgütiger!
Es hilft nichts, Grundgütiger zu denken, Snicket. Ruhig bleiben.
Nein, halt, das wäre ja schon der dritte Gedanke.
Ruhig bleiben.
So ist es besser.
Also, dann schau dir die Botschaft jetzt noch einmal an.
Sie hatten Gift zum Frühstück.
Grundgütiger!
Hör auf.
Also gut.
Tief durchatmen. Oft hilft es, wenn man tief durchatmet, am besten gleich mehrmals.
Das war nur ein Mal. Mach weiter. Jeder weiß, wie man atmet, aber manchmal muss man unterbrechen und sich noch einmal neu beibringen, wie es geht.
Sie hatten Gift zum Frühstück.
Aufhören! Atme ein paarmal tief durch.
Nun gut. Also, glaubst du, die Botschaft könnte ein Witz sein? Wenn ja, dann entspann dich. Wenn nein, spring zu Nummer 35.
Ja, ein Witz. Es muss ein Witz sein.
Aber wenn es doch kein Witz ist?
Es sieht gar nicht nach einem Witz aus.
Ein Mann sitzt mit einem sehr hässlichen Baby im Zug.
Das Baby ist so hässlich, dass ein Mitreisender sagt: »Was für ein abscheuliches Baby.«
»So bin ich im ganzen Leben noch nicht beleidigt worden«, sagt der Mann und eilt zur Schaffnerin, um sich zu beschweren.
»Das tut mir leid, Sir«, antwortet die Schaffnerin, als ihm der Mann von der schrecklichen Beleidigung erzählt.
»Nehmen Sie doch bitte im Erste-Klasse-Abteil Platz und genießen Sie dort ein kostenloses Glas Champagner«,
»und ich werde sehen, ob ich nicht etwas Käse auftreiben kann für Ihre Hausratte.«
Das ist ein Beispiel für einen Witz.
Darin wird eine kleine Geschichte mit einer lustigen Wendung erzählt.
Bei Sie hatten Gift zum Frühstück ist das überhaupt nicht so.
Es gibt aber natürlich auch die Sorte Witz, die nur aus einer Frage mit einer lustigen Antwort bestehen.
Wo hat der König seine Armeen?
Ja, der ist gut.
Aber so ist Sie hatten Gift zum Frühstück auch nicht.
Also gut, es ist kein Witz.
Und wenn es kein Witz ist, dann ist es ein Notfall.
Bei dem Wort Notfall schaute ich nochmal auf den Zettel und musste mir beipflichten. Was dort geschrieben stand, fühlte sich wirklich wie ein Notfall an. Trotzdem fand ich nicht, dass ich irgendwelches Notfallpersonal einschalten sollte – jemanden auf einer Polizeiwache zum Beispiel, oder ein Krankenhaus. Wenn mich jemand vergiftet hatte, dann wurde ich ermordet. Wenn das aber jemand nicht getan hatte, dann wurde ich eben nicht ermordet. Die Polizei zu verständigen war also, als würde ich bei der Feuerwehr anrufen und sagen, dass mein Haus entweder vollständig niedergebrannt war, oder, dass es noch stand und ich gemütlich auf der Veranda saß – und wenn ich im Krankenhaus anrief, dann würden sie bestimmt fragen, was das für ein Gift war, wie viel ich davon gegessen hatte und wie lange das her war, und ich sollte bitte schnell dort hinkommen und mich ausziehen lassen, und dann würden sie mir noch mehr Fragen stellen, und ich könnte nichts antworten außer ich weiß nicht, und ich weiß nicht, und nein danke.
Ich drehte mich wieder um und schaute mein Frühstück an, obwohl es eigentlich kein Frühstück mehr war.
Ich hatte alles bis zum letzten Rest vertilgt, und zwar
Tee
mit Honig,
eine Scheibe Toast
mit Käse,
eine aufgeschnittene Birne
und ein perfekt zubereitetes Ei,
und übrig war nur eine feuchte Tasse und ein Teller mit ein paar Krümeln, neben dem Buch, das ich las. Beim Frühstück habe ich immer gern ein Buch dabei, auch wenn ich manchmal nur wenig darin lese. Manchmal schlage ich es beim Frühstück nicht einmal auf, aber es liegt da neben mir wie ein stiller Gefährte, während meine Gedanken den ganzen Morgen über hin und her wandern. Ich denke dann vielleicht an den Tag, der vor mir liegt, oder die zurückliegende Nacht, oder vielleicht an Dinge fern meiner eigenen Lebensumstände, bis mein Verstand, von einem Augenblick oder Schluck Tee zum anderen, zum Frühstückstisch zurückkehrt, manchmal mit einer köstlichen neuen Idee oder einer Lösung für ein fassungslos machendes Problem.
Das ist Philosophie, mehr oder weniger – die eigenen Gedanken benutzen, um etwas herauszufinden – und es kam mir in den Sinn, dass sich das Problem meiner Vergiftung vielleicht am besten mit Philosophie lösen lässt. Nicht viele Leute denken daran, bei einem Notfall einen Philosophen anzurufen, und doch sind die aufregendsten und nützlichsten Dinge der Welt einfach dadurch entstanden, dass jemand über sie nachgedacht hat. Vielleicht funktioniert das ja auch heute, dachte ich. Vielleicht kann die Philosophie mich retten.
Genau in diesem Augenblick dachte ich an etwas: eine Geschichte, die ich gelesen hatte über andere Leute, die beim Frühstück fassungslos geworden waren. Die Geschichte handelt von den Emersons, einer Familie, die in Amerika lebte, wo ihre älteste Tochter Sally einen jungen Mann liebte, den ihre Eltern nicht mochten. Denen war ein Mann namens Stephen Jones lieber, dessen Name mir sofort im Gedächtnis haften blieb, weil er den Mann sehr langweilig erscheinen ließ. Sally willigte allem Anschein nach ein, traf aber Vorbereitungen, durchzubrennen und den Mann zu heiraten, den sie lieber mochte. Aber just an jenem Morgen bekam die Familie Emerson Besuch von einer exzentrischen alten Frau, die in der Nähe wohnte. »Exzentrisch« ist ein Wort, das hier so viel bedeutet wie »so ungewöhnlich, dass die Leute im Dorf dachten, sie könnte eine Hexe sein«, und sie klopfte an die Tür und bat um etwas zum Frühstück. Die Emersons erklärten, sie wären sehr beschäftigt, baten die alte Frau allerdings herein und sagten, sie solle sich einfach nehmen, was sie brauche.