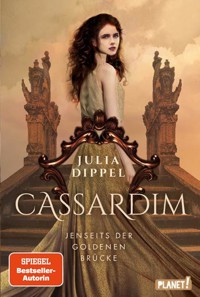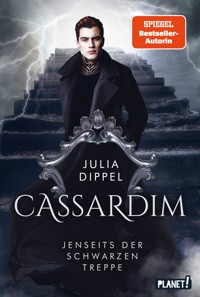16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Manchmal reicht ein Lied, um die Nacht zu durchdringen
Seit fast drei Jahren ist Sintha nun auf der Flucht vor Arez. Der Krieg hat den Kontinent fest im Griff und die Vakàr kämpfen an vorderster Front für die magische Welt. Doch als Arez tödlich verwundet wird, muss sich Sintha entscheiden: Entweder sie stellt sich dem, was sie ihm angetan hat, oder der Mann, den sie liebt, wird sterben.
Das bildgewaltige und mitreißende Finale der Sonnenfeuer-Ballade – mit einzigartigen Wesen, gefährlichen Intrigen und einer prickelnden Liebesgeschichte.
***Wer es spicy mag, findet im Buch einen QR-Code, der zu einem Bonuskapitel führt – aber Achtung, hier wird's heiß.***
***Mit wunderschön gestaltetem farbigen Buchschnitt von Alexander Kopainski in limitierter Auflage.***
Alle Bände der Sonnenfeuer-Ballade:
// Band 1: A Song to Raise a Storm
Band 2: A Storm to Kill a Kiss
Band 3: A Kiss to End a Song//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Seit fast drei Jahren ist Sintha nun auf der Flucht vor Arez. Der Krieg hat den Kontinent fest im Griff und die Vakàr kämpfen an vorderster Front für die magische Welt. Doch als Arez tödlich verwundet wird, muss sich Sintha entscheiden: Entweder sie stellt sich dem, was sie ihm angetan hat, oder der Mann, den sie liebt, wird sterben.
Die Autorin
© Rob Perkins
Julia Dippel wurde 1984 in München geboren und arbeitet als freischaffende Regisseurin für Theater und Musiktheater. Um den Zauber des Geschichtenerzählens auch den nächsten Generationen näherzubringen, gibt sie außerdem seit über zehn Jahren Kindern und Jugendlichen Unterricht in dramatischem Gestalten. Ihre Textfassungen, Überarbeitungen und eigenen Stücke kamen bereits mehrfach zur Aufführung.
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor:innen auf:www.thienemann.de
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemann_booklove
Planet! auf TikTok:https://www.tiktok.com/@thienemannverlage
Viel Spaß beim Lesen!
Julia Dippel
A Kiss to End a Song
Planet!
Für alle, die glauben, keinen Platz in dieser Welt zu haben.
Dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Auf der vorletzten Seite findest du eine Themenübersicht, die Spoiler für den Roman enthält.
In den Kapiteln „Ein kleiner Gefallen“, „Nackter Wahnsinn“ und im Glossar findest du jeweils einen QR-Code.
Die ersten beiden führ en zu je einem Bonuskapitel. Aber Achtung, hier wird’s spicy! Der dritte bringt dich zu einem ausführlichen Glossar.
Viel Spaß!
Vorgeschichte
Man erzählt sich, dass die Tochter der Onyden-Fürstin den menschlichen Kronprinzen verwünscht und in den Tod getrieben hat. So kam es zum Großen Krieg zwischen Qidhe und Menschen, der für beide Seiten schreckliche Verluste bedeutete. Als die Vakàr sich schließlich um einen Waffenstillstand bemühten, verfiel die Onyden-Fürstin Danja ihrer Rachsucht und befahl den Angriff auf die menschliche Hauptstadt, wo die Friedensverhandlungen bereits im Gange waren. Sie wurden zurückgeschlagen, doch dieses Ereignis, das viele Leben gekostet hatte, brandmarkte die Onyden für alle Zeiten als blutrünstige Verräter. Daraufhin stellte die menschliche Monarchin eine neue Bedingung für das Friedensabkommen: die komplette Ausrottung aller Onyden.
Und die Vakàr fügten sich …
Was Bisher Geschah …
Sintha, die letzte lebende Halb-Onyde, kann mit ihrem Lied jeden dazu bringen, zu tun, was sie will. Aus diesem Grund wird sie von Arez, dem Anführer der Vakàr, gezwungen, ihm bei einer Mordermittlung in einem eingeschneiten Gasthaus zu helfen. Dabei muss Sintha ihr Können unter Beweis stellen und den berühmten Spielmann Tillard von Kronsee verwünschen, der ihr seitdem verfallen ist.
Außerdem erfährt sie, dass das Aufeinandertreffen von ihr, der letzten Onyde, und Arez, dem Syr der Syrs, der Grund für den zerstörerischen Schneesturm ist, in dem sie festsitzen. Um die entgegengesetzten Energien abzubauen und den Sturm damit zu beenden, müssen sie miteinander schlafen. Dadurch wird Arez immun gegenüber Sinthas Lied, was die Beziehung zwischen den beiden verkompliziert. Doch schlussendlich gestehen sie sich ihre Gefühle füreinander ein und finden den Mörder, der sich als Arez’ tot geglaubter Bruder Cjan herausstellt. Allerdings mordet Cjan nicht freiwillig, sondern unter dem Einfluss von Raga-Blutperlen. Er ist Teil einer großen Verschwörung, um die menschliche Monarchin zu ermorden.
Als Sintha schlussendlich keine andere Wahl hat, als Cjan zu erschießen und ihm so einen ehrenhaften Tod zu verweigern, rettet sie zwar die Monarchin, verliert aber auch Arez’ Vertrauen. Denn sie hat nicht nur seinen Bruder getötet, sondern das schwerste Verbrechen in der Welt der Vakàr begangen. Ihr droht die Hinrichtung, der Siddac. Allerdings bekommt sie eine Gnadenfrist, um zuvor noch am Karmesinpalast der Monarchin für den Frieden zu werben. Dem beugt sie sich zum Schein. Nur so bleibt ihr Zeit, Arez’ Liebe zurückzugewinnen und den wahren Schuldigen zu finden, die »Stimme in den Schatten«.
Sinthas Jagd auf den Drahtzieher der Verschwörung gestaltet sich jedoch schwierig. Offiziell ist sie Ehrengast, inoffiziell eine todgeweihte Gefangene. Arez legt ihr bei ihren Ermittlungen, wo er nur kann, Steine in den Weg und verleugnet seine Gefühle für sie. Dennoch kristallisieren sich schnell vier Verdächtige heraus: die vier »Eulen«. Minister Firell, Generalin Myka, Herzog Sabin und Prinz Anyagos.
Um mehr Hinweise zu erhalten, reaktiviert Sin alte Kontakte in die Unterwelt, insbesondere Onna und deren liebsten Auftragsmörder Scarraban. Letzterer verschafft ihr heimlich ein magisches Amulett, mit dem Sintha den Vakàr entkommen könnte. Doch Sin kann nicht fliehen, denn die menschliche Monarchin hat noch einen Trumpf im Ärmel: Sinthas schwangere Schwester Jelina. Mit ihr als Druckmittel ist Sin gezwungen, alles zu tun, was die Monarchin verlangt. Darunter fällt auch, dass Sin den Sturm beenden soll, der über der Hauptstadt tobt. Dazu bräuchte sie Arez, doch der hält sich eisern von ihr fern. Also sucht sich Sin in ihrer Not einen anderen Vakàr, um ihn zu verführen. Zum Äußersten kommt es jedoch nicht, weil Arez dazwischenfunkt und sich schlussendlich zu seinen Gefühlen für Sin bekennt – trotz der Prophezeiung einer Raga, einer Nachthexe, dass sein Volk untergehen wird, wenn Arez sich für sein Herz entscheidet.
Danach überschlagen sich die Ereignisse: Die Monarchin wird bei einer Kundgebung von ihrem Neffen Anyagos ermordet. Dabei stirbt auch Anyagos. Sintha wird gegen Arez’ Willen vom Tribunal der Vakàr festgenommen und dem Siddac überlassen, dem schlimmsten und langsamsten aller Tode. Nur durch die Zeugenaussage des kleinen Irrlichts Nivi entkommt Sin ihrem Schicksal.
Gemeinsam finden sie nun heraus, dass die vier Eulen und die Monarchin seit dem großen Krieg etliche Onyden eingesperrt, gefoltert und für ihre Zwecke benutzt haben. Doch im Keller von Herzog Sabin finden sie nur noch einen letzten Überlebenden: Naàndes. Aber nicht Sabin ist die Stimme in den Schatten, sondern Elestros, der Sohn von Minister Firell, den Sintha als Biber kennen und mögen gelernt hatte. Elestros bringt die Vakàrin Tye um und nimmt Sinthas Schwester Jelina als Geisel, um sein Ziel zu erreichen: Er will um jeden Preis das Ansehen der Vakàr zerstören und einen neuen Krieg entfesseln – und er handelt nicht allein. Er steht unter dem Bann von Naàndes, was den Onyden zur wahren Stimme in den Schatten macht.
Und leider geht ihr Plan auf. Die Vakàr müssen Hals über Kopf die menschliche Hauptstadt verlassen und fliehen in eine entlegene Festung in Ozann. Mitgekommen sind Sintha, Jelina, Flink, Sabin, Tillard und Minister Firell.
Doch nun wendet sich auch sein Volk gegen Arez, denn der hat Sin noch auf der Flucht einen uralten Schwur geleistet, um eine Seelenbindung mit ihr einzugehen. Falls Sintha annimmt, wäre sie seine »Ashani«, sein »Herzschlag«, eine Ehre, die in den Augen vieler Vakàr keiner Onyden-Bhix gebühren sollte. Das vakàrische Tribunal verhängt den Weg der Hundert Tode über Arez – sein sicheres Ende. Um ihn zu retten, beschwört Riven Sintha, Arez zu verlassen. Mehr noch, sie soll ihm mit einer Eisblattnadel seine Immunität und mit ihrem Lied seine Liebe zu ihr nehmen, damit Arez seine Pflichten wieder an erste Stelle setzen und die Qidhe im bevorstehenden Krieg mit den Menschen anführen kann.
Sintha bleibt keine Wahl. Schweren Herzens verwünscht sie Arez und taucht mit dem magischen Amulett, das sie von Scarraban hat, ab.
Jenseits des Krieges
Glücklicherweise fiel eine junge Frau, die Vorräte kaufte, in Amabeth nicht übermäßig auf. Ich schulterte meinen Beutel und bahnte mir einen Weg durch das Gedränge am Hafen. Städte hatte ich noch nie gemocht, doch nach dem letzten Winter, in dem ich fast vier Monde lang keiner Menschenseele begegnet war, versetzten mich die vielen Leute in eine regelrechte Dauerpanik. Mein Puls raste, der Fluchtinstinkt ließ meinen Odem aufwallen und ich musste mich gewaltsam zu einem angemessenen Schritttempo zwingen. Den Kopf hielt ich unten, denn der Blendzauber, den ich vor ein paar Tagen aktiviert hatte, verschleierte nur Teile meines Aussehens wie Haarfarbe und Hautbeschaffenheit. Aufmerksame Beobachter würden dennoch eine Ähnlichkeit zu den Zeichnungen auf den Kopfgeldanzeigen feststellen. Und davon hingen leider genug herum – in den Schaufenstern der Geschäfte, an Laternen und öffentlichen Gebäuden. Wenigstens war ich nicht die Einzige, nach der gesucht wurde – auch wenn ich die Einzige war, auf deren Ergreifung beide Kriegsparteien eine Prämie ausgesetzt hatten. Und das nicht zu knapp.
Als ich die Docks Richtung Markt verließ, erlaubte ich mir einen kurzen Blick gen Himmel. Die Sonne würde bald untergehen und färbte ein paar harmlose Wolken in ein glühendes Orangerot. Kein Sturm. Keine Gefahr. Zumindest, was die Vakàr betraf. Das hieß, ich musste mich im Moment nur um die Menschen sorgen, die hoffentlich genug eigene Probleme hatten. Immerhin brachte der inzwischen wieder eisfreie Hafen einen nicht enden wollenden Strom an Flüchtlingen und Verwundeten in die Stadt. Blutend, dreckig und traumatisiert. Überall in den Straßen roch es nach Krieg. So penetrant, dass der lebensfrohe Duft des sprießenden Frühlings wie purer Zynismus wirkte. Ich gab den Geflohenen eine Woche. Dann würden die meisten von ihnen feststellen, dass sie hier nur auf Hunger, Armut und die Knochenpest hoffen konnten.
»Das Abendblatt von Amabeth! Alle Neuigkeiten des Tages im Abendblatt von Amabeth! Neues von der Front und Kunde aus allen Winkeln des Kontinents.« Ein junger Postillenbote schlängelte sich durch die geschäftige Menge. Bestens gelaunt pries er seine Ware an, in der bestimmt nichts stand, was seine gute Stimmung gerechtfertigt hätte. »Der Schattenschlächter rückt nach Dornland vor.Die Belagerung von Valbeth dauert an. Sind auch wir in Glimhill in Gefahr? Der Monarch verstärkt die Truppen und fordert unbefestigte Dörfer zur Evakuierung auf.«
Mist, wenn das stimmte, wurde es wirklich Zeit, dass ich von hier wegkam.
»Auch ’ne Ausgabe?« Grinsend hielt mir der Junge eine druckfrische Postille unter die Nase. Ich schüttelte den Kopf und ging weiter, doch er ließ sich nicht abwimmeln.
»Wirklich nicht? Ist sogar ein Bild vom Schattenschlächter drin.«
Während er neben mir herlief, hob er die Postille neben sein Gesicht und fletschte die Zähne, um die Tuschezeichnung auf der Titelseite nachzuahmen.
»Nein, wirklich nicht«, zischte ich und beschleunigte meine Schritte. Zu spät, ich hatte das Bild bereits gesehen. Kaltblütige Augen, zornige Züge, gifttropfende Fänge und Haare, die das Gesicht mit tiefschwarzer Finsternis umrahmten. Das Porträt eines erbarmungslosen Monsters. Ich hatte keine Ahnung, wie viel von dieser Darstellung der Wahrheit entsprach oder ob die Menschen den sogenannten Schattenschlächter nur erfunden hatten, um die Angst vor dem Feind zu schüren. Aber falls auch nur ein Bruchteil davon stimmte, dann trug ich die Schuld daran. Und Schuld war leider nicht die einzige Emotion, die mich gerade flutete.
Das konnte ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Genau deshalb mied ich normalerweise alles, was mit ihm zu tun hatte. Ich wollte seinen Namen nicht lesen, nicht wissen, was er tat, und schon gar keine Bilder von ihm sehen.
Eins … zwei …
Ich zählte gegen das Gefühlschaos in mir an. Früher hatte ich so meine Wut besänftigt. Heute hielt ich damit andere, viel gefährlichere Empfindungen im Zaum. Der aufkeimende Schmerz drohte mir die Brust zu zerquetschen, aber ich musste weitergehen. Die Hauptstraße entlang, weg vom Hafen, vom Markt und den vielen neugierigen Blicken, denen leuchtende Onyden-Augen sicherlich aufgefallen wären.
Drei … vier …
Ich durfte mir nicht den kleinsten Fehler erlauben. Nicht in einer Menschenstadt. Und schon gar nicht hier im Südosten des Kontinents, wo die Kämpfe noch nicht wüteten und sich nicht nur die üblichen Monarchie-Fanatiker, sondern auch potenzielle Sympathisanten der Vakàr herumtrieben.
Fünf … sechs …
Unwillkürlich tastete ich nach dem Amulett an meinem Herzen und versicherte mich, dass es noch da war. Eine überflüssige Angewohnheit. Ich konnte das Amulett nicht verlieren, denn es hing nicht an einer Kette, es steckte in meinem Fleisch. Wie ein goldenes Insekt hatte es sich mit filigranen Krallen in meine Haut gebohrt, um dort seine Magie zu wirken und den Geruch meines Blutes zu verschleiern.
Es unter meinen Fingern zu spüren, beruhigte mich. Er konnte mich nicht finden.
Sieben … acht …
Ein paar Häuser vor meinem Ziel blieb ich stehen und tat so, als würde ich etwas in meinem Beutel suchen. In Wirklichkeit ließ ich meinen Blick über die Straße gleiten. Ich konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Nur das Flackern von ein paar Schemen hier und da. Aber die verlorenen Seelen der Getöteten waren in diesen Zeiten so allgegenwärtig, dass mir nicht einmal mehr ihre Schreie auffielen. Von den Lebenden beobachtete mich niemand. Und niemand verfolgte mich. Gut, denn ich wollte bestimmt nicht, dass das Ganze hier endete wie letzten Sommer in Heraton. In den drei Jahren meiner Flucht war er mir nie dichter auf den Fersen gewesen. Hätte damals der aufziehende Sturm nicht die menschlichen Truppen alarmiert, die sich daraufhin blutige Kämpfe mit den Vakàr geliefert hatten, wäre ich nie entkommen. Sie hatten die halbe Stadt abgebrannt in ihrem Wettrennen, mich als Erste zu finden. Und alles bloß, weil ich geglaubt hatte, dass seine Besessenheit von mir sich über die Jahre beruhigt haben könnte. Hatte sie nicht.
Neun … zehn.
Mein Puls war wieder halbwegs im Normalbereich.
Und jetzt reiß dich am Riemen, Sin!
Nur noch eine Nacht. Wenn Bartusch heute Abend sein Personal bezahlte, hatte ich das nötige Geld zusammen. Dann konnte ich morgen früh die neuen Stiefel kaufen, die ich so dringend benötigte, und anschließend wieder in den Wäldern abtauchen.
Ich ging weiter, vorbei an den Seeleuten, die vor dem Singenden Anker Schlange standen, um noch ein Zimmer oder wenigstens ein Bier zu bekommen. In diesen Tagen waren die Gasthäuser stets überfüllt. Glück für mich, denn andernfalls hätte Bartusch niemanden gebraucht, der ihm in der Küche aushalf. Er zahlte schlecht, aber was sollte ich machen? Mit legaler Arbeit verdiente man eben lang nicht so gut wie mit kriminellen Machenschaften. Und von denen musste ich mich tunlichst fernhalten. Ein Kopfgeld von zweihundert Kronen war leider auch für die loyalsten Gauner eine zu große Versuchung.
Ich bog in eine Seitengasse ein und betrat den Singenden Ankerüber den Hintereingang. Bartusch hatte mir eine kleine Kammer unterm Dach zur Verfügung gestellt. Dort wollte ich gerade meine überteuerten Vorräte in Sicherheit bringen, als die Verbindungstür zum Schankraum aufflog und ein Schwall Tavernenlärm ins Stiegenhaus schwappte.
»Onjessa! Wollt’ grad zu dir rauf«, brummte Bartusch in seinen dichten schwarzen Bart. »Elin ist noch immer krank. Kannst du heute wieder im Schankraum aushelfen?«
Ach, du meine Güte. Das war ganz und gar keine gute Idee. Ich war gestern nur die letzte Stunde für sie eingesprungen. Weit nach Mitternacht, als der Schankraum fast leer und alle Gäste betrunken gewesen waren.
»Ich … äh … kann nicht besonders gut mit Leuten umgehen«, log ich in meiner Not. »Mir wäre es lieber –«
»Glaubst du, ich kann gut mit Leuten umgehen?«, blaffte der griesgrämige Wirt, der wirklich kein Händchen für den Umgang mit seinen Gästen besaß. »Bitte, Onjessa, ich brauch dich! Da drinnen herrscht das blanke Chaos. Ich zahl dir das Doppelte. Trinkgeld gehört auch dir, und wenn du bis zum Schluss durchhältst, gibts ’nen Silberling als Bonus.«
Mist! Das war ein wirklich gutes Angebot, zumal ich das Geld dringend benötigte und keine Ahnung hatte, wie ich Bartusch abwimmeln sollte, ohne ihn zu verärgern. Vielleicht wäre es nicht so schlimm? Ich würde einfach den Kopf einziehen, meine Arbeit machen und morgen wäre ich ohnehin weg. Was sollte schon passieren?
»Also gut«, seufzte ich. »Ich bring nur schnell meine Sachen rauf.«
»Danke! Du rettest mir das Leben!«, rief Bartusch. »Masha holt dir was zum Umziehen, dann kannste gleich anfangen.«
Er hielt Wort. Wenig später sah ich aus wie eine typische Schankmagd aus Amabeth – nur dass ich die bestickte Bluse bis zum Hals zugeknöpft trug, um mein Amulett zu verbergen. Meine Haare hatte ich wie immer zu einem schlichten Zopf geflochten und in einem Dutt festgesteckt. Keine Ahnung, warum ich sie mir nicht wieder abschnitt. Vielleicht weil er mich hatte erkennen lassen, dass sie zu mir gehörten. Es war dumm und leichtsinnig, aber ich liebte meine Haare, und solange mein Blendzauber aktiv war, sahen die Leute in mir lediglich eine ganz normale Brünette. Ich musste bloß aufpassen, dass die Quelle des Blendzaubers nicht zu Bruch ging, denn dann hätte ich ein echtes Problem. Deshalb schob ich das zerbrechliche Glasröhrchen mit den magischen Gravuren vorn in mein Mieder. So gewappnet betrat ich den Schankraum, wo mich Bartusch bereits händeringend erwartete. Und nicht nur Bartusch, sondern auch ein Heer an Gästen, die nach Bier, Wein und Braten verlangten.
Der alte Wirt hatte nicht übertrieben. Es herrschte das blanke Chaos. Zu meinem Glück, denn das verschaffte mir die perfekte Ausrede, um mit niemandem länger als unbedingt nötig plauschen zu müssen. Wie ich es mir vorgenommen hatte, hielt ich den Kopf unten und machte meine Arbeit. Das wäre allerdings viel einfacher gewesen, wenn Bartusch nicht den schlechtesten Barden aller Zeiten angeheuert hätte. Der Kerl sang mittelmäßig, verspielte sich ständig auf der Laute und gab zu allem Überfluss auch noch den ganzen Abend Lieder seines großen Idols zum Besten: Tillard von Kronsee. Noch jemand, an den ich am liebsten nicht denken wollte. Der Einfaltspinsel hatte meine Flucht nicht verkraftet und die Vakàr dafür verantwortlich gemacht. Er war schon nach wenigen Monaten zurück in den Karmesinpalast gekrochen und schrieb nun ausschließlich kriegstreibende Hetzlieder. So wie das, das der lausige Barde gerade vortrug:
»Nächtens seid ihr wohl ein Schrecken.
Ihr könnt knurr’n und Zähne blecken.
Doch wenn die Sonne den Tag mit sich bringt,
ist’s unser Eisen, das euch bezwingt.
Glaubt ihr, dass die Menschheit Angst vor euch hegt?
Nein! Köter gehör’n an die Leine gelegt.«
Oh, bitte, warum konnte niemand dem Idioten einen Krug über den Kopf ziehen? Es war schlichtweg dumm, solche Texte hier in Amabeth zu singen. Ja, der Obrigkeit mochte das gefallen, aber im Südosten gab es einfach viel zu viele Menschen, die mit dem Krieg nichts zu tun haben wollten.
Ich verkniff mir, selbst einen Krug in Richtung des Barden zu werfen, als sich plötzlich zwei recht behaarte Arme um mich schlangen.
»Hey, meine Süße …«, lallte mir eine Männerstimme ins Ohr.
Scheiße, was machte der denn noch hier?!
»Die letzte Nacht war unglaublich«, schnurrte er weiter, wobei er seine Lippen auf ziemlich eklige Weise an mein Ohr presste. »Lass uns das wiederholen. Diesmal bleibe ich auch nüchtern.«
Beinahe hätte ich gelacht. Würde er sich an irgendetwas erinnern können, hätte er bestimmt nicht vorgeschlagen, die letzte Nacht zu wiederholen. Mal ganz abgesehen davon, dass er längst nicht mehr nüchtern war.
Ich befreite mich aus den Armen des untersetzten Glatzkopfs, den ich gestern auf sein Zimmer begleitet hatte, und schenkte ihm ein erzwungenes Lächeln. »Ich dachte, du wolltest das Schiff nach Bluelle nehmen?«
»Wollte ich auch«, erwiderte er und zog mich erneut an sich ran, »bis ich dich getroffen hab.«
Na, ganz toll! Ein anhänglicher Verehrer, der meinetwegen seine Reisepläne änderte, war das Letzte, was ich gebrauchen konnte. Genau deshalb suchte ich mir ja nur Durchreisende aus, die niemand kannte und schnell wieder weg waren. Zur Not taten es auch verheiratete Männer, weil die es in der Regel vermieden, über ihre Fehltritte zu reden. Aber mit dem Glatzkopf hier hatte ich mir wohl einen von der hartnäckigen Sorte geangelt. Ein zweites Mal wand ich mich aus seinen Armen und senkte meine Stimme.
»Hör mal, äh …« Mist, ich hätte ihn nach seinem Namen fragen sollen. »Die Schankmädchen dürfen nicht mit Gästen rummachen.« Frei erfunden, aber hilfreich. »Ich könnte deinetwegen echt Ärger kriegen. Kannst du nicht so tun, als wäre nichts passiert?«
Zum Schluss schaute ich mich ängstlich um und schenkte ihm einen flehenden Blick samt Wimpernklimpern. Sich retten lassen, zog immer. Natürlich nur in Kombination mit der wichtigsten Regel: Nimm ihnen nie die Hoffnung. »Morgen Abend habe ich frei. Wenn du willst, könnten wir uns dann treffen?«
Er leckte sich über die Lippen und sah anzüglich an mir herunter. Es wirkte nicht so, als würde er die Abfuhr akzeptieren, doch zu meiner Überraschung nickte er.
»Dann also morgen.«
Sein Mund kam auf mein Gesicht zu. Widerlich. Zum Glück erfüllte mir in diesem Moment einer der Gäste meinen Wunsch und warf seinen noch vollen Bierkrug nach dem Barden. Die perfekte Gelegenheit, um meinem Verehrer zu entkommen.
»Wir wollen nichts vom Krieg hören!«, brüllte der Bierkrugwerfer quer durch den Schankraum. Der Barde reagierte nicht. Er stand wohl unter Schock, weil er gerade kapierte, dass der Krug nicht an der Wand hätte zu Bruch gehen sollen, sondern an seinem Schädel.
»Wenn er die Töne treffen würde, wär’s mir egal, was er singt«, rief jemand anderes.
»Spiel was von Lyzette! Die ist besser als Tillard.«
»Der ist schon lang nicht mehr, was er mal war!«
»Ja, spiel Lyzette!«
»LYZETTE! LYZETTE! LYZETTE!«
In dem Moment wusste ich, dass es ein Fehler gewesen war, Bartuschs Angebot anzunehmen. Und es wurde noch schlimmer, denn gerade als die ganze Meute nach einer Bardin rief, die man auch als die Nachtigall des Aschekreises kannte, spazierte ein Trupp royaler Soldaten in die Taverne. Die Stimmung kippte so schnell wie Frischmilch in der Mittagssonne. Es war nur Bartuschs Geistesgegenwart zu verdanken, dass die Situation nicht eskalierte. Er entließ den Barden in eine »wohlverdiente Pause« und versicherte den Soldaten, dass man »Betrunkene nicht allzu ernst nehmen sollte« und seine Taverne schon immer eine »monarchietreue Institution« war. Und zu guter Letzt brüllte er meinen Namen durch den Raum, sodass alle Soldaten gleichzeitig in meine Richtung sahen.
»ONJESSA! Bring unseren tapferen Helden hier eine Runde Bier! Geht aufs Haus!«
Scheiße, ich war am Arsch. Schnell drehte ich mein Gesicht weg und tat das Erstbeste, das mir einfiel: Ich stieß einen Weinbecher um.
»Bei Baga Bors Bart! Das tut mir leid!«, entschuldigte ich mich überschwenglich beim Besitzer des Weins, bevor ich über die Schulter rief: »Ich komm gleich, Bartusch! Ich muss erst noch die Sauerei hier wegmachen!«
Wie erwartet dauerte das dem Wirt zu lange und er zitierte Masha zu sich, damit sie seine Ehrengäste bedienen konnte – was sie liebend gern zu tun schien. Na, da hatten wir doch alle gewonnen.
Zum Glück wirkte auch der junge Mann, dessen Wein ich verschüttet hatte, nicht übermäßig genervt. Ganz im Gegenteil. Mit einem trägen Lächeln beobachtete er mich dabei, wie ich mein Missgeschick beseitigte.
»Du scheinst Soldaten nicht sonderlich zu mögen«, stellte er gelassen fest.
Großartig! Von all den Saufbolden hier drinnen verschüttete ich ausgerechnet den Wein von einem, der eins und eins zusammenzählen konnte.
»Wie kommst du darauf?«, erkundigte ich mich, ohne ihn anzusehen. Je weniger Aufmerksamkeit ich ihm schenkte, desto kürzer würde das Gespräch dauern.
»Ich beobachte dich schon eine Weile. Vor den Soldaten konnte dich niemand aus der Ruhe bringen. Weder der lallende Sack an der Theke noch der grapschende Schwerenöter vorm Fenster oder der Kahlköpfige, der dir bereits den ganzen Abend hinterherstarrt. Du weißt schon, der, mit dem du gestern auf seinem Zimmer verschwunden bist.«
Oh, das war gar nicht gut. Binnen Sekunden hatte sich der junge Mann auf meiner Liste potenzieller Bedrohungen ganz weit nach oben katapultiert – und das mochte in einem Raum mit einem Trupp royaler Soldaten was heißen.
Aus den Augenwinkeln versuchte ich, mir ein Bild von meinem neusten Problem zu machen: kurze schwarze Haare, Dreitagebart, leichte Sonnenbräune, höchstens Anfang zwanzig, definitiv menschlich und mit Händen, die wirkten, als wäre er harte Arbeit gewöhnt – oder den Kampf. Er war nicht außergewöhnlich hübsch, aber auch nicht unattraktiv. Kerle wie er blieben in Tavernen wie dieser normalerweise nicht lange allein – es sei denn, sie wollten es so. Das hieß, bestenfalls war er sehr von mir angetan – und das schon seit gestern Abend. Schlimmstenfalls interessierte er sich aus einem viel gefährlicheren Grund für mich.
»Scheint, als beobachtest du mich nicht erst ’ne Weile«, konterte ich mit einer spöttisch gehobenen Braue. Angriff war die beste Verteidigung. Dachte ich zumindest, bis ich ihm in die Augen schaute.
Verdammt.
Der Ausdruck, der darin glitzerte, strafte seine Unbekümmertheit Lügen. Das war … Jagdhunger. Und nicht die harmlose Variante, sondern eine, die all meine Instinkte in Alarmbereitschaft versetzte.
»Erwischt«, gab er zurück, wobei auch sein verschmitztes Lächeln nicht davon ablenken konnte, dass er den Blick eines Raubtiers besaß – so unverkennbar, wie ich es sonst nur von den Vakàr kannte. Unwillkürlich schoss mein Puls in die Höhe, während ich gleichzeitig versuchte, mir meine Panik nicht anmerken zu lassen. War es vielleicht möglich, dass er … bloß vorgab, ein Mensch zu sein? Er wäre nicht der erste Vakàr, der einen Blendzauber benutzte.
Um dem auf den Grund zu gehen, wischte ich den Tisch fertig ab und sorgte beiläufig dafür, dass sich unsere Hände berührten. Der Ring, den ich am Daumen trug, war mit Borh-Runen versehen und reagierte auf einen plötzlichen Anstieg magischer Energie. Die teuerste Anschaffung seit meiner Flucht, aber sie ließ mich ruhiger schlafen, also hatte sie sich bezahlt gemacht.
Die Runen glühten nicht auf – zu meiner Erleichterung. Kein Blendzauber. Kein Vakàr. Der Kerl sah ganz genauso aus, wie er aussah. Oh Mann … Gut möglich, dass ich inzwischen ein bisschen übervorsichtig geworden war, aber nach der Biber-Elestros-Geschichte wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen.
»Ich geb dir ’nen Tipp«, sagte ich trocken. Es war Zeit, das Gespräch zu beenden. »Wenn du nicht vorhast, jemanden zu verschrecken, solltest du nicht unbedingt den unheimlichen Beobachter raushängen lassen.«
Mein pragmatischer Ratschlag entlockte dem Kerl ein sympathisches Grinsen, das meine Erleichterung mit einem Schlag in Luft auflöste. Mir gefror das Blut in den Adern. Er hatte zwar gleich den Kopf gesenkt, dennoch war mir ein kleines, gefährliches Detail nicht entgangen. Seine Eckzähne waren länger und spitzer, als sie bei einem Menschen sein dürften. Ich hatte recht gehabt – mit all meinen Beobachtungen. Der Kerl war kein Vakàr, aber er war auch kein Mensch.
Er war beides.
Ein Patt
Routiniert überspielte ich meine Panik, doch falls der junge Halb-Vakàr neben seinen Reißzähnen auch die feine Nase seines Volks besaß, würde er wissen, dass ich ihn durchschaut hatte. Ich musste hier raus. Sofort. Also schnappte ich mir mein Putztuch und wollte die Flucht ergreifen, als seine kräftige Hand nach vorn schoss und mich am Arm packte. In diesem Moment war klar, dass ich ihm zuvorkommen musste, wenn ich überleben wollte. Ich tat, als hätte er mich zu sich gezogen, und ließ mich lachend auf seinen Schoß fallen. Nach außen wirkte es, als würden wir miteinander schäkern. Niemand schöpfte Verdacht, denn niemand bemerkte den Dolch, den ich unauffällig zückte und dem Halb-Vakàr gegen die Rippen presste.
»Eine falsche Bewegung und du bist tot«, raunte ich ihm mit einem koketten Lächeln zu.
Seine Oberlippe zuckte, als er die Klinge spürte. Ich hatte ihn eindeutig überrascht. Allerdings war er klug genug, meine Anweisung zu befolgen. Mehr noch, er erwiderte sogar mein Lächeln, um den Schein zu wahren. Entweder war er die Abgebrühtheit in Person oder er traute mir nicht zu, dass ich ihn hier drinnen abstechen würde.
»Es waren die Zähne, oder?«, fragte er, ohne im Mindesten beunruhigt zu wirken.
»Das spielt keine Rolle«, zischte ich zurück. Ich hatte weder Zeit noch Nerv, um über Offensichtliches zu plauschen. »Wie hast du mich gefunden?«
Er zuckte mit den Schultern, während er unauffällig den Raum im Blick behielt. »Ich bin der Spur aus gebrochenen Herzen und liebeskranken Idioten gefolgt, die du alle paar Wochen hinterlässt. Immer in Städten, die groß genug sind, um dort nicht aufzufallen, aber zu unbedeutend für eine maßgebliche Militärpräsenz. Das hat Amabeth zur logischen Wahl gemacht. Der Rest war ein Kinderspiel. Du würdest dich wundern, was die Leute einem erzählen, wenn man nicht wie der Feind aussieht.«
Nein, das wunderte mich kein bisschen.
»Aber du bist der Feind«, erinnerte ich ihn. »Und wenn die Soldaten das herausfinden, bist du geliefert.«
Bedächtig nickte er. »Dasselbe gilt für dich. Scheint, wir hätten hier eine kleine Pattsituation.«
Leider hatte er recht. Ohne Aufmerksamkeit zu erregen, konnte er mich nicht mitnehmen und ich ihn nicht loswerden.
»Hey, Bürschchen!« Eine angetrunkene Gestalt versperrte uns plötzlich die Sicht auf den Raum. Es war der Glatzkopf von letzter Nacht. »Die da gehört mir!«
Ich verkniff mir ein Stöhnen. Das Glück war heute tatsächlich nicht auf meiner Seite.
Das Bürschchen, durch dessen Adern Vakàr-Blut floss, hob gelangweilt den Blick. Der andere Mann schien ihn noch weniger zu beeindrucken als die Klinge an seinen Rippen.
»Jetzt nicht mehr«, stellte er unterkühlt fest. »Zieh Leine!«
Das Gesicht des Glatzkopfs nahm einen bedenklich roten Farbton an.
»Onjessa, wir gehen!« Er streckte mir seine Hand hin und bot mir so unwissentlich einen Ausweg. Allerdings reagierte der Halb-Vakàr schneller. Ohne sich um meinen Dolch zu scheren, legte er seine Arme um meine Taille und erinnerte mich mit sanftem Druck daran, dass er mich nicht gehen lassen würde. Ich hatte keine Wahl. Wenn das hier nicht in einem Blutbad enden sollte, musste ich den Glatzkopf loswerden.
»Kein Interesse«, teilte ich ihm mit und ignorierte mein schlechtes Gewissen. Letzte Nacht hatte ich ihn betäubt und bestohlen, aber zumindest in dem Glauben zurückgelassen, ein paar heiße Stunden mit mir verbracht zu haben. Ihm jetzt auch noch das Herz und seinen Stolz zu brechen, war nicht fair – wie der Hauch von Verbitterung bewies, der sich unter seine Wut mischte.
»So viel zum Rummachen mit Gästen, hm?«, spie er mir entgegen. »Glaubst du, ich gehöre zu den Idioten, die das mit sich machen lassen, du Flittchen?«
Er griff nach meinem Arm, doch der Halb-Vakàr wehrte ihn ab, schnell und präzise. Für alle anderen sah es so aus, als hätte er lediglich die Hand meines hartnäckigen Verehrers beiseite geschlagen, aber mir war weder das Schimmern von Eisen entgangen noch der winzige Schnitt am Handgelenk des Glatzkopfs. Er taumelte rückwärts, rempelte ein paar Gäste an und fiel schließlich zwei älteren Herrn vor die Füße.
»Hat wohl zu viel erwischt, der Gute«, rief der Halb-Vakàr ihnen zu, woraufhin die Männer lachten und sich kameradschaftlich um den Trunkenbold kümmerten. Solidarität unter Säufern wurde hier scheinbar noch großgeschrieben. Allerdings war ich mir ziemlich sicher, dass der Glatzkopf vor morgen früh nicht aufwachen würde. Nicht mit Vakàr-Gift im Blut.
»Sieh an, Eisenklauen hat der kleine Schattenwelpe also auch …«, flüsterte ich. Das war ebenso überraschend wie beunruhigend, denn inzwischen ruhten beide Hände des jungen Mannes wieder an meiner Taille, was in diesem Fall einer Drohung gleichkam.
Seine dunklen Augen blitzten amüsiert auf.
»Ich sagte ja: ein Patt. Ich brauch kein Messer, um dich zu töten.«
»Wir beide wissen, dass du mir nicht mal einen Kratzer zufügen wirst.«
Weil er ihn sonst umbringen würde. Die Order lautete, mich unversehrt zurückzubringen.
Der Halb-Vakàr schnitt eine missmutige Grimasse. Anscheinend war er sich dieses Umstands sehr wohl bewusst. Dann seufzte er und sah mich zum ersten Mal so an, als wäre ich eine Person und nicht seine Beute.
»Ich bin nicht hier, um dich gefangen zu nehmen. Riven schickt mich.«
Netter Versuch.
Riven war vermutlich tot und wenn nicht, hatte er bestimmt nicht die Befehlsgewalt, irgendjemanden irgendwohin zu schicken. Aber ich spielte mit. Vielleicht bekam ich etwas Nützliches aus ihm raus.
»Weshalb sollte Riven das tun?«
»Weil ich dir ausrichten soll, dass die ganze Sache ein Fehler war und dass du unbedingt zurückkommen musst.«
»Und was genau soll ein Fehler gewesen sein?«
»Dass er dir bei der Flucht geholfen hat«, lautete die prompte Antwort. Dann fügte er mit einem schiefen Lächeln hinzu: »Riven konnte der Bitte einer hübschen Frau noch nie widerstehen. Wobei … auch hübsche Männer haben ihn schon oft in Schwierigkeiten gebracht.«
»Wirklich?« Der Kerl riet. Er hatte keine Ahnung, was damals tatsächlich geschehen war, denn ich hatte Riven um gar nichts gebeten. Er hatte mich angefleht zu gehen.
»Und was hast du davon, ihm zu helfen?«
»Gar nichts.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich hab ihm gesagt, dass er verrückt ist, aber ich bin nun einmal sein Bruder. Na ja, Halbbruder.«
Sein Halbbruder?! Das war so weit hergeholt, dass ich fast laut losgelacht hätte. Allerdings fiel mir auf den zweiten Blick tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit auf, die nicht von der Hand zu weisen war. Oh Mann … wenn das stimmte, waren die Vakàr tiefer gesunken, als ich es für möglich gehalten hätte. In den letzten drei Jahren hatten sie mich erbittert gejagt. Hart, gnadenlos und erschöpfend, aber nie hinterlistig. Jetzt Rivens Halbbruder – oder jemanden, der so aussah – zu schicken, um mich emotional zu manipulieren und mit Lügen zurückzulocken, lag definitiv unter ihrer Würde. Also entweder hatte sich in Ikkaria einiges geändert, oder der Kerl war auf eigene Faust unterwegs. So oder so durfte ich den kleinen Schattenwelpen nicht unterschätzen. Immerhin hatte er mich gefunden. Etwas, das den Vollblut-Vakàr nicht gelungen war.
Nur … was machte ich jetzt mit ihm?
Rasch ging ich meine Optionen durch. Im Moment hatte ich die besseren Karten. Er würde es nicht riskieren, mich zu verletzen oder die Soldaten auf mich aufmerksam zu machen. Dazu war ich für ihn zu wertvoll. Das hieß, ich musste nur warten, bis Bartusch auffiel, dass ich nicht mehr arbeitete. Dann würde der Schattenwelpe mich gehen lassen müssen. Allerdings hatte ich danach ein viel größeres Problem: Er wusste, wo ich war, würde sich mir an die Fersen heften, mir in den Wäldern auflauern oder mir eine Skall auf den Hals hetzen. Nein, solange ich im Vorteil war, musste ich dafür sorgen, dass er mir nicht folgen konnte.
»Wir sollten das nicht hier besprechen.«
Der Schattenwelpe nickte. »Ganz deiner Meinung.«
»Dann steh auf und sieh aus wie jemand, der gleich sehr glücklich gemacht wird«, wies ich ihn an.
Mit einem Lächeln tat er, was ich verlangte. Gemeinsam erhoben wir uns, wobei mir auffiel, dass er für einen Schattenwelpen ziemlich groß war. Er hielt mich eng an sich gepresst, damit niemand meinen Dolch bemerkte. So bahnten wir uns einen Weg durch den überfüllten Schankraum. Diesmal war das Schicksal auf meiner Seite. Wir fielen niemandem auf. Nicht einmal Bartusch, der an der Theke selbst alle Hände voll zu tun hatte.
Ich dirigierte uns in einen dunklen Gang, vorbei an den Toiletten und einigen Vorratsräumen.
»Öffnen!«, befahl ich dem Halb-Vakàr, als wir vor der letzten Tür angekommen waren. Er gehorchte ohne Widerworte, doch kaum hatten wir die finstere Kammer dahinter betreten, zeigte er sein wahres Gesicht. Er packte die Hand, in der ich das Messer hielt, und nutzte die Hebelwirkung, um mich herumzuschleudern. Ich krachte vorwärts gegen eines der Regale, während sein Griff so schmerzhaft wurde, dass mir die Klinge aus den Fingern glitt. Gleichzeitig hörte ich irgendwo in meinem Mieder das leise Knirschen von Glas. Verdammt, die Quelle des Blendzaubers! Blaue Blitze zuckten über meinen Körper und nahmen die Illusion von mir, die mein einziger Schutz in dieser verfluchten Stadt gewesen war.
Wut flammte in mir auf und entfesselte meinen Odem. Heiß und unkontrollierbar. Wenigstens brachte das Blitzspektakel den Halb-Vakàr ausreichend aus dem Konzept, dass ich mich seinem Griff entwinden und ihm den Ellbogen in den Magen rammen konnte. Keinen Wimpernschlag später stürzte ich mich auf ihn, riss ihn mit, bis die gegenüberliegende Wand uns bremste. Dann schnappte ich mir seine Kehle und drückte meine Krallen in seine Haut – gerade tief genug, um ihm eine Warnung zu sein. Die kleinste Bewegung und er würde sich selbst die Schlagader durchtrennen.
Das wütende Glühen meiner Onyden-Augen spiegelte sich im erstaunten Blick des Schattenwelpen wider. Wahrscheinlich hatte er mit Gegenwehr gerechnet, aber nicht damit, eine ziemlich angepisste Onyde vor der Nase zu haben – mit weißblondem Zopf, Reißzähnen und sehr spitzen goldenen Krallen.
»Ich brauche ebenfalls kein Messer, um dich zu töten«, zischte ich ihm ins Gesicht. »Und wenn du glaubst, mein Gewissen würde mich davon abhalten, hast du nicht die geringste Ahnung, was ich in den letzten drei Jahren alles tun musste, um zu überleben.«
Er blinzelte ein paarmal, bevor irgendwann seine nervige Gelassenheit zurückkehrte, die ich ihm am liebsten aus dem Leib geprügelt hätte.
»Und was jetzt?«, erkundigte er sich spöttisch. »Willst du –«
Ich unterbrach ihn mit einem Fauchen und bugsierte ihn ein paar Schritte weiter in die Ecke des Raums, wo schwere Eisenketten in der Wand verankert waren. Wir befanden uns nämlich in der Krawallkammer der Taverne, in der man normalerweise pöbelnde Säufer einsperrte, bis sie ihren Rausch ausgeschlafen hatten. Aber auch bei einem übergriffigen Halb-Vakàr würde dieser Ort seinen Zweck erfüllen.
»Leg dir die Ketten an! Der Schlüssel steckt.«
Er zögerte, bis ich den Druck meiner Krallen erhöhte und er sich geschlagen geben musste. Mit einer Miene, die mich sehr an ein schmollendes Kind erinnerte, fesselte er sich selbst, schloss ab und hielt mir den Schlüssel hin. Bevor ich seinen Hals freigab, kontrollierte ich mit der anderen Hand, ob alles richtig saß. Dann nahm ich den Schlüssel, ging auf Abstand und warf mit Schwung die Tür ins Schloss. Zufällige Zeugen hätten alles nur noch viel schlimmer gemacht.
Eins … zwei … drei … vier … fünf …
Ich brauchte eine Weile, um meine Wut zu bändigen. Er konnte von Glück sagen, dass ich mich inzwischen besser unter Kontrolle hatte als früher.
… sechs … sieben … acht …
Nach und nach zogen sich meine Krallen zurück.
… neun … zehn.
Ich sah wieder menschlich aus. Nur eben nicht wie die brünette Onjessa. Damit stand fest, dass ich noch heute Nacht von hier abhauen musste – ohne meinen Lohn und ohne neue Stiefel. Und das alles hatte ich einem übereifrigen Schattenwelpen zu verdanken.
Genervt entzündete ich die Öllampe neben dem Eingang und fing an, die Scherben des Blendzaubers aus meinem Mieder zu fischen.
»Wie heißt du?«, wollte ich von dem Halb-Vakàr wissen, der mich aufmerksam beobachtete. Inzwischen hatte er wieder den tödlichen Raubtierblick aufgesetzt, was wohl hieß, dass er lernte und sich jedes Detail merkte, damit er mich notfalls noch einmal aufspüren konnte.
»Cilik.«
Das klang überraschend aufrichtig. Vielleicht hatte er die Taktik geändert und versuchte nun, mich mit Offenheit zu ködern. Fein, dann war es jetzt an mir, ein paar Details herauszufinden, um ihm seine Jagd ein bisschen zu erschweren.
»Bist du wirklich Rivens Halbbruder?«
»Ja.«
»Dann hättest du dir die Mühe machen sollen, mit ihm zu reden, bevor du mir irgendwelche Geschichten auftischst.«
Ciliks Miene verfinsterte sich, als er begriff, auf welche Art ich ihn durchschaut hatte. Wobei es ihn beinahe noch mehr zu ärgern schien, die tatsächliche Wahrheit nicht zu kennen.
»Mit Riven zu reden, ist gerade nicht möglich«, knurrte er leise.
So was hatte ich mir schon gedacht.
»Ist er tot?«
»Nein.«
Irgendwo hinter all meinen Schutzmauern fiel mir ein Stein vom Herzen – nur spürte ich ihn kaum.
»Das klingt nicht so, als wärst du froh darüber.«
»Was du nicht sagst.«
Aha. Da war er also, der wunde Punkt, nach dem ich gesucht hatte.
»Der Bhix-Bruder eines Verräters hat es in Ikkaria bestimmt nicht leicht.«
Volltreffer. Cilik sah aus, als hätte er am liebsten die Ketten aus der Wand gerissen und mich damit erwürgt.
»Wie hoch ist die Belohnung des Syrs inzwischen, hm?«, fragte ich weiter. »Was bekommst du, wenn du mich unversehrt ablieferst? Zweihundert Kronen? Oder sind es mittlerweile schon dreihundert?«
»Es sind fünfhundert«, informierte er mich kalt und schien meinen erschrockenen Gesichtsausdruck sichtlich zu genießen. Fünfhundert Kronen?! Das war ein Vermögen und mehr als das Doppelte des royalen Kopfgelds. Dafür würden es sich selbst die treusten Anhänger des Monarchen zweimal überlegen, ob sie mich nicht doch an die Vakàr auslieferten.
»Aber das ist nicht dein größtes Problem, Sintha. Der Syr der Syrs hat nämlich eine Belohnung ausgesetzt, die seine Vakàr viel mehr motiviert als Geld.«
»Und die wäre?«
»Wer immer dich findet und zurückbringt, erhält Rivens Platz in der Skall des Syrs.«
Mir klappte der Mund auf.
Bei allen Göttern!
Darauf war der kleine Schattenwelpe aus?!
Es war allgemein bekannt, dass der fünfte Platz in der Skall des Syrs unbesetzt war. Nur wusste niemand warum. Jetzt hatte er es sich wohl anders überlegt und das bedeutete …
»Jeder Vakàr des Kontinents ist hinter dir her. Nicht nur, weil es der Befehl des Syrs ist, sondern weil er ihnen eine ganz persönliche Motivation gegeben hat«, fasste Cilik meine schlimmste Befürchtung in Worte. »Sie nutzen ihre Freizeit, opfern ihren Schlaf, durchstreifen die Schatten. Glaub mir, wenn dein Leben bislang ein Albtraum war, wirst du ab jetzt durch die Hölle gehen. Sie werden dich jagen, bis du vor Erschöpfung zusammenbrichst. Oder den Menschen in die Hände fällst. Das willst du doch auch nicht. Beende es, Sintha. Komm mit mir! Ich bring dich nach Ikkaria. Ohne Fesseln. Ohne Gewalt. Dann ist dieser Irrsinn endlich vorbei.«
Oh, er war wirklich gut. Hätte Aufgeben nicht alles nur noch viel gefährlicher gemacht, hätte er mich vielleicht sogar überzeugen können. Mal abgesehen davon, dass ich keinen Beweis hatte, dass er die Wahrheit sagte.
»Willst du wissen, was ich glaube«, gab ich zurück. »Ich glaube, dass so ein einsamer kleiner Schattenwelpe wie du – halb Vakàr, halb Mensch – gerade schlechte Karten hat, wo doch seine beiden Völker im Krieg miteinander sind. Ich schätze, niemand vertraut dir so recht. Wobei die Vakàr wahrscheinlich toleranter sind als die Menschen, nicht wahr? Du würdest so gern dazugehören. Und jetzt hoffst du, dass sich alles ändern wird, wenn du mit mir als Beute heimkehrst. Also entschuldige bitte, dass ich dir nicht vertraue, denn du würdest mir alles erzählen, mich belügen, verraten und verkaufen, nur damit du endlich bei den Großen mitspielen darfst.«
Ciliks scheinbar freundliche Fassade fiel in sich zusammen wie eine Sandburg im Regen.
»Du weißt nichts über mich!«
»Ich bin eine Onyden-Bhix. Ich habe mehr übers Nicht-Dazugehören vergessen, als du je erleben wirst«, murmelte ich und ging zu dem Regal, gegen das mich Cilik beim Reinkommen geschleudert hatte. Es war das einzige Möbelstück in der Krawallkammer, und das nicht ohne Grund. Hier lagerte Bartusch Beruhigungstränke, Schlafpulver, Arzneien und Betäubungsmittel für die besonders harten Fälle. Während ich die bruchsicheren Behälter durchstöberte, auf der Suche nach der stärksten Substanz seiner Sammlung, haderte ich mit mir selbst. Es gab da etwas, über das ich seit drei Jahren nichts hatte in Erfahrung bringen können. Und mit Cilik bot sich mir eine einmalige Gelegenheit, die so schnell nicht wiederkommen würde. Allerdings bedeutete das auch, meinem Jäger eine Schwäche preiszugeben.
Ich musste das Risiko eingehen …
»Hast du … hast du in Ikkaria vielleicht mal eine Menschenfrau mit braunen Locken gesehen? Sie heißt Jelina und hat eine kleine Tochter?«
»Wieso?« Ciliks Stimme triefte vor Spott. »Glaubst du etwa, die Menschen-Schwester einer Verräterin könnte es in Ikkaria nicht so leicht haben?«
Er benutzte meine Worte mit der Präzision einer Klinge gegen mich. Die Retourkutsche saß und wahrscheinlich hatte ich sie auch verdient. Trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass mir Tränen in die Augen stiegen. Ich drehte den Kopf zur Seite, aber Cilik hatte sie bestimmt bemerkt. Mist! Die Frage war ein Fehler gewesen. Wenn er –
Ein entnervtes Stöhnen unterbrach mich in meinen Selbstvorwürfen.
»Jetzt hör schon auf zu flennen«, brummte Cilik mürrisch, während er an der Wand herunterglitt und sich hinsetzte. »Es geht ihnen gut. Deine Schwester und ihre Tochter leben in Ikkaria. Nicht als Gefangene, als Gäste. Sie stehen unter dem Schutz des Syrs.«
Was?!
Unendliche Erleichterung durchflutete mich, gefolgt von sehr viel gefährlicheren Gefühlen, die nicht aufzuhalten waren. Jelina und meine Nichte standen unter seinem Schutz? Er hatte sich um sie gekümmert, obwohl ich …?
Atmen, Sin … atmen! Keiner hätte etwas davon, wenn ich jetzt zusammenbrach. Vor Cilik durfte ich mir das erst recht nicht erlauben. Er ließ mich keine Sekunde aus den Augen. Wahrscheinlich, weil er ihm über alles Bericht erstatten würde. Und das machte es noch schlimmer. Zu wissen, dass jedes Wort, das ich sagte, und jede Träne, die ich weinte, den Weg zu ihm finden würde, war … war …
Es fühlte sich an, als wäre er hier.
Erinnerungen drängten aus den Tiefen meines Bewusstseins an die Oberfläche. Ich bekam keine Luft mehr und musste mich am Regal festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Eins … zwei … drei … vier … fünf …
»Hey, ist alles in Ordnung?«, wollte Cilik wissen. Er klang irritiert.
Sechs … sieben … acht … neun … zehn.
»Sintha, wenn du Hilfe bra–«
»ES GEHT MIR GUT!«, fuhr ich ihn viel zu heftig an, um diese himmelschreiende Lüge auch nur halbwegs glaubhaft zu machen.
»Sieht mir aber nicht danach aus!«, meinte Cilik prompt. »Hör mal, ob du es glaubst oder nicht, ich mach mir Sorgen. Dein Blendzauber ist weg und du bist ganz offensichtlich nicht in der Verfassung, dich um deine Sicherheit zu kümmern. Wenn du da jetzt rausgehst und dir was passiert –«
»Was dann? Dann verlierst du jede Chance auf deine Belohnung? Tut mir echt leid für dich, Schattenwelpe.«
Wenigstens war er nervig genug, um mich von dem emotionalen Strudel in meinem Inneren abzulenken. Es wurde Zeit, dass ich hier wegkam. Ich schnappte mir das Döschen mit dem gelben Knollkrautpulver. Es wirkte schnell und zuverlässig, auch wenn die Betäubung bei einem Halb-Vakàr nicht sehr lange anhalten würde.
»Oh, verdammt, Sintha! Das ist eine wirklich miese Idee!«, warnte er mich, als er kapierte, was ich vorhatte. »Hör mal, ich mach dir einen Vorschlag. Erlaub mir, dich aus der Stadt rauszubringen. Nur aus der Stadt. Sobald wir draußen sind – das schwör ich bei Nheema –, lass ich dich laufen und gebe dir einen ganzen Tag Vorsprung. Das ist viel mehr, als dir das Knollkraut verschaffen würde.«
Wie großzügig …
»Wer sagt, dass ich dich nicht umbringe, wenn du bewusstlos bist?«, fragte ich, während ich das Döschen aufschraubte. »Dann hätte ich auf jeden Fall genug Vorsprung.«
»Wer sagt, dass ich allein hier bin? Draußen könnte eine Skall auf dich lauern.«
Ich schnaubte. »Ja, bestimmt, Schattenwelpe.«
Wären noch mehr Vakàr hier, echte Vakàr, hätte sich über Amabeth schon längst ein Sturm zusammengebraut.
»Und wenn die Menschen meine Leiche finden?« Er hob seine Arme und klirrte demonstrativ mit den Ketten. »Als Notwehr geht das wohl kaum durch. Dann werden sie dich als Mörderin jagen.«
»Entspann dich. Ich hab nicht vor, dich umzubringen. Vielmehr rette ich dir sogar das Leben, denn ich lasse dich so aussehen, als wärst du nur ein besoffener Unruhestifter, der hier seinen Rausch ausschläft. Wenn du dich also nicht komplett dämlich anstellst, werden sie nie dahinterkommen, dass du ihr Feind bist.«
Damit pustete ich ihm eine Handvoll Schlafpulver ins Gesicht. Die Wirkung entfaltete sich beinahe sofort. Cilik blieben vielleicht fünf Atemzüge, bevor er das Bewusstsein verlor.
»Ach, und noch was, Schattenwelpe. Weil ich dich irgendwie mag, gebe ich dir einen guten Rat: Erzähl niemandem von diesem Treffen. Ganz besonders nicht dem Syr. Erstatte ihm keinen Bericht. Sag ihm nicht, dass du mich gefunden und wieder verloren hast. Sag ihm nicht, wie es mir geht. Erwähne nicht einmal meinen Namen. Denn damit würdest du alles nur noch viel schlimmer machen.«
Gold und Schatten
Das schwere Atmen des Pferds und das Trommeln seiner Hufe hallten durch die Nacht. Ich trieb es zu Höchstleistungen an, was auf den vom Tauwetter durchnässten Straßen ein ziemliches Risiko darstellte. Aber ich musste so weit wie möglich von Amabeth weg, bevor ich die Stute wieder freiließ und zu Fuß in den Wäldern abtauchte. Deshalb ritt ich ohne Sattel. Mit etwas Glück würde sie später zu dem Bauernhof zurücktraben, von dem ich sie gestohlen hatte, und niemand würde je von dem Diebstahl erfahren.
Ciliks Sorge war nicht unbegründet gewesen. Mein Verschwinden würde auffallen. Allerdings hatte er mich und meinen Willen zu entkommen gnadenlos unterschätzt. Ich besaß einen Fluchtplan für alle Eventualitäten. Das schloss auch den Fall mit ein, dass ich nachts, übereilt und ungesehen, aus einer Stadt abhauen musste. Meine Sachen waren immer gepackt. Ich hatte also nur hastig meine Haare verhüllt, bevor ich über das Dach geflohen und während des Wachwechsels unbemerkt durch die Fallgitter am Osttor geschlüpft war. In diesen Tagen sorgten sich die Stadtwachen eher um Angriffe von außen als um Leute, die dumm genug waren, den Schutz der Stadtmauern ohne Eskorte zu verlassen. Ganz besonders nachts. Denn seit dem Krieg waren Menschen in den Wäldern Freiwild. Das galt vor allem für die Gebiete südlich des Eckhons, wohin viele Qidhe aus dem von den Menschen dominierten Norden geflohen waren.
Für mich machte das keinen Unterschied. Hinter mir waren sowieso alle her. Deshalb setzte ich normalerweise eher auf Vorsicht als auf Geschwindigkeit. Nur blieb mir heute keine Wahl. Ich musste einfach darauf hoffen, dass mich niemand entdeckte. Das Mondlicht war dabei nicht unbedingt hilfreich, auch wenn der Sternenhimmel bedeutete, dass keine Vakàr in der Nähe waren. Dafür kroch mir die Kälte der ersten Frühlingsnächte in die Glieder. Als ich den Waldrand erreichte, waren meine Finger steif gefroren. Ich konnte mich nur noch mühsam an der Mähne meiner Stute festklammern. Trotzdem durfte ich nicht stehen bleiben. Ich musste –
Plötzlich riss meine Stute den Kopf hoch, bremste ab, allerdings nicht schnell genug, um dem unsichtbaren Hindernis auszuweichen. Ihre Beine verfingen sich in etwas. Wiehernd kämpfte sie um ihr Gleichgewicht, doch im Morast fanden ihre Hufe keinen Halt. Als ihr schwerer Körper fiel, schleuderte es mich von ihrem Rücken. Ich krachte hart auf dem Waldboden auf. Mein Kopf verfehlte nur knapp ein paar tödliche Steine. Trotzdem presste mir der Aufprall die Luft aus den Lungen. Für einen Moment drehte sich alles. Ich hörte, wie meine Stute keuchte und schnaubte, bevor sie wieder auf die Beine kam und panisch davongaloppierte.
Na wunderbar.
Stöhnend bewegte ich mich, um zu kontrollieren, ob ich mir etwas gebrochen hatte. Meine linke Schulter tat weh und meine Rippen schmerzten, aber ansonsten ging es halbwegs. Ich hievte mich gerade auf die Knie, als ich etwas auf dem Waldweg entdeckte. Ein Seil. Scheiße, das war eine Falle! Kaum hatte ich meinen Dolch gezogen, da hörte ich auch schon, wie hinter mir der Hahn einer Muskete gespannt wurde.
»Waffe weg!«, forderte eine schneidende Männerstimme. Mein Herz klopfte mir in der Kehle. Jetzt war ich so richtig am Arsch. Während ich fieberhaft überlegte, was ich tun sollte, traten zwei weitere Kerle mit Fackeln aus dem Unterholz. Nein, es waren fünf. Vielleicht noch mehr. Eine ganze Bande umringte mich. Eindeutig Menschen. Wahrscheinlich Söldner, die die Wälder »säuberten« und gutes Geld für jeden toten Qidhe kassierten. Von allen Ungeheuern, die hier draußen lauerten, waren das so ziemlich die schlimmsten.
»Tu besser, was er sagt, meine Hübsche«, riet mir einer der älteren Söldner. Er hatte lange Haare, die nur mäßig kaschieren konnten, wie kahl er obenrum bereits wurde. »Tonnes hat ’nen nervösen Zeigefinger.«
Ich ließ den Dolch fallen. Meine Krallen würden unter diesen Umständen ohnehin die besseren Waffen sein. Es war bloß nicht optimal, dass ich noch immer kniete und nicht genau wusste, wie sehr ich meine Schulter belasten konnte.
Der Kerl namens Tonnes, ein schlaksiger Söldner, spazierte mitsamt seiner Muskete in mein Sichtfeld, dicht gefolgt von einem Muskelberg, der all seine Kameraden um mindestens einen Kopf überragte. Vor dem musste ich mich im Kampf in Acht nehmen. Seine schiere Masse würde ihn zwar langsam machen, dafür reichte vermutlich ein einziger Treffer, um mich außer Gefecht zu setzen.
Aber alles der Reihe nach. Erst einmal galt es herauszufinden, wer hier das Sagen hatte. Als besonders schwierig stellte sich das nicht heraus, denn die Blicke der Söldner huschten andauernd zu einem stämmigen Mann, dessen Hals so breit war, dass er Kopf und Rumpf nahtlos miteinander verband. Ein buschiger schwarzer Schnauzbart hing weit über seine Oberlippe. Die Daumen hatte er in seinem Gürtel eingehängt, während er sich gemächlich langsam vor mir aufbaute. In seinen Augen schimmerte ein Hauch von Wahnsinn und Gewaltbereitschaft.
»Na, was ist uns denn da Feines ins Netz gegangen?«, murmelte er und musterte mich von oben bis unten. »Wenn das nicht die meistgesuchte Bhix in Enebha ist.«
Mir wurde heiß und kalt zugleich. Wie konnte er –? Oh, verdammt. Meine Haare! Das Tuch musste mir beim Sturz vom Kopf gerutscht sein.
»Was?! Das soll ’ne Onyde sein?! Bist du dir sicher?«, fragte der Muskelberg.
»Natürlich bin ich mir sicher«, blaffte der Anführer ihn an. »Ich hab die Kleine schon mal gesehen. In Cahess. Auf dem Kesselmarkt. Glaubt mir, wir haben gerade den Hauptgewinn gelandet.«
Unter dem Johlen seiner Männer kam er auf mich zu. Gut so. Noch ein Schritt und er wäre in Reichweite meiner Krallen. Leider machte er diesen Schritt nicht. Mist.
Na, kommt schon. Gebt mir zumindest einen weiteren Namen. Dann hätte ich eine Chance.
»Und müssen wir sie … unversehrt abgeben?«, erkundigte sich der mit der Muskete.
Ein boshaftes Grinsen erschien unter dem Schnauzbart des Anführers. »Nein. Ich denke, es reicht, wenn sie noch atmet.«
Das Lachen der Männer drehte mir den Magen um. Aber ich durfte mich meiner Angst jetzt nicht ergeben, sonst wäre ich verloren.
»Wir nehmen sie mit ins Lager. Sami! Fessle und kneble sie!«
Na also …
»Sami, beschütz mich! Tonnes, halt mir deine Kameraden vom Hals!«
Meine beiden Wünsche verhallten im Wald und irritierten die Söldner einen Moment lang. Dann prusteten sie los.
Alle außer Sami und Tonnes …
Ich hielt den Atem an, denn ich hatte keine Ahnung, wie sie reagieren würden. Deshalb benutzte ich mein Sonnenfeuer-Lied nur im äußersten Notfall. Die Folgen waren schlichtweg zu unberechenbar. Es hing immer vom Charakter meiner Opfer ab, wie sie meine Wünsche umsetzten. Hier und jetzt hoffte ich einfach, dass sie nicht zu diskutieren anfangen, sondern ihre Kameraden lang genug in Schach halten würden, damit ich fliehen konnte.
Ich bekam etwas Schlimmeres.
Tonnes schwenkte seine Muskete herum und schoss dem Kerl mit dem lichten Haupthaar in den Kopf. Dann zog er ein Messer und stach wie ein Irrer auf den Muskelberg ein. Gleichzeitig brach auch hinter mir Chaos aus.
Verdammt! Wenn sie sich so einen Dreck um die Leben ihrer Kameraden scherten, hatte ich noch weniger Zeit als befürchtet. Ich sprang auf und fand mich in einem Gemetzel wieder. Überall flogen Fäuste und Kugeln.
»Nicht auf die Bhix schießen, ihr Idioten!«, brüllte der schnauzbärtige Anführer. Er zückte seine Pistole und knallte Tonnes ab. »Wir brauchen sie lebend!«
Einen Wimpernschlag später stürzte ich mich mit entfesseltem Odem auf ihn. Leider besaß er hervorragende Reflexe. Er wich aus und stieß mich einem seiner Männer in die Arme, der nun das Pech hatte, Bekanntschaft mit meinen Krallen zu machen. Ich riss ihm die Kehle auf, zog ihm die Pistole aus dem Gürtel und jagte dem nächsten Angreifer eine Kugel ins Herz. Als er zusammenbrach, krachte etwas Hartes auf meinen Schädel herab. Ein scharfer Schmerz brachte meine Gedanken ins Taumeln. Die Welt verschwamm hinter tanzenden Sternen, während ich mich fallen fühlte. Ich roch die Nacht und mein Blut und wusste, dass es vorbei war, noch bevor ich auf dem Boden aufkam.
Vielleicht war ich ein paar Augenblicke weggetreten gewesen. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, als plötzlich Schimpfwörter und Tritte auf mich herabregneten. Instinktiv versuchte ich, meinen Kopf zu schützen. Jemand packte mein Kinn und stopfte mir einen stinkenden Lappen in den Mund. Kraftlos hieb ich nach den Umrissen des Mannes, doch meine Hand wurde weggestoßen und unter einer schweren Stiefelsohle begraben. Knochen brachen. Ich schrie in den Knebel und spürte, wie mir das Bewusstsein entglitt. Nein, nicht jetzt! Ich musste kämpfen! Ein massiger Körper presste mich in den feuchten Untergrund. Der schnauzbärtige Anführer saß auf mir, während seine Männer mir die Arme über den Kopf zerrten und jede Gegenwehr unmöglich machten.
»Du dreckiges Miststück!«, schnauzte er mich an. Sein Atem stank nach schlechten Zähnen und Branntwein. »Dafür wirst du bezahlen!«
Das Fackellicht wurde heller und weitere Gesichter tauchten in meinem Sichtfeld auf.
»Na los! Mach schon!«, forderte jemand.
»Das wollt’ ich schon lang mal sehen!«, zischte wer anderes.
Der Anführer hob den Blick und nickte. Eine grobe Hand packte meinen Zopf. Ich hatte gerade noch Zeit, panisch die Augen aufzureißen, bevor ich spürte, wie sich eine kalte Klinge an meine Haare legte und sie dann mit einem Ruck durchschnitt. In diesem Moment schrumpfte meine ganze Welt, mein Verstand, meine Existenz zu einer einzigen Empfindung zusammen. Schmerz. So rein und unverfälscht, dass meine Sinne in winzige Splitter zersprangen. Ich brüllte wie nie zuvor in meinem Leben. Es war, als hätten sie mir nicht nur einen Teil meines Körpers abgeschnitten, sondern einen Teil meiner Seele. Der Schmerz fraß sich wie brennende Säure durch die Reste meiner Haare, meine Kopfhaut und jeden einzelnen Nerv in meinem Körper. Warmes Blut rann meinen Nacken hinunter, während das Lachen der Männer meine gedämpften Schreie übertönte.
»Hahahaha! Gold!«
»Ihr hattet recht!«
»Bei Baga Bors verlaustem Arsch.«
»Sie haben sich wirklich in Gold verwandelt!«
»Gold! Gold! Gold!«
Einzig der Anführer kümmerte sich nicht um das, was aus meinen Haaren geworden war. Er betrachtete mich und meinen Schmerz mit glänzenden Augen, bis mir die Stimme versagte und ich keuchend nach Luft rang. Dann packte er mein tränenüberströmtes Gesicht und presste mir seine Lippen ans Ohr.
»Das war noch nicht alles, kleine Onyde. Du wirst noch viel mehr für mich schreien.«
Ich spürte seine Hände an meinem Körper, und als er mein Mieder zerriss, setzten meine Überlebensinstinkte mit aller Macht ein. Ich ignorierte meine Verletzungen, wehrte mich erbittert, aber mein Widerstand schien die Söldner nur noch mehr anzuspornen. Die Gier in ihren Fratzen war ekelerregend. Auch meine Bluse zerfetzte der Anführer, bevor er schlagartig innehielt.
Oh nein. Das Amulett!
»Was haben wir denn hier?«, murmelte er fasziniert. »Guckt mal, Jungs. Hier ist noch was für unsere Sammlung!«
Ich schüttelte den Kopf, verzweifelt, ich flehte, ohne jeden Stolz, ohne Selbstachtung, doch der Schnauzbart nahm mein stummes Betteln nicht einmal zur Kenntnis. Er griff sich das Amulett und riss es mir gnadenlos aus der Brust.
Er hätte mir auch das Herz herausreißen können. Genauso fühlte es sich an. Alles, wofür ich gekämpft hatte, die Opfer, die ich erbracht hatte, die endlosen Tage auf der Flucht, die Einsamkeit – alles zerstört von der Habsucht eines abgeschmackten Söldners, der nicht einmal wusste, was er da angerichtet hatte.
Grinsend ragte der Schnauzbart über mir auf. In seinen Fingern das blutige Schmuckstück. Seine Lippen bewegten sich, aber ich hörte nicht mehr, was er sagte. Ein hoher sirrender Ton überlagerte seine Stimme und all die übrigen Geräusche dieser schrecklichen Nacht. Er schob das Amulett in seine Hosentasche, bevor sein Blick sich auf meine nackten Brüste heftete und seine Hände zu seinem Gürtel wanderten …
Angst stieg in mir hoch, während ein Windstoß durch den Wald fegte und einen Schwarm Krähen aufscheuchte. Im Licht der tanzenden Fackeln zuckten die Söldner erschrocken zusammen. Für einen winzigen Moment ließ der Griff um meine Handgelenke nach. Das war meine Chance. Meine letzte Chance.
Ich reagierte instinktiv. Mein Körper blendete die Schmerzen aus und war nur noch von dem Willen beherrscht, zu überleben. Mit einem kraftvollen Ruck befreite ich meine Arme und hieb um mich. Keine Ahnung, wen ich erwischte, aber ich spürte heißes Blut an meinen Krallen. Der Schnauzbart sprang fluchend von mir runter.
»Haltet sie fest, verdammt noch mal!«
Die Söldner wollten gehorchen, aber ich kämpfte wie eine Besessene, steckte Schläge ein und teilte aus. Wieder und wieder gruben sich meine Krallen in das Fleisch der Männer. Mein Verstand kam meinen Instinkten nicht hinterher. Ich nahm nur Blut und Schreie wahr, während meine Muskeln simple Bewegungsabläufe abspulten. Ducken, schlagen, treten, kratzen, fallen und wiederaufstehen. Ich hörte auch Schüsse. Es war reines Glück, dass mich keine der Kugeln traf. Und noch größeres Glück, dass ich in einen Gepäckhaufen stolperte, wo mein Blick direkt an einer halb vollen Schnapsflasche hängen blieb. Das perfekte Wurfgeschoss. Ich schleuderte die Glasflasche mit aller Kraft auf den Kerl mit der Fackel und löste damit ein wahres Spektakel aus: Er brannte binnen Sekunden lichterloh, schrie um Hilfe und stürzte über einen toten Kameraden – genau in die Arme des schnauzbärtigen Anführers. Der stand kurz darauf ebenfalls in Flammen und warf sich laut fluchend auf den Boden, während einer seiner Männer versuchte, ihn zu löschen.
Genau die Ablenkung, die ich gebraucht hatte.
Ich drehte mich um und rannte los. Na ja, es war weniger rennen als taumeln, aber überraschenderweise gaben meine Beine nicht unter mir nach und brachten mich fort von dem unglückseligen Waldweg. Schon bald war der Schein des Feuers hinter den dicht stehenden Bäumen verschwunden und die Nacht verschluckte das Geschrei der Söldner. Schritte, die mir folgten, hörte ich keine. Noch nicht. Früher oder später würden sie sich mir an die Fersen heften. Die Frage war nur, ob sie mich einholen würden, bevor …
Mit zitternden Fingern fasste ich mir ans Herz und ertastete dort