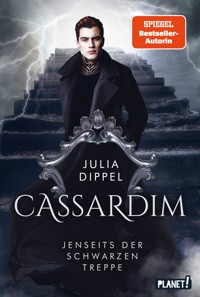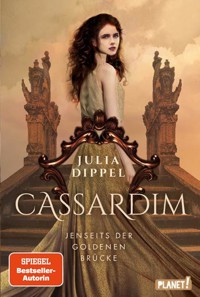
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gefährlich, überraschend und fesselnd – willkommen in Cassardim!
Amaia ist gerade sechzehn geworden – zum achten Mal. Warum ihre Familie so langsam altert und warum sie keinem ihrer fünf Geschwister ähnelt, möchte Amaia unbedingt herausfinden, aber ihre Eltern tun alles, um dieses Familiengeheimnis zu wahren – ständige Umzüge, strenge Regeln und Gedankenkontrolle inklusive. Amaia sieht ihre Chance gekommen, als ihre älteren Brüder eines Tages einen Gefangenen mit nach Hause bringen: den geheimnisvollen wie gefährlichen Noár, der ebenso wenig menschlich ist wie sie. Doch dann wird Amaias Familie angegriffen und plötzlich ist Noár ihre letzte Hoffnung: Er verlässt mit ihnen die Menschenwelt und bringt sie nach Cassardim, ins Reich der Toten, wo Amaia zwischen Intrigen, Armeen, lebendig gewordenen Landschaften, unwirklichen Kreaturen und mächtigen Fürstenhäusern endlich ihre Antworten findet – und ihr Herz verliert.
Der neue Roman von Julia Dippel, Autorin der Izara-Bände.
Nominiert für den Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Wenn die Wüste fließt, Felsen schweben, Wälder wandern und der Nebel deine Erinnerungen stiehlt, dann bist du jenseits der Goldenen Brücke – in Cassardim.
Aber Vorsicht: Was hier verloren geht, bleibt verloren. Auch wenn es sich um dein Herz handelt.
Die Autorin
© http://perkins.photo
Julia Dippel wurde 1984 in München geboren und arbeitet als freischaffende Regisseurin für Theater und Musiktheater. Um den Zauber des Geschichtenerzählens auch den nächsten Generationen näherzubringen, gibt sie außerdem seit über zehn Jahren Kindern und Jugendlichen Unterricht in dramatischem Gestalten. Ihre Textfassungen, Überarbeitungen und eigenen Stücke kamen bereits mehrfach zur Aufführung.
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch! Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autoren und Illustratoren: www.planet-verlag.de
Planet! auf Facebook: www.facebook.com/thienemann.esslinger
Viel Spaß beim Lesen!
AUFZÜGE SIND NICHT SICHER
Die pulsierende grüne Linie und ihr regelmäßiges Piepen brachten mich dem Tod näher, als ich es in meinem ganzen Leben gewesen war. Ich hatte noch nie einen Menschen sterben sehen – geschweige denn erlebt, wie jemand quälend langsam seinem Ende entgegenkroch.
»Versuch wenigstens, deinen Schock zu verbergen«, murmelte Zoey. »Mir ist klar, dass ich grade weißer bin als du.«
Der Anblick meiner Freundin schockierte mich tatsächlich. Wobei das noch untertrieben war. Ich fühlte mich, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Dieses zerbrechliche Etwas unter den Krankenhauslaken hatte kaum noch was mit meiner Zoey gemeinsam. Dem energiegeladenen Mädchen, das jede gute Note mit ein paar Dance-Moves feierte und laut auf dem Fahrrad sang, wenn sie nach Hause fuhr – egal, ob sie jemand dabei hörte oder nicht. Zwei Jahre hatte ich meine Freundin nicht mehr gesehen. Zwei Jahre, die Zoey schwer gezeichnet hatten. Ihr strahlendes Lächeln fehlte, genau wie der temperamentvolle Glanz in ihren Augen. Auch ihr perfekter Karamell-Teint und der innig geliebte Afro waren der Chemo zum Opfer gefallen.
»Warum hast du es mir nicht früher gesagt?« Nur mit Mühe schaffte ich es, meine Stimme unter Kontrolle zu halten. Zoeys Mundwinkel hoben sich ein paar Millimeter. Es brach mir das Herz, sie so zu sehen. Wir hatten uns in einem Jazz-Tanzkurs in Zürich kennengelernt, in dem Zoey alle mit ihren temperamentvollen Bewegungen begeistern konnte. Jetzt fehlte ihr selbst die Kraft für die kleinste Geste. Als sie mich zu sich winkte, erinnerte sie mich eher an eine alte Frau als an ein junges Mädchen.
»Eine Drama-Queen zu sein macht nur Spaß, wenn man dabei blendend aussieht«, versuchte Zoey zu scherzen. Auch das war nur ein Bruchstück der Schlagfertigkeit, die sie mir früher um die Ohren gehauen hätte.
Zögerlich löste ich mich vom Türrahmen und setzte mich auf den Stuhl, der neben dem Bett stand. Ich griff nach Zoeys Hand und drückte sie. Das allein reichte, um die Fassade meiner Freundin ins Wanken zu bringen und ihr die Tränen in die Augen zu treiben.
»Schön, dass du gekommen bist«, hörte ich sie flüstern.
»Ist doch selbstverständlich!«
Nachdem Zoey mir endlich gestanden hatte, was mit ihr los war und warum sie nur noch sporadisch auf meine Nachrichten antwortete, hatte ich alles stehen und liegen gelassen, um mir sofort ein Zugticket nach Genf zu kaufen. Dort gab es wohl eine Spezialklinik für Leukämie-Patienten und wie es der Zufall so wollte, lebten wir zurzeit nur drei Zugstunden entfernt. Die verbliebenen Tage bis zum Wochenende waren eine Tortur gewesen. Wenigstens konnte ich mir so noch ein ausführliches Alibi zurechtlegen, warum ich den ganzen Samstag unterwegs sein würde.
»Wissen deine Eltern, dass du hier bist?«, erkundigte sich Zoey, als hätte sie meine Gedanken gelesen.
Ich antwortete mit einem vielsagenden Schnauben. Sie hätten mich niemals gehen lassen. Wahrscheinlich bekäme ich für die nächsten zwanzig Jahre Hausarrest, wenn sie erfahren würden, dass ich Kontakt zu einem meiner alten ›Leben‹ hielt.
Das war gegen die Regeln und in all den Jahrzehnten hatte ich sie nur für Zoey gebrochen. Die einzige Freundin, die sich nicht daran gestört hatte, wie verkorkst, verschlossen und abweisend ich zu ihr gewesen war.
»Dad ist gerade etwas empfindlich, weil wir wieder umziehen mussten«, erklärte ich. Das entsprach der Wahrheit. »Solange sie hinter uns her sind, bleibt uns nichts anderes übrig.« Wieder die Wahrheit – zumindest ein Teil davon. Irgendwas hatte ich Zoey ja schließlich erzählen müssen, als wir damals von einem Tag auf den anderen weggegangen waren. Eine hübsch ausgeschmückte Geschichte über unsere Familie im Zeugenschutzprogramm schien mir am glaubwürdigsten – mit dem großartigen Nebeneffekt, dass Zoey niemandem verraten würde, was aus uns geworden war.
»Schätze, du wirst ziemlichen Ärger kriegen.«
Ich grinste. »Wäre nicht das erste Mal.«
Tatsächlich hatte ich noch nie so viel Hausarrest bekommen wie in meiner Zeit mit Zoey – und ihn noch nie so gern in Kauf genommen. Früher war selten jemand daran interessiert gewesen, mich zu sich nach Hause einzuladen. Geschweige denn, mich zu einer Party mitzunehmen. Nur dank Zoey hatte ich zum ersten Mal so etwas wie ein Sozialleben gehabt.
»Tja, aber das hier«, murrte meine Freundin und sah sich in ihrem Krankenzimmer um, »ist kein Schulball. Hier laufen auch keine Leons oder Wills oder Alexanders rum, die eine elterliche Standpauke wert wären.« Sie zog eine schwache Grimasse. »Sieht aus, als wäre dein Leben inzwischen ziemlich traurig geworden, MaiMai.«
Wohl wahr, aber das war nichts im Vergleich zu dem Albtraum, den Zoey gerade durchmachen musste. Sie hatte in ihren letzten Voicemails alles über ihre Leukämie erzählt. Man hatte angeblich bereits einen Stammzellenspender gefunden, trotzdem musste sie zuerst die Chemotherapie hinter sich bringen.
»Du bist es wert!«, versicherte ich ihr. »Und du wirst es durchstehen.«
Eine dicke Träne kullerte über Zoeys eingefallene Wange.
»Wenn du es sagst.«
Ich hatte sie noch nie weinen sehen. Es schnürte mir die Kehle zu. Zoey war so tapfer und dennoch hatte sie schon fast aufgegeben. Das fühlte ich. Genau in diesem Moment traf ich eine Entscheidung. Das Risiko war überschaubar. Wir befanden uns zwar an einem denkbar schlechten Ort, aber Zoey würde das ohne Hoffnung nicht durchstehen.
»Ich sage es nicht nur, ich weiß es! Du wirst das schaffen!« Ich sah meiner Freundin fest in die Augen und legte meine ganze Überzeugungskraft in die nächsten zwei Worte.
»Glaub mir!«
Ein trüber Nebel wirbelte durch Zoeys dunkle Augen, bevor der so vertraute Glanz zurückkehrte. Sie lächelte mich an. Dankbar und voller Zuversicht.
Selbstverständlich ahnte sie nicht, was ich mit ihr gemacht hatte. Technisch gesehen wusste ich es selbst nicht genau. Ich nannte es heimlich die Macht der Worte. Wenn man es richtig anstellte, konnten ich und meine Familie andere damit beeinflussen. Aber wir redeten nur wenig darüber. Niemand hatte mir je erklärt, wie diese Fähigkeit funktionierte oder wie man sie einsetzte. Ich hegte sogar den Verdacht, dass meine Eltern mich und meine Geschwister manipulierten, damit wir nicht weiter nachforschten. Das Einzige, das ich mit Sicherheit wusste, war, dass ich mich auf diese Gabe nicht verlassen konnte. Manchmal klappte es und manchmal nicht. Diesmal hatte ich Glück gehabt. Wie auf Knopfdruck wurde Zoey lebendiger. Sie fing an zu plappern und versorgte mich mit dem neuesten Klatsch aus meiner alten Klasse und fragte mich über meine Geschwister aus. Genauer gesagt nur über meinen älteren Bruder Nick, den Zoey mit seiner dunklen Mähne schon immer ›hotter als hot‹ fand. Wie sehr ich sie doch vermisst hatte …
Wir quatschten fast eine Stunde lang, bevor eine stämmige Krankenschwester ins Zimmer marschiert kam und uns unterbrach.
»Du meine Güte, was machst du denn noch hier, junge Dame?« Sie bedachte mich mit einem kritischen Blick. »Die Besuchszeit ist vorbei! Bist du allein hier? Wo sind deine Eltern?«
»Maia ist eine Freundin aus dem Tanzkurs«, antwortete Zoey für mich. »Sie ist vor einer Weile weggezogen und jetzt sehr weit gefahren, um mich zu sehen. Vielleicht könnten Sie ja mal eine Ausnahme machen, Schwester Agnes?« Der energische Unterton in Zoeys Stimme erinnerte mich an früher. Ich lächelte. Wie hieß es doch so schön: Der Glaube versetzt Berge.
»Noch eine Tänzerin also. Wie schön«, trällerte die Krankenschwester begeistert, während sie Geräte und Schläuche kontrollierte. »Ich finde es sehr lobenswert, dass du Zoey unterstützt, aber ich muss dich trotzdem hinausbitten. Wenn du möchtest, kannst du deine Eltern vom Schwesternzimmer aus anrufen, damit sie dich abholen.«
»Nicht nötig, ihre Eltern warten unten im Wagen«, log Zoey ohne mit der Wimper zu zucken und fügte mit einem Zwinkern in meine Richtung hinzu: »Geh schon, wir schreiben. Und grüß Nick von mir!«
Schwester Agnes scheuchte mich aus dem Zimmer und warf mir die Tür vor der Nase zu.
Ein kurzes Vergnügen. Trotzdem hatte es sich gelohnt.
Ich sah auf die Uhr. Wenn ich mich beeilte, konnte ich sogar einen früheren Zug als geplant zurück nach Lyon nehmen. Ich fühlte mich hier ohnehin nicht sehr wohl. Krankenhäuser standen ganz oben auf der Liste der Orte, von denen wir uns unter allen Umständen fernhalten sollten. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, warum das so war, aber ich wollte es lieber nicht herausfinden.
Während ich auf den Fahrstuhl wartete, kramte ich mein Handy aus meiner übervollen Umhängetasche. Zoey hatte sie ›MaiMais Bermuda-Dreieck‹ getauft, weil dort drinnen Dinge verschwanden und erst Jahre später wieder auftauchten.
Als ich es endlich gefunden hatte, fand ich auf dem Display – wie erwartet – eine Nachricht von Zoey.
Schwester Agnes hört gar nicht mehr auf, von dir zu reden. Sie sagt, du erinnerst sie an die Lieblingspuppe ihrer Tochter. Ziemlich creepy, wenn du mich fragst!
Ich seufzte und verkniff mir ein Augenrollen. Inzwischen hatte ich mich an die ewigen Puppenvergleiche gewöhnt. Die Krankenschwester war nicht die Erste, die sich von meiner fehlenden Körpergröße, der blassen Haut und den widerspenstigen dunklen Korkenziehern auf meinem Kopf beeindrucken ließ. So ziemlich jeder fand das ›süß‹. Jeder, der keine Ahnung hatte, wie kompliziert es war, damit nicht wie eine minderjährige, erkältete Vogelscheuche auszusehen.
Solange ihre Tochter nicht erfunden ist und sie mich zu ihren anderen ›Puppen‹ in den Keller sperrt …, tippte ich ein, woraufhin ich eine Flut von entsetzten und grinsenden Emoticons von Zoey zurückbekam.
Ein dumpfer Schlag ließ mich aufblicken. Am Ende des Ganges stritten zwei Männer miteinander. Der eine hatte den anderen gegen die Wand gedrückt und redete leise auf ihn ein. Da die Lichter in den Gängen schon auf Nachtruhe gedimmt worden waren, konnte ich sie nicht gut erkennen. Aber sie trugen Wintermäntel und schwere Stiefel, also waren sie wohl keine Patienten. Etwas in mir sträubte sich, drängte an die Oberfläche und versuchte, durch meine Haut nach draußen zu gelangen. Durch meine Jacke hindurch rieb ich mir die Arme. Ich kannte dieses Gefühl und ich hasste es. Es war, als krabbelten winzige Insekten in Zeitlupe unter meiner Haut. Allerdings passierte das normalerweise nur zu Hause, wenn meine Eltern …
Der Aufzug kam mit einem ›Ping‹ an. Ich schlüpfte hastig hinein und drückte gleich mehrmals auf den Knopf für das Erdgeschoss. Als der Fahrstuhl sich schloss, klang das unangenehme Gefühl ab. Ich atmete auf … bis sich in letzter Sekunde ein schwarzer Lederhandschuh zwischen die Türen schob. Darin steckte eine wuchtige Hand, die zu einem grau melierten Kerl in mittleren Jahren gehörte. Er musterte mich eindringlich aus seinen schlammfarbenen Augen, bevor er die Kabine betrat und sie durch seine schiere Größe und seine bedrohliche Präsenz fast völlig ausfüllte. Ich drückte mich in eine Ecke und fühlte mich noch kleiner, als ich ohnehin schon war. Das musste einer der beiden Männer sein, die sich eben gestritten hatten. Sonst hatte ich niemanden in den Gängen gesehen.
Die Fahrstuhltüren schlossen sich wieder und sperrten mich für die nächsten vierzehn Stockwerke mit dem seltsamen Typen ein. Inzwischen hatte er seinen durchdringenden Blick von mir abgewandt, sodass ich ihn verstohlen betrachten konnte. Sein Gesicht war kantig und vernarbt, aber trotzdem auf eine ungewöhnliche Art schön. Die langen Haare hatte er im Nacken zusammengebunden, was perfekt zu seinem rauen und dennoch gepflegten Äußeren passte. Er wirkte ein bisschen wie der Bodyguard eines russischen Gangsterbosses, der seinen Chef sowohl in die Oper begleiten als auch Leute in dunklen Gassen verprügeln konnte. Ob er etwas mit dem unangenehmen Gefühl zu tun hatte, das mir eben unter die Haut gekrochen war? Während ich so darüber nachdachte, bemerkte ich aus den Augenwinkeln, wie sich der Boden in der gegenüberliegenden Ecke aufzulösen begann. Das graue Linoleum kräuselte sich und Schatten schlängelten daraus hervor wie tastende Finger, die aus einer anderen Welt zu uns vordringen wollten. Oh, bitte nicht. Ich hatte meine Gabe doch nur ganz kurz eingesetzt.
Die dunklen Finger verbanden sich und wurden zu Tentakeln, in denen violette und grüne Schlieren aufblitzten. Es war ein Chaoswirbel, der keinem Muster folgte, keinem geraden Weg. Unberechenbare nervige Dinger … und sie waren mir auf der Spur. Panisch sah ich auf die Anzeige des Fahrstuhls. Wir befanden uns erst im achten Stock. Mist. Ganz gleich, wie langsam sich das Chaos hier ausbreitete, bis wir im Erdgeschoss angekommen waren, würde es mich erreicht und verschlungen haben.
Ich ging einen Schritt zur Seite, um den sich windenden Tentakeln auszuweichen, die bereits über meine Schuhspitzen strichen. Dabei stieß ich beinahe gegen den großen Mann, der mich nun wieder mit zusammengezogenen Brauen beobachtete. Als ich ihm versichern wollte, dass ich nicht verrückt war, setzte mein Herz einen Schlag aus. Auch hinter ihm wucherte ein großer Chaoswirbel, der gierig seine dunklen Klauen ausstreckte. Oh mein Gott! Ich musste etwas tun, ihn warnen! Ich holte Luft … aber mir fehlten die Worte. Was sollte ich ihm denn sagen? Dass eine für ihn unsichtbare Gefahr ihn zu verschlucken drohte?! Wieder spürte ich ein leichtes Tasten an meinen Zehen. Die Schatten am Boden hatten mich erneut gefunden und eingekreist. Mir blieb nur ein großer rettender Schritt in Richtung der Fahrstuhlanzeige. Im selben Moment, als ich dem Mann eine erfundene Geschichte präsentieren wollte, warum wir dringend aussteigen sollten, griff er über meine Schulter hinweg und drückte einen der Knöpfe. Beinahe sofort bremste der Fahrstuhl und öffnete sich. Ich sprang hinaus, gerade rechtzeitig, bevor die Schatten sich um meine Knöchel schlingen und mich festhalten konnten.
»Sie sollten vielleicht auch die Treppe nehmen«, stammelte ich. »Aufzüge … sind nicht … sicher.«
Aufzüge sind nicht sicher?! Etwas Dümmeres war mir wohl nicht eingefallen! Am liebsten hätte ich mir mit der flachen Hand auf die Stirn geschlagen. Wenn ich damit meine Glaubwürdigkeit nur nicht noch mehr untergraben hätte. Doch der Mann schien sich an meiner Aussage nicht zu stören. Er grinste mich schief an. Dabei erinnerte er mich eher an ein wildes Tier als an einen Menschen.
»Sei besser vorsichtig, Treppen sind es auch nicht«, brummte er und trat dann mit seinem schweren Stiefel auf die kriechenden Chaoswirbel, die mir aus dem Aufzug folgen wollten. Die Schatten zerstoben. »Lauf!« Im selben Augenblick schlossen sich die Türen und ich glaubte noch, etwas kupferfarben blitzen zu sehen.
Ein paar Sekunden stand ich fassungslos da, doch dann erreichte die Warnung des seltsamen Mannes mein Gehirn und ich rannte los. Seine Worte hallten immer und immer wieder in meinen Ohren nach. Besonders als die ersten dunklen Tentakel aus den Wänden des Treppenhauses krochen und versuchten, nach mir zu greifen. Aber sie waren träge, tasteten blind umher. Ohne die Enge des Fahrstuhls konnte ich ihnen mühelos ausweichen. Im Erdgeschoss stürmte ich durch den Haupteingang und lief durch die hereinbrechende Nacht in Richtung Bahnhof. Den Bus wollte ich nicht nehmen. Noch war ich nicht weit genug vom Ausgangsort weg. Und allein die Vorstellung, wieder in einem geschlossenen Raum oder Fahrzeug eingesperrt zu sein, falls das Chaos wiederkehren sollte, war alles andere als verlockend.
Erst am Bahnsteig erlaubte ich mir durchzuatmen. Der Sprint durch die kalte Herbstluft hatte mir geholfen, meinen anfänglichen Schock zu verdauen. Ich stützte mich auf den Knien ab und sortierte meine Gedanken. Es war in den letzten Jahrzehnten natürlich ab und an vorgekommen, dass sich kleinere Chaoswirbel gezeigt hatten. Meistens wenn ich verbotenerweise jemanden beeinflusste. Doch heute waren die Wirbel viel lebhafter und aggressiver gewesen. Vielleicht lag das tatsächlich am Krankenhaus? Oder hatte dieser fremde Mann etwas damit zu tun? Immerhin war da dieses widerliche kriechende Gefühl gewesen, das ich immer nur dann bekam, wenn jemand in meiner Nähe die Macht der Worte benutzte. War er wie wir? Hatte er im Aufzug das Chaos sehen können … oder bildete ich mir das nur ein? Jetzt – mit genügend Abstand – verfluchte ich mich dafür, weggerannt zu sein. Der Typ hätte Antworten haben können auf all die Fragen, die mir schon so lange auf der Seele brannten. Am liebsten wäre ich direkt umgekehrt, aber ich wusste, dass er längst weg sein würde. Und damit auch meine Chance auf die Wahrheit …
Frustriert ließ ich mich auf eine Bank fallen. Ich hatte mich heute so frei gefühlt wie noch nie. Es war mein persönliches Abenteuer gewesen, zum ersten Mal alleine in die weite Welt aufzubrechen. Natürlich war ich mit diesem Ausflug auch ein Risiko eingegangen. Ein zu großes, wie mir jetzt bewusst wurde. Die ganze Sache hätte für mich richtig übel enden können. Ich hatte keine Angst. Okay, vielleicht ein bisschen. Aber vor allem rumorte in mir ein unangenehm schlechtes Gewissen. Und ich musste – nicht ohne Zähneknirschen – zugeben, dass das Verbot meiner Eltern, was derartige Alleingänge betraf, offenbar einen guten Grund hatte.
Eine halbe Stunde später saß ich im Zug nach Lyon. Mit etwas Glück würde ich schon gegen neun zurück sein und konnte mein Alibi vom Shoppingtrip aufrechterhalten.
»Den Fahrschein bitte«, forderte mich eine Frauenstimme auf. Sie gehörte einer älteren Zugbegleiterin mit einer übergroßen Hakennase. In ihrem Französisch klang ein starker Dialekt mit, aber ich verstand sie trotzdem. Das war für unsere Familie noch nie ein Problem gewesen. Wir beherrschten alle Sprachen, ohne sie lange lernen zu müssen. Warum das so war, gehörte zu den vielen Fragen, auf die mir meine Eltern eine Antwort schuldeten. Als Kind hatte ich meinen Vater einmal darauf angesprochen. Er meinte damals nur, das läge uns im Blut.
Mit einem herzlichen Lächeln zeigte ich der Kontrolleurin die App mit meinem Fahrschein. Sie scannte den Strichcode und musterte mich skeptisch. »Wie alt bist du, Mädchen?«
»Ich bin neulich sechzehn geworden, Madame.« Zum achten Mal, um genau zu sein. Davor war ich fünfzehn Jahre lang fünfzehn gewesen. Und davor vierzehn Jahre lang vierzehn. Tja, was sollte ich sagen … es war die Hölle gewesen, eine gefühlte Ewigkeit in der Pubertät festzustecken.
Der skeptische Blick der Zugbegleiterin blieb und mir war klar, was gleich kommen würde. Also zog ich einen Umschlag aus meiner Bermuda-Dreieck-Tasche und hielt ihn ihr unter die Nase. Wenn man sich als Dauer-Sechzehnjährige auch nur halbwegs frei bewegen wollte, dann war man auf derartige Hilfsmittel dringend angewiesen.
»Hier ist die schriftliche Erlaubnis meiner Eltern«, erklärte ich ihr in fließendem Französisch. »Ich habe in Genf eine Tante von mir besucht. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Es hat alles seine Richtigkeit.«
Die Kontrolleurin studierte das Papier, das selbstverständlich gefälscht war. In diesem Moment klingelte mein Handy. Es war meine Mutter. Ich deutete mit einem entschuldigenden Schulterzucken auf das Display und räumte damit auch die letzten Zweifel der Zugbegleiterin aus.
»Hi, Mom!«, ging ich ran, während die Kontrolleurin weiterzog.
Die Stimme meiner Mutter klang scharf. »Wer ist bei dir?« Das war zu erwarten gewesen. Ich nannte sie nur Mom, wenn ich signalisieren wollte, dass ich nicht frei sprechen konnte.
»Ich hab zufällig ein paar Freunde getroffen«, log ich. Gleichzeitig schickte ich ein stilles Gebet ans Universum, dass ich das Telefonat abwürgen konnte, bevor eine Durchsage im Zug mich verriet.
Das Schweigen am anderen Ende der Leitung war kein gutes Zeichen. Meine Mutter zögerte ausschließlich dann, wenn sie eine strittige Entscheidung zu fällen hatte.
»Komm sofort nach Hause!«
»Was?! Warum?« Jetzt saß ich wirklich in der Klemme. Von Lyon brauchte ich fast eine Stunde zu unserem Haus. Noch war ich aber etwa zwei Stunden von Lyon entfernt.
»Eine der Fallen wurde ausgelöst. Dein Vater ist mit deinen Brüdern auf die Jagd gegangen.«
Ach du Scheiße! Wie konnte das denn passieren? Normalerweise dauerte es doch mindestens ein Jahr, bevor uns die Chaoswandler fanden. Im Vergleich zu diesen menschenähnlichen Kreaturen, in deren Augen der Wahnsinn brannte, waren die Chaoswirbel aus dem Krankenhaus geradezu niedlich. Kein Wunder, dass meine Mutter sich Sorgen machte und uns alle nach Hause beorderte.
Trotzdem konnte ich weder fliegen noch den Zug schneller fahren lassen …
»Wäre es nicht besser, zu warten, bis Dad das Problem beseitigt hat?«, versuchte ich mir etwas mehr Zeit zu erkaufen. Mein Argument war nicht einmal aus der Luft gegriffen. Immerhin stand unser neues Zuhause inmitten eines riesigen bewaldeten Anwesens. Alleine durch die unbewohnte Dunkelheit zu fahren, solange ein Chaoswandler dort sein Unwesen trieb, erschien mir tatsächlich als keine gute Idee.
Meine Mutter seufzte und ich fühlte mich schlecht, weil ich ihre Angst noch schürte.
»In Ordnung. Bleib in Bewegung, meide Menschenmassen und schreib mir alle fünf Minuten. Wenn dein Vater Entwarnung gibt, fährst du sofort los!«
»Alles klar!«, sagte ich, aber meine Mutter hatte schon aufgelegt.
ZUMINDEST KEIN VAMPIR
Ich hatte heute Abend wirklich mehr Glück als Verstand. Die Nachricht von meinem Vater kam genau in dem Moment, als ich in Lyon das Auto aufsperrte. Und auch auf der Heimfahrt hielt mich niemand an, obwohl ein minderjähriges Mädchen am Steuer durchaus ein Grund dazu gewesen wäre. Für diesen Fall besaß ich einen gefälschten Führerschein, den ich letztes Weihnachten von meinem Vater geschenkt bekommen hatte. Das gehörte zu den wenigen Zugeständnissen, die uns älteren Geschwistern eingeräumt wurden. Schließlich konnten wir alle schon seit Jahrzehnten gut und sicher Auto fahren – wir sahen eben nur nicht danach aus …
Ich parkte den Volvo in der Einfahrt und holte meine Alibi-Einkaufstüten aus dem Kofferraum. Ein Shoppingtrip ohne die entsprechende Ausbeute wäre alles andere als glaubhaft. Schließlich spielten die Details die Hauptrolle in jedem guten Schwindel.
Meine Mutter erwartete mich bereits am Eingang. Sie hatte ihre Finger ungeduldig in ihre Strickjacke gekrallt. Der Kleidungsstil war allerdings das Einzige an ihr, das im klassischen Sinn mütterlich wirkte. Ansonsten war sie groß, kühl und das genaue Gegenteil von feminin. Sie stemmte Gewichte, ging jeden Tag zwei Stunden Joggen und lächelte so gut wie nie. Ich konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern, sie jemals unbeschwert erlebt zu haben. Auch jetzt nickte sie mir nur knapp zu. Eine Umarmung oder etwas in der Art gab es nicht. Stattdessen behielt sie die nächtliche Auffahrt im Blick und verriegelte die Tür, als ich im Haus war.
»Maaaia!« Meine jüngere Schwester Annie polterte die Treppe hinunter und bremste nur ein paar Zentimeter vor mir. »Hast du mir was mitgebracht?«
Erwartungsvoll sah sie mich mit ihren großen hellbraunen Augen an, als wäre ich eine Märchenfee, die ihr alle Wünsche erfüllen konnte. Ich verkniff mir ein Grinsen. Annie wurde zwar in zehn Tagen hundertfünf, aber sie hatte es trotzdem geschafft, sich ihre Unbeschwertheit zu bewahren. Eigentlich sollte sie aussehen wie dreizehn, durch ihre kindliche Art wirkte sie jedoch eher wie elf.
»Vielleicht«, sagte ich in verschwörerischem Tonfall und zog an ihrem karamellbraunen Zopf. »Vielleicht aber auch nicht. Ich schätze, da wirst du dich gedulden müssen.«
Annie schnitt eine Grimasse und verschränkte schmollend ihre schmächtigen Arme vor der Brust.
»Ich rede nicht von meinem Geburtstagsgeschenk. Du bringst mir doch sonst auch immer was mit, wenn du in der Stadt warst«, meinte sie, während sich nach und nach Enttäuschung auf ihrem zuckersüßen Gesicht ausbreitete. Das reichte, um mich um den Finger zu wickeln. Besonders da ich wusste, dass Annie ihre Niedlichkeit nicht aus Kalkül einsetzte. Deshalb liebte ich sie auch so heiß und innig.
»Könnte sein, dass ich da tatsächlich eine Kleinigkeit für dich habe.« Ich kramte in einer meiner Tüten und beförderte die neueste Ausgabe von Annies Lieblings-Pferdemagazin zutage. Danach hörte ich nur ein Quietschen, spürte eine feste Umarmung und sah Annie, wie sie samt Magazin die Treppe hinaufstürmte.
»Es wäre besser, wenn du sie nicht so verwöhnst«, kritisierte mich meine Mutter. Sie klang nicht verärgert, sondern sachlich. Wie immer. Ich ignorierte sie. Wie immer.
»Ist Jenny schon zurück?«, erkundigte ich mich stattdessen. Meine ältere Schwester hatte heute eigentlich bei einer Freundin übernachten wollen. Nach der ganzen Sache mit der ausgelösten Falle war sie aber bestimmt ebenfalls zurückzitiert worden.
»Nein. Sie ist nicht an ihr Handy gegangen.«
Das wunderte mich kaum. Anders als meine Mutter wusste ich nämlich, dass ihre neue Freundin Paul hieß und in Wirklichkeit ein heißer Skater war, den Jenny an ihrem ersten Schultag in Lyon aufgerissen hatte.
»Ihr geht es bestimmt gut«, versuchte ich, sie in Schutz zu nehmen. Meine Mutter nickte kalt und zog sich ihren weißblonden Pferdeschwanz fest.
»Ja, sie hat zumindest geschrieben. Trotzdem wird das nicht ohne Konsequenzen bleiben.«
Ich unterdrückte ein Stöhnen. Nicht nur, weil ich eine Strafe für übertrieben hielt, sondern auch, weil das bedeutete, dass ich in den nächsten Wochen rund um die Uhr eine schlecht gelaunte Jenny ertragen musste.
»Wir warten mit dem Essen auf die anderen«, wechselte meine Mutter mehr oder weniger geschmeidig das Thema. »Bring deine Sachen nach oben und räum sie auf, bevor die Tüten wieder tagelang rumstehen.«
Seufzend tat ich, was meine Mutter von mir verlangte. Theoretisch hatte sie recht. Praktisch wünschte ich mir manchmal ein bisschen weniger Kontrolle und ein bisschen mehr Herzlichkeit. Aber das ließ sich wohl nicht ändern.
Mein Zimmer lag im zweiten Stock des Herrenhauses. Früher war es mal der Landsitz eines Barons gewesen – zumindest laut Google. Jetzt wurde von hier aus ein Weingut verwaltet. Das ganze Anwesen versprühte einen gewissen heimeligen Charme, aber ich hatte mir längst abgewöhnt, mich irgendwo zu Hause zu fühlen. Genauso wie ich aufgegeben hatte, Fragen zu stellen, auf die ich ohnehin keine Antworten bekam. Auch das gehörte zu den Dingen, die ich nicht ändern konnte.
In meinem Zimmer angekommen, stellte ich die Tüten unausgepackt in den Wandschrank, kickte meine Stiefel in die ›Schuh-Ecke‹ und verriegelte die Tür. Dann startete ich meine Gib-niemals-auf-Playlist und warf mich zu meinem Laptop aufs Bett. Nachdem ich mein Passwort eingegeben hatte, leuchteten direkt die Ergebnisse meiner Leukämie-Recherchen auf. Ich schloss sie schweren Herzens und stieß auf einen Artikel über hethitische Mythologie, mit dem ich mich beschäftigt hatte, bevor Zoeys Krankheit wichtiger geworden war. Daneben kam ein YouTube- Video zum Vorschein: ›Das Geheimnis der Kaffeebohne!‹ Und darunter tauchte mein mit Dateien übersäter Desktop auf, auf dem eine Ballerina mit Kopfhörern zu sehen war.
Das alles beschrieb mein Leben relativ gut. a) Ich war musiksüchtig und b) leider ziemlich unordentlich. c) Ich liebte Bibliotheken und seit den letzten dreißig Jahren auch das Internet, weil ich dort mit meinen Fragen nie aneckte. d) Man brauchte nur genügend Freizeit, Langeweile und fehlende Sozialkontakte, damit auch die absurdesten Hobbys an Attraktivität gewannen. Im Moment war Kaffeerösten dran, aber ich hatte mich auch schon durch unzählige andere durchprobiert. Manche bereute ich, wie die Bienenzucht. An anderen verlor ich recht schnell wieder das Interesse, wie bei meinem Kräutergarten oder dem Töpfern. In manche verliebte ich mich aber. Und damit waren wir auch schon bei e): Ich tanzte für mein Leben gern. Ballett, Jazz, Hip-Hop … ganz egal.
Plötzlich hörte ich ein Poltern. Jemand rief etwas. Es war die Stimme meines Vaters. Sie waren zurück! Ich sprang auf und rannte die Treppe runter. Was auch immer sie zu berichten hatten, würde darüber entscheiden, ob wir bald schon wieder umziehen mussten. Das konnte mir, ehrlich gesagt, nicht gleichgültiger sein. Was mich aber sehr wohl interessierte, waren alle Fakten, die mit uns, dem langsamen Altern, der Macht der Worte und dem Chaos zu tun hatten. Nichts wollte ich mehr, als endlich zu erfahren, was ich war.
Doch im Erdgeschoss erwartete mich etwas, das mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Nick und Adam, meine beiden älteren Brüder, sahen aus, als hätten sie sich eine heftige Prügelei geliefert. Geschwollene Wangenknochen, Veilchen, blutige Nasen, geplatzte Lippen. Zwischen den beiden hing ein großer Mann mit dunkler Kleidung. Wenn meine Brüder sich nicht wieder mal gegenseitig in die Haare gekriegt hatten, musste er der Grund für ihren Zustand sein. Die Arme hatten sie ihm hinter dem Rücken gefesselt. Über seinem Kopf trug er einen groben Leinensack, sodass ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Aber ich zweifelte keine Sekunde daran, dass seine Augen aus bodenlosen Strudeln voller Wahnsinn bestehen würden.
»Ihr habt einen Chaoswandler hierher gebracht?!«, keuchte ich entsetzt.
»Er ist kein Wandler«, grunzte Nick in meine Richtung. Sein sonst immer gestylter Pferdeschwanz war ein einziges Durcheinander aus rabenschwarzen Strähnen. Ich warf ihm einen ungläubigen Blick zu. »Was?! Aber –«
»Genug!«, rief mein Vater. Seine Stimme schnitt wie eine Peitsche durch den Raum. Ein widerliches krabbelndes Gefühl kroch mir unter die Haut. »Bringt den Gefangenen in den Keller. Und dann will ich, dass ihr keine Fragen mehr stellt. Vergesst ihn. Wir haben im Wald einen Chaoswandler gefunden und getötet. Sonst gibt es nichts zu wissen.«
Ich spürte, wie meine Gedanken sich unter dem Druck seiner Worte beugten und diese neue Realität annehmen wollten. Das durfte ich nicht zulassen! Das hier war zu wichtig. Wir hatten noch nie einen Gefangenen gehabt. Zumindest konnte ich mich nicht daran erinnern.
Ohne es zu wollen, bewegten sich meine Füße und trugen mich die Treppe hoch. Nein, nein, nein!
Follow … the silver lane … through …
Ich begann in meinem Kopf eine Melodie zu summen. Sie hatte mir schon immer dabei geholfen, mich auf das zu konzentrieren, was mir wichtig war.
Nicht vergessen! Ein Gefangener! In unserem Keller!
… mist and moonlight … it’s just … a little step into …
Als ich elf war, hatte ich zu diesem Kinderlied getanzt. Mein erster und einziger Auftritt als Ballerina. Und ich hatte mein Schneeflockenkostüm so geliebt.
… a starry midnight …
Meine Eltern hatten mir den Auftritt ausreden wollen. Damals war ich zum ersten Mal der Macht der Worte entkommen.
… ride on a falling star … right to where your wishes are …
Seitdem erinnerte mich das Lied daran, dass ich ihnen widerstehen konnte.
… cause all your dreams come true …
Ich durfte es nicht vergessen, durfte mich nicht abbringen lassen. Wir hatten einen Gefangenen!
… if you only want to.
Meine Füße stoppten. Ich war wieder Herr über sie.
Trotzdem setzte ich meinen Zombie-Gang in die oberen Stockwerke fort. Wenn meine Eltern mitbekämen, dass ich ihrem Zwang entkommen war, würden sie andere Mittel und Wege finden, mich von meiner Suche nach der Wahrheit abzuhalten.
Außer Sichtweite ging ich in die Hocke und quetschte mein Ohr an das Treppengeländer. Ich musste einfach wissen, warum alle so aufgebracht waren. Hier passierte etwas ganz Großes und ich hatte keine Lust mehr, das unmündige gehirngewaschene Anhängsel zu sein.
Die schwere Tür zu den Weinkellern quietschte. Meine Brüder brachten den Gefangenen hinunter. Danach würden sie sich an nichts erinnern. Adam und Nick waren leider schon immer viel zu leicht zu beeinflussen gewesen.
»Wieso ist er hier?«, hörte ich meine Mutter zischen.
»Ich weiß es nicht, aber bei seinen Fähigkeiten ist er sicher kein Niemand.« Mein Vater seufzte, als hätte er Schmerzen. Kein Wunder, auch er war verletzt gewesen. »Wir haben ihn zu dritt kaum unter Kontrolle bekommen.«
»Ein Krieger?«, wollte meine Mutter wissen. Offenbar sprach die Mimik meines Vaters Bände, denn meine Mutter fauchte, gefolgt von einem Rumpeln, als hätte sie gegen etwas getreten. Zu gerne hätte ich mich näher ans Erdgeschoss gewagt, um sie zu beobachten. Aber das traute ich mich nicht. »Hat er seinen Willen eingesetzt?«, fragte meine Mutter weiter.
»Nein«, lautete die finstere Antwort. »Wahrscheinlich wollte er das Chaos nicht anlocken. Allerdings weiß er vermutlich, dass das Haus von Barrieren geschützt ist. Wir müssen also sehr vorsichtig sein.«
Wieder quietschte die Kellertür. Ich hörte die Schritte meiner Brüder und hastete die Treppe weiter hinauf. Adam und Nick würden direkt auf ihre Zimmer im ersten Stock gehen und mich mit etwas Glück nicht entdecken.
»Jungs, ihr hab mit diesem Wandler einen großartigen Job gemacht«, rief meine Mutter ihnen nach. »Wir essen in einer Dreiviertelstunde. Duscht euch vorher!«
»Alles klar!«, brummte Adam. Und wieder einmal konnte ich nur den Kopf schütteln über all die Lügen, die meine Eltern uns auftischten. Sicher, sie liebten uns, aber trotzdem war diese ganze Manipulationssache einfach nur verkorkst. Als meine Brüder ihre Zimmertüren schlossen, senkte meine Mutter erneut ihre Stimme.
»Können wir das Risiko eingehen, ihn zu befragen?«
»Wir müssen es tun«, entschied mein Vater. »Am besten sofort. Ich gehe rein, und du überwachst jedes Wort. Zur Not weißt du, was du zu tun hast.«
»Also gut.«
Sie setzten sich in Bewegung und ließen mich aufgewühlt im Treppenhaus zurück. Was zum Teufel passierte hier gerade? Mein Vater und meine Brüder waren keine einfachen Gegner. Wir waren zwar keine Superhelden, aber unsere Anatomie hatte der menschlichen einiges voraus. Außerdem trainierten die Jungs fast jeden Tag. Was für ein Mensch konnte es bitte mit allen dreien gleichzeitig aufnehmen? ›Ein Krieger‹ wie meine Mutter vermutete? Was bedeutete das?
Resigniert wanderte ich in mein Zimmer zurück. Am liebsten wäre ich meinen Eltern in den Keller gefolgt, doch ich wollte mein Glück für heute nicht überstrapazieren. Ich verriegelte meine Tür und kniete mich vor mein Bett, um einen alten Koffer darunter hervorzuziehen. Das war mein ganz persönlicher Schatz. Bei all den Umzügen gingen so viele Dinge verloren und irgendetwas mussten wir immer zurücklassen. Dieser Koffer jedoch kam stets mit. Außerdem gab mir das kleine Schloss daran das Gefühl von Privatsphäre. An einer Kette um meinen Hals baumelte der dazugehörige Messingschlüssel. Ich sperrte den Koffer damit auf und klappte den Deckel hoch. Alles, was mir wichtig war, fand hier seinen Platz. Meine ersten Spitzenschuhe, die inzwischen viel zu klein und zu kaputt waren, um sie zu benutzen. Eine alte Schneekugel aus Moskau. Eine Spieluhr aus Dublin mit der Silver-Lane-Melodie. Ein paar meiner Lieblingsbücher. Der Stoffhase, den Adam mir geschenkt hatte, als wir das erste Mal umziehen mussten. Zwei Kinokarten von meinem ersten und von meinem liebsten Date. Eine winzige Buddha-Statue aus Bangkok, die mich daran erinnerte, alles gelassen zu sehen. Und natürlich ein paar alte Fotografien meiner Familie, die ich geklaut hatte, bevor mein Vater sie verbrennen konnte. So viele Erinnerungen der letzten hundert Jahre. Aber jetzt ging es mir um mein in Leder gebundenes Notizbuch. Darin hatte ich alles aufgeschrieben, was ich über mich in Erfahrung gebracht hatte, inklusive diverser Experimente. Inzwischen konnte ich nur noch darüber schmunzeln. Zum Beispiel meine Vollmondstudie, oder der Versuch, Blut zu trinken, um festzustellen, ob meine Familie und ich vielleicht Vampire waren. Wir vermochten auch keine Wünsche zu erfüllen, konnten mit unseren Stimmen keine Seefahrer bezirzen und hatten keine Vorliebe für Dinge, die funkelten. Wobei ich mir da bei meiner Schwester Jenny manchmal nicht so sicher war. Als ich alle mir bekannten Fabelwesen ausgeschlossen hatte, war ich auf die Suche nach neuen gegangen. Ich studierte fremde Mythologien und altertümliche Dokumente. Alles ohne Erfolg, wie die zahlreichen roten Kreuze in den oberen Ecken der Seiten bewiesen.
Ich blätterte bis ganz nach hinten. Dort stand alles, was ich mehr oder weniger heimlich von oder durch meine Eltern erfahren hatte.
- Nicht zu lange in Chaoswirbel schauen!
- Meiden: Schlägereien, Unfälle, Überfälle, Duelle, Schlachtfelder, Friedhöfe, Krankenhäuser, Lazarette, Altenheime
- Das Chaos folgt uns, wenn wir uns zu erkennen geben. Nur zu Hause nicht. Warum? Wegen der Barrieren? Was ist das?
- Chaoswandler sind der Tod!!!
- Wir altern mit der Zeit immer langsamer.
- Sprachen liegen uns im Blut.
- Ich soll nicht öffentlich tanzen, weil wir nicht auffallen dürfen.
- Meine Eltern beeinflussen mich und meine Geschwister!
- Die Macht der Worte löst ekliges Gefühl aus. Meistens. Nachtrag: Manchmal mehr, manchmal weniger. Nachtrag 2: Manchmal gar nicht. Glaub ich. Beweis fehlt.
- Ich bin stärker als normale Jungs in meiner Klasse. Nachtrag: Und schneller.
- Keiner von uns war je krank. Wie das wohl ist?
- Wir sehen uns nicht ähnlich. Sind wir wirklich verwandt?
- Ich soll aufhören, Fragen zu stellen.
- Die Nebel werden schwächer, sagt mein Vater. (Sollte ich eigentlich vergessen.)
- Meine Eltern bekommen Botschaften. Vom wem? (Hab ich heimlich gesehen.)
- Die Rebellion ist schuld, sagt meine Mutter. (Sollte ich eigentlich vergessen.)
- Meine Eltern wollen nach Hause. Wo ist das? (Hab sie belauscht.)
Mit einem Seufzer nahm ich meinen Füller aus dem Koffer und schrieb darunter:
- Wir haben einen Gefangenen, der kein Wandler ist. (Sollte ich eigentlich vergessen.)
- Meine Eltern denken, er ist ›ein Krieger‹ (Hab sie belauscht.)
Ich überlegte gerade, ob ich noch etwas zu dem Mann im Krankenhaus schreiben sollte, als ich ein leises Rascheln hörte. Ich schaute auf und bekam einen halben Herzinfarkt, weil trotz abgesperrter Tür ein kleiner blonder Junge in meiner Zimmerecke stand.
»Moe!« Ich presste mir die Hand auf die Brust, um meinen rasenden Puls zu beruhigen. »Du kannst mich doch nicht so erschrecken.«
Mein kleiner Bruder hatte ein Talent dafür, sich lautlos zu bewegen. Dass er aber durch Wände gehen konnte, war mir neu. »Wie bist du hier reingekommen?«
Während er schuldbewusst auf seiner Unterlippe herumkaute, packte ich das Notizbuch wieder in den Koffer und schob ihn zurück unters Bett. Als ich fertig war, zögerte Moe noch immer mit seiner Antwort. Er klammerte sich an seinem Zeichenblock fest, der in seinen kleinen Händen ziemlich überdimensioniert aussah.
»Da ist wer«, piepste er so leise, dass ich es kaum hören konnte. Ich runzelte überrascht die Stirn. Normalerweise redete Moe nicht und wenn, dann nur weil ihm etwas sehr wichtig war. Jetzt wirkte er geradezu verstört. Und das wiederum beunruhigte mich. Ich ging zu ihm und hockte mich hin, damit wir auf einer Augenhöhe waren.
»Wo ist jemand?«, fragte ich und sah ihm dabei fest in seine riesigen moosgrünen Augen. Moe war das Sorgenkind meiner Eltern. Egal, in welcher Stadt wir lebten, sie schickten ihn regelmäßig zu einem neuen Psychologen, den sie selbstverständlich vorher manipuliert hatten. Sie verstanden nicht, dass mit ihrem jüngsten Sohn alles in bester Ordnung war. Er sprach einfach nur nicht gerne und sah die Welt mit anderen Augen als wir. Für Moe bestand das Leben aus Farben und Formen und nicht aus Worten. Das hieß aber nicht, dass sein Verstand zurückgeblieben war.
Moe deutete mit seinem Zeigefinger auf den Boden. Jetzt kapierte ich, was er mir sagen wollte.
»Du meinst den fremden Mann bei Mom und Dad im Keller?«
Er nickte und klammerte sich erneut an seinen Zeichenblock. Moe hatte ihn also auch gesehen. Kein Wunder, dass er so aufgelöst war. Veränderungen in seiner gewohnten Umgebung machten ihm immer schwer zu schaffen. Deswegen war auch jeder Umzug für ihn eine Tortur.
»Er jagt mir auch Angst ein«, versicherte ich ihm. »Aber er kann uns nichts tun.« Wie so oft hätte ich ihn gerne in den Arm genommen, doch ich wusste, dass Moe das nicht ausstehen konnte. Stattdessen versuchte ich, ihn mit seinen Zeichnungen abzulenken. Mein kleiner Bruder zeigte sie nicht jedem. Eigentlich nur mir. Ich wollte ihn gerade danach fragen, als mir auffiel, dass etwas an ihm fehlte.
»Wo ist deine Stiftebox?« Ohne seinen Block und die Box ging er nirgendwohin.
Moe kaute auf seiner Unterlippe herum. Dabei wirkte er fast schon verzweifelt.
»Er hat mich gesehen«, flüsterte er. Die Worte schienen nur widerwillig aus seinem Mund kommen zu wollen. »Da bin ich weggerannt.«
»Wer hat dich gesehen?«, fragte ich immer besorgter. »Der fremde Mann?«
Moe nickte und versetzte mich damit in Aufregung. Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass Moe die Ankunft des Fremden mitbekommen hatte. Mein kleiner Bruder saß oft still in einer Ecke, sodass man ihn nicht wahrnahm oder irgendwann vergaß. Aber der Gefangene hatte einen Sack über dem Kopf getragen. Der einzige Ort, an dem der Fremde meinen Bruder gesehen haben könnte, war … »Im Keller?«
Wieder ein Nicken. Oh mein Gott. Was hatte Moe im Keller zu suchen gehabt? Und vor allem, wie war er dort hinein- und wieder rausgekommen, ohne dass unsere Eltern ihn gesehen hatten?
Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
»Ist dein Fuchsbau da unten?«
So nannte Moe seinen Rückzugsort. Ein Versteck, das er sich in jedem neuen Zuhause suchte und einrichtete. Dort störte ihn niemand und er konnte in Ruhe zeichnen. Manchmal war es nur eine Abstellkammer, manchmal auch der Dachboden oder ein Kleiderschrank.
Ich spürte, wie mein Herz immer schneller schlug, als mein Bruder noch ein weiteres Mal nickte und sehr unglücklich dreinsah. Seine Not eröffnete mir eine perfekte Gelegenheit. Ich sollte mich eigentlich schlecht fühlen, aber im Moment konnte ich an nichts anderes denken, als an die Antworten, die dort unten im Keller auf mich warteten.
Ich lächelte Moe an und verkaufte es meinem Gewissen als eine Win-win-Situation.
»Soll ich dir deine Stifte holen? Du musst mir nur zeigen, wie ich in deinen Fuchsbau komme.«
Hinter Moes Brille – die er nicht brauchte, aber trotzdem liebte – erhellte sich sein kindliches Gesicht. Er packte meine Hand und zog mich zu meinem Wandschrank. Nein, er zog mich hinein. Zwischen meinen Klamotten und den Einkaufstüten wühlte er sich zur Rückwand, die wie der Rest des Einbauschrankes aus einer alten Holzvertäfelung bestand. Ich begann zu ahnen, worauf das hinauslief und wie mein Bruder sich in unserem neuen Haus fortbewegte. Diese Ahnung bestätigte sich, als Moe auf eine geschnitzte Rose drückte und ein Teil der Vertäfelung aufschwang.
Oh, wow. Das war gruselig. Extrem gruselig. Wäre meine Neugier nicht so überwältigend gewesen, hätten mich keine zehn Pferde in die dunkle Leere zerren können. Abgesehen davon wusste ich nicht, ob ich jemals wieder in meinem Zimmer schlafen wollte. Hatte ich schon erwähnt, dass das gruselig war?
Moe schlüpfte durch die enge Öffnung und trotz meiner mäßigen Körpergröße musste ich mich ducken, um ihm folgen zu können. Die Schatten rochen trocken und nach uraltem Staub. Ich richtete mich vorsichtig auf, aber das bereute ich sofort wieder, als ich mich in einem ganzen Teppich von Spinnweben verfing. Nur mit eiserner Beherrschung unterdrückte ich einen Schrei. Ich hasste Spinnen und die Vorstellung, wie viele davon sich hier im Dunkeln tummelten, war ekelerregend.
Moe zog mich weiter. Wenn ich meinem Orientierungssinn glauben durfte, befanden wir uns direkt hinter den Wänden des Flurs und des Treppenhauses. Durch die Fugen der Holzverkleidung fiel gerade genug Licht, um die kleine Silhouette meines Bruders nicht aus den Augen zu verlieren. Er bewegte sich völlig lautlos. Keine Ahnung, wie er das anstellte. Ich selbst hatte das Gefühl, bei jedem meiner Schritte ein Knarzen auszulösen.
Moe stoppte und ließ meine Hand los. Einen Augenblick später krabbelte er nach unten in einen senkrechten Schacht, der definitiv nicht für Menschen gemacht war. Ein alter Kamin? Ein Wäscheschacht? Oder ein ehemaliger Speiseaufzug? Ich biss die Zähne zusammen und kletterte Moe hinterher. Meine Finger trafen auf widerliches Zeug. Was genau sich alles an der Ziegelwand abgelagert hatte, wollte ich mir lieber nicht vorstellen. Zwei Stockwerke tiefer baumelten meine Füße plötzlich in der Luft. Panisch klammerte ich mich an ein paar herausstehenden Ziegeln fest. Der Schacht endete im Nichts.
»Leiter«, hörte ich Moe flüstern.
Eine Leiter? Ich tastete mit meinen Füßen durch den leeren Raum unter mir. Und tatsächlich, ich stieß auf etwas Hartes. Meine Güte! Das hatte mein kleiner Bruder alles allein ausgekundschaftet?!
Die hölzerne Klappleiter wackelte beunruhigend, aber ich schaffte es, daran herunterzuklettern. Jetzt stand ich in einem langen, schmalen Kellerraum. Hier unten war es kalt und roch modrig. Durch Glasbausteine knapp unter der Decke fiel etwas Licht herein. Ich sah Moe an, der stocksteif in die Dunkelheit am anderen Ende des Kellers schaute, ohne sich vom Fleck zu rühren.
»Ist es dort?«, erkundigte ich mich mit gedämpfter Stimme.
Moe reagierte nicht und starrte weiter in die Schatten. Ich kannte ihn gut genug, um zu erkennen, dass er Angst hatte.
»Weißt du was?«, sagte ich leise. »Ab hier finde ich mich schon zurecht. Wie wäre es, wenn du in meinem Zimmer auf mich wartest?«
Das musste ich meinem Bruder nicht zweimal sagen. Ich hatte ihn selten so erleichtert und dankbar erlebt. Flink wie ein Wiesel stieg er die Leiter hoch und verschwand in dem Ziegelschacht.
Für einen Moment spielte ich mit dem Gedanken, ihm zu folgen. Aber irgendwo dort in der Dunkelheit warteten vielleicht Antworten auf mich. Also schluckte ich meinen Widerwillen runter und marschierte los.
Es wurde immer finsterer. Ich streckte meine Hände vor mir aus, um nicht versehentlich gegen etwas zu stoßen. Irgendwann trafen sie auf rauen Stein. Eine Ecke. Langsam tastete ich mich an der Wand entlang weiter. Der schmale Raum bog noch zweimal ab, bevor ich Stimmen und seltsame Geräusche hörte. Dann sah ich ein gedämpftes Licht. Stein wurde wieder zu Holz. Aber diesmal nicht geschliffen und verziert. Es waren raue Bretter – schlampig zusammengezimmert, mit fingerbreiten Spalten dazwischen. Die Rückwand eines Weinregals. Im Glas der gelagerten Flaschen brach sich das warme Licht und tauchte den versteckten Gang in einen grüngoldenen Schimmer. Ein Kissen lag auf dem Boden und überall hingen Skizzen an den Wänden – von Landschaften, Menschen und Gegenständen. Mir stockte der Atem, als mir wieder einmal bewusst wurde, wie unglaublich viel Talent mein kleiner Bruder besaß. Das war also sein Fuchsbau. Kein Wunder, dass er hier gerne zeichnete. Abgesehen von dem vielen Staub war es echt gemütlich.
»Fangen wir noch mal von vorne an«, drang die Stimme meines Vaters zu mir. Ich zuckte zusammen, weil sie so sehr vor Abscheu triefte, dass ich seinen Hass beinahe körperlich spürte. »Und diesmal kannst du dir deine Arroganz sparen! Also: Wer hat dich geschickt?«
Ich lugte durch eine der Spalten und entdeckte den hellbraunen Haarschopf meines Vaters. Zumindest kurz, denn seine spärlich beleuchtete Gestalt tigerte gereizt umher und verschwand immer wieder aus meinem Sichtfeld. Er wirkte wütend. So wütend hatte ich ihn nur ein einziges Mal erlebt, als mein ältester Bruder Adam ihm gestanden hatte, dass er verliebt wäre und ausziehen wollte.
Ein weiches Lachen ließ die staubige Luft vibrieren. Es war ein Furcht einflößendes Geräusch. Tief, abgeklärt und alles andere als besorgt. Definitiv nicht das, was ich von einem Gefangenen erwartet hätte.
Möglichst leise versuchte ich, eine bessere Position zu finden. Ich musste wissen, wie der Mann aussah, zu dem dieses Lachen gehörte. Aber wie sehr ich mich auch verrenkte, ich bekam keine freie Sicht auf den Fremden. Weinfässer, Flaschen und selbst das spröde Holz der Regale, das mir diverse eingezogene Splitter bescherte, schienen sich gegen mich und meine Neugier verschworen zu haben. Ich konnte lediglich erkennen, dass der Gefangene kniete – mit dem Rücken zu mir. Seine Handgelenke hingen in schweren Ketten, die straff um zwei wuchtige Säulen gespannt waren. Ein bisschen fester und sie hätten ihm vermutlich die Arme aus den Gelenken gerissen.
Plötzlich keuchte der Gefangene auf und krümmte sich in seinen Fesseln. Ich presste mir entsetzt die Hand vor den Mund, als mein Vater immer und immer wieder zutrat. Es war nicht das erste Mal, dass ich ihn gewaltbereit erlebte. Schließlich hatte ich oft genug beobachtet, dass er meine Brüder beim Training nicht schonte. Aber das war anders. Es war brutal, grausam und nur darauf ausgelegt, möglichst viele Schmerzen zu bereiten. Nach einer Weile packte er seinen Gefangenen an dessen rotbraunen Haaren und zwang ihm den Kopf in den Nacken. Ich war zutiefst erschüttert von dem eisigen Triumph in seiner Stimme.
»Was glaubst du, wie lange du durchhältst?«
Da erklang wieder dieses unheimliche Lachen – diesmal schwächer und unterlegt von rasselndem Atem.
»Ich hatte ganz vergessen, wie wenig ich euch Goldkrieger leiden kann.«
Die Worte des Fremden ließen meinen Vater erstarren. Sein Gesicht verwandelte sich in eine zornige Fratze. Er schlug zu. So heftig, dass sein sonst so ordentlicher Scheitel durcheinandergeriet.
»Wer hat dich geschickt?«, schrie er, während seine Fäuste weiter auf den Fremden eindroschen. Blut spritzte auf sein helles Hemd. Ich musste die Augen schließen, weil ich den Anblick nicht ertrug. Wie konnte mein Vater nur derart die Kontrolle verlieren?
Zwischen zwei Schlägen schnitt plötzlich die Stimme des Fremden durch den Keller. »Verschwinde!«
Der Klang dieses einen Wortes kroch mit einer Gewalt unter meine Haut, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Das kriechende krabbelnde Gefühl war so übermächtig, dass ich mich am liebsten sofort auf dem Boden gewälzt hätte.
Nebenan wurde es ruhig.
»Verschwinde«, wiederholte der Fremde, »und komm erst wieder, wenn du bereit bist, mir zuzuhören!«
Zwischen den Holzlatten sah ich, wie mein Vater umdrehte und den Raum verließ. Die Erkenntnis traf mich wie Blitz und Donner gleichzeitig. Dieser Mann war wie wir. Und er benutzte die Macht der Worte mit einer Präzision, die mir mein Innerstes nach außen kehrte. Selbst ich musste gegen das Bedürfnis ankämpfen, seinem Befehl zu gehorchen – obwohl er eigentlich jemand anderem gegolten hatte.
Nun, da mein Vater fort war, legte sich eine beklemmende Stille über den Keller. Es war die Art von Stille, die nur das Alleinsein kreieren konnte. Dummerweise war der Fremde aber nicht allein. Auf einmal kam mir mein Atem unglaublich laut vor. Ich war hier der Eindringling und sollte eigentlich abhauen – so schnell es ging. Trotzdem konnte ich den Blick nicht von dem Mann abwenden, der die fleischgewordene Antwort auf all meine Fragen zu sein schien. Er hing reglos in seinen Ketten. Sein Kopf ruhte auf seiner Brust und nur das leichte Heben und Senken seines breiten Rückens verrieten, dass er am Leben war. Und dann stockte diese sanfte Bewegung für einen Moment. Er hob seinen Kopf, drehte ihn etwas, lauschte. Jetzt konnte ich einen kleinen Teil seines Gesichts sehen. Eine energisch geschwungene Braue, an der Blut klebte. Lange Wimpern an geschlossenen Augenlidern. Ein scharf geschnittener Kiefer und … ein halbes Lächeln.
»Ich weiß, dass du da bist«, sagte er leise. Unvermittelt öffnete er seine dunklen, fast schwarzen Augen. Darin funkelten goldene Flecken, als würden sie aus einem Stück glühender Kohle bestehen.
Das war nicht möglich! Ich befand mich im Schatten, verborgen hinter Fässern, Flaschen und Regalen. Und ich hatte keinen Laut von mir gegeben. Wie also konnte er mich sehen?! Oder bluffte er?
»Zeig dich!«, befahl er und wie von allein legten sich meine Hände an die Holzbretter, als würden sie das Regal umstoßen wollen. Ich spürte die Macht, die in seinen Worten lag, und fühlte das eklige Krabbeln unter meiner Haut. Nein, nein, nein …
Follow the silver lane through mist and moonlight …
Panisch klammerte ich mich an die Melodie, die mich so oft gerettet hatte, und gewann zumindest teilweise die Kontrolle zurück. Unter größter Anstrengung schaffte ich es, meine Hände in die Hosentaschen zu stecken. Ich sang in Gedanken tapfer weiter und bewerkstelligte es tatsächlich, einen Schritt rückwärts zu machen. Dummerweise trat ich auf das Kissen, verlor mein Gleichgewicht und fiel. Mein Kopf knallte gegen etwas und ein Scheppern verriet endgültig meine Anwesenheit. Es war Moes Stiftebox. Mit einem unterdrückten Fluchen schnappte ich sie mir und rannte.
POLIERTES MAHAGONI UND FEURIGE ABGRÜNDE
Das Abendessen wurde zur Qual. Moe malte neben seinem Teller. Er war überglücklich gewesen, als ich ihm seine Stifte zurückgebracht hatte. Annie saß neben ihm. Mit bester Laune quasselte sie ununterbrochen und löcherte Nick und Adam mit Fragen über die Jagd nach dem Chaoswandler. Mein Vater hatte sein Hemd gewechselt und tat, als wäre nichts gewesen. Allerdings wirkte er ungewöhnlich bleich und kraftlos.
Die darauffolgende Nacht war schlimmer als das Abendessen, denn ich brauchte Ewigkeiten, um einzuschlafen. Stundenlang starrte ich auf die Tür meines Wandschranks, die ich mit einem Stuhl verrammelt hatte. Ich redete mir ein, dass ich das nur getan hatte, damit nichts aus den gruseligen Geheimgängen in mein Zimmer kommen konnte, während ich schlief. Wenn ich aber ehrlich mit mir war, hörte ich noch immer die Stimme des Fremden in meinem Kopf, der mir befahl, mich zu zeigen.
Irgendwann klingelte mein Wecker und ich stellte fest, dass ich tatsächlich geschlafen hatte. Ich fühlte mich nur nicht danach. Wie so oft verfluchte ich unser obligatorisches sonntägliches Familienfrühstück. Wer wollte am Wochenende schon um halb neun aufstehen?!
Überraschenderweise traf ich nicht meine Eltern in der Küche, sondern Adam, der gerade Eier für Omeletts aufschlug. Wie üblich war er von einer melancholischen Wolke umgeben, die ihm die Ausstrahlung eines tragischen Helden verlieh. Er hatte noch nie wirklich zur fröhlichen Sorte Jungs gehört, aber seit er das Mädchen zurücklassen musste, in das er verliebt war, schien er unablässig zu leiden. Dieser Zustand hatte sich auch in den letzten sieben Jahren nicht geändert.
»Morgen, Maia«, begrüßte er mich stoisch.
»Guten Morgen«, trällerte Jenny, die beschwingt den Tisch deckte. Offenbar war sie in aller Frühe von ihrer ›Freundin‹ zurückgekehrt.
»Guten Morgen, Jen.« Ich holte das Besteck aus der Schublade und begann ihr zu helfen. »Na, wie war euer Mädelsabend?«
Meine Schwester rammte mir ihren Ellbogen in die Rippen, was ich mit einem Grinsen quittierte. Jenny war einfach zu selbstverliebt, als dass es keinen Spaß gemacht hätte, sie ab und an aufzuziehen. Sie entsprach dem typisch blonden Klischee-Mädchen, stand auf Pastelltöne, Lockenstäbe, Hautcremes und Perlenohrringe. Alles nicht wirklich mein Ding. Vielleicht verstanden wir uns deshalb nur sehr selten. Meistens dann, wenn es darum ging, das Alibi für den jeweils anderen zu sein.
»Es war lustig«, verkündete Jenny laut, während sie eine warnende Grimasse schnitt. »Wir haben ein paar Filme geschaut und Pizza und Popcorn gegessen.«
»Spart euch euer kleines Schauspiel für jemanden, der darauf reinfällt.« Adam klang genervt. Es wunderte mich wenig, dass er über Jennys amouröse Abenteuer Bescheid wusste. Als ältester Bruder hielt er es für seine Aufgabe, uns alle im Auge zu behalten.
»Nur, weil du dir keinen Spaß gönnst, heißt das ja noch lange nicht, dass ich wie eine Nonne leben muss«, fauchte Jenny ihn an.
»Wer muss hier wie eine Nonne leben?«, erkundigte sich Nick, der ahnungslos in die Küche geschlendert kam.
Jenny stöhnte auf. »Das geht dich überhaupt nichts an!«
Mit seinem so typischen WTF-Blick hob Nick abwehrend die Hände und entschied sich, nicht weiter nachzufragen. Kurz darauf kamen Annie und Moe hereingestürmt. Sie waren in eine hitzige Diskussion über die Mona Lisa vertieft, was bei den beiden bedeutete, dass Annie redete und Moe versuchte zu entkommen.
»Ich würde auch ganz still dasitzen!«, beteuerte meine kleine Schwester. »Biiiiitte!«
Moe verdrehte die Augen. Er zog sich auf einen der Küchenstühle und setzte sein neustes Werk fort. Ich runzelte überrascht die Stirn. Es war eine Kohlezeichnung von mir.
»Maiaaa, sag ihm, er soll mich auch mal malen!«, quengelte Annie. »Ich hab sogar geübt, zu lächeln wie die Mona Lisa.«
Adam stellte lautstark einen Teller mit Omeletts in die Mitte des Tischs. »Hör auf, ihn zu nerven, Annie. Moe kann selbst entscheiden, wen er zeichnet und wen nicht.«
Wow, heute war Adam sogar noch schlechter drauf als sonst.
Wir setzten uns alle und dann … sahen wir uns ratlos an. Unsere Eltern waren noch nie zu spät zum Sonntagsfrühstück erschienen.
»Haben Mom und Dad verschlafen?«, fragte Annie in die Runde.
Nick zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Der Kampf gegen den Chaoswandler war ziemlich anstrengend. Vielleicht –«
»Ihr habt gegen einen Chaoswandler gekämpft?!«, fiel ihm Jenny ins Wort.
»Was denkst du denn, warum Mutter wollte, dass du heimkommst«, knurrte Adam sie an. »Fangt an zu essen. Sie werden schon noch kommen.«
Tja, unser Ersatz-Papa hatte gesprochen und da niemandem etwas Besseres einfiel, taten wir, was er gesagt hatte.
Während sich die anderen an Toast, Omeletts und in Moes Fall an Cornflakes bedienten, fragte ich mich, ob es an dem Gefangenen lag, dass unsere Eltern noch nicht hier waren. Für einen Augenblick war ich versucht, meine Geschwister einzuweihen. Sie hatten ein Recht darauf zu erfahren, was für eine Gefahr in unserem Keller lauerte. Aber dann hörte ich Nick über einen Witz von Annie lachen. Ich sah, wie Jenny heimlich ihren Teller ein Stück zur Seite schob, damit Moe mehr Platz zum Zeichnen hatte. Und Adam drängte mir einen Extra-Toast auf, weil ihm aufgefallen war, dass ich seit Zoeys Krankheit weniger aß. Nur ihm.
So unterschiedlich wir sechs auch waren, wir gehörten zusammen. Und solange ich nichts Konkretes wusste, würde ich diesen Zusammenhalt nicht auf die Probe stellen.
»WAS hat dieser Junge aus deiner Klasse gesagt?!«
Nicks aufgebrachter Tonfall ließ mich aufschauen. Er fixierte Annie mit einem strengen Blick.
»Bitte mach keine große Sache draus«, flehte unsere kleine Schwester und zog eine Schnute, die selbst das Herz des grimmigsten Verbrechers zum Schmelzen gebracht hätte. »Es ist doch schon vielen aufgefallen, dass wir uns nicht ähnlich sehen.«
»Trotzdem darf niemand unsere Mutter als Flittchen bezeichnen«, polterte Nick.
Ich seufzte. Das war ein Thema, das an jedem neuen Wohnort aufkam: Keiner aus der Außenwelt wollte glauben, dass wir verwandt waren. Zugegeben, der blond gelockte Moe mit seinen Pausbacken hatte nicht viel gemeinsam mit der spindeldürren Annie und ihrer quirligen Art. Jenny erinnerte an eine modelgleiche Barbie, während Nick mit seiner sonnengebräunten Haut und dem schwarz glänzenden Haarschopf eher einem Latino glich. Er war zwar muskelbepackt, dafür aber nicht groß – ganz anders als Adam, unser schlaksiger Riese mit den traurigen Augen und den kurzen hellbraunen Haaren. Und dann gab es da natürlich noch mich, die Porzellan-Puppe mit dem dunklen Locken- Wischmopp auf dem Kopf.
Wir ähnelten uns wirklich kein bisschen – weder untereinander noch unseren Eltern. Und doch wollte keiner von uns diesem Rätsel auf die Spur gehen. Eine Tatsache, die wir vermutlich einer weiteren Manipulation unserer Eltern zu verdanken hatten.
Ein vertrautes Quietschen lenkte die gesammelte Aufmerksamkeit zur offenen Küchentür. Dahinter lag das Wohnzimmer und dort tauchte unser Vater auf. Er trug einen leblosen Körper.
»Mom!«, schrie Annie ängstlich und wollte aufspringen. Aber unser Vater stoppte sie, stoppte uns alle.
»Bleibt sitzen und beachtet uns gar nicht!«
Ich plumpste zurück auf meinen Stuhl.
Follow the silver lane …
Während meine Geschwister wieder in die alte Diskussion fielen, konzentrierte ich mich darauf, dem Befehl meines Vaters zu widerstehen. Da ich mich nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren konnte, nahm ich das Sitzenbleiben in Kauf und bemühte mich, das Gesehene nicht zu vergessen. Überraschenderweise fiel es mir diesmal nicht sonderlich schwer, mich gegen die Manipulation zu wehren.
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, wie mein Vater meine Mutter auf das Sofa im Wohnzimmer legte. Er wirkte besorgt und flößte ihr irgendeine Flüssigkeit aus einem hellen Fläschchen ein. Daraufhin wachte sie sofort auf, schrie und wand sich, als wäre sie vergiftet worden. Mein Vater brauchte seine ganze Kraft, um sie auf den Polstern zu halten. Es war bizarr. Ein dramatischer Thriller im Wohnzimmer und hier in der Küche: Happy Family. Keiner reagierte auf das Geschrei meiner Mutter. Es kam mir vor, als würde ich in zwei verschiedenen Realitäten gleichzeitig leben.
Und es wurde nicht besser. Nicht nach dem Frühstück und auch nicht den Rest der Woche. Meine Mutter hatte sich an jenem Morgen schnell wieder erholt, aber von nun an ging jeden Tag das Schauspiel von vorne los. Meine Eltern kamen irgendwann aus dem Keller – voller Blutspritzer. Entweder war einer der beiden bewusstlos oder stand komplett neben sich. Dann gab es einen Schluck aus dem hellen Fläschchen. Derjenige drehte durch und keiner außer mir bekam den Wahnsinn mit. Wegen der akuten Gefahr durften wir noch nicht einmal in die Schule gehen. Meine Mutter hatte uns offiziell befreit. Ein angeblicher familiärer Notfall. Das führte dazu, dass mir irgendwann die Decke auf den Kopf fiel. Besonders weil Moe mein Zimmer übergangsweise zu seinem neuen Fuchsbau bestimmt hatte und tagsüber bei mir malte. Deshalb zog ich mich immer öfter auf den Dachboden zurück. Ich musste den Kopf freikriegen, und das konnte ich nur beim Tanzen. Dort auf dem Speicher befand sich der wichtigste Raum für unsere Familie. Nach jedem Umzug machten es sich Nick und Adam zu ihrer persönlichen Aufgabe, ihn einzurichten. Meistens war er noch vor unserem Wohnzimmer nutzbar: Unsere private kleine Sporthalle. Hier gab es einen Boxring für meine Brüder, Yogamatten für Jenny und natürlich Annies Trampolin. An den Wänden standen Waffenschränke, daneben hingen Zielscheiben und in der hintersten Ecke warteten Dummys auf ihren Einsatz im Kampftraining.
Letzteres war etwas, auf das meine Eltern schon früh bei uns allen bestanden hatten: Wir sollten uns im Ernstfall zumindest ansatzweise selbst verteidigen können. Ein notwendiges Übel, das ich durchaus einsah, auch wenn ich es nicht mochte.