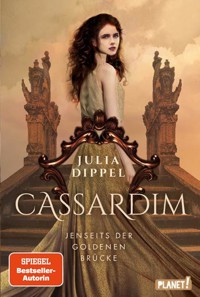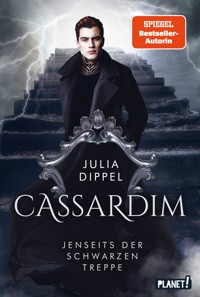13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der dritte und finale Band der Trilogie von Fantasy-Queen Julia Dippel
Der Kaiser ist tot, doch Amaias Status als Goldene Erbin ist nach wie vor umstritten. Sie steht zwischen der Tradition und einer Revolution – größer, als Cassardim sie je gesehen hat. Noár ist bemüht, sie aus der Schusslinie zu halten, aber Amaia verfolgt eigene Pläne. Sie muss das wachsende Chaos aufhalten, das von ihrem frisch vermählten Ehemann Besitz ergreift. Um ihn, Cassardim und die Menschenwelt zu retten, versammelt sie auf eigene Faust die Erben aller Reiche um sich und begibt sich mit ihnen auf die gefährliche Suche nach einem neuen Juwel der Macht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, an dessen Ende sie nicht nur ihre große Liebe verlieren könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Was in Cassardim verloren geht, bleibt auch verloren. Doch wenn sich ein Sturm erhebt und das Trockene Meer mit sich reißt, wenn der Wandernde Wald verdorrt, schwebende Berge fallen, die Tanzenden Nebel schwinden und wenn ganze Städte in Chaos-Fluten versinken, dann ist nur noch das Herz stärker als der Wille und man findet vielleicht wieder, was einst verloren schien.
www.cassardim.de
Die Autorin
© http://perkins.photo
Julia Dippel wurde 1984 in München geboren und arbeitet als freischaffende Regisseurin für Theater und Musiktheater. Um den Zauber des Geschichtenerzählens auch den nächsten Generationen näherzubringen, gibt sie außerdem seit über zehn Jahren Kindern und Jugendlichen Unterricht in dramatischem Gestalten. Ihre Textfassungen, Überarbeitungen und eigenen Stücke kamen bereits mehrfach zur Aufführung.
www.instagram.com/julia_dippel_autorin
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer*in erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autor*innen und Illustrator*innen:www.planet-verlag.de
Planet! auf Facebook:www.facebook.com/thienemann.esslinger
Planet! auf Instagram:www.instagram.com/thienemann_esslinger_verlag/
Viel Spaß beim Lesen!
INS GEDÄCHTNIS GERUFEN
Während ihrer Verlobungszeit am Schattenhof hat Amaia neben Noárs skrupellosem Vater Shaell auch mit den Intrigen der Schattenfürstin Zima, mit Attentaten, dem wachsenden Chaos und einem unheimlichen Kapuzenmann zu kämpfen, der sie verfolgt. Zu allem Überfluss unterstellt man ihr noch immer, nicht Kaiser Katairs Tochter und damit auch nicht die wahre Goldene Erbin zu sein.
Nur ihre Liebe zum Schattenprinzen ist ein Lichtblick in diesen finsteren Zeiten. Zumindest, bis der ehemalige Seneschall Lazar ihr offenbart, dass Noár in der Nacht der Rebellion das Chaos in den Goldenen Berg gebracht hat und somit mitverantwortlich für Amaias Zeit als Geisel in der Menschenwelt ist.
Nun zweifelt Amaia, ob sie Noár noch immer heiraten will. Doch Kaiser Katair erzwingt eine öffentliche Hochzeit, um sie als Betrügerin bloßzustellen. Dazu präsentiert er seine vom Chaos besessene Ehefrau in einem Käfig. Kaiserin Moya gibt tatsächlich zu, dass Amaia nicht ihre Tochter sei, nur bleibt ihre Glaubwürdigkeit umstritten.
Der tot geglaubte Chaoskaiser Fidrin, der sich zwischenzeitlich im Körper des Waldprinzen Tincos versteckt hat, nutzt die aufgeheizte Stimmung, um die Macht an sich zu reißen. Eine Schlacht zwischen Cassarden und Chaoswandlern bricht aus, die Amaia nur zu ihren Gunsten wenden kann, indem sie sich selbst Zugang zum Chaos verschafft. Zu diesem Zweck lässt Noár sich absichtlich mit einem Chaos-Pfeil verwunden. Schließlich besiegen sie Fidrin.
Amaia wird zu ihrer Sicherheit von dem unheimlichen Kapuzenmann, der sich inzwischen als der Faheen-Fürst Ilion herausgestellt hat, in ein entlegenes Fort gebracht. Dort entscheidet sie sich, Noár zu verzeihen, und ihre Geisterfreundin Zoey richtet eine kleine private Hochzeit aus – als letzte Amtshandlung, bevor sie in die Menschenwelt zurückkehrt.
Glücklich verheiratet feiert Amaia mit ihren Freunden und Geschwistern, als sie plötzlich in Noárs Augen wirbelnde Chaos-Abgründe wahrnimmt.
HONEYMOON IM CHAOS
Unsere Schwerter schlugen so hart gegeneinander, dass Funken sprühten. Gerade als ich von dem Baumstumpf springen wollte, auf dem wir geheiratet hatten, packte Noár mein Handgelenk und machte damit jede Aussicht auf rettenden Abstand zunichte. Gar nicht gut. Jetzt konnte er seine Kraft und Größe gnadenlos ausnutzen, um mich in die Knie zu zwingen.
»Gib auf!«, forderte er mit einem gefährlichen Lächeln. Sein Befehl kroch mir unter die Haut. Der Wille des Schattenprinzen war so stark, dass alles in mir danach schrie, mich diesem zu beugen. Aber ich war nicht irgendwer. Ich ließ mich nicht so einfach manipulieren. Ich war die Goldene Erbin, die Bezwingerin des Chaoskaisers und … seit Neuestem auch die Ehefrau dieses leider viel zu attraktiven Sammelsuriums aus schweißnassen Muskeln, samtiger Stimme und funkelnden Augen voll sinnlicher Versprechen.
»Hättest du wohl gern«, keuchte ich. Noárs Befehl aus meinem Bewusstsein zu verdrängen, kostete mich mindestens genauso viel Konzentration, wie meine Beine anzuweisen, auf keinen Fall unter mir nachzugeben. Glücklicherweise reagierte mein Körper wie von allein und folgte den Abläufen, die mich Rhome immer und immer wieder hatte trainieren lassen: Schritt zur Seite, Gewicht verlagern, drehen, zuschlagen.
Meine Faust traf den Schattenprinzen unterhalb der Rippen. Ich verstärkte die Wucht des Schlags durch meinen Willen, sodass Noár sich eigentlich vor Schmerzen hätte krümmen und den Griff um mein Handgelenk hätte lockern müssen, doch er grinste nur. Unvermittelt wirbelte er mich herum, ein Manöver, das ich weder kannte noch nachvollziehen konnte. Ich krachte mit dem Rücken gegen seine Brust und war prompt in stahlharten Armen gefangen. Noárs Klinge lag an meiner Kehle, während mein Schwert am Baumstumpf abprallte und mit einem Scheppern auf dem Geröllboden landete – weit außerhalb meiner Reichweite. Verdammt.
»Das war gut«, raunte er. »Du wirst jeden Tag besser.«
Ich schnaubte. »Wäre das ein echter Kampf, wäre ich jetzt tot. So gut kann ich also nicht gewesen sein.«
Obwohl ich meinen Widerstand aufgab, ließ Noár mich nicht los. Sein warmer Atem strich mir über den Hals. Dann spürte ich seine Lippen an meinem Ohr.
»Sei nicht so streng mit dir.« Die sanften Worte brachten meinen Frust mühelos zum Schmelzen. »Immerhin hast du dir einen Gegner gewählt, mit dem es niemand in Cassardim aufnehmen kann.«
Unwillkürlich erschauerte mein ganzer Körper. Ich ignorierte es und rollte mit den Augen. »Schon mal versucht, gegen dein Ego anzutreten?«, erkundigte ich mich trocken. »Da hättest du nicht die geringste Chance.«
Der Schattenprinz lachte leise. Die Umklammerung, die mich zuvor noch bewegungsunfähig gemacht hatte, fühlte sich nun gar nicht mehr nach der eines Gegners an. Ganz im Gegenteil.
»Ich kenne da jemanden, dem nicht einmal mein Ego gewachsen wäre«, offenbarte er mir amüsiert, während er mich zu sich drehte. Seine Sternenaugen musterten mich so intensiv, dass mir trotz des kühlen Winds und meiner verschwitzten Kleidung heiß wurde. Schien, als wäre das Training nun offiziell beendet.
»Würden wir beide uns in einem echten Kampf gegenüberstehen, läge mein Leben in deinen Händen«, fuhr er fort und drückte mich fest an seine kräftige Brust. »Ich wäre dir hilflos ausgeliefert, weil ich dir niemals etwas antun könnte.«
Oh Mann, wenn er mich so hielt wie jetzt und derartige Sachen sagte, beschränkten sich meine Gedanken und Gefühle auf ein einziges primitives Wort: meins.
»Dann«, flüsterte ich, »war es ein taktisch sehr kluger Schachzug von dir, mich zu heiraten.«
»Oh ja, das war es, Kätzchen.« Noár grinste, aber in seinem Ton schwang großer Ernst mit. Er beugte sich zu mir. »Die klügste Entscheidung meines Lebens.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, verschloss er meinen Mund mit seinem und stahl der Welt um uns herum jede Bedeutung. Noár schaffte mit einem einzigen Kuss etwas, was sonst nichts und niemand vermochte. Er brachte all meine Sorgen und die unaufhörlich kreisenden Gedanken zum Verstummen. Für ein paar Augenblicke herrschte Ruhe in meinem Kopf. Für ein paar Augenblicke waren weder Cassardims lädierte Barrieren noch der mögliche Bürgerkrieg oder die nahende Chaos-Apokalypse von Belang. Für ein paar Augenblicke gab es nur Noár und mich und das überwältigende Gefühl, das uns verband. Ich versuchte, mich an diesem Moment festzuklammern, denn ich wusste, was unweigerlich folgen würde, wenn mein Kopf wieder die Kontrolle übernahm. Angst. Angst, diesen Mann, dem mein Herz gehörte – meinen Mann –, zu verlieren. Die Liebe zu Noár erfüllte mich auf eine so gewaltige und übermächtige Weise, dass ich nicht wusste, was mit meinem Verstand geschehen würde, sollte er irgendwann nicht mehr an meiner Seite sein.
Dieses beklemmende Gefühl begleitete mich seit der Nacht unserer Hochzeit, als sich die Augen meines Bräutigams für den Bruchteil einer Sekunde in wirbelnde Chaos-Abgründe verwandelt hatten. Ich wusste nicht einmal, ob es wirklich real gewesen war. In dieser Nacht war so vieles ungefiltert auf mich eingeprasselt: meine Sorgen, meine Anspannung, meine Müdigkeit, meine Emotionen. Gut möglich, dass ich mich getäuscht hatte, immerhin war einen Wimpernschlag später alles wieder normal gewesen. Auch danach hatte Noár keinerlei Anzeichen einer Chaos-Infektion gezeigt. Und trotzdem hörte diese kleine Stimme in mir nicht auf, mich zu foltern. Sie nannte mich naiv, unterstellte mir eine rosarote Honeymoon-Brille und forderte mich immer wieder auf, irgendetwas zu unternehmen. Mit Noár reden zum Beispiel. Aber ich schaffte es einfach nicht. Die Angst zuzulassen, sie in Worte zu fassen, würde sie real werden lassen. Fragen würden nur zu weiteren Fragen führen, deren Antworten ich vielleicht nicht verkraften konnte. War mein Schweigen ein Fehler? Wahrscheinlich. Versteckte ich mich hinter Ausreden? Ganz bestimmt. Doch noch mehr Probleme, noch mehr Gefahren konnte ich nicht ertragen. Nicht, wo Noárs Liebe das Einzige war, das mich funktionieren und die Hoffnung nicht aufgeben ließ. Also stopfte ich der lästigen Stimme in meinem Kopf den Mund und versuchte, nicht ständig auf die kleinste Reaktion der Splitter in meinen Handflächen zu warten. Eine unangenehme Hitze, ein kriechendes Kribbeln unter der Haut, brennende Schmerzen, fauliger Geruch …
Und dann spürte ich es: Die unangenehme Hitze, das kriechende Kribbeln unter der Haut, brennende Schmerzen und der faulige Geruch – all das stürzte in genau diesem Moment auf mich ein und schien meinen schlimmsten Albtraum wahr zu machen.
Ich packte Noárs Kopf und unterbrach unseren Kuss so abrupt, dass er mich verwirrt ansah. Das durfte nicht sein. Bitte nicht.
»Alles in Ordnung?«, fragte er mich alarmiert, doch ich konnte ihn nur wie gelähmt anstarren.
Nichts. Absolut nichts. Seine Augen waren völlig normal. Panisch presste ich die Splitter fester auf seine Wangen. Ich musste sichergehen, durfte nichts riskieren. Aber der Hautkontakt verschlimmerte weder meine Schmerzen noch die Fäulnis, die sich wie ein dichter Pelz auf meine Zunge legte. Noár war nicht die Ursache. Es ging ihm gut. Oder?
»Kätzchen!« Ich wurde geschüttelt. »Sprich mit mir!«
Das riss mich aus meinem Schock.
»Cha-os«, krächzte ich.
Dann geschah alles gleichzeitig. Mitten im Hain spaltete sich der Felsboden. Schwarzer Rauch voller grüner und violetter Blitze schoss aus dem Abgrund empor und teilte sich in unzählige Tentakel. Noár stieß mich zur Seite. Noch in derselben Bewegung schnitt sein Schwert durch die wabernde Masse, die nach mir hatte greifen wollen. Ich verlor das Gleichgewicht, fiel vom Baumstumpf und landete unsanft auf den Knien. Ein knorriger Baum mit tief hängenden Ästen nahm mir die Sicht auf den angreifenden Wirbel, aber das gierige Kreischen und das Flattern ledriger Flügel, das von den Felswänden widerhallte, verhießen nichts Gutes. Chokaal. Chaoshunde. Binnen Sekunden verwandelte sich der gesamte Hain in ein wirres Durcheinander. Wirbelnde Rauch-Tentakel, Klauen, Zähne – und mittendrin der Schattenprinz und seine Klinge, vereint in einem tödlichen Tanz.
Kalte Wut sammelte sich in meinem Bauch. Das Chaos hatte in den letzten Wochen immer wieder die Barrieren durchbrochen und uns attackiert, aber das hier nahm ich persönlich. Dieser Hain gehörte mir.
Mein Blick fiel auf das Schwert, mit dem ich trainiert hatte. Es lag neben einem Schatten-Farn, nur ein paar Schritte von mir entfernt. Ich sprintete gerade los, als der Hain sich weiter verdunkelte. Diesmal war jedoch nicht das Chaos schuld, sondern die mächtigen Schwingen eines Shendai. Nox pflückte jeden Chokaal aus der Luft, der dumm genug war, den schützenden Felsüberhang zu verlassen.
»Schließ den Wirbel!«, wies Noár mich an.
Ich nickte und schnappte mir mein Schwert. Der Schattenprinz und sein Shendai waren ein unschlagbares Team. Sie würden dafür sorgen, dass keiner der Chaoshunde entkommen und in Cassardim sein Unwesen treiben konnte. Ich dagegen hatte ein gewisses Talent entwickelt, die Barrieren zu flicken. Und solange ich die Juwelensplitter in meinen Händen nutzte, mieden mich Chaoskreaturen wie die Pest.
Gutes Stichwort, die Splitter …
»Über dir!«, hörte ich Noárs Warnung. Sofort riss ich die Klinge hoch und traf einen massigen Körper. Scharfe Klauen verfehlten mein Gesicht nur um Zentimeter. Unglücklicherweise galt dasselbe nicht für das widerlich stinkende schwarze Blut des Chaoshundes, das auf meiner Haut wie Feuer brannte. Oh, wie ich dieses Zeug hasste! Ich sprang zur Seite und überließ es der Schwerkraft, meinen angeschlagenen Gegner zu Fall zu bringen. Der Chaoshund krachte flügelschlagend in die Kaiserweide, zerschmetterte deren Stamm und landete rücklings auf dem uralten Baumstumpf, auf dem Noár und ich bis eben noch trainiert hatten.
Das war mein Lieblingsort gewesen!
Jetzt wurde ich wirklich sauer.
»Zurück!«, befahl ich den wabernden Tentakeln, die nach mir greifen wollten. Die Macht der Juwelensplitter verband sich mit meinem Willen. Meine Handflächen begannen zu leuchten und das Licht verdrängte das Chaos. Zumindest so weit, dass ich den Abgrund sehen konnte, aus dem der dunkle Rauch quoll. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Etwas hielt das verfluchte Ding offen. Menschliche Gestalten, die ohne Rücksicht aufeinander aus den Tiefen emporkletterten. Chaoswandler. Sie trugen goldene Rüstungen, Umhänge der Waldkrieger oder zivile Kleidung. Es waren die Opfer vom Goldenen Berg, die nicht das Glück gehabt hatten, zu sterben. Noch behinderten sie sich gegenseitig, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten es aus dem Abgrund herausschaffen würden. Verdammt! Aus einem nervigen Zwischenfall war soeben eine echte Bedrohung geworden.
»Bleibt, wo ihr seid! Ihr gehört nicht hierher!«, rief ich so laut ich konnte. Mein Wille stoppte die drohende Zombie-Invasion vorübergehend. Aber Chaoswandler waren sehr viel gefährlicher als jede noch so monströse Chimäre. Sie behielten trotz ihrer Besessenheit ihre Intelligenz und kannten die Stärken und Schwächen ihrer Gegner. Deshalb änderten sie jetzt auch ihre Jeder-für-sich-Strategie und begannen zusammenzuarbeiten. Sie wussten, dass ich nur eine gewisse Anzahl von ihnen würde zurückhalten können. Jeder neue Chaoswandler, der aus dem Wirbel kroch, machte es mir schwerer, auch die übrigen in Schach zu halten.
Panisch warf ich das Schwert beiseite und streckte ihnen meine glühenden Handflächen entgegen.
»Zurück, hab ich gesagt!«
Unvermittelt sirrten Pfeile durch den Hain. Wieder regnete schwarzes Blut auf mich herab. Rhome und die anderen kamen als Verstärkung. Gut, jetzt musste ich mich wenigstens nicht mehr um Angriffe aus der Luft sorgen. Blieb nur noch das Problem, wie ich den Wirbel schließen sollte, solange die Chaoswandler meine ganze Aufmerksamkeit forderten. Ich würde Hilfe brauchen.
»Okay, Trudi«, flüsterte ich und nutzte meinen Verlobungsring, um Kontakt zum Schattenreich herzustellen. »Wie wäre es mit ein bisschen Teamwork?«
Die Antwort kam prompt. Trudi schickte mir ein Bild von der schwarzen Treppe und kappte dann die Verbindung. Ich seufzte. Das Schattenreich war immer noch angefressen, weil ich mir damals den Zutritt erzwungen hatte. Vielleicht gefiel es diesem eingeschnappten Stück Felsbrocken auch nicht, dass ich es Trudi nannte. Aber was sollte ich tun? Gertrud war einfach der perfekte Name für diese nicht ganz unkomplizierte, strenge Lady.
»Trudi!«, sagte ich warnend. »Wir stehen auf derselben Seite. Ich habe deinen Kronprinzen geheiratet und werde nicht zulassen, dass er in noch größere Gefahr gerät, nur weil du dich wie eine übersensible Mimose benimmst. Ich würde ihn ja bitten, auf deine Befindlichkeiten einzugehen, aber er ist im Moment BESCHÄFTIGT.«
Ein Bild drängte sich in mein Bewusstsein. Das Schattenreich zeigte mir einen Erinnerungsfetzen des jungen Rhome, der die Arme vor der Brust verschränkt hatte und meinte: »Noár kann auf sich selbst aufpassen.«
»Ja, aber du offenbar nicht auf dich«, zischte ich. Meine Geduld kam an ihre Grenzen. »Ich sehe doch, dass dir das Chaos Schmerzen bereitet und du schon jetzt dein Bestes gibst, um es zurückzudrängen. Die schwindenden Barrieren schwächen auch dich. Dir geht die Kraft aus. Also lass mich dir helfen!« Und weil ich wusste, dass die Zeit knapp wurde, setzte ich ein Wort hinterher, dessen Benutzung ich mir eigentlich mühsam abgewöhnt hatte: »Bitte!«
Als hätte ich die gleichermaßen stolze wie sture Trudi mit diesem einen Wort der Demut erlöst, begann der Boden zu beben. Schatten fluteten meine Gedanken und gewährten mir eine ungehinderte Verbindung. Ich spürte, wie das Reich litt, aber ich nahm auch die ungeheure Stärke wahr, die darin steckte. Und genau darüber hatte ich nun die volle Kontrolle. Gerade rechtzeitig, denn im selben Moment verlor ich meinen Einfluss auf die Chaoswandler. Mit Augen voll wirbelnder Schwärze stürmten sie auf mich zu. Irgendjemand brüllte meinen Namen. Überflüssig. Ich war nicht in Gefahr. Ich war das Schattenreich. Die Splitter in meinen Händen begannen heller und heller zu strahlen. Ich fühlte das Gestein, die Pflanzen, die Tiere, die Luft und selbst Noár und seine Krieger. Bevor der erste Chaoswandler mich erreichen konnte, befahl ich dem Boden, unter ihnen nachzugeben. Sie torkelten, fielen, versuchten Halt zu finden, aber das Schattenreich gewährte keine Gnade. Der immer größer werdende Spalt verschluckte einen nach dem anderen. Als der Letzte von ihnen in der Dunkelheit verschwunden war, wies ich die Felsen an, sich wieder zu schließen. Gleichzeitig brach ich riesige Steinbrocken aus den Steilwänden und ließ sie von oben auf den Abgrund fallen. Sie begruben den Chaoswirbel unter sich und ebenso alle Kreaturen, die sich aus den Tiefen hatten erheben wollen.
Ich hatte es geschafft.
»Wir!«, korrigierte mich das Bild eines ziemlich gruseligen Mädchens, das sich in meine Gedanken drängte.
»Ja, wir …«, gab ich dem Schattenreich recht. Ich hatte keine Kraft mehr, mich mit Trudi zu streiten, denn eine unendliche Müdigkeit ergriff von mir Besitz – wie immer, wenn ich die Splitter so intensiv nutzte. Allerdings war der Angriff noch nicht vorbei und meine Arbeit nicht getan. Nicht, solange meine Freunde von Chokaal attackiert wurden.
»Dann zeig mal, was du sonst so draufhast«, forderte ich Trudi auf und überließ ihr die Führung. Keinen Atemzug später wurde der Hain lebendig. Bäume wuchsen und spießten Chaoshunde mitten im Flug auf. Nachtranken schnappten nach Klauen, Flügeln und Kehlen, während die Schattenfeste den Eindringlingen mit erstaunlich gezielten Steinschlägen den Garaus machte. Doch auch als der letzte Chokaal gefallen war, hörte Trudi nicht auf. Sie nutzte die Macht der Juwelensplitter, um weitere Chaoswirbel überall im Schattenreich zu schließen – kleine, große, nahe, ferne …
Mir wurde schwindlig. Zu viel. Es war zu viel. Das Juwel der Macht zehrte immer auch an der Lebenskraft seines Trägers. Bei den zersplitterten Überresten in meinen Händen war es nicht anders.
»Amaia!«
Trudi würde ohne Rücksicht weitermachen, bis ich tot wäre.
»Amaia!«
Ich sollte es beenden … konnte es nicht mehr … ich …
Eine schallende Ohrfeige traf mich und durchbrach meine Verbindung zum Schattenreich. Als ich die Augen aufschlug, lag ich auf dem Boden. Über mir schwebte ein Gesicht, das ich kannte. Aber es war nicht das, das ich mir wünschte. Keine Augen voller Sterne, keine Haare wie glänzendes Mahagoni, sondern Augen so grau wie ein Regentag und Locken dunkel wie Kohle. Ilion. Der junge Fürst der Faheen.
Mit einem schiefen Grinsen schüttelte er den Kopf. »Sein Leben in die Hände eines anderen zu legen, ist nie eine gute Idee. Besonders dann nicht, wenn der andere überhaupt keine Hände hat.«
Ich brauchte ein paar Augenblicke, um zu kapieren, dass sein Witz gar kein Witz, sondern ein sehr scharfsinniger Ratschlag gewesen war. Trudi hätte mich tatsächlich beinahe umgebracht! Und Ilion war eingeschritten. Ilion, nicht Noár. Wo war Noár? Und warum schmeckte ich noch immer diese unerträgliche Fäulnis? Warum brannten die Splitter in meinen Handflächen?
Ich zog mich umständlich auf die Beine und kam mir dabei wie eine Abrissbirne vor, weil ich gleich mehrfach gegen Ilion kippte.
»Immer schön langsam«, lachte er.
Für langsam war keine Zeit. Ich musste zu Noár.
Als ich endlich stand, ließ ich meinen Blick über den Hain wandern. Überall lagen gefallene Chaoshunde. Bäume, Sträucher und Blumen waren entweder zerstört, zerquetscht oder von stinkendem, schwarzen Blut besudelt. Rhome und Drokor kontrollierten, ob die Kadaver auch wirklich tot waren. Aber Noár war nicht bei ihnen. Er war nirgends zu sehen. Ich entdeckte nur Nox. Der Shendai saß an der Felskante am anderen Ende des Hains. Pash stand neben ihm und hatte den Blick auf etwas am Boden gerichtet. Mir schnürte sich die Kehle zu.
Bitte nicht!
Ich torkelte vorwärts. Mein Körper rebellierte. Jeder Schritt fühlte sich wie ein Marathon an. Nur mein eiserner Wille hielt mich aufrecht. Na ja, mein eiserner Wille und Ilion, der hin und wieder beherzt zupackte, um einen Sturz zu verhindern. Trotzdem gab ich nicht auf. Zu präsent, zu beängstigend war die Erinnerung an den sterbenden Schattenprinzen in meinen Armen, durchbohrt von einem Chaos-Pfeil …
»Echt jetzt?!«, hörte ich Pash schimpfen. »Ich hab dich nicht großgezogen, als du noch ein milchnuckelndes Kätzchen warst, damit du mir jetzt so in den Rücken fällst.« Verärgert verschränkte er die Arme vor der Brust und fixierte die haushohe geflügelte Raubkatze. »Glaub ja nicht, dass ich dir jemals wieder was zu essen bringe, du undankbares Vieh!«
Nox maunzte schuldbewusst, doch er ließ den Schattenkrieger dennoch nicht näher kommen. Der Shendai beschützte jemanden. Jemanden, der zwischen seinen Pfoten kniete. Erleichterung durchströmte mich, als ich Noár lebend, atmend und wohlauf sah – nur um kurz darauf von einer erneuten Panikwelle erfasst zu werden. Er reagierte nicht – nicht auf Pash, nicht auf Nox, nicht auf deren Auseinandersetzung oder meine Ankunft. Mit geschlossenen Augen stützte er sich auf sein Schwert. Ich schüttelte Ilions Hand ab und taumelte zu ihm. Nox ließ mich ohne Protest durch, was Pash zu einem empörten Schnauben und einem weiteren Beschwerdeschwall veranlasste. Er brummte etwas von jahrzehntelanger Freundschaft, von Brüdern im Herzen und von geflügelten Fellbergen, die sich zu viel herausnahmen, doch ich achtete nicht darauf. Ich fiel vor Noár auf die Knie. Schwarzes und rotes Blut klebte überall an ihm. Er war also verletzt gewesen. Hatte er mir deshalb nicht zu Hilfe kommen können? Weil er sich selbst heilen musste? Wieso spürte ich dann nach wie vor das Chaos? Lebte doch noch einer der Chokaal? Oder hatte mich das Schattenreich so ausgelaugt, dass ich halluzinierte?
Ein winziges Lächeln erschien auf Noárs Gesicht. »Ich muss dich nicht einmal ansehen, um zu wissen, dass du dir zu viele Sorgen machst, Kätzchen.« Seine Stimme war leise, aber alles andere kraftlos. Trotzdem hatte er noch immer den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen. Meine Instinkte sagten mir, dass etwas nicht stimmte.
»Dann sieh mich an und beweis mir, dass es dir gut geht!«
Noár rührte sich nicht. Er seufzte.
»Sieh mich an!«, forderte ich erneut und griff an sein Kinn, um seinen Kopf zu heben.
Plötzlich kamen die Splitter in meinen Handflächen zur Ruhe und der faule Geruch ließ zumindest ein wenig nach. Noár schlug die Augen auf. Dunkle Augen mit wunderschönen goldenen Sprenkeln. Sie schienen von innen heraus zu glühen – wie Sterne in der Nacht. Nicht die geringste Spur von Chaos.
Er funkelte mich verschmitzt an.
»Ich hab dir doch gesagt, dass du die Einzige bist, die mich zu Fall bringen kann.«
All meine Anspannung löste sich mit einem Schlag in Luft auf. Ich wollte lachen, weinen und schlafen gleichzeitig – wobei mein Körper Letzteres so vehement einforderte, dass es mir immer schwerer fiel, gegen das watteartige Gefühl in meinem Kopf anzukämpfen.
»Kätzchen?«
Mein Gesicht kippte an eine warme Brust. Die Brust schien erst besorgt und dann verärgert zu sein. »Was ist mit ihr? Den Wirbel zu schließen, hätte sie nicht so viel Kraft kosten dürfen.«
»Die bessere Frage wäre, was mit dir los ist, Schattenprinz«, entgegnete Ilions Stimme kühl und ohne jede Spur von Sarkasmus. Oje. Ich kannte ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, was das bedeutete. Der junge Fürst der Faheen bombardierte Noár nur dann nicht mit sarkastischen Kommentaren, wenn er stinksauer war. Und das hieß, dass sich ein Streit anbahnte – mal wieder.
»Ich mag dich hier dulden, Faheen, aber ich schulde dir keine Rechenschaft«, knurrte Noár.
Ilion lachte frostig. »Nein, du schuldest mir lediglich das Leben deiner Frau.«
»Du lügst.«
»Oft. Doch diesmal ist es die Wahrheit«, gab der Faheen zurück. »Amaia wollte nur helfen und dein Reich hätte sie fast umgebracht. Ich mache deiner Heimat keinen Vorwurf, aber dir mache ich einen. Du hättest die Schatten unter Kontrolle haben oder zumindest bemerken müssen. Also frage ich dich noch mal: Was ist los mit dir, Schattenprinz? Denn wenn du nicht mal in der Lage bist, Amaia vor deinem eigenen Reich zu beschützen, fange ich an, daran zu zweifeln, ob du auch wirklich der Richtige für sie bist.«
Über mir machte sich Stille breit. Eine sehr gefährliche Stille. Ich wäre gerne eingeschritten, aber meine Zunge fühlte sich bleischwer an.
»Hey, mein krimineller Kumpel«, sprang Pash für mich ein. Dem Geräusch nach schien er Ilion auf die Schulter zu klopfen. »Ich mag dich. Ehrlich. Und grundsätzlich schätze ich auch deine lebensmüde Waghalsigkeit, aber du sprichst von Dingen, von denen du keine Ahnung hast. Hier also ein gut gemeinter Rat: Zweifle nie wieder an den Fähigkeiten oder Beweggründen meines Herrn, sonst wird er dein kleinstes Problem sein – wenn du verstehst, was ich meine.«
»Ich verstehe sehr gut«, murmelte Ilion. »Aber ihr seid diejenigen, die keine Ahnung habt.«
Es folgten ein abfälliges Schnauben und Schritte, die sich entfernten.
»Was hat er gemeint?«, wollte Pash wissen. Diesmal war sein Tonfall gedämpft und wesentlich ernster.
»Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden.«
Noárs Worte klangen wie ein Versprechen.
Kurz darauf erzitterte das Schattenreich.
WORKING AT THE CAR WASH
Ich konnte nicht sehr lange geschlafen haben, denn als ich erwachte, befand ich mich noch immer in dem zerstörten Hain. Allerdings lag ich jetzt auf schwarzem Fell – auf weichem, atmendem, schwarzem Fell. Gerade wollte ich mich aufsetzen, da verpasste mir Nox einen sanften Stoß und rollte sich noch ein wenig fester um mich herum zusammen. Eine unmissverständliche Ansage: Ich sollte mich weiter ausruhen.
Seufzend sank ich zurück gegen den warmen Shendai-Körper und bemerkte dabei, dass irgendjemand mir das Blut abgewaschen hatte. Ich tippte auf Nox. Er war nicht nur ein fürsorgliches Rudeltier, sondern auch noch durch und durch eine Katze. Ich hatte ihm bestimmt zu sehr gemüffelt, um mir zu erlauben, mich ungewaschen an ihn zu kuscheln. Wie dem auch sei, ich war froh, das widerliche Blut losgeworden zu sein. Genauso wie ich froh war, noch nicht aufstehen zu müssen. Die Splitter zu benutzen, powerte mich zwar normalerweise aus, aber Trudi hatte das Ganze auf die Spitze getrieben. Abgesehen davon war ich wirklich nicht wild darauf, bei den Aufräumarbeiten zu helfen und mich schon wieder mit stinkendem Blut zu besudeln. Noár und die anderen brachten nämlich gerade den Hain auf Vordermann. Im Moment schleiften sie die letzten toten Chokaal an die Klippen und stießen sie in die Tiefe. Die Überreste würden im Ewigen Fluss unter den Niemandslanden versinken und keinen mehr mit ihrem Anblick oder ihrem Geruch belästigen. Gut, denn sie hier verrotten zu lassen, war definitiv keine Option.
Plötzlich ertönte aus meinen Haaren ein gedämpftes Piepsen. Dann schwang sich ein dunkler Fellball in die Luft und schwebte vor meinem Gesicht auf und ab. Flummel war alles andere als erfreut, dass er den Angriff verpasst hatte.
»Du hättest nichts ausrichten können«, versuchte ich ihn aufzuheitern. »Chaoshunde sind sogar für dich eine Nummer zu groß.«
Das half nichts. Nachdem sich Flummel überzeugt hatte, dass ich keine bleibenden Schäden davontragen würde, landete er auf Nox’ Pfote und ließ geknickt seine winzigen Flügel sinken. Es war herzzerreißend. Vorsichtig stupste ich ihn mit der Fingerspitze an.
»Ich werde mit Noár reden, damit er dir erlaubt, bei den nächsten Trainingseinheiten wieder mit dabei zu sein«, bot ich ihm an. »Aber nur, wenn du versprichst, ihn nicht ständig zu beißen, sobald er mich angreift.«
Flummels riesige goldene Augen begannen zu strahlen. Er stieß eine ganze Reihe von Fiep- und Blubber-Lauten aus, bevor er in den kleinen Beutel an seinem Bauch griff und darin herumkramte. Irgendwann schien er gefunden zu haben, was er suchte: eine Nuss. Erwartungsvoll streckte er sie mir hin. Ich war tief gerührt. Flummel teilte nie freiwillig sein Essen. Obwohl ich überhaupt keinen Hunger hatte, nahm ich sein Entschuldigungsgeschenk an. Ich biss ein Stück ab und gab ihm den Rest zurück. Der Okoklin gluckste glücklich, sodass wir kurz darauf gemeinsam kauend den anderen dabei zusahen, wie sie ihre Arbeit beendeten.
Als die Männer den ekelhaften Part erledigt hatten, zogen sie sich an den kleinen Teich im hinteren Teil des Hains zurück, um sich zu waschen. Ich konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. So manche Hofdame hätte ein Vermögen dafür gezahlt, das sehen zu können: Fünf der tödlichsten Krieger Cassardims, die sich Blut und Dreck von ihren halbnackten Körpern wuschen und dabei ihre Späße trieben wie unbekümmerte Teenager. Sogar Ilion schien irgendwie dazuzugehören. Spätestens als Pash ihn umriss und beide mit einem lauten Platschen im Teich landeten, war das Eis gebrochen. Alle prusteten los, bis ihnen die Tränen in die Augen stiegen. Da erst fiel mir auf, dass ich den Fürsten der Faheen noch nie hatte lachen sehen. Es stand ihm ausgesprochen gut, auch wenn er nicht mit Noár mithalten konnte. Aber mal ehrlich, nichts und niemand konnte mit Noár mithalten. Das Lachen des Schattenprinzen war das Schönste von allen. Atemberaubend. Überwältigend. Sexy. Es verzauberte mich immer wieder aufs Neue und machte es mir unmöglich, meinen Blick von ihm loszureißen. Großer Gott, wie ich diesen Mann liebte.
Einer Eingebung folgend nutzte ich die Verbindung unserer Eheringe und schickte ihm ein Bild von herumtollenden Welpen. Die Ähnlichkeit zu ihm und seinen Freunden war nicht von der Hand zu weisen. Da brach Noár erneut in schallendes Gelächter aus, diesmal sehr zur Verwunderung der anderen. Zurück kam das Bild einer älteren Dame, die es sich mit Wein und Snacks vor einer Bühne bequem gemacht hatte, auf der mehrere gut aussehende Männer für sie strippten.
Ich grinste und dachte gar nicht daran, den Vergleich zu dementieren. Stattdessen kuschelte ich mich tiefer in Nox’ Fell und wünschte, Zoey könnte jetzt bei mir sein. Meiner besten Freundin hätte das hier definitiv gefallen. Und sie wäre der perfekte Ausgleich zu all dem Testosteron gewesen. Ich vermisste sie so sehr – genau wie Keeza und Mariz. Aber von den beiden wusste ich wenigstens, dass ich sie bald wiedersehen würde. Bei Zoey lag der Fall anders. Sie war in die Menschenwelt gegangen, wiedergeboren in einem sterblichen Körper – weit, weit weg von Cassardim. Sie lebte ein neues Leben und ich gönnte es ihr von Herzen. Zoey wäre als Geist niemals glücklich geworden. Trotzdem fehlte sie mir.
Als hätte Noár die Veränderung in meiner Stimmung gespürt, löste er die fröhliche Männerrunde auf, gab einige Anweisungen und kam schließlich auf mich zu. Er beeilte sich nicht, als wollte er sich den Anblick von Nox, Flummel und mir genau einprägen. Und ich tat meinerseits dasselbe mit ihm. Deshalb rührte ich mich nicht, setzte mich nicht auf und kam ihm nicht entgegen. Ich lag einfach nur da und sah meinem Mann dabei zu, wie er den Weg zu mir fand.
Wie hätte ich das auch nicht genießen können?
Nox machte seinem Herrn unaufgefordert Platz. Mit einer geschmeidigen Bewegung ging Noár vor mir in die Hocke. Er strich mir lächelnd eine Locke aus dem Gesicht und nahm dann meine Hand.
»Da ist jemand, der dir etwas sagen möchte.«
Verwundert runzelte ich die Stirn, doch bevor ich nachfragen konnte, floss über seine Ringe Dunkelheit in mein Bewusstsein. Schatten. Tief und undurchdringlich, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Ich spürte sofort, wer da Kontakt zu mir aufbaute: Trudi höchstpersönlich. Und diesmal war es keine flüchtige Begegnung, kein Hallo zwischen Tür und Angel, kein Winken aus der Ferne. Nein, diesmal schauten mir die Schatten direkt ins Gesicht. Instinktiv wollte ich Noár meine Hand entreißen, doch er hielt sie sanft fest, sodass ich sehen konnte, wie sich die Dunkelheit zu einer Szene formte: eine Schattenkriegerin in voller Rüstung, verwundet, nicht gebrochen. Sie senkte den Kopf und sagte leise, aber deutlich: »Ich bitte um Vergebung.«
Danach zogen sich die Schatten zurück und hinterließen mich sprachlos. Trudi hatte sich gerade bei mir entschuldigt. Und was das in Cassardim bedeutete, wusste ich inzwischen zur Genüge.
»Meine Heimat wird sich nie wieder gegen dich stellen«, sagte Noár entschieden, »das verspreche ich dir.«
Mir fehlten noch immer die Worte. Das stolze Schattenreich hätte sich niemals freiwillig so unterwürfig verhalten. Niemals. Noár musste es dazu gezwungen haben. War seine Macht so groß? Sein Wille so stark? Konnte er wirklich ein ganzes Reich in Angst und Schrecken versetzen? Es buchstäblich in die Knie zwingen?
Der Schattenprinz seufzte. »Ich hätte es früher bemerken sollen, aber die Barrieren, die Cassardim schützen, werden von Tag zu Tag schwächer. Das bedeutet, dass alle acht Reiche im Überlebensmodus sind. Sie haben Angst und das macht ihr Verhalten unberechenbar.«
Mir war klar, dass Noár mich beruhigen wollte, doch er erreichte das genaue Gegenteil. Jetzt war ich nicht mehr nur fassungslos, sondern auch noch zutiefst in Sorge. Ich hatte gewusst, dass es schlimm um Cassardim stand, aber gleich so dramatisch?
»Das ist jedoch keine Entschuldigung. Etwas Derartiges hätte nie passieren dürfen. Ich war unaufmerksam. Genau wie du. Wir müssen beide vorsichtiger sein.«
In seiner Stimme schwang kein Vorwurf mit, nur eine liebevolle Erinnerung an das, was er mir beständig predigte: Ich sollte weniger freimütig mit meinem Vertrauen umgehen. Wir hatten das Thema in den letzten Wochen des Öfteren diskutiert. Meistens ging es dabei um Ilion. Ironischerweise hatte nun ebendieser fragwürdige Ilion mich gerettet, während Noárs Heimat, sein Ein und Alles, ohne zu zögern meinen Tod in Kauf genommen hätte.
»Schätze, wir haben beide unsere Lektion gelernt«, murmelte ich und verschränkte meine Finger mit seinen.
»Das haben wir«, gab er mir recht. »Nur leider wird die Lektion diesmal Konsequenzen haben.«
Sein Tonfall ließ nichts Gutes erahnen. Alarmiert setzte ich mich auf. »Weil ich dem Fürsten der Faheen jetzt mein Leben schulde?«
Noár verdrehte die Augen. »Nein, Ilion steht seinerseits in Lazars Schuld und unser lieber Regent hat den Faheen beauftragt, dich zu schützen. Nichts von dem, was Ilion für dich tut, hat mit dir zu tun. Vergiss das besser nicht.« Der Blick des Schattenprinzen wanderte zu den schwebenden Bergen der Niemandslande. Heute schienen die Nebel, die sie verhüllten, besonders dicht zu sein. »Ich rede davon, dass es Aufmerksamkeit erregt hat, als sich überall im Schattenreich Chaoswirbel wie von Zauberhand geschlossen haben.«
Oh nein! Jetzt verstand ich, worauf er hinauswollte. Seit der letzten großen Schlacht, der man zynischerweise den Spitznamen »Chaos-Hochzeit« verpasst hatte, war so ziemlich jeder im Totenreich auf der Suche nach mir. Die einen wollten mich als rechtmäßige Kaiserin auf den Thron setzen, die anderen als Betrügerin hinrichten. Beide Wege führten in einen blutigen Bürgerkrieg. Um das zu verhindern, hatten wir den Plan ausgetüftelt, mich zu verstecken, bis sich die politische Lage entspannt hatte. Oder bis alles derart eskalierte, dass sogar die gegnerischen Fürsten »Kaiserin Amaia« für eine Verbesserung hielten.
Es war ein guter Plan, der allerdings nur funktionieren konnte, wenn niemand herausfand, wo ich mich aufhielt. Auch nicht Shaell, der Schattenfürst, den ich durch mein Intermezzo mit Trudi wohl gerade auf unsere Spur gebracht hatte.
»Dein Vater weiß, wo wir sind?«
Noár nickte finster. »Junos hat es mir bestätigt. Wir werden bald Besuch kriegen.«
Sein stummer Schattenkrieger-Freund behielt Shaell im Auge, was so viel bedeutete, wie dass er für Noár spionierte. Wenn er Alarm schlug, war das unser Signal zur Flucht.
»Wann gehen wir?«
Ein gefährliches Lächeln schlich sich auf Noárs Gesicht.
»Gar nicht.« Ohne meine Hand loszulassen, erhob er sich und zog mich auf die Beine. »Es ist an der Zeit, dass du dir die Krone nimmst, die dir zusteht.«
Mir wurde schwindelig. Ich hätte es gern auf das schnelle Aufstehen geschoben oder die Erschöpfung, die selbst mein Nickerchen nicht hatte vertreiben können, doch die Wahrheit war viel schlichter: Ich hatte Panik vor dem, was nun geschehen würde. Ganz besonders, weil mir kaum Zeit zum Luftholen blieb. Von einem Moment auf den anderen waren wir von Noárs Neun Toden umringt. Rhome warf seinem Herrn einen roten Gehrock zu, bevor er sich die eigene Uniform zuknöpfte. Gleichzeitig baute sich ein wandernder Kleiderberg vor mir auf. Dem gedämpften Gebrabbel nach verbarg sich darunter Pash.
»Besorgt ihr was Passendes zum Anziehen«, äffte er jemanden nach, der verdächtig nach seinem Herrn klang. »Also echt, Noár! Ich weiß, was ich als die künftige Kaiserin anziehen würde, um den gestelzten Goldlöffel-Lutschern zu zeigen, was ich von ihnen halte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Amaia den hochnoblen Fürsten nicht ihr blankes Hinterteil unter die Nase reiben will. Dementsprechend bin ich leicht überfordert und hab einfach alles mitgebracht. Also? Was möchtest du tragen, Prinzesschen?«
Überfordert war das richtige Schlagwort. Ich wusste ja noch nicht einmal, wer uns besuchen würde. Auch nicht wann oder warum. Von Kriegern, die mich mit Waffengewalt in den Goldenen Berg schleifen wollten, bis hin zu einer offiziellen Diplomatendelegation war alles möglich.
»Ähm …«
Drokor kam mir zu Hilfe. Während der dunkelhäutige Hüne mit erstaunlich kundigen Blicken die Kleidungsstücke sichtete, wechselten Noár und Rhome Positionen. Jetzt sorgte plötzlich der blonde General dafür, dass ich nicht versehentlich umkippte, und verschaffte dem Schattenprinzen die Zeit, sich anzuziehen.
»Darf ich?«, erkundigte sich Rhome und deutete auf meine Haare. Verdattert nickte ich und ehe ich michs versah, hatte er meinen Pferdeschwanz geöffnet und fuhr mir mit geübten Fingern durch die Locken.
»Zum Flechten bleibt keine Zeit, aber mein Angebot steht«, murmelte er amüsiert und erinnerte mich daran, dass ich ihn mir noch immer für einen Abend als beste Freundin ausleihen durfte.
Inzwischen hatte Drokor eine Vorauswahl getroffen und hielt mir einen schwarzen Mantel mit Goldbesatz und eine schwarze Robe mit besticktem Gürtel unter die Nase. Beides geschmackvoll und äußerst pragmatisch, da ich meine Trainingskleidung darunter anbehalten konnte. Ich nickte Drokor dankbar zu und griff nach dem Mantel. Noár nahm ihn mir postwendend wieder ab und half mir ganz gentlemanlike hinein.
»Wer braucht schon Zofen, wenn man auch Schattenkrieger haben kann«, witzelte Rhome.
Drokor schnaubte. »Alles eine Frage der Perspektive.«
»Ich ziehe Zofen in jedem Fall vor«, meinte Ilion und reihte sich in unsere kleine Runde ein. Auch der Fürst der Faheen hatte sich umgezogen und sah mit seinem dunklen Hemd, der Lederweste und einer Art cassardischem Bandana irgendwie piratenhaft aus.
Das war so absurd, dass es mir den Rest gab.
»STOP!«, forderte ich streng. »Keiner rührt sich vom Fleck, bevor mich nicht irgendjemand in den Plan einweiht!«
Statt einer Antwort drang ein gellendes Heulen aus dem Nebel. Nox sprang auf und stieß seinerseits ein Brüllen aus, das mir durch Mark und Bein ging. Adrenalin pumpte durch meine Adern. Jetzt war ich hellwach. Einen Augenblick später brachen fünf mächtige Silhouetten durch die diesigen Schwaden.
DER APFEL FÄLLT VOM STAMM
Drei Shendai und ein Falke von der Größe eines Learjets segelten an den Klippen vorbei. Die fünfte Gestalt kreuzte deren Flugbahnen in einem gewaltigen Sprung. Es war ein gigantischer graublauer Wolf. Er landete knapp hinter der Felskante des Hains und schlug dort seine eisernen Krallen in den Steinboden, als wäre der aus Styropor. Eisblaue Augen fixierten uns. Lefzen zuckten. Ein tiefes Knurren erfüllte die Luft. Instinktiv wollte ich zurückweichen, doch schon sprang Nox dem Wolf in den Weg und öffnete fauchend seine rasiermesserscharfen Schwingen. Damit schottete uns der Shendai vor jeglicher Bedrohung und neugierigen Blicken ab. Trotzdem hatte ich bereits gesehen, dass der Wolf von jemandem geritten wurde. Von jemandem, den ich kannte. Es war Fürst Onode von den Niemandslanden, ein kriegerischer Mann mit langen geflochtenen Haaren und eisernen Ornamenten an den Schläfen. Der Vater meiner Ziehschwester Jenny.
»Pfeif dein Haustier zurück, Schattenprinz. Wir müssen reden.« Onodes sonore Stimme hallte zu uns herüber, doch weder Noár noch seine Männer reagierten darauf.
»Sollten wir nicht irgendwas antworten?«, erkundigte ich mich im Flüsterton.
»Wir warten«, raunte Noár und hauchte mir einen Kuss auf die Stirn. »Eine Kaiserin verdient einen würdigen Auftritt.«
Kurz darauf verstand ich, worauf wir gewartet hatten. Ich hörte die Schritte mehrerer Personen. Vermutlich die Reiter der Shendai und des seltsamen Falken, die ein Stück weiter oben am Fort gelandet sein mussten. Niemand sagte etwas, doch ich spürte, dass pure Macht sich im Hain versammelt hatte. Jetzt kam auch Bewegung in meine Freunde. Vollkommen synchron nahmen sie offiziell Aufstellung. Noár und ich bildeten dabei die Mitte. Rechts von uns stand Rhome als Schattengeneral, links Ilion als Fürst der Faheen. Drokor und Pash flankierten uns mit einigem Abstand wie todbringende Leibwächter.
Gerade fragte ich mich, ob und wann sie das einstudiert hatten, als eine wohlbekannte Stimme erklang.
»Geh mir aus dem Weg, Shendai!«, verlangte Shaell gefährlich leise. Der Wille des Schattenfürsten war so durchdringend, dass sich sogar Flummel tiefer in meinen Haaren verkroch und zu wimmern anfing. Noárs Vater herrschte über dieses Reich und ließ keine Gelegenheit aus, das auch zu demonstrieren. Nervosität stieg in mir auf. Ich wappnete mich davor, Shaell gleich von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, doch Nox widersetzte sich dem Befehl des Schattenfürsten. Er widersetzte sich? Das war nicht möglich. Nicht bei einem Befehl des Schattenfürsten. Es sei denn …
Panisch packte ich Noár am Ärmel. »Hör auf! Ruf ihn zurück. Dein Vater wird ihn umbringen.«
»Wird er nicht. Er fürchtet mich zu sehr«, lautete die trockene Antwort. Dann erschien ein Lächeln auf seinen Lippen. »Aber du hast recht. Irgendjemand sollte Nox zurückrufen.«
Ich blinzelte ein paarmal verwirrt, bis mir schließlich ein Licht aufging. All das hier war Teil einer gut durchdachten Inszenierung. Eine Show mit dem Ziel, mich als Kaiserin zu etablieren.
Plötzlich erklang ein metallisches Sirren. Ein Schwert wurde gezogen. Trotzdem senkte der Shendai weder seine Schwingen noch gab er seine feindselige Haltung auf. Die Zeit für Zweifel oder Lampenfieber lief ab.
»Nox!«, rief ich laut. »Wärst du so freundlich und lässt unsere Gäste durch?«
Als hätte ich einen Schalter umgelegt, verwandelte sich der fauchende Shendai abrupt in einen handzahmen Schmusekater. Er legte artig seine Flügel an und trottete hinter uns.
Jetzt stand nichts mehr zwischen Noárs beängstigendem Vater und mir. Und Shaell kochte vor Zorn angesichts der Demütigung, die wir ihm gerade bereitet hatten.
»Seit wann bin ich Gast in meinem eigenen Reich?«, fragte er mich frostig.
Trotz der äußerlichen Ähnlichkeit zu seinem Sohn hatte er kaum etwas mit Noár gemein. Shaell war grausam und auf eine Art einschüchternd, die in mir das Gefühl weckte, unbedeutend und einfältig zu sein. Umso dankbarer war ich Nox und Noár, dass sie mich daran erinnert hatten, wie sehr dieses Gefühl trog. Dafür würde ich die beiden später unbedingt abknutschen müssen. Mit frisch poliertem Selbstvertrauen straffte ich die Schultern.
»Ich habe nicht von Euch gesprochen Fürst Shaell.« Beiläufig nickte ich in Richtung der anderen Besucher. Neben Noárs Vater und Fürst Onode von den Niemandslanden hatten sich außerdem Waldfürstin Ganaya, Wüstenfürst Samtar, der kürzlich beförderte General Askan und der in Gold gekleidete Lazar hier eingefunden. Eine bunt gewürfelte wie hochkarätige Runde und – soweit mir bekannt war – meine Verbündeten.
Lazar trat nach vorne. Dem ehemaligen Seneschall und aktuellen Regenten von Cassardim war nicht entgangen, dass der Schattenfürst noch immer sein Schwert in der Hand hielt und mich gereizt anstarrte. Die Situation besaß eindeutig das Potenzial zu eskalieren.
»Wir sind nicht gekommen, um zu streiten«, verkündete Lazar beschwichtigend. Er schenkte mir ein kleines Lächeln und wirkte dabei erschreckend ausgelaugt. Sogar seine silbernen Schläfen schienen seit unserer letzten Begegnung noch mehr ergraut zu sein. Nur sein Blick war wachsamer denn je.
»Wir möchten lediglich –«
»Was macht er hier?«, unterbrach ihn Shaell und deutete mit blanker Klinge und blankem Hass auf Ilion. »Tötet ihn!«
Die Anweisung richtete sich an Pash und Drokor. Damit stürzte er die beiden Krieger in ein offensichtliches Dilemma. Ihre Loyalität galt zwar dem Schattenprinzen, aber Shaell war noch immer ihr Fürst. Sie würden sich dem Befehl beugen müssen – falls niemand einschritt. Ich spürte, wie Noár Luft holte, um sich mit seinem Vater anzulegen, und ich entschied spontan, dass es besser wäre, ihn da rauszuhalten. Ilion war meinetwegen hier und deshalb auch meine Verantwortung.
»Der Fürst der Faheen hat sich als nützlicher Verbündeter erwiesen«, sagte ich mit fester Stimme. »Seine Anwesenheit entspricht meinem Wunsch.«
Noárs Vater entglitten die Gesichtszüge. »Das hier ist mein Reich«, fuhr er mich an. »Du hast doch keine Ahnung, wer er ist. Das Schattenreich beherbergt keine Verbrecher. Es richtet sie.«
»Es wird wohl eher von einem regiert«, höhnte Ilion leise.
Ich verkniff mir ein Stöhnen. Nicht hilfreich! Blieb nur zu hoffen, dass Shaell den Kommentar nicht gehört hatte und –
»Du nichtsnutziger Abschaum wagst es, so mit mir zu sprechen?!«, presste der Schattenfürst hervor. Er packte seine Klinge fester und marschierte auf Ilion zu.
So viel zu meiner Hoffnung. Jetzt konnte ich das Stöhnen nicht länger zurückhalten, denn natürlich zog Ilion nun ebenfalls sein Schwert. Und natürlich war Pash drauf und dran, sich zwischen die Fronten zu werfen. Und natürlich würde Noár nichts davon zulassen.
Oh, Mann. Keine fünf Minuten und schon gingen sich alle an die Gurgel. Das konnte doch nicht deren Ernst sein?!
»Keinen Schritt weiter«, befahl ich dem Schattenfürsten.
Shaell blieb so abrupt stehen, als wäre er gegen eine unsichtbare Wand gerannt. Mein Wille zwang ihn dazu – unterstützt von den Splittern. Das würde zwar einiges an Kraft kosten und mich später zu einem zweiten Powernap zwingen, doch die Genugtuung war es mir definitiv wert.
Shaell wehrte sich vehement, speiste seinen Willen mit seiner Wut, aber er hatte trotzdem keine Chance. Das schien ihm ebenfalls gerade bewusst zu werden, denn er wandte sich aufgebracht an seinen Sohn: »Du bist den Schatten verpflichtet und lässt das zu?«
Noár zuckte nicht einmal mit der Wimper. »Ich bin Cassardim verpflichtet, nicht deinem Stolz. Amaia ist Cassardim. Sie ist unsere Kaiserin und außerdem die Frau, die ich liebe und geheiratet habe. Stell dich gegen sie und du wirst mich zum Feind haben.«
Der Tonfall des Schattenprinzen war so frostig, wie man es von seinen öffentlichen Auftritten gewohnt war, aber der Inhalt seiner Worte erwärmte mein Herz. Noár stand nicht nur zu mir als Kaiserin – er stand auch zu seinen Gefühlen für mich. Abgesehen davon hatte er gerade quasi nebenbei unsere Hochzeit bekannt gegeben, obwohl Lazar eigentlich darauf bestanden hatte, sie vorübergehend geheim zu halten. Dementsprechend groß war die Überraschung der versammelten Fürsten. Während Lazar tadelnd den Kopf schüttelte, klappten überall die Münder auf. Auch Shaell brach plötzlich seinen sinnlosen Kampf gegen meinen Willen ab. Ilion schien nicht länger das Ziel seines Unmuts zu sein. Stattdessen richtete er nun seine volle Missbilligung auf Noár.
»Ich hätte es wissen müssen«, knurrte er. »Wieder einmal rennst du einem Weib hinterher wie ein liebeskranker Idiot. Ganz Cassardim erzittert vor dem großen Ardiza Noár val Shaell, doch kaum verdreht dir eine Frau den Kopf, verlierst du jeden Kontakt zur Realität. Wie oft muss ich dir noch sagen: Gefühle nehmen dir jede Macht! In der Arena hatte ich noch geglaubt, du erzählst diesen rührseligen Schwachsinn nur, um Katair zu provozieren. Aber nein, mein Sohn hat tatsächlich den Verstand verloren.«
Noár ertrug die hohntriefende Maßregelung seines Vaters, ohne eine Miene zu verziehen. Trotzdem beschlich mich eine böse Vorahnung. Shaell kam gerade erst in Fahrt und das gehässige Blitzen in seinen Augen war ganz bestimmt kein Ausdruck familiärer Zuneigung.
»Deine Schwäche macht mich krank!«, spie er seinem Sohn förmlich ins Gesicht. »Du hättest aus deinen Fehlern mit Zima lernen sollen!«
Die Erwähnung seiner Stiefmutter ließ Noár kaum merklich erbleichen. Eine Reaktion, die Shaell nicht entging. Er lachte.
»Dachtest du etwa, dein Vater wüsste nicht, was in seinem eigenen Reich geschieht? Was ihr beide hinter meinem Rücken getrieben habt?«
Noár versuchte vergeblich, sich seinen Schock nicht ansehen zu lassen. Egal, wie sehr er seinen Vater verabscheute, die Affäre mit dessen Frau war Hochverrat und konnte nicht nur ihn teuer zu stehen kommen, sondern auch alle, die ihm etwas bedeuteten.
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, entgegnete er gefasst.
»Natürlich weißt du nicht, wovon ich spreche. Weil deine Gefühle dich blind gemacht haben. Andernfalls hättest du sehr schnell begriffen, dass ich Zima ausgesucht und in dein Bett geschickt habe. Ich habe ihr gesagt, was sie dir ins Ohr flüstern soll. Ich habe sie geheiratet, um dich an mich zu binden. Ich habe deine Schwäche erkannt und benutzt, um dich zu kontrollieren. SO HERRSCHT MAN! DAS IST MACHT!«
Der Schattenfürst hätte seinem Sohn auch das Schwert in die Brust rammen können – das wäre gnädiger gewesen. Noch nie hatte ich Noár so fassungslos erlebt. Zima hatte fast ein ganzes Jahrhundert mit seinen Gefühlen gespielt. Schlimm genug. Doch nun zu erfahren, dass sein eigener Vater ihm all das angetan hatte … Großer Gott, wir steuerten eindeutig auf eine Katastrophe zu und ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, ohne alles noch viel schlimmer zu machen. Hilfe suchend sah ich zu Rhome und den anderen, doch denen schien es wie mir zu gehen.
»Und jetzt?« Shaell breitete die Arme aus und genoss seine Überlegenheit. »Nach all dieser Zeit? Nach all meinen Lektionen? Jetzt passiert dasselbe wieder!« Sein ausgestreckter Zeigefinger deutete in meine Richtung. »Du bist diesem Mädchen nicht nur verfallen, nein, du musstest auch noch die ganze Welt wissen lassen, dass sie dich kontrolliert. Aber wer kontrolliert sie? Wer ist sie überhaupt? Zima war wenigstens eine von uns. Sie hatte Potenzial. Sie wusste, was Macht bedeutet. Sie hätte sich nicht hier versteckt wie ein Feigling, während ein Thron auf sie wartet. Sie hätte –«
Mitten im Satz verstummte Shaell.
Sein Körper verkrampfte. Er griff sich an die Brust, rang nach Luft, brachte jedoch kein Wort heraus. Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er auf die Knie fiel.
Alle Blicke richteten sich auf Noár. Aus dessen Bestürzung war eisiger Zorn geworden. In seinen dunklen Augen funkelten keine friedlichen Sterne mehr, die Feuer der Hölle brannten nun darin. Kein Wort war über seine Lippen gekommen und doch spürte ich seinen Willen wie tausend Nadeln unter meiner Haut. Ich war mir nicht sicher, ob er die Beherrschung verloren oder sie wiedergefunden hatte. Nur einer Sache war ich mir sicher: Er hatte gerade das Herz seines Vaters angehalten.
Entsetzt starrte ich ihn an. Er würde Shaell umbringen. Doch weder Lazar noch die Fürsten oder Noárs Freunde erweckten den Eindruck, einschreiten zu wollen. Auf Rhomes Gesicht entdeckte ich sogar ein grimmiges Lächeln.
Und da verstand ich es: Noár zog endlich eine Grenze. Er hatte sich seinem Vater stets untergeordnet, sich im Hintergrund gehalten, seine Willensstärke gezügelt, um seinem Fürsten treu zu dienen. Damit war jetzt Schluss. Wir erlebten hier keinen Amoklauf, sondern die Geburt eines wahren Herrschers. Noár übte keine Rache, er erhob sich über seinen Vater.
Mit gemessenen Schritten wanderte der Kronprinz des Schattenreichs zu seinem röchelnden Fürsten. Er ging vor ihm in die Hocke und sah in mit einer Kaltblütigkeit an, die auch dem Letzten klarmachte, dass nun jedes Band zwischen Vater und Sohn durchtrennt war.
»Vergleiche meine Frau nie wieder mit jemandem wie Zima.«
Das obligatorische »sonst …« hatte Noár nicht nötig, denn seine Haltung, sein Tonfall und sein Blick sagten bereits alles.
»Meine Mutter hat dich geliebt. Ihretwegen lasse ich dir dein Leben und deinen Thron. Heute. Stell meine Gnade lieber kein zweites Mal auf die Probe.«
Shaell starrte seinen Sohn aus weit aufgerissenen Augen an. Keine Ahnung, ob er überhaupt noch mitbekam, was um ihn herum geschah. Und dann, ganz plötzlich, ließ Noár von ihm ab. Das Herz des Schattenfürsten pumpte wieder Blut durch seine Adern. Hustend und würgend füllte er seine Lungen mit Luft. Er gab ein erbärmliches Bild ab, doch sein Sohn schenkte ihm keinerlei Aufmerksamkeit mehr. Noárs Sternenaugen hefteten sich auf mich. Ohne Umschweife trat er an meine Seite, nahm meine Hand und richtete schließlich sein Wort an die übrigen Fürsten: »Noch jemand, der unsere Kaiserin oder meine Liebe zu ihr infrage stellen will?«
MEIN THRON, MEIN PLAN, MEIN UTERUS
Das folgende Schweigen war erfüllt von Bestürzung und Respekt. Na ja, von Bestürzung, Respekt und Shaells ziemlich unappetitlichem Japsen. Unglücklicherweise brauchte der Schattenfürst nicht lange, um sich zu fangen. Feindseligkeit verwandelte sein Gesicht in eine Fratze. Er wagte es nicht, den Blick zu heben, weil er wohl fürchtete, dass sein Sohn seine Drohung wahr machen könnte, aber er hatte offensichtlich auch nicht vor, sich geschlagen zurückzuziehen. Erst spuckte er auf den Boden – eine Mischung aus Speichel und Blut. Danach spuckte er Noár eine Frage entgegen, die mich endgültig vor den Kopf stieß: »Hast du sie wenigstens schon geschwängert?«
Meine Augenbrauen schossen in die Höhe. »WAS?«
Dieser Typ war einfach unglaublich. Wusste er wirklich nicht, wann man besser die Klappe hielt?
Noár drückte beruhigend meine Hand. Inzwischen war er die Gelassenheit in Person. Ich dagegen stand kurz davor, Shaell meinerseits eine Lektion zu erteilen.
»Das ist eine berechtigte Frage«, meinte Fürst Onode und trat aus dem Schatten des Wolfs. Seine Kleidung hatte denselben graublauen Farbton wie das Fell seines tierischen Begleiters und auch seine Augen waren ähnlich durchdringend. »Ihr könnt den Thron nur besteigen, wenn Ihr einen Erben habt, kaiserliche Hoheit.«
»So will es das Gesetz«, fügte Samtar, der Fürst des Trockenen Meers, hinzu.
Ilion schüttelte abfällig den Kopf. »Gesetzestreu bis in den Tod«, spottete er. »Was hilft ein Erbe, wenn es nichts mehr zu vererben gibt?«
Sowohl Samtar als auch Onode schienen den Faheen zurechtweisen zu wollen, doch Lazar riss das Wort an sich. »Dieses Thema ist nun wirklich nicht das Wichtigste auf unserer Agenda. Wir werden einfach das Gerücht streuen, dass Amaia guter Hoffnung ist. Das wird das Volk vorübergehend zufriedenstellen, bis die beiden tatsächlich Nachwuchs erwarten.«
Jetzt reichte es mir! Niemand außer mir selbst bestimmte über mein Leben, meine Zukunft oder meinen Uterus.
»Ich werde ganz sicher kein Kind in die Welt setzen, solange das Chaos uns bedroht und ein Krieg vor der Tür steht. Das wäre mehr als verantwortungslos! Und auch danach ist es allein Noárs und meine Sache, ob und wann wir Kinder wollen.«
Lazar stöhnte leidgeprüft. »Du kannst so viele Reformen durchführen, wie du möchtest, sobald du auf dem Kaiserthron sitzt, Amaia. Das wird jedoch nie geschehen, wenn du unsere Traditionen und Gesetze missachtest!« Sein Tonfall wurde mit jeder Silbe strenger und unerbittlicher. »Nimm den Kompromiss an, den ich dir biete! Komm mit uns in den Goldenen Berg, spiel die Schwangere, lass dich krönen und dann rette uns alle, verdammt noch mal!«
Oha. Lazar war nicht der Typ für Verzweiflung, aber das hier kam ziemlich nah ran.
»Was ist passiert?«, wollte Noár wissen, der so alarmiert klang, wie ich mich fühlte.
Überraschenderweise antwortete uns der Wüstenfürst. »Saphama hat Lazar als Regenten kaltgestellt und die Führung übernommen«, informierte er uns. »Wir müssen jetzt intervenieren oder die Wolkenfürstin wird sich selbst zur Kaiserin krönen.«
»Ich werde niemals vor dieser Silberschlange knien!«, knurrte Shaell.
Nun räusperte sich Rhome. »Das Ganze klingt eher nach einer Falle, um Amaia aus ihrem Versteck zu locken.«
»Wir werden sie mit unserem Leben schützen«, mischte sich nun Fürstin Ganaya ein. »Doch Amaia muss mit uns in den Goldenen Berg kommen. Das ist der einzige Weg.«
Voller Ungeduld sahen mich alle an. Sie erwarteten eine Entscheidung. Jetzt.
Aber ich hatte noch nicht einmal die Auseinandersetzung mit Shaell verarbeitet, geschweige denn die Tatsache, dass Saphama ein Putsch gelungen war. Woher sollte ich wissen, was zu tun war? Woher sollte ich wissen, wem ich vertrauen konnte? Sogar Lazar hatte sich nach der Hochzeit heimlich aus dem Staub gemacht, weil er wusste, dass ich einen Haufen Fragen an ihn haben würde, die zu beantworten er wohl weder damals noch heute bereit war.
»Wenn ich mit euch gehe, bedeutet das Krieg, und das wisst ihr.« Ifars durchgeknallte Mutter würde niemals freiwillig das Feld räumen.
Onode nickte finster. »Manchmal muss man eben Krieg führen, um Frieden zu gewährleisten.«
»Frieden?«, platzte es aus mir heraus. »Ich glaube, es geht Euch nur um Eure Macht. Aber was ist mit Cassardim? Was ist mit den Barrieren und dem Chaos?«
»Nehmt Euch den Thron, der Euch zusteht«, beschwor mich die Waldfürstin eindringlich, »dann wird die Ordnung wiederhergestellt und Cassardim ist gerettet.«
Samtar schnaubte verächtlich. »Falls ihr der Thron auch wirklich zusteht.«
»Was genau wollt Ihr damit sagen?«, erkundigte sich Noár. Der warnende Unterton in seiner Stimme war nicht zu überhören. Trotzdem blieb der Wüstenfürst erstaunlich ruhig.
»Noch immer kursieren Gerüchte zu Prinzessin Amaias Herkunft. Mir persönlich ist es gleichgültig. Das Mädchen ist mir als Kaiserin tausendmal lieber als Saphama. Doch die Ordnung wird nur dann wiederhergestellt, wenn sie rechtmäßig auf dem Kaiserthron sitzt.«
»Sie ist die Goldene Erbin! Punkt!«, donnerte Lazar. »Oder glaubst du den Aussagen einer verrückten Chaoskaiserin mehr als den Kaisersymbolen, die Amaia trägt?«
»Was ich glaube, ist nicht von Bedeutung.«
Der Streit, der nun unter den Fürsten ausbrach, kam mir wie ein surrealer Albtraum vor. Sie schienen das Thema nicht zum ersten Mal zu diskutieren und ihre Argumente drehten sich wieder und wieder im Kreis. Niemand interessierte sich für mich. Nicht wirklich. Ich war nichts weiter als eine Galionsfigur, deren Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit man auslotete. Nur einer der Besucher gab sich auffällig zurückhaltend und das weckte mein Interesse.
»Was ist Eure Meinung, General Askan?«, unterbrach ich die zankenden Fürsten lautstark. »Was würdet Ihr tun?«
Der alte Goldkrieger mit der wettergegerbten Miene zuckte zusammen, als sein Name fiel. Ich kannte ihn als anständigen Mann aus dem Volk, als loyalen Soldaten, der Befehle ausführte und dennoch seinen moralischen Kompass nie verloren hatte. Es war ihm sichtlich unangenehm, in einer derartigen Gesellschaft im Mittelpunkt zu stehen.
»Niemand redet von den Opfern«, begann er scheu. »Niemand redet davon, dass das Gericht der Toten seit Wochen stillsteht. Niemand redet von den Seelen, die vom Chaos verschlungen werden, weil wir unsere Aufgaben nicht erfüllen. Wenn Ihr mich fragt, kaiserliche Hoheit, hat das Chaos schon gewonnen.«
Seine Antwort beeindruckte mich. Umso unverschämter empfand ich die herablassende Reaktion der Fürsten. Sie hielten den Goldkrieger wohl nicht für befähigt, sich in hohe Politik einzumischen. Nach ein paar respektlosen Kommentaren schenkten sie ihm keine Beachtung mehr und ihr Streit ging in eine neue Runde.
»Genug!«, rief ich wütend. »General Askan hat recht. Wir konzentrieren uns auf das falsche Problem.«
Das fegte den anderen ihre Süffisanz aus den Gesichtern.
»Weiht uns ein«, forderte Fürst Onode verärgert. »Was würde Cassardim Eurer Meinung nach retten, Hoheit?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Wir müssen die Barrieren erneuern.«
»Das ist ohne ein intaktes Juwel der Macht nicht möglich«, erinnerte mich der Fürst der Niemandslande. Sein unterschwelliger Vorwurf ließ mich mit den Augen rollen.
»Dann brauchen wir eben ein neues Juwel.«
Stille legte sich über den Hain. Hatten sie mich nicht verstanden oder waren sie schlichtweg schwer von Begriff?
»Das Juwel kann ja nicht einfach da gewesen sein, oder? Irgendwer muss es gefunden oder erschaffen haben. Und wo es eins gab, gibt es vielleicht noch ein zweites.«
Endlich machte sich Erkenntnis auf ihren Gesichtern breit. Und eine Spur von Hoffnung. Aber auch Ratlosigkeit.
»Also? Hat irgendwer eine Ahnung, woher das Juwel stammt? Immerhin seid ihr doch alle superalt und superwichtig.«
Die Fürsten wechselten unsichere Blicke. Keiner von ihnen hatte eine Antwort.
»Dieses Wissen«, meinte Lazar schließlich, »hatten nur die Kaiser. Außer dir gibt es also niemanden, der –«
»Kommt gar nicht infrage!«, schnitt Noár ihm das Wort ab.
Lazars Mund klappte zu, doch sein Gesichtsausdruck sprach Bände. Da kapierte ich, was er mir sagen wollte. Ich trug das Wissen in mir. Das Juwel hatte seit Anbeginn der Zeiten die Erinnerungen aller Kaiser gesammelt und sie mir übertragen, bevor es zerstört worden war. Ich kam nur nicht ran, denn Lazar hatte alles abgeschottet und blockiert, damit die unglaublichen Wissensmengen mein Bewusstsein nicht überschwemmen und mir den Verstand rauben konnten. Eine Gefahr, die noch immer bestand. Deshalb hatte Noár eben so heftig reagiert. Und deshalb schimmerte jetzt auch dieser gequälte flehentliche Ausdruck in seinen Augen.
Ich ignorierte ihn schweren Herzens und wandte mich wieder an Lazar: »Kannst du mir die entsprechende Erinnerung zeigen? Ohne mein Gehirn in Pudding zu verwandeln?«
Der abgesetzte Regent zögerte.
»Möglich. Aber als ich dir die Erinnerung aus der Nacht der Rebellion gezeigt habe, wusste ich, wonach ich suche. Das wäre diesmal anders. Ich bräuchte Zeit, um so tief im Wissen der ältesten Kaiser zu graben.«
Shaell warf seine Arme in die Luft. »Wir haben diese Zeit nicht. Schon gar nicht, um sie an solch idealistische Träumereien zu verschwenden. Zuerst muss Saphama aufgehalten werden. Wenn sie den Thron an sich reißt, ist Cassardim verloren.«
Lazar nickte bedächtig. »Obwohl ich deinen Ansatz für den besseren halte, Amaia, muss ich Shaell recht geben.«
Wieder ruhten alle Blicke auf mir.
Yay, es machte so richtig Spaß, die Verantwortung zu tragen. Ich konnte zwischen Pest und Cholera wählen, und nichts Geringeres als das Schicksal der Welt hing von dieser Entscheidung ab. Begab ich mich auf die Suche nach einem neuen Juwel und bekämpfte das Chaos? Oder verhinderte ich, dass Saphama die Macht bekam, alles und jeden zu vernichten, der mir am Herzen lag?
Ich