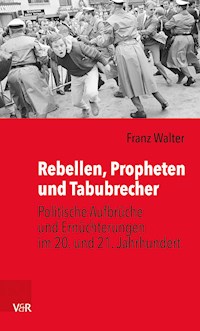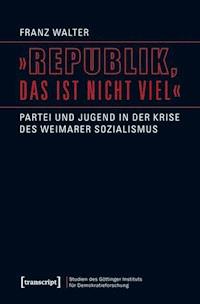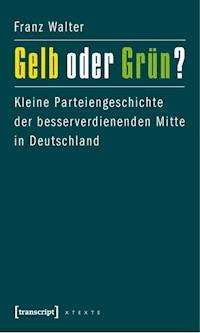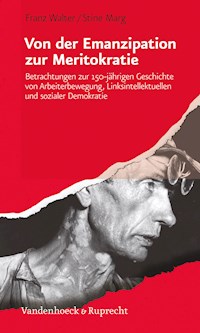13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die SPD ist die älteste Partei Deutschlands. Wer die Sozialdemokratie verstehen will, muss ihre Geschichte kennen, ihre Höhenflüge, ihre bitteren Niederlagen. Lebendig, kritisch und mit festem Blick auf die Gegenwart durchschreitet der Göttinger Politologe und Historiker Franz Walter die Biographie einer großen und doch oft unglücklichen Partei. Er porträtiert die Persönlichkeiten, die die einstmals verfolgte Vertreterin der Arbeiterbewegung und aktuelle Regierungspartei geprägt haben – und jene, die dieses fragile Erbe heute in ihren Händen halten: von August Bebel über Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder bis hin zu Sigmar Gabriel, Martin Schulz und Andrea Nahles. Als Die SPD im Mai 1863 entstand, war Bismarck noch nicht Kanzler und Deutschland noch kein Nationalstaat. Der Weg der Partei führte durch Industrialisierung, Krieg und Depression, optimistischen Aufbruch – und schwere Krisen. Die Geschichte der SPD ist deutsche Gesellschaftsgeschichte, geprägt von Abenteurern und Konvertiten, Charismatikern und Populisten, Präsidenten und Kanzlern. Zugleich erzählt dieses brillante Buch vom schleichenden Ende einer traditionsreichen Gegenkultur der Arbeiter und kleinen Leute. An ihrer Stelle klafft heute eine Lücke, deren ganze Dimension erst allmählich sichtbar wird. Hat Die SPD im 21. Jahrhundert nur eine bewegte Geschichte – oder auch eine Zukunft? «Kaum ein Politologe im Land, der so geistreich über Parteien und ihre gewandelte Rolle in der Gesellschaft zu schreiben vermag.» taz «Wenige Politikwissenschaftler verfolgen das politische Alltagsgeschehen so lebhaft und können es so thesenfreudig mit historischem Wissen rückkoppeln wie Franz Walter.» DLF
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Ähnliche
Franz Walter
Die SPD
Biographie einer Partei von Ferdinand Lassalle bis Andrea Nahles
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die SPD ist die älteste Partei Deutschlands. Wer die Sozialdemokratie verstehen will, muss ihre Geschichte kennen, ihre Höhenflüge, ihre bitteren Niederlagen. Lebendig, kritisch und mit festem Blick auf die Gegenwart durchschreitet der Göttinger Politologe und Historiker Franz Walter die Biographie einer großen und doch oft unglücklichen Partei. Er porträtiert die Persönlichkeiten, die die einstmals verfolgte Vertreterin der Arbeiterbewegung und aktuelle Regierungspartei geprägt haben – und jene, die dieses fragile Erbe heute in ihren Händen halten: von August Bebel über Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder bis hin zu Sigmar Gabriel, Martin Schulz und Andrea Nahles.
Als die SPD im Mai 1863 entstand, war Bismarck noch nicht Kanzler und Deutschland noch kein Nationalstaat. Der Weg der Partei führte durch Industrialisierung, Krieg und Depression, optimistischen Aufbruch – und schwere Krisen. Die Geschichte der SPD ist deutsche Gesellschaftsgeschichte, geprägt von Abenteurern und Konvertiten, Charismatikern und Populisten, Präsidenten und Kanzlern.
Zugleich erzählt dieses brillante Buch vom schleichenden Ende einer traditionsreichen Gegenkultur der Arbeiter und kleinen Leute. An ihrer Stelle klafft heute eine Lücke, deren ganze Dimension erst allmählich sichtbar wird. Hat die SPD im 21. Jahrhundert nur eine bewegte Geschichte – oder auch eine Zukunft?
«Kaum ein Politologe im Land, der so geistreich über Parteien und ihre gewandelte Rolle in der Gesellschaft zu schreiben vermag.» taz
«Wenige Politikwissenschaftler verfolgen das politische Alltagsgeschehen so lebhaft und können es so thesenfreudig mit historischem Wissen rückkoppeln wie Franz Walter.» DLF
Über Franz Walter
Franz Walter, geboren 1956, war bis Herbst 2017 Professor für Politikwissenschaft und Direktor des Instituts für Demokratiewissenschaft an der Universität Göttingen. Zuletzt hat er Bücher über Bürgerproteste, den politischen Tabubruch und das Gesellschaftsbild von heutigen Unternehmern publiziert. Der Geschichte der sozialistischen Parteien gehört sein stetes Augenmerk.
1.Handwerker und Intellektuelle. Die Sattelzeit
Will man Parteien mit einer langen Geschichte verstehen, dann lohnt sich ein genauer Blick auf die Genese, den Anfang, die Satteljahre. Die Primärerfahrungen bleiben im weiteren Verlauf haften, werden durch Kultur und Rituale auch bewusst erinnert und als Epos an die Nachgeborenen weitergegeben. Eine Partei, die sich in ihrer Entstehungszeit in harten Auseinandersetzungen gegen entschlossene Gegner durchsetzen und behaupten muss, produziert Legenden, Mythen, Helden und Märtyrer, auch Konvertiten und Verräter, also den gesamten Stoff, der nötig ist für «große Erzählungen». Eine solche Partei verschwindet nicht beim ersten Gegenwind. Sie verfügt schließlich über in scharfen Konflikten mit anderen sozialen und politischen Kräften gewachsene und stabilisierende Loyalitäten, die sich zu einem spezifischen Charakter verdichten, zur Tradition verfestigen. Wird eine derartige Organisation im Laufe der Jahre erneut von außen angefeindet, schließt sie sich ganz so, wie zu den Zeiten, als alles begann, abermals fest zusammen. Parteien dieser gesellschaftlichen Substanz und Dauer überleben selbst dann noch eine ganze Weile, wenn die Bedingungen ihrer Formierung und Gründung schon verschwunden oder überwunden sind. Darin liegt ihre Kraft und Beharrlichkeit. Aber vieles aus einer langen, stolzen Geschichte erweist sich auch als drückende Last, da politische Überzeugen regelmäßig zu starr kanonierten Glaubenssätzen verkümmern, da vitale Solidargemeinschaften aktiver Mitglieder währenddessen in konservativ abgekapselte Vereinsmeiereien übergehen. Linear verlaufen diese Prozesse indes nicht, da Parteien sich durch gesellschaftlichen Außendruck und neue Mitgliederzuflüsse fortbewegen können – sie lernen, sich zu korrigieren und zu wandeln.
Dies alles werden wir auch in der Geschichte der SPD finden. Lange Zeit war die Sozialdemokratie nicht nur einfach eine Partei, sondern auch – und zunächst sogar viel mehr – eine soziale Bewegung. Und bei sozialen Bewegungen lässt sich immer schwer sagen, wann genau sie sich gebildet haben. Exakte Entstehungsdaten gibt es keine, und so hat die SPD seit jeher einige Schwierigkeiten, ihr Gründungsjahr parteihistorisch verbindlich festzulegen. Meist lässt man die Geschichte der Sozialdemokratie mit Ferdinand Lassalle und seinem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) im Jahr 1863 beginnen; mitunter wird aber auch die Bildung der Arbeiterverbrüderung des Stephan Born im Zuge der Revolution von 1848 als Startschuss gefeiert. Das Jahr 1875, in dem sich die bis dahin verfeindeten Flügel der frühen Arbeiterbewegung in Gotha zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands organisatorisch zusammenrauften, gilt zuweilen ebenfalls als das eigentliche Konstituierungsdatum. Und für eher sozialhistorisch argumentierende Interpreten sind es schon die 1830er Jahre und die frühsozialistischen, im europäischen Ausland agierenden Handwerkervereine, mit denen all das begann, was später August Bebel, Otto Wels, Kurt Schumacher, Willy Brandt, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder und nach ihm etliche weitere fortsetzten.
Den Sozialdemokraten selbst ist es im Grunde ganz recht, dass es mehrere geschichtliche Ausgangspunkte ihrer Partei gibt – haben sie so doch genügend Anlässe, sich zu feiern und stolz auf ihre großen und langen Traditionen zu verweisen. Da die Diskussion über ein präzises historisches Gründungsdatum der Sozialdemokratie letztlich tatsächlich unergiebig ist, sollte man einfach offen formulieren: Irgendwann zwischen den 1830er und 1870er Jahren entstand in Deutschland – als Reaktion der neuen, industriellen Arbeiterklasse auf die Abhängigkeitsverhältnisse, Unsicherheiten und Krisen des neuen, industriellen Kapitalismus – die moderne Arbeiterbewegung.
Doch selbst das ist sogleich wieder zu relativieren – denn modern war die Arbeiterbewegung in ihren Anfängen nur bis zu einem gewissen Grad. Und auch die Arbeiterklasse, die sich sozialdemokratisch organisierte, war so neu nicht. Soziale Bewegungen fangen eben nicht bei null an, sie haben immer, gerade die erfolgreichen und dauerhaften unter ihnen, Wurzeln und Kraftquellen in der Vergangenheit. Die Fabrikarbeiter im Frühkapitalismus waren wirklich wurzel- und traditionslos; sie kamen aus der agrarischen Provinz, hatten keine Organisationserfahrung und keine gruppenbildenden Leitideen. Über all das verfügten jedoch die städtischen Handwerksgesellen jener Jahre: die Schriftsetzer, Scherenschleifer, Drechsler, Sattler oder Zimmerer. Sie wurden, ohne moderne Industriearbeiter zu sein, zu den Pionieren der neuen Arbeiterbewegung und prägten die Führungsschicht der deutschen Sozialdemokratie bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. Denn sie besaßen jene Ressourcen, die man braucht, um eine soziale Bewegung ins Leben zu rufen und ihr Schritt für Schritt Parteistrukturen zu verleihen: Organisationskompetenz, Selbstbewusstsein, Bildung, Leitziele, Kommunikationsfähigkeit und Mobilität.
Ihre Organisationskompetenz hatten die Handwerksgesellen über Jahrhunderte in den Zünften akkumuliert. Nicht weniges dieser alten Zunftstrukturen – etwa die Unterstützungskassen bei Krankheit, Invalidität und im Todesfall – floss in den 1860er und 1870er Jahren unmittelbar in die moderne Arbeiterbewegung ein. Die Handwerksgesellen verfügten über traditionsgesättigte Symbole und Rituale, Fahnen und Lieder, die auch innerhalb der neuen Arbeiterbewegung identitätsbildend wirkten. Zudem hatten sie schon in der altständischen Gesellschaft ihre Mobilität bewiesen. Nach ihrer Lehrzeit mussten die Gesellen auf Wanderschaft gehen, sodass sie ihre Organisationen und Ideen überregional vernetzen konnten. Ebendas wurde die Voraussetzung für eine nationale Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie in Deutschland.
Die Handwerksgesellen hatten einen ausgeprägten Berufsstolz und Ehrenkodex, und oft verfolgten sie das Ziel, Meister zu werden. Doch das alles geriet Mitte des 19. Jahrhunderts in Konflikt mit dem neuen Kapitalismus: Die Fabrikarbeit entwertete viele alte Berufe und Ehrvorstellungen und zerstörte nicht selten die Aufstiegshoffnungen der Gesellen. Aus dieser Spannung von traditionsgeleiteten Erwartungen und neuzeitlichen Enttäuschungen entstand das Protestpotenzial der Handwerksgesellen, resultierte ihr frühsozialistisches Engagement. Die moderne Sozialdemokratie in Deutschland geht mithin auf Mentalitäten der vormodernen, vorbürgerlichen, vorkapitalistischen, vorproletarischen Gesellschaft zurück. Diese Konstellation findet man häufig: Ganz moderne soziale Bewegungen nähren sich von Protestpotenzial, das aus der Verletzung alter Rechte hervorgegangen ist, aus der Missachtung traditioneller Einstellungen, aus der jähen Infragestellung früherer Sicherheiten und Gewissheiten.
Obwohl die neue Arbeiterbewegung also eine Menge rückwärtsgewandter Antriebselemente hatte, wies sie im Großen und Ganzen doch nach vorn, in die Zukunft. Auch das lässt sich bei sozialen Bewegungen oft genug beobachten: Die Energien, die entstehen, indem traditionelle Ansprüche aufgrund gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels nicht mehr erfüllt werden, verharren nicht in überlebten Organisationsstrukturen; sie führen nicht nur zu nostalgischen Defensivkämpfen, sondern zugleich zu neuartigen Aktionsmethoden, Postulaten und Forderungen. So auch bei der frühen Arbeiterbewegung. Schon bald war sie mehr als lediglich die kulturelle und organisatorische Verlängerung überkommener Zunftstrukturen, nämlich eine wirklich neue soziale Bewegung von Arbeitern, nicht von Gesellen. Die Gesellenproteste der vormodernen Zeit waren defensiver Natur, sie konzentrierten sich auf die Verteidigung alter Rechte. Die Arbeiterbewegung aber ging schnell in die Offensive, forderte neue Rechte, verlangte mehr Teilhabe und Mitwirkung. Und die Gesellen der verschiedenen Gewerbe verstanden sich zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich kollektiv als Arbeiter, da sie – im Falle von Krankheit, Invalidität, im Alter und hinsichtlich der kapitalistischen Konjunkturzyklen – die gleichen Risiken trugen und die gleichen Nöte litten. In diesem Lernprozess bildete sich die moderne Sozialdemokratie.
Doch zunächst handelte es sich dabei lediglich um eine Avantgarde, gleichsam den Vortrupp der entstehenden Arbeiterklasse. Mehr als einige tausend Mitglieder gehörten dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein in den 1860er Jahren nicht an. Ferdinand Lassalle hatte 1863, als er den Verein gründete, noch von hunderttausend gesprochen, die er rasch beisammenhaben wollte. Aber zu seiner großen Enttäuschung kamen die Massen anfangs nicht.
Man mag verwunderlich finden, dass gerade Lassalle, der jüdische Intellektuelle und Bohemien, der sein Geld als Anwalt verdiente, diejenige geschichtliche Figur wurde, die viele für den Gründer der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung halten.
Lassalle stammte aus Breslau, wo er im April 1825 geboren wurde, als Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers. Der Name der Familie schrieb sich damals «Lassal», was Sohn Ferdinand als junger Erwachsener mit 26 Jahren für sich in «Lassalle» modifizierte – wohl auch, um weniger Assoziationen zu seiner jüdischen Herkunft, die ihm unangenehm, zeitweise sogar verhasst war, zu wecken. Ferdinand Lassalle wollte hoch hinaus, schon als Kind. Und sein Vater, der den Sohn früh hätschelte, ja bewunderte, bestärkte ihn in seinem Ehrgeiz. Auch andere Ältere waren fasziniert, oft gar eingeschüchtert vom Temperament, vom Scharfsinn, der unglaublich raschen Auffassungsgabe und oratorischen Virtuosität Lassalles. Alexander von Humboldt, die Geistesgröße in Berlin zur Mitte des 19. Jahrhunderts schlechthin, sang adorierende Hymnen auf den jungen Genius. Heinrich Heine huldigte ihm – und fürchtete sich zugleich vor der hemmungslosen Egozentrik. Lassalle war stolz darauf, ein Mann der Tat zu sein. Die Großautoritäten des theoretischen Sozialismus jener Jahre hingegen, Karl Marx und Friedrich Engels, mochten Lassalle nicht sonderlich. Insbesondere Engels hatte für ihn beinahe nur Spott, bösartige Mokanzen übrig. Er konnte Lassalle regelrecht nicht ausstehen. Friedrich Engels war ein denkbar uneitler Charakter, der nie darunter litt, ein wenig im Schatten des anderen Genius, von Karl Marx also, zu stehen. Lassalle wiederum war an Eitelkeit kaum zu überbieten. Und so verhöhnte Engels ihn als «Gecken» mit der «überschnappenden Stimme», als «Schuft», als «Richelieu des Proletariats». Marx hatte einige Zeit einen etwas offeneren, faireren Blick auf Lassalle, als er dessen Stärken sah. Wie dieser, so hatte auch Marx eine besondere Schwäche für Frauen adeliger Herkunft. Aber Marx übertraf in seinen Invektiven gegenüber Lassalle seinen Freund Engels dann doch um einiges. Er, selbst jüdischer Herkunft, bezeichnete Lassalle als «Jüdel», den «Dunklen», einen «jüdischen Nigger». Aber nach dem frühen und überraschenden Tod Lassalles im Duell sandten selbst Marx und Engels, die verlässlichen Spötter, nun respektvolle Kondolenzbriefe nach Deutschland, in denen sie Lassalle als den «einzigen Kerl in Deutschland» bezeichneten, der schon deshalb ihr Freund gewesen sei, weil er als Feind der Bourgeoisie agiert habe.
Mitte April 1862 hatte Lassalle mit einer Rede vor Berliner Arbeitern, die anschließend als «Arbeiterprogramm» publiziert wurde, auch in Sachsen Aufmerksamkeit erregt. Arbeiter in Leipzig zeigten sich so beeindruckt, dass sie Ende des Jahres Lassalle die Anführerschaft einer neuen Arbeitervereinigung antrugen. Lassalle bestand auf einer formell korrekten, offiziellen Aufforderung, die dann im Februar 1863 eintraf. Daraufhin sandte Ferdinand Lassalle am 1. März 1863 ein «offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig» ab, das gleichsam zur Programmschrift der frühen deutschen Sozialdemokratie avancierte. Ende Mai 1863 gründete sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) und bestimmte Ferdinand Lassalle für die Dauer von fünf Jahren zu seinem Präsidenten. Gemäß dem «Antwortschreiben» seines neuen Präsidenten zielte der ADAV zuvörderst auf die Einführung eines allgemeinen und gleichen Wahlrechts, schließlich auf die Bildung von Produktivgenossenschaften mit Hilfe staatlicher Förderung. Der Staat spielte im Denksystem des Hegelianers Lassalle eine ausschlaggebende Rolle; mittels seiner sollte sich die sittliche Idee des Sozialismus vollziehen und erfüllen.
Den Liberalismus dagegen verachtete der Präsident des ADAV in den letzten Jahren seines Lebens geradezu. Die «Fortschrittspartei» der liberalen Bürger war ihm gar der Hauptfeind schlechthin – nicht die Konservativen, nicht die Junker, nicht der Adel. Mit Bismarck konnte der Chef der Sozialisten stundenlang angeregt parlieren. Dieser, der preußische Ministerpräsident, war wenigstens ein wirklicher «Mann». Hingegen die Liberalen: «Alte Weiber», wie Lassalle gerne in seinen Ansprachen sarkastisch ausspie. Das Bündnis der Arbeiter mit der liberalen Bourgeoisie, hämmerte Lassalle seinen Zuhörern ein, sei auf immer vorbei.
Aber dann traf er bei seiner Kur in Kaltbad auf dem Rigi in der Schweiz auf Helene von Dönniges, die attraktive 18-jährige Tochter des Historikers und bayerischen Diplomaten Wilhelm von Dönniges. Ihretwegen starb Lassalle am 31. August 1864 im Duell, nur 15 Monate nachdem er die Präsidentschaft des ADAV übernommen hatte.
Mit seinem Tod setzte in der Arbeiterbewegung ein regelrechter Lassalle-Kult ein, der bis zum Ende der Weimarer Republik die sozialdemokratischen Festivitäten prägte. Stets sang man dort die Arbeiter-Marseillaise, die zur Totenfeier von Lassalle einen neuen Refrain erhalten hatte:
«Nicht zählen wir den Feind,
nicht die Gefahren all!
Marsch, Marsch, Marsch, Marsch
der kühnen Bahn nun folgen wir die uns geführt Lassalle!»
Im Grunde war dieser Kult, der in den 1860er und 1870er Jahren in höchster Blüte stand, nur schwer nachvollziehbar, wenn man die genauen Umstände von Lassalles Tod reflektiert. Hier hatte sich kein heldenhafter Sozialist im selbstlosen Kampf für die proletarische Sache geopfert. Hier war ein eitler Mann im anachronistischen Duell gefallen, weil ihm ein junges Mädchen, das er kaum näher kannte, nach einigen glühenden Liebesbekundungen unerwartet schnippisch die kalte Schulter gezeigt hatte. Nur: Lassalles Anhänger wussten nichts Genaues von dem, was sich da in der fernen Schweiz wirklich ereignet hatte. Die Gerüchte, die umherschwirrten, gingen vorwiegend in die Richtung, dass die feudale Reaktion den tapferen Freiheitskämpfer Lassalle in die Falle gelockt und hinterhältig niedergestreckt habe. Lassalle sei demnach als kühner und unbestechlicher Vorkämpfer für das Anliegen des Proletariats und dessen Befreiung gestorben. Daran glaubten Anhänger des ADAV noch viele Jahre später.
Damit war die Art und Weise vorgezeichnet, wie in der frühen deutschen Arbeiterbewegung Lassalles gedacht, wie mit der Erinnerung an ihn umgegangen wurde. Der 31. August, der Todestag des ADAV-Chefs, war für rund zwei Jahrzehnte der Feiertag dieses Teils der Arbeiterbewegung schlechthin. Die Katholiken pflegten ihre Prozessionen am Fronleichnamstag; die protestantischen Bürger erbauten sich seelisch am Sedanstag, hissten ihre Fahnen mit den schwarz-weiß-roten Farben; und die neue sozialistische Bewegung gedachte, jeweils einen Tag vor dem Sedansfest, feierlich Ferdinand Lassalles nahezu im Stil einer religiösen Messe, liturgisch wie in den christlichen Kirchen. In dieser jährlichen Zeremonie verkörperte Lassalle den neuen, wiedergekehrten Nazarener, den Heiland und Messias des 19. Jahrhunderts.
Doch zu Lebzeiten zeichnete Lassalle unzweifelhaft politischer Instinkt aus, der Sinn für den historischen Moment, überdies die entschlossene Handlungskraft, um eine sich bietende Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen. Auch gehörten bei ihm Tat und Gedanken eng zusammen; Politik verstand er als die Praxis der Idee. Ein begründungs- und zielloser Pragmatismus kann sich jedenfalls nicht auf Lassalle berufen. Seine Vorliebe für einen genossenschaftlichen Sozialismus ist vielleicht zu Unrecht rasch in Vergessenheit geraten. Seine Insistenz auf die Organisation hat die Arbeiterbewegung in Deutschland lange geformt, hat ihr in schwierigen Zeiten Rückzugsräume, Personal, Fundament und Krisenresistenz verliehen. Mit seinem Einsatz für das allgemeine Wahlrecht und für Wahlagitation hat er die sozialistische Bewegung gewissermaßen zivilisiert, von geheimbündlerischen Träumen und Praktiken abgetrennt. Aber Lassalle war auch ein plebiszitärer Populist. An die parlamentarische Demokratie dachte er nicht, wenn er über die Wege der Revolution – die ihm immer näherstand als die langsame Reform – nachsann. Daher war die neue Partei auch auf ihn zugeschnitten, den präsidialen Charismatiker, der zentralistisch vorgab, wohin das arbeitende Volk zu gehen hatte. Auch das gehört zum Erbe, das Lassalle der Arbeiterbewegung in Deutschland hinterließ.
Schon der wichtigste seiner Nachfolger trat es an: Johann Baptist von Schweitzer. Es gehörte fraglos zu den Eigentümlichkeiten der neuen sozialistischen Bewegung, dass ihre Gründungspatrone und Protagonisten weder aus der Arbeiterklasse stammten noch recht eigentlich intime Kenntnisse der proletarischen Verhältnisse besaßen. Der eine, Ferdinand Lassalle, war ein berüchtigter Salonlöwe, Liebhaber schöner Frauen und exquisiter Weine, ein früher Rentier und Bohemien; der andere, Johann Baptist von Schweitzer, war Sprössling einer Frankfurter Patrizierfamilie, promovierter Jurist und Autor von Theaterstücken, ein Komödiant. Sein politisches Engagement zielte anfangs auf die nationale Bewegung in den Turn- und Schützenvereinen, in denen er jeweils führende Funktionen innehatte. Danach konzentrierte sich seine Aktivität auf die Arbeiterbildung. Dann aber kam er in seiner Frankfurter Heimatgegend politisch nicht mehr voran, da er wegen Päderastie in Mannheim im Gefängnis eingesessen hatte, was zu seiner Ächtung im Arbeitervereinswesen am Main geführt hatte. Von Schweitzer siedelte nach Berlin über, kam mit Ferdinand Lassalle zusammen, gründete die neue Parteizeitung, den Socialdemokrat. 1867 rückte er dann ganz an die Spitze des ADAV, gelangte überdies als Abgeordneter in den Norddeutschen Reichstag.
1868 war von Schweitzer ohne Zweifel die zentrale Führungsfigur in der sozialdemokratischen Bewegung. Diese stieß allerdings – junge politische oder soziale Bewegungen pflegen sich gerade zu Beginn zu spalten und mit einer gehörigen Portion Unversöhnlichkeit miteinander zu streiten – auf die erbitterte Gegnerschaft der leitenden Figuren der zweiten sozialdemokratischen Organisation, nämlich August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Der Parteihistoriker Franz Mehring attestierte später von Schweitzer, in jenen Jahren «der am klarsten und schärfsten blickende Sozialist auf deutschem Boden» gewesen zu sein. Erst durch ihn wurde die kleine Sekte, die Lassalle geschaffen hatte, zu einer schlagkräftigen, verhältnismäßig geschlossenen, taktisch verblüffend klug operierenden Formation. Im Vergleich zu Wilhelm Liebknecht, dem ewigen 1848er und Romantiker des politischen Kampfes, hatte von Schweitzer, eifriger Rezipient der Schriften Machiavellis, einen analytischen, illusionslosen Blick für politische Kräfteverhältnisse und Handlungsmöglichkeiten. «Kein anderer deutscher Arbeiterführer», schrieb ein weiterer Historiker der Sozialdemokratie, Gustav Mayer, «hatte so wenig wie er vom Ideologen in sich.» Wie Ferdinand Lassalle, so besaß auch von Schweitzer einige Bewunderung für die meisterlichen politischen Schachzüge Bismarcks. Und wie Lassalle, vielleicht gar noch stärker als dieser, baute auch von Schweitzer seine Parteiführung in der jungen Sozialdemokratie autokratisch aus, strebte einen sozialistischen Bonapartismus bzw. Cäsarismus an.
Mit solch maßlosen Ambitionen entfachte und stärkte von Schweitzer allerdings oppositionelle Kräfte im eigenen Lager, was dazu führte, dass er 1871 von der politischen Bühne abtrat – wenngleich er mit der ihm eigenen Raffinesse zuvor noch versucht hatte, die Mitglieder der Partei gegen die ihm zusetzenden Delegierten und Aktivistenkader auszuspielen. Aber auch die Genossen an der Basis hatten sich zuletzt mehr und mehr von ihm abgewandt. Zu sehr war seine persönliche Integrität ins Gerede gekommen. Von Schweitzer liebte die Annehmlichkeiten eines luxuriösen Lebens, ohne sich ein solches materiell leisten zu können. Er verschuldete sich hier, pumpte sich dort etwas, konnte das Geld nicht zurückzahlen und griff – so warf man ihm zumindest vor – beherzt selbst in die Kasse des Arbeitervereins. Infolgedessen galt er vielen Historikern der Arbeiterbewegung als eine «dekadente», «moralisch zweifelhafte» und «derangierte» Persönlichkeit. Doch leugneten die meisten Autoren nicht von Schweitzers besondere Verdienste um den Ausbau und die Festigung der Sozialdemokratie, wenngleich ihn vor allem August Bebel, Friedrich Engels und Karl Marx inbrünstig verachteten und schmähten.
Karl Marx’ Schriften trugen in den darauffolgenden Jahrzehnten zur großen Sinnstiftung der sozialistischen Bewegung bei. Nach und nach eigneten sich die führenden deutschen Sozialdemokraten die Analysen und Prognosen von Marx an und verbreiteten eine Art volksmarxistische Version in der Anhängerschaft der Partei. Marx war im Grunde ein Geschöpf des bürgerlichen Zeitalters, der Aufklärung, des Rationalismus, der Ehrfurcht vor Erkenntnis, Wahrheit, Wissenschaft. Marx war ein Forscher aus Leidenschaft. Tag für Tag saß er stundenlang in der Bibliothek des British Museum, las auch noch die entlegensten Bücher, exzerpierte unermüdlich – um sich und seine Ansicht immer wieder aufs Neue zu korrigieren. Abends ging es dann zu Hause bis in die Nacht weiter, in einem mit Büchern, Blättern und Manuskripten vollgestopften Arbeitszimmer, das für Außenstehende einen chaotischen Eindruck gemacht haben muss. Leicht machte es sich Marx mit seinem unbändigen Lesehunger nicht. Denn er fand nie ein Ende, ließ es nie genug sein. Der Imperativ des Zweifels – auch an sich selbst – war ihm Elixier, ehernes Gebot und: Plage wie Paralyse. Es ging ihm da wie anderen weit überdurchschnittlich begabten Geistern. Ihre Ansprüche sind hoch, die an sich selbst angelegten Maßstäbe oft kaum erreichbar. Das Opus, das sie schaffen wollen, soll einzigartig, komplett, vollendet sein, im höchsten Glanz erscheinen, noch nach Jahrzehnten Bestand und Gültigkeit haben. Solche Ambitionen spornen zunächst an, aber sie lähmen auch, umso mehr, je näher der Termin der Werkvollendung rückt. Das galt auch für Marx. Er brauchte Jahre, ja Jahrzehnte für seine großen Analysen zur Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft; das meiste brachte er gar nicht erst zum Abschluss, mochten auch seine Freunde drängen, wie sie wollten. Marx war kein Autor, der diszipliniert schrieb, Fristen und Verträge einhielt. Meist flüchtete er sich, wenn es ernst wurde, in Krankheiten. Er war ein großer Hypochonder, bekam aber auch wirklich die somatischen Folgen zu spüren. Seine Leidensgeschichte mit all den Furunkeln und Karbunkeln an den empfindlichsten Körperstellen wurde hernach in der Medizin- und Psychologiegeschichte des Sozialismus legendär.
Weit leichter gingen Marx seine zahllosen Pamphlete von der Hand, in denen er seine ebenso unzähligen Gegner «vernichtete». Häme, Sarkasmus, Sottisen – darüber verfügte Marx überreichlich. Er konnte über die unbedeutendsten Köpfe seiner Zeit Hunderte von Seiten zwar boshafter, aber brillanter Polemik verfassen, Seite für Seite gefüllt mit ebenso funkelnden wie verächtlichen Aperçus. In dieser Art, in der Marx seine Widersacher intellektuell zerfetzte, blieben ihm die späteren Epigonen des «Marxismus» treu. Die Negation war jedenfalls die stärkste Seite von Karl Marx. Oder freundlicher ausgedrückt: die Kritik. Marx bestach durch seine Kritiken – an Hegel, an Feuerbach, an der Ökonomie des Kapitalismus, am Gothaer Programm der jungen deutschen Sozialdemokratie. Immer konnte Marx messerscharf sezieren, wo die Aporien lagen, wo der Schein das reale Sein überdeckte, wo Texte ins Phrasenhafte abrutschten. Er dachte weniger über präzise Alternativen, über Wege, Techniken und Instrumente des anderen nach. Dergleichen tat er hochfahrend als kleinbürgerliche Utopisterei und philiströse Spekulation ab. Auch sprachen aus seinen sozialistischen Schriften kein Altruismus, keine Wärme, kein Mitgefühl. Man gewann nicht den Eindruck, dass da jemand mit dem Subjekt seiner Geschichtsphilosophie, dem Proletariat, mitlitt. Sein primäres Interesse galt der bürgerlichen Gesellschaft, der inneren Dynamik des Kapitalismus. Davon war er zutiefst erregt: von der mächtigen Expansionskraft der kapitalistischen Produktionsweise, von der Wucht, mit der sie territoriale Grenzen einriss und sich international ausdehnte – niemand sonst hat die Globalisierung so früh und hellsichtig antizipiert wie eben Marx bereits in den 1840er Jahren, als die Mehrheit der europäischen Nationen noch tief in der Feudalität steckte.
Marx war fasziniert vom Kapitalismus, beeindruckt auch von der Fortschrittsfähigkeit des Bürgertums. Und zugleich hasste er dies alles. Nichts charakterisierte das Leben des deutschen Emigranten im Londoner Exil mehr als die stete Spannung von extremem Leistungswillen und düsterer Destruktivität, von Suche nach Zuneigung und triebhafter Zerstörung der meisten Freundschaften. Marx wollte Meister sein, in philosophischen Runden, im Kommunistenbund, in der sozialistischen Internationale. Doch zugleich konnte er gläubige und beflissene Jünger nicht ertragen; er wies sie hochmütig und kalt von sich ab. Die besten Freunde – mit Ausnahme des kommunistischen Fabrikanten Friedrich Engels – gerieten früher oder später zu abgründig gehassten Feinden. Aus dieser Spannung zog Marx viel Energie – allerdings auch in schlimmer autoaggressiver Hinsicht.
Ferdinand Lassalle (1825–1864), Sohn großbürgerlicher Eltern, gilt als Begründer der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in Deutschland. Er war eine charismatische Persönlichkeit und hatte große politische Pläne. Doch starb er früh, 39-jährig, in einem Duell. Reichskanzler Bismarck sagte in einer Reichstagsdebatte im September 1878 über ihn: «Lassalle war ehrgeizig im hohen Stil, und ob das deutsche Kaisertum gerade mit der Dynastie Hohenzollern oder mit der Dynastie Lassalle abschließen solle, das war ihm vielleicht zweifelhaft.»
Der exilierte Marx gehörte zu jenen gesellschaftlich eher randständigen, politisch jedoch ehrgeizigen Intellektuellen, deren Zusammenspiel mit bildungsbeflissenen Handwerksgesellen charakteristisch für die frühe deutsche Sozialdemokratie war. Schon die wandernden Gesellen der 1830er Jahre hatten in Paris, Zürich und London emigrierte Intellektuelle kennengelernt – und mit ihnen so manche sozialistische Utopie. Bis 1933 trifft man in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie oft auf den Typus des marginalisierten, beruflich blockierten, religiös oder politisch geächteten Bildungsbürgers, der in der Arbeiterbewegung einen Platz und nicht selten auch eine Führungsrolle suchte. Dieser «Konvertit» hatte sich an seiner Herkunftsklasse wund gerieben, sich über deren haltlosen Opportunismus und mangelnden Idealismus empört und sodann in der Arbeiterklasse den neuen kollektiven Heiland entdeckt. Das wurde oft genug noch alttestamentarisch überhöht: Jenen Intellektuellen galt der Sozialismus als Erlösungsbotschaft für die gesamte Menschheit; und sie selbst sahen sich gern als Auserwählte, jeder für sich ein Moses, der das Volk in das gelobte Land der klassenlosen Gesellschaft führen würde. Das Gros der ehrgeizigen revolutionären Intellektuellen interessierte sich dabei nicht sonderlich für die Alltagsnöte und Problemlösungen der unteren Schichten. Die authentische Volks- und Arbeiterkultur mit ihren derben Sitten, oft brutalen Umgangsformen – alkoholgeschwängert, schmutzig, zotig – bereitete ihnen vielmehr Unbehagen, ja: Ekel. Die Intellektuellen dachten, wenn sie die geschichtliche Rolle der Massen priesen, an den lesenden, bildungsbeflissenen, disziplinierten Arbeiter der Bildungsvereine. Dieser rezipierte, was jene formulierten; der Arbeiter sollte in die Richtung gehen, die ihm die Intellektuellen wiesen.
Bildung war jedenfalls das Zauberwort für jene Handwerksgesellen, welche die frühe Sozialdemokratie begründeten. Das zweite Zauberwort in diesen Kinderjahren der Arbeiterbewegung lautete «Assoziation». Und als drittes kam noch die «Produktivgenossenschaft» hinzu, die als Leitidee allerdings sehr viel schneller an Kraft verlor und die sozialdemokratische Arbeiterbewegung längst nicht so durchdrang und festlegte wie eben «Assoziation» oder «Bildung». Alles in allem spiegelte diese Trias frühsozialistischer Identität die Verhaltensmaßstäbe, die Gruppenmoral, auch die Wunschvorstellungen, Träume und Hoffnungen der Handwerker und der qualifizierten Arbeiter. Es war ein gut organisierter, selbstverwalteter, ausbeutungsfreier Werkstattsozialismus, nach dem die Pioniere der deutschen Sozialdemokratie strebten.
Ungelernte Arbeiter ließen sich davon jedoch weniger faszinieren; und überhaupt sollte die Kluft zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern in der deutschen Sozialdemokratie lange Zeit fortbestehen: Die Sozialdemokratie war von Beginn an Bewegung und Partei der disziplinierten, ehrgeizigen, aufstiegswilligen Arbeiter; jene, die über diese Tugenden und Einstellungen nicht verfügten, fremdelten ihr gegenüber oft, gehörten nicht zu ihren treuen Anhängern und standen in Krisenzeiten schnell abseits oder in anderen politischen Lagern.
Und schließlich gab es ebenfalls von Anfang an die innersozialistischen Streitigkeiten, Flügelkämpfe und Spaltungen, die so typisch für die Geschichte der Arbeiterbewegung wurden. Die meisten Arbeitervereine machten schon 1863 nicht mit, als Lassalle die autonome Arbeiterpartei ausrief; die Mehrheit verblieb im Organisationsrahmen des liberalen Bürgertums, bis sich 1869 in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei als zweite eigenständige Formation der Arbeiterschaft und des Sozialismus konstituierte. Deren Anführer waren August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Dieser zweite Flügel der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung war weniger zentralistisch, weniger autokratisch als der von Lassalle geformte. Im Übrigen unterschied man sich in der nationalen Frage: Die Lassalleaner hielten zu Preußen, die Richtung Bebel/Liebknecht bevorzugte die großdeutsche Lösung. Besonders in den ersten Jahren ging es zwischen den Angehörigen der beiden Parteien ziemlich rüde zu. Sie sprengten einander die Veranstaltungen, beschimpften und prügelten sich zuweilen. Erst in den frühen 1870er Jahren, als die Kontrahenten gleichermaßen Opfer staatlicher Kriminalisierung und Illegalisierung waren, hörte der Kleinkrieg auf. Hinzu kam die wirtschaftliche Krise, die nach dem Gründerkrach 1873 einsetzte. Beides zusammen, der Druck des Obrigkeitsstaates wie der kapitalistischen Depression, brachte die verfeindeten Lager des frühen Sozialismus einander rasch näher, ja einte die Sozialdemokratie: 1875 wurde in Gotha die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands gegründet.
2.Nicht revolutionär, nicht reformistisch. Unter der Monarchie
Karl Marx spuckte Gift und Galle gegen das Programm, das sich die vereinte Sozialdemokratie gab. Mit dem ihm eigenen boshaften Scharfsinn sezierte er die Widersprüche, Ungereimtheiten und «lassalleanischen Phrasen» des Gothaer Programms. Doch die Philippika des im Londoner Exil lebenden sozialistischen Meisterdenkers drang nicht recht nach Deutschland durch. Sie hätte auch nicht viel bewirkt, denn die deutschen Sozialdemokraten wollten den lästigen Parteienstreit im eigenen Lager endlich beilegen; auf theoretischen Glanz kam es ihnen in dieser Situation kaum an. Überhaupt echauffierte sich Marx 1875 im Grunde ganz unnötig: Die Zeit des «Lassalleanismus» lief in den 1870er Jahren ohnehin ab, die Zahl der «Marxisten» in der deutschen Arbeiterbewegung dagegen nahm stetig zu. Der massive politische und ökonomische Druck, der die Arbeiterbewegung in diesem Jahrzehnt einte, war zugleich der Resonanzboden für die Verbreitung marxistischer Ideen und Begrifflichkeiten.
Nur selten zuvor hatten die Arbeiter in Deutschland die Klassengesellschaft und den Klassenstaat als so bedrohlich, rücksichtslos und demütigend empfunden wie in den 1870er Jahren. Auf den Gründerkrach 1873 folgte eine langanhaltende wirtschaftliche Stagnation. Firmenzusammenbrüche und Entlassungen häuften sich, Streiks blieben erfolglos, und bald war die gewerkschaftliche Gegenmacht empfindlich geschwächt. Zum Ende des Jahrzehnts führte ein Bündnis von Konservativen und Rechtsliberalen überdies noch die Schutzzollpolitik ein, durch die sich importiertes Getreide verteuerte, wodurch wiederum die Lebensmittelpreise erheblich stiegen. So gerieten die städtischen Arbeiter ökonomisch und sozial mehr und mehr in Bedrängnis.
1878 verübten zwei von wirren politischen Ideen geleitete Männer, Max Hödel und Karl Nobiling, Attentate auf den Kaiser. Reichskanzler Bismarck nutzte dies, um seinen größten innenpolitischen Gegner auszuschalten, und brachte das «Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie» durch den Reichstag. Die sozialdemokratische Partei war fortan verboten. An diese bitteren und gleichzeitig prägenden Jahre für die deutsche Sozialdemokratie erinnerte sich August Bebel 1903: «Die Schläge fielen hageldicht, alles wurde zertrümmert …, Hunderte und wieder Hunderte von Genossen wurden brotlos … Wir wurden wie räudige Hunde aus der Heimat hinausgetrieben.»
Gewiss: Eine solche Krisensituation war für Arbeiter keine ganz ungewöhnliche Erfahrung, und sie allein hätte die deutsche Sozialdemokratie wohl nicht für marxistisches Vokabular geöffnet; da mussten noch die politische Entrechtung, ja die gesellschaftliche Stigmatisierung hinzukommen, welche die Sozialdemokraten zwischen 1878 und 1890 erlebten. Dies war die Zeit des Sozialistengesetzes, mit dem Reichskanzler Otto von Bismarck die Sozialdemokratie zu zerschlagen suchte. Als im Mai und im Juni 1878 zwei Psychopathen Attentate auf den greisen Kaiser Wilhelm I. verübten, instrumentalisierte Bismarck dieses Ereignis kurzerhand und boxte das «Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie» durch den Reichstag. Dabei waren die beiden Attentäter gar keine Sozialdemokraten: Der eine zählte zu den Anhängern des antisemitischen Hofpredigers Adolf Stoecker, der andere sympathisierte mit den Nationalliberalen. Aber darauf achtete in der Hysterie, die nach den Schüssen auf den Kaiser Oberhand gewann, kaum jemand; fast herrschte eine Art Pogromstimmung gegen die Sozialdemokraten. Bismarck, der sich vor der «Partei des Umsturzes» fürchtete, nutzte das kühl kalkulierend aus. Und so wurde die Parteiorganisation in den nächsten zwölf Jahren verboten, ebenso die Gewerkschaften; die sozialdemokratischen Zeitungen mussten ihr Erscheinen einstellen, und ein großer Teil der Parteielite – Agitatoren, Journalisten und Organisatoren – kam unter Anklage, landete in Zuchthäusern, wurde ausgewiesen oder zur Emigration gezwungen. Und stets bekamen sie das brandmarkende Verdikt von den «vaterlandslosen Gesellen» höhnisch hinterhergeschickt.
Nur wenige andere Phasen in der deutschen Geschichte haben die Sozialdemokraten so nachdrücklich und dauerhaft geprägt wie die Zeit unter dem Sozialistengesetz. Sie wurden verachtet, verfolgt und beleidigt, sie fühlten sich gedemütigt – und das von allen gesellschaftlichen Kräften. Anfangs hatten sich lediglich Nationalliberale und Konservative hinter die Bismarck’sche Verbots- und Unterdrückungspolitik gestellt; später dann, als das Sozialistengesetz verlängert werden musste, fand sie aber auch die Unterstützung von Zentrumsabgeordneten und Linksliberalen. Das wurde zum Urerlebnis der Sozialdemokraten im Umgang mit sozialen und politischen Gruppen: Seither taten sie sich schwer mit bürgerlichen Bündnispartnern und misstrauten prinzipiell der Charakterfestigkeit deutscher Liberaler. Seither teilten sie die Gesellschaft streng in Gut und Böse auf, in «wir und die anderen».
Von nun an herrschte in der Sozialdemokratie der marxistische Jargon vor. Natürlich wurden nicht alle sozialdemokratischen Arbeiter zu eifrigen und verständigen Lesern des bekanntlich ziemlich sperrigen Marx’schen Werks; man las eher – und auch das gilt bloß für eine kleine Minderheit – die popularisierten Fassungen von Friedrich Engels oder Karl Kautsky. Nein, es waren Schlagwörter und einzelne Begriffe aus dem Marx’schen Erklärungsarsenal, die damals die Runde machten. Lassalle hatte noch auf den Staat gesetzt, auch auf den preußischen und den Bismarck’schen; aber diese Position hatte mittlerweile jeden Rückhalt verloren. Der Staat galt den Sozialdemokraten nun unzweifelhaft als Klassenstaat. Im Marx’schen Duktus bezeichnete man sich selbst als «Proletariat», die anderen, die Herrschenden, als «Bourgeoisie». Von Marx hatte man überdies die Deutung übernommen, dass alle Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen sei, und die Gewissheit, dass aus ihnen die Proletarier als historische Gewinner hervorgehen müssten. Die Arbeiterklasse würde am Ende die Bourgeoisie enteignen und eine ausbeutungsfreie Gesellschaft der Gleichen einrichten, ohne soziale Not, ohne polizeiliche Repression, ohne großen Arbeitsdruck. So musste es kommen – schließlich hatte Karl Marx es prognostiziert. In den schwer erträglichen Jahren der Unterdrückung jedenfalls glaubten immer mehr sozialdemokratisch orientierte Arbeiter bereitwillig an diese Lehre.
Es war die Mischung aus Religionsersatz und Wissenschaftsanspruch, die damals gerade die Elite der sozialdemokratischen Facharbeiter faszinierte. Viele von ihnen hatten sich soeben erst von der Kirche gelöst, aber damit nicht schon alle Heilsbedürfnisse hinter sich gelassen. Allerdings suchten sie nicht nach einer rein spirituellen Alternative, einem rein metaphysischen Ersatz für die aufgegebene Kirchlichkeit. Die lernbegierigen Facharbeiter dieser Zeit begeisterten sich vielmehr für die Naturwissenschaften; sie lasen allerlei einschlägige Traktate und vor allem auch Charles Darwin. Dies ergänzte sich mit ihrem Interesse an den popularisierten Formen des Marxismus, etwa an den Broschüren des Parteitheoretikers Karl Kautsky. Denn hier, in den Schriften Kautskys, verband sich Heilsversprechen mit wissenschaftlichem Anspruch, war der Chiliasmus gleichsam Naturgesetz. Die sozialdemokratischen Arbeiter glaubten nicht einfach an das sozialistische Endziel, sie wussten, dass es dazu kommen würde, weil es Folge und Ergebnis der gesellschaftlichen Entwicklung war. Dieses Verständnis von Politik und Gesellschaft wurzelte tief in der deutschen Sozialdemokratie und hielt sich dort noch ganze acht Jahrzehnte – zum Guten wie zum Schlechten: Die Sozialdemokraten standen zueinander selbst in schwierigen Zeiten, denn sie vertrauten auf die letztlich segensreiche «Entwicklung»; aber sie versteckten sich oft genug auch passiv und einfallslos hinter ihr, wo sie doch hätten vorpreschen, Einfluss nehmen und gestalten können.
Besonders Karl Kautsky (1854–1938) sorgte für die Verbreitung der Marx’schen Ideen in der deutschen Arbeiterbewegung. In den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts galt er als «Cheftheoretiker» der Sozialdemokratie. Er lieferte dem Parteiführer Bebel die entscheidenden theoretischen Stichworte, und zusammen mit Eduard Bernstein verfasste er das Erfurter Programm von 1891. Nach der Jahrhundertwende ließ sein Einfluss auf die Sozialdemokraten deutlich nach; in dem Moment, wo diese zu einem politischen Faktor wurden, handeln und sogar regieren mussten, war mit seinem verstaubten Determinismus nicht mehr viel anzufangen.
Während der Zeit des Sozialistengesetzes aber stärkte und festigte der optimistische marxistische Entwicklungsglaube die Sozialdemokratie zweifellos; die Zukunftsgewissheit spendete Trost, verlieh Kraft und gab Zuversicht. Mit dem Marxismus ließen sich politische Unterdrückung und soziale Not besser ertragen, und überhaupt empfand man ihn als attraktives, anziehendes Denkgebäude. Am Ende jedenfalls war Bismarck gescheitert: Der Reichskanzler hatte die Sozialdemokratie nicht zerstört, sondern größer gemacht. Zum Ausgang des Sozialistengesetzes vereinten die sozialdemokratischen Kandidaten bei den Reichstagswahlen dreimal mehr Stimmen auf sich als in der Zeit des Erlasses. Auch das prägte die Sozialdemokraten zutiefst: Sie hatten gelitten, man hatte sie ausgegrenzt und isoliert, aber schließlich waren sie erfolgreich. So zog es sie noch über Jahrzehnte – mitunter geradezu magnetisch – in die Pariastellung. Die Sozialdemokraten liebten es geradezu, zu leiden. Ihnen gefiel die Rolle des Ausgestoßenen, des Geächteten und Verfemten und dementsprechend die des Märtyrers, des Helden, der sich, aufrecht und anständig, dem Druck der Herrschenden nicht beugt und auf diese Weise über alle Feinde siegt. Unter dem Sozialistengesetz schufen sich die Sozialdemokraten ihr Epos, ihre Legende, aus der sie immer dann zitierten, wenn sie in Bedrängnis gerieten. Daran klammerte sich 1933 auch Otto Wels, als er dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten entgegentrat und in der Kroll-Oper trotzig ausrief: «Das Sozialistengesetz hat die Sozialdemokratie nicht vernichtet. Auch aus neuen Verfolgungen kann die deutsche Sozialdemokratie neue Kraft schöpfen.»
Die bürgerlichen und feudalen Kräfte hatten die Sozialdemokratie unter dem Sozialistengesetz in die Isolation getrieben. Aber die marxistische Sozialdemokratie fand allmählich Geschmack an dieser Isolation, ja verschärfte sie noch durch ihren exklusiven Missionsanspruch, durch ihre radikale Klassenkampf- und Revolutionsrhetorik. Ihre Anhänger grenzten sich nach Aufhebung des Sozialistengesetzes sogar selbst und freiwillig ab, verließen beispielsweise auch solche – und keineswegs wenigen – «bürgerlichen» Freizeit- und Bildungsvereine, die gegen sozialdemokratische Arbeiter gar nichts hatten. Sie errichteten sich ihre eigene Welt, ihr separates Milieu, getragen von zahlreichen Kultur-, Sport- und Geselligkeitsvereinen. Der Sozialismus in Deutschland wurde zum Milieu- und Vereinssozialismus, streng abgeschottet von der bürgerlichen Organisations- und Lebensform.
Insofern hat das Sozialistengesetz die Arbeiterbewegung, wenn man so will, in die Gegenkultur getrieben, sie stärker nach links gerückt, weg von Lassalle, hin zu Marx. Auf der anderen Seite haben die Jahre der Unterdrückung – paradoxerweise und natürlich unbeabsichtigt – aber auch die moderaten und reformistischen Grundströmungen innerhalb der deutschen Sozialdemokratie gefördert. Die autarke Welt des sozialdemokratischen Milieus etwa, die damals entstand, radikalisierte nicht die Arbeiter, sondern dämpfte eher ihren Aktionismus, ihre Militanz, ihr revolutionäres Draufgängertum. Die «Milieusozialisten» wurden mehr und mehr Vereinsmeier, richteten sich, nicht unzufrieden mit dem Alltag, den man darin hatte, in ihren Gesangs-, Wander- und Sportclubs ein.
Das war nicht nur Spießbürgerlichkeit, sondern durchaus eine imposante Eigenkultur, eine große Organisationsleistung der Arbeiter, die auch der Emanzipation diente. Im sozialdemokratischen Bildungswesen beispielsweise lernten sie hinzu, was die staatlichen Volksschulen ihnen vorenthalten hatten. Aber das Milieu war keine Trainingsstätte, kein Katapult für die revolutionäre Tat. Vielmehr milderte es die Verbitterung der sozialdemokratischen Arbeiter, ihre Wut auf den Staat und die Herrschenden. Über ihr Milieu fanden sie einen festen Ort im Kaiserreich, nicht im Zentrum des Systems, nicht anerkannt von den mittleren und höheren Schichten, aber im Ganzen – vor allem nach der Zeit des Sozialistengesetzes – doch gesichert und geschützt. Sie mussten nicht im Untergrund leben und hatten keinen blutigen Terror von oben zu befürchten. Finster entschlossene Revolutionäre waren die sozialdemokratischen Vereinsmeier in Deutschland daher nicht. Sie hatten sich eine Heimat aufgebaut, ihre soziale und kulturelle Nische bewohnbar gemacht. Das alles setzten sie für unwägbare revolutionäre Risiken nicht einfach aufs Spiel.
Otto von Bismarck (1815–1898), Reichskanzler von 1871 bis 1890. Als virtuosem Diplomaten und nüchternem Realpolitiker waren ihm die großen weltanschaulichen Bewegungen seiner Zeit mit ihren Glaubenskräften und visionären Zielsetzungen – der Katholizismus ebenso wie die sozialistische Arbeiterbewegung – fremd. Während er die Sozialdemokratie als Partei mit Ausnahmegesetzen und Polizeiaktionen drangsalierte, versuchte er zugleich, die Arbeiter durch Sozialreformen an den Staat zu binden. Illusionslos und freimütig gab er zu: «Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe und nicht eine Menge Leute sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt in der Sozialreform bisher gemacht haben, auch nicht existieren, und insofern ist die Furcht vor der Sozialdemokratie … ein ganz nützliches Element.»
Die Sozialdemokraten hatten also selbst unter dem Sozialistengesetz mehr zu verlieren als nur ihre Ketten. Die zwölf Jahre Bismarck’scher Repression sind eben nicht zu vergleichen mit den zwölf Jahren des nationalsozialistischen Terrorregimes. Im Kaiserreich waren die Sozialdemokraten als Individuen nicht völlig entrechtet; als Staatsbürger standen sie unter dem durchaus verlässlichen Schutz von Recht und Verfassung und wurden physisch nicht wirklich bedroht. Ihre Partei war durch parlamentarischen Mehrheitsbeschluss verboten, aber als Ersatz konnten sie recht problemlos ihre Geselligkeitsvereine gründen und pflegen. Und sie hatten Parlamentarier, denn im Kaiserreich wählte man Personen, nicht Parteien. Infolgedessen konnten Sozialdemokraten als Einzelpersonen kandidieren, gewählt werden und schließlich als Abgeordnete im Reichstag agieren. Ihre parlamentarischen Reden durften gedruckt und verbreitet werden. Damit war die Reichstagsfraktion der Sozialdemokraten die einzige legale Instanz der sonst verbotenen Partei; sie wurde zum Zentrum, zum Leitungsorgan der deutschen Arbeiterbewegung.
Das prägte die Sozialdemokraten auf lange Zeit: Wahlkämpfe, Wahlen, parlamentarische Arbeit, Spezialwissen und Fachkompetenz – das hatte in der Partei höhere Bedeutung als der Gedanke an die revolutionäre Massenaktion oder gar die Spekulation auf den Barrikadenkampf. Der Primat der Parlamentsfraktion trug so ebenfalls zur Entradikalisierung der Sozialdemokratie bei. Überhaupt darf man sich die sozialdemokratische Reichstagsgruppe nicht als Ansammlung feuriger Volkstribunen oder gar deutscher Danton-Gestalten vorstellen. Als Parlamentarier musste man sein finanzielles Auskommen haben, denn Diäten gab es erst nach der Jahrhundertwende. Gewerbliche Arbeiter, wirkliche Proletarier also, hatten deshalb keine Chance, zumal ihnen als sozialdemokratischen Kandidaten seitens ihrer Betriebe die Entlassung drohte. So tummelten sich in den sozialdemokratischen Reichstagsfraktionen Parteischriftsteller, aber auch Tabakhändler oder Gastwirte. Friedrich Engels grauste es bei diesem Anblick: «Was sitzen in der Fraktion für Spießer und kommen immer wieder hinein!»
Auch die Sozialgesetzgebung, das Bismarck’sche Zuckerbrot, das der Reichskanzler nach den Peitschenhieben des Sozialistengesetzes verteilte, förderte die reformistischen Mentalitäten. Natürlich stimmten die Sozialdemokraten zunächst gegen die Sozialgesetze – und doch nutzten sie vom ersten Moment an die Möglichkeiten und Institutionen des neuen Sozialversicherungswesens. Das blieb ebenfalls lange ein Merkmal sozialdemokratischen Verhaltens: anfangs die große fundamentaloppositionelle Geste, das pathetische «Nein!», dann irgendwann die pragmatische Annäherung, schließlich das stillschweigende «Ja».
Mit seiner Sozialgesetzgebung hatte Bismarck die Arbeiter von den Sozialdemokraten wegziehen wollen, vergebens. Vor allem die Krankenversicherungen trugen – entgegen Bismarcks Absicht – zur Integration der Sozialdemokraten bei. Etliche tausend sozialdemokratische Aktivisten kamen so in die Funktionsräume des Sozialsystems, besetzten besonders in den Ortskrankenkassen die Verwaltungsgremien, Aufsichtsräte und Vorstände – häufig genug in hauptamtlichen Positionen. Das ließ in der Arbeiterbewegung einen Typus von Funktionär entstehen, den es auch in den Gewerkschaften gab, der sich an der sozialen Wirklichkeit orientierte, die Bedingungen der Gegenwart verändern wollte und tatsächlich einiges an Fortschritten und Verbesserungen erreichte. Dieser Funktionärstypus lebte in den Strukturen der Gesellschaft, verteidigte sie schon in Teilen, neigte jedenfalls nicht mehr zu revolutionären Visionen, brauchte keine kühnen Heilsversprechen und strebte nach keinem Fundamentalwandel. Mithin trieb er die Vergewerkschaftung, die Sozialverkassung der Arbeiterbewegung voran.
Demonstration zum 1. Mai 1890 in Dresden. Im Jahr zuvor hatte der Gründungskongress der Sozialistischen Internationale in Paris beschlossen, «eine große internationale Manifestation zu organisieren, und zwar dergestalt, dass gleichzeitig in allen Ländern und in allen Städten an einem bestimmten Tage die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen». So kam es 1890 in mehreren Staaten zu Demonstrationen und Streiks, auf die die Arbeitgeber vielfach mit Aussperrung reagierten. Auch 1919 scheiterten Sozialdemokraten und Gewerkschaften mit ihrem Vorhaben, den 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Zum arbeitsfreien «Tag der nationalen Arbeit» wurde er erst 1933 unter den Nationalsozialisten.
Und doch blieb die Utopie von der befreiten Gesellschaft wichtig für die sozialdemokratische Arbeiterbewegung. Gewiss: Pragmatische Grundhaltungen setzten sich mehr und mehr durch, aber das führte keineswegs zu einem reformistischen Selbstverständnis, zu einem selbstbewussten reformistischen Ethos. Dafür stieß der praktische Reformismus zu rasch an seine Grenzen; denn für die Sozialdemokraten gab es im Kaiserreich im Grunde keine Bündnispartner für die Reform der Gesellschaft – nicht in der Reichspolitik, aber auch nicht in den Kommunen. In den Gemeinden der meisten Reichsländer herrschte ein strikt plutokratisches Zensuswahlrecht; die bürgerlichen Parteien standen hier – und das noch bis in das erste Jahrzehnt der Bundesrepublik hinein – den Sozialdemokraten oft als Einheitsblock, als Kartell gegenüber. Insofern war ein reformistisches Programm, wie es Eduard Bernstein zum Ende des 19. Jahrhunderts entworfen hatte, nicht sonderlich attraktiv.
Bernstein galt in späteren Jahrzehnten als Pionier und Vater einer realpolitischen, reformerischen, parlamentarisch orientierten Partei der gemäßigten Linken. Wie etliche andere sozialistische Vordenker jener Aufstiegsjahrzehnte der Arbeiterbewegung war auch er jüdischer Herkunft. Aber Bernstein entstammte nicht, wie Karl Marx, dem Bildungsbürgertum, kam erst recht nicht, wie Ferdinand Lassalle, aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Die Verhältnisse in der Familie Bernstein waren vielmehr ärmlich und eng. Der Vater verdiente sein Geld als Lokomotivführer und hatte die beachtliche Zahl von 16 Kindermündern zu stopfen. So fehlte das Geld, um dem begabten Sohn Eduard den gymnasialen Abschluss zu ermöglichen. Der Sohn des Eisenbahners hatte also – wie allerdings nicht wenige im Sozialismus des Jahrhunderts zwischen 1860 und 1960 – sein Wissen als Autodidakt zu sammeln.
Insofern war Bernsteins Biographie nicht untypisch für die Sozialdemokratie jener Ära. Diese frühen Jahrzehnte waren wohl die glücklichsten in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Die Partei wuchs und wuchs; die Zahl ihrer Wähler und Reichstagsmandate mehrte sich stetig. Man stand in der Opposition, durfte sich also – durch keinerlei Regierungszwänge in den eigenen Idealen kompromittiert – radikal, prinzipienstark und visionär gebärden. Auch Bernstein gehörte zunächst zu den gläubigen Marxisten, mehr noch: Er avancierte zu einem geistigen Protagonisten dieser Denkrichtung. Den Zugang zum Marxismus hatten ihm die vergleichsweise populär verfassten Schriften Friedrich Engels’ – des engsten Freundes und Kampfgefährten von Karl Marx – verschafft. Und Engels blieb rund 15 Jahre wichtig für Bernstein. Solange Engels lebte, traute sich Bernstein nicht, seine Bedenken und wachsenden Zweifel gegenüber dem marxistischen Paradigma offen auszusprechen.
Stattdessen wuchs Bernstein im Laufe der 1880er Jahre auf dem Felde der marxistischen Theorie, nebst seinem damaligen Freund Karl Kautsky, in die Rolle der großen Autorität. Beide verfassten gemeinsam das später parteihistorisch berühmt gewordene «Erfurter Programm» der deutschen Sozialdemokraten. Und beide bezahlten ihre sozialistische Schriftstellerei mit Jahren der Verbannung aus Deutschland. Eduard Bernstein traf es besonders hart: Über zwanzig Jahre musste er im Exil verbringen, da er in seiner deutschen Heimat steckbrieflich zur Fahndung ausgeschrieben war. Anfangs redigierte Bernstein das illegale Parteiorgan Der Sozialdemokrat von der Schweiz aus; dann wurde er, unter dem Druck der deutschen Behörden, auch von dort ausgewiesen. Zwischen 1888 und 1901 lebte er in der Londoner Emigration. Dort kam er in engen Kontakt mit Friedrich Engels, der Bernsteins Fleiß und Verlässlichkeit zu schätzen lernte und ihn schließlich zum Verwalter seines Nachlasses – darunter auch der umfangreiche Briefwechsel mit Karl Marx – bestimmte.
Dabei war Bernstein, als Friedrich Engels 1895 verschied, kein verlässlicher Apostel des Marxismus mehr. Auch Engels, dem Bernstein seine zunehmend häretischen Ansichten eher verschwieg, hatte das gespürt und ihm zuweilen vorgeworfen, mehr und mehr wie eine «englische Krämerseele» zu klingen. Tatsächlich hatte sich Bernsteins Position seit seiner Ankunft in London schleichend verändert. Das mochte darauf zurückzuführen sein, dass er ein undoktrinärer Kopf war, den eine neue Empirie zu neuem Denken inspirierte. Das konnte aber auch – wie nicht ganz wenige aus seinem Bekanntenkreis erzählten – mit Bernsteins leichter Beeinflussbarkeit zusammenhängen. Jedenfalls: Schon gleich nach seiner Ankunft in der englischen Hauptstadt geriet Bernstein in den Bann der «Fabian Society», einer kleinen, elitären Gruppe von Intellektuellen – Engels nannte sie abfällig: die «jebildeten Sozialisten» –, die an Programmen und Konzeptionen einer sozialen Reformpolitik bastelten. Die prominenten Figuren dieser Gruppe waren das Ehepaar Beatrice und Sidney Webb sowie der Dramatiker und spätere Literaturnobelpreisträger George Bernard Shaw. Sidney Webb kreierte für die Gruppe die Maxime des «Schritt für Schritt», also eine graduelle Reformstrategie anstelle des revolutionären Hammerschlags. Und dieses Prinzip der schrittweisen Überwindung des Kapitalismus wurde auch für die nächsten Jahrzehnte zum Credo des Eduard Bernstein.
An die Öffentlichkeit ging Bernstein damit allerdings erst nach dem Tod seines langjährigen Mentors Friedrich Engels. Dann aber hatte er den Mut zu einer Generalkritik an den zentralen Deutungen der marxistischen Theorie. Zumindest in den populären Schulungsschriften der Partei ging die marxistische Sozialdemokratie von einer stetigen Verelendung der Arbeiterklasse aus, vom unvermeidlichen Niedergang der Mittelschichten, von einer dualen Polarisierung zwischen den Millionenmassen an Proletariern und der kleinen Ausbeuterschicht der Großbourgeoisie. Das alles, so die Prognose der Marxisten, würde von einem Bündel sich kumulativ verschärfender Krisen begleitet sein, schließlich in einen großen «Kladderadatsch» der bürgerlichen Gesellschaft münden, wodurch die Pforte für die neue sozialistische Gesellschaft aufgestoßen wäre.
Gegen all diese Interpretationen und Zukunftsprognosen brachte Bernstein in den Jahren 1896 bis 1898 in einer Artikelserie für das sozialdemokratische Theorieorgan Neue Zeit seine Einwände vor. Er hatte über die Jahre mit großem Fleiß statistisches Material gesammelt, mit dessen Hilfe er nun zu beweisen versuchte, dass das materielle Lebensniveau der Arbeiter gestiegen und nicht zurückgegangen war, dass die Mittelschichten sich wohl wandelten, aber keineswegs verschwanden, dass die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus bemerkenswerter war als seine Krisendynamik, dass ein jäher Zusammenbruch des Kapitalismus nicht zu erwarten und auch nicht wünschenswert sei. Und schließlich stellte er die historisch-moralische Überlegenheit des «revolutionären Subjekts», der Arbeiterklasse also, ebenfalls in Frage. Nüchtern konstatierte er, dass es zwar durchaus revolutionäre, tapfere und human eingestellte Arbeiter gebe, aber eben leider auch solche, die als rundum reaktionäre, gänzlich feige und nicht selten gar bestialische Gestalten die Welt schlechter statt besser machten.
Seltsamerweise hielt sich die Empörung über derlei Ketzereien in den ersten beiden Jahren in Grenzen. Der Entrüstungssturm brach erst im Jahr 1898 los, als Bernstein einen Satz schrieb, der bis heute in der Linken berühmt, für viele berüchtigt ist: «Ich gestehe es offen, ich habe für das, was man gemeinhin unter ‹Endziel des Sozialismus› versteht, außerordentlich wenig Sinn. Dieses Ziel, was immer es sei, ist mir gar nichts, die Bewegung alles.» Jetzt bebte die Partei, jetzt blieb die Debatte keineswegs auf Intellektuelle beschränkt, jetzt folgte für ein halbes Jahrzehnt eine erbitterte Auseinandersetzung, die seither den historischen Namen «Revisionismusstreit» trägt.
In diesem Disput stand Bernstein von Beginn an auf verlorenem Posten. Der Marxismus spendete in jenen Jahren den Arbeitern Trost und Hoffnung auf eine erlösende Zukunft. Bernstein dagegen stand ihnen für pedantische Bedenkenträgerei, für ein fades Linsengericht zäher Reformschritte. Leicht jedenfalls hatte Bernstein es nicht. Im Laufe der Kontroverse verlor er seinen langjährigen besten Freund, Karl Kautsky. Etliche Monate musste er überdies den Parteiausschluss, also den Bann der wärmenden sozialistischen Familie, fürchten.
Denn es ging hart zur Sache in der Sozialdemokratie in den fünf Jahren zwischen 1898 und 1903. Die Sprache wurde rüder, die Toleranz nahm ab, das Autodafé breitete sich aus. Damals, in den Zeiten des Revisionismusstreits, baute sich der Jargon der Dogmatik und Rechthaberei auf, wuchs die Hemmungslosigkeit, den Andersdenkenden als Renegaten, Konvertiten, ja Verräter «an der Sache» zu brandmarken und politisch zu vernichten. Der unversöhnliche Streit im Sozialismus der Zwischenkriegszeit, auch die Deformationen und Pervertierungen in den folgenden staatssozialistischen Episoden: Hier hatten sie ihren Ursprung. Schlimm war nicht zuletzt Rosa Luxemburg, die in libertären Kreisen zuweilen seltsamerweise noch immer als «freiheitliche Sozialistin» gilt und für ihre poetische Sprache gepriesen wird. In der Auseinandersetzung mit Bernstein griff sie nicht zu lyrischen Bildern. In harten, unerbittlichen Sätzen forderte sie den Ausschluss Bernsteins aus der Partei, überzog ihn mit galligen Gehässigkeiten und spottete über sein Plädoyer für den Weg der Reformen in einen demokratischen Parlamentarismus. In Luxemburgs Weltbild existierte nur die schroffe Alternative des «Alles oder nichts»; für das Wesen von Reformen, Kompromissen, Bündnissen hatte sie keinerlei Sinn.
Insofern war Bernstein in der Tat weit moderner, realistischer als seine Kontrahenten im Revisionismusstreit. Doch eine Chance, aus diesem Konflikt als Sieger hervorzugehen, besaß er nicht. Mit großen Mehrheiten wurde die Bernstein’sche Position von den Parteitagen der Sozialdemokraten niedergestimmt. Das geschah zunächst in Abwesenheit Bernsteins, da diesem in Deutschland ja das Gefängnis drohte. Doch der neue Reichskanzler von Bülow hob 1901 den Steckbrief auf, da er hoffte, dass Bernstein nach seiner Rückkehr Anhänger sammeln und die sozialdemokratische Partei aufmischen würde.
Indes: Zum charismatischen Religionsstifter, der gläubige Jünger und folgsame Schüler um sich scharte, taugte Bernstein nie. Als er nach über zwanzig Jahren der Verbannung wieder auf einem Parteitag auftauchte, waren gerade die Sozialdemokraten des rechten Flügels – die auf einen neuen Leitwolf gehofft hatten – schwer enttäuscht. Sie erlebten einen denkbar unpraktischen Menschen, der über die Gabe der Rede einfach nicht verfügte. Bernstein sprach zögerlich, unsicher, in abgehackten, brüchigen Sätzen. Er gehörte in die Schreibstube, nicht auf die Bühne von Volksversammlungen. Aber auch mit seinen Schriften – ob Bücher, Aufsätze oder Zeitungsartikel – erreichte und bewegte er die Massen nicht. Dafür war sein Stil zu spröde, zu langatmig, zu oberlehrerhaft. Er hatte die Defizite der offiziellen Parteidoktrin erkannt, das ja. Er hatte mit seinen englischen Erfahrungen deutsche Einseitigkeiten korrigiert, auch das. Er hatte früher als die meisten anderen im Sozialismus seiner Generation begriffen, dass in komplexen modernen Gesellschaften allein die systematische Reform, nicht der revolutionäre Frontalangriff realistisch sein konnte; dies blieb sein Verdienst. Aber eine kohärente Strategie, die in seiner Gegenwart die Sozialdemokraten überzeugte und mitriss, hatte er nicht konzipieren können. Zum Führer der praktizierenden Reformisten in seiner Partei wurde der Revisionist der Schrift nicht.
In jenen Jahrzehnten wärmte der Marxismus des offiziellen Parteitheoretikers Karl Kautsky und des Parteiführers August Bebel mehr als der reformistische Empirismus von Bernstein. Die Aussicht auf eine herrschaftsfreie Zukunftsgesellschaft schien verlockender als der zähflüssige, stockende Reformprozess im Obrigkeitsstaat. Doch war der Marxismus der wilhelminischen Sozialdemokratie ein Radikalismus der Phrase, der Sonntagsreden, der gemütvollen Erbauung, nicht der militanten Aktion. Als marxistischer Sozialdemokrat durfte man seelenruhig auf den – selbstverständlich gesetzmäßigen – Zusammenbruch der Gesellschaft warten, musste konzeptionell und strategisch nichts dafür tun. Für einen aktiven Radikalismus der Massen, den sich etwa Rosa Luxemburg herbeiwünschte, fehlten einfach die blanke Wut, der offene Hass in der sozialdemokratischen Arbeiterschaft. Denn schließlich hatte sich die ökonomische und soziale Lage der Arbeiter im Kaiserreich keineswegs verschlechtert, im Gegenteil: Die Reallöhne waren sukzessive gestiegen; die Arbeitszeit hatte sich seit der Frühindustrialisierung erheblich reduziert, von etwa sechzehn auf zehn Stunden täglich; und vom Schicksal anhaltender Massenarbeitslosigkeit blieb man verschont.
Rosa Luxemburg (1870–1919) auf einer Kundgebung in Stuttgart, 1907. Die spätere Mitbegründerin des Spartakusbundes und der KPD war eine große Rednerin, leidenschaftlich, temperamentvoll, scharfsinnig. Sie träumte vom revolutionären Aufstand des Proletariats, von Barrikadenkämpfen und internationalen Massenstreiks. Der Parlamentarismus war in ihren Augen nicht mehr als ein «Hühnerstall» voll «legalistischem Gegacker». Rosa Luxemburg war eine der letzten großen revolutionären Romantiker des 19. Jahrhunderts; von den kalten Despoten des staatssozialistischen Totalitarismus unterschied sie sich ebenso wie von den nüchternen Demokraten der westlichen Verfassungssysteme im 20. Jahrhundert.
Kurzum: Die sozialdemokratischen Arbeiter waren im Wilhelminismus zwar kulturell und politisch stigmatisiert, aber sozial und ökonomisch erlebten sie beachtliche Fortschritte. So wohnten denn auch zwei Seelen in der Brust der deutschen Arbeiterbewegung: Die eine war ein bisschen radikal, die andere ein bisschen reformistisch. Ebendas spiegelte sich im berühmten Erfurter Programm von 1891. Darin gab es einleitend einen allgemeinen Teil, der gehorsam marxistisch geschrieben war und ein düsteres Krisenszenario des Kapitalismus entwarf, aber auch den alles entscheidenden Königsweg aus der sonst unabwendbaren Misere offerierte: die Verwandlung des kapitalistischen Privatguts in gesellschaftliches Eigentum. Dem folgte dann allerdings ein Abschnitt mit vielen konkreten Forderungen zur Verbesserung der Verhältnisse, die jedoch in der bürgerlichen Gesellschaft eigentlich gar nicht erfüllt werden konnten, wenn man dem anfangs gezeichneten apodiktischen Krisendrama Glauben schenkte. Zumindest gab es zwischen den beiden Programmteilen keine Vermittlung, kein strategisches Verbindungsstück; sie standen jeweils für sich. Es war ein gespaltenes Programm, das zwei Wirklichkeiten beschrieb und zwei Perspektiven wies; die doppelte Seelenlage der Arbeiterbewegung, die widersprüchliche Erfahrung der Arbeiterschaft, ihre reformistischen Alltagsmentalitäten und ihre revolutionären Zukunftshoffnungen wurden zu einem Paket verschnürt.
Auszug aus dem Erfurter Programm von 1891. Den theoretischen Teil hatte Karl Kautsky verfasst, die eher praktisch-konkreten Passagen stammten von Eduard Bernstein. Später waren beide dann Gegner im sogenannten Revisionismusstreit; Kautsky hütete die marxistischen Glaubenssätze, Bernstein wollte sie revidieren. Schon im Erfurter Programm war diese Spannung erkennbar: Der eine Teil erwartete alles Heil von der Revolution, der andere versprach sich viel auch von der Reform. Aber so war die Haltung der deutschen Sozialdemokraten im Kaiserreich: ein bisschen revolutionär, ein bisschen reformistisch.
Und damit schien die Sozialdemokratie auch bestens zu fahren, denn mit ihr ging es stetig aufwärts: Zu Beginn des Kaiserreichs hatten die Sozialdemokraten bei den Reichstagswahlen lediglich 3,2 Prozent der Stimmen erhalten; 1912 dann, bei den letzten nationalen Wahlen im Wilhelminismus, erzielte die Partei immerhin 34,8 Prozent und war die stärkste politische Kraft in Deutschland – die Liberalen kamen zusammen auf 25,9, die Konservativen auf 12,2 und das katholische Zentrum auf 16,4 Prozent. Auch die Mitgliederrekrutierung verlief nach der Jahrhundertwende erfreulich. Um 1900 hatte die Partei nicht mehr als 200000 Mitglieder, 1913/14 lag die Zahl dann bei nahezu einer Million. Überhaupt waren die Jahre zwischen 1900 und 1914 organisatorisch entscheidend für die deutsche Sozialdemokratie. Erst jetzt wandelte sie sich vom Wahlverein zur schlagkräftigen Massenpartei: Das Netz der Kultur- und Umfeldorganisationen war dichter als je zuvor, der Ausbau des Parteiapparats weit vorangeschritten. Nachdem sich aufgrund eines neuen Reichsvereinsgesetzes von 1908 Frauen in ganz Deutschland politisch organisieren durften, stieg die Zahl sozialdemokratisch aktiver Frauen von 11000 im Jahr 1907 auf 82000 im Jahr 1910. Ideologisch und organisatorische Anführerin der proletarischen Frauenzusammenschlüsse war die frühere Lehrerin Clara Zetkin, eine Repräsentantin des radikal linken Flügels ihrer Partei. Sie achtete streng auf eine – wie sie bevorzugt zu sagen und zu schreiben pflegte – «reinliche Scheidung» von allen bürgerlichen Frauenrechtsinitiativen, richtete ihre Vereinigung ganz auf den primären «Kernkonflikt», den Antagonismus von Kapital und Arbeit, den Klassenkampf von Proletariat und Bourgeoisie, aus. Die organsierten sozialdemokratischen Frauen, als Seite ihres Geschlechts in der proletarischen Gesamtklasse, hatten sich für den politischen Befreiungskampf als unabdingbare Voraussetzung jeder Emanzipation und Befreiung zu schulen, für ihre Rolle und Mission im harten Alltag sozialistischer Überzeugungsarbeit diszipliniert zu erziehen. Dieser strikte Bildungsauftrag galt generell für die Sozialdemokratie jener Jahre. Die Partei hatte ihre – 1906 in Berlin eröffnete – eigene zentrale Parteischule und gab rund siebzig Zeitungen heraus. Dem Zentralbildungsausschuss der Sozialdemokratie gehörten 364 lokale Einrichtungen an, deren Bildungskurse im Jahr 1913 insgesamt 44146 Teilnehmer erfassten. Zudem vollzog sich in der Parteielite ein einschneidender Generationswechsel: Der Typus Ebert, in den 1870er Jahren geboren, kam nach oben und wurde allmählich wichtiger als der Typus Bebel aus der 1840er-Kohorte. Gewissermaßen löste der Organisator und Sekretär den Agitator und Tribun ab.
Der Mann der Wachstums- und Heroenzeit der Sozialdemokratie war August Bebel gewesen; unter ihm wurde die Arbeiterbewegung in Deutschland groß. Mit zwanzig Jahren zählte er schon zu den ersten Männern der Arbeiterbildungsbewegung, mit siebenundzwanzig saß er im Reichstag. Damals war ein schneller Aufstieg junger Arbeiter in den Organisationen der eigenen Klasse noch leicht möglich. Natürlich wartete auf sie dann das Märtyrertum: Ausweisung und Gefängnis. Doch das verschaffte ihnen auch Ruhm. Bebel verbrachte rund siebenundfünfzig Monate seines Lebens in Strafanstalten, was für ihn nicht nur ein Unglück war. Der von seiner Konstitution her eher schwächliche Sozialistenführer erholte sich hier meist recht gut von den Strapazen der Politik, und vor allem konnte er Unmengen von Büchern lesen. Der Freiheitsentzug war für ihn gewiss eine Schmach und Belastung, aber er bedeutete auch Regeneration und Bildung. Das Gefängnis machte Bebel zum Märtyrer und Schriftsteller und festigte insofern seine Führungsposition in der Sozialdemokratie.
Der andere Grund für Bebels überragende politische Stellung war seine rednerische Kraft. Der Sozialismus befand sich schließlich noch in seiner agitatorischen Phase, der Rhetor war wichtiger als der Organisator. Und Bebel war ein charismatischer Redner, voller Temperament und Suggestivkraft. Er sprach durchaus herrisch, apodiktisch, duldete keinen Widerspruch. Doch das stieß die Arbeiter nicht ab; sie liebten ihn, gerade weil er den Zweifel verbannte, wenn er von der Siegesgewissheit des Sozialismus sprach. Für viele Arbeiter war er eine Art Heiland, zumindest aber ein Prophet der neuen, der befreiten Gesellschaft. In sächsischen Arbeiterwohnungen ersetzte man im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts das Luther-Bild vielfach durch ein Porträt des deutschen Sozialistenführers. Später zierten Bebel-Konterfeis sogar Bierkrüge und Taschenmesser, und oft wurde er auch «Kaiser der deutschen Arbeiter» genannt.
Wilhelm Liebknecht (1826–1900) und August Bebel (1840–1913) im Hochverratsprozess vor Gericht in Leipzig, März 1872. Die beiden Angeklagten wurden wegen ihrer Opposition gegen den Deutsch-Französischen Krieg zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt. Bebel musste in seinem Leben insgesamt siebenundfünfzig Monate in Gefängnissen und Zuchthäusern verbringen. Auch deshalb wurde er zum Märtyrer und Helden der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Die Haft nutzte er für ausgiebige Lektüre, weshalb er das Gefängnis auch «Universität der Arbeiter» nannte. Freimütig gestand der schmächtige, von seinen langen Vortragsreisen erschöpfte Bebel kurz vor seinem Tod: «Ich würde wohl zugrunde gegangen sein, wenn sie mich nicht öfter zur rechten Zeit eingelocht hätten.»
Zu dieser Zeit hatte die Arbeiterbewegung noch etwas Religiöses, war sie noch Stätte von Kult und Vision. Bebel war zwar nicht ihr großer Schriftgelehrter, aber doch ihr erster Künder und Propagandist. Den Zukunftsstaat konnte er begeisternd beschreiben und in den schönsten Farben ausmalen, so auch in seinem Buch «Die Frau und der Sozialismus», das bis zu seinem Tode 1913 in 53 Auflagen erschien. Keine andere sozialistische Schrift hat die europäischen Arbeiter so sehr beeinflusst wie diese. In ihr konnte man lesen, wie paradiesisch es in der sozialistischen Zukunftsgesellschaft zugehen würde: Man arbeitete dort nicht mehr als drei Stunden täglich; es gab keine Verbrecher und auch keine Polizei; der Staat regelte alles im Guten. Bebels Buch war ein Best- und Longseller, der ihn zu einem wohlhabenden Mann machte. Der Arbeiterführer konnte sich sogar eine große Villa in der Schweiz leisten, und die Arbeiter nahmen ihm das nicht übel, etikettierten ihn nicht als «Bonzen».
Denn Bebel war ein ehrlicher Mann, der an das glaubte, was er sagte. Er sehnte sich wirklich nach der Revolution. Dabei war er im Alltag eher ein pragmatischer Mensch, sehr geschäftstüchtig, in politischen Dingen auch taktisch äußerst beweglich, durchaus kein Dogmatiker und Prinzipienreiter. Doch es fehlte das innere Band zwischen dem revolutionären Chiliasmus und der pragmatischen Wendigkeit: Er hatte kein mittelfristiges Reformkonzept, keinen Plan für die strukturelle Transformation der Gesellschaft; für ihn gab es nur das Hier und Jetzt sowie die weite, revolutionäre Zukunft. Als er 1910 seinen siebzigsten Geburtstag feierte, gab Bebel seinen Gästen und Gratulanten seinen innigsten Wunsch preis: «Ich hoffe den Tag noch zu erleben, an dem ich Euch die Sturmfahnen der Revolution vorantragen werde.» Das war nicht einfach aus feierlichem Anlass so dahingesagt. Bebel hoffte das tatsächlich. Als er dann drei Jahre später starb, da endete mit ihm auch das messianische Zeitalter der deutschen Sozialdemokratie.
Bebel war eher klein von Gestalt, doch er besaß viel Energie, konnte rabiat werden und autoritär sein. Er hoffte auf die Revolution des Proletariats und den Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft, aber zugleich war er ein geschickter Taktiker, listig und pragmatisch. Die sozialdemokratischen Arbeiter verehrten ihn wie einen Kaiser, sein Porträt hing in ihren Stuben, und seine Ansprachen waren für viele wie eine Verkündigung. Sein Buch «Die Frau und der Sozialismus» (1883) wurde zum Klassiker der sozialistischen Bewegung; es machte ihn, der Geschäftstüchtigkeit nicht verächtlich fand, zusammen mit anderen Einkommensquellen zu einem wohlhabenden Mann.