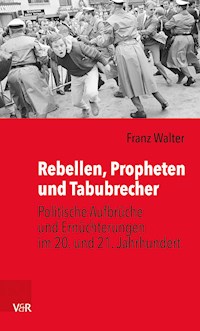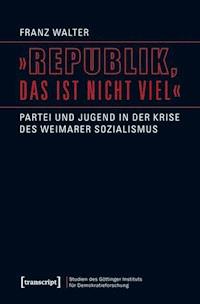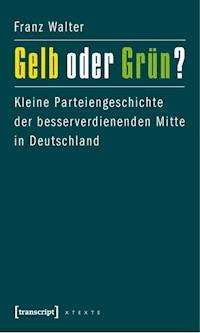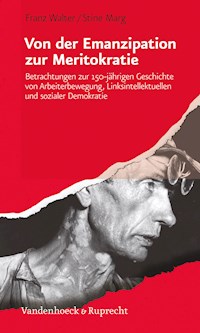5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Während die einen die Erfolge der Piraten als den längst überfälligen Einbruch des digitalen Zeitalters in die parlamentarische Wirklichkeit feiern, spotten andere über politische Dilettanten, braune Irrläufer und Demokratievorstellungen, die genauso flüssig wie inhaltsleer sind. Inmitten dieser oft polemisch geführten Debatte werfen die Autoren einen klaren analytischen Blick auf Ursprünge, Funktionsweise und Ziele dieser Anti-Parteien-Partei. Sie bieten Einblicke in prekäre Finanzen und die Arbeit einer Organisation, in der basispartizipatorische Grundsätze und die Notwendigkeit programmatischer Willensbildung sich nicht immer reibungslos vereinbaren lassen. Dabei fördern sie außerdem Parallelen zur Entwicklung der Grünen zutage. Das Ergebnis: Die Piraten lassen sich nicht auf ihr Interesse an »Netzpolitik« reduzieren. Vielmehr konfrontieren sie das krisengeplagte System der repräsentativen Demokratie mit seinen Schwächen – ohne den Anspruch zu erheben, über die richtigen Antworten zu verfügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die edition suhrkamp digital präsentiert kurze, aktualitätsbezogene, thesenstarke Bände, Manifeste, Langreportagen, Dossiers und Features. Alle Titel sind auch als eBook erhältlich. Mehr zur Reihe und zu den einzelnen Bänden unter: www.editionsuhrkamp.digital.de
Während die einen die Erfolge der Piraten als den längst überfälligen Einbruch des digitalen Zeitalters in die parlamentarische Wirklichkeit feiern, spotten andere über politische Dilettanten, braune Irrläufer und Demokratievorstellungen, die genauso flüssig wie inhaltsleer sind. Inmitten dieser oft polemisch geführten Debatte werfen die Autoren einen klaren analytischen Blick auf Ursprünge, Funktionsweise und Ziele dieser Anti-Parteien-Partei. Sie bieten Einblicke in prekäre Finanzen und die Arbeit einer Organisation, in der basispartizipatorische Grundsätze und die Notwendigkeit programmatischer Willensbildung sich nicht immer reibungslos vereinbaren lassen. Dabei fördern sie außerdem Parallelen zur Entwicklung der Grünen zutage. Das Ergebnis: Die Piraten lassen sich nicht auf ihr Interesse an »Netzpolitik« reduzieren. Vielmehr konfrontieren sie das krisengeplagte System der repräsentativen Demokratie mit seinen Schwächen – ohne den Anspruch zu erheben, über die richtigen Antworten zu verfügen.
Franz Walter, geboren 1956, lehrt Politikwissenschaft an der Universität Göttingen und ist Direktor des Göttinger Instituts für Demokratieforschung. Stephan Klecha, geboren 1978, und Alexander Hensel, geboren 1983, arbeiten dort als Politikwissenschaftler und forschen seit geraumer Zeit zur Piratenpartei.
Alexander Hensel/Stephan Klecha/Franz Walter
Meuterei auf der Deutschland
Ziele und Chancen der Piratenpartei
Suhrkamp
Umschlagfoto: picture alliance/dpa
Dieser Band der Reihe edition suhrkamp digital basiert auf einem von der Otto Brenner Stiftung (www.otto-brenner-stiftung.de) initiierten und gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungsprojekt. Dessen Ergebnisse erscheinen im Frühjahr 2013 als Arbeitsheft der Otto Brenner Stiftung (mehr Informationen dann auch unter: www.piraten-studie.de).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Originalausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Bureau Johannes Erler
eISBN 978-3-518-73725-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
1. Einleitung
2. Wurzeln und Entwicklung der Piraten
2.1 Gründungsmythos: Schwedische Freibeuter
2.2 Vom kruden zum attraktiven Außenseiter: Die deutsche Piratenpartei
3 Der Hype: Der Berliner Siegeszug hinterlässt Spuren
3.1 Wie funktioniert Führung bei den Piraten?
3.2 Wirklich kein Programm?
3.3 Wer sind die Mitglieder?
3.4 Wie finanziert sich die Partei?
4. Wenn der Rauch sich verzieht
4.1 Der neue Populismus?
4.2 Partizipation als Schlüssel
4.3 Erkennbare Schwierigkeiten
5. Fazit
Literatur
1. Einleitung
Eigenartige Gestalten mischen die politische Landschaft auf. Bei Landtagswahlen verhindern sie zuvor sicher geglaubte klare Mehrheiten für das Regierungs- wie das Oppositionslager im Bundestag. Ihre Positionen wirken merkwürdig naiv. Ihre Themen ungewohnt. Sie rütteln am Konsens zwischen den etablierten Parteien. Sie haben einen spielerischen Zugang zur Politik. Parteitage gleiten in endlose Geschäftsordnungsdebatten ab und wirken auf Außenstehende chaotisch. Wähler und Mitglieder scheinen auffallend jung. Auch habituell unterscheiden sie sich von den alten Berufspolitikern: Turnschuhe, Latzhosen, lange Haare und Bärte, flegelhaftes Auftreten in Talkshows und Parlamenten. Die Neuen sind anders, bisweilen sonderbar, aber genau das macht sie interessant. Ein Teil der Medien sympathisiert offen mit ihnen, wenngleich die eine oder andere Personalie einen üblen Beigeschmack hat. Schließlich finden sich in den Lebensläufen einiger Repräsentanten braune Sprenkel.
Nein, die Rede ist hier nicht von den Piraten, sondern von den Grünen, die sich 1980 als Bundespartei konstituiert haben. In der Tat: Auf den ersten Blick lässt sich die Ähnlichkeit zwischen den Parteien schwerlich leugnen. Und genau deshalb fallen die politischen Bewertungen des Phänomens noch recht entspannt aus. Vieles wirkt intuitiv wie vor drei Dekaden, eine vergleichbare Entwicklung scheint realistisch und absehbar. Ein neues Thema (in diesem Fall der Umgang mit den Folgen der digitalen Revolution) steht wie damals der Umweltschutz plötzlich auf der Agenda. Eine junge Partei eignet sich die Materie an. Sie etabliert sich, muss lernen, das Säurebad der Macht auszuhalten, sich konsolidieren und irgendwann auch mit Rückschlägen umgehen.
All diese wohlfeilen Analogien enden dann aber doch recht schnell. Nicht wenige Beobachter halten die Piraten im Vergleich zu den Grünen für überschätzt. Ihre zentralen Anliegen – Freiheit im Internet, Transparenz politischer Entscheidungsverfahren, unmittelbare Mitwirkung der Bürger – sind aus Sicht der Skeptiker beileibe nicht so elementar wie seinerzeit die Themen Frieden und Umwelt. Zudem wurzelten die Grünen auf einem breiten, über eine Dekade hinweg gewachsenen gesellschaftlichen Vorfeld aus Subkulturen, politischen Initiativen und sozialen Bewegungen. Das alternative Milieu der frühen achtziger Jahre, die Frauen- und Schwulenbewegung, Ökoprojekte, Kommunen, Kinderläden, Anwaltskollektive, Bioläden, Hausbesetzer und alternative Zeitungen waren der Humus, auf dem die junge Partei gedeihen konnte (Rucht 2010, S. 76 ff.). Mit der Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung gab es zwei massenwirksame Kristallisationspunkte, von denen man profitieren konnte. Die Piraten dagegen wirken zunächst wie ein fades Projekt der Postmoderne. Gegen die giftige Wolke über Seveso oder die Bilder einer atomaren Apokalypse wirkt die Kritik an Netzsperren gegen Kinderpornografie viel zu begrenzt, kleinteilig und technisch. Die Datenschutzaktivisten vertreten zweifelsohne ehrbare Werte, die Bedrohung durch staatliche Übergriffe dünkt dem Gros der Bürger dann allerdings doch eher abstrakt.
Die Zweifel an der dauerhaften Etablierung der Partei bleiben, zumal das Wählerverhalten zunehmend volatil geworden ist. SPD und CDU/CSU bewegen sich bei Wahlen gegenwärtig 10 bis 15 Prozentpunkte unterhalb des Niveaus, das sie von circa 1960 bis 2002 beständig erreichten. Legt man nicht den Anteil, sondern die absolute Stimmenzahl zugrunde, ist der Niedergang noch weitaus dramatischer: Rund 25 Millionen Stimmen konnten die Volksparteien SPD, CDU und CSU bei der Bundestagswahl 2009 auf sich vereinen, das sind über neun Millionen weniger als sie 1972 und 1976 erzielten – und das seinerzeit nur in Westdeutschland. Die Profiteure dieser Entwicklung finden sich vielerorts. Die Grünen konnten sich ein beachtliches Wählerspektrum sichern. Die Linke, die nach wie vor auf eine spezifische Klientel in Ostdeutschland zählen kann, hat im Zuge ihrer zwischenzeitlich erfolgreichen Westausdehnung einen Teil der SPD-Wähler fortgelockt. Ende der nuller Jahre profitierte insbesondere die FDP von der Beweglichkeit im bürgerlichen Milieu. Schließlich wuchs auch der Anteil der Nichtwähler an.
Nun haben sich also die Piraten einen Teil des Kuchens gegriffen, doch die Ausschläge, die alle Parteien bei Wahlen erleben, sind immens groß. Totgesagte Parteien wie die FDP schaffen ein Comeback, scheinbar bereits etablierte wie die Linke im Westen erleiden Rückschläge. Ehemals hegemonial auftrumpfende Parteien wie die CDU in Baden-Württemberg werden von der Macht verdrängt, zur Erfolglosigkeit verdammte wie die CDU in Berlin übernehmen überraschend Regierungsverantwortung. Die Berechenbarkeit von ehedem ist passé. Wer angesichts grandioser Umfragewerte dann wie die Grünen oder die FDP von eigenen Kanzlerkandidaten träumt oder diese gar kürt, kann jäh aus seinen Blütenträumen gerissen werden.
Tatsächlich wechseln parteipolitische Moden, verändern sich Wählerpräferenzen rekordverdächtig schnell. Möglicherweise spiegelt sich dabei in der Politik etwas, das wir auch in der Gesellschaft vielfältig erleben: Soziale Bindungen lockern sich, werden unverbindlich, variabel und individualisiert. Der Wähler wird im wahrsten Sinne des Wortes wählerisch und übernimmt im Politischen die täglich trainierte Rolle des Konsumenten, der ebenfalls nach Tagesgeschmack oder Wochenangebot entscheidet. Er will sich nicht vorschreiben lassen, welche sozialen Verpflichtungen er einzugehen hat. Anstatt Mitglied im Sportverein zu werden, in dem seit Generationen die ganze Familie aktiv ist, geht er ins Fitnessstudio. Statt sich von den Gewerkschaften oder dem Mieterschutzbund die Interessen vertreten zu lassen, schließt er eine Rechtschutzversicherung ab. Die kulturellen Präferenzen im Fernsehen, im Theater oder im Radio sind keineswegs mehr festgefügt. Es steht eine Vielfalt an medialen Angeboten zur Verfügung, unzählige Fernsehsender, Lifestyle-Magazine und das Internet haben den Medienkonsum radikal verändert.
Zugleich entstehen neue Formen der Gemeinschaft: Die Fußballstadien sind am Wochenende so voll wie nie zuvor. Bei Welt- und Europameisterschaften ist das gemeinschaftliche Public Viewing weitverbreitet, obwohl man bequem im eigenen Wohnzimmer mit bester Sicht auf den Flachbildfernseher die Spiele verfolgen könnte. Die Sehnsucht nach Gemeinschaftlichkeit findet ihren Ausdruck auch in medialen Großinszenierungen wie dem Eurovision Song Contest, der Jahr für Jahr ein Millionenpublikum vor die Mattscheibe und zu großen Partys lockt. Das neue Gemeinschaftsgefühl ist dabei keineswegs immer unpolitisch. An Online-Petitionen beteiligen sich Hunderttausende Bürger, Demonstrationen gegen randständig erscheinende Themen wie das Handelsabkommen ACTA erreichen ebenso beachtliche Teilnehmerzahlen wie die eigentlich längst totgesagte Friedensbewegung im Vorfeld des Irakkriegs.
Allerdings vollzieht sich dieser Wunsch nach Gemeinschaftlichkeit weniger in den tradierten Organisationsstrukturen, sondern in veränderter, flexibler und unverbindlicher Form. Nicht erst seit dem Arabischem Frühling wird über das politische Potenzial des Internets nachgedacht. Tatsächlich sind soziale Medien wie Facebook oder Informationsquellen wie Wikipedia aus dem Alltag vieler Menschen kaum mehr wegzudenken. Vor diesem Hintergrund ergibt sich im Hinblick auf die Piraten ganz zwangsläufig die Frage, ob ihre jüngsten Wahlerfolge wirklich nur eine Laune der Wähler waren oder ob es sich nicht doch um die Folge eines tiefgreifenden Wandels von Lebensformen und Mentalitäten handelt. Den gleichzeitigen Einzug in vier Landtage haben in den vergangenen 40 Jahren schließlich nur die derzeit im Bundestag vertretenen Parteien geschafft. Es könnte durchaus sein, dass wir tatsächlich das Entstehen einer neuen politischen Kraft erleben.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts vermessen wir gegenwärtig die Piratenpartei, untersuchen ihre Arbeitsweisen, vollziehen ihre programmatischen und strategischen Entscheidungen nach. Auf einen elaborierten Forschungsstand können wir uns dabei bislang noch nicht stützen, wohl aber auf umfangreiches empirisches Material. So greifen wir auf die umfassende Dokumentation der Partei selbst zurück. Ihre innerparteiliche Kommunikation legen die Piraten in Wikis, Foren, auf Mailinglisten, bei Twitter oder in Live-Streams zu einem großen Teil offen. Zudem beobachten wir Treffen und Parteitage und sprechen mit Vertretern der verschiedensten Ebenen. Aus all dem haben wir uns ein erstes Bild einer Partei angefertigt, das nach wie vor etwas amorph bleibt und einige Paradoxien offenbart: Wir haben es mit einer Parteistruktur zu tun, die eigentlich nicht den Anforderungen gerecht wird, um sich im Parteispektrum zu etablieren. Aufbau und finanzielle Ausstattung entsprechen der Struktur einer Klein-, wenn nicht gar Kleinstpartei. Das schubhafte Wachstum könnte erhebliche innerparteiliche Konflikte nach sich ziehen. Die Wähler schließlich unterstützen die Piraten mehrheitlich nicht wegen ihres Programms, sondern in erster Linie aus Enttäuschung über die etablierten Parteien. Dabei scheinen sie auf die Piraten allerlei Erwartungen zu projizieren, welche die junge Partei realistischerweise kaum erfüllen kann. Gleichwohl entsteht der Eindruck, dass die Piraten mit ihren Unzulänglichkeiten bislang ganz gut zurechtkommen und Schwächen durch ihre unkonventionelle politische Kultur und Organisation kompensieren können. Auf die Neuwahlentscheidungen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen haben die örtlichen Parteiführungen mit einer beeindruckenden Mischung aus Cleverness, Unprofessionalität und Improvisationstalent reagiert. Zudem ist es den Piraten bislang in den Landtagswahlkämpfen und ihren sonstigen Medienauftritten gelungen, sich auf bemerkenswerte Weise auf dem Wählermarkt anzubieten. Ihre Führungspersonen wirken geradezu abgeklärt, und dennoch vermitteln sie keineswegs den Eindruck, sie seien »alte Hasen«. Sie kokettieren vielmehr erfolgreich mit einem spielerischen Dilettantismus, thematisieren offen eigene Fehler und Unvollkommenheiten. In Teilen erwecken sie den Eindruck, jene Anti-Parteien-Partei zu sein, als die sich vor 30 Jahren die Grünen präsentierten. Der Vergleich mit den Grünen begegnet uns also in schöner Regelmäßigkeit. Wir werden ihn im Folgenden daher immer wieder aufgreifen.
2. Wurzeln und Entwicklung der Piraten
Will man den Höhenflug und die ungewöhnliche Kultur der deutschen Piraten verstehen, lohnt sich ein Blick auf deren Entstehung und bisherige Genese. Legt man die Mitglieder- und Organisationsentwicklung zugrunde, lassen sich in ihrer noch jungen Geschichte vier Phasen ausmachen: die eher sachte Frühentwicklung von der Gründung im September 2006 bis zum Frühjahr 2009; eine Phase des rasanten Wachstums, die im Frühsommer 2009 begann und bis kurz nach der Bundestagswahl andauerte; eine Zeit der Stagnation und Konsolidierung zwischen Herbst 2009 und Sommer 2011; und schließlich jene Phase des beschleunigten Wachstums, das seit der Berlin-Wahl im September 2011 anhält (Bieber 2012, S. 33 f.).
Ebenso interessant wie die ungewöhnliche Entwicklung ist die Herkunft der Piraten. Es handelt sich um eine genuine Neugründung, die den bis dato vom westeuropäischen Parteiensystem nicht oder nicht ausreichend repräsentierten Konflikt um die Folgen der digitalen Revolution aufgegriffen hat. Unabhängig von seiner langfristigen Tragweite stellt er den Ausgangspunkt dar für die grundlegende Agenda, für die Bindung der Kernklientel und die spezifische symbolische Kultur der Partei (Zolleis/Prokopf/Strauch 2010, S. 7 f.). Versucht man, die frühen Piraten mittels eines Konfliktmodells zu ergründen, geraten zwei zentrale Konstellationen ins Visier (Dobusch/Gollatz 2012): Erstens die durch die Expansion des Internets aufgeworfene Auseinandersetzung um den Gebrauch und die Regulierung von Informationen, Wissen und Kultur im digitalen Zeitalter, bei der es vor allem um die Ausgestaltung eines modernen Urheberrechtes geht; zweitens der Konflikt um die fortschreitende Einschränkung von Bürgerrechten im Rahmen der Anti-Terror-Gesetzgebung (Schulzki-Haddouti 2003), der sich auf verschiedene staatliche Überwachungs- und Regulierungsmöglichkeiten bezieht und sich vor allem an der Frage der Vorratsdatenspeicherung entzündet hat.
Dabei waren die Piraten keineswegs der erste politische Akteur, der diese Themen artikuliert hat. Vielmehr knüpften sie an verschiedene transnational agierende soziale Bewegungen an (Dobusch/Quack 2011, S. 26 ff.). So wird etwa bereits seit den neunziger Jahren unter dem Stichwort der Wissensallmende eine profilierte, wenngleich sehr akademische Diskussion über die Idee und Praxis immaterieller Gemeingüter geführt. Und auch das Thema digitale Bürgerrechte hat in Deutschland seit der resonanzkräftigen Kampagne gegen die Volkszählung in den achtziger Jahren eine Vorgeschichte. Daneben gab und gibt es spezifische Bewegungsansätze innerhalb der Netzkultur, man denke allein an die Hackerbewegung, die immer wieder auf die Potenziale, aber auch auf die mit den neuen Kommunikationstechnologien verbundenen Probleme hingewiesen hat.
Diese historischen Wurzeln schlagen sich bei den Piraten programmatisch und kulturell nieder. Nicht nur im Wertehorizont, auch im Alltag der Partei finden sich mannigfaltige Referenzen an das Hackermilieu und die Bürgerrechtsbewegung: Der technisch fundierte Optimismus der Selbstermächtigung, die aus der Internetkultur stammende Mischung aus radikalem Individualismus und vernetztem Kollektivismus sowie eine ausgeprägte Empathie gegenüber dem Grundgesetz sind Teil dieses Selbstverständnisses. Auch die ungewöhnliche Organisationsform und -praxis der Piraten muss in diesem Kontext gesehen werden. Die deutschen Piraten sind also weder aus dem Nichts entstanden noch eine bloße Kopie der schwedischen Mutterpartei, deren Geschichte im Folgenden kurz umrissen werden soll.
2.1 Gründungsmythos: Schwedische Freibeuter
Sie waren die Pioniere, sie wurden zum europäischen Vorbild: die Piraten in Schweden, die 2009 mit sieben Prozent ins Europaparlament einzogen. Der riesige Medienrummel in Stockholm schwappte in den folgenden Tagen, wenngleich gedämpft, auch nach Deutschland über. Die schwedische Piratenpartei gründete sich im Januar 2006 im Zuge des im Land schon seit der Jahrtausendwende virulenten Konflikts um das sogenannte Filesharing. Gemeint ist damit der Austausch oftmals urheberrechtlich geschützter immaterieller Güter wie Musik- und Videodateien. In der besonders webaffinen schwedischen Bevölkerung standen sich früher als im übrigen Europa Verwerter und Teile der sich kriminalisiert fühlenden, vor allem jüngeren Bevölkerung gegenüber (Bartels 2009, S. 28 ff.; Strippel 2010). Um das »Raubkopieren« bekämpfen zu können, gründeten mehrere Unterhaltungskonzerne 2001 das »Antipirateriebüro«, das relativ rasch erste Erfolge erzielte: 2005 wurde in Schweden ein verschärftes Urheberrecht verabschiedet, das die Interessen der Verwerter stärkte, da zum Beispiel nicht nur das Herunter-, sondern auch das Hinaufladen urheberrechtlich geschützter Daten als Straftat deklariert wurde. Hinzu kam eine EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, die es unter anderem ermöglicht, illegale Filesharer eindeutig zu identifizieren (Gürbüz 2011, S. 21).
Als Reaktion auf diese Entwicklung entstand 2003 das »Piratenbüro« (Piratbyrån) als eher loser Diskussionszusammenhang. Aus diesem heraus gründete der IT