
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Tam, Beschützer der Bären Die Berge im Norden von Laos sind die Heimat der Mondbären – und des 12-jährigen Tam. Bis der nach dem Tod des Vaters in die Stadt ziehen muss, um Geld für seine Familie zu verdienen. Er findet Arbeit in einer illegalen Bärenfarm, wo die Mondbären auf engstem Raum gehalten werden. Tam leidet mit den Tieren. Doch seine Familie ist auf seinen Lohn angewiesen. Als ein krankes Mondbärenjunges in die Farm gebracht wird, kann er die Augen nicht länger verschließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gill Lewis
Die Spur des Mondbären
Aus dem Englischen von Siggi Seuß
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für die Bienen und die Bären
Der erste Sturm
Mein Großvater und mein Vater waren Bienenflüsterer. Sie konnten sich mit Bienen unterhalten. Sie verstanden sie und sie kannten ihre Lebensweise.
In mondlosen Nächten kletterten sie den glatten Stamm des Bienenbaums hoch, um wilden Honig zu sammeln. Die Bienen haben ihnen alles erzählt: wo man Wild jagen konnte, wann die Früchte des Waldes reif waren und wann die Regenzeit begann.
Großvater hat mir immer gesagt, dass wir von den Bienen viel lernen können.
An kalten Winterabenden, wenn der Regen aus den Tälern heraufzog und in den Feuern fauchte und zischte, zog ich eine Decke über mich und setzte mich neben Großvater.
»Erzähl mir die Geschichte von Nâam-pèng«, bettelte ich dann.
Und Großvater lachte. »Nâam-pèng? Wer ist das?«
»Nâam-pèng, die tapferste aller Bienen.«
»Pah!«, rief Großvater dann. »Er war nur ein kleines Bienenmännchen. Kaum der Rede wert.«
»Bitte, erzähl mir von ihm«, bettelte ich weiter, »erzähl mir die Geschichte von Nâam-pèng.«
Großvater wickelte eine Betelnuss in ein Blatt und kaute sie langsam. »Nun gut«, sagte er dann, »nun gut.«
Ich zog die Knie unters Kinn, blickte ins Feuer und beobachtete, wie die Flammen hüpften und tanzten und selbst zu erzählen anfingen.
»Vor langer, langer Zeit«, begann Großvater dann, »als die Welt noch jung und heiter war, strömte der Großer Fluss von den Weißen Bergen herab. Dieser Fluss brachte Wälder mit sich, die voller Elefanten und Tiger waren, voller Mondbären und Sonnenbären und Nebelparder und Marmorkatzen und Zwergböckchen und Makaken und Webervögel und …« Großvater holte tief Luft, »… so viele Tiere, dass ich nicht lange genug leben würde, wollte ich sie alle erwähnen. Diese Wälder ragten bis in den Himmel und fingen mit ihren Ästen die Regenwolken ein, und bald strömten viele Flüsse in den Großen Fluss und alle wimmelten von Fischen.«
»Aber kam dann nicht ein Ungeheuer?«, fragte ich. Ich liebte diesen Teil der Geschichte.
Großvater runzelte die Stirn und nickte. »Eines Tages jedoch kam ein Ungeheuer. Tám-láai erschien in der Finsternis, bevor der Tag anbrach, trampelte durch die Wälder, fraß die Tiere und die Bäume und spuckte Knochen und Kerne auf den Boden. Er verschlang alles und jedes, was ihm in den Weg kam. Die Tiere rannten davon und flogen und schwammen, um tiefer in den Wäldern Schutz zu finden, aber schon war ihnen das Ungeheuer auf den Fersen. Es zerstampfte den Boden und trank den Großen Fluss aus, bis er nichts weiter war als ein Rinnsal, und die Fische blieben zappelnd zurück und starben im Schlamm. Am Ende des Tages war nur noch ein Häufchen Bäume übrig, die sich an einen kleinen Berg klammerten. ›Bitte, bitte, lass uns diesen Wald‹, kreischten die Tiere und heulten und bellten und piepsten, ›das ist alles, was wir noch haben.‹ Aber das Ungeheuer war immer noch hungrig. Es richtete sich zu seiner vollen Größe auf …«
Wenn Großvater an diese Stelle kam, stand ich immer auf, schleuderte meine Decke in die Höhe und warf hinter mir riesige Schatten. Ich holte tief Luft und brüllte: »Ich bin Tám-láai! Ich bin Tám-láai! Wer wagt es, mich aufzuhalten?«
Großvater tat dann so, als würde er sich ducken. »Alle Tiere zusammen verkrochen sich. Nicht einmal der Tiger oder der Bär waren diesem Ungeheuer gewachsen. Aber genau in dem Augenblick, als Tám-láai den Arm ausstreckte, um den nächsten Baum aus dem Boden zu reißen, flog eine kleine Biene aus dem Wald und schwirrte ihm direkt vor der Nase herum.
›Ich bin Nâam-pèng‹, sagte das Bienenmännchen, ›und ich werde dich aufhalten.‹
Das Ungeheuer fing Nâam-pèng mit seiner Pranke, warf den Kopf zurück und lachte. ›Du?‹, brüllte es. ›Du bist ja so klein. Dein Stachel würde mir gerade mal einen Pickel bescheren.‹
Nâam-pèng surrte in der hohlen Pranke des Ungeheuers. ›Ich bin Nâam-pèng und ich werde dich aufhalten.‹
Als nun die anderen Waldbienen Nâam-pèng so mutig reden hörten, füllten sich ihre Herzen mit Mut und Hoffnung. Konnten sie auch so tapfer sein wie Nâam-pèng?
Tám-láai fletschte die Zähne und hielt Nâam-pèng an den Flügeln. Das Ungeheuer blickte tief in Nâam-pèngs Augen. Überall um sie herum verdunkelte sich plötzlich der Himmel. ›Du bist ein Nichts, kleine Biene, ein Nichts. Deine Dummheit hat dich hierhergeführt, nicht deine Tapferkeit. Willst du noch etwas sagen, bevor ich dich in meiner Hand zerquetsche?‹
Nâam-pèng zitterte vor Angst, aber er schaute dem Ungeheuer ins Auge. ›Tám-láai …‹, sagte er.
›Sprich lauter‹, brüllte das Ungeheuer. ›Ich kann dich kaum verstehen!‹
›Dreh dich um‹, sagte Nâam-pèng. ›Du musst dich umdrehen.‹
›Umdrehen? Ich mich umdrehen?‹, fauchte Tám-láai. ›Wenn das dein letzter Wunsch ist …‹
Das Ungeheuer drehte sich um.
Vor ihm waberte eine riesige schwarze Wolke. Ein Wirbelsturm aus wütenden Bienen verfinsterte die Sonne und bedeckte das ganze Himmelszelt, von einem Ende bis zum anderen.
Tám-láai fiel in sich zusammen.
›Vielleicht bin ich klein‹, sagte Nâam-pèng, ›aber allein bin ich nicht. Hast du die Bienen nicht gehört?‹«
Kapitel 1
Ich schaufelte mir ein Häufchen kleiner Steine auf die Hand und schloss sie zur Faust. Die scharfen Kanten der Steinchen piksten mich. Bleib wach, Tam. Schlaf nicht ein. Schlaf ja nicht ein.
Ich sah Noy an, der auf dem Felsvorsprung neben mir lag. Sein Kopf ruhte auf seinen Armen. Er atmete sanft. Ich wollte ihn wecken. Im Wald zu schlafen ist gefährlich. Im Schlaf lösen sich die Seelen und wandern herum. Geister können sie beschwatzen und weglocken, während man träumt. Unsere Seelen sollten nachts nicht zu weit umherschweifen.
Ich rieb mir die Augen, atmete tief ein und füllte die Lungen mit kühler Nachtluft. Der Mond war inzwischen in einem weiten Bogen am Himmel entlanggewandert. Die ganze Nacht hatten wir gewartet. Über den Baumwipfeln war der helle Stern des Drachenschweifs aufgegangen. Der Wald lag still und dunkel da. Das war die Finsternis, bevor der Morgen dämmerte, die Finsternis, in der die Geister spukten.
Ich rutschte nach vorn und spähte von unserem Felsen aus in die Tiefe. Auf den großen Tümpeln unterhalb des Wasserfalls spiegelte sich das Mondlicht. Die kleinen Wellen verbreiteten sich in makellosen Kreisen aus glänzend weißem Licht. Über dem Wasser schwebte der süße Duft von Honigklee. Der Wald lag noch in tiefem Schlaf. Vielleicht hatte sich Noy geirrt. Vielleicht würde sie heute Nacht gar nicht kommen.
Ich starrte in die dunklen Nischen auf der anderen Seite des Flusses.
In den unergründlichen Schatten zwischen dem Felsgestein und den Geröllbrocken regte sich etwas – ein noch dunklerer Schatten. Ich knetete ein loses Blatt wilden Wein zwischen den Fingern und wartete. Trotz der Kühle waren meine Handflächen schweißnass. Ich fühlte das Blut durch die Hände pulsieren und holte tief Luft. Unter uns, etwa fünfzig Schritte entfernt, setzte sich der Schatten in Bewegung. Er wurde größer, nahm Gestalt an und trat hinaus ins Licht des Mondes.
Ich stieß Noy in die Rippen. »Wach auf!«
Noys Kopf schnellte in die Höhe. »Was?«
»Schsch«, sagte ich. »Sie ist da. Jetzt ist sie da!«
Noy wischte sich den Schlaf aus den Augen und beugte sich über den Felsrand. Er blickte auf den Fluss und packte meinen Arm. »Wo?«
»Dort!«
Der Schatten richtete sich auf, stellte sich auf die Hinterbeine und nahm Witterung auf.
Ich hielt den Atem an.
Eine Bärin. Eine riesige Bärin. Ich hatte noch nie einen Bären gesehen. Sie war größer als Pa. Sogar größer als der Dorfvorsteher. Das mondsichelförmige weiße Fell auf ihrer Brust hob sich hell vom dunklen Pelz ihres Körpers ab. Sie nahm noch einmal Witterung auf und ihre kleinen runden Ohren zuckten in unsere Richtung. Es war der Bär aus den alten Sagen. Ein Mondbär. Ein Geisterbär. Ein Erntevernichter, Menschenfresser.
Und die Bärin war genau hier.
In diesem Augenblick.
Ich presste mich gegen den Fels. Wir lagen in Windrichtung und waren von Schatten eingehüllt. Das Donnern des Wasserfalls übertönte alle anderen Geräusche. Obwohl wir uns still verhielten, fragte ich mich, ob uns die Bärin irgendwie wittern konnte. Wusste sie, dass wir hier waren?
Ich konnte Noys Anspannung spüren. Sein Atem klang flach und gedämpft. Auch er beobachtete das Tier. Die Bärin stellte sich auf ihre vier Pfoten und beugte sich über den Fluss. Sie neigte langsam den Kopf zum Wasser und trank. Ihre Ohren schwenkten abwechselnd nach hinten und nach vorne.
Ich atmete langsam aus.
Noy lehnte sich an mich. »Ich hab dir gesagt, dass sie kommen wird.«
Die Bärin sah mager aus. Sie hatte unsere Ernte gefressen und war in den Futterspeicher eingedrungen. Und sie hatte die Angst in die Herzen aller Mütter im Dorf gepflanzt. Bis jetzt war es niemandem gelungen, sie zu fangen. Großvater sagte, sie sei schlau und gefährlich, wenn sie Junge hätte. Ich musste an Ma denken. Wenn sie gewusst hätte, dass ich hier war, um ein Junges zu stehlen, würde sie mich umbringen.
»Glaubst du wirklich, dass sie dort irgendwo Junge hat?«, fragte ich.
Noy nickte. »Dein Großvater sagt, dass sie Junge füttert, sonst würde sie es nicht wagen, so nah ans Dorf zu kommen.«
Jahrelang hatte niemand einen Bären zu Gesicht bekommen. Großvater erzählte, man habe sie in die Tiefe der Wälder verjagt. Als er jung war, war ihm einmal einer begegnet. Er hatte gesehen, wie ein Bär einen Mann umstieß und ihm die Hälfte seines Gesichtes wegriss. Bären waren gefürchteter als Tiger.
Noy grinste und seine weißen Zähne glänzten im Dunkeln. »Wir kriegen hundert Dollar für ein Junges! Vielleicht sogar noch mehr. Stell dir bloß vor, Tam«, sagte er, »nicht mal mein Bruder hat es geschafft, diese Höhle zu finden. Wir werden wie Männer ins Dorf zurückkehren. Ich kann’s gar nicht erwarten, das Gesicht meines Bruders zu sehen, wenn ich einen Bären anschleppe.«
Die Bärin schnupperte noch einmal in die Luft, sprang von Fels zu Fels und nutzte den Fluss als Weg hinunter zu den Feldern des Dorfes.
Noy schob mir eine kleine Taschenlampe in die Hand. »Los jetzt!«, befahl er. »Geh!«
»Ich dachte, wir machen das zusammen?«, gab ich zurück.
Noy schüttelte den Kopf. »Einer von uns muss Wache halten.«
Ich wollte ihm die Taschenlampe wieder in die Hand drücken. »Ich halte Wache«, sagte ich. »Du gehst.«
Noy guckte mürrisch. Sein Gesicht war halb vom Mondschatten verdeckt. »Ich hab sie gefunden. Ich hab ihre Spuren im Schlamm gesehen und die Kratzspuren an den Bäumen. Und das bedeutet, dass du gehst und die Jungen holst. Und außerdem«, sagte er, als ob das entscheidend wäre, »und außerdem bis du kleiner als ich und passt zwischen die Felsblöcke.«
Ich funkelte ihn an. Wir sind in derselben Nacht unter demselben Mond zur Welt gekommen. Wir waren zwölf Regenzeiten alt. Die Leute sagten, wir teilten unsere Seelen wie Zwillingsbrüder. Doch Noy war der jüngste Sohn des Dorfvorstehers. Er setzte immer seinen Kopf durch.
»Geh jetzt!«, befahl Noy und gab mir einen Stoß.
»Was ist, wenn sie zurückkommt?«, fragte ich. Ich blickte auf den Fluss, der sich, immer wieder von stufenförmigen Wasserfällen unterbrochen, geradewegs talabwärts zog. Die Bärin schwamm in einem der tiefen Flussbecken von uns weg.
»Die wird ewig unterwegs sein«, sagte Noy. »Da unten in der Höhle warten hundert Dollar auf uns.« Er lehnte sich an mich und auf seinem Gesicht erschien ein Lächeln. »Du hast doch wohl keine Angst?«
»Nein«, schnauzte ich zurück.
»Dann geh jetzt«, sagte er. »Wenn ich sie zurückkommen sehe, dann warn ich dich.«
Ich hielt die Taschenlampe zwischen den Zähnen, zerdrückte die Ranken in meiner Hand und blickte Noy finster an. Hier ging es überhaupt nicht um einen Bären. Hier ging es um Noy, der es seinem Bruder zeigen wollte.
Ich ließ mich in die enge Schlucht hinunter, stellte mich auf einen Felsen und lauschte in die Dunkelheit. Eine leichte Brise streifte durch das Blätterdach. Im Stillwasser quakten Frösche. Ich wusste, dass ich keine Bären hören würde. Großvater hat gesagt, dass man Bären niemals hört. Sie schleichen wie Geister durch den Wald. Man kann vor ihnen nicht davonlaufen, davonklettern oder davonschwimmen. Man darf keinen Mucks machen und muss selbst zum Geist werden.
Das Wasser war flach. Die Regenzeit, die den Fluss zum reißenden Strom anschwellen lassen würde, lag noch vor uns. Ich sprang von Fels zu Fels auf die andere Seite, in die tiefen Schatten der Bärenhöhle.
Was, wenn dort drinnen ein zweiter erwachsener Bär auf mich wartete? Was, wenn die Jungen groß genug waren, um zu kämpfen?
Mein Blick glitt die schroffen Felswände nach oben. Noy war nicht zu sehen, aber ich wusste, dass er mich beobachtete. Vielleicht waren wir einen Schritt zu weit gegangen. Ich knipste die Taschenlampe an. Der Lichtschein flackerte trübe, kaum genug, um etwas zu sehen. Die Lampe gehörte Noys Bruder. Vermutlich hatte Noy sie ohne zu fragen mitgenommen.
Ich tastete mich langsam zum Höhleneingang vor. Der Boden unter mir war feucht und schwer. Der Fels fühlte sich eiskalt an. Der enge Durchgang erweiterte sich zu einer kleinen Höhle, die gerade groß genug für einen Bären war. Es roch frisch und sauber, als würde ein Luftzug durchströmen.
Ich ließ den Lichtstrahl durch den leeren Raum gleiten. Der Höhlenboden war mit trockenem Laub, Reisig und Ästen übersät. An der Schlafstelle der Bärin war die weiche Erde von einer Schicht schwarzer Fellhaare bedeckt. Ich fuhr mit den Fingern durch das trockene Laub und konnte noch immer die Körperwärme am Boden fühlen.
Ich sprang hoch.
Irgendetwas hatte sich bewegt.
Irgendetwas krümmte sich unter meiner Hand.
Ich richtete den Lichtkegel nach unten.
Halb unter der Blätterdecke verborgen, streckte mir ein schwarzes Etwas seine Stummelpfote entgegen. Im Licht der Taschenlampe blinzelten seine kleinen Augen. Ein Bärenjunges, nicht größer als ein Ferkelchen, beschnüffelte mich und streckte seine flache rosa Zunge heraus. Ich starrte das Kleine an. Die Mutter musste wohl sehr hungrig gewesen sein, wenn sie ihr Kleines völlig unbewacht zurückgelassen hatte.
Es rollte sich auf den Rücken. Auf seiner Brust konnte ich die Mondsichel aus weißem Fell sehen. Ein Wirbel aus weißen Haaren über der Mondsichel sah aus wie der Abendstern.
Ich konnte dieses Bärenjunge nicht mitnehmen. Oder doch? Es wurde noch von seiner Mutter gefüttert. Es war viel zu jung.
Ich starrte es an. Einhundert Dollar. Fünfzig Dollar für Noys Familie und fünfzig für meine. Das war mehr, als Pa jemals mit dem Verkauf von Honig und Wildfleisch verdienen konnte. Vielleicht konnten wir uns davon sogar einen Büffel kaufen.
Irgendwo da draußen in der Nacht ertönte der Ruf eines Gibbons. Er schien von weit, weit entfernt zu kommen. Die Höhle lag abgeschottet von der Außenwelt. Hier drinnen war es ruhig und friedlich. Hier drinnen war das Junge sicher. Geborgen und beschützt.
Vielleicht sollte ich Noy erzählen, ich hätte kein Junges gefunden. Es schien mir einfach nicht in Ordnung, es mitzunehmen.
Aber einhundert Dollar! Diese Chance würden wir nie wieder kriegen.
Wieder war der Gibbon zu hören, dieses Mal mit einem schrillen Warnschrei. Irgendetwas hatte seinen Schlaf gestört, aber in der Höhle fühlte ich mich merkwürdigerweise sicher. Ich fuhr mit dem Finger durch den weichen Pelz des Bärenjungen.
Ein weiterer Schrei – dieses Mal noch panischer. Eine Warnung.
Mit einem Ruck riss ich mich hoch. Mein Herz pochte – Noys Warnruf war der Schrei eines Gibbons!
Die Bärenmutter kam zurück.
Ich packte das Junge bei der schlaffen Nackenhaut und tastete mich zum Ausgang. Sie sollte doch noch lange nicht zurück sein. Noch nicht. Noy hatte gesagt, dass sie sich lange Zeit in den Feldern aufhalten würde. Warum war sie so bald zurückgekehrt?
Ich stolperte aus der Höhle direkt in den festen, schwarzen Körper eines Bären. Ich taumelte, fiel auf den Fels und ließ das Junge los.
Die Bärin drehte sich plötzlich um, sie beugte den Kopf, beschnüffelte ihr Junges und starrte mich mit ihren kleinen dunklen Augen wütend an. Sie war so nah, dass ich sie fühlen und riechen konnte und sie atmen hörte. Sie zog die Lippen nach hinten und zeigte ihre gelben Fangzähne.
Ich wollte am liebsten im Boden versinken und zu Stein erstarren.
Ich schloss die Augen. Sei tapfer. Beweg dich nicht, beweg dich nicht, beweg dich nicht.
Ich wartete darauf, dass mir die Bärin ihre Beißer in den Schädel bohrte.
Nichts geschah.
Ich öffnete die Augen. Das Tier stand auf den Hinterbeinen und richtete seine Aufmerksamkeit auf etwas im Tal. Die Nasenspitze reckte sich in die Luft. Die Bärin schnupperte.
»Wuff!«, grunzte sie. Der Warnruf kam tief aus ihrem Inneren. »Wuff!« Sie ließ sich wieder auf alle viere fallen und fasste das Junge am Nacken. Das Kleine hing aus ihrem Maul. Seine Pfoten baumelten in der Luft. Die Bärenmutter sprang über den Fluss und verschwand in den Schatten der Felsen. Zurück blieben nur die sich ausbreitenden Lichtkreise, dort, wo ihre Füße das Wasser berührt hatten.
Noy sprang vom Felsen und kniete sich neben mich. Im Mondlicht sah sein Gesicht ganz blass aus. »Ich hab schon gedacht, du bist tot.«
Ich wollte mich aufsetzen, aber meine Arme und Beine zitterten.
»Weg hier«, rief er, »bevor sie zurückkommt!«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie ist weg. Sie hat was unten im Tal gehört, das sie erschreckt hat.«
Noy stand auf und blickte zum Dorf hinunter. »Vielleicht ist mein Bruder schon mit seinem Gewehr unterwegs.«
Ich zog mich an Noy hoch und klammerte mich an ihn. Seite an Seite standen wir da und lauschten in die Nacht.
Von jenseits der Berge drang ein Grollen zu uns herüber.
»Da ist noch was anderes«, sagte ich. »Hör mal!«
Noy runzelte die Stirn. »Donner?«
Das ferne Grollen nahm zu. Es kam die Täler herauf. Maschinendonner dröhnte durch die Nacht. Die Echos klangen dumpf und prallten an weit entfernten Bergen ab, dort wo Holzfäller schon damit begonnen hatten, den Wald zu roden.
Das schleifende Lärmen von Maschinen zerriss die Stille der Nacht.
Noy packte mich am Arm, drehte sich um und blickte mich mit großen Augen, die im Mondlicht glänzten, an.
Das war kein Donner.
Das war kein Sturm.
Noy fuhr sich mit den Händen durchs Haar. »Sie kommen, stimmt’s?«, sagte er. »Sie kommen und holen uns.«
Tief in mir fühlte ich mich matt und leer.
Sie sollten nicht hier sein. Noch nicht.
Vielleicht wären sie nicht so weit vorgedrungen, wenn die Regenzeit schon frühzeitig begonnen hätte. Vielleicht wären dann die Räder ihrer Lastwagen im dicken Schlamm stecken geblieben und würden immer noch durchdrehen. Aber es hatte nur zwei Tage lang stark geregnet. Die lange, schmutzige Straße, die sich vom großen Tal des Mekong hochschlängelte, war schon wieder staubtrocken. Jetzt konnte sie nichts mehr aufhalten.
Die Soldaten und ihre Lastwagen würden hier sein, noch bevor der Morgen dämmerte.
Kapitel 2
Ma packte mich am Hemd und hielt mir die Öllampe vors Gesicht. »Tam! Wo wart ihr?« Sie blitzte Noy an und nahm ihm die schlammverkrustete Kleidung ab und das Jagdmesser, das er sich an die Hüfte gebunden hatte. Sie kannte uns zu gut. »Bärenjagd ist nichts für Jungs.«
Pa drückte mir einen Bambuskäfig in die Hand. »Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Fang die Hühner ein, bevor sie sich im Wald verlaufen. Und die Ferkel auch.« Er wandte sich an Noy. »Und du gehst nach Hause, Noy. Dein Bruder sucht dich schon.«
Das Rumoren der Lastwagen wurde jetzt lauter. Sie waren bereits im Tal unter uns. Ich konnte sie hinter den Bäumen sehen – eine ganze Schlange aus Scheinwerferlichtern. Das Dröhnen der Motoren erschütterte den Boden unter meinen Füßen.
Sulee rieb sich den Schlaf aus den Augen. Mae weinte und hielt sich an Ma fest. »Beeil dich, Tam!« Pa gab mir einen Schubs. »Wir haben nicht viel Zeit.«
Ich nahm den Käfig. Ich wusste, wo ich unsere Hennen finden würde. Sie hatten sich bestimmt in ihre Schlafplätze verkrümelt und hockten in den Erdmulden rund um die hölzernen Pfähle, die unser Haus hoch über dem Boden hielten. Und die Ferkel dösten sicherlich in der warmen Asche des Herdfeuers aus der vergangenen Nacht. Aus den anderen Häusern drangen Rufe und Schreie durch die Finsternis. Babys weinten. Schweine grunzten. Vorbeihuschende Schritte und gedämpfte Stimmen waren zu hören. Das Dorf wurde aus dem Schlaf gerüttelt. Hinter mir quiekte ein entlaufenes Ferkel. Seine Hufe trommelten auf dem trockenen Boden. Ich holte unsere Hühner unterm Haus hervor, band ihnen die Füße zusammen, damit sie sich auf der langen Reise, die vor uns lag, nicht wehren konnten, und schob sie flatternd und gackernd in den Käfig. Ich wollte mir den alten Gockel greifen, aber der war bereits wach, flog hoch aufs Dach, warf seinen Kopf zurück und kündigte den Morgen an, der noch auf sich warten ließ. Vielleicht hatte auch er die Soldaten gehört.
»Tam!« Mein Vater stand neben mir. Er beugte sich nieder und verschnürte die Käfigtür. Ich konnte seinen Atem durch die Zähne pfeifen hören, als er die Schnur durchbiss. »Deine Mutter und deine Schwestern holen gerade noch von den Feldern, was sie tragen können. Wir müssen alles zusammenpacken. Wir werden nicht mehr zurückkehren.«
Ich spürte, wie mir die Galle hochkam und schmeckte bittere Schärfe in meinem Mund.
Pa nahm mir den Käfig ab und trug ihn zum Straßenrand, wo sich Körbe, Taschen, Käfige und Schachteln immer höher stapelten, um auf die Lastwagen geladen zu werden. Dorfbewohner liefen zwischen ihren Häusern und der Straße hin und her und balancierten auf den Köpfen wuchtige Habseligkeiten. Es sah aus, als würde eine Ameisenkolonie umziehen. Ich trug unsere Reissäcke, Töpfe und Pfannen hinaus und wickelte unsere Kleidung in die Matratzen und Decken ein. Nichts durfte zurückbleiben. Wir würden alles brauchen.
Ein letztes Mal stieg ich die Stufen hoch, um Mas Stickereien zu holen. Sie hoffte, sie auf Märkten verkaufen zu können, wenn wir unser neues Zuhause erreicht hatten. Unser Haus war jetzt leer geräumt. Nur ein Raum, nichts weiter als eine Hülle. Er roch jetzt anders. Er fühlte sich anders an. Hohl. Leer. Wo unsere Matratzen gelegen hatten, war jetzt nackter Boden. Nie mehr würden wir in diesem Zimmer schlafen oder essen. Ich versuchte, diese Gedanken zu verdrängen, sackte in mich zusammen, drückte die Rolle mit Stickereien an mich und atmete den scharfen Geruch des Farbstoffs ein.
»Willst dich wohl verabschieden?«
Ich fuhr herum. Ich hatte Großvater nicht gesehen. Er saß mucksmäuschenstill und ins Mondlicht getaucht am Fenster.
Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht. Er sollte mich nicht weinen sehen.
»Ich geh nicht mit ihnen«, sagte ich. »Ich bleib bei dir.«
Großvater sagte nichts und zündete seine Pfeife an. Die ersten Rauchwölkchen waberten wie blassblauer Nebel um ihn herum. Der süße Blumenduft des Pfeifenrauchs erfüllte den Raum. Großvater lehnte sich zurück und streckte sein schlimmes Bein aus. Die Spur der schenkellangen Narbe hob sich dunkel von seiner Haut ab.
Ich wartete darauf, dass er zu sprechen begann, aber er wandte den Kopf in Richtung der dröhnenden Schritte draußen auf den Treppenstufen. Die Tür schwang auf, der Dorfvorsteher stand vor uns und hielt eine Lampe hoch, deren mattgelber Lichtkegel die Nacht noch dunkler erscheinen ließ.
Ich trat zurück in die Schatten und hoffte, er würde mich nicht sehen. Durch die offene Tür konnte ich die riesigen Konturen der Lastwagen erkennen und die Silhouetten von Soldaten, die durchs Dorf strömten.
Der Dorfvorsteher ging auf Großvater zu. »Puan«, sagte er, »die Soldaten sind da, um uns mitzunehmen. Niemand kann hierbleiben.«
Großvater nahm die Pfeife aus dem Mund. »Du weißt, dass ich nicht mitkommen kann.«
Der Dorfvorsteher ging zum Fenster. »Du hast keine Wahl. Sie werden unsere Häuser niederbrennen, um den Weg für die Straße zum neuen Staudamm freizuräumen.«
Großvater entspannte sein krankes Bein. »Dein Vater und ich haben Seite an Seite für unsere Freiheit gekämpft. Und jetzt willst du sie einfach wegwerfen, nur weil man uns ein Stück Land und ein neues Haus versprochen hat?«
Der Dorfvorsteher blickte Großvater ins Gesicht. »Das war vor vierzig Jahren, Puan. Die Zeiten haben sich geändert. Die Welt hat sich geändert. Auch wir müssen uns ändern.«
Großvater beugte sich durch den Schleier aus Rauchschwaden nach vorne. »Aber nicht auf diese Weise.«
Ich grub meine Fingernägel in die Stoffrolle. Ich sollte nicht hier sein und Großvaters Widerworte gegen den Dorfvorsteher hören.
Der Dorfvorsteher lehnte sich gegen den Fensterrahmen und starrte in die Dunkelheit. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber er ließ seine Schultern hängen. »Ich mache das für unsere Kinder, Puan«, sagte er. »Wir werden Schulen und Hospitäler haben und gute Wohnhäuser. Der große Staudamm bringt uns Elektrizität. Unser Land wird reich sein. Wir werden reich sein. Unseren Kindern wird es besser gehen als uns. Ist das nicht das, was auch du für sie erreichen wolltest?«
Großvater rappelte sich hoch und lehnte sich aus dem Fenster. Er spuckte auf den Boden. Die Luft war voller Motorenlärm und brachte das Gebälk unseres Hauses zum Vibrieren. Der Lärm drang durch die Nacht, als wären Hunderte von Lastwagen unterwegs.
Großvater schüttelte den Kopf. »Das hier war einmal das reichste Land der Welt. Man nannte es ›Das Land der tausend Elefanten‹.« Er drehte sich um und blickte den Dorfvorsteher an. »Aber ich glaube nicht, dass es heute noch viele wilde Elefanten in Laos gibt. Glaubst du das?«
Der Dorfvorsteher ging zur Tür zurück. »Du wirst sterben, wenn du hierbleibst.«
Blaue Rauchwölkchen kringelten sich um Großvater und zogen aus dem Fenster, als hätte der Wald bereits Ansprüche auf ihn erhoben.
»Dann will ich sterben, wie ich geboren wurde«, sagte Großvater. »Ich möchte als freier Mensch sterben.«
Der Dorfvorsteher starrte ihn an, drehte sich um, verließ den Raum und drängte sich an Pa vorbei, der auf der Treppe stand.
Pa sah mich im Schatten stehen. »Tam, Zeit zu gehen. Die Lastwagen warten.«
Großvater stand auf. Er band sich sein Jagdmesser an den Gürtel und hob eine kleine Tasche mit Habseligkeiten hoch.
Ich trat neben ihn. »Ich will bei dir bleiben.«
Großvater fasste mich an der Schulter. »Dieser Wald ist kein Platz für Jungs wie dich.«
Ich hielt meine Steinschleuder in der Hosentasche fest. »Ich kann auf mich selbst aufpassen. Und auf dich auch.«
Großvater beugte sich zu mir herunter. »Tam, deine Mutter und deine Schwestern brauchen dich mehr als ich.«
Pa machte einen Schritt nach vorn und nahm mich am Arm. Er und Großvater standen sich mit gebeugten Köpfen gegenüber und berührten sich fast. An dieses Bild erinnere ich mich, an das letzte Mal, dass ich sie zusammen sah: Pa und Großvater, die Bienenmänner, die sich ohne Worte verstanden, in der geheimen Sprache der Bienen.
Draußen spürte ich die sengende Hitze. Von den Häusern am anderen Ende des Dorfes stiegen dicke weiße Rauchfahnen empor. Flammen züngelten in den Himmel, die Funken flogen hoch über unsere Köpfe in das bläuliche Licht der Morgendämmerung. Ein beißender Geruch lag in der Luft. Der Rauch drang in meine Lungen und brannte mir in den Augen. Zwischen den Flammenherden bewegten sich Soldaten wie stille Schatten mitten im Gebrüll des Feuers. Sie fackelten das ab, was einmal unsere Häuser gewesen waren. Vor den Häusern warteten die Lastwagen. Pa nahm mich am Arm und zog mich mit sich. Der Dorfvorsteher stand mit einem Soldaten an der Heckklappe des letzten Fahrzeugs.
Der Soldat überflog die Namensliste auf seinem Klemmbrett. Er schaute hoch. »Da fehlt einer. Es sollte einer mehr sein.«
Pa blickte den Dorfvorsteher an und dann den Soldaten. »Es gibt keinen mehr.«
Der Soldat nannte einen Namen. »Puan Vang.«
Der Name meines Großvaters.
Der Dorfvorsteher räusperte sich.
»Puan ist tot.«
Mein Magen zog sich zusammen. Ich richtete den Blick auf die Listen des Soldaten. Mit der Spitze seines Stiftes tippte er Großvaters Namen an. Er drehte den Stift zwischen seinen Fingern, als wolle er sie entscheiden lassen. Ich wartete darauf, dass er uns der Lüge bezichtigte, aber stattdessen zog er einen dicken Strich durch Großvaters Namen, warf das Klemmbrett auf den Lastwagen und schnauzte uns an, dass wir aufsteigen sollten.
Ich stellte einen Fuß auf die Heckklappe und der Soldat zog mich hinein. Ich quetschte mich neben Ma, Sulee, Mae und einen Käfig voller Hühner. Pa und der Dorfvorsteher drängten sich direkt neben mich. Hinten im Wagen saßen zwei Soldaten mit ihren Gewehren zwischen den Beinen. Die Heckklappe wurde zugeschlagen und der Lastwagen fing an zu knattern und zu dröhnen. Mit einem Ruck ging es los, wir nahmen Fahrt auf und holperten den Weg hinunter.
Ich warf einen Blick auf unseren Ortsvorsteher. Neben den Soldaten wirkte er klein, gar nicht wie unser Oberhaupt. Kleidung und Haut waren rußverschmiert. Er starrte auf seine Hände. Sein Gesicht lag im Schatten verborgen.
Als die Soldaten das erste Mal zu uns gekommen waren, hatte der Dorfvorsteher gesagt, wir würden nicht umziehen. Aber dann waren noch mehr Soldaten gekommen mit General Chan an der Spitze und Männern in Anzügen aus der Stadt. Uns wurden neue Häuser, Elektrizität, Fernsehen, Reisfelder und eine Schule versprochen. Uns wurde ein besseres Leben versprochen. Und als die Soldaten ein drittes Mal anrückten, willigte der Dorfvorsteher in den Umzug ein.
Großvater sagte, der Dorfvorsteher habe unsere Freiheit verkauft.
Pa meinte, er habe keine Wahl gehabt.
Ich setzte mich auf und schaute an den Soldaten vorbei nach hinten. Ich suchte unser Haus, aber es war bereits im weiß glühenden Flammenmeer verschwunden.
Ma versuchte mich zurückzuziehen. »Schau nicht hin, Tam.«
Aber ich konnte nicht anders.
Ich musste hingucken.
Ich sah, wie unser Dorf brannte und von Flammen und Rauch verschlungen wurde.
In Gedanken sah ich die Bärenmutter mit ihrem Jungen durch den Wald fliehen.
Vielleicht schloss sich ihnen in jener Nacht auch ein Teilchen meiner Seele an, weil es sich anfühlte, als wäre irgendetwas tief in mir drin auseinandergerissen. Ich wusste, dass nichts jemals mehr so sein würde, wie es einmal war.
Kapitel 3
»Willkommen«, sagte General Chan, »willkommen in eurem neuen Leben.«
Ich saß mit Noy und den anderen Bewohnern auf einem blanken Fleckchen Erde am Rand des Ortes. Unser neues Dorf lag im Tal des Mekong, zwischen den fernen blauen Bergen und dem großen Fluss. Vor sieben Tagen hatten wir das Gebirge verlassen. Und nun besuchte uns General Chan. Eben war er mit seinen Männern in Anzügen und einem Mann mit riesiger Kamera vom Himmel gekommen und aus dem Helikopter gestiegen. Jetzt stand er vor uns, ein kleiner, wohlgenährter Mann, dessen Uniformknöpfe sich über seinen runden Bauch spannten. Hinter den Gläsern der Goldrandbrille blitzten uns kleine stechende Augen an.
Noy beugte sich zu mir herüber. »Das ist der, der den Damm bauen lässt, der, der uns umgesiedelt hat.«
Ich spürte, wie sich General Chans Augen auf uns richteten, und schubste Noy weg. »Pschsch!«
General Chan drückte die Brust heraus, warf die Schultern nach hinten, schritt vor uns allen auf und ab und beobachtete uns. »Ich hoffe, ihr habt euch inzwischen in euren neuen Häusern, die für euch gebaut wurden, eingelebt. Ihr stimmt mir sicher zu, dass sie größer und komfortabler sind als eure alten Hütten.«
Ich blickte an ihm vorüber zu den Häusern, die in zwei ordentlichen Linien links und rechts der Straße aufgereiht standen. Die Gebäude waren, wie unsere alten Häuser, aus Holz, standen aber auf hohen Betonpfählen. Unser neues Haus war groß, aber der Dorfvorsteher und seine Familie hatten das größte. Es lag direkt neben der Wasserpumpe, obwohl es – das wusste ich – Noys Mutter dort gar nicht gefiel. Wassergeister hatten eines ihrer Babys zu sich genommen. Sie wollte nicht, dass sich das noch einmal wiederholte.
General Chan riss den Arm hoch und deutete auf die Anhöhe hinter dem Dorf. »Ihr habt Gemüsegärten und Reisfelder«, sagte er. »Ihr werdet in der Lage sein, so viel Reis anzupflanzen, dass ihr ihn auf den Märkten verkaufen könnt. Hier habt ihr alles, was ihr braucht, um ein besseres Leben zu beginnen.« Er machte eine Pause und lächelte. »Nun mach schon!«, wandte er sich an den Dorfvorsteher. »Die Leute wollen das nicht aus meinem Mund erfahren. Sie wollen das von dir hören.«
Der Dorfvorsteher trat neben den General und blickte uns ebenfalls an.
Der General zeigte auf den Kameramann. »Erzähle den Menschen in Laos, wie ihr in eurem Dorf lebt«, herrschte er den Dorfvorsteher an.
Noy beugte sich wieder zu mir herüber. »Wir kommen ins Fernsehen!«
Der Dorfvorsteher räusperte sich. »Hier ist es viel besser«, begann er und sein Blick schwenkte dabei zwischen General und Kameramann hin und her. Der General lächelte und deutete auf die Kamera.
»Das Leben ist hier viel besser«, fing der Dorfvorsteher noch einmal an und blickte in die Kamera. »Wir haben Land, auf dem wir unseren eigenen Reis anbauen können. Wir haben sauberes Trinkwasser. Wir werden in der Lage sein, unser Gemüse auf dem Markt zu verkaufen. Unsere Kinder können zur Schule gehen. Außerdem werden wir medizinisch versorgt. Hier ist es einfach besser.«
General Chan lächelte immer noch und nickte, während der Dorfvorsteher sprach. Als der seine Rede beendet hatte, schwenkte die Kamera auf uns und wir winkten und grinsten. Ich musste Sulee zu mir ziehen, damit sie aufhörte zu tanzen. General Chan gab bekannt, er habe für uns alle ein paar Geschenke mitgebracht. Jeder Haushalt bekam zwei zusätzliche Säcke Reis. Auch für den Dorfvorsteher, kündigte der General an, habe er ein Geschenk. Noys älterer Bruder nahm es am Helikopter in Empfang. Ich konnte an der Art, wie er sich den Karton aufbuckelte, nur erkennen, dass er schwer zu tragen hatte. Alle guckten aufmerksam zu, als der Dorfvorsteher die Verpackung öffnete.
Die Kinder vor mir richteten sich auf, um etwas zu sehen.
Noy drehte sich zu mir und grinste. »Schau dir das doch mal an!«
Ich sah, wie Noys Bruder einen riesigen Fernsehapparat heraushob. Ich hatte bisher nur einen durch das Fenster der Bar an der Holzstation gesehen, wo Pa mit Honig und Wildfleisch handelte. Der war klein gewesen und hoch oben an der Wand über dem Tresen befestigt. Aber dieser Apparat war gigantisch. Der Dorfvorsteher fuhr mit der Hand über die Oberfläche des Bildschirms und bedankte sich bei General Chan.
General Chan bewegte den Arm in einem Bogen über den blanken Boden, auf dem wir saßen. Er wartete, bis die Kamera auf ihn gerichtet war. »Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Schule«, sagte er. »Das ist der Platz, wo wir eine bauen werden. Genau hier.«
Ma drückte mir den Arm und ich sah hoch. Sie nickte und lächelte und ich durfte mich an sie lehnen.
Vielleicht hatte sich Großvater geirrt. Vielleicht würde das Leben hier besser sein. Ich könnte zur Schule gehen. Wir bräuchten keine Almosen mehr, wenn wir unseren eigenen Reis anpflanzten. Wenn wir krank würden, könnten wir zu einem Arzt gehen. Noch hatten wir keinen Strom, aber auch der würde kommen. Und wenn wir erst Elektrizität hatten, dann könnte ich am Abend lernen und Ma wäre in der Lage, ihre Stickarbeiten zu machen. Vielleicht könnten auch wir einen Fernsehapparat haben.
Wir könnten hier leben.
Das war unser neues Dorf.
Unser neues Leben.
Ich wollte Großvater bitten, zu uns zu kommen und mit uns zu leben.
Ich wollte ihn wissen lassen, dass das Leben gut werden konnte.
Kapitel 4
»Au!« Ich rieb mir die Schulter an der Stelle, wo mich ein Klumpen Erde getroffen hatte.




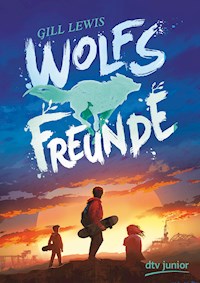














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









